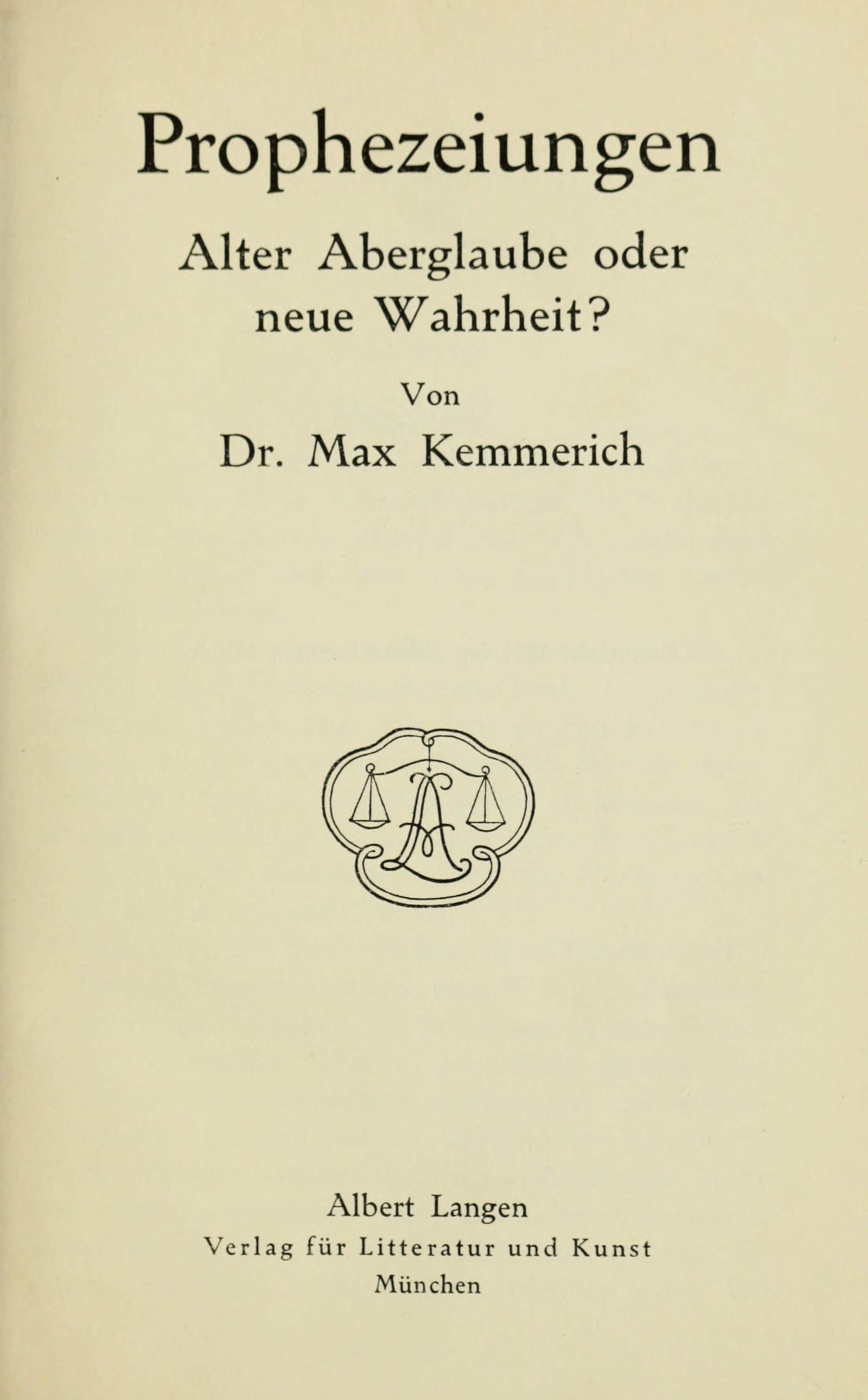
Anmerkungen zur Transkription:
Die Rechtschreibung und Zeichensetzung des Originals wurde weitgehend übernommen, lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Hervorhebungen von Textpassagen durch fetten oder gesperrten Druck wurden hier übernommen, können jedoch je nach Lesegerät unterschiedlich erscheinen. Am Ende des Textes befindet sich eine Liste korrigierter Druckfehler.
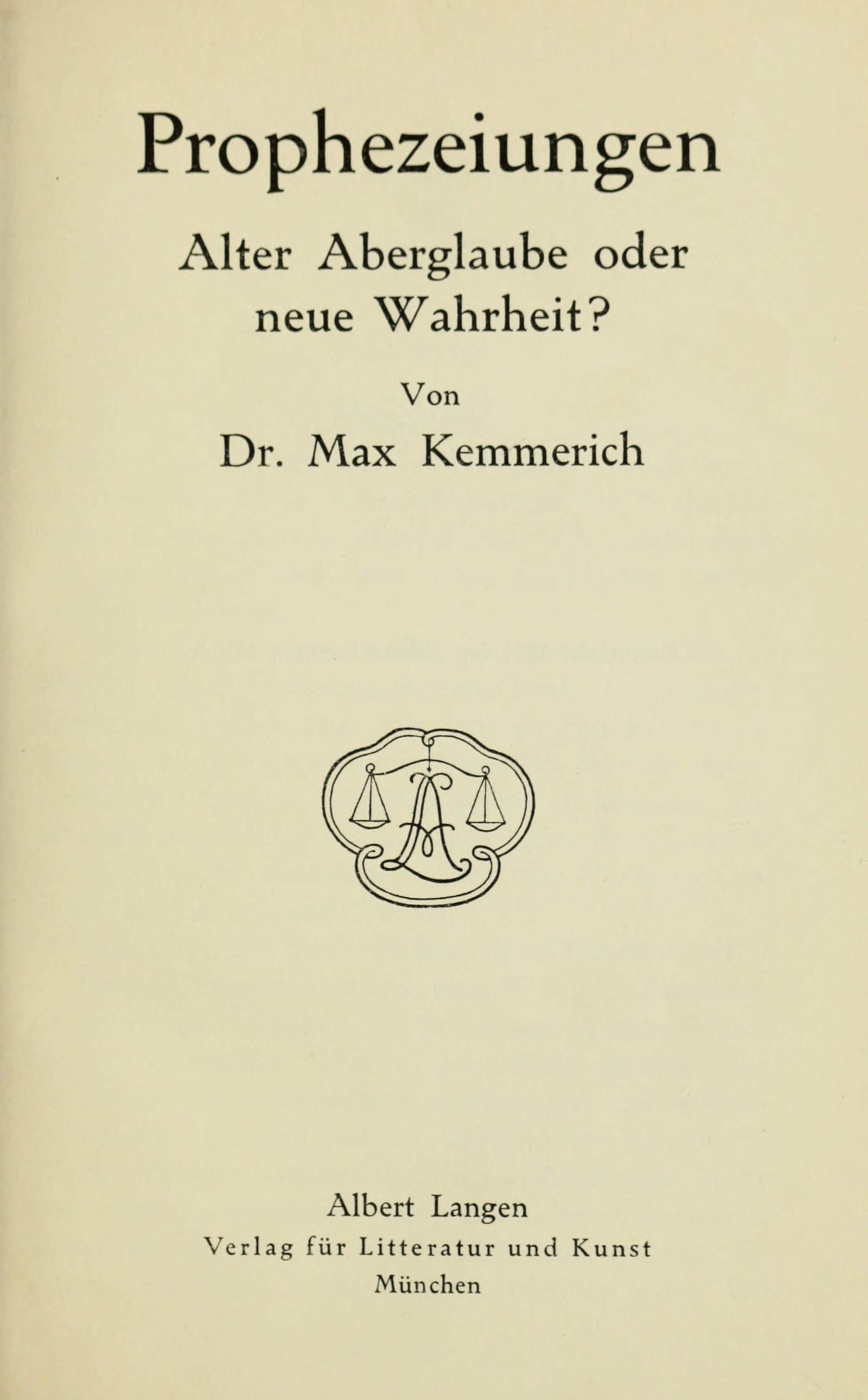
Prophezeiungen
Von Dr. Max Kemmerich erschien im Verlage von
Albert Langen in München:
Kultur-Kuriosa Erster Band
Zehntes Tausend
Kultur-Kuriosa Zweiter Band
Sechstes Tausend
Dinge, die man nicht sagt
Siebentes Tausend
Von
Dr. Max Kemmerich
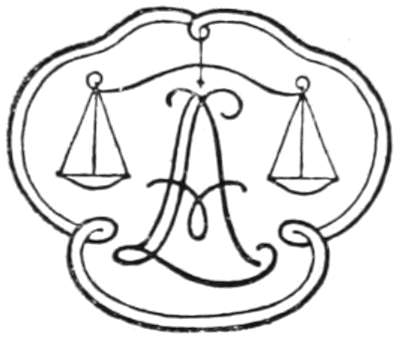
Albert Langen
Verlag für Litteratur und Kunst
München
Copyright 1911 by Albert Langen, Munich
[S. v]
Nicht eine Geschichte der Prophezeiungen zu schreiben, stellte ich mir zur Aufgabe. Auch lag es mir fern, den flauen Geschäftsbetrieb der Wahrsagerinnen in eine Hausse überzuleiten. Ich müßte daher eine mir von dieser Seite etwa zugedachte Ehrung dankend ablehnen.
Was ich beweisen wollte und bewiesen habe, ist lediglich das Vorhandensein einer Kraft des zeitlichen Fernsehens. Und zwar trat ich ursprünglich an die Frage heran im Glauben, die Prophetie als Rest mittelalterlichen Denkens endgültig abtun zu können. Erst im Laufe der Untersuchung und unter dem Gewicht der Argumente verwandelte sich der Verfasser von einem Saulus in einen Paulus.
Ich übergebe diese Blätter der Öffentlichkeit in der festen Überzeugung, eine neue Wahrheit gefunden, als erster den Glauben der Jahrtausende zum Wissen erhoben zu haben. Daß es Jahrzehnte dauern wird, bis daraus die notwendigen Schlüsse auf unsere Weltanschauung gezogen werden, darüber bin ich mir im klaren. Ebenso darüber, daß die erdrückende Mehrzahl der Zeitgenossen mit jener beneidenswerten Sicherheit, die nur die absolute Ignoranz verleiht, das Thema, wie seine Beantwortung ablehnen wird. Die [S. vi]Gewißheit aber, daß noch einmal die Zeit kommen wird, in der die gedankenlose Menge unter unserem Einfluß ebenso ungeprüft das in Bausch und Bogen ablehnen wird, was sie jetzt, gleichfalls ungeprüft, anbetet, um das anzubeten, was sie heute verwirft, wird mir niemand rauben können.
Für freundliche Unterstützung und Anregung in Gesprächen ist es mir ein Bedürfnis, den Herren Privatdozent Dr. Alfred Brunswig, Dr. Hans F. Helmolt und Friedrich Freih. von Stromer-Reichenbach, sämtlich in München, meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Besonders aber Herrn Geheimrat Prof. Dr. Ferdinand Lindemann, der die große Güte hatte, den mathematischen Teil meiner Beweisführung in den Korrekturbogen einzusehen und zu begutachten.
Für den Hinweis auf Versehen irgendwelcher Art werde ich jederzeit dankbar sein.
München, im März 1911
Der Verfasser
[S. vii]
| Seite | |
| Einleitung | 1 |
Erstes Kapitel Einzelne Prophezeiungen und Vorahnungen Das Altertum |
23 |
Zweites Kapitel Einzelne Prophezeiungen und Vorzeichen Mittelalter und Neuzeit |
75 |
Drittes Kapitel Unsere Beweisführung. Einwände und deren Widerlegung |
137 |
Viertes Kapitel Die lehninsche Weissagung I. Der Text |
157 |
II. Kommentar |
177 |
Fünftes Kapitel Christina Ponitowssken |
191 |
Sechstes Kapitel Die Prophezeiungen des Christian Heering aus Prossen |
203 |
Siebentes Kapitel Die Art der Prophezeiung Heerings |
231 |
Achtes Kapitel Johann Adam Müller |
241 |
Neuntes Kapitel Cazotte’s Weissagung der französischen Revolution |
293 |
Zehntes Kapitel Die Prophezeiungen der Frau de Ferriëm |
325 |
Elftes Kapitel Michel Nostradamus |
346 |
Zwölftes Kapitel Stellung der Wissenschaft zur Prophezeiung |
403 |
Wer heute den Mut hat, über Prophetie zu sprechen, kann sicher sein, auf ein überlegenes Lächeln der sogenannten Gebildeten zu stoßen. Der Glaube an die Möglichkeit des räumlichen, mehr noch des zeitlichen Fernsehens gilt ja als Rest finstersten mittelalterlichen Aberglaubens, so etwa wie der an Inkubus und Sukkubus. Jedermann hält es für unter seiner Würde, derartige Phänomene überhaupt zu prüfen, so wenig es jemandem einfällt, den alchimistischen Lehren anders, als mit einem Achselzucken entgegenzutreten.
Nun wird man zugeben, daß die Wahrheit die allerschärfsten Prüfungen vertragen kann und nur der Irrtum Schonung fordern muß. Wenn es also keine fernseherischen Phänomene gibt, so wird sich die Wissenschaft sicherlich durch einwandfreie Feststellung der Tatsache nichts vergeben, wohl aber in schiefes Licht kommen durch hochmütiges Ignorieren. Und das zumal in einer Zeit, die so überaus reich an umstürzenden Entdeckungen und Erfindungen ist, wie die unserige. Man denke an die Röntgenstrahlen, Radium, drahtlose Telegraphie, lenkbare Luftschiffe usw. usw. Alle diese neuen Erweiterungen [S. 2]unseres Gesichtskreises lehren uns oder sollten uns doch wenigstens lehren, daß selbst das Unwahrscheinlichste, ja für unmöglich Gehaltene wirklich sein kann; daß nach wenigen Jahren dem Schulkinde selbstverständlich scheint, was die größten Denker der vorangehenden Generation für unmöglich erklärten.
»Unmöglichkeit«, das ist der Angelpunkt der Frage. Die Autoritäten, die heute modern sind – denn auch wissenschaftliche Ansichten, Hypothesen, Theorien und Dogmen sind der Mode unterworfen – erklären die Prophetie für unmöglich. Nicht alle, ein Plato, Cicero, Augustinus, ja noch ein Kant und Schopenhauer zweifelten nicht an der Wirklichkeit der Phänomene, aber ohne dadurch das Denken der Gegenwart zu beeinflussen. Entschuldigte man die ersteren mit ihrer Zeit, so galt der Glaube an Prophetie bei den letzteren als Schwäche, als mystischer Einschlag, den man bei Männern, an deren Intelligenz sonst ja nicht gerade viel auszusetzen ist, gern vermißt hätte. Um es also nochmals festzustellen: Seit den Zeiten der Aufklärung, also seit etwa anderthalb Jahrhunderten, gilt die Prophetie oder – da dieses Wort einen biblischen Beigeschmack hat – das Fernsehen in der Zeit für unmöglich. Deshalb hat der Gebildete das Recht, einzelne Fälle des Vorhersehens zu leugnen, und wo das gänzlich untunlich ist, sie durch Zufall zu erklären. Geht er dem Problem nach – was doch voraussetzt, daß er seine Möglichkeit zugibt, wenn er auch die Wirklichkeit bestreitet – so blamiert er sich.
Ich bin nicht müde geworden, nachzuweisen, daß etwas darum weder töricht, noch schlecht, noch [S. 3]viel weniger unmöglich zu sein braucht, weil die Autoritäten es behaupten. Sie haben sich dem Genialen und Neuen gegenüber regelmäßig und nahezu grundsätzlich blamiert. So als die Ingenieure bewiesen, daß es unmöglich sei, Lasten fortzubewegen, wenn glatte Räder auf glatten Schienen liefen, oder daß die Eisenbahnen unmöglich auf Dämmen laufen könnten, sondern nur auf gemauerten Unterbauten; oder als das kgl. Bayerische Medizinalkollegium den Beweis erbrachte, daß die schnelle Bewegung der Eisenbahnzüge – es war in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts! – nicht nur bei den Insassen, sondern auch bei den Zuschauern die schrecklichsten Gehirnstörungen hervorrufen müßte und deshalb die Errichtung von unübersehbaren Planken längs der Bahnlinien geboten sei.
Nicht anders war es, als Hegel nachwies, daß der von Piazzi 1801 entdeckte Planetoid Ceres unmöglich existieren könne – aus philosophischen Gründen. Oder als Gassendi, ja noch Bertholon und Vaudin die Möglichkeit der Meteorfälle leugneten und das, wiewohl dem ersteren ein eben niedergefallener, noch heißer Stein gebracht wurde, die andern aber den protokollarischen Bericht von einem Fall mit der Unterschrift des Maires und von 200 Zeugen vor Augen hatten. Bekannt ist ja auch, daß Galvani auf die geniale Entdeckung der nach ihm benannten Naturkraft hin von seinen Zeitgenossen verlacht wurde, wie ja auch der große Davy über den Gedanken lachte, daß London jemals mit Gas beleuchtet werden könne. Ein Heiterkeitsausbruch und die Weigerung, den Vortrag zu drucken, war ja [S. 4]auch das einzige Resultat Franklins, nachdem er der englischen Akademie der Wissenschaften den von ihm entdeckten Blitzableiter entwickelt hatte. Daß Semmelweiß, der Entdecker des Kindbettfiebers, im Irrenhaus starb, daß es Robert Mayer, dem Entdecker des Gesetzes von der Erhaltung der Energie, ebenso gegangen wäre, wenn seine kräftige Konstitution die Mißhandlungen nicht überwunden hätte, gehört nicht zu den Ruhmesblättern deutscher Geistesgeschichte[1].
Diese wenigen Fälle, die sich ins Endlose fortsetzen ließen, führten wir nicht an, um etwa die Autoritäten als halbe Idioten hinzustellen. Das wäre nicht nur für einen jüngeren Gelehrten höchst unangemessen, es wäre auch sehr töricht, würden wir doch die Wissenschaft herabsetzen, indem wir ihre Leuchten brandmarken. Denn wenn diese Männer auch Mißgriffe begingen und oft den Fortschritt der Wissenschaft durch die Wucht ihres Namens hemmten, so hat doch die Menschheit andrerseits ihnen außerordentlich viel zu verdanken. Sind es doch ausnahmslos Leute, die durch Intelligenz ihre Zeitgenossen, wenigstens die älteren von ihnen, mit ganz wenigen Ausnahmen um Hauptes-, ja um Turmeslänge überragten.
Wir registrieren sie vielmehr aus einem doppelten Grunde. Zunächst um die Worte des großen Mathematikers Arago, man müsse mit Anwendung des Wortes »unmöglich« außerhalb der Mathematik sehr [S. 5]zurückhaltend sein, es am besten überhaupt nicht gebrauchen, zu bestätigen. Dann aber, und das ist noch wichtiger, um die Leser nach Tunlichkeit in die Seelenstimmung oder Verstandesverfassung – um das Modewort Weltanschauung zu vermeiden – des Autors zu versetzen, in die des Zweifels.
»Zweifel? Wie ist das zu verstehen, wo Sie uns da mittelalterliche Märchen auftischen wollen und Ihr Möglichstes tun, Ihren Namen zu diskreditieren! Sie meinen wohl Glauben, ja Wunderglauben?«
So wird man mir ins Wort fallen und mir dadurch willkommene Gelegenheit geben, meinen Gedanken näher auszuführen.
Ich fordere allerdings Zweifel, Kritik, Skeptizismus, denn das ist die Grundlage meiner Weltanschauung. Nicht daß ich als radikaler Skeptiker die Unmöglichkeit jeder Erkenntnis behauptete und damit viel mehr, als ich jemals beweisen könnte, noch dazu etwas überaus Törichtes, weil Unfruchtbares. Wohl aber in dem Sinne, daß ich nur und in erster Linie gut beobachtete Tatsachen für wahr halte. In zweiter Linie kommen dann an Wahrheitsgehalt die auf Grund einer zwingenden Logik daraus gezogenen Schlüsse.
Daraus ergibt sich, daß bei einer Disharmonie zwischen bewiesener Tatsache und erklärender Hypothese oder Theorie selbstverständlich die erstere bedingungslos anzuerkennen, die letztere zu verwerfen ist. Denn dann ist niemals die Tatsache falsch, sondern die Theorie, das Dogma ist falsch oder zum mindesten lückenhaft und daher ergänzungsbedürftig. Nur diese Denkweise ganz allein ermöglicht einen [S. 6]dauernden Fortschritt der Wissenschaft. Nur wer jede, auch die am besten gestützte Theorie aufzugeben bereit ist, wenn eine einzige Tatsache sich durch sie nicht erklären läßt, nur der denkt wissenschaftlich frei.
Auch die Lehre von den vier Elementen hatte großartige Entdeckungen ermöglicht, und doch war sie falsch und fiel mit dem Augenblick, als es dem großen Lavoisier zur hellen Entrüstung seiner Zeitgenossen gelungen war, die Luft in ihre Bestandteile zu zerlegen. Nicht anders stand es mit der Phlogistontheorie, die darum doch falsch war. Wenn mir daher heute jemand ein Perpetuum mobile zeigen würde, was ja bekanntlich nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie unmöglich wäre, so würde ich mich durchaus nicht weigern, es zu prüfen. Denn so machten es die peripatetischen Kollegen des großen Gallilei, als sie sich sträubten, das Fernrohr zu benutzen, aus Angst, seine Entdeckung der Jupitermonde bestätigen zu müssen. Vielmehr würde ich das Instrument sehr, sehr eingehend prüfen und ev. zum Resultat kommen, daß das große Gesetz, die genialste Geistestat des 19. Jahrhunderts, lückenhaft ist.
Und wenn mir jemand den Stein der Weisen brächte und behauptete, damit Gold machen zu können, so würde ich für einen Augenblick die Theorie von der Unverwandelbarkeit der Elemente vergessen und den Fall genauestens prüfen. Und wenn mir dabei einfiele, daß der große Chemiker van Helmont und vor ihm Paracelsus behaupten, Gold hergestellt zu haben, so wäre diese alchimistische Bestätigung kein [S. 7]Grund, die Nachprüfung überlegen lächelnd abzulehnen.
Die Autoritäten, mögen sie auch noch so geniale Männer gewesen sein, sind eben auch nur Menschen, und darum sind alle ihre Theorien dem Irrtum unterworfen. Absolute Wahrheit oder doch Beweisbarkeit finden wir wohl ausschließlich in der reinen Mathematik. Mit dem Augenblick aber, wo die Mathematik in die reale Welt eingreift, etwa bei der Konstruktion einer Eisenbahnbrücke oder in der Unfallstatistik, ist auch sie nicht mehr unfehlbar, wenn auch zugegeben werden muß, daß ihr immer ein hoher Grad von Beweiskraft beizumessen ist.
Wenn man sich darüber wundert, daß ich in einer historischen Studie zum Beweise für die Fehlbarkeit der Autoritäten nur Beispiele aus dem Gebiete der Naturwissenschaften anführe, so geschieht das ganz und gar nicht deshalb, weil sich etwa hier die Autoritäten mehr blamiert hätten, wie in den Geisteswissenschaften. Es hat lediglich in der besseren Kontrollierbarkeit der Resultate seine Begründung.
Die Geisteswissenschaften stehen im Gegensatz zu den Naturwissenschaften noch durchaus in den Anfängen. Von der Logik, die ja rein formaler Natur ist, abgesehen, gibt es auch nicht einen einzigen philosophischen Lehrsatz, der allseitig anerkannt wäre. Grundwahrheiten hat die Philosophie überhaupt nicht. Ähnlich ist es etwa um die Psychologie oder Geschichte bestellt. Gibt es doch Leute, die die Möglichkeit historischer Gesetze rundweg leugnen. Mit der Tatsache aber, daß Ritter Kunz in diesem oder jenem Jahre gestorben ist, oder daß soundso viele Soldaten [S. 8]in der Schlacht bei Adorf fochten, lockt man keinen Hund vom Ofen fort.
Die Naturwissenschaften verfügen dagegen über eine ganze Reihe zwar nicht unfehlbarer, wohl aber gut fundierter Gesetze, und dadurch, daß sie das Experiment als Beweismittel besitzen, sind sie den Geisteswissenschaften gegenüber weit im Vorteil. Wenn es also sogar bei ihnen schwer fällt und oft Jahrzehnte erfordert, die Fachwelt von einer neuen Entdeckung zu überzeugen, so muß das auf geisteswissenschaftlichem Gebiete noch viel schwerer sein.
Geradezu unmöglich wird es aber, wenn der neue Gedanke dem materialistischen Modedogma, einem indirekten Resultate der Aufklärung, widerspricht oder zu widersprechen scheint.
Die Aufklärung hat uns zweifellos unendlichen Segen gebracht, viel mehr als Schaden. Sie beseitigte den Wunderglauben, d. h. den Glauben, daß Gott mit Durchbrechung der Naturgesetze irgendeinen Eingriff in die Weltordnung tun könne. Das allein schon ist ein nicht zu überschätzender Gewinn. Sie befreite uns vom Hexenwahn, diesem Schandfleck der christlichen Kirchen. Sie lehrte überall nach natürlichen Gründen, nach Gesetzmäßigkeiten suchen und verhalf dem gesunden Menschenverstand zu seinem Rechte.
Aber sie schoß auch über das Ziel hinaus, indem sie eine Überkritik walten ließ, die besonders in der Geschichtswissenschaft noch üppige Triebe zeitigt. Sie verwarf vor allem alles Übersinnliche, erklärte es für unmöglich. Das aber ist vorläufig, d. h. für die nächsten Jahrhunderttausende, bis wir nämlich alle [S. 9]Naturkräfte kennen, unsinnig. Sie erklärte für »freie Geister« nur jene, die an die Hypothese von der Unmöglichkeit alles nicht Alltäglichen, jederzeit willkürlich und durch das Experiment Hervorrufbaren glauben. Aber das ist ein Glaube, ein falscher Glaube sogar, wie ich in vorliegendem Werke nachzuweisen versuchen werde.
Da jedoch das wunderbar Scheinende – nicht etwa nur das endgültig als nicht existierend bewiesene »Wunder« – die Ausnahme bildet, durch bereits bekannte Naturgesetze Erklärbares oder doch auf sie Zurückführbares aber die Regel, so war der von der Aufklärung und ihren heute noch herrschenden Schülern angerichtete Schaden bei weitem nicht so groß, wie der Nutzen. Denn wenn wir auch die Existenz echter Prophetie beweisen werden, so werden wir doch nicht leugnen, daß es sich um relativ seltene Phänomene handelt.
Wogegen wir mit aller Energie und mit Berufung auf die Irrtümer der sogenannten Autoritäten sowohl, als auf die Lückenhaftigkeit unserer Kenntnisse des Naturgeschehens zu Felde ziehen müssen, das ist vor allem die unbewiesene und unbeweisbare Hypothese von der Unmöglichkeit irgendeiner Erscheinung nur deshalb, weil sie einer Theorie widerspricht, oder weil wir sie nicht erklären können.
Nicht der ist frei, der einer Theorie zuliebe widersprechende Tatsachen ungeprüft ablehnt, der in lächerlicher Überschätzung des derzeitigen Standes unserer Kenntnisse etwas für unmöglich hält, sondern ganz allein, wer vorurteilslos und tendenzlos [S. 10]alles prüft, was ihm fremdartig erscheint, ohne sich dabei im allergeringsten über die Urteile der Autoritäten aufzuregen.
Sehr lehrreich für die Macht des materialistischen Dogmas, das nur Kraft und Stoff kennt und den fehlerhaften Analogieschluß fordert, die Gesetze der materiellen Welt seien auf die des Geistes ohne weiteres übertragbar, ist die Leidensgeschichte des Hypnotismus.
Da ich sie an anderer Stelle[2] ausführlich erzählte, möge es genügen, hier daran zu erinnern, daß Mesmer, der Entdecker oder vielmehr der Wiederentdecker – und auch das nur mit Einschränkung, denn das Phänomen war schon Jahrtausende bekannt – einer geheimnisvollen Kraft, mit der er Heilungen und höchst wunderbare Phänomene erzeugte, auf Grund einer eingehenden Prüfung von der Pariser Akademie der Wissenschaften, und zwar von Männern wie Leroy, Bailly, Lavoisier, für einen Phantasten erklärt wurde. Als Schwindler verschrien mußte er sterben, ohne die Anerkennung seiner Lehre erlebt zu haben. Auch dem Arzte James Baid, der 1843, 59 Jahre nach der ersten Prüfung, die Frage neuerdings in Angriff nahm, gelang es nicht, die Anerkennung der Zeitgenossen zu finden. Erst durch die Vorführungen des gewerbsmäßigen Hypnotiseurs Hansen im Jahre 1879 wurde die Aufmerksamkeit der Welt auf die wunderbaren Erscheinungen gelenkt. Aber noch Virchow leugnete sie bis zu seinem Tode, weil sie in das gerade herrschende System nicht paßten und [S. 11]wohl auch, weil Phantasten aus ihnen zu weit gehende Schlüsse zogen.
Heute kennt jedes Kind Suggestion und Hypnotismus, und doch sind wir noch durchaus nicht imstande, die Phänomene, obwohl wir sie jederzeit hervorrufen können, zu erklären.
Genau wie hier verhält es sich mit dem zeitlichen und räumlichen Fernsehen und wohl auch noch mit ungezählten anderen Dingen: sie werden geleugnet, weil sie nicht erklärt werden können. Erst wenn eine unübersehbare Fülle von Daten vorliegt, gibt man eine unerklärbare Tatsache zu, oder man bildet sich ein, sie erklärt zu haben, indem man für sie einen Namen prägt. Dies ist wieder ein schlagender Beweis für den oft erschreckenden Mangel an Logik, den wir auch bei Gebildeten finden.
Ein anderer Grund – neben Aufklärung und Materialismus – für das Widerstreben, Tatsachen anzuerkennen, die nicht in das Modedogma passen, ist die Furcht, für kirchengläubig zu gelten. Nun, gegen diesen Verdacht schützen mich meine anderen Bücher. Aber ich fühle mich auch von dem Vorurteile gegen das Vorurteil frei oder habe doch das redliche Streben, es zu werden.
Daß die Kirche an Prophezeiungen und Offenbarungen glaubt, kann für mich natürlich kein Grund sein, es auch zu tun, aber es ist auch keiner aus wohlbegründeter Abneigung gegen sie, und zwar nur aus ihr – denn träten Gründe dazu, dann wären ja diese ausschlaggebend – die Prophetie abzulehnen. Das wäre ein Rückfall in jene Intoleranz und Borniertheit, die ich zu bekämpfen nicht müde werde.
[S. 12]Was ich suche, ist ganz allein die Wahrheit. Ob sie nützt oder schadet, ob meine Gegner sie gutheißen oder nicht, ist mir vollkommen gleichgültig. Selbst wenn ich ihnen Waffen gegen mich in die Hand drückte, so könnte diese Befürchtung mich nicht zu einer Unehrlichkeit verleiten.
Aber so liegt hier der Fall gar nicht. Denn wenn wir auch zum Resultate kommen werden, daß echte Prophetie existiert, so ist damit selbstverständlich noch nicht im allergeringsten etwas darüber ausgesagt, daß irgendeine Prophezeiung, deren Eintreffen noch aussteht, auch richtig sein muß. So wenig, wie aus der Konstruktion des lenkbaren Luftschiffes gefolgert werden kann, daß nun auch jedes, oder auch nur die Mehrzahl ihr Ziel erreicht. Deshalb möchte ich meinen orthodoxen Freunden in beiden Lagern raten, nicht zu früh über den verlorenen und wieder gefundenen Sohn zu frohlocken und sich nicht auf mich zu berufen, wenn sie einen Gewährsmann für die Richtigkeit der Apokalypse oder der Weissagungen irgendeines Nönnlein benötigen. Sie würden mich zwar nicht zu einer Polemik bewegen können – dazu Nachhilfestunden in der Logik zu erteilen, fehlen mir wirklich Lust und Zeit – aber sie würden einen groben Denkfehler begehen.
Noch ein weiterer Grund wird der Annahme meines Beweises hindernd im Wege stehen: die Furcht, durch Zugabe der Prophetie die Willensfreiheit zu leugnen. Ich stehe der sogenannten Willensfreiheit sehr skeptisch gegenüber, würde aber den einer historischen Untersuchung gesteckten Rahmen weit überschreiten, wollte ich mich auf diesen schlüpferigen [S. 13]Boden, auf dem schon die größten Geister strauchelten, begeben. Ob die Anerkennung der Prophetie für oder gegen die Willensfreiheit spricht, mag mich als Privatmann interessieren. Hier ist es mir ebenfalls gleichgültig. Denn die Konsequenzen, die man aus einer richtigen Tatsache zieht, dürfen, mögen sie auch noch so unerfreulich sein, ihre Anerkennung doch nicht verhindern.
Als letzten Grund für die Feindschaft gegen die Prophetie, wie übrigens gegen alle seltenen Phänomene, mag noch der demokratische Gleichheitswahn angeführt werden. Da alle Menschen, wenigstens in ihren politischen Rechten, gleich zu sein behaupten oder es doch beanspruchen, liegt der Schluß nahe, sie seien es überhaupt. Nun ist die Gabe der Weissagung zweifellos selten. Sie unterscheidet den mit ihr Begnadeten – oder Belasteten – von den anderen Menschen. Das Zugeständnis aber, daß es Leute mit Fähigkeiten gibt, die nicht etwa nur quantitativ, sondern auch ihrem ganzen Wesen nach über der Durchschnittsmenschheit stehen, will gar nicht dem modernen Denken entsprechen. Man mag – widerstrebend allerdings – zugeben, daß dieser oder jener klüger ist, als man selbst, aber das ist noch kein Verzicht auf die Fähigkeit zu denken überhaupt. Zuzugestehen aber, daß irgend jemand einer Gabe teilhaftig ist, von der uns anderen auch die leiseste Spur fehlt, kostet schmerzliche Überwindung.
Ich selbst besitze die Gabe der Prophetie nicht. Ich bin auch weder Spiritist noch Okkultist. Nicht etwa deshalb, weil ich die von jener Seite behaupteten Erscheinungen für unmöglich hielte, sondern lediglich [S. 14]deshalb, weil ich noch keine Gelegenheit hatte und sie wohl auch nicht suchte, mich von ihrer Richtigkeit zu überzeugen. Ich bin lediglich als Historiker an diese Frage herangetreten, und zwar kam das so:
In meiner Untersuchung »Lebensdauer und Todesursachen innerhalb der deutschen Kaiser- und Königsfamilien«[3], in der ich auf historisch-statistischer Basis erstmalig den Beweis erbrachte, daß die Lebensdauer im geraden Verhältnis zur Höhe der materiellen Kultur steht und daß die Menschen seit dem frühen Mittelalter immer älter werden, stieß ich auf folgende Stellen:
»Mit des Kaisers Kräften ging es zur Neige, als er Ende September 1518 von Augsburg durch die Ehrenberger Klause in sein geliebtes Tirol gezogen kam . . . Die Ärzte konnten nichts helfen, zumal einer, Collinitius (Tannstetter), hoffnungslos war wegen eines Horoskopes, das er vor Jahren vor Zeugen über des Kaisers Todesepoche gestellt hatte . . .« Der Kaiser Maximilian I. starb am 12. Januar 1519[4].
Oder von Kaiser Rudolf II., der schon viele Jahre geistig und körperlich krank, seit 1612 andauernd ans Bett gefesselt war, fand ich: Ende des Jahres 1619 ging es mit ihm schlechter. »Er versank in tiefe Melancholie, da er seinen Tod für unvermeidlich hielt. Tycho Brahe, sein großer Astronom, hatte nämlich durch das Horoskop gefunden, daß er und sein [S. 15]Lieblingslöwe unter demselben Einfluß stünden. Letzterer war aber in diesen Tagen gestorben.« Der Kaiser starb am 20. Januar 1620[5].
Noch eine dritte Stelle sei angeführt. Sie handelt von Kaiser Karl VI., dem letzten Habsburger. Der Kaiser hatte, wiewohl ganz gesund, am 1. Oktober des Jahres 1740 plötzlich ein Vorgefühl des nahen Todes geäußert. Um ihn zu zerstreuen, war eine große Jagd veranstaltet worden, von der er todkrank heimkehrte. Und zwar hatte er am 13. Oktober plötzlich heftigen Schnupfen und Leibschmerzen, so daß er auf der Heimfahrt mehrmals ohnmächtig wurde. Am 20. Oktober hauchte er seine Seele aus[6].
Diese und andere historisch völlig einwandfrei feststehende Tatsachen, die ich in meinem Gedächtnis nachkramend noch fand, machten mich stutzig, und ich entschloß mich, die Frage einer eingehenderen Prüfung zu unterziehen. Wäre ich gläubig gewesen, d. h. hätte für mich die Hypothese der Unmöglichkeit derartiger übersinnlicher Phänomene festgestanden, dann hätte ich mich mit dem Zufall als Erklärung begnügt und nicht weiter darüber nachgedacht. Aber ich war und bin ganz und gar nicht gläubig, weder der Kirche und ihren Dogmen, noch den Autoritäten oder den gerade aktuellen Zeitdogmen gegenüber, und so ging ich vor auf die Gefahr hin, einen Schlag ins Wasser zu tun.
Einigermaßen zögerte ich noch, weil mir die [S. 16]Konsequenzen eines ev. Eintretens für die Wahrheit der Prophetie keinen Augenblick zweifelhaft sein konnten. Hätte ich gefunden, daß alle überlieferten Daten falsch sind, dann wäre damit gegen die Möglichkeit der Prophetie ebenso wenig bewiesen gewesen, wie etwa die Nichterreichung der Pole etwas gegen die Möglichkeit, doch einmal ans Ziel zu gelangen, aussagen will.
Wie aber, wenn ich mich von der Wirklichkeit überzeugte und dann den selbstverständlichen Bekennermut der Wahrheit beweisen müßte? Ein Fall, der, wie das Folgende zeigen wird, eintrat. Oder wenn es mir nicht gelingen sollte, den zwingenden Beweis zu erbringen, nachdem ich persönlich überzeugt worden war?
Ich hätte mich unfehlbar lächerlich gemacht. Es ist ja ein beneidenswertes Vorrecht der absoluten Ignoranz, a limine alles das abzulehnen, was ihr nicht sofort plausibel erscheint. Je mehr wir uns mit irgendeiner Materie beschäftigen, desto mehr werden wir finden, daß es nur sehr wenig Irrtümer gibt, die sich nicht mit einigen Argumenten stützen ließen, aber andrerseits auch nur sehr wenig Wahrheiten, gegen die sich nicht gleichfalls triftige Gründe ins Feld führen lassen. Da nun aber gerade auf diesem Gebiete die Zahl derer, die sich mit der Materie beschäftigten, sehr minimal ist; da sie zumeist nicht den Mut haben, das zu bekennen, was sie fanden oder – wenn sie es tun – es zumeist in Organen geschieht, die durch die geringe kritische Sichtung ihres sonstigen Materiales auch das Richtige schädigen, so befinde ich mich unbedingt in der verschwindenden Minorität [S. 17]und muß sehen, wie ich den Kampf allein durchführen kann.
Besonders die große Zahl der Freunde meiner anderen Schriften wird, dachte ich mir, an mir irre werden. Denn sie lachte mit mir die Ignoranz und Borniertheit der Pfaffen und Bureaukraten aus und freute sich über Dummheiten anmaßender »Autoritäten«. Sie wird – das bewiesen mir schon Zuschriften – glauben, ich sei Apostat geworden, wo doch das gerade Gegenteil der Fall ist. Gerade meine Autoritätslosigkeit und mein Wahrheitsdrang befähigten und ermutigten mich eine Frage, die für die gedankenlosen Nachbeter des Zeitdogmas längst gelöst ist, nachzuprüfen. Also nicht Apostasie, sondern konsequente Verfolgung des eingeschlagenen Weges führte zu diesem Ziele. Wenn es auch verdienstvoll ist, mit Irrtümern aufzuräumen, wie ich das in früheren Schriften tat, so ist es doch zweifellos noch dankenswerter, eine neue Wahrheit zu finden. Brach ich also Bahn für dogmenfreies Denken nach jeder Richtung, so war es nur natürlich, wenn ich als einer der ersten diese Bahn auch beschritt.
Ein weiterer Einwand, den ich mir machte, um ihn gleich dem vorigen zu widerlegen, war folgender: Die Prophetie ist ein Phänomen, das seit Jahrtausenden bekannt ist und das das Volk – neben mancher anderen Wahrheit – auch niemals vergessen hat, trotz aller Gelehrten. Man wird also, wenn ich den Beweis für die Tatsächlichkeit erbringe, in ganz kurzer Zeit vergessen, daß ich mich damit aufs entschiedenste gegen die Zeitdogmen gestemmt habe, daß ich den [S. 18]Mut bewies, den Fluch der Lächerlichkeit zu riskieren und tatsächlich eine neue Wahrheit, wenigstens für die Wissenschaft, fand. Man wird sich vielmehr breitbeinig vor mich hinstellen und mir mit Stentorstimme zuschreien: »Du glaubst eine neue Wahrheit gefunden zu haben? Du Narr! Das haben ja schon die alten Babylonier, Hebräer und Griechen gewußt.«
Und man wird glauben, mir eine große Neuigkeit geoffenbart zu haben.
Doch selbst wenn es so kommen wird – dachte ich mir – ist es nicht so schlimm. Denn nicht nur die Goldbarren der Wahrheit aus tiefem Schacht ans Licht zu fördern, ist des Schweißes der Edeln wert. Auch aus ihnen Dukaten zu schlagen und sie so unter die Leute zu bringen, ist nicht ohne Verdienst.
So weit freilich, daß man den berühmten Tric anwenden kann, erst eine neue Wahrheit mit allen Mitteln, selbst gegen besseres Wissen zu bekämpfen und dann, wenn sie glücklich zum Siege geführt ist, zu beweisen, daß sie gar nicht neu ist, sind wir noch lange nicht. Vorläufig befinden wir uns noch im ersten Stadium dieses Prozesses. Das beweist auch folgender Vorfall:
Als mir neulich ein Bekannter sagte: »Was machen Sie denn eigentlich? Ich habe Sie immer für einen modernen Menschen gehalten und nun treiben Sie solche Sachen«, da konnte ich ihm ruhig antworten: »Nicht wiewohl, sondern eben weil ich mich bemühe, ein moderner Mensch zu sein, darum tue ich es. Denn in zehn Jahren werden es die Spatzen von den Dächern pfeifen.«
Es gibt also tatsächlich noch Leute, und sie [S. 19]haben die öffentliche Meinung ganz auf ihrer Seite, die die Beschäftigung mit solchen übersinnlichen Phänomenen für eines modernen Menschen unwürdig halten. Das war mir eine große Beruhigung, denn da ich den Beweis gefunden habe, ist es mir natürlich wertvoll, zu wissen und bestätigt zu finden, daß ich damit vorläufig wenigstens etwas Unerhörtes sage.
Es ist ja ein trauriges Los aller Entdecker und Förderer einer neuen Wahrheit, daß das, was sie fanden – um so bedeutender es war, desto schlimmer –, bald Gemeinplatz wird und man sich nachträglich kaum mehr vorstellen kann, welcher Kämpfe und Gedankenarbeit es bedurfte, es so weit zu bringen.
Doch alle diese Erwägungen und wohl auch noch andere brachte ich durch den schlagenden Gegengrund zum Schweigen, daß es unehrenhaft ist, eine Wahrheit, die man gefunden zu haben glaubt, aus keinem anderen Grunde zu verschweigen, als weil man persönliche Unbequemlichkeiten fürchtet. Hätten nicht zu allen Zeiten mutige und ehrenhafte Männer so gedacht, dann wären wir heute noch Kannibalen und Troglodyten.
Allerdings war mir eines klar: allein durch die Zusammentragung beglaubigter Prophezeiungen ist das Problem niemals zwingend zu lösen. Denn mögen die Daten auch noch so zahlreich sein, so wird die Möglichkeit des Zufalles doch niemals ganz von der Hand gewiesen werden können. Es handelte sich also vor allem darum, eine Methode zu ersinnen, die diesen Rückzug endgültig abschneidet.
Sie fand ich durch Verbindung der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit den historischen Tatsachen. [S. 20]Dadurch gelang es mir, an die Stelle eines Glaubens oder Nichtglaubens an Prophetie das unbedingt feststehende Wissen von ihrer Existenz zu setzen.
Das ist eine neue Wahrheit. Denn die Voraussetzung der Wahrheit, das, was sie vom Glauben oder Aberglauben unterscheidet, ist ihre Beweisbarkeit. In die Wissenschaft wird etwas nur durch den Beweis eingeführt. Und ihn zu erbringen, gelang mir als erstem. Denn was die größten Denker früher auch über Prophetie geschrieben haben mögen, alles war mehr oder weniger hypothetisch, mag es auch noch so geistreich oder genial gewesen sein. Die feste Basis des exakten wissenschaftlichen Beweises legte sich.
Nun wird man noch fragen können, warum ein Buch, das die strengsten wissenschaftlichen Ansprüche erhebt und den ersten zwingenden Nachweis einer zwar vermuteten, aber doch noch völlig unbekannten Naturkraft erbringt, in einem Verlage erscheint, der vornehmlich populäre und belletristische Literatur pflegt.
Ich könnte darauf antworten, daß eine solche Äußerlichkeit nicht der Rede wert sei. Damit würde ich allerdings die Denkweise der gelehrten Zunft verkennen, die sich mit Vorliebe an äußerliche Kriterien hält. Sie wird sich in diesem Falle wohl oder übel mit der Tatsache abfinden müssen, daß eine Wahrheit, die in ihren Konsequenzen an Bedeutung alle Klostergeschichten und Aktenpublikationen turmhoch überragt, in einer Form und in einem Verlage erscheint, der nichts weniger als für den Ausschluß der Öffentlichkeit bestimmt ist.
Um es gerade heraus zu sagen: Mir genügt es [S. 21]nicht, wenn ein Dutzend Gelehrte von meiner Entdeckung Kenntnis erlangen. Ich verzichte auf die papierne Unsterblichkeit der Bibliotheken und Anmerkungen. Ich will wirken, das Denken meiner Zeitgenossen beeinflussen. Ich will verhüten, daß einige übelwollende oder neidische Fachgenossen, einige dogmatisch befangene Fachzeitschriften mein Werk auf Jahrzehnte totschweigen können. Vestigia terrent. Darum versuchte ich strenge Wissenschaftlichkeit des Tatsachenmateriales und der Beweisführung mit einer Form zu verbinden, die auch der versteht, der über nichts weiter als seinen gesunden Menschenverstand und leidliche Schulbildung verfügt. Und ich trug Sorge, daß dieses Buch eine Verbreitung findet, ebenso groß, oder noch größer, als die meiner übrigen Schriften.
Daß mir Hohn und Spott von der einen Seite, der Vorwurf, ich stieße offene Türen ein, von der anderen, orthodoxen, die ein Glauben an Prophetie mit dem exakten Nachweis ihrer Existenz verwechselt, nicht erspart bleiben wird, des bin ich gewiß. Es schreckt mich nicht. Ich kann sogar meinen Gegnern die Versicherung geben, daß es gar nichts Ungefährlicheres gibt, als mich anzugreifen. Denn da die Wahrheit für sich spricht und sprechen wird, habe ich keine Veranlassung, mich in Polemiken einzulassen und damit Leuten zu einem Bekanntwerden zu verhelfen, auf das sie sonst wohl verzichten müßten. Nur Gelehrten von Ruf und Namen rate ich zu einiger Vorsicht. Sie könnten sich sonst leicht in meinen Kultur-Kuriosa unter der Liste der entgleisten »Autoritäten« wieder finden.
[S. 22]Ich schließe mit einer Bitte an alle jene, denen es wirklich um die Wahrheit zu tun ist. Ich bitte nicht um irgendeinen Glauben, im Gegenteil, ich bitte um Zweifel. Aber um einen Zweifel, der nicht stehen bleibt bei der Kritik der einzelnen Tatsache, sondern der auch nicht halt macht weder vor Hypothesen, noch Theorien, noch Zeitdogmen. Auch nicht vor dem der Unmöglichkeit der Prophetie.
[1] Eine große Zahl weiterer Fälle findet man in meinen »Kultur-Kuriosa«, 8. Aufl., S. 268 ff., und II. Band, 6. Aufl., S. 42 ff. Meine Ansichten über Autoritäten im allgemeinen sprach ich aus in »Dinge, die man nicht sagt«, 7. Aufl., S. 98 ff.
[2] Kultur-Kuriosa II, S. 61 ff.
[3] Bei Franz Deuticke, Wien und Leipzig 1909.
[4] H. Ulmann, »Kaiser Maximilian I.«, II. Bd., S. 760 ff. Über die letzte Krankheit des Kaisers sind wir genauestens informiert durch das Schreiben J. Spiegels an den Arzt Stromair. Vgl. Knod. Spiegel, 1. Schlettstädter Programm 1884, Beil. VII, S. 51 f.
[5] Vgl. Anton Gindely, Rudolf II. und seine Zeit, Prag 1863, II. Bd., S. 325 ff.
[6] P. A. Lelande, Histoire de l’empereur Charles VI, Haag 1743, VI. Bd., S. 114 ff.
[S. 23]
Die Zahl der uns aus der Vergangenheit erhaltenen und als eingetroffen beglaubigten Prophezeiungen ist außerordentlich groß. Dabei ist es keineswegs nötig, die Weissagungen religiösen Inhaltes in den Kreis der Betrachtung zu ziehen. Auf sie werden wir in diesem Buche überhaupt nicht näher eingehen, und zwar aus verschiedenen Gründen.
Zunächst hat das an Prophezeiungen reiche Alte Testament verschiedene Redaktionen und Interpolationen sich gefallen lassen müssen, so daß wir oft nicht wissen, ob es sich um eine beglaubigte Vorhersage handelt. Das schließt das Vorhandensein der echten nicht aus. Auf sie werden wir später zurückkommen. Daß die messianischen Prophezeiungen ausscheiden, ist klar, denn es ist eine mißliche Sache, sich mit solchen mystischen Dingen zu befassen, wenn man eine neue Wahrheit finden oder doch eine [S. 24]alte durch neue Argumente stützen will. Die Juden stehen ja bekanntlich noch heute auf dem Standpunkt, daß der Messias noch kommen wird.
Eine Prophezeiung allerdings zieht sich durch das Alte Testament, die wir nicht vergessen dürfen, zumal sie profaner Natur ist: die das jüdische Volk und seine Zukunft betreffende. Von ihr wissen wir auch mit absoluter Sicherheit, daß sie nicht nachträglich erst abgefaßt sein kann. Mag man einwerfen, sie sei prophezeit nicht etwa auf visionärem Wege, sondern als Wunsch, oder in der Absicht, durch diese Hoffnung das kleine Judenvolk auch in den schlimmsten Zeiten aufrecht zu erhalten, so sind das Hypothesen, die an der verblüffenden Tatsache nichts ändern.
Wo sind sie alle geblieben, die Herren der alten Welt? Wo sind die Babylonier, die Assyrer, die Griechen, Römer?
Sie sind wie die Spreu vom Winde verweht. Da und dort Trümmer gewaltiger Bauwerke, Reste ihrer Literatur, Spuren in unserem Geiste hinterlassend, aber im wesentlichen hat nur der Name die Jahrtausende überdauert. Was an den alten Herrenvölkern von Fleisch und Blut war, das ist ausgestorben. Gewiß mag noch in den Adern von manchen unter uns ein Tropfen ihres Blutes rollen. Aber es ist ein Tropfen.
Und leben nicht die Juden? Sie ganz allein von allen Völkern, die einst vor Jahrtausenden über die Erde wandelten? Und auch sind sie es wiederum ganz allein, die seit zweiundeinhalb Jahrtausenden kein Vaterland besitzen, sondern verfolgt, gehaßt, [S. 25]verachtet unter Wirtsvölkern wohnen, die oftmals wechselten, während sie blieben.
Aber es ist nicht genug zu sagen, daß das Judenvolk der einzige Rest der Antike ist, der lebend mit Fleisch und Blut in die Gegenwart hineinragt. Sie sind jetzt bedeutend zahlreicher als je zuvor. Schätzt man doch das ganze Volk auf etwa 11½ Millionen Seelen, während das alte Palästina, ein Land nicht größer als die Provinzen Sachsen oder Westpreußen, kaum mehr als eine halbe Million Bewohner ernährte, und von diesen waren keineswegs alles Juden. Das Volk hat sich also nach allermindester Schätzung verzwanzigfacht.
Doch es ist nicht genug an dem, daß das Judenvolk als einziges des Altertums heute noch besteht, daß es ohne Vaterland dies Wunder ermöglichte, daß es sich verzwanzigfachte, es herrscht auch! Unser Handel und Geldwesen ist leider zum großen Teile durch die törichten kirchlichen Wucherverbote den Landesherren entwunden und in ihre Hand gelegt. Ebenso steht es mit dem größten Teil der Presse. Und daß auch politisch das Judenvolk keineswegs machtlos ist, wenigstens nicht im Westen und Süden Europas, beweisen die zahlreichen Minister israelitischen Glaubens in Italien und Frankreich, beweist ein Disraeli im stolzen England und mancher hohe Beamte bei uns. Dabei sehen wir ganz davon ab, daß sehr viel jüdisches Blut sich mit dem blauen unseres Adels vermischt hat.
Fürwahr: Keine Prophezeiung ist in jeder Hinsicht in so wunderbarer Weise in Erfüllung gegangen, wie die alttestamentliche das Judenvolk betreffende.
[S. 26]Wir wollen nun im folgenden eine Anzahl das Judenvolk betreffender Prophezeiungen notieren[7].
Der älteste bekannte Prophet ist Amos, dessen Leben wir um 800 vor Chr. ansetzen dürfen. Er verkündet deutlich den Untergang des Zehnstämme-Reiches in der Zeit, als es unter Jerobeam II. wieder auf der Höhe der Macht stand und sich vom Hermon im Norden bis zum Toten Meer erstreckte. Die Vorhersagen lauten: »Durchs Schwert wird Jerobeam umkommen, und Israel wird auswandern von seinem Boden« (Amos 7, 11). Ferner: »Ich werde euch vertreiben weit über Damaskus hinaus« (Amos 5, 27) oder »Ich werde unter alle Völker das Haus Israel zerstreuen« (9, 9) und endlich: »Ich werde gegen euch, Haus Israel, spricht Gott, ein Volk auftreten lassen, das euch bedrängen wird, von gen Chamat bis zum Flusse der Araba« (des Toten Meeres), d. h. im ganzen Lande (6, 14). Amos nennt das Volk nicht, welches die Transportation vollziehen soll, kennt es noch nicht einmal, weiß aber, daß das Faktum bestimmt eintreffen wird. Nun ist das Zehnstämme-Reich erst ein Jahrhundert später (um 720) durch die Assyrer vernichtet worden. Diese von Amos so lange vorher verkündete Vorhersage hat sich also buchstäblich erfüllt.
Man könnte das Faktum zwar zugeben, trotzdem aber leugnen, daß es auf prophetischem, übersinnlichem Wege von Amos vorhergesehen wurde. Man würde es dann einer richtigen politischen Kombination [S. 27]zuschreiben. Denn schon damals hätten die Assyrer Lust gezeigt, Ägypten zu erobern, auf dem Wege dorthin aber müßten sie Palästina berühren und unterwerfen.
Dieser Einwurf läßt sich leicht damit widerlegen, daß im Falle der politischen Kombination auch das Reich Juda hätte hineingezogen werden müssen, und das um so mehr, als es damals viel schwächer als das Zehnstämme-Reich war. Ganz im Gegenteil hat aber Amos den Fortbestand Judas ausdrücklich betont (9, 8. 11). »Ich werde das Haus Jakob (Juda-Benjamin) nicht vertilgen, an jenem Tage werde ich die einfallende Hütte Davids aufrichten.« Tatsächlich hat sich das Haus Jakobs noch 134 Jahre länger als das Haus Israels gehalten. Es hat sich erst fast zwei Jahrhunderte nach Amos aufgelöst. Es handelt sich hier also um eine richtige prophetische Vorhersage, bei der Kombination ausgeschlossen sein dürfte.
Recht inhaltreich und im vollen Umfang eingetroffen ist auch folgende Verkündigung: »Von Zion wird Belehrung ausgehen und das Wort Gottes von Jerusalem für viele Völker« (Jesaia 2, 2–4 und gleichlautend Micha 4, 1–3). Jedermann kennt den ungeheuren, bis heute noch fortwirkenden Einfluß der jüdischen Lehre auf das Denken des Abendlandes, durch Vermittlung des Mohammedanismus aber auf den Orient.
In Erfüllung gegangen ist auch Michas Verkündigung des Unterganges Jerusalems, ein Jahrhundert vor dem Eintreten des Ereignisses. Micha prophezeite zur Zeit des Königs Hiskija (etwa 711–695). Aber mehr als das: Micha verkündete auch, daß das [S. 28]Exilland der Juden Babylonien sein würde (Micha 3, 9–12 und 4, 10). »Kreise, Tochter Zions, wie eine Gebärerin; denn bald wirst du hinausziehen aus der Stadt, wirst weilen auf dem Felde, wirst bis Babel kommen, dort wirst du gerettet werden, dort wird der Herr dich aus der Hand deiner Feinde erlösen.« Diese Prophezeiung ist deshalb nicht gut als Kombination einzuschätzen, weil Babylonien damals ohnmächtig in der Hand der Assyrer war und weil auch der Rücktransport der Gefangenen vorhergesagt wird.
Übrigens hat auch Jesaia dem König Hiskija 124 Jahre vor der Erfüllung vorhergesagt, daß dessen Nachkommen nach Babylonien transportiert und Eunuchen im Palast des Königs von Babel sein werden (Jesaia 39, 5–7).
Auch Jeremia hat nicht nur den Transport der Juden nach Babylonien vorhergesagt, sondern auch den Wiederaufbau Jerusalems nach Rückkehr der Judäer (Jeremia 1, 13. 15 und 37, 7–10). Und zwar war Jeremia ein Jüngling, als er Niedergang und späteren Aufstieg seinem Volke vorhersagte, was politische Kombination noch unwahrscheinlicher macht. Er war von seiner Prophezeiung so überzeugt, daß er während der hoffnungslosen Zeit der Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar auf innere Eingebung hin ein Grundstück kaufte (32, 24 f.).
Ein weiterer Verkünder der Schicksale des Judenvolkes ist der Prophet Ezechiel. Auch er weissagte den Untergang Jerusalems und das Exil, aber auch die Rückkehr und Verjüngung des Volkes. Er sagte mit unzweideutigen Worten voraus, daß die Verbannten in Babel den Grundstock zu einem neuen [S. 29]Volke und zu einer neuen, edleren historischen Entwicklung bilden würden (11, 16–20). Auffällig ist, daß auch er im Anfange seiner prophetischen Laufbahn diese Sehergabe bewies. Sein Bild von den vertrockneten und zerstreuten Gebeinen, die plötzlich wieder lebendig werden, hat sich buchstäblich erfüllt (Ezechiel, Kap. 37).
Von den exilischen Propheten verkünden sowohl der Deutero-Jesaia (Jes. 40–66), der Prophet des Stückes Kap. 13–14 und 24–27, als auch der Deutero-jeremianische Prophet (Jerem. 50–51) zuversichtlich die Rückkehr aus dem Exil und ein fürchterliches Strafgericht über Babylonien. Mag das letztere auf politischer Kombination beruhen, da die gewaltige Gestalt des Cyros bereits am Horizont auftauchte, so war doch weder die Vernichtung Babyloniens – da ja Unterwerfung genügt hätte – vorauszusehen, noch vor allem, daß gerade das winzige Judenvölkchen die Aufmerksamkeit des Eroberers auf sich lenkte. Berücksichtigt man ferner, daß gerade der letzte König Babylons die Juden besonders hart behandelte, so ist kaum zu bestreiten, daß die Vorhersagen erstaunlich sind.
Endlich führen wir noch zwei nachexilische Propheten an, nämlich Chaggai und Zacharia. Als man über die Winzigkeit des Tempels während der Regierung des Darius seufzte, sagte der erstere: »Größer wird die Ehre dieses (kleinen) Tempels, als des ersten sein« (2, 6–9) und der andere: »Entfernte werden kommen und werden an dem Tempel Gottes teilnehmen« (6, 15). Tatsächlich kamen zum zweiten Tempel Heiden in Menge aus Syrien, den Euphratländern, [S. 30]Kleinasien, Griechenland und selbst Rom, um sich zum Judentum zu bekennen oder Weihgeschenke zu schicken. Erst die »Fülle der Heiden«, die in das Haus Jakobs einkehrten, hat Paulus auf den Gedanken gebracht, die Heiden zu bekehren und zur Kindschaft Abrahams zu berufen.
Besonders merkwürdig aber ist folgende Verkündigung des nachexilischen Zacharia: »Es werden noch Völker und Bewohner großer Städte kommen und einander auffordern, Gott den Herren in Jerusalem aufzusuchen. Zehn Männer von allen Zungen der Völker werden den Zipfel eines jüdischen Mannes erfassen, sprechend: »Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben Gott mit Euch gehört« (8, 20–23). Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Juden bei ihrer Heimkehr von seiten der Nachbarvölker nur Verachtung und Haß fanden.
In allen oben angeführten Fällen ist ein Vatecinium post eventum völlig ausgeschlossen, Kombination aber unwahrscheinlich. Inwiefern der berühmte Zufall eine Rolle spielt, möge jeder selbst entscheiden. Ausgeschlossen in der obigen Liste sind alle Prophezeiungen, die in den Geschichtsbüchern erzählt werden, da ihre Authentizität angefochten werden kann.
Daß einige Prophezeiungen nicht in Erfüllung gingen, sei nicht in Abrede gestellt. Wir werden das später noch sehr häufig finden und an anderer Stelle ausführlich auf diese Frage zurückkommen.
Das Neue Testament ist als Quellenschrift unbrauchbar, da – von den Briefen abgesehen – alle [S. 31]Berichte auf Hörensagen beruhen. Das älteste Evangelium, das des Markus, ist keinesfalls vor dem Jahre 70 geschrieben worden, die auf ihm fußenden Evangelien des Lukas und Matthäus sind etwa zwei Generationen jünger, und das des Johannes ist gar erst gegen die Mitte des 2. Jahrhunderts verfaßt; also reichlich ein Jahrhundert nach Christi Tode. Daß unter diesen Umständen den evangelischen Prophezeiungen keine Bedeutung zuzuerkennen ist, liegt auf der Hand[8].
Was die mittelalterliche Heiligenliteratur betrifft, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß sich in ihr eine stattliche Anzahl echter Prophezeiungen würde nachweisen lassen. Jedoch ist sie in der Regel erst viel später und überdies außerordentlich unkritisch und mit der Absicht dem Heiligen möglichst viele Wunder zuzuschreiben, abgefaßt worden, so daß sie wenig Glauben verdient. Es mag eine dankbare Aufgabe der Zukunft sein, hier kritisch zu sichten. Daß durchaus nicht nur leeres Stroh gedroschen werden muß, ergibt sich z. B. aus der interessanten Arbeit von Merkt über die Stigmatisation des Heiligen Franz von Assisi[9]. Sie hat unzweifelhaft den Beweis erbracht, daß dieser außerordentliche Mensch Stigmen in der Art der Wundmale Christi hatte, ein Phänomen, für das, wie für so manches andere, die heutige Wissenschaft noch keine ausreichende Erklärung hat. Ohne Prophetengabe zu besitzen, [S. 32]können wir mit größter Bestimmtheit vorhersagen, daß es nicht mehr lange dauern wird, bis diese ganze Literatur von urteilsfähigen allen kirchlichen Dogmen ebenso frei, wie allen materialistischen gegenüberstehenden Männern nach unsern Gesichtspunkten durchforscht werden wird.
Die Skepsis des Autors gegenüber der religiösen Literatur, sowie die nicht geringere der Gebildeten im allgemeinen gegen derartige Quellen wird es rechtfertigen, wenn wir hier nicht länger verweilen, sondern – von wenigen gut beglaubigten Ausnahmen abgesehen – uns auf die profanen beschränken.
Wir leben unzweifelhaft noch in einer Zeit der Hyperkritik, die ohne weiteres ablehnt, was ihr irgendwie außergewöhnlich erscheint. Das wird sich ja wohl dereinst ändern, aber unsere Aufgabe kann es nicht sein, hier mehr dem Zeitgeist zu trotzen, als es unbedingt nötig ist. Daß trotzdem auch die kritischste Quellenbearbeitung Glauben fordert – man denke an die zahlreichen Fälle, in denen ein Faktum nur durch einen einzigen Bericht überliefert ist – steht fest. Aber in diesen Fällen muß das Faktum eben möglichst alltäglich sein. Bei unserer Untersuchung jedoch, die sich mit einer Materie befaßt, die rundweg in ihrem Bestande geleugnet wird, in den Fällen aber, wo sich die Tatsachen nicht fortdisputieren lassen, nach Tunlichkeit durch Zufall erklärt zu werden pflegt, tut doppelte und dreifache Vorsicht not.
Diese Erwägungen objektiver Art – soweit sie die tatsächlich unkritische und panegyrische religiöse Literatur betreffen – sowie die ebenso beachtenswerten subjektiver Natur – d. h. die Skepsis [S. 33]allem gegenüber, was irgendwie das Alltägliche, das Allerheiligste unserer demokratischen Zeit, übersteigt – lassen größte Vorsicht in Verwertung unverdächtiger Quellen als Pflicht der Klugheit erscheinen. Es muß unser Bestreben sein, möglichst gar nichts auf den guten Glauben des Lesers ankommen zu lassen.
Beginnen wir mit einigen beglaubigten Beispielen, die um so weniger Widerspruch finden werden, als sie gar keine echten Prophezeiungen sind.
Am bekanntesten ist das Orakel zu Delphi, das Krösus auf seine Frage hin die Antwort gab: wenn er den Halys überschreite, werde er ein großes Reich zerstören. Der Doppelsinn dieses Ausspruches ist so klar, daß man sich nur wundern muß, daß Krösus ihn nicht merkte.
Ebenso doppelsinnig ist das von Cicero überlieferte Apollinische Orakel, das Pyrrhus gegeben wurde:
Ajo te, Aeacida, Romanos vincere posse.
Da es sowohl heißen kann »ich sage dir, Aeacide, daß du die Römer besiegen kannst«, als auch »ich sage dir, Aeacide, daß die Römer dich besiegen können«, so ist es weder verwunderlich, daß es in Erfüllung ging, noch daß wir Cicero glauben, wiewohl er insofern keine lautere Quelle genannt werden darf, als er zwei Jahrhunderte nach dem großen Epiroten lebte.
Endlich wollen wir noch ein Orakel von Heliopolis in Aegypten anführen, das uns Macrobius[10] überliefert: Vor seinem Partherkriege wandte sich [S. 34]Trajan dorthin, um Auskunft über den Ausgang zu erhalten. Die Heliopolitaner schickten ihm statt einer Antwort einen zerbrochenen goldenen Weinstock, der im Tempel des Gottes geopfert worden war. Der Kaiser starb auf dem Feldzuge und man brachte die Gebeine, die durch den zerbrochenen Weinstock symbolisiert worden waren, nach Rom. Hätte er die Parther geschlagen, dann hätte man selbstverständlich auf sie das Symbol des Weinstocks gedeutet.
Daß uns mit solchen doppelsinnigen Aussprüchen, die unter allen Umständen in Erfüllung gehen müssen, nicht gedient ist, liegt auf der Hand. Zu verurteilen aber ist die Neigung der Gegenwart alle Orakel als ebenso doppelsinnig oder schwindelhaft hinzustellen.
Interessanter schon ist das alte Orakel, das uns Thukydides in seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges mitteilt.
Nachdem er die Pest und die furchtbare Not in Athen beschrieben hat, fährt er fort: »Und in diesen unglücklichen Zeiten fiel ihnen, wie man leicht denken kann, die Weissagung ein, die, wie die älteren unter ihnen versicherten, vor langen Zeiten gesungen worden sei:
Kommen wird einst ein dorischer Krieg und mit ihm die Seuche. Die Meinungen hatten sich darüber geteilt, ob die Alten in diesem Vers λοιμός (Pest) oder λιμός (Hungersnot) gemeint hätten. Doch bei den damaligen Begegnissen der Stadt behielt, wie leicht zu erachten, die erste Meinung die Oberhand, wie denn einem gewöhnlich dasjenige am ersten in den Sinn kommt, was mit dem, was uns wirklich begegnet, die nächste Verwandtschaft hat. [S. 35]Und ich stelle mir vor, wenn einmal nach diesem ein anderer dorischer Krieg ausbrechen, und eben eine Hungersnot dabei eintreten sollte, so würde man natürlich auch die Weissagung so auslegen. Nicht minder gedachten nunmehr auch diejenigen, welche darum wußten, an das den Lakedämoniern erteilte Orakel, da Apollo ihnen auf die Anfrage, ob sie den Krieg anfangen sollten, zur Antwort gegeben: wenn sie den Krieg mit Nachdruck führten, so würde der Sieg auf ihrer Seite sein, ja selbst ihnen beizustehen versprochen hatte. Mit diesem Orakel hielten sie den bisherigen Verlauf der Sache ganz übereinstimmend. Die Seuche brach gleich von der Zeit an aus, als die Peloponnesier ins Attische einfielen, und, was ein merkwürdiger Umstand war, die Peloponnes blieb gänzlich davon frei. Ihre stärkste Wirkung äußerte sie in Athen, sodann aber auch in andern Plätzen, die vor andern volkreich waren[11].«
Daß Thukydides Skeptiker ist und deshalb seine Mitteilung auch bei modernen Gesinnungsgenossen keinem Zweifel begegnen wird, dürfen wir als bekannt voraussetzen. Schrieb er doch seine berühmte Geschichte, ein bis heute unübertroffenes Meisterwerk, in ausgesprochenem Gegensatz zu seinem Vorgänger Herodot. Ihm kommt es im Gegensatz zu jenem darauf an, überall den natürlichen Zusammenhang der Dinge nachzuweisen, weshalb er alles Mythische und Göttliche, insoweit es die menschlichen Geschicke beeinflußt, ablehnt.
[S. 36]Aber selbst wenn jemand das nicht wissen sollte, geht es aus obiger Stelle unzweideutig hervor. Es ist kaum möglich, nüchterner und rationalistischer einem immerhin höchst merkwürdigen Phänomen entgegenzutreten.
Tatsache ist, daß das Orakel folgende durch die Geschichte bestätigte Weissagungen gemacht hatte:
1. Es findet ein dorischer Krieg statt.
2. Während dieses Krieges bricht eine Seuche aus. Selbst wenn wir mißtrauisch, wie wir nun einmal sind, die ungünstigere Interpretation, nämlich die Hungersnot, annehmen, dann wäre die Prophezeiung doch insofern richtig gewesen, als es sich um eine über das ganze Volk hereinbrechende, vom Kriege direkt unabhängige Katastrophe handelt. Es besteht aber gar keine Veranlassung für den objektiv urteilenden Menschen, die ungünstigere Interpretation zu wählen. Wollte man das prinzipiell tun, dann könnte man fast jeden noch so geistreichen Ausspruch eines noch so großen Mannes zum Unsinn stempeln.
3. Die Spartaner sollten nur angreifen, dann würden sie siegen.
4. Apollo, bekanntlich Gott der Pest, werde ihnen beistehen. Letzteres ist, wie ja auch Thukydides bemerkt, außerordentlich merkwürdig. Und zwar nach zwei Richtungen hin: Sowohl, weil der Ausbruch der Pest mit dem Einfall der Spartaner genau zusammenfällt, und zwar nicht etwa – was eine rationalistische, aber doch nur oberflächliche Erklärung wäre, da sie ja die Richtigkeit der Prophezeiung nicht umstoßen würde – weil sie von ihnen eingeschleppt [S. 37]wurde, sondern völlig unabhängig davon. Begann sie doch im Piräus, was die Vermutung nahe legt, daß sie von Übersee eingeschleppt wurde, worauf auch Thukydides im 48. Kapitel hinweist.
Ferner, weil der Peloponnes davon verschont wurde, so daß die Pest (Apollo) also tatsächlich nur den Spartanern half.
Ob wir diese merkwürdigen Vorhersagen als Zufall betrachten wollen, sei der Denkart jedes Lesers überlassen. Auf alle Fälle aber ergibt sich daraus eines, daß nämlich die Orakel keineswegs nur zweideutige und nichtssagende Auskünfte erteilten, sondern oft recht präzis antworteten.
Das läßt sich auch aus einem anderen Grunde voraussetzen, selbst wenn wir aus der antiken Literatur keine Belegstellen hätten, die es beweisen ließen.
Gewiß kann man die Dummheit des Volkes in gewissen Fragen gar nicht überschätzen. Sobald die Furcht vor dem Tode, das Seelenheil und ähnliche Dinge in Frage kommen, läßt es sich Jahrtausende die größten Bären aufbinden und opfert einen guten Teil seines sauer verdienten Geldes den Pfaffen. Wäre es nicht so, dann hätte es nie Priesterherrschaften gegeben und es wäre nicht möglich gewesen, daß die vorgeblichen Nachfolger eines Mannes, der am Morgen nicht wußte, wo er am Abend sein müdes Haupt niederlegen sollte, an Luxus die Fürsten übertrafen und man ihnen und ihren Dienern Schätze geradezu aufzwang.
Anders liegt aber der Fall weltlichen, praktischen Fragen gegenüber. Hier hat sich seit je die Klugheit des Volkes, die Bauernschlauheit, bewährt. Hier, [S. 38]wo es gilt, im Kampf mit gleichen Mitteln, im Geschäft, seinen Vorteil zu finden, stellt und stellte auch das ungebildete und ungelehrte Volk seit je seinen Mann.
Nun haben die Orakel aber weit über ein Jahrtausend, in Ägypten sicher mehrere Jahrtausende, bestanden, und die reichen Schätze, die sich aus freiwilligen Gaben in ihren Tempeln und Hainen aufspeicherten, beweisen, daß sie in hohem Grade die Zufriedenheit all der zahllosen Generationen zu erringen wußten. Daß das niemals der Fall gewesen wäre, wenn sie ausschließlich plumpe Zweideutigkeiten oder gar unwahre Aussprüche zum besten gegeben hätten, bedarf doch eigentlich keines Beweises.
Die rationalistischen Beurteiler der Orakel sehen in ihrer Priesterschaft nur politisch kluge, welterfahrene Männer. Daß sie das waren, können wir als sicher annehmen. Auch daß sich manche Prophezeiung nur deshalb realisierte, weil der Frager sein Verhalten genau nach dem Wahrspruch einrichtete, nicht minder, daß auch hie und da – aber das müssen verschwindend seltene Ausnahmen gewesen sein – eine Prophezeiung nicht in Erfüllung ging. Diese Erklärungen genügen aber auf die Dauer nicht.
Dem einfachen Manne mag der kluge Rat immer wertvoll sein. Was aber mächtige Könige und Staaten für ein Interesse daran haben sollten, sich von auswärts, noch dazu von einer Priesterschaft, die unter religiöser Maske vielleicht Interessenpolitik trieb, Anweisungen erteilen zu lassen, das will uns nicht einleuchten. Gerade der Umstand, daß die Orakel ihre Autorität völlig verloren, als sie sich eine politische [S. 39]anzumaßen versuchten, beweist hinlänglich, wie grundfalsch es ist, nur mit Schlagworten wie: Sophismen, zweideutige Aussprüche, weltkluge Priester, politisches Intrigenspiel usw. zu operieren. Man tut nie klug daran, den Gegner für weniger intelligent zu halten, wie sich selbst. Es ist auch nicht weise, dem Altertum, das uns neben den Sophisten einen Sokrates, Plato und Aristoteles schenkte, eine Naivität zuzutrauen, die wir uns scheuen würden, beim simplen Bauern vorauszusetzen.
Daß es sich bei den Orakeln, nach unserer festen Überzeugung, um mehr handelt als normale Klugheit oder gar Betrug – was keineswegs ausschließt, daß beide zuzeiten nicht fehlten[12] – möge auch aus der Art der Abgabe der Weisungen gefolgert werden.
In Delphi trank die Pythia, bevor sie ihre anstrengende Tätigkeit begann, vom heiligen Wasser und kaute Lorbeerblätter und Gerste, worauf sie in Verzückung geriet. »Angeblich« – die Philologie ist gar vorsichtig! – infolge eines unterirdischen Luftstromes, eines divinus adflatus, bzw. durch Dämpfe, die aus der Erde unter ihrem Sitz aufstiegen und durch ihren Schoß in den Leib eindrangen[13]. Daß [S. 40]dieser Luftstrom keineswegs nebensächlich war, erhellt daraus, daß Plutarch und Cicero den Verfall des Delphischen Orakels mit der Abnahme des inspirierenden Gases in Zusammenhang bringen.
Nach diesem uns von mehreren alten Autoren überlieferten Bericht steht es fest, daß die Pythia nicht in normaler Verfassung, sondern in Trance[14] war, wenn sie weissagte. Das Orakel war also kein Produkt intensiver Verstandesarbeit, sondern vielmehr ein solches des Unterbewußtseins. Das ist um so einleuchtender, als Plutarch ausdrücklich berichtet, man habe zu Pythien schlichte und unwissende Frauen gewählt. Dafür spricht auch, daß die Seherin durchaus nicht immer in Versen sprach, sondern ihre Aussagen oft abgehackt, ja bisweilen wohl auch unartikuliert waren und deshalb von Priestern stilisiert werden mußten. Genau, wie man es von modernen Somnambulen weiß, nur daß man heute ihre Aussprüche stenographisch, also ganz genau nach ihrem Wortlaut, festhält und so herausgibt.
Pausanias erwähnt eine Prophetie der Phännis, welche die Invasion der Gallier in Asien vorher verkündete. Auch führt er eine Vorhersage der Schlacht bei Aigos potamoi von Musaios und der Sybille an (X, 12 und X, 9) und ein anderes sybillinisches [S. 41]Orakel, nach welchem die durch Philippos gegründete makedonische Macht unter einem andern Philippos untergehen sollte (X, 15, X, 9 und VII, 8).
Cicero legt seinem Bruder die Argumente der Verteidiger der Orakel in den Mund. Schließen wir den kurzen Abstecher auf dieses Gebiet mit seinen Worten: »Wer weiß nicht, was der pythische Apollo dem Kroisos, was er den Athenern, den Lakedaimoniern, den Tegeaten, den Argeiern, den Korinthern geantwortet hat? Unzählige Orakel hat Chrysippus gesammelt, und keines ohne einen vollgültigen Gewährsmann und Zeugen; ich übergehe sie aber, weil sie dir bekannt sind. Nur so viel sage ich der Verteidigung wegen: Nie würde das Orakel zu Delphoi so besucht und berühmt gewesen sein, nie wäre es mit so ansehnlichen Geschenken aller Könige und Völker angefüllt worden, wenn nicht alle Zeitalter die Wahrhaftigkeit seiner Orakel erprobt hätten[15].«
Wir wollen nun noch einige Fälle von Prophetie bzw. Vorahnung oder Vorzeichen aus der alten Geschichte anführen[16].
Zu den bekanntesten Prophezeiungen des Altertums gehört jene, die sich auf Cäsars Ermordung bezieht. Sueton erzählt in seiner Biographie des Gajus Julius Cäsar, im 81. Kapitel, den Vorgang wie folgt[17]:
»Dem Cäsar wurde unterdessen der bevorstehende [S. 42]gewaltsame Tod durch die offenbarsten Vorzeichen verkündet. Wenige Monate zuvor, da in der Kolonie Capua die Kolonisten, die infolge des Julischen Gesetzes dorthin übersiedelten, zum Aufbau ihrer Landhäuser uralte Gräber umgruben, und dies um so eifriger taten, weil sie dabei eine große Menge Gefäße von alter Kunstarbeit fanden, entdeckte man in einem Monumente, das für das Grabmal des Capys, des Gründers von Capua, galt, eine eherne Tafel mit griechischer Schrift und Sprache, des Inhalts:
»Wenn einst die Gebeine des Capys ans Licht gekommen sein würden, werde ein Sprosse des Julus von der Hand seiner Blutsverwandten getötet, sein Tod aber bald durch schreckliche Heimsuchungen Italiens gerächt werden.«
Niemand darf diese Tatsache für fabelhaft oder erdichtet halten; es bezeugt sie Cornelius Balbus, Cäsars vertrautester Freund. Wenige Tage vor seinem Ende berichtete man ihm, daß die Rosse, die er beim Uebergang über den Rubiko den Göttern geweiht und ohne Hüter frei hatte laufen lassen, durchaus nicht mehr fressen wollten und häufige Tränen vergössen. Beim Verrichten eines Opfers erteilte ihm der Opferschauer Spurinna die Warnung: er möge sich vor einer Gefahr hüten, die nicht länger als bis zu den Iden des März ausbleiben werde. Am Tage aber vor diesen Iden des März sah man eine Vogelschar vor dem nahegelegenen Haine einen Zaunkönig, der mit einem Lorbeerzweiglein in die Pompejanische Kurie flog, verfolgen und daselbst zerreißen. Ja in der Nacht, auf die der Tag des Mordes anbrach, [S. 43]sah Cäsar seinerseits im Traume sich mehrmals über den Wolken schweben, und dann wieder einmal, wie er dem Jupiter die Hand reichte; und Calpurnia, seine Gattin, sah im Traum, wie der Giebel ihres Hauses einstürzte, und wie man ihren Gemahl in ihren Armen erdolchte; zugleich sprangen plötzlich die Türen ihres Schlafgemaches von selbst weit auf.
Teils dieser Dinge wegen, teils weil er sich unwohl fühlte, war er längere Zeit unentschlossen, ob er sich nicht lieber zu Hause halten und das, was er dem Senate vorzutragen beschlossen hatte, vertagen sollte. Endlich aber machte er sich, da ihm Decimus Brutus vorstellte, doch den zahlreich versammelten und bereits längere Zeit auf ihn wartenden Senat nicht vergeblich sitzen zu lassen, etwa um die fünfte Stunde (d. h. zwischen 10 und 11 Uhr vormittags) auf den Weg.
Eine Schrift, die ihm unterwegs von jemandem überreicht wurde, und die eine Anzeige des Verschwörungsplans enthielt, steckte er unter die übrigen Schriften, die er in der Linken hielt, um dieselben später zu lesen. Als er darauf das Opfer hielt und die Opfertiere, trotzdem daß man deren mehrere schlachtete, keine glücklichen Vorzeichen gaben, ging er ohne Rücksicht auf diese religiöse Bedenklichkeit in die Kurie. Dort sah er den Spurinna und bemerkte ihm mit spottendem Lächeln, um ihn als falschen Propheten zu bezeichnen: »des Märzen Idus sind ja ohne Unglück gekommen«, worauf jener warnend erwiderte: »gekommen sind sie, aber noch nicht vorüber.«
[S. 44]So weit Sueton.
Was jeder von den Vorzeichen halten will, etwa dem Weinen der Rosse, das auch Homer von des Achilleus Pferden erzählt, die des Patroklos Tod beweinen, oder Vergil vom Leibroß des Pallas, Shakespeare von denen des Duncan berichtet, ist seine Sache. Solche Geschichten sind besonders in der mittelalterlichen Literatur überaus zahlreich und dürfen nur als dichterische Freiheiten gewertet werden. Unmaßgeblichst vermute ich dagegen, daß die Eingeweideschau und die übrigen Vorzeichen der römischen, wie aber auch etwa der babylonischen Divination, die bestimmte Zeichen ganz bestimmt deutet, nicht Schwindel, sondern Selbsttäuschung ist. Es handelt sich wohl um eine Autosuggestion, wie wir sie beim Prophezeien aus Karten, Kaffeesatz, der Hand usw. antreffen. In Wahrheit dürfte es ein visionäres Schauen des Sehers sein, ein Trancezustand, in den er aber nur auf Grund solcher Zeichen versetzt wird. Wir könnten uns dann den Vorgang etwa so vorstellen, wie den Aberglauben fast aller Schauspieler, die nur aufzutreten wagen, nachdem sie gewisses getan, oder bestimmte Talismane zu sich gesteckt haben. Durch Autosuggestion wird der Schauspieler sonst vom Lampenfieber gelähmt werden, während er sich vermittelst seines Amulettes oder eines bestimmten abergläubischen Spruches in die erforderliche Inspiration leicht versetzt.
Anders liegt hier aber der Fall mit dem Traume Cäsars, sowie dem seiner Gemahlin, und den warnenden Worten des Spurinna am Unglückstage. Der »Freigeist«, d. h. der durch das materialistische Dogma [S. 45]Gebundene, wird keinen Augenblick zögern, das Vorhersehen eines Ereignisses im Traume für Schwindel oder Selbsttäuschung zu erklären. Und das, wiewohl sicher ein außerordentlich hoher Prozentsatz der Menschen von Wahrträumen heimgesucht wird, sich aber aus Furcht, den Spott der Superklugen auf sich zu laden, hütet anderen davon Mitteilung zu machen.
Wir gehen gleich an dieser Stelle auf die Frage der Wahrträume ein, weil wir aller Voraussicht nach, wenn wir uns auch nur etwas mit der Materie beschäftigt haben werden, nicht mehr so ohne weiteres jede historische Überlieferung von Wahrträumen für Aberglauben oder Schwindel erklären werden. Die Analogien der Gegenwart werden uns Gerechtigkeit oder doch mindestens Vorsicht den alten Autoren gegenüber rätlich erscheinen lassen.
Da ist zunächst das Zeugnis des Justinus Kerner, den mancher für leichtgläubig halten mag, dem aber niemand eine Lüge zutraut. Er schreibt in seinen Kindheitserinnerungen:
». . . reine Wahrheit ist, daß ich von dieser Zeit an durch mein ganzes Leben voraussagende Träume behielt, die mir zu einer wahren Qual im Leben wurden, eine Qual, die ich keinem wünsche und die mich gleichsam praktisch kennen lehrte, welch ein Unglück es für den Menschen wäre, hätte ihm Gottes weise Hand die Zukunft nicht verschlossen. Diese voraussagenden Träume finden bei mir gegen Morgen statt, besonders wenn eine schlaflose Nacht mich erst gegen Morgen ruhen und in Schlaf sinken läßt. Sie kamen immer unter Bildern und symbolisch vor. [S. 46]Erscheinen von Licht bedeutet kommende Freude . . .«[18] (S. 242 folgt eine Erklärung der Symbole, z. B. Wasser bedeutet Betrübnis, Schnee und Eis Krankheit, Essen von Trauben oder Beeren Krankheiten usw.).
»Da ich auf das Eintreffen solcher voraussagenden Träume gewiß rechnen kann, so sind sie mir eine wahre Pein im Leben, besonders da ihre Erfüllung oft erst nach drei Tagen stattfindet, doch meist am gleichen Tage des Erwachens aus ihnen.«
Der verstorbene Weltreisende, Professor Dr. Wilhelm Joest, übrigens ein Schulfreund meines Vaters und auch mir persönlich als wahrheitsliebend bekannt, richtete an die Zeitschrift »Sphinx«[19] am 25. September 1886 folgenden Brief:
Sehr geehrter Herr!
Sie werden sich wahrscheinlich wundern, einen Brief von mir zu erhalten, mehr noch, wenn Sie ihn gelesen haben. Sie wissen, daß ich ebensowenig Spiritist wie Bibelchrist bin, und ich hoffe, auch nie eins oder das andere zu werden. Wo es sich aber um Tatsachen handelt, da bin ich Ihr Mann, und wenn heute jemand behauptete, die Stockfische wären Säugetiere und ich wäre – natürlich bona fide – in der Lage, dem Manne mit irgendeinem Faktum unter die Arme zu greifen, ich würde es gewiß tun.
Sie können also von dem Untenstehenden jeglichen Gebrauch machen, ich teile Ihnen nur die Tatsache mit, für die ich voll und ganz einstehe. [S. 47]Ich selbst erfuhr es erst vor vierzehn Tagen, darum teilte ich sie Ihnen nicht früher mit.
Ich hatte Europa 1884 verlassen, bereiste Südafrika, die Ostküste und kam Ende Mai in Aden an, mit der Absicht von dort über die Maskarenen nach Madagaskar, später über Mauritius nach Australien, Südsee usw. zu reisen. Ich war für 2–3 Jahre ausgerüstet. In Aden wurde ich sehr krank. Am 30. Mai schrieb ich in mein Tagebuch: »Es geht zu Ende, Energie weg« usw. Am 3. Juni 1885 entschloß ich mich zur Rückkehr nach Europa und telegraphierte an meinen Vater, den Geheimen Kommerzienrat Eduard Joest in Köln, folgende Worte: Retourne malade gefahrlos. Diese Depesche kam nachmittags in Köln an.
Am Morgen desselben Tages war ein Dienstmädchen meines Vaters, »Tilla« mit Namen, ziemlich aufgeregt zu der Gesellschafterin meines Vaters, Fräulein Anna W. aus R., gekommen und hatte ihr folgendes gesagt: »Fräulein, der Herr Wilhelm ist krank, ich weiß es, ich habe es geträumt. Ich habe geträumt, daß er zurückkommt, ich muß sein Bett machen.« Zwei Stunden später traf meine Depesche ein.
Ich teile Ihnen diese Tatsache mit und enthalte mich jeglicher Bemerkungen.
Obengenannte Tilla ist übrigens durchaus kein irgendwie ätherisches Wesen, sondern eine nicht mehr junge, wohlgenährte, brave und tüchtige Magd – nur behauptet sie, daß das, was sie im Traume sähe, häufig einträfe u. dgl.
Vielleicht interessiert Sie diese Mitteilung.
In vorzüglicher Hochachtung, Ihr ergebenster
Dr. Wilhelm Joest.«
[S. 48]Ich selbst hatte zwar seit dem Frühjahr 1910 einige Male telepathische Erlebnisse räumlicher Art, niemals aber Visionen, Halluzinationen oder ähnliches. Von einem einzigen Wahrtraum kann ich aus persönlicher Erfahrung Zeugnis ablegen. Bevor ich ihn erzähle, möchte ich bemerken, daß ich außerordentlich selten träume oder – in praxi dasselbe – mich des Traumes beim Erwachen erinnere.
Meine »Dinge, die man nicht sagt,« waren eben erschienen – das Buch war am 26. April 1910 ausgegeben worden – ich befand mich begreiflicherweise in einiger Spannung über seine Schicksale. Nicht ob es gelobt oder getadelt würde, was mich völlig kalt läßt, sondern ob es Beachtung finden würde.
Da träumte ich – es war am 18. Mai – ich hätte einen Brief des Verlegers Albert Langen erhalten, der mir eine Neuauflage – 4. und 5. Tausend – der »Dinge« ankündigte. Ich hatte im Traum Langen antelephoniert und gesagt, der Verlag hätte sich wohl verschrieben, da ich viel eher an eine Neuauflage der Kulturkuriosa dachte. Aber Langen hatte mir – im Traume – den telephonischen Bescheid erteilt: der Brief sei inhaltlich völlig richtig, es handle sich um die »Dinge«.
Am Morgen erzählte ich diesen Traum meiner Frau und schrieb ihn überdies nieder. Ich fügte hinzu, daß hier einmal wieder der Wunsch Vater des Gedankens geworden sei.
Da kam – zu meiner größten Überraschung – am 21. Mai ein Brief von Langen mit genau demselben Inhalt und – wie mir schien – auch Wortlaut, wie ich es geträumt hatte. Von den Kulturkuriosa [S. 49]aber – und das erhöht das Merkwürdige des Falles – erschien wider Erwarten die nächste Auflage – das 8. Tausend – erst im November 1910.
Während Träume neutralen oder gar erfreulichen Inhaltes recht selten zu sein scheinen, sind solche tragischer Natur desto häufiger. Sei es, daß es sich um den eigenen Tod handelt, sei es um den naher Angehöriger oder Verwandter.
Da das ja beim Falle Caesars zutreffen würde, so seien nachstehend einige Beispiele angeführt, nicht ohne zu erwähnen, daß Camille Flammarion auf Grund einer Umfrage ein sehr reiches Material über dieses Thema zusammen brachte. Zitieren wir daraus:
»In den letzten Tagen des November 1871 – es war an einem Mittwoch und, wie ich glaube, der 22. – weilte ich bei der mir befreundeten Familie Davidson in New Orleans. Eine Frau Thilton war anwesend und erzählte verschiedene Träume, die sie gehabt und die immer in Erfüllung gegangen waren. Die Anwesenden kannten bereits die Wahrheit ihrer Berichte. Betroffen von einer Erzählung dieser Dame rief nun unser Wirt aus:
»Madame, ich ersuche Sie, ja nicht von mir zu träumen!«
»Zu spät, mein Herr! Erst gestern abend habe ich von Ihnen geträumt.«
Alles bestürmt sie, den Traum zu erzählen.
»Mir hat geträumt, daß ich von heute in sechs Wochen einer dringenden Einladung von Ihnen folgend Sie besuchte.«
»O, der Traum läßt sich leicht verwirklichen, Madame! Ich werde Sie an dem bestimmten Tage [S. 50]zu uns bitten, und Sie, mein Fräulein,« wendete sich der Hausherr zu mir, »werden sicher uns auch die Ehre geben. Welcher Tag ist es?«
Einer der Anwesenden sah im Kalender nach: »Mittwoch, der 3. Januar 1872.«
»Gut, wir wollen alle den Traum von Madame mit erleben!«
»O, bitte, warten Sie, das ist noch nicht alles,« warf Frau Thilton ein, »mir träumte noch,« fuhr die Dame fort, »daß ich beim Eintreten dieses Haus leer und verlassen fände und daß ich Sie vergebens suche. Endlich habe ich in der Mitte des zweiten Salons einen großen Metallsarg gesehen; der Deckel war geschlossen, ich sah weiter nichts, aber ich wußte, daß Sie in dem Sarg liegen.«
Unser Wirt brach in Gelächter aus, ebenso alle Anwesenden, und Herr Davidson sagte scherzend zu seiner Frau: »O, nur keinen Metallsarg, ich mag Metall nicht! Nur einen Sarg aus Palisanderholz bitte ich mir aus.«
Lachend versprach seine Frau, falls sie ihn überleben sollte, seinen Wunsch zu erfüllen.
Frau Thilton fuhr fort: »Ich sah nur einen Menschen im Salon und stellte mich neben ihn. An den Längsseiten des Sargdeckels sah ich sechs silberne Rosen.« Man lachte von neuem über diesen bizarren Sargschmuck; aber Frau Thilton blieb ernst und sagte: »Es hat, selbst im Traum, einen tiefen Eindruck auf mich gemacht.«
Man trennte sich lachend und gab sich ein Stelldichein für Mittwoch den 3. Januar. Noch während der folgenden sechs Wochen wurde der Traum öfters scherzhaft erwähnt.
[S. 51]Am 2. Januar 1872 fiel unser Wirt, Herr Davidson, einem fürchterlichen Zufall zum Opfer: er wurde von einer Lokomotive erfaßt und zermalmt.
Am andern Morgen wurde er in den Sarg gelegt; die Familie wünschte, daß niemand sein entstelltes Gesicht sehe, und ich übernahm die Wache am Sarge und blieb auch, nachdem der Deckel geschlossen worden war, auf meinem Posten.
Frau Thilton kam, der Einladung folgend, in das Haus und fand im zweiten Salon den Sarg und nur mich bei ihm. Sie stellte sich an meine Seite; stumm, ohne uns anzusehen, standen wir bei dem Sarge. Plötzlich berührte sie meinen Arm und deutete auf sechs silberne Rosen, die die Längsseiten des Metallsarges zierten. Ich sah sie fragend an, und sie sagte: »O, erinnern Sie sich nicht? Die sechs silbernen Rosen, die ich genau so in meinem Traum gesehen habe?«
Vierzehn Tage später sagte mir die Witwe: »Erinnern Sie sich jenes außergewöhnlichen Traumes? Alles kam, wie unsere Freundin es vorausgesehen! Bis auf den Sarg! Selbst in meinem Schmerz habe ich seinen Wunsch nicht vergessen!«
Ich war unfähig mich zu verstellen und stammelte: »Aber es war doch ein Metallsarg!«
»Niemals! O mein Gott! Wer hat es gewagt, mir entgegenzuhandeln?«
»Und die sechs silbernen Rosen waren auch auf jeder Seite.«
Meine arme Freundin war ganz erschüttert. Man stellte den Leichenbestatter zur Rede. Ein Palisandersarg war nicht aufzutreiben gewesen und nur ein [S. 52]Metallsarg war in der nötigen Größe vorrätig, so daß man diesen hatte nehmen müssen.
Von den dreizehn Zeugen jenes Traumes leben heute nur noch neun. Die Familie (Calvinisten) würde sehr empört sein, wenn ihr Name mit einem Aberglauben in Verbindung gebracht würde, doch ist sie viel zu ehrlich und wahrheitsliebend, um die Tatsache zu leugnen.
Sara Morgan-Dawson, 36, rue de Varenne.
Paris, 20. Dezember 1901.
Frau Dawson ist seit Jahren mit mir (d. h. Flammarion) bekannt und eine durchaus wahrheitsliebende Dame; da wir alle aber auf unser Gedächtnis nicht schwören können, habe ich die in New Orleans lebende Tochter des Verstorbenen ersucht, mir ihrerseits diese Geschichte mitzuteilen.
Hier die Abschrift ihrer Antwort vom 24. Januar 1902:
»Jawohl erinnere ich mich, wenigstens teilweise, jenes Traumes. Eines Tages, nach dem Diner, erzählte uns Frau Thilton, daß sie im Traum meinen Vater in einem verschlossenen Metallsarg habe liegen sehen. Mein Vater erwiderte damals lachend, Metallsärge seien ihm ein Greuel, und er wolle sich nur in einem Holzsarg begraben lassen. Tatsächlich starb mein Vater am zweiten Tage des neuen Jahres und sein Leichnam wurde in einen Metallsarg gebettet.
Frau Thilton hat dies auch getan[20].«
Ein weiteres Vorkommnis nach Flammarion:
»Am 25. November 1860 waren wir auf der [S. 53]Wasserjagd. Es war vier Uhr nachmittags und unsere Barke näherte sich dem Ufer. Da erwähnte einer meiner Freunde, er habe in der Nacht geträumt, er werde heute im Meer ertrinken.
Ich versicherte ihm, daß wir in zehn Minuten landen würden. Einen Augenblick später kenterte unser Boot und trotz unserer größten Anstrengung ertranken zwei meiner Freunde, darunter der, der seinen Tod vorhergesehen. Sein Bruder ist noch heute Advokat in Havre, wo sich die Katastrophe ereignet hat. (Sie können es auch in den Tageszeitungen von Havre vom 26. November 1860 nachschlagen). E. B. rue de Phalsbourg, Havre[21].«
Ein weiterer Fall nach demselben Gewährsmann:
L. Bouthors, Direkteur des Contributions directes in Chartres schreibt:
»Es war während des Krieges 1870–71; eine Freundin von mir, eine Offiziersfrau in Metz, träumt, daß mein Vater, ein Arzt, den sie sehr liebte und schätzte, an ihr Bett tritt und sagt: »Sehen Sie, ich sterbe jetzt.« Sobald die Festung wieder mit der Außenwelt in Verbindung treten konnte, schrieb mir meine Freundin und beschwor mich, ihr genaue Nachrichten über meine Angehörigen zu geben und ob nicht am 18. September meinem Vater ein Unglück zugestoßen sei. Sie hätte an dem Tag von ihm geträumt. Mein armer Vater war uns tatsächlich am 18. September um 5 Uhr morgens plötzlich durch den Tod entrissen worden.
Als ich im Sommer darauf meine Freundin sah, [S. 54]erzählte sie mir, der Traum hätte sie tief berührt, weil sie kurz vorher von einer ebenfalls in Metz wohnenden Freundin einen ähnlichen Traum gehabt hätte und am Morgen darauf ihren Tod erfuhr[22].«
Mit diesem Fall, der ja rein räumlich-telepatischer Natur ist, haben wir eigentlich den Rahmen unserer Untersuchung schon überschritten. Denn wir beschränken uns ja auf das Fernsehen in der Zeit, ohne auf das im Raume eingehen zu wollen. Nicht weil letzteres etwa zweifelhafter wäre. Im Gegenteil: es gibt viel mehr Menschen, die ähnliche Erfahrungen gesammelt haben. Sie bestreiten zu wollen, wäre geradeso nutzlos und töricht, wie eine Fata morgana oder ein Gewitter zu leugnen, nur weil man es nicht beliebig reproduzieren kann. Wenn wir auf dieses Thema nicht näher eingehen, so geschieht es vornehmlich, um nicht den Umfang des Buches allzusehr anschwellen zu lassen. Und doch ist auch der letztgenannte Fall einschlägig, weil er die Wahrheit des bisweilen im Traume Geschauten beweist. Wir lassen weitere Fälle folgen:
Sehr merkwürdig ist die Erzählung eines österreichischen Oberleutnants von F. von einem Wahrtraum, der zur Zeit der Schlacht bei Wagram spielt.
»Kaum graute der Morgen der denkwürdigen Schlacht von Wagram (5. Juli 1809), als das Regiment, in welchem ich diente, Order erhielt, das vor dem rechten Flügel unserer Position gelegene, vom Feinde besetzte Dorf Großhosten nebst der dort aufgestellten Batterie zu stürmen. Da trat mein Flügelkorporal – [S. 55]Wittenbart hieß der Wackere – zu mir und bat, seine Uhr und Barschaft, das einzige Erbteil der Seinen, womöglich in Sicherheit zu bringen, da er gewiß sei, diesen Morgen zu fallen. Von niemandem als diesem tapferen Krieger, der damals noch in der vollen Kraft seines Lebens stand, hätte mich eine solche Anrede mehr befremden können, da selbst seine Geistesbildung jene seiner meisten Standesgenossen weit übertraf. Natürlich fragte ich vor allem um den Grund einer solchen Besorgnis; folgendes war seine Antwort:
›Sie kennen mich, Herr Oberleutnant, und werden es daher mir glauben, daß ich ohne alle Ängstlichkeit, ermüdet von den gestrigen Strapazen, fest und ruhig bei der Gewehrpyramide meiner Leute einschlief. Da träumte ich, bevor wir geweckt wurden, ein Wesen von himmlischer Schönheit stände vor mir und betrachte mich eine ziemliche Zeit mit unendlichem Wohlgefallen; von einem unnennbaren Gefühle zu ihm hingezogen, streckte ich meine Arme nach ihm aus; da sprach es: »Heute noch wirst du bei mir sein; nimm dies Band als Wahrzeichen!« Und mit diesen Worten hing es mir ein breites rotes Band über die rechte Schulter und Brust; ich erwachte. Sie wissen, daß Furcht und Kleinmut meine geringsten Fehler sind; trotzdem halte ich mich für überzeugt, der heutige Tag sei der meines Todes, und ich bitte daher noch einmal um die Erfüllung meines Wunsches. Die paar Taler übrigens, welche ich zurückbehalten habe, gehören dem Kameraden, welcher mir die Augen zudrücken wird, oder denen, die mich beerdigen.‹
[S. 56]Vergeblich erschöpfte ich alle Vernunftgründe, ihm die Unzuverlässigkeit eines Traumes zu beweisen; der Befehl zum Vorrücken endete meine nutzlosen Bemühungen.
Wir marschierten mit halben Divisionen rechts ab, setzten uns vor dem linken Flügel en colonne und passierten solchergestalt ein seichtes Defilee, welches gegen den Feind ausmündete. Kaum gewahrten die Franzosen unsere Bewegung, als sie ihr schweres Geschütz auf den Ausgang des seichten Hohlwegs richteten und Kugel auf Kugel in unsere Reihen sandten. Wohl niemand wird es mir verargen, wenn meine Augen mehr gegen die feindliche Batterie als irgendanderswohin gerichtet waren; da erblickte ich eine Kanonenkugel, welche rikochettiert hatte und gerade auf mich zuflog. Zur Seite springen und meinen Leuten zurufen: ›Bückt euch!‹ war das Werk eines Augenblickes, und dennoch kam meine Warnung zu spät; mein braver Wittenbart lag – die rechte Brust und Schulter zerschmettert und regungslos – auf dem Boden, mein und sein Nebenmann (ersterer bloß durch die Luft niedergerissen) neben ihm[23].«
Der berühmte Ägyptologe Heinrich Brugsch schreibt in seinen Lebenserinnerungen[24] über einen merkwürdigen Wahrtraum des Khedive im Jahre 1875 folgendes:
»Ich selbst nahm meinen Weg nach Göttingen, um von meiner dort befindlichen Familie Abschied zu nehmen und ohne längeren Aufenthalt die Weiterreise [S. 57]auf einem Bremer Dampfer anzutreten. Im Begriff, nach dem nahgelegenen Bahnhof zu gehen, um den nach Bremen abgehenden Frühzug zu benutzen, erhielt ich auf dem Wege eine Drahtmeldung, die ich sofort öffnete, um ihren Inhalt noch vor der Abreise kennen zu lernen. Sie lautete kurz und bündig: ›Der Khedive ersucht Sie, augenblicklich nach Kairo zurückzukehren.‹ Mit dem nächsten Eilzuge schlug ich die Richtung nach Triest ein, um mit dem fälligen Lloyddampfer mich nach Ägypten zurückzubegeben. Ich hatte seit meiner Abreise keine Zeitung gelesen und mußte nicht wenig überrascht sein, als mir von dem Kommandanten des Schiffes die Nachricht mitgeteilt wurde, daß auf dem letzten Bremer Dampfer, demselben, mit welchem ich die Reise antreten wollte, eine von einem Amerikaner namens Thomas konstruierte Höllenmaschine vorzeitig explodiert sei und mehrere Reisende und sonstige Personen getötet und verwundet habe. Ich dankte Gott im stillen, einer möglichen Gefahr für Leib und Leben durch meine Rückberufung entgangen zu sein, und stellte mich bei meiner Ankunft in Kairo sofort dem Vizekönig vor. In der Meinung, von ihm nachträglich besondere Aufträge zu erhalten, die er mir nur mündlich mitteilen könne, war ich nicht wenig erstaunt, aus seinem Munde die Versicherung zu erhalten, er sei hoch erfreut, mich heil und gesund zu sehen, habe mir aber durchaus nichts zu sagen. Er habe sich bewogen gefühlt, mich sofort durch den Draht zurückzuberufen, da in der Nacht ein Traumbild ihm angeraten habe, mich sofort kommen zu lassen, widrigenfalls mir ein großes Unglück bevorstünde.«
[S. 58]Nachstehend noch ein weiteres Beispiel für die Erfüllung eines Traumes:
»Mein ältester Bruder, Emile Zipelius, Maler, starb am 16. September 1865 im Alter von 25 Jahren, indem er in der Mosel ertrank. Er wohnte in Paris, war aber bei seinen Eltern in Pompey bei Nancy zu Besuch. Meine Mutter hatte zweimal in ziemlich langen Zwischenräumen geträumt, daß ihr Sohn ertrunken sei. Als der Überbringer der schrecklichen Nachricht zu meinen Eltern kam, vermutete meine Mutter gleich ein Unglück und fragte zuerst nach einer abwesenden Tochter, von der sie seit längerer Zeit keine Nachricht hatte. Als man ihr sagte, es handle sich nicht um ihre Tochter, rief sie aus: »O, fahren Sie nicht fort, ich weiß was geschehen ist; mein Sohn ist ertrunken!« Denselben Tag noch hatten wir einen Brief von ihm erhalten.
Mein Bruder selbst hatte kurz vorher zu seiner Hausfrau gesagt: »Wenn ich eines Abends nicht nach Hause komme, so gehen Sie am nächsten Morgen in die Morgue. Ich habe das Gefühl, daß ich im Wasser sterben werde. Mir träumte, ich läge tot und mit offenen Augen am Grund des Flusses.«
In der Tat hatte man ihn so gefunden, er war infolge eines Schlagaderbruchs im Wasser beim Baden gestorben. Meine Mutter und mein Bruder glaubten fest an ihre Vorahnung. An dem Tage seines Todes wollte er nicht schwimmen gehen, gegen Abend aber verlockte ihn die Kühle des Wassers und wir verloren ihn zu unserm größten Schmerz.«
J. Vogelsang-Zipelius, Mühlhausen i. E.[25]
[S. 59]Endlich wollen wir einen Eideshelfer anrufen, an dessen Glaubwürdigkeit wohl niemand zu zweifeln wagen wird und der ein Ereignis berichtet, das an Bedeutung dem Traume der Calpurnia in nichts nachsteht: Bismarck!
Der greise Heldenkaiser Wilhelm I. machte dem großen Kanzler am 18. Dezember 1881 Mitteilung von einem besonders lebhaften Traume, der eine Reichstagsverhandlung zum Gegenstande hatte. Bismarck antwortete darauf am gleichen Tage u. a. folgendes:
»Euer Majestät Mitteilung ermutigt mich zur Erzählung eines Traumes, den ich Frühjahr 1863 in den schwersten Confliktstagen hatte, aus denen ein menschliches Auge keinen gangbaren Ausweg sah. Mir träumte, und ich erzählte es sofort am Morgen meiner Frau und anderen Zeugen, daß ich auf einem schmalen Alpenpfad ritt, rechts Abgrund, links Felsen; der Pfad wurde schmaler, so daß das Pferd sich weigerte, und Umkehr und Absitzen wegen Mangel an Platz unmöglich; da schlug ich mit meiner Gerte in der linken Hand gegen die glatte Felswand und rief Gott an; die Gerte wurde unendlich lang, die Felswand stürzte wie eine Coulisse und eröffnete einen breiten Weg mit dem Blick auf Hügel und Waldland wie in Böhmen, preußische Truppen mit Fahnen und in mir noch im Traume der Gedanke, wie ich das schleunig Eurer Majestät melden könne. Dieser Traum erfüllte sich, und ich erwachte froh und gestärkt aus ihm[26].«
[S. 60]Also ein Vorgesicht der drei Jahre später Wirklichkeit werdenden Ereignisse in Böhmen und des Krieges um die Hegemonie mit Österreich!
Die angeführten Fälle, die sich natürlich ins Endlose vermehren lassen, sollen keineswegs beweisen, daß Caesar oder seine Gattin wirklich die Ermordung geträumt haben. Wenn die Überlieferung auch gut ist, so läßt sich das doch heute nicht mehr mit unanfechtbarer Sicherheit feststellen. Was sie aber beweisen sollen, ist, daß der Traum uns gar nicht so selten ein bevorstehendes Unglück enthüllt. Wenn mancher Leser dieses Buches durch die wenigen angeführten Beispiele auch zu nichts anderem bewogen wird, als dazu ähnliche Überlieferungen nicht ohne Prüfung als Unsinn abzulehnen, so ist damit für den weiteren Gang der Untersuchung schon manches gewonnen.
Nun gibt es aber außer partiellen Enthüllungen der Zukunft durch den Traum auch noch Vorahnungen anderer Art, die ebenfalls zumeist den eigenen Tod, oder den naher Angehöriger zum Gegenstande haben. Von ihnen einige Beispiele anzuführen, scheint um so mehr am Platz, als wir später noch wiederholt ähnlichen, historisch gut beglaubigten Vorkommnissen begegnen werden.
»Ein junges Mädchen aus der Gegend von Nancy, 18 Jahre alt, wurde oft von ihren Angehörigen eingeschläfert. In einen Zustand von Somnambulismus geraten, wiederholte sie bei jeder neuen Sitzung, daß eine nahe Verwandte, die sie mit Namen nannte, noch vor dem 1. Januar sterben würde. Es war im November 1883. Ihre Beharrlichkeit veranlaßte den [S. 61]Familienvater, eine Lebensversicherung von 10 000 Franken für jene Dame, die übrigens ganz gesund war, aufzunehmen. Um das nötige Geld aufzutreiben, schrieb er an Herrn M. L. mehrere Briefe und teilte ihm in einem das Motiv seiner Handlungsweise mit. Herr L. bewahrte diese Briefe als unwiderleglichen Beweis für die Möglichkeit der Vorhersage zukünftiger Ereignisse und hat sie mir gezeigt. Da man sich über die Zinsen nicht einigen konnte, ließ man die Angelegenheit fallen. In der Tat starb die in Frage stehende Dame am 31. Dezember, und der am 2. Januar an Herrn L. gerichtete letzte Brief übermittelt diese Nachricht[27].«
Ein merkwürdiges Beispiel einer Ahnung erzählt Jung-Stilling[28] vom Professor der Mathematik Böhm, einer keineswegs schwärmerischen Natur, was ja schon der Beruf vermuten läßt.
»Er war einmal an einem Nachmittag in einer angenehmen Gesellschaft bei einer Tasse Tee und einer Pfeife Tabak recht vergnügt, ohne über irgend etwas nachzudenken, als er auf einmal eine Anregung im Gemüt empfindet, nach Hause zu gehen. Da er nun nichts zu Hause zu tun hatte, so sagte ihm sein mathematischer Verstand, er solle nicht nach Hause gehen, sondern bei der Gesellschaft bleiben. Indessen wurde die innere Aufforderung immer stärker und dringender, so daß endlich jede mathematische Demonstration erlag, und Böhm seinem inneren Trieb [S. 62]folgte. So wie er auf sein Zimmer kam und sich umsah, aber nichts Besonderes entdecken konnte, fühlte er eine neue Anregung in seinem Inneren, das Bett, worinnen er schlief, müsse von da weg und in jene Ecke gebracht werden. Auch hier räsonierte seine Vernunft und stellte ihm vor, das Bett habe ja immer da gestanden, überdem sei das ja auch der schicklichste Platz und jener der unschicklichste, allein das alles half nicht, die Aufforderung ließ ihm keine Ruhe, er mußte die Magd rufen, welche nun das Bett an die verlangte Stelle rückte; hierauf wurde er ruhig im Gemüt, er ging weiter zur Gesellschaft und empfand nichts mehr von jenen Anregungen. Er blieb auch zum Abendessen bei der Gesellschaft, ging gegen zehn Uhr nach Haus, dann legte er sich in sein Bett und schlief ganz ruhig ein. Um Mitternacht weckte ihn ein schreckliches Krachen und Poltern, er fuhr aus dem Bett auf und sah nun, daß ein schwerer Balken mit einem großen Teil der Zimmerdecke gerade da niedergefallen war, wo vorhin das Bett gestanden hatte. Jetzt dankte Böhm dem barmherzigen Vater der Menschen, daß er ihn so gnädig hatte warnen lassen.«
Die rationalistische Erklärung oder, besser gesagt, der rationalistische Erklärungsversuch dieser merkwürdigen Vorahnung wird annehmen, daß der brüchige Balken in der vorigen Nacht bereits gekracht habe. Das habe Böhm im Schlaf gehört und aus diesem Dämmerzustande nur das Denkresultat, daß er das Bett von dieser gefährlichen Stelle fortschaffen müsse, ins Wachen gerettet.
Möglich, daß der Erklärungsversuch das Richtige [S. 63]trifft. Sicher ist, daß wir bei der folgenden Geschichte damit nicht auskommen.
Frau von Beaumont erzählt folgende Begebenheit[29]:
»Meine ganze Familie besinnt sich noch auf einen Zufall, vor dem mein Vater durch Hilfe der Ahnung in seiner Jugend bewahrt wurde. Das Fahren auf dem Fluß ist eine der gewöhnlichen Vergnügungen der Einwohner der Stadt Rouen in Frankreich. Auch mein Vater fand an diesen Spazierfahrten ein großes Vergnügen und er ließ wenige Wochen vorbeigehen, ohne daß er dasselbe genoß. Er vereinigte sich einstmals mit einer Gesellschaft zwei Meilen weit von Rouen nach Port St. Quen zu fahren. Man hatte ein Mittagsmahl und Instrumente ins Schiff gebracht und alles zu einer angenehmen Fahrt vorbereitet. Als es Zeit war aufzubrechen, stieß eine von den Tanten meines Vaters, welche taubstumm war, eine Art von Geheul aus, stellte sich an die Tür, versperrte sie mit ihren Armen, schlug die Hände zusammen und gab durch Zeichen zu verstehen, daß sie ihn beschwöre, er möchte zu Hause bleiben. Mein Vater, der sich von dieser Spazierfahrt viel Vergnügen versprochen hatte, trieb nur seinen Spott mit ihren Bitten, allein das Frauenzimmer fiel ihm zu Füßen und äußerte eine so heftige Betrübnis, daß er sich endlich entschloß, ihren Bitten nachzugeben und seine Lustfahrt auf einen andern Tag zu verschieben. Er bemühte sich daher, die andern auch zurückzuhalten und bat sie [S. 64]seinem Beispiel zu folgen, allein man lachte über seine Nachgiebigkeit und reiste ab. Kaum hatte das Schiff die Hälfte des Weges zurückgelegt, so bekamen diejenigen, die sich darin befanden, die größte Ursache zur Reue, daß sie ihm nicht gefolgt hatten. Ihr Schiff riß voneinander, viele kamen dabei ums Leben, und diejenigen, die sich durch Schwimmen retteten, wurden von dem Schrecken, der sie dabei überfallen hatte, in die äußerste Lebensgefahr gestürzt.«
Zum Schluß folgende Zeitungsnotiz:
»Der Jugendschriftsteller Boussénard, der in Frankreich, wo er für den Erben Jules Vernes gilt, bekannt und beliebt ist, ist letzten Sonntag gestorben. Er fühlte seinen Tod herannahen und verfaßte selbst seine Todesanzeige, die folgendermaßen lautet: ›Louis Boussénard, Schriftsteller, beehrt sich, Sie zu seinem bürgerlichen Leichenbegängnis einzuladen, das Montag, den 12. September (1910) nachmittags, stattfindet. Untröstlich über den Tod seiner Frau, erliegt er in seinem 63. Lebensjahre einem Schmerz, den nichts hat lindern können. Sein letzter Gedanke gilt seinen zahlreichen Freunden und treuen Lesern. Man versammelt sich im Sterbehaus, um den Leichenzug bis zum Bahnhof zu geleiten, von wo der Zug um zwölf Uhr abgeht.‹ – Der Tod trat ein, wie Boussénard es erwartete, und die Anordnungen, die er für die Beerdigung getroffen hat, konnten, was die Zeitangaben betrifft, buchstäblich befolgt werden[30].«
Kehren wir nach diesem Exkurs zu Caesar zurück!
Die Art der Überlieferung nicht minder, als – das [S. 65]bezeugten unsere Beispiele – ihr Inhalt, würden uns berechtigen, Suetons Erzählung Glauben zu schenken. Im übrigen möge das jeder nach Gefallen tun. So viel ist aber sicher, daß Caesar, wäre er dem Übersinnlichen weniger abgeneigt gewesen, den warnenden Stimmen Gehör geschenkt hätte. Dann würde der größte Staatsmann der Geschichte, dessen Eigenname zur höchsten Standesbezeichnung der Menschheit wurde, wohl kaum unter den Dolchen von Mördern haben verbluten müssen.
Sueton erzählt noch von anderen Wahrträumen, bzw. ähnlichen Vorzeichen in seinem Leben des Augustus, der im Gegensatz zu seinem großen Onkel sehr geneigt war, ihnen Glauben zu schenken.
Wir begegnen hier dem einfältigsten Aberglauben. Etwa wenn Augustus, wenn man ihm den linken Schuh statt des rechten anzog, das als ungünstige Vorbedeutung nahm, oder wenn starker Taufall seine Entscheidungen beeinflussen konnte. Daneben finden wir auch den Glauben an Vorzeichen von größerer Bedeutung (Kap. 93). Damit ist nicht nur gesagt, daß er seltene Naturereignisse, wie das ja in einer Zeit, die dem Wesen der Natur noch sehr fern steht, gang und gäbe ist, auf sich deutete, sondern daß er auch echten Weissagungen Glauben schenkte.
Sueton erzählt im 94. Kapitel der Biographie[31]: »Atia träumte kurz vor ihrer Niederkunft, daß ihre Eingeweide gen Himmel flögen und sich dort über den ganzen Umfang von Himmel und Erde ausbreiteten. [S. 66]Auch Augusts Vater, Octavius, träumte, daß aus dem Schoße der Atia der Strahlenkranz der aufgehenden Sonne sich erhebe. Am Tage seiner Geburt, wo gerade über die Verschwörung Catilinas in der Kurie verhandelt wurde, und Octavius wegen der Niederkunft seiner Frau etwas zu spät in die Sitzung kam, steht es als eine allbekannte Tatsache fest, daß Nigidius Figulus[32], als er die Ursache der Verzögerung und zugleich die Stunde der Geburt selbst vernahm, den Ausspruch getan hat: In dieser Stunde sei dem Erdkreis der Herr geboren. Die gleiche Versicherung erhielt Octavius später, als er bei seinem Heerzug durch Thraziens Öden in einem Haine des Liber pater das dortige thrazische Orakel über seinen Sohn befragte, von den Priestern, weil, als er den Wein über den Altar goß, eine Flamme aufschlug, die über das Tempeldach hinaus bis zum Himmel aufstieg: ein Wunderzeichen, das, wie die Priester sagten, ähnlich nur allein noch dem großen Alexander, als er an denselben Altären opferte, zuteil wurde. Gleich in der darauf folgenden Nacht sah er denn auch seinen Sohn in übermenschlicher Größe mit Blitz und Zepter, sowie mit den Prachtgewändern des Olympischen Jupiter und einer Strahlenkrone angetan, hoch thronend auf einem lorbeerbekränzten Wagen, den zweimal sechs glänzend weiße Rosse zogen.«
Halten wir hier inne.
Was zunächst das thrazische Orakel betrifft, so werden wir – wenn die Überlieferung überhaupt auf Wahrheit beruht – recht mißtrauisch sein. Wer mit [S. 67]Heeresmacht Auskunft über die Zukunft heischt, wird in 99 von 100 Fällen eine günstige erhalten. Und wenn eine Flamme gen Himmel schlug, so liegt die Vermutung nahe, daß die schlauen Priester hier einen Taschenspielertric sich leisteten.
Die mitgeteilten Träume sind an sich durchaus möglich. Wenn wir uns gegen sie skeptisch verhalten, so ist ihre Häufung daran schuld. Gewiß kommt es vor, daß zwei dasselbe träumen, und wenn es sich um Ehegatten handelt, die beide nicht nur einen Sohn, sondern auch einen berühmten und tüchtigen Sohn erhoffen, so ist es ganz und gar nicht unwahrscheinlich, wenn ihnen der Traum verlockende Bilder über seine Zukunft vorgaukelt. Das ereignet sich alle Tage bei ungezählten Elternpaaren. Da hier aber der Wunsch unbedenklich für die Vaterschaft des Traumes haftbar gemacht werden kann, da ferner auch Millionen träumender Eltern nur ein Weltherrscher trifft, so werden wir, auch wenn wir der Überlieferung keinen Zweifel entgegensetzen, uns doch sehr hüten müssen, hier einen Beweis für unsere Behauptung von der Existenz der Wahrträume zu suchen. Bei Cäsar war der Fall ganz anders gelagert. Meuchelmord hofft man nicht, sondern man fürchtet ihn. Da zudem die Ermordung des Staatsoberhauptes in Rom ein ganz unerhörter Fall war, so kann man auch mit Zufall hier nicht wohl operieren. Zum Belege dafür, daß bei Eheleuten Doppelträume vorkommen, sei folgender Fall mitgeteilt:
»Als im Junius des Jahres 1812 mein zweiter Sohn, Karl, ein Knabe von früh entwickeltem Talente und hoher Herzensgüte, in seinem neunten Lebensjahre [S. 68]so gefährlich krank darnieder lag, daß der Gedanke an seinen möglichen nahen Verlust bisweilen düster durch meine und meiner Gattin Seele fuhr, wagten wir es, aus gegenseitiger Schonung, dennoch nicht, das wahrscheinliche baldige Hinscheiden des holden Kindes laut auszusprechen. Wir beweinten, oft von dem lieben Kranken getröstet, unser Los im stillen. In der Nacht vom 17.–18. Junius hatte ich folgenden, mir unvergeßlichen Traum: Ich führte meinen Karl auf einer blühenden Aue an der Hand, er schritt freudig rasch einher und sah mich lächelnd an: ›Wie?‹ rief ich froh, ›du kannst wieder gehen, lieber Karl?‹ (Schon seit mehreren Monaten war ihm dies unmöglich gewesen). Kaum hatte ich ausgeredet, so erblick’ ich einen großen prächtigen Palast vor mir, der Knabe reißt sich von mir los und eilt in jenen Palast. ›Ach,‹ sprach ich, ›du wirst mich doch nicht verlassen?‹ Ich versuche es, ihm nachzueilen und kann nicht von der Stelle. In dem schmerzhaftesten Gefühl erwach’ ich. Schlaf und Ruhe waren verschwunden.
Um meine Gattin nicht zu betrüben, verschwieg ich ihr diesen leicht zu deutenden Traum. Indessen sitzen wir am Abend desselben Tages noch spät in einer wehmütigen Stimmung zusammen. Wir reden von unserm kranken Lieblinge, mein Herz war zu voll, und zum ersten Male spreche ich meine bange Besorgnis um sein Leben aus. Endlich erzähle ich auch, mit pochender Brust, den in der letzten Nacht gehabten Traum. Aber noch kaum habe ich die Erzählung geendigt, so tat meine Gattin einen lauten Schrei und ruft unter heißen Tränen aus: ›Mein Gott, [S. 69]denselben Traum habe ich ja auch in der letzten Nacht geträumt!‹ Sie ruft sogleich unser Dienstmädchen in das Zimmer und läßt es ihren eigenen Traum erzählen, den sie ihm gleich am Morgen mitgeteilt, aber auch verboten hatte, ihn mir zu erzählen. Ich fühlte mich tief ergriffen, aber auch das Mädchen wußte sich kaum zu fassen, als es nachher den meinigen erfuhr. Nur im Ausgange des Traums fand eine kleine Verschiedenheit statt.
Meiner Gattin träumte: Sie und ihr Mädchen führten unsern Knaben auf einer blühenden Aue an der Hand. Er ging freudig-rasch, blickte seine Führerinnen lächelnd an; beide verwundern sich seines raschen Ganges. Auf einmal erblickten sie einen großen prächtigen Palast vor sich. Der Knabe reißt sich von ihnen los und eilt hinein. Beide eilen ihm nach, finden in dem Palaste eine außerordentlich große Menschenmenge, durchsuchen unter Tränen mehrere Säle und finden den Knaben nicht. ›O Gott, was wird mein Mann sagen, daß wir unsern Karl verloren haben?‹ ruft meine Gattin trostlos aus und – erwacht.
Leider bewährten sich die Worte des Ennius (beim Cicero, de divinat. II, 61) ›aliquot somnia vera!‹ Drei Tage nach diesem merkwürdigen Doppel-Traum entschlief unser Liebling sanft, unter unsern Küssen und Zähren. Auch hier war ›ein Bund des Traumes mit dem Wachen!‹ (Jean Pauls Herbstblumen, 2. Bändchen, S. 275) – aber wir hatten die trübe Wirklichkeit nicht sowohl nach, als vorgeträumt! –
Marburg.
D. Justi[33].«
[S. 70]Es handelt sich also um ein Erlebnis des berühmten Theologen Karl Wilhelm Justi (geb. 1767 gest. 1846), an dessen Wahrheit zu zweifeln wohl niemand den Mut haben wird.
Wenn wir auch Gedankenübertragung annehmen – was ja immerhin räumliche Telepathie voraussetzt und damit bereits das Wichtigste, eine Übertragung äußerer Eindrücke ohne Vermittlung der Sinne einräumt – so genügt das nicht. Daß die Sorge die Eltern auch nicht nachts verläßt und sich in Träumen äußert, ist gewiß natürlich. Sehr merkwürdig aber die symbolische Einkleidung. Es liegt hier zweifellos ein noch nicht näher ergründetes Phänomen der Prophetie vor. Dazu kommt, daß schon nach drei Tagen die Erfüllung sich einstellt.
Bedeutungsvoller als die Träume von Augustus’ Eltern sind die Worte des Nigidius Figulus. Über seine Prophezeiung sind wir durch Dio Cassius[34] unterrichtet. Er schreibt:
»Kaum war der Knabe geboren, so prophezeite ihm der Senator Nigidius Figulus die Alleinherrschaft. Unter allen seinen Zeitgenossen verstand sich dieser am besten auf die Sternkunde und die Konstellation und wußte, was jedes Gestirn einzeln oder in Konjunktion oder Opposition mit andern für einen Einfluß übte; deshalb sagte man ihm auch nach, daß er sich mit geheimen Künsten befasse. Als dieser sah, daß Octavius (wegen der Geburt seines Kindes) etwas später in die Kurie kam (es wurde gerade Senat gehalten), trat er ihm entgegen und fragte ihn, [S. 71]warum er so spät komme. Als er ihm die Veranlassung nannte, so rief er aus: du hast uns einen Herrn gezeugt! Octavius, darüber bestürzt, wollte das Kind töten lassen; er aber hielt ihn davon ab, indem er sagte: es wäre nicht möglich, daß dem Kinde etwas der Art widerführe.«
Sueton erzählt im 94. Kapitel von einem anderen Horoskop, das dem Augustus der Astrolog Theogenes gestellt hatte, und zwar als jungem Manne. Als er dem Astrologen seine Geburtsstunde nannte, da soll Theogenes aufgesprungen und ihm verehrend zu Füßen gefallen sein. Seitdem hatte Augustus großes Vertrauen auf seinen Stern und ließ auch einst eine Münze mit dem Bild des Steinbockes, unter dem er geboren war, prägen.
Was nun die Glaubwürdigkeit von diesen Berichten – die wir nur im Auszug wiedergeben – betrifft – so mag man sagen: ein Mann, der so einfältiges Zeug erzählt, wie etwa, daß Augustus als kleines Kind den Fröschen geboten hätte zu schweigen, was zur Folge hatte, daß sie in dieser Gegend noch zur Zeit Suetons nicht quakten, verdient keinen Glauben.
Das gehört zu jenen logischen Schnitzern, an denen unsere Hyperkritik nur allzu reich ist.
Wenn es auch heißt: »wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht«, so ist das Sprichwort doch klug genug zuzugeben, daß auch ein Lügner die Wahrheit reden kann. Daß man ihm dann nicht glaubt, ist ein Fehler der Zuhörer.
Nun ist aber Sueton nichts weniger als ein Lügner, [S. 72]wenn er auch leichtgläubig sein mag und häufig unkritisch alles wiedererzählt, was er von mancherlei Leuten gehört hat. Er ist so wenig ein Lügner, wie unsere offiziellen Hyperkritiker es sind, wenn sie die Möglichkeit der Weissagung oder anderer nicht alltäglicher Begebenheiten leugnen. Man könnte daraus ja auch mit gleichem Rechte folgern, daß alles, was sie für unglaublich erklären, doch glaubwürdig sei. Ein Denkfehler, der nicht um ein Haar geringer ist, als wollte man alle Berichte des Sueton über ungewöhnliche Dinge lediglich deshalb ablehnen, weil er, wie wir auf Grund unserer heutigen Naturkenntnis wissen, auch Unmögliches im guten Glauben überliefert.
Gibt es etwas Natürlicheres, als die Anschauung, ein so großer Mann wie Augustus müßte auch anders als ein gewöhnlicher Sterblicher in die Welt eintreten und durch sie wandeln? Dieser stillschweigenden Voraussetzung ist es doch allein zuzuschreiben, daß man Plato so gut wie Alexander, Buddha oder Christus zu Söhnen Gottes stempelte. So wenig es uns aber deshalb einfällt, in Bausch und Bogen alles zu verwerfen, was von diesen Geisteshelden überliefert ist, so wenig dürfen wir das etwa vom Bericht des Sueton tun.
Während früher die Tendenz durch die Geschichtschreibung ging – besonders ausgeprägt finden wir sie in der mittelalterlichen Heiligenliteratur –, daß ein geistig oder sittlich großer Mann auch über außergewöhnliche Kräfte verfüge, Wunder wirken könne, läßt sich gegenwärtig die entgegengesetzte feststellen. Das hängt nicht allein mit den Fortschritten [S. 73]der Naturwissenschaften zusammen, es hat, wie schon in der Einleitung angedeutet, auch einen politischen Grund: die Demokratisierung unserer Denkweise hält es mit ihren Dogmen nicht für vereinbarlich, daß irgend jemand eine besondere Stellung einnimmt.
Im übrigen liegt es uns fern, uns im einzelnen für die Wahrheit oder Glaubwürdigkeit dieser Erzählungen zu erhitzen. Uns genügt der Nachweis, daß es sich ganz und gar nicht um Unmögliches, ja noch nicht einmal besonders Seltenes handelt und daß man gut tut, die Berichterstatter solcher Phänomene nicht ohne weiteres abzulehnen.
Indem wir es jedem Leser anheimstellen, davon zu glauben oder nicht zu glauben, so viel ihm beliebt, unterlassen wir nicht zu bemerken, daß Sueton wohl bei jedem Herrscher von Träumen, Vorzeichen oder ähnlichem zu erzählen weiß. Mag das auch gewiß bei flüchtiger Betrachtung seine Glaubwürdigkeit herabsetzen, so läßt sich nicht leugnen, daß der Grund hierfür zumeist bei uns selber liegt. Die Zahl der Selbstbiographien – auch von sehr nüchternen Leuten – in denen der Verfasser von übersinnlichen Erlebnissen erzählt, ist auch heute noch, trotz des entgegenstehenden Modedogmas und trotz des leichten Risikos, das jeder, der Übersinnliches von sich erzählt, läuft, sehr groß. Fast jeder hat – das ist heute genau so, wie in der fernsten Vorzeit – in seinem Leben irgendwelches Erlebnis gehabt, das er sich nicht oder nur durch Zufall, was das Gleiche ist, erklären kann. Früher achtete man darauf, heute tut man es nicht mehr. Das ist der [S. 74]Unterschied. Früher mag man sein Sinnen und Trachten so sehr auf Vorzeichen und Ähnliches gerichtet haben, daß die Phantasie manchen bösen Streich spielte. Heute hält man für einen Lügner oder Phantasten jeden, der wahrheitsgemäß etwas berichtet, was nicht jeden Tag passiert. In beiden Fällen ist der Aberglaube fast der gleiche; nur das Objekt hat gewechselt.
Doch genug vom Altertum. Leicht ließe sich noch mehr Material beibringen. Für unsere Zwecke genügt das Gesagte und wir wollen uns in einem neuen Kapitel dem Mittelalter und der Neuzeit zuwenden.
[7] Vgl. zu Nachstehendem H. Graetz, Geschichte der Juden, 1. Bd., Leipzig 1874, S. 372 ff., worauf mich aufmerksam zu machen Herr Rabbiner Dr. C. Werner die Freundlichkeit hatte.
[8] Otto Pfleiderer, Die Entstehung des Christentums, München 1905, S. 191 ff. und 291.
[9] Josef Merkt, Die Wundmale des heiligen Franz von Assisi. Leipzig und Berlin 1910, besonders S. 65 ff.
[10] in Saturnalibus I. 23.
[11] II, 37. Übersetzung von J. D. Heilmann, Neuausgabe von Otto Güthling, Reclams Universalbibliothek S. 167 f.
[12] Pausanias kennt nur ein einziges bei Herodot (VI, 66) erzähltes Beispiel von Bestechung eines Orakels (Pausanias III, 7).
[13] Vgl. Paulys Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, 2. Aufl., 8. Hlbd., Artikel Delphoi, S. 2533, und O. Gruppe, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte II, S. 928, in J. v. Müllers Klassischer Altertumswissenschaft V, 2, 2, sowie Ed. Döhler, Die Orakel, Berlin 1872, eine nachstehend wiederholt benutzte Studie, und Erwin Rohde, Psyche, besonders S. 112 ff., 313 f. und 344 ff. Bouché-Leclerq, Histoire de la divination dans l’antiquité, Paris 1879/81, war mir nicht zugänglich.
[14] Unter Trance versteht man einen der Hypnose ähnlichen Zustand. Trance tritt in sehr verschiedenen Intensitätsgraden auf, doch kann es nicht unsere Aufgabe sein, hier näher darauf einzugehen. Als vortreffliche Einführung in die okkulten Wissenschaften sei Ludwig Deinhard, Das Mysterium des Menschen im Lichte der psychischen Forschung, Berlin 1910, empfohlen.
[15] Cicero, de Divinatione, I, 19.
[16] Viele Orakelsprüche bei R. Hendess Oracula Graeca, Halle a. S. 1877.
[17] Übersetzung von Adolf Stahr in Langenscheidts Bibliothek, 2. Aufl., S. 97 f.
[18] Justinus Kerner, Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit. Erinnerungen aus den Jahren 1786–1804. 2. Aufl. Stuttgart 1886. S. 240 f. Die nächste Stelle auf S. 243.
[19] Vgl. »Sphinx« 3. Bd. 1887. S. 62.
[20] Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, Stuttgart 1909, S. 374 ff.
[21] Eb. S. 385, Brief Nr. 194.
[22] Eb. 28. Brief, p. 295, Nr. II.
[23] Justinus Kerner, Magikon, III. Bd., S. 568.
[24] Mein Leben und mein Wandern, Berlin 1894, S. 330 f.
[25] Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, S. 384 f., 127. Brief.
[26] Otto Fürst von Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, 2. Bd. Stuttgart 1898, S. 194.
[27] Nach Dr. Liébaut, Thérapeutique suggestive, zitiert nach Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, S. 408.
[28] Heinrich Jung, genannt Stilling, Theorie der Geisterkunde, 1808, S. 78 f.
[29] Jung-Stilling, Theorie der Geisterkunde, S. 84, übernommen aus dem »Museum des Wundervollen«, 2. Bd., 2. Stück, S. 152.
[30] Münchener Neueste Nachrichten, 1910, Nr. 441.
[31] Übersetzung von Adolph Stahr, Langenscheidtsche Bibliothek, Sueton, 106. Bd., S. 191. Eine Anzahl historischer Träume hat Kleinpaul im Magazin für die Literatur des In- und Auslandes, 1886, Nr. 16 und 17, zusammengestellt.
[32] Nigidius Figulus war ein sehr gelehrter Mann, Senator, großer Astronom und Astrolog und Freund des Cicero.
[33] Vgl. (Vulpius) »Curiositäten«, 5. Bd., Weimar 1816, S. 274 ff.
[34] 45, 1. Übersetzung der »Römischen Geschichte« von L. Tafel, Stuttgart 1837.
[S. 75]
Ist schon die Literatur des klassischen Altertums reich an mehr oder minder beglaubigten übersinnlichen Phänomenen, so gilt dies noch weit mehr von der des Mittelalters. Das Altertum hat zweifellos die Kritik häufig vermissen lassen, was freilich bei dem damaligen Stande der naturwissenschaftlichen Kenntnisse nicht verwunderlich ist. Das christliche Mittelalter ging darin, gemäß dem allgemeinen Kultursturze, noch viel weiter. Kann man sagen: die Antike berichtet manches Unglaubwürdige, wiewohl es unglaubwürdig oder gar unmöglich ist, so mag es vom christlichen Mittelalter heißen: gerade weil etwas unmöglich scheint, wird es erzählt und geglaubt.
Besonders die umfangreiche Literatur der Heiligengeschichten bringt es mit sich, daß nach Außerordentlichem geradezu gefahndet wird. Noch heute findet die Kirche es zur Heiligsprechung erforderlich, daß der also Ausgezeichnete auch »Wunder« gewirkt [S. 76]habe. Noch heute gilt das sacrificium intellectus, das kritiklose Glauben selbst an den haarsträubendsten Blödsinn für verdienstvoll.
Ist es da erstaunlich, wenn eine Zeit, die zur allgemeinen Kritiklosigkeit infolge mangelnder Naturkenntnis noch die Sucht, möglichst viele und möglichst verblüffende Wunder verzeichnen zu können, hinzufügt, an Wust, Unsinn und wildesten Phantasmagorien alles je Dagewesene in den Schatten stellt?
Damit ist aber keineswegs gesagt, daß nun alles, was berichtet wird, weil es uns erstaunlich scheint, auch falsch sein müßte. Die »voraussetzungslose« Forschung der Gegenwart macht es sich sehr bequem, wenn sie alles ablehnt, was sie noch nicht erklären kann. Und doch sollte sie gelernt haben, daß dieses negative Verhalten nicht viel unkritischer ist, als das der verspotteten Vorzeit.
Heute wissen wir, daß es tatsächlich Stein- und Fischregen gab und noch gibt, wir wissen, daß die »blutige« Hostie weniger auf einem Fehler der Beobachtung, als der Interpretation des Beobachteten beruht. Wir wissen ferner, daß eine große Zahl von Phänomenen, die noch vor wenigen Jahrzehnten einfach geleugnet wurden, nunmehr zugegeben und durch Hypnose oder Suggestion erklärt werden. Wie der »singende« oder nahende Karawanen verkündende Sandberg den Geologen kein Rätsel mehr ist und seitdem die Erklärung gefunden, seine Existenz auch eingeräumt wird – daß es mehrere solcher Berge gibt, wissen wir auch erst seit ganz kurzer Zeit –, so wurde schon vieles und wird noch mehr aus den Berichten der Alten sich bewahrheiten. Hier waren [S. 77]es nicht die Erzähler von wunderbar scheinenden Dingen, die sich blamierten, sondern die superklugen Gelehrten waren es, die, bewaffnet mit dem berühmten Rüstzeug der modernen Kritik, die Frage nicht vorurteilslos prüften, sondern kategorisch negierten.
Aus alledem ergibt sich, daß auch die mittelalterliche Literatur, bei gehöriger kritischer Verarbeitung, für unsere und noch manch andere Zwecke zweifellos viel wertvolles Material beizusteuern geeignet wäre. Hier kritische Methoden zu ersinnen – denn die gegenwärtig geübten der Negation lassen durchaus im Stich –, wird ein dankbares Feld der Zukunft sein. Wir können uns der Aufgabe nicht unterziehen. Weniger, weil es den Rahmen der Untersuchung zu weit ausdehnen würde, als deshalb, weil wir damit unserer Beweisführung nicht dienen würden.
Wie die Festigkeit einer Kette nicht durch das stärkste, sondern durch das schwächste Glied bestimmt wird, so auch die einer Beweisführung. Wir müssen uns deshalb ängstlich hüten, allzuviel Material zu verwenden, bei dem der Kritiker einwenden kann, es könne ja wahr sein, müsse es aber nicht sein.
Deshalb wollen wir uns im Nachstehenden, unter teilweisem Verzicht auf die oben skizzierte, an sich gewiß außerordentlich verlockende Aufgabe, damit begnügen, einige Beispiele für Prophetie anzuführen, an deren Authentizität sich kaum zweifeln läßt. Dabei schicken wir aber voraus, daß wir hier nur den Boden für die weitere Untersuchung bereiten wollen und uns völlig darüber klar sind, daß ein zwingender Beweis auf dem in den beiden ersten Kapiteln [S. 78]dieses Buches eingeschlagenen Wege nicht zu erbringen ist.
Tommaso Parentucelli, Bischof von Bologna, bestieg 1447 als Nikolaus V. den Stuhl Petri. Er hatte in der Nacht vor Papst Eugens Tode seine Wahl geträumt, ja, mehr als das, Kaiser Friedrich III. hatte in der Nacht, als Parentucelli Österreich verließ, geträumt, daß er von ihm zum Kaiser gekrönt werde, und sich gewundert, daß ein einfacher Bischof diese feierliche Handlung vornehmen würde. Als nun Nikolaus wirklich Papst geworden war, zweifelte der Habsburger nicht, daß er auch die Kaiserkrone aus seinen Händen empfangen würde. Da Äneas Sylvius, der nachmalige Papst Pius II., zugegen war, als Nikolaus und Friedrich sich gegenseitig ihre Träume erzählten, auch in seinem Berichte beifügt, daß vier weitere Zeugen anwesend waren, ist die Beglaubigung dieser Vorahnung völlig einwandfrei[35].
Der bekannte Arzt Thurneysser gab von 1573 bis 1585 Kalender heraus, wobei er den einzelnen Monatstagen »Prognostika« beisetzte. Wunderbarerweise traf manche Vorhersage erstaunlich richtig ein, so daß die Vermutung nicht ferne liegt, Thurneysser habe eine gewisse Sehergabe besessen.
Um ein Beispiel anzuführen, steht im Kalender von 1579 beim 17. Dezember: »Eine schändliche Tat einer fürstlichen Person.« Die Erklärung lautete im Kalender des folgenden Jahres: »Auf diesen Tag hat Signora Bianca Capelli ihren Stiefsohn zu Florenz mit Gift vergeben, welcher am 18. Dezember gestorben, [S. 79]da denn bald hernach folget ›Mord oder Totschlag einer fürstlichen Person‹, welches also erfolget[36].«
Es sei niemandem verwehrt, hier Zufall anzunehmen; immerhin ist es ein recht merkwürdiger Zufall, denn solche Taten passierten auch damals nicht allzuoft, und ihre Festlegung auf einen bestimmten Tag gibt zweifellos zu denken.
Pierre d’Ailly (geb. 1350 zu Compiègne, gest. zu Avignon zwischen 1419 und 1425), Kanzler der Sorbonne, Almosenier und Beichtvater des Königs Karl VI., Bischof von Puy, dann von Cambray, seit 1411 Kardinal, schrieb unter dem latinisierten Namen Petrus de Aliace mit dem Titel »Concordantia Astronomiae cum Theologia, Concordantia Astronomiae cum Historica Narratione« ein Buch, das erst im Jahre 1490 in Augsburg im Druck erschien.
Pierre d’Ailly, der übrigens vornehmlich den Tod des Johann Huß auf dem Konstanzer Konzil verschuldet hat, war einer der angesehensten Männer seiner Zeit und wurde wegen seines Scharfblicks »der Adler der französischen Gelehrten« zubenannt.
Wie Ersch und Grubers »Encyklopädie« bemerkt, hatte er aber die »Schwäche«, astrologischen Berechnungen zu glauben. Fast könnte er uns zu dieser Schwäche durch die Lektüre des 60. Kapitels genannten Werkes bekehren.
In diesem »de octava coniunctione maxima« betitelten Abschnitt ist zu lesen, daß nach der großen achten »Konjunktion« des Saturn die Vollendung von [S. 80]gewissen 10 Umdrehungen dieses größten Planeten im Jahre 1789 stattfinden wird.
»Wenn die Welt bis zu jenen Zeiten stehen wird, was allein Gott weiß, dann werden große und erstaunliche Umwälzungen und Wandlungen geschehen, die am meisten die Gesetze und das Parteiwesen betreffen.«
Also eine Vorherbestimmung der großen französischen Revolution[37]!
Es bedarf keiner Betonung, daß uns der astrologische Weg völlig unverständlich ist. Das ändert aber natürlich nichts daran, daß Berechnung und Wirklichkeit hier harmonieren. Jedermann sei es auch hier freigestellt, den Zufall als Begründung anzunehmen.
Was im übrigen die Astrologie betrifft, in früheren Jahrhunderten die bevorzugte und mit Gold überhäufte Schwester der Astronomie, so beruht der Glaube an sie bekanntlich auf einem supponierten Einfluß der Gestirne auf das Leben des einzelnen.
Es ist ohne weiteres klar, daß nur kindische Spielerei aus der Übereinstimmung des Planetennamens Mars mit dem Kriegsgott, oder des Planetennamens Venus mit der freundlichen Göttin der Liebe irgend etwas zu folgern vermag. Man hätte selbstverständlich [S. 81]die Gestirne auch anders taufen können und die Analogie käme dann in Fortfall.
Anders läßt sich allerdings die Sache betrachten unter der Annahme, daß jahrhunderte-, ja, jahrtausendelange Erfahrung ein Zusammentreffen gewisser Ereignisse und Schicksale mit bestimmten Konjunktionen der Gestirne ergeben habe. Wie es etwa zahlreiche Menschen gibt, die bei Witterungswechsel Rheumatismus oder Kopfweh bekommen.
Wäre letztere Annahme richtig, dann müßte allerdings – eine ausreichende Erfahrung und genügend scharfe Beobachtung vorausgesetzt – wenigstens in der Regel die schwierige astrologische Berechnung mit den Tatsachen übereinstimmen. Das ist nun aber keineswegs der Fall. Vielmehr sind die Beispiele, daß selbst die größten Astronomen – die also keine Kunstfehler machen – sich ganz gründlich irren, nichts weniger als selten.
So sandten zum Beispiel im Jahre 1179 sämtliche Astrologen Briefe an alle Länder und verkündeten den Untergang des Menschengeschlechtes für das Jahr 1186. Oder Johann Stoffler berechnete für das Jahr 1524 eine neue Sintflut und erregte damit das größte Entsetzen in ganz Europa. Andere, so Georg Tannstetter in Wien, griffen zur Feder, um das Irrtümliche dieser Prophezeiung zu beweisen. Es war auch notwendig, etwas zur Beruhigung der Gemüter zu tun, denn man hatte schon begonnen Archen zu bauen, um für alle Fälle gesichert zu sein.
Cyprianus Leovitius, Hofmathematiker des Kurfürsten Otto Heinrich von der Pfalz, verkündete aus den Sternen den Weltuntergang für das Jahr [S. 82]1584[38]. Diesen Vorhersagen des Weltunterganges folgten noch viele andere, auf die einzugehen wenig Interesse bietet.
Noch im 18. Jahrhundert hat ein gewisser Ziehen die einfältigsten astrologischen Weissagungen zum besten gegeben. So, daß die Erdoberfläche Europas sich immer mehr gegen Süden senken würde, daß der Ärmelkanal austrocknen würde und anderes mehr[39].
Überhaupt ist an falschen astrologischen Prophezeiungen gewiß kein Mangel. So hat z. B. Kepler dem damals sechsundzwanzigjährigen Wallenstein im Jahre 1609 das Horoskop gestellt, das heute noch im Original erhalten ist. Darin sagt er dem späteren großen Feldherrn neben einigem Richtigen auch voraus, er werde im siebzigsten Lebensjahre einem viertägigen Fieber erliegen.
Melanchthon, ein heftiger Gegner des Kopernikanischen Sonnensystems, der zu einem astrologischen Handbuch des Johann Schoner eine lange Vorrede verfaßte, kehrte einst auf einer Reise bei seinem Freunde Melander ein. Er stellte dessen jüngstem, etwa halbjährigen Kind das Horoskop und prophezeite, daß es gleich seinem Vater sehr gelehrt sein werde und als tapferer Streiter Gottes zu hohen geistlichen [S. 83]Würden gelangen würde. Darauf rief Melander lachend aus: »Philippe, Philippe, es ist ja ein Mägdlein[40]!«
Solche und ähnliche Entgleisungen der Astrologie sind außerordentlich häufig. Dagegen werden wir aber noch sehen, daß auch Vorhersagen erstaunlich richtig eintreffen. Letzteres läßt sich natürlich am einfachsten durch Zufall erklären, was einem Verzicht auf Erklärung gleichkäme. Ob wir zu diesem Auskunftmittel in allen Fällen greifen müssen, wollen wir vorläufig dahingestellt sein lassen. Soviel ist jedenfalls sicher: eine Methode, die zu so zahlreichen Mißgriffen führt, wie die astrologische, ist mangelhaft, vielleicht überhaupt ganz falsch. Auf keinem Fall kann der Astrologie für sich allein und in ihrer bisherigen Handhabung ein hoher prophetischer Wert beigelegt werden.
Daß Goethe der Astrologie nicht völlig fern stand, was gewiß manchen interessieren wird, mag aus dem Anfang seiner »Dichtung und Wahrheit« hervorgehen. Er schreibt hier im ersten Buche des ersten Teils:
»Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; Jupiter und Venus blickten sich freundlich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig: nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins [S. 84]um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen.
Diese guten Aspekten, welche mir die Astrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sein: denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für tot auf die Welt, und nur durch vielfache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblickte.«
Tycho de Brahe deutete den neuen Stern, der 1572 in der Cassiopeia erschien, als Ursache der Geburt eines tapferen Prinzen, dessen Waffen Deutschland überstrahlen, der selbst aber 1632 wieder verschwinden würde. Er verfaßte darüber die Schrift: »De stella nova in Cassiopea exorta.« Die Deutung auf Gustav Adolf von Schweden liegt nahe genug. Allerdings wurde er erst 1594 geboren, starb aber 1632.
Kepler sagte in seiner astrologischen »Practica« für das Jahr 1619 den Tod des Kaisers Matthias richtig voraus, und zwar durch ein sechsfaches M. M(agnus) M(onracha) M(atthias) M(ense) M(artis) M(orietur), d. h. der große Monarch Matthias wird im Monat März sterben. Das war auch richtig, denn der Kaiser schloß die Augen am 20. dieses Monats.
Der Astronom J. H. Vogtius sagte nicht nur das Ende seines Sohnes, der als Mörder hingerichtet wurde, sondern auch im Jahre 1682 den Untergang Moskaus vorher mit den Worten: »Moscovia infortunium suum noc evitabit.« Bekanntlich verbrannte [S. 85]die alte Hauptstadt im Jahre 1812. Vogtius, ein gelehrter Mann, starb zu Stade im Jahre 1691[41].
Der Astrologe Andreas Goldmayer (geb. 1603) sagte 1632 in Straßburg voraus, daß Gustav Adolf bei Lützen eines gewaltsamen Todes sterben würde. Diese Vorhersage war Ursache, daß er die Stadt verlassen mußte. Als sie sich aber erfüllt hatte, erntete er Ruhm und Ferdinand III. zeichnete ihn aus[42].
Man wird zugeben, daß das Eintreffen dieser Vorhersage ein merkwürdiger Zufall ist. Wallenstein war ganz begeistert von der treffenden Sicherheit, mit der Kepler aus den ihm, ohne nähere Kenntnis der Person, übermittelten astrologischen Daten, Charakter und Gestalt der Herzogin erkannt hatte.
Übrigens versäumte der große Astronom nie, einem Horoskop oder einer Nativität die Bemerkung [S. 86]hinzuzufügen, die seinen Zweifel an der Richtigkeit dieser Kunst ausdrückte[43].
Auch der Tod Eduards VII. wurde im Horoskop vorgesehen[44]. Zu denken gibt auch, daß der Astrologe A. J. Peare schon 1868 aus dem Horoskop des jetzigen Königs von England, der damals 2 Jahre zählte, voraussagte, »dieser Prinz wird, wenn er am Leben bleibt, König von England werden mit dem Namen Georg V.« Übrigens hat der König das beklagenswerte Schicksal seines Bruders auch im Horoskop, und seiner Regierung sollen Katastrophen zu Lande und Wasser bevorstehen[45].
In jüngster Zeit sagte die Pariser Astrologin Mme. Thebes in der Neujahrsnummer des »Gaulois« 1899 den Tod des Präsidenten Felix Faure vorher, der auch wirklich am 16. Februar dieses Jahres eintrat. Auch hier überlassen wir es selbstverständlich dem Leser, Zufall anzunehmen. Das ist um so mehr erlaubt, als bei einem Manne Ende der fünfziger Jahre die Todeswahrscheinlichkeit in einem Jahre etwa 1 : 20 beträgt, also keineswegs die Irrtumsmöglichkeit enorm ist. Im Keplerschen Falle wäre diese Zahl, da der Monat angegeben ist, natürlich noch mit 12 zu multiplizieren.
Bemerkenswert ist auch, daß ein englischer und ein französischer Astrologe, deren Namen verschwiegen werden, durch das Horoskop gefunden haben, daß Dreyfuß unschuldig sei und Ende des Jahres [S. 87]1899, wohl im Oktober, freigelassen würde. Bis dahin werde er trotz seiner Unschuld im Exil bleiben müssen. Tatsächlich wurde der unglückliche Hauptmann am 21. September 1899 begnadigt.
Was an diesen Astrologen Wahres ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Da aber die angegebene Vorhersage bereits in der siebenten Nummer der Zeitschrift für Spiritismus vom 18. Februar 1899 erschien, so handelt es sich zweifellos um eine richtige Vorhersage.
Gerade hier scheint es aber nicht am Platze, dem Fall außerordentliche Bedeutung beizulegen. Denn da die Dreyfußaffäre die ganze Welt, in erster Linie Frankreich beschäftigte, so werden zahllose Leute prophezeit haben. Da es ferner nur die Möglichkeiten schuldig oder unschuldig, Freilassung oder Exil gab und auch der Natur der Sache nach nicht viele Termine in Frage kommen konnten, so läßt sich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ohne Schwierigkeit konstruieren. Da das Verhältnis der wirklichen zu den möglichen Fällen nur begrenzt ist, so wäre gerade bei dieser Prophezeiung Zufall keineswegs ausgeschlossen.
Cardanus, einer der geistreichsten Astrologen und, wie bekannt, berühmter Mathematiker und Arzt, ließ im Jahre 1543 in Nürnberg ein Werk »Zwei Bücher des Cardanus usw.« erscheinen, in dem er 67 Horoskope von bedeutenden Menschen aller Zeiten veröffentlicht, so das des Patrarcha, Karls V., Albrecht Dürers u. a. Hier findet sich auch folgende Charakterskizze Luthers, dessen Geburtstag er fälschlich auf den 22. Oktober 1483 festgesetzt. Sie lautet:
»Dies ist das wahre Horoskop Luthers. Auch [S. 88]mußte eine so bedeutende Erscheinung einen solchen Anfang haben, und bei einer so wunderbaren Konstellation konnten solche Folgen nicht ausbleiben. Denn Mars, Venus und Jupiter traten neben der Ähre der Jungfrau im untersten Winkel des Himmels zusammen, so daß aus ihrer Verschwörung notwendig auch ohne königliches Blut eine fast königliche Gewalt hervorgehen mußte. Unglaublich ist es, welche große Anzahl von Anhängern sich diese Lehre in kürzester Zeit erworben hat. Schon entbrennt die Welt in wildem Kampfe ob dieses Wahnes, der doch, weil Mars sich in seine Erzeugung mischte, in sich selbst zerfallen muß. Unzählig sind die Köpfe, welche in ihm herrschen wollen, und wenn nichts anderes uns von seiner Nichtigkeit überzeugen könnte, so müßte es die Menge der verschiedenen streitenden Meinungen sein, da doch die Wahrheit nur eine einzige ist, die vielen verschiedenen Ansichten also notwendig abirren. Nichtsdestoweniger zeigen uns Sonne und Saturn an dem Orte der zukünftigen großen Konjunktion die Festigkeit und lange Dauer dieser Ketzerei.«
Selbst Schleiden muß zugeben, daß diese Prophezeiung, wenigstens was ihren Schluß betrifft, von erstaunlicher Richtigkeit ist, und das wiewohl Cardanus das dogmatische Gezänk, den Krebsschaden der Reformation, ganz richtig als Gefahr erkannt hatte.
Einigermaßen merkwürdig ist auch die Prophezeiung, die Johannes Capistrano in seiner »Astronomie« im Jahre 1460 nebst mancher anderen bemerkenswerten für das Jahr 1622 gibt. Sie lautet: »Der große Löw von Mitternacht zeucht auß, und [S. 89]kömpt nicht heim, er habe dann verricht, was ihme befohlen, viel, die sich für klug achten, werden sprechen: Non putaram, andere werden sagen: Hab ich das nicht ehe gesagt, die aber, so es am härtsten treffen wird, werden blind seyn, und den Löwen für einen Hanen halten, für welchem sich auch kein Adler fürchtet. Er wird aber im 1622. Jahr sehr brüllen, daß die Erde erzittert, unnd alle Menschen sehr erschrecken werden.«
Wenn Capistranus sich auch um einige Jahre irrte, so stimmt doch die Tatsache. Denn die Deutung auf Gustav Adolf ist geboten. Bedenkt man, daß damals Skandinavien noch gar keine Rolle spielte, so wird man, angenommen es spiele hier der Zufall, immerhin zugeben müssen, daß es ein merkwürdiger Zufall ist.
Merkwürdig ist auch der unmittelbar anschließende Passus: »Niederland wird sich heiß und hefftig umb aller Welt Händel annemen, unnd uberall vorne an der spitzen seyn wollen.« Daß in diese Zeit der Kriege mit Spanien die höchste Blüte der Niederlande, damals des reichsten Landes Europas, fällt, ist hinlänglich bekannt. Daß ab 1620 Deutschland in eine große Kriegsperiode eintritt, sagt Capistrano auch voraus. Gewiß ist der Anfang nicht genau richtig angegeben, die Tatsache stimmt aber[46].
Die angeführten Beispiele aus der Astrologie dürften um so mehr genügen, als sie aus einschlägigen [S. 90]Werken leicht vermehrt werden können. Wir wollen nun noch nachstehend eine Reihe von Vorhersagen zusammenstellen ohne Rücksicht darauf, auf welchem Wege sie gewonnen wurden.
Als im Jahre 1610 König Heinrich IV. von Frankreich gegen Spanien rüstete, bestimmte er für die Zeit seiner Abwesenheit seine Gemahlin Maria von Medici zur Regentin. Schon im Begriff der Abreise zur Armee, wiederholte seine Gemahlin ihre Bitte, sich vor seiner Abreise salben und krönen zu lassen, um dadurch ihrer Regentschaft in den Augen des Volkes mehr Glanz zu verleihen. Er zeigte anfangs die größte Abneigung dagegen. Nicht nur, weil diese Feierlichkeit bedeutende Summen kosten und ihn noch einige Zeit in Paris zurückhalten würde, sondern auch wegen der gegen Sully ausgesprochenen Besorgnis, daß sie die Ursache seines Todes sein würde. Denn ihm war verkündet worden, er werde bei dem ersten Feste, das er veranstalte, getötet werden. Endlich willigte er in die Bitte der Königin und bestimmte am 12. Mai den folgenden Tag zu ihrer Krönung und den 16. zu ihrem feierlichen Einzug in Paris. Die Krönung und Salbung fand mit großer Pracht zu St. Denys statt. Am folgenden Tage, dem 14. Mai 1610, wollte der König vom Louvre zum Arsenal fahren, um Sully, der hier wohnte und krank war, zu besuchen. In seinem Wagen, der wegen des schönen Wetters offen war, saßen noch die Herzöge von Epernon und Montbazon und fünf weitere Personen. Eine kleine Anzahl Edelleute zu Pferde und einige Diener zu Fuß folgten ihm. Die Straße La Ferronnerie, [S. 91]welche schon durch Buden, die an die Mauer des neben ihr liegenden Kirchhofes gebaut waren, sehr verengt war, wurde durch einen mit Wein beladenen Wagen und einen Heuwagen gesperrt, so daß der König anhalten mußte. Die meisten der ihm folgenden Edelleute und Diener schlugen den Weg über den Kirchhof ein, um an dem anderen Ende der Straße sich wieder dem königlichen Wagen anzuschließen. Während von den zwei Zurückgebliebenen der eine vorwärts ging, um Platz zu machen, und der andere sich bückte, um sein Knieband zu befestigen, trat ein Mann auf das Hinterrad des Wagens und stieß dem König, der soeben aufmerksam einen Brief anhörte, den Epernon ihm vorlas, ein Messer etwas oberhalb des Herzens in die Brust. Der König, rief aus »ich bin verwundet!« Im selben Augenblick traf ein zweiter Stoß sein Herz und sogleich stürzte ihm das Blut in solcher Menge aus dem Mund, daß er erstickte. Der Mörder hieß Franz Ravaillac[47].
Bassompierre, der in seinen Memoiren diese Erzählung bestätigt, weiß noch von Vorzeichen bzw. Vorahnungen zu berichten: »Er (der König) sagte mir kurze Zeit vorher (d. h. vor seiner Ermordung): ›Ich weiß nicht, was das ist, Bassompierre, aber ich kann mich nicht davon überzeugen, daß ich nach Deutschland gehen werde und das Herz sagt mir nicht, daß du auch nach Italien gehen wirst‹. Wiederholt sagte er mir und auch andern: ›Ich [S. 92]glaube bald zu sterben‹. Und am ersten Tage des Mai, als er aus den Tuilerien durch die große Galerie zurückkehrte (er stützte sich immer auf jemand) und er Mr. de Guyse an der einen Seite führte und mich auf der andern und uns erst verließ, als er im Begriffe war, ins Gemach der Königin einzutreten: da sagte er uns: ›Gehen Sie nicht fort, ich gehe nur fort, um meine Frau zu veranlassen, sich schnell anzuziehen, damit sie mich beim Essen nicht warten läßt‹, denn er speiste gewöhnlich mit seiner Gemahlin.
Wir stützten uns, ihn erwartend, auf das eiserne Geländer, das auf den Hof des Louvre geht; als plötzlich der Maibaum den man hier in der Mitte eingesetzt hatte, umfiel, ohne durch den Wind oder eine andere Ursache erschüttert worden zu sein, und dabei nach der Seite der kleinen Treppe zu, die zum Zimmer des Königs führt, stürzte. Ich sagte darauf zu Herrn von Guyse: ›Ich wollte viel darum geben, wenn das nicht passiert wäre; das ist ein sehr schlechtes Omen. Gott wolle den König schützen, der ja der Maibaum des Louvre ist.‹
Er antwortete mir: ›Was sind Sie närrisch, an solche Sachen zu denken!‹ Ich entgegnete: ›In Italien und Deutschland würde man von einem solchen Vorzeichen noch ganz anderes Aufhebens machen, wie wir jetzt hier. Gott schütze den König und alles was ihn betrifft.‹
Der König, der nur ins Gemach der Königin eingetreten war und es gleich wieder verlassen hatte, war ganz leise herangetreten, um uns zuzuhören, im Glauben, wir sprächen von irgendeiner Dame, vernahm [S. 93]alles, was ich gesagt hatte und unterbrach uns mit den Worten: ›Ihr seid närrisch euch über solche Vorzeichen zu unterhalten: seit dreißig Jahren haben alle Astrologen und Charlatans, die es zu sein vorspiegeln, mir alljährlich vorherverkündet, daß ich mein Leben aufs Spiel setze; et celle que je mourray, on remarquera lors tous les presages quy m’en ont adverti en celle, dont l’on fera cas, et on ne parlera pas de ceux quy sont avenus les années precedentes[48].‹
Nach diesem Bericht, der den Stempel der Wahrheit an der Stirn trägt, wird man wohl kaum an der Tatsächlichkeit der Vorhersage eines gewaltsamen Todes zweifeln können.
Übrigens soll auch ein Edelmann Namens Villandry und der Astrolog Rizacasa das Attentat auf Heinrich IV. vorhergesagt haben[49].
Katharina von Medici sagte dem Herzog von Biron seinen Tod bei der Belagerung von Epernay voraus.
Der Bruder des Herzogs, der denselben Astrologen fragte, dessen sich auch Katharina bediente, erhielt folgende Antwort:
»Er wird unter dem Henkerbeil sterben.«
»Was soll das heißen?« rief Biron aus.
»Gnädiger Herr, wenn ich mich besser ausdrücken soll, so muß ich sagen, daß ihm der Kopf zerrissen wird.«
[S. 94]Der erzürnte Biron richtete in seiner Wut den armen Astrologen darauf übel zu und ließ ihn auf dem Boden liegen. Dieser Gewaltakt hinderte nicht, daß die Prophezeiung nach sechs Monaten in Erfüllung ging. Eine Kanonenkugel raffte den Herzog hinweg.
Ein besonderes Interesse verdienen die Visionen des sonst unbekannten Joachim Greulich, die ihrer Zeit ein ungeheures Aufsehen machten. Die somnambulen Zustände des Greulich stellten sich öfter und zuletzt täglich ein. Greulich verlor im tagwachen Zustande nicht die Erinnerung an seine auf die politische Lage der Staaten und Hauptstädte Europas bezüglichen Visionen, sondern führte über sie ein Tagebuch. Einige Stellen dieses Tagebuches seien nachstehend wiedergegeben[50]:
Am 18. August »kam der Engel GOttes wieder zu mir um die mitternachtsstunde und sprach zu mir: Siehe in den himmel, wie er so blutig ist; da sahe ich darinne ein blutiges schwerd, und neben dem schwerd stund mit güldenen buchstaben geschrieben: Du schöne stadt Erfurt; und auff der andern seiten stund wieder mit güldenen buchstaben geschrieben: Große feuersbrünsten, die in dieser stadt auskommen werden; über dem schwerdt aber stund geschrieben, [S. 95]groß auffruhr, rebellerey wird sich da begeben, sonsten keinen krieg weiß ich ihnen anzuzeigen; dann dieses schwerd ist ihnen selbst in ihre hand gegeben.«
Tatsächlich legten einige Jahre später – die Visionen wurden 1653 niedergeschrieben – mehrere große Feuersbrünste das damals bedeutende Erfurt fast ganz in Asche. Anfangs der sechziger Jahre entstanden Reibereien zwischen der Bürgerschaft und dem Rat, welche jahrelang dauerten und in offene Empörung gegen Kurmainz ausarteten. Als die Erfurter einen kaiserlichen Herold, der der Stadt die Reichsacht verkünden sollte (1660), schwer mißhandelt hatten, beauftragte Kaiser Leopold I. den Kurfürsten Johann Philipp von Mainz mit der Reichsexekution. Dieser belagerte, weil wegen der Türkenkriege kein Reichskontingent verfügbar war, die Stadt mit französischen aus Ungarn zurückkehrenden Hilfstruppen und nahm sie durch Kapitulation (1664)[51].
Greulich hatte auch eine auf die Belagerung Wiens durch Kara Mustapha und die große Pest, die 80 000 Menschen dahinraffte, bezügliche Vision:
»Den 29. August um 4 uhr zu nachts kam der Engel GOttes wieder zu mir und sprach: Siehe wieder in den Himmel, wie er so blutig ist; da sahe ich darin pfitzschpfeile, bögen und blutige säbel, und ein creutz auch dabey, und neben dem säbel stund geschrieben mit güldenen buchstaben: Du schöne [S. 96]stadt Wien, du wirst schrecklich von den Türcken betränget werden; und über den pfitzschpfeilen, bögen und blutigem säbel stund ein schöner adler, und ich fragte den Engel GOttes, was der adler bedeuten wird; da sagte er mir, der Engel GOttes, nach eroberung der stadt Raab werden sich die Türcken für Wien machen, daß gleichsam Käyserliche Majestät von seiner Residentz-stelle weichen wird müssen, jedoch werde unsere Käyserl. Majestät den Türcken gewaltig schlagen, und die Türcken mit schand und spott wieder vor Wien werden abziehen müssen; keinen Teutschen krieg kan ich der stadt Wien anzeigen, auch keine straff als sterben und den Türken.«
Auch über die Vertreibung der Bourbonen hatte Greulich zwei Visionen:
Die erste beschreibt er (p. 253) folgendermaßen: »Ady den 28. Aug. zu nacht um 4 auff der großen uhr, kam der Engel GOttes wieder zu mir und sprach: . . . Und nach diesem sprach der Engel GOttes wieder zu mir, ich solte in den himmel sehen, wie er so blutig sey, da sahe ich darinnen ein blutiges schwerd, und ein kreyß oben darauff, und auf der rechten seiten neben dem schwerd stund geschrieben mit güldenen buchstaben: Ihr Königl. Majestät in Franckreich, und auf der lincken stund abermal mit güldenen buchstaben geschrieben: Schönes Franckreich, es wird jämmerlich mit dir zugehen, da fragte ich den Engel GOttes, was das bedeuten wird, da sagte er zu mir, siehe wol an den himmel, wie des Königes in Franckreich sein Name sich daran verdunckelt, und er hat sich gantz verlohren, das bedeut, daß er soll mit den seinen verjagt [S. 97]und verderbet werden, und es wird ein sterben auch dazu kommen.«
Die zweite Vision Greulichs lautet:
». . . Über eine weile kam der Engel GOttes wieder zu mir und sprach: Sihe in den himmel, wie er so blutig ist, und ich sahe darinnen einen grausamen stuhl gesetzt; und auf dem stuhl saß einer in einer güldenen crone, und er hatte in seiner rechten Hand Scepter und Reichs-apfel, und über seinen stuhl (der grausam schön war anzusehen) stund mit güldenen buchstaben geschrieben: Königl. Majestät in Franckreich, und über der schrifft stund eine blutige fahne; und der Engel GOttes sagte zu mir: Siehe jüngling, da kommen des Königs in Franckreich seine Räthe, die ältisten so wol als die jüngsten, daß beysamt der blutigen fahnen kniend für dem König in Franckreich sie müssen einen eid ablegen, daß sie bey ihrer treu und glauben bey ihme leben und sterben wollen, und auch gegen ihres Königs feinde seyn (der Schwur im Ballhause und die große Feier auf dem Marsfeld!) und wie das verrichtet war, saß der König noch auf seinem stuhl, und der Engel GOttes sprach zu mir: Siehe, jüngling, wie des Königs seine crone, scepter und Reichsapfel alles verrostet, und es anfangs alles schöne geglissen hat, nun aber siehestu, daß es mit allem Königlichen Ornat von seinem stuhl herunter gestoßen wird[52].«
Wenn wir uns bei der Betrachtung obiger Visionen vor Augen halten, daß sie, selbst wenn wir an Arnolds [S. 98]Quelle zweifeln sollten, da er ungedruckte Papiere benutzt zu haben behauptet, ein volles Jahrhundert früher publiziert wurden, als sie eintraten, daß also auch nur der allerleiseste Zweifel an ihrer Authentizität hinfällig ist – denn auch Arnold konnte ja gar keine Ahnung davon haben, daß neunzig Jahre, nachdem er es im Druck erschienen ließ, das Gesicht sich realisieren würde – dann wird wohl auch der größte Verfechter der Unmöglichkeits- und Zufallstheorie einigermaßen bedenklich werden.
Um die volle Wunderbarkeit der Prophezeiung richtig bewerten zu können, müssen wir uns vergegenwärtigen, daß Greulich so gut wie Arnold in der Zeit des auf die Spitze gesteigerten Absolutismus lebten. Man muß ferner wissen, daß Frankreich, vom Sonnenkönig Ludwig XIV. regiert, damals auf dem Gipfel seiner Macht und seines Ansehens stand. Es lag außerhalb jeder menschlichen Berechnung sowohl an einen Sturz des Königtums irgendwo in Europa, als besonders an den der glänzenden, allmächtigen Bourbonen Frankreichs zu denken.
Die Vision wird noch erstaunlicher durch den Nebenumstand, daß der König erst vertrieben wird – und zwar wie der »grausame stuhl« und die »blutige fahne« andeuten nicht eben sänftiglich; den Henkerstod zu prophezeien scheute sich wohl auch ein Greulich – nachdem ihm der Treueid geleistet worden war. Daß dieser Zug jede Berechnung ausschließt, dürfte kaum bestritten werden können.
Wir haben es hier – und zwar zum ersten Male in diesem Buche – mit einer richtigen Vision zu tun. Die Form, in der die Zukunft enthüllt wird, das Erscheinen [S. 99]eines Engels, ist höchst befremdlich und der Verdacht, es handele sich um Schwindel oder Wahnideen, liegt nahe. Wir werden aber später noch häufig Gelegenheit haben, bei anderen Sehern ganz Ähnliches zu finden. Entscheidend ist hier eben nur, ob die Vorhersage eintrifft oder nicht. Und da hier letzteres der Fall ist, müssen wir wohl oder übel das Phänomen hinnehmen, wie es sich uns bietet.
Zur Warnung für vorschnelle Urteile ist es nicht überflüssig, daran zu erinnern, daß das Problem der Prophetie noch Neuland ist. Unsere erste Aufgabe muß es sein, festzustellen, ob es überhaupt ein Fernsehen in der Zeit gibt. Erst wenn das geschehen ist, kann die Untersuchung der Bedingungen, unter denen diese Kraft wirksam wird, uns beschäftigen. Wenn wir also auch die allerwunderlichsten Berichte finden – wie etwa in bezug auf Greulichs Engel – so werden wir uns hüten müssen, daran herumzukritisieren. Vielmehr handelt es sich für uns zunächst nur darum, ob dieser angebliche Engel sich durch die Wahrheit seiner Eingebung sozusagen legitimiert.
Wenn eine neue Naturkraft oder irgendeine Erscheinung der Natur untersucht werden soll, so bedient sich der Naturforscher zu diesem Zweck des Experimentes. Dann ist es seine Aufgabe nicht etwa – wie der Laie meinen mag – der Natur das Experiment aufzutrotzen, sondern ganz im Gegenteil ihr die Bedingungen abzulauschen, unter denen sie den Versuch gelingen läßt. Nicht der Naturforscher stellt also die Bedingungen auf, sondern die Natur.
Um ein Beispiel zu gebrauchen: die Entwicklung der photographischen Platte ist nur in der Dunkelkammer [S. 100]bei rotem Lichte zu bewerkstelligen. Dieser Bedingung des roten Lichtes hat sich der Photograph einfach zu fügen und erst wenn er auf Grund von vielfachen Versuchen zum Resultate gekommen ist, daß Licht von anderer Farbe ihm die Platte verdirbt, wird er dazu übergehen die Gründe dieser Erscheinung zu prüfen. Hier stellen also das rote Licht, die Natur, die Beschaffenheit der Platte die Bedingungen, und die Aufgabe des Experimentators kann nur sein, diese Bedingungen herauszufinden und sich ihnen zu fügen. Erst auf einer höheren Stufe wird er dazu übergehen können die Natur – scheinbar – zu zwingen.
Leute, die sich am Engel in der Prophetie oder am Symbolismus vieler Vorhersagen stoßen, erscheinen fast so, als wollte jemand das Schwimmen der Fische untersuchen und sich darüber aufregen, daß das nur im Wasser vor sich geht. Auf dem trockenen Lande wären doch die Beobachtungsbedingungen viel bequemer!
Was übrigens den Sturz der Bourbonen bzw. die große Revolution betrifft, so wurde sie – von Cazottes Prophezeiung, auf die wir noch eingehend zurückkommen werden, abgesehen – außer von Greulich und Ailly noch von Johannes Cario in seiner 1522 zu Berlin erschienenen »Prognosticatio« vorhergesagt. Es ist nun sehr spaßhaft, daß der superkluge Adelung noch im Jahre 1787 die Richtigkeit dieser Prognose mit folgenden Worten bestreitet:
»Noch unbarmherziger soll es in dem Jahre 1789 zugehen; das sollte das schrecklichste unter allen sein, indem in demselben große und wunderbare [S. 101]Geschichten, Veränderungen und Zerstörungen vorfallen würden. Allein, so sehr sich der Narr in Ansehung des 1693sten Jahres betrogen hat, so sehr wird er vermutlich auch 1789 zum Lügner werden[53].«
Kehren wir noch einen Augenblick zum »Engel« zurück! Daß es sich nicht um einen der biblischen Engel handeln kann, sondern nur um ein Phantasieprodukt unterliegt natürlich bei Greulich so wenig, als bei irgendeinem andern Seher dem allergeringsten Zweifel. Das Wahrscheinlichste ist, daß das Kausalitätsbedürfnis der Propheten, die Eingebungen haben ohne zu wissen, woher sie stammen, einen Geist oder Engel oder gar Gott selbst erfinden und die Figuren ihrer Phantasie dann für wirkliche Personen halten. Damit ist keine Erklärung des hellseherischen Phänomens gegeben, es sollen lediglich die Seher nach Tunlichkeit von dem Verdacht des Schwindels oder Irreredens befreit werden. Denn daß es sich hierum nicht handelt – wenn auch gewiß beides da und dort vorkommen mag – geht aus dem Inhalt des Geschauten und dessen Uebereinstimmung mit der Wirklichkeit zur Evidenz hervor. Im übrigen müssen wir den Leser vorläufig noch um Geduld bitten.
Ebenso merkwürdig fast, wie der Engel als Vermittler der Zukunft, sind Karten und Kaffeesatz der Wahrsagerinnen. Daß es noch zahllose andere angebliche Mittel gibt Zukünftiges zu sehen, Spiegel, Kristalle usw. sei im Vorbeigehen bemerkt. Darauf näher einzugehen, müssen wir ablehnen, da wir [S. 102]ja nicht untersuchen wollen, auf welchem Wege das zeitliche Fernsehen zustande kommt, sondern uns ganz bescheiden damit begnügen müssen, festzustellen, ob und daß es ein solches tatsächlich existiert.
Um aber das Unsere zu tun, um den Leser vor vorschnellem Aburteil zu bewahren, sei folgende interessante Geschichte hier zum besten gegeben.
»Eine Freundin von mir, Lady A., wohnte in den Champs-Elysées. An einem Oktoberabend 1883 hatte ich bei ihr diniert. Trotz ihres großen Vermögens war sie eine sehr häusliche, ordnungsliebende Dame und machte jeden Abend ihre Abrechnung vor dem Schlafengehen.
Wie sehr war sie betroffen, als ihr an diesem Abend 3500 Frs. aus der Innentasche ihres großen Reisekoffers fehlten, in dem sie ihre Juwelen und ihr Geld verwahrte.
Das Schloß war nicht verletzt; nur die Ränder der Tasche waren ein wenig verbogen. Und doch war Lady A. überzeugt, daß sie um 2 Uhr nachmittags in Gegenwart ihrer Kammerfrau die Tasche geöffnet und eine Nota bezahlt hatte. Dann hatte sie das Geld bestimmt wieder an seinen Platz gelegt. Sie schellte ihrer Kammerfrau und teilte ihr den Verlust mit. Diese wußte auch nichts anzugeben, erzählte aber dem Personal den Verlust. Die Folge war, daß der oder die Schuldige Zeit finden konnte, das gestohlene Gut in Sicherheit zu bringen.
Zeitig früh wurde der Polizeikommissar der rue Berryer benachrichtigt. Alles wurde verhört und durchsucht, umsonst.
Der Kommissar besprach noch mit Lady A. den [S. 103]Fall und fragte sie aus, wen sie am ehesten für den Schuldigen halte.
Lady A. gab ihre ganze Dienerschaft als vertrauenswürdig an; ganz ausgeschlossen sei aber von dem Verdacht der zweite Kammerdiener, ein großer, 19jähriger Mensch, den sie aus einer Art Protektion, die er sich durch seine musterhafte Haltung erworben, zärtlich ›den Kleinen‹ zu nennen pflegte.
Der Morgen verlief resultatlos. Um 11 Uhr vormittags schickte Lady A. die Erzieherin ihrer jüngsten Tochter zu mir mit der Bitte, ich möchte diese Dame doch zu einer Hellseherin begleiten, deren Fähigkeit ich vor einigen Tagen gerühmt hatte.
Ich kannte diese Hellseherin auch nur aus den Erzählungen einer Dame und wir machten uns auf den Weg.
Unsere Hellseherin, Frau E., brachte eine mit Kaffeesatz gefüllte Tasse und ersuchte die Erzieherin, dreimal darauf zu blasen. Dann goß sie den Kaffeesatz in eine zweite Tasse und in der ersten blieb in verworrenen Linien nur der festere Kaffeestaub zurück. Darin schien unsere Pythia zu lesen.
Sie breitete ihre Karten aus und begann: ›Ah! ein Diebstahl . . . Der Dieb ist im Hause selbst und hat sich nicht erst eingeschlichen. Warten Sie, jetzt will ich aus dem Kaffeesatz die Details herauslesen.‹
Sie nahm die Tasse, die Erzieherin mußte wieder dreimal blasen und sie griff nach ihrem Lorgnon.
Als hätte sie der Szene beigewohnt, beschrieb sie auf das genaueste das Zimmer der Lady A. Sieben Bediente, die sie dem Alter und Geschlecht [S. 104]nach genau beschrieb, sah sie in dem Haus. Dann kam sie wieder in Lady As. Zimmer zurück und bemerkte einen eigenartigen Schrank[54].
›Warum ist dieser Schrank nicht versperrt? Er enthält viel Geld . . . in . . . wie komisch das Ding ist! . . . es öffnet sich wie ein Portemonnaie . . . es ist kein Koffer . . . ah, ist weiß . . . ein Reisesack . . . welche Idee, hier sein Geld aufzubewahren und wie unvorsichtig, es so unverschlossen zu lassen! – Die Diebe kennen den Sack wohl . . . sie haben das Schloß nicht verletzt. Sie biegen die Seiten auseinander und mit einer Schere oder mit einer Pinzette ziehen sie die Banknoten heraus.‹
Wir lassen sie sprechen; alles, was sie sagt, stimmt in den feinsten Details mit der Wahrheit überein. Sie hält ermüdet inne. Wir beschwören sie, uns den Schuldigen zu nennen. Sie erklärt, dies sei gegen die französischen Gesetze, denn man dürfe ohne Beweise, nur durch okkultes Wissen, niemand als einen Verbrecher bezeichnen.
Da wir weiter in sie dringen, erklärt sie, das Geld werde niemals gefunden und der Dieb nicht für den Diebstahl bestraft werden, aber in zwei Jahren würde er die Todesstrafe erleiden.
So oft sie von dem ›Kleinen‹ spricht, sieht sie ihn bei den Pferden. Wir versichern ihr, er sei Kammerdiener und komme mit den Pferden gar nicht in Berührung. Aber sie besteht auf ihrer Behauptung.
[S. 105]Wir lassen also diese Kleinigkeit fallen, die uns aber in ihren sonst so richtigen Angaben stört.
Vierzehn Tage später entläßt Lady A. ihren Portier und ihre Kinderfrau; der ›Kleine‹ tritt ohne Grund einige Wochen später aus ihrem Dienst. Das Geld wird nicht gefunden, und ein Jahr später reist Lady A. nach Ägypten.
Zwei Jahre nach dem Diebstahl erhält Lady A. die Aufforderung vom Tribunal de la Seine, als Zeugin nach Paris zu kommen. Man hatte den Dieb gefunden. Es war Marchandon, der Mörder Frau Cornets, ehemals der so hochgeschätzte ›Kleine‹.
Wie es die Hellseherin von rue Notre-Dame-de-Lorette vorausgesehen, erlitt er die Todesstrafe. Im Prozeß konstatierte man auch, daß der ›Kleine‹ ganz nahe der Residenz von Lady A. einen Bruder hatte, der als Kutscher in einem großen Haus bedienstet war. Der ›Kleine‹ war ein großer Pferdeliebhaber und hatte jeden freien Moment bei seinem Bruder im Stall zugebracht.
So hatte die Hellseherin in jedem Detail recht behalten.
L. d’Ervieux.
Ich bestätige, daß dies der Wahrheit entspricht, da ich der Konsultation beiwohnte.
C. Deslions.«
Zu diesem außerordentlich interessanten Fall, einer Verbindung von zeitlichem und räumlichem Fernsehen, macht Dariex die Anmerkung:
»Dieser Fall von Hellsehen ist äußerst interessant. Lady A. hat mir ihn in allen Einzelheiten bestätigt. Die Karten und der Kaffeesatz sind nur ein nebensächliches Mittel, das das Medium unbewußt anwendet, um sich in Autosomnambulismus zu versetzen, [S. 106]d. i. in einen Zustand, worin das normale Bewußtsein außer Tätigkeit tritt, und zwar zugunsten des unbewußten Handelns. Es ist möglich, daß in diesem Zustand die unbewußten Fähigkeiten ihren größten Aufschwung nehmen können und daß die hellseherische Fähigkeit, die vielleicht in uns allen schlummert, bei manchen Individuen ziemlich viel zu leisten vermag.«
Ob es sich auch bei der Astrologie um ein ähnliches nebensächliches Mittel, wie Kaffeesatz und Karten, handelt, bleibe dahin gestellt. Desgleichen was es mit dem Engel für eine Bewandtnis hat. Denn wie man auch darüber denken mag, der Sache selbst bringt es uns nicht näher. Wenn die gut beglaubigte Geschichte, die durchaus nicht vereinzelt ist, den Erfolg hat, daß die Leser dieser Zeilen sich nicht lediglich deshalb unwillig abwenden, weil in den Visionsberichten Engel oder sonst was Merkwürdiges vorkommt, so ist der Zweck des Autors vollauf erreicht.
Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zur Sammlung historischer Beispiele für ein richtiges Vorhersehen der Zukunft zurück! Daß die chronologische Reihenfolge nicht strenge innegehalten wird, dürfte die Natur des Gegenstandes rechtfertigen.
Alessandro de Medici wurde im Jahre 1536 von seinem Vertrauten und Vetter Lorenzino auf raffinierte Weise ermordet. Dieses Ende war dem Herzog wiederholt vorhergesagt worden, sogar mit Bezeichnung der Person des Mörders. Ein Page aus Perugia hatte es geträumt und der Astrologe Giuliano del Carmine in seiner Nativität gelesen. Und zwar nicht nur, daß er ermordet, sondern sogar, daß ihm [S. 107]die Gurgel durchschnitten würde, und zwar durch seinen Vetter Lorenzino. Alessandro, der nicht an Astrologie glaubte, hatte darüber nur gelacht.
Ja, er hatte zum Entsetzen der Florentiner zur Hochzeit mit Margarete von Parma einen astrologischen Unglückstag gewählt, nämlich eine Sonnenfinsternis und noch dazu einen Dreizehnten.
Es gab eben zu allen Zeiten Leute, die von Wahrsagerei, Astrologie oder andern Versuchen, die Zukunft zu enthüllen, nichts hielten. Hatte doch schon Villani davor gewarnt[55]. Diese Skepsis, die also keineswegs absolut neu ist, nur daß die Gegenwart in der Ablehnung viel weiter geht, als frühere Zeiten, ist dazu angetan, die Glaubwürdigkeit einiger Berichte zu erhöhen.
Alessandro war auch von verschiedenen Personen, denen Lorenzinos Benehmen aufgefallen war, gewarnt worden, jedoch ohne jeden Erfolg. Deshalb glaubte man allgemein in Florenz, sein Tod sei ihm vom Schicksal bestimmt.
Ein Soldat von Alessandros Leibwache hatte geträumt, der Herzog sei von einem kleinen, schmächtigen Menschen, dessen Äußeres er sich genau erinnerte, ermordet. Er redete darauf seinen Herrn des Morgens an der Tür an, um ihm den Traum zu erzählen. Und als Lorenzino eben dazu trat, rief er: [S. 108]»Dieser ist es.« Der Herzog aber schickte den Warner mit barschen Worten fort[56].
Unterm 27. Dezember 1759 hatte der Marquis d’Argens König Friedrich dem Großen gemeldet: daß ein Mensch, der vor einundeinhalb Jahren für einen Narren gegolten, ihm im Jahre 59 großes Unglück prophezeit, für das Jahr 60 aber glücklichere Ereignisse. Er fährt in einem zweiten Briefe von 1760 fort:
»Sire! mein Prophet, über den Sie sich lustig machen, sagt noch immer Wunderdinge vorher.«
Hier folgt eine niedliche Antwort, die der Prophet dem einfältigen Markgrafen von Schwedt gab, der ihn mit vornehmen Worten abzuspeisen versuchte: »Geht, Ihr seid ein Narr!«
»Meine Frau sagt mir das täglich, aber ich achte nicht darauf, weil ich den Umfang ihres Geistes kenne,« replizierte der schlagfertige Prophet.
D’Argens erzählt jetzt weiter, daß der Seher die Schlacht bei Küstrin einen ganzen Monat vorher mit folgenden Worten angekündigt habe: »Der König wird in dreißig Tagen eine blutige Schlacht über die Russen gewinnen; an 15 000 werden bleiben und lange Zeit auf dem Schlachtfeld liegen und den Vögeln zur Beute werden.«
»Der Tag«, fährt Argens wörtlich fort, »war gerade der Tag der Schlacht. Ich weiß wohl, das Ungefähr hat die Vorhersage dieses Mannes wahr [S. 109]gemacht, aber man muß doch gestehen, es war ein sonderbares Ungefähr.«
Der Marquis betont ausdrücklich, daß er trotzdem nicht an Propheten glaube – wie konnte er auch anders in der Zeit der Aufklärung und in einem Briefe an einen ihrer glänzendsten Vertreter?! – sondern ein treuer Anhänger Epikurs nach wie vor sei[57].
Der Tod des Königs Friedrich von Württemberg im Jahre 1816 wurde bereits 1812 von den Stuttgarter Somnambulen Wanner und Krämer vorhergesagt. Eschenmayer berichtet darüber im ersten Bande des »Archivs für tierischen Magnetismus«[58] ausführlich. Das wesentliche seines Berichtes lautet:
»Die erste Vorhersage geschah im Jahre 1812, wahrscheinlich am 12. Juli, in Gegenwart von Hofmedikus Klein, Oberfinanzrat St. . ., dessen Frau und Tochter. Sie lautete: »S. M. stirbt im Jahre 1816 zwischen dem 18. und 20. April auf ungewöhnliche Weise.« (Zu Klein): »Zu Dir wird noch vorher geschickt werden und eine andere Person (die sie nannte) wird vorangehen.«
Die Somnambule verpflichtete alle zu strengstem Stillschweigen aus Furcht, man werde sie für eine Irrin erklären, wenn ihre Prophezeiung bekannt würde. Später sagte die Wanner: »Das Jahr des Todes sei [S. 110]zuverlässig, aber im Monat könne sie sich irren.« Dem fügte Frau von St. . . hinzu, »daß nachmals ihr Mann ihr gesagt hätte, er habe noch besonders herausgebracht, daß der Monat der Oktober sein könne.«
Eschenmayer wollte den Finanzrat von St. . . deshalb interpellieren, traf ihn jedoch nicht an und sagt: »Soviel ist aber gewiß, daß St. . . das Ende des Monats Oktober vom Jahre 1816 mit einer solchen Zuverlässigkeit als den wahren Termin der Erfüllung annahm, daß er sich gegen mehrere meiner Bekannten äußerte, er biete seinen ganzen Weinvorrat als Wette auf dieses Ereignis an.«
Die in der Behandlung des Dr. Nick befindliche Somnambule Krämer führte mit diesem ihrem Arzte, dem Hofmedikus Klein und Professor L. . .t am 17. April 1816 folgendes Gespräch:
Krämer: »S. M. stirbt in diesem Jahre im Monat Oktober.«
Nick: »Ist es der Anfang, die Mitte oder das Ende des Oktobers?«
Krämer: »Das Ende des Oktobers.«
Nick: »Du kannst wohl den Tag bestimmen? Ist es wohl der 26.?«
Krämer: »Nein.«
Nick: »Aber der 28. Oktober?«
Krämer: »Da trifft ihn ein Kopf- und Brustschlag.«
Der Leibarzt Dr. Klein hatte eine Reise nach Augsburg gemacht, von der er am 28. Oktober zurückgekehrt war, als ein königlicher Läufer erschien und ein chirurgisches Instrument für den König holen [S. 111]wollte. »Wie ein Blitzschlag erinnerte sich Klein an diesen Vorboten, der den Tod verkündigte.« Und wirklich traf an diesem Tage den König ein Schlaganfall, welchem er am 29. erlag. Bezüglich der Zeugenschaft führt Eschenmayer folgendes an:
»Dr. Christian Reuß. Diesem übergab Professor L. . .t mehrere Monate vorher einen versiegelten Zettel, auf welchem die vorhergesagte Begebenheit stand, mit der Bemerkung, denselben nach Ablauf der Zeit zu erbrechen. Da aber späterhin durch die allmähliche Verbreitung des Gerüchts diese Vorsicht unnütz wurde, so ließ L. . .t durch R. . .ß den Zettel öffnen. Mit dem Inhalt und den Umständen vertraut, bekam R. . .ß selbst Glauben an die Geschichte, wettete darauf und gewann zwei förmliche Wetten. Einer der Wettenden ist der Major C. . ., der andere ist mir unbekannt.
Minister von W. . ., ein tätiger Beschützer des Magnetismus, sprach selbst in Gesellschaften von dieser sonderbaren Vorhersage, um die Möglichkeit solcher Phänomene in wissenschaftlicher Hinsicht zu beleuchten. Tatsache ist es, daß er mit Graf G. . .z eine Wette eingehen wollte.
Geheimrat von St. . . ist Zeuge, daß St. . . drei bis vier Monate vorher auf das letzte Drittel des Oktobers mit Einschluß bis zum 11. November seinen ganzen Weinvorrat als Wette anbot.
Madame von W. . . teilte ich selbst etwa drei Monate vorher auf besondere Veranlassung diese Vorhersage mit. Sie bekam später Gelegenheit mit St. . . darüber zu sprechen, der ihr gleichfalls äußerte, daß er jede Wette darauf eingehe.«
[S. 112]Die Legationsräte K. . .e und von B. . .r hatten lange vor dem Tode des Königs über diese Prophezeiung mit Eschenmayer gesprochen. Letzterer bemerkt, daß er mit Leichtigkeit noch 200 Zeugen für diese Begebenheit beibringen könne. Eschenmayer hält diese Weissagung Hufeland und Stieglitz entgegen, welche Tatsachen und keine Räsonnements begehrten, und bemerkt am Schluß: »Doch, noch eine Ausflucht! Alles war Zufall. – Nichtiges Wort der Erbärmlichkeit.«
Es wird wohl kaum jemand an der Wahrheit obiger Mitteilung zu zweifeln wagen. Eschenmayers Persönlichkeit bürgt nicht minder dafür, als die stattliche Zahl sozial angesehener Zeugen, die er unter so durchsichtigem Schleier verbirgt, daß man noch heute viele mit Leichtigkeit identifizieren könnte. Beachten wir ferner, daß der Bericht über die merkwürdige Vorhersage bereits ein Jahr nach ihrem Eintreffen veröffentlicht wurde, also zu einer Zeit, wo noch alle, oder doch fast alle der genannten Zeugen lebten, so wird man um so weniger geneigt sein, ihm irgendwie zu mißtrauen.
Hier sei eine allgemeingültige Bemerkung eingeschaltet: Daß Eschenmayer nur die Anfangsbuchstaben, aber nicht den ganzen Namen nennt, mag in einer Anzahl von Fällen damit motiviert werden können, daß es tatsächlich nicht allzu großes Feingefühl verrät, wenn man über den Tod eines Menschen, noch dazu des eigenen Landesherrn, Wetten abschließt.
Aber auch die anderen Personen werden durch ähnliche Rücksichtnahme ausgezeichnet. Das ist bezeichnend, [S. 113]nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch für die Gegenwart. Auch heute – das beweisen die zahlreichen von Flammarion veröffentlichten Tatberichte, die so und so oft die Bitte um Verschweigen des Namens ›wegen meiner amtlichen Stellung‹ usw. enthalten, – ist die Feigheit weitester Kreise, auch der Gebildeten, geradezu fabelhaft.
Es mag manchem unangenehm sein, wenn mit Namen und Adresse von ihm berichtet wird, daß er silberne Löffel gestohlen oder einen Notzuchtversuch gemacht hat. Wie es aber jemand unangenehm sein kann, die Wahrheit eines Vorganges zu bezeugen ist – wenn er dabei nicht riskieren muß die Segnungen unserer Rechtspflege kennen zu lernen – völlig unverständlich. Oder vielmehr, es wäre es, wenn es nicht durch gewisse Folgen, die unsere aufgeklärte Zeit damit verbindet, verständlich gemacht würde.
Im Mittelalter war es bekanntlich höchst gefährlich, die Existenz der Hexen zu leugnen. Denn wer das tat, erklärte indirekt die Hexeninquisitoren für Toren oder Mörder, ein Verbrechen, das nach Recht und Billigkeit mit dem Tode geahndet wurde. Seit dem Siege der Aufklärung ist es umgekehrt. Was nicht alle Tage passiert, was nicht die Spatzen von den Dächern pfeifen, und das Begriffsvermögen von Hinz und Kunz übersteigt, gilt eo ipso für phantastisch oder unwahr. Darum riskiert jeder, der das Dogma von der Unmöglichkeit aller in die gerade heute herrschenden naturwissenschaftlichen Hypothesen und Theorien nicht hineinpassenden Phänomene nicht bedingungslos unterschreibt, die unangenehmsten Folgen. [S. 114]Entweder er wird als Phantast verschrien, der in den Wolken wandert, oder aber er gilt als Lügner. Nun ist es nicht jedermanns Sache, sich einer capitis diminutio seiner Ehre oder Urteilsfähigkeit unterziehen zu müssen. Nur wenige haben den, unter den obwaltenden Verhältnissen nicht geringen Mut, sich dem Geschrei der zwar urteilslosen, aber desto stimmkräftigeren und zahlreicheren Menge entgegenzustemmen.
Daraus folgt zwingend, daß heute das Dogma genau so herrscht, wie im finstersten Mittelalter. Nur sein Inhalt ist dem früheren konträr. Kritiklos aber wird es nachgebetet und befolgt von Leuten, die – und das ist das Komische an der Sache – sich für frei, aufgeklärt und vorurteilslos halten.
Die obige Prophezeiung ist abgesehen von ihrer guten Beglaubigung noch durch etwas anderes interessant. Die Fälle, daß jemandem der Tod vorherverkündet wurde und dann auch wirklich eintrat, sind nichts weniger als selten. Aber wir können häufig dem – bisweilen völlig berechtigten – Einwand begegnen, daß die Prophezeiung Ursache des Todes wurde. Denn es ist klar, daß suggestible Gemüter ihre ganze Widerstandskraft verlieren, wenn ihnen ein vorgeblich unentrinnbares Schicksal vorher verkündet wird[59].
Diese Erklärungsmöglichkeit schaltet hier vollkommen aus. Denn der König hatte von dieser Vorhersage natürlich keine Ahnung.
Der Skeptiker wird gegen solche Todesankündigungen [S. 115]immer einwenden können, daß sie – wie alle Vorhersagen – um beweiskräftig zu sein, vorher hätten gedruckt sein müssen. Das wird sich freilich gerade in diesen Fällen kaum verwirklichen lassen. Denn die Kitzlichkeit dieser Prophezeiungen schließt deren frühere Veröffentlichung geradezu aus. Man wird hier also immer mehr oder minder den Gewährsmännern Glauben schenken müssen.
Regelmäßig wird dabei ein ganz merkwürdiger Trugschluß begangen. Da nur wenige Personen ähnliche, sagen wir, mystische Daten überliefern, was ja in einer Zeit, die sie ungeprüft für Schwindel hält, ganz begreiflich ist; da diese wenigen Interessenten aber zumeist eine Reihe solcher Phänomene bezeugen, so wird stets gesagt: »Das ist wenig glaubwürdig, denn X. ist ja bekanntlich Mystiker.« Und doch liegt der Fall gerade umgekehrt. Nicht weil X. Mystiker ist, erzählt er okkulte Fälle und verdient deshalb kein Vertrauen, sondern er wurde Mystiker, weil er solche Erlebnisse hatte oder deren Zeuge war. Hier liegt also eine Verwechslung von Ursache und Wirkung vor.
Wir wollen nun noch einige Fälle des Vorgefühles des eigenen Todes anführen. Nachdem wir im vorigen Kapitel gesehen haben, daß sich noch in der Gegenwart Ähnliches sehr häufig ereignet, werden wir um so weniger an den historischen Berichten zweifeln. Und zwar wählen wir ausdrücklich Beispiele, in denen der Tod gewaltsam eintritt. Damit hoffen wir dem Einwurf begegnen zu können, daß das physische Übelbefinden, das vielleicht nicht klar zum Bewußtsein kommt, Ursache der Vorahnung ist.
[S. 116]De Baudus, der ehemalige Adjutant des Marschalls Bessières, erzählt in seinen »Etudes sur Napoléon«[60]:
»Am 30. Mai 1813 brachte das kaiserliche Hauptquartier die Nacht in Weißenfels zu. Auch der Marschall Bessières, welcher die ganze Kavallerie kommandierte, schlief hier. Ich frühstückte am anderen Morgen allein mit ihm, fand ihn sehr traurig und niedergeschlagen, und konnte ihn lange nicht bewegen, etwas von den aufgetragenen Speisen zu genießen; er antwortete immer, er habe keinen Hunger. Ich machte ihm bemerklich, daß unsere und die feindlichen Vorposten einander gegenüber ständen und wir folglich einen ernsthaften Kampf erwarten müßten, der uns wahrscheinlich den ganzen Tag nicht erlauben würde, etwas zu essen. Der Marschall gab endlich nach und sagte: ›Nun, wenn mich diesen Vormittag eine Kugel trifft, so soll sie mich wenigstens nicht mit nüchternem Magen finden.‹
Als er vom Tische aufstand, gab mir der Marschall den Schlüssel zu seinem Portefeuille und sagte: ›Suchen Sie doch gefälligst die Briefe von meiner Frau.‹ – Ich tat es und gab sie ihm. Er nahm sie und warf sie ins Feuer. Bis dahin hatte er sie sorgfältig aufbewahrt. Die Frau Herzogin von Istrien[61] hat mich seitdem versichert, der Marschall habe beim Abschiede zu mehreren Personen gesagt, er werde von diesem Feldzuge nicht zurückkommen.
Der Kaiser stieg zu Pferde, und der Marschall [S. 117]folgte ihm. Sein Gesicht war so bleich und seine Züge verrieten so tiefe Traurigkeit, daß es mir nicht entgehen konnte, und ich sagte zu einem Kameraden: ›Wenn es heute zu einer Schlacht kommt, wird der Marschall wohl bleiben.‹ –
Die Schlacht begann. Der Herzog von Elchingen[62] hatte das Dorf Rippach mit seiner Infanterie besetzt, und der Herzog von Istrien bereitete sich das Defilé zu rekognoszieren, aus welchem der Feind verdrängt war, während er mit seinen Truppen hindurch marschieren wollte. Als er auf der Höhe angelangt war, welche das Dorf beherrscht[63], am Ende desselben nach Leipzig zu, befand er sich vor einer Batterie, die der Feind da aufgefahren hatte, um die Straße zu bestreichen. Die erste Kugel, welche von dieser Batterie kam, riß einem Quartiermeister der Garde der polnischen Chevaulegers den Kopf weg; er hatte seit mehreren Jahren Ordonnanzdienste beim Herzog getan. Dieser Verlust verstimmte den Herzog von Istrien und er entfernte sich im Galopp. Nach einigen Augenblicken kam er jedoch mit Gefolge wieder zurück und sagte, indem er auf den Leichnam deutete: ›Der junge Mann muß begraben werden; auch würde der Kaiser unzufrieden sein, wenn er einen Unteroffizier seiner Garde tot hier liegen sähe; denn wenn der Posten wieder gewonnen wird, könnte der Feind glauben, die Garde sei zurückgewichen.‹
[S. 118]Eine Kugel, welche von derselben Batterie kam, streckte den Marschall in dem Augenblicke tot nieder, als er diese Worte gesagt hatte. Die linke Hand, welche den Zügel hielt, als er gerade sein Fernrohr einsteckte, wurde ganz zerschmettert; die Kugel ging ihm durch den Leib. Seine Uhr blieb stehen, ob sie gleich nicht getroffen wurde; sie zeigt noch jetzt seine Todesstunde an, denn sie wurde seitdem nicht wieder aufgezogen.«
So weit der Bericht des Augenzeugen de Baudus.
Auch Marschall Lannes fühlte seinen Tod voraus. Als 1809 der Krieg mit Österreich ausbrach, nahm er von Frau und Kindern in der festen Überzeugung Abschied, daß er sie nicht wieder sehen werde. Er fiel am 22. Mai bei Eßlingen[64].
Der General Lasalle konnte vor der Schlacht bei Wagram, von Todesahnungen beunruhigt, nicht schlafen. Er schrieb an Napoleon und empfahl ihm Frau und Kinder. Seinen Freunden gegenüber sprach er mit Bestimmtheit davon, daß er den Tag nicht überleben würde. Diese Tatsache wird nicht nur von Zeugen bestätigt, sondern Napoleon selbst erzählt in seinen Memoiren von St. Helena, Lasalle habe ihm mitten in der Nacht geschrieben und ihn gebeten, sein Majorat auf seinen Sohn übergehen zu lassen, da er fürchte, in der morgigen Schlacht zu fallen[65].
[S. 119]Auch von Cervoni erzählt Napoleon, daß er vor der Schlacht von Eckmühl Todesahnungen ausgesprochen habe, die eintrafen.
Ebenso hatte Duroc vor der Schlacht bei Bautzen Todesahnungen. Er sprach hiervon zu Napoleon, der ihn nicht beruhigen konnte, vielmehr von Durocs innerer Erregung gleichfalls ergriffen wurde. Während der Schlacht brachte ein Adjutant die Nachricht, daß der Marschall gefallen sei und die Augenzeugen erzählen, daß sich Napoleon vor die Stirn schlug und ausrief: »Meine Ahnungen trügen niemals.« Napoleon war nämlich selbst von Ahnungen heimgesucht und hielt viel von ihnen.
Ein Kapitel für sich bilden die Prophezeiungen von Davis.
Der um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika lebende Andrew Jackson Davis besaß die Gabe des räumlichen und zeitlichen Fernsehens. Man kann sich davon leicht aus seinen Büchern überzeugen, nachdem eine Reihe von Vorhersagen erst jetzt in Erfüllung gegangen ist.
In seinem Werke »The principels of nature« (New York 1847), das er in somnambulen Zustande diktierte, stellt Davis die Behauptung auf, es gäbe noch einen transneptunischen neunten Planeten. Damals hatte man noch kaum eine Ahnung vom achten Planeten. Gegenwärtig aber sind die Astronomen dabei, den neunten zu entdecken, was nur auf Grund der neuesten Instrumente und der Himmelsphotographie möglich ist, Mittel, die für Davis gar [S. 120]nicht in Frage kamen. Zweifellos ist diese Entdeckung ein idealer Beweis für das räumliche Fernsehen.
Da wir uns aber auf das Zeitliche beschränken, seien einige Prophezeiungen Davis’ noch angeführt. In seinem Werke »The Penetralia« (New York 1856, deutsch Leipzig 1884 bei Wilhelm Besser) findet sich auf Seite 219 folgende Vorhersage:
»Gebet acht in jenen Tagen! – auf Wagen, Equipagen, Reisesalons auf der Landstraße, ohne Pferde, ohne Dampf, ohne jedwede sichtbare Bewegungskraft, alles bewegt sich mit großer Schnelle und weit größerer Sicherheit als gegenwärtig. Equipagen und Wagen schwerer Gattung werden durch eine seltsame und dabei einfache Verbindung von Wasser und atmosphärischen Gasen bewegt werden. Diese Verbindung wird so leicht kondensiert, so einfach entzündet und unseren gegenwärtigen Lokomotiven ähnlich angewendet, daß der ganze Apparat zwischen den Vorderrädern verborgen und gehandhabt werden kann. Diese Fahrgelegenheiten werden viele Verlegenheiten verhindern, wie solche jetzt die Bewohner wenig bevölkerter Gegenden durchzumachen haben. Die erste Bedingung für diese Landlokomotiven wird eine gute Straße sein, auf der mit der neuen Lokomotive ohne Pferde mit großer Schnelligkeit gefahren wird. Diese Fahrgelegenheiten werden von wenig komplizierter Bauart sein.«
Interessant ist, daß dieses visionär geschaute Automobil wie die allerneuesten Fabrikate den Motor zwischen den Vorderrädern hat!
Bedenkt man, daß es noch gar nicht lange her ist, daß hervorragende Techniker vor Versuchen, [S. 121]Automobile zu konstruieren, als Utopie abrieten, daß der erste brauchbare Motorwagen erst 1885 erschien, das erste brauchbare Straßenlokomobil 1890, so muß man allerdings über diese Prophezeiung aus dem Jahre 1856 staunen.
Auf derselben Seite schreibt Davis auch über die Luftschiffahrt. »Es ist nur ein Ding notwendig, um Luftschiffahrt zu haben, und das ist die Anwendung dieser soeben in Betracht gezogenen höheren Bewegungskraft, die eben jetzt im Begriff ist, entdeckt zu werden. Der nötige Mechanismus, die Gegenluftströmung zu überwinden, um in der Luft ebenso leicht, sicher und angenehm wie die Vögel zu segeln, – hängt ebenfalls von dieser neuen Bewegungskraft ab. Diese Kraft wird kommen! Sie wird nicht nur die Lokomotiven auf den Schienen, die Wagen aller Gattung auf der Landstraße, sondern auch die Luftwagen in Bewegung setzen, die durch den Äther hin von Land zu Land reisen.«
Es handelt sich hier augenscheinlich um den Explosionsmotor, der damals noch nicht einmal geahnt wurde und dessen Erfindung Voraussetzung der Luftschiffahrt mit Fahrzeugen schwerer als die Luft war.
Solche Vorhersagen, die teils schon eingetroffen sind, zum Teil wohl noch eintreffen werden, enthalten die Werke von Davis noch viele.
Doch auch eine politische Vorhersage aus einem Briefe vom Jahre 1868 an den Übersetzer seiner Werke, Dr. Gregor Constantin Wittig, sei angeführt.
»Es scheint mir« – schreibt Davis – »daß Preußen bestimmt ist, eine Art Amerika im alten Europa zu [S. 122]werden. Ich glaube, daß es nicht lange mehr dauern wird und der ›Bund‹ wird Süd- und Norddeutschland in sich vereinigen. Napoleon kann jetzt nichts dagegen tun; und die, wenn es mir gestattet ist, sie so zu nennen, große deutsche Republik, wird dann Europa seine Geschicke vorschreiben. Und sie wird immer größere Freiheit und immer mehr Fortschritt erringen.«
Der Brief wurde 1869, also vor Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges in den Vorbemerkungen zu dem erstgenannten Werk »Die Prinzipien der Natur« usw. Seite LXIV abgedruckt[66].
*
Endlich wollen wir noch einige Fälle von bemerkenswerten Vorhersagen aus der jüngsten Vergangenheit anführen.
Der furchtbare Pariser Bazarbrand in der Nähe der Champs Elysées, dem am 4. Mai 1897 außer vielen anderen vornehmen Personen auch die Herzogin von Alançon, die Schwester der ermordeten Kaiserin Elisabeth von Österreich, zum Opfer fiel, wurde von Fräulein Couédon, Tochter eines Pariser Rechtsanwalts, anfangs Mai 1896 im Salon des Grafen Urbain de Maillé vorhergesagt. Und zwar trug sich die Begebenheit folgendermaßen zu:
Der Graf Maillé machte – wie der »Temps« unterm 16. Mai 1897 – also allerdings kurz nach dem Brande – mitteilte, folgende Angaben:
[S. 123]»Ich hatte Mlle. Couédon in ihrer Wohnung befragt, und obwohl ich durchaus nicht an die Mitwirkung des Erzengels Gabriel[67] glaubte, so schienen mir doch die Enthüllungen des jungen Mädchens äußerst merkwürdig zu sein. Auf meine Bitte willigte Mlle. Couédon ein, ausnahmsweise einmal entgegen ihren sonstigen Gepflogenheiten sich bei mir hören zu lassen, und zwar in Gegenwart von etwa hundert Personen, unter denen sich die Frau Gräfin Aimery de la Rochefoucauld, Frau v. Mesnard, die Marquise d’Anglade, die Gräfin Virien, der Graf Fleury und verschiedene andere befanden. Nachdem Mlle. Couédon die Neugier derjenigen Geladenen, welche sie jeder für seine Person befragt hatten, befriedigt hatte, kam der Moment, wo sie uns von dem bevorstehenden Brande sprach. Vielleicht sprach sie nicht dieselben Worte, die Sie mir berichten, aber jedenfalls war der Sinn fast derselbe. Sie sprach von ›einem großen Brande, welcher in einer zu Wohltätigkeitszwecken [S. 124]gebildeten Gesellschaft ausbrechen würde‹ – ›Ich sehe‹, sagte sie, – ich zitiere aus dem Gedächtnis – ›daß die Spitzen der Gesellschaft werden getroffen werden. Und ganz besonders wird das Faubourg St. Germain zu leiden haben.‹ Und ganz genau entsinne ich mich, daß die Seherin hinzufügte: ›Keine der hier versammelten Personen wird in Mitleidenschaft gezogen werden!‹ – und sich mir persönlich zuwendend: ›Sie selbst werden nur ganz von ferne davon berührt werden, sozusagen nur auf indirektem Wege.‹ In der Tat ist keiner unserer Gäste von dem Unglück betroffen worden. Was mich anbelangt, so habe ich gemäß den Voraussagen der Mlle. Couédon eine ganz entfernte Kusine verloren, welche ich kaum kenne.«
So weit die Worte des Grafen in dem im Temps veröffentlichten Briefe.
Außer diesem Zeugnis besitzen wir noch eines vom Redakteur der Pariser Zeitung »La libre Parole« und »L’Echo de Merveilleux«, Gaston Méry. Im letztgenannten Organ schreibt er am 25. Mai u. a.
»Man weiß daß Fräulein Couédon sich stets beharrlich geweigert hat, in Gesellschaft zu gehen. Ein einziges Mal – nur einmal – machte sie zugunsten der Gräfin de Maillé eine Ausnahme; es war zu Anfang Mai 1896. In den Salons der Frau von Maillé hatte sich das ganze Viertel Rendezvous gegeben. Zuerst sprach Fräulein Couédon privatim mit denen unter den Eingeladenen, die sie konsultieren wollten. Aber ihre Anzahl war so groß, daß Fräulein Couédon auf Bitten der Herrin des Hauses einwilligte, nachdem sie den ›Engel Gabriel‹ angerufen hatte, vor [S. 125]der ganzen versammelten Gesellschaft zu sprechen. Unter anderen Prophezeiungen machte sie die nachfolgende, deren sich mehrere Zeugen vollkommen erinnern und deren Wortlaut sie selbst rekonstruiert hat:
In deutschen Zeitungen wurde der Inhalt folgendermaßen wiedergegeben: |
|
»Près des Champs-Elysées, Je vois un endroit pas élevé, Qui n’est pas pour la piété, Mais qui en est approché Dans un but de charité Qui n’est pas la vérité . . . Je vois le feu s’élever . . . Et les gens hurler Des chairs grillées, Des corps calcinés, J’en vois comme par pelletés.« – |
»In der Elysäischen Felder Nähe Ich ein wüstes Gedränge sehe. Erst dem Mitleid war es geweiht, Dann aber macht es viel Herzeleid. Flammen seh’ ich lodern und sengen, Ängstlich die Menge sich furchtbar drängen; Lebendes Fleisch seh’ ich geröstet, Körper verbrannt, die Luft verpestet!« |
Der »Engel« fügte hinzu, daß alle zuhörenden Personen verschont werden würden. Darauf sagte einer der Anwesenden, der Vicomte de Fleury, sehr ungläubig und scherzend zu der Seherin: »Ach, Sie sagen das nur so, um uns zu schmeicheln!« In der Tat ist keiner der zu dieser Soirée Eingeladenen, die alle mehr oder minder regelmäßig bei den Wohltätigkeitsverkäufen zugegen waren, umgekommen oder bei der schrecklichen [S. 126]Katastrophe des 4. Mai verwundet worden. Unter den bei dieser Soirée Anwesenden befanden sich: die Marquise d’Anglade, die Komtesse Virien, die Grafen Divonne usw.«
Die Tatsache, daß Fräulein Couédon in der Rue Jean Coujon diese schreckliche Brandkatastrophe, bei der über hundert Menschen, meist aus der ersten Gesellschaft, ums Leben kamen und deren sich wohl die meisten noch erinnern werden, vorhergesehen hat, unterliegt nach den Berichten, wiewohl sie erst ein Jahr später zu Papier gebracht wurden, nicht dem allergeringsten Zweifel.
Die Übereinstimmung der gleichzeitig und unabhängig voneinander abgefaßten Berichte des Grafen Maillé und des Herrn Gaston Méry sind ja schon hinlängliche Beweise für die Authentizität des Mitgeteilten. Dazu kommen die genannten Zeugen, des weiteren, daß sich viele von ihnen, wenn nicht an den Wortlaut, so doch an den Inhalt erinnerten, daß man schon vor der Katastrophe zu andern davon gesprochen hatte usw.
In diesem Falle ist Autosuggestion ganz ausgeschlossen. Denn eine Gesellschaft, die mehr oder minder in Wohltätigkeitsbazaren aufgeht, erinnert sich – wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang –, wenn jemand vor sie hintritt, der ihr zuruft, daß sie bei solcher Gelegenheit auf gräßliche Weise ums Leben kommt. Sie atmet aber auch erleichtert auf, wenn sie damit beruhigt wird, daß keine der anwesenden Personen noch deren nahen Anverwandten dem Unglück zum Opfer fällt. Ein Irrtum des Gedächtnisses bezüglich des essentiellen Inhaltes der Prophezeiung [S. 127]ist in diesem Falle ganz ausgeschlossen. Das wurde auch meines Wissens von keiner Seite behauptet.
Eine Kritik, die Dinge, die sich vor Hunderten von Zeugen, die dazu zusammenkamen, um eben diese Dinge zu beobachten, leugnen wollte, würde einen viel größeren Fehler begehen, als die alten Astronomen, die das Vorkommen von Meteoren bestritten. Und da von diesen Zeugen alle noch lebten, viele heute noch leben, so kann die Kritik leichter leugnen, daß Napoleon I. existiert hat, als die Tatsächlichkeit dieser Prophezeiung.
Und das, wiewohl der Text der Vision rekonstruiert wurde. Denn was für uns ausschlaggebend ist und mit Rücksicht auf die Fixierung erst nach dem Ereignis auch nur beweiskräftig sein kann, ist ja nur der wesentliche Kern der Prophezeiung. Der aber lautet:
Es wird in der Nähe der Champs-Elysées, also in Paris, bei einem Wohltätigkeitsfest ein großes Brandunglück geben.
Ist diese Prophezeiung schon interessant genug, so wird sie durch den mündlichen Zusatz – der gut beglaubigt ist –, daß niemand der Anwesenden oder aus deren Verwandtschaft zugrunde gehen würde, verblüffend. Denn gerade diese, numerisch gar nicht sehr zahlreiche Gesellschaftsschicht, veranstaltet doch in Paris, wie in jeder anderen Großstadt, derartige Festlichkeiten. Wir dürften daher in der Prophezeiung des Fräulein Couédon einen der besten Beweise für die Existenz dieser Gabe sehen.
Über die Sprechweise der Seherin berichtet Méry im genannten Aufsatz: »Sie spricht oder vielmehr: [S. 128]sie leiert eintönig rhythmisch abgemessene Sätze her, welche assonierend klingen und von denen manche refrainartig wiederkehren. Es sind keine Verse und auch keine Prosa; ein Mittelding, etwas Unfaßbares ist es, was sich mit einer gewissen Melancholie und Eintönigkeit endlos abwickelt, wobei fast unverändert dieselben Assonanzen immer wieder hörbar werden.«
*
In Nummer 290 vom 1. Februar 1909 brachte das »Echo du merveilleux« folgenden Bericht[68]:
»Eine römische Dame, welche seit mehreren Monaten an akuter Neurasthenie, oder besser gesagt, Hysterie leidet, hat seit dem verflossenen 2. Dezember vorigen Jahres die Katastrophe vorausgesagt, die Messina zerstört und Kalabrien verheert hat. Diese Dame, welche einer hervorragenden Familie der Aristokratie angehört, ließ schleunigst den Dr. Sarti rufen, nachdem sie in der Nacht durch ein schreckliches Traumgesicht gepeinigt worden war, das bei ihr eine quälende Beunruhigung zurückgelassen hatte. Vergebens bot der Arzt alle Mittel auf, die Dame zu beruhigen; dies gelang ihm erst, als er ihr versprach, einen von ihr geschriebenen Brief dem König zu übergeben.
In diesem Briefe wurde S. Majestät der König Viktor Emanuel gebeten, der Stadt Messina zur Hilfe zu kommen, welche von einem furchtbaren Erdbeben bedroht sei. »Ich sehe,« so heißt es in dem Briefe, »sich Land [S. 129]und Meer vereinigen, um die schöne Stadt zu verschlingen. Dieses entsetzliche Unglück wird sich am 8., 18., oder 28. des Monats ereignen.«
In der Überzeugung, daß er es mit einer Halluzinierenden zu tun habe, steckt der Arzt den Brief in sein Portefeuille, und als er andern Tages so tat, als habe er die Botschaft an den Souverän habe gelangen lassen, zeigte sich die Kranke ruhiger und bereit, einige Nahrung, sowie die verordnete Medizin zu sich zu nehmen. Aber in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember wurde sie von einer heftigen hysterischen Krise befallen. Sie wand sich, weinte, schrie und fragte unaufhörlich, ob der König angeordnet habe, daß Messina geräumt werde. Auch eine weitere Krisis in der Nacht vom 17. Dezember spielte sich höchst dramatisch ab und eine solche vom 27. war derart ernst, daß man in der Umgebung der Patientin glaubte, ihre letzte Stunde sei gekommen. Sie lamentierte und schüttelte sich vor Angst bis zum Abend des 28. Alsdann verfiel sie in einen tiefen Schlaf . . . Die Katastrophe hatte stattgefunden.
Dr. Sarti war im höchsten Grade betroffen über die Richtigkeit der Prophezeiung seiner Kranken. Die grauenvolle Brutalität, mit welcher die Vorschau seiner Patientin in Erfüllung gegangen ist, hat bei ihm jeden Zweifel für immer erstickt. Er bereitet über diesen Fall eine Denkschrift für die Akademie vor, und will seine Klientin den italienischen Autoritäten auf dem Gebiete der Psychologie vorstellen.
Der fragliche Brief ist nachträglich dem König übergeben worden, der mit dem größten Interesse [S. 130]den Untersuchungen entgegen sieht, welche die Fakultät bei der Prophetin anstellen wird.
Diese Mitteilung wurde zuerst im »Gil Blas« am 20. Januar 1910 veröffentlicht. Das »Echo« bemerkt dazu: »Wenn der betreffende Brief wirklich das enthält, was behauptet wird, die genauen Angaben über das bevorstehende Unglück von Messina und Reggio, über das Datum und die Art des Ereignisses, so hätten wir ein überaus wertvolles Dokument vor uns.«
Aus später noch zu erörternden Gründen hätte es nicht viel Wert, noch weitere vereinzelte Beispiele zeitlichen Vorhersehens hier zusammen zu stellen. Gewiß könnten wir noch recht viel des Interessanten bieten, aber ein zwingender Beweis ist auf diesem Wege für den hartnäckigen Zweifler kaum zu erbringen. Immerhin möchten wir der Überzeugung Ausdruck geben, daß es nicht allzu schwer sein würde, den Nachweis zu liefern, daß jedes oder doch fast jedes bedeutende Ereignis der Weltgeschichte, besonders tragische Dinge, mehr oder minder klar und genau von dazu befähigten Personen vorhergesagt wurde.
Zum Schlusse dieses fast allzulangen Kapitels wollen wir noch einen Gewährsmann für den Glauben an Telepathie anführen – denn er bekennt ausdrücklich, kein bestimmtes Wissen davon zu haben – einen Eideshelfer, dessen Intelligenz und Wahrheitsliebe wohl von niemand in Zweifel gezogen wird: Goethe!
Bekannt ist Goethes Vision, die er in seiner »Dichtung und Wahrheit« (3. Teil, 11. Buch) erzählt:
»In solchem Drang und Verwirrung konnte ich [S. 131]doch nicht unterlassen, Friederiken noch einmal zu sehen. Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Als ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Tränen in den Augen, und mir war sehr übel zumute. Nun ritt ich auf dem Fußpfade gegen Drusenheim, und da überfiel mich eine der sonderbarsten Ahnungen. Ich sah nämlich, nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes, mich mir selbst, denselben Weg, zu Pferde wieder entgegen kommen, und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen: es war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, war die Gestalt ganz hinweg. Sonderbar ist es jedoch, daß ich nach acht Jahren in dem Kleide, das mir geträumt hatte und das ich nicht aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug, mich auf demselben Wege fand, um Friederiken noch einmal zu besuchen. Es mag sich übrigens mit diesen Dingen, wie es will, verhalten, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicken des Scheidens einige Beruhigung.«
Wie Goethe im übrigen den okkulten Phänomenen gegenüber stand, ergibt sich aus folgendem Passus aus seinen Wahlverwandtschaften. Bekannt ist oder könnte doch sein, was er im elften Kapitel des zweiten Teiles über die Wünschelrute erzählt. Da dieses Phänomen aber seit zwei Jahren sogar von der Fachwelt anerkannt zu werden beginnt, hat es für uns weniger Interesse, als die andere Stelle, die wie folgt lautet (2. Teil, 8. Kapitel):
»Wenn sie (Ottilie) sich abends zur Ruhe gelegt und im süßen Gefühl noch zwischen Schlaf und [S. 132]Wachen schwebte, schien es ihr, als wenn sie in einen ganz hellen, doch mild erleuchteten Raum hineinblickte. In diesem sah sie Eduarden ganz deutlich, und zwar nicht gekleidet, wie sie ihn sonst gesehen, sondern im kriegerischen Anzug, jedesmal in einer anderen Stellung, die aber vollkommen natürlich war und nichts Phantastisches an sich hatte: stehend, gehend, liegend, reitend. Die Gestalt, bis aufs kleinste ausgemalt, bewegte sich willig vor ihr, ohne daß sie das mindeste dazu tat, ohne daß sie wollte oder die Einbildungskraft anstrengte. Manchmal sah sie ihn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichem, das dunkler war, als der helle Grund, aber sie unterschied kaum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Menschen, als Pferde, als Bäume oder Gebirge vorkommen konnten. Gewöhnlich schlief sie über der Erscheinung ein, und wenn sie nach einer ruhigen Nacht morgens wieder erwachte, so war sie erquickt, getröstet, sie fühlte sich überzeugt: Eduard lebe noch, sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Verhältnis.«
Es handelt sich hier unzweifelhaft um ein telepathisches Phänomen. Mag Goethe nun Ähnliches aus zuverlässiger Quelle erfahren, mag er es, wie seine Drusenheimer Vision, selbst erlebt haben, eines ist sicher: er hielt es für möglich, denn sonst hätte er ganz gewiß nicht gewagt, in einer Zeit der rücksichtslosesten Aufklärung solche erstaunliche Begebenheiten zu schildern.
Übrigens verleiht er seiner Ottilie in den »Wahlverwandtschaften« (2. Teil, 11. Kapitel) noch eine andere Fähigkeit, die dem Vorgefühl eines Witterungswechsels, unter dem ja viele Leute leiden und das [S. 133]Shakespeare im Hamlet bereits in die Literatur einführt, verwandt zu sein scheint. Der Passus lautet:
»Ottilie, die uns begleitete, stand an zu folgen, und bat sich auf dem Kahne dorthin begeben zu dürfen. Ich setzte mich mit ihr ein und hatte meine Freude an der Gewandtheit der schönen Schifferin. Ich versicherte ihr, daß ich seit der Schweiz, wo auch die reizendsten Mädchen die Stelle des Fährmanns vertreten, nicht so angenehm sei über die Wellen geschaukelt worden, konnte mich aber nicht enthalten sie zu fragen, warum sie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu machen: denn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art von ängstlicher Verlegenheit.
Wenn Sie mich nicht auslachen wollen, versetzte sie freundlich, so kann ich Ihnen darüber wohl einige Auskunft geben, obgleich selbst für mich dabei ein Geheimnis obwaltet. Ich habe jenen Nebenweg niemals betreten, ohne daß mich ein ganz eigener Schauer überfallen hätte, den ich sonst nirgends empfinde und den ich mir nicht zu erklären weiß. Ich vermeide daher lieber mich einer solchen Empfindung auszusetzen, um so mehr, als sich gleich darauf ein Kopfweh an der linken Seite einstellt, woran ich sonst auch manchmal leide.
Wir landeten, Ottilie unterhielt sich mit Ihnen, und ich untersuchte indes die Stelle, die sie mir aus der Ferne deutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Verwunderung, als ich eine sehr deutliche Spur von Steinkohlen entdeckte, die mich überzeugt, man würde bei einigem Nachgraben vielleicht ein ergiebiges Lager in der Tiefe finden.«
Goethe hatte selbst wiederholt telepathische Erlebnisse [S. 134]gehabt. Er sagt: »Unter Liebenden ist diese magnetische Kraft besonders stark und wirkt sogar in die Ferne. Ich habe in meinen Jünglingsjahren Fälle genug erlebt, wo mich auf einsamen Spaziergängen ein mächtiges Verlangen nach einer Geliebten überfiel, und wo ich so lange an sie dachte, bis sie mir wirklich entgegen kam. Es wurde mir in meinem Stübchen unleidlich, sagte sie; ich konnte mir nicht mehr helfen, ich mußte hierher.« Einen solchen Fall erzählt Goethe ausführlich[69]. Das ist allerdings ein räumliches Ferngefühl.
Die Gabe der Weissagung oder doch die der Visionen – man erinnere sich des Drusenheimer Falles – war in Goethes Familie heimisch. Man höre, was er darüber in »Dichtung und Wahrheit« erzählt[70]:
»Was jedoch die Ehrfurcht, die wir für diesen würdigen Greis (Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Textor) empfanden, bis zum Höchsten steigerte, war die Überzeugung, daß derselbe die Gabe der Weissagung besitze, besonders in Dingen, die ihn selbst und sein Schicksal betrafen. Zwar ließ er sich gegen niemand als gegen die Großmutter entschieden und umständlich heraus; aber wir alle wußten doch, daß er durch bedeutende Träume von dem, was sich ereignen sollte, unterrichtet werde. So versicherte [S. 135]er z. B. seiner Gattin, zur Zeit als er noch unter die jüngeren Ratsherren gehörte, daß er bei der nächsten Vakanz auf der Schöffenbank zu der erledigten Stelle gelangen würde. Und als wirklich bald darauf einer der Schöffen, vom Schlage gerührt, starb, verordnete er am Tage der Wahl und Kugelung daß zu Hause im stillen alles zum Empfang der Gäste und Gratulanten solle eingerichtet werden, und die entscheidende goldene Kugel ward wirklich für ihn gezogen. Den einfachen Traum, der ihn hiervon belehrt, vertraute er seiner Gattin folgendermaßen: Er habe sich in voller gewöhnlicher Ratsversammlung gesehen, wo alles nach hergebrachter Weise vorgegangen. Auf einmal habe sich der nun verstorbene Schöff von seinem Sitze erhoben, sei herabgestiegen und habe ihm auf eine verbindliche Weise das Kompliment gemacht; er möge den verlassenen Platz einnehmen, und sei darauf zur Türe hinausgegangen.
Etwas Ähnliches begegnete, als der Schultheiß mit dem Tode abging. Man zaudert in solchem Falle nicht lange mit Besetzung dieser Stelle, weil man immer zu fürchten hat, der Kaiser werde sein altes Recht, einen Schultheißen zu bestellen, irgend einmal wieder hervorrufen. Diesmal ward um Mitternacht eine außerordentliche Sitzung auf den andern Morgen durch den Gerichtsboten angesagt. Weil diesem nun das Licht in der Laterne verlöschen wollte, so erbat er sich ein Stümpfchen, um seinen Weg weiter fortsetzen zu können. ›Gebt ihm ein ganzes‹, sagte der Großvater zu den Frauen; ›er hat ja doch die Mühe um meinetwillen.‹ Dieser Äußerung entsprach auch der Erfolg: er wurde wirklich [S. 136]Schultheiß; wobei der Umstand noch besonders merkwürdig war, daß, obgleich sein Repräsentant bei der Kugelung an der dritten und letzten Stelle zu ziehen hatte, die zwei silbernen Kugeln zuerst herauskamen und also die goldne für ihn auf dem Grunde des Beutels liegen blieb.
Völlig prosaisch, einfach und ohne Spur von Phantastischem oder Wundersamem waren auch die übrigen der uns bekannt gewordnen Träume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als Knabe unter seinen Büchern und Schreibkalendern gestöbert und darin unter andern auf Gärtnerei bezüglichen Anmerkungen aufgezeichnet gefunden: ›Heute nacht kam N. N. zu mir und sagte . . . . . Name und Offenbarung waren in Chiffren geschrieben. Oder es stand auf gleiche Weise: Heute nacht sah ich . . . . Das übrige war wieder in Chiffren, bis auf die Verbindungs- und andere Worte, aus denen sich nichts abnehmen ließ.
Bemerkenswert bleibt es bei, daß Personen, welche sonst keine Spur von Ahnungsvermögen zeigten, in seiner Sphäre für den Augenblick die Fähigkeit erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entfernung vorgehenden Krankheits- und Todesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Vorempfindung hatten. Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Gabe fortgeerbt; vielmehr waren sie meistenteils rüstige Personen, lebensfroh und nur aufs Wirkliche gestellt[71].«
[35] Vgl. Enneas Sylvius (Piccolomini), Historia Friderici, ed. Kollar, p. 136.
[36] Vgl. Eduard Vehse, Geschichte des preußischen Hofes und Adels (in der Geschichte der deutschen Höfe), I. Bd., S. 48.
[37] Vgl. Walter Bormann, »Die Nornen«, S. 206 f. Ailly beruft sich noch auf einen »tractatus de magnis coniunctionibus« von Abumasar. M. J. Schleiden bespricht in seinen »Studien«, Leipzig 1855, S. 264 ff., diese Vorhersage und kommt zu dem Resultate, daß sie auf einem astronomischen Rechenfehler beruhe, da der große Saturnumlauf nicht 300, sondern nur 294½ Jahre betrage. Das braucht uns nicht weiter zu kümmern, da es an der Tatsache der richtigen Vorhersage nichts ändert.
[38] Vgl. Schleiden, Studien, S. 247 f. Über Astrologie – vom gegnerischen Standpunkt aus – vergleiche dessen Aufsatz »Wallenstein und die Astrologie«, Studien, S. 217 f. Es mag Vielen neu sein, daß unter dem Namen »Zodiakus« seit 1910 eine deutsche astrologische Zeitschrift erscheint.
[39] Vgl. Ch. Lichtenberg, Vermischte Schriften, IV. Band. Göttingen 1802, S. 214.
[40] Schleiden, Studien, S. 243.
[41] Vgl. Tharsander, Schauplatz sonderbarer Meinungen I, S. 187. Goclenii Libri Uraniae divinatricis. Marp. 1694. Zitiert nach (Vulpius) »Curiositäten der Vor- und Mitwelt« 5. Bd., Weimar 1816, S. 15. Hier sei nicht verschwiegen, daß die Tradition, Lucas Gauricus habe den Tod Heinrichs II. von Frankreich vorhergesagt – vgl. »Curiositäten« S. 15 – falsch ist. Vgl. (Adelung) Geschichte der menschlichen Narrheit, II. Bd., Leipzig 1786, S. 261. Hier sind noch andere falsche Nativitäten notiert. Vgl. auch Suden, Gelehrter Kritikus, 3. Bd., S. 62. Weitere Literatur in »Curiositäten«, 5. Bd., S. 15 Anm. ***. Was Keplers Vorhersage des Todes von Matthias betrifft, so kann ich sie bei Frisch, J. Kepleri opera omnia, I. B., Frankfurt 1858, p. 483 ff., nicht finden.
[42] Vgl. Freher, Theatrum virorum eruditorum, p. 1551. Die Schriften Goldmayers bei (Adelung) Geschichte der menschlichen Narrheit, 4. Bd., S. 218 ff.
[43] Vgl. Allgemeine deutsche Biographie, 15. Bd., p. 618.
[44] Vgl. Albert Kniepf, Zodiakus, 1911, S. 3 ff.
[45] Vgl. Zadkiels Almanac 1911, London, nach gütiger Mitteilung des Herrn A. Kniepf.
[46] Zitiert nach »Woldenckwürdige Weissagung unnd Propheceyung, von den jetzigen Läufften, unnd sonderlich von dem noch innstehenden 1619. Unnd nachfolgenden 1620. 1621. 1622. 1623 Jahre. Von Johanne Capistrano usw.« 1619. VII. Abschnitt.
[47] Vgl. E. A. Schmidt, Geschichte von Frankreich in Heeren und Ukert, Geschichte der europäischen Staaten, 3. Bd., Hamburg 1846, S. 386 f.
[48] »Journal de ma vie« Mémoires du maréchal de Bassompierre. I. Bd., Paris 1870, p. 270 f.
[49] Vgl. A. Debay, Histoire des sciences occultes. Paris 1860, p. 103. Das Folgende eb. p. 103 f.
[50] Zitiert nach Gottfried Arnold, Kirchen- und Ketzerhistorie, 3. Teil, Frankfurt a. M. 1700, Kap. 26, S. 248 ff. Die (ungedruckte) »Relation«, der Arnold diese Visionsberichte entnommen hat, trägt die Aufschrift: »So schrieb anno 1653. am II. Pfingsttage im namen der Heiligen Dreyfaltigkeit, ich Joachim Greulich, und bekenne mit GOTT und dem Vater, den Sohn, und den Heiligen Geist, wie folgt . . .«
[51] Vgl. v. Tettau, Erfurts Unterwerfung unter die mainzische Landeshoheit 1648–1664. Halle 1887 in den »Neujahrsblättern«, herausgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachsen und »Thüringische Lesehalle«, 1886, S. 173 f.
[52] Wir haben hier und weiter oben nur gesperrt, was auch im Original gesperrt gedruckt ist!
[53] (Adelung) Geschichte der menschlichen Narrheit, III. Bd., S. 118.
[54] Anm. der Erzählerin: Ein englischer Schrank, wie sie ihn wohl noch nie gesehen hatte. – Der Fall trägt bei Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, die Nummer LXXV und steht auf S. 411 ff.
[55] Vgl. G. Villani, Chronik von Florenz, Geschichte der Vorzeit, XIV. Jahrh., II. Bd., S. 137. Eine Verulkung der Prophetie hat sich aus dem Jahre 1536 erhalten unter der Titel »Propheci und wunder–/ barlich Pronostication, uff das 1536./ jar kürtzlich gefunden zu Rätersch/ eym im Nergaw.« Vgl. O. Clemen, Archiv für Kulturgeschichte, 7. Bd., 1909, S. 1 ff.
[56] Diese Mitteilung verdanke ich Fräulein Isolde Kurz. Vgl. unter anderen zeitgenössischen Quellen: Benedetto Varchi, Storia Florentina, Florenz 1844, 3. Bd., p. 262 ff. Auch Nardi und Guicciandini berichten ähnliches.
[57] Friedrichs des Großen Werke, Frankfurt und Leipzig 1788, S. 88–95.
[58] Leipzig 1817. Karl August von Eschenmayer, geb. 1768, gest. 1852, war Professor der Medizin und Philosophie in Tübingen. Seit 1836 ins Privatleben zurückgezogen, beschäftigte er sich viel mit Mystizismus, was ihm natürlich Spott eintrug. Immermann stellte ihn im »Münchhausen« unter dem Namen »Eschenmichel« satirisch dar.
[59] Vgl. A. J. Davis, Die Wirklichkeit eingebildeter Krankheiten: Sphinx, 2. Bd., 1886, S. 216 ff.
[60] Übersetzung von Kiesewetter, Psychische Studien, 17. Bd., 1890, S. 402 f.
[61] Bessières führte den Titel eines Herzogs von Istrien.
[62] Marschall Ney.
[63] Nach einer Anmerkung von Kiesewetter ist das ein Gedächtnisfehler von Baudus, da die Anhöhe, auf der sich jetzt ein Bessières’ Namen tragender Gedächtnisstein befindet, unweit Weißenfels nach Rippach zu liegt.
[64] Vgl. Justinus Kerner, »Magikon«, III. Bd., S. 262. Zitiert nach Kiesewetter a. a. O. gleich dem Folgenden.
[65] Nach Du Prel in den Psychischen Studien, 17. Bd., 1890, S. 207. Die in Kerners Magikon II, 263 berichtete Tatsache wurde von Du Prels Großonkel, einem Verwandten und Waffengefährten Lasalles, bestätigt. – Das Folgende nach Brierre de Boismont, Des hallucinations, S. 295 (nach Du Prel).
[66] Zu Davis vgl. H. Johannsen »Gibt es ein Hellsehen?« Psychische Studien, 36. Bd., 1909, S. 480 ff.
[67] Hierzu machte Frau de Ferriëm, »Mein geistiges Schauen in die Zukunft«, Berlin 1895, S. 105 Anm., der wir obenstehenden Bericht entnehmen, die Bemerkung: daß sich damals durch die französische Seherin ein Spirit kundgab, der sich merkwürdigerweise ebenso wie ihr »Haupt-Kontroll-Geist« »Gabriel« nannte usw. Die Erklärung für diese prophetischen »Geister« dürfte meines Dafürhaltens wie schon weiter oben bemerkt, im Kausalitätsbedürfnis der Seherinnen liegen. Sie beobachten an sich das Phänomen der Visionen usw., ohne es sich erklären zu können und greifen deshalb zur Spirithypothese, die weder bisher bewiesen wurde, noch auch notwendig ist, so wenig wir zum Hypnotismus oder zur drahtlosen Telegraphie »Spirits« benötigen. Es handelt sich hier jedenfalls um eine uns noch nicht näher bekannte Naturkraft.
[68] Zitiert nach den »Psychischen Studien«, 36. Bd., 1909, S. 78 ff.
[69] Vgl. Eckermann, Gespräche mit Goethe, III. S. 137–139. Die ebenda wiedergegebene Erzählung, der Dichter habe das Erdbeben, das am 5. Februar 1783 Messina zerstörte, in Weimar auf telepathischem Wege gespürt, ist nicht stichhaltig. Vgl. R. Hennig, Gartenlaube 1910, S. 758 (Nr. 36).
[70] 1. Teil, erstes Buch, Cottasche Ausgabe ed. Goedeke, 20. Bd., S. 38 ff.
[71] Vgl. auch den Aufsatz von A. P. Brumm, »Seltsames und Mystisches aus der englischen Dichterwelt«. »Sphinx«, II. Bd., 1886, S. 187 ff. Hier werden merkwürdige Dinge von W. Blake, Thomas de Quincey, Shelley und Walter Scott erzählt.
[S. 137]
Wir haben in den beiden vorangehenden Kapiteln eine ganze Reihe von Prophezeiungen angeführt und schlossen mit der Bemerkung, daß wir trotzdem nicht behaupten, schon einen zwingenden Beweis erbracht zu haben.
Das bedarf einer eingehenden Begründung.
Gegen unser Material muß zunächst eingeworfen werden, daß es sich zum Teil um Berichte handelt, die erst veröffentlicht wurden, nachdem das vorhergesagte Ereignis auch eingetreten war. Da ist die Vermutung möglich, die Zeugen hätten bewußt oder unbewußt die Unwahrheit gesagt.
Daß Lügen, gerade wenn es sich um so Ungewöhnliches handelt, wie in unserer Untersuchung, möglich sind, soll gewiß nicht bestritten werden. Immerhin stammt eine ganze Reihe von Daten von Leuten, an deren Wahrheitsliebe zu zweifeln schlechterdings nicht zulässig ist. Wer selbst auf seine Ehre etwas hält, wird sehr vorsichtig sein, wenn er in Versuchung [S. 138]kommt, der eines anderen zu nahe zu treten. Deshalb wollen wir den bewußten Schwindel ganz ausschalten. Es kämen ja überhaupt nur ganz wenige der hier mitgeteilten Phänomene für diese Art des Zweifels in Frage.
Wie aber steht es mit dem andern Einwurf, dem, die Gewährsmänner hätten unbewußt die Unwahrheit gesagt?
Wer die Psychologie der Zeugenaussage kennt, weiß, daß unser Gedächtnis uns oft in einer Weise im Stich läßt, die wir nicht für möglich gehalten hätten. In vieler Erinnerung wird noch das Experiment sein, das der große Strafrechtslehrer Franz von Liszt in seinem Seminar – also mit lauter gebildeten jungen Leuten – anstellte und das gänzlich negativen Erfolg hatte. Es handelte sich damals um den Bericht über ein von ihm im Hörsaal inszeniertes Attentat, wobei die Zeugen keine Ahnung davon hatten, daß es sich um eine abgekartete Sache handle. Allerdings mag damals die große Erregung und die Schnelligkeit, mit der sich die Vorgänge abspielten, das Resultat ungünstig beeinflußt haben. Aber zuzugeben ist, daß unserem Gedächtnis, zumal wenn es sich um Details handelt und besonders, wenn das Erlebnis lange zurück liegt, nicht allzuviel Glauben beizumessen ist.
Das liegt hauptsächlich in der Art begründet, in der solche Gedächtnisbilder zustande kommen. Es sind keineswegs, wie man annehmen sollte, lauter Beobachtungen, Eindrücke, die wie die Bilder auf der photographischen Platte festgehalten und nach Hause getragen werden. Vielmehr ist nur ein Bruchteil [S. 139]wirklich beobachtet, das andere aber kombiniert, und zwar ganz unbewußt kombiniert.
Sehen wir jemanden in großer Erregung mit gezücktem Dolch auf einen Dritten zustürzen und ihm scheinbar die Waffe in den Körper bohren, dann glauben wir auch sofort den Blutstrahl aufspritzen zu sehen. Auch wenn gar nicht zugestochen wurde. Unsere Phantasie, verbunden mit dem Kausalitätsbedürfnis, mit der Erfahrung, daß bei Wunden auch Blut fließt, spielte uns einen Streich.
Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Das Fazit, daß auch intelligente Menschen mit großer Wahrheitsliebe objektiv unwahre Dinge berichten, können wir schon jetzt ziehen. Die Vermutung bei besonders merkwürdigen Phänomenen, wie denen, um die es sich hier ausschließlich handelt, sei die Phantasie doppelt geschäftig, liegt gewiß nahe.
Nun ist aber dagegen einzuwenden, daß es sich fast regelmäßig um so Wichtiges – etwa den vorhergesagten Tod naher Angehöriger – handelt, daß das Essentielle der Vorhersage behalten wird, wenn auch Irrtümer in bezug auf die Nebenumstände vorkommen mögen. Denn wenn wir daran zweifeln wollen, daß jemand Fragen von solcher Bedeutung in sein Gedächtnis eingraben kann, dann müssen wir das Gedächtnis als Gehirntätigkeit überhaupt streichen. Dann kann auch jemand vergessen, daß er irgendwo verwundet wurde oder daß sein Vater starb. Auch hier führt eine Hyperkritik zu absurden Konsequenzen.
Einräumen wollen wir aber, daß in allen jenen Fällen, in denen die Vorhersage eines Ereignisses erst [S. 140]nach dessen Eintreffen publiziert wird, der Leser das Recht hat, an der Glaubwürdigkeit des oder der Zeugnisse zu zweifeln.
Deshalb schreibt der bekannte verstorbene Vorkämpfer des Okkultismus, Freiherr von Du Prel, ein Forscher, dessen Verdienste im vollen Umfange auch erst die Zukunft anerkennen wird:
Solche Visionen müssen »vor dem Eintreffen in einer Zeitschrift publiziert werden, selbst auf die Gefahr hin, daß einzelne nicht eintreffen. – Das bloße Deponieren im Archiv der betr. Gesellschaft hätte höchstens für die Gesellschaftsmitglieder einen Wert«.
Nun ist aber eine große Anzahl der von uns mitgeteilten Fälle von zeitlichem Fernsehen bereits früher, ja oft schon Jahrhunderte vorher, im Druck erschienen.
Was läßt sich gegen deren Beweiskraft anführen? Da besteht zunächst der Einwand, diese Prophezeiungen seien so unklar gefaßt, daß sie vielleicht auch auf andere Ereignisse bezogen werden könnten. Er ist häufig schwer oder gar nicht zu widerlegen.
Oder es heißt – und das ist einer der beliebtesten Gegengründe – man erinnere sich zwar genau der wenigen Vorhersagen, die zutrafen, vergesse aber alle jene, die falsch gewesen seien.
Diese Erwägung besteht zweifellos zu Recht. Es ist ja fabelhaft, wie viel und was für haarsträubend dummes Zeug prophezeit wurde und noch wird. In früheren Jahrhunderten gab man solche Elaborate gern in den Druck, heute ist man darin – nicht zum Schaden der Sache – zurückhaltender geworden.
[S. 141]Wenn wir nun auch ohne weiteres die Berechtigung dieser Art des Zweifels zugeben und es uns gar nicht einfällt, zu bestreiten, daß es geradezu ein Wunder sein müßte, wenn unter den Myriaden von Vorhersagen nicht diese oder jene wahr geworden wäre, so bedarf doch anderseits diese Frage eingehenderer Prüfung.
Es sind drei Möglichkeiten für die richtige Vorhersage von etwas Zukünftigem gegeben: 1. die Berechnung. Sie ist Aufgabe der Wissenschaft und wird es in späteren Zeiten noch mehr werden. Wenn ein warmer Sommer im nördlichen Polargebiet war, so daß große Massen von Eis schwimmend ins Meer gelangten und nach Süden trieben, so hat die metereologische Erfahrung ergeben, daß der nächste Winter in unseren Breiten kalt werden wird.
Oder wenn ich als Bevölkerungsstatistiker aus ungezählten Millionen von Einzelbeobachtungen zum Resultat gelangt bin, daß auf 106 Knabengeburten in Deutschland 100 Mädchengeburten treffen, dann kann ich folgern, daß auch in künftigen Jahren das Verhältnis ebenso sein wird. Wenn auch das sogenannte Gesetz der großen Zahl nicht Notwendigkeit fordert, so werde ich mich auch doch in praxi nur um Dezimalen irren.
Oder wenn ich als Arzt die Erfahrungstatsache kenne, daß ein Prießnitz-Umschlag um die Brust katarrhalische Affektionen der Atmungsorgane günstig beeinflußt, dann bin ich dazu berechtigt, bei meinem Patienten dieses Mittel bei gleicher Erkrankung mit einiger Aussicht auf Erfolg anzuwenden.
[S. 142]In allen diesen Fällen, im Versicherungswesen, in der Politik, in der Volkswirtschaft und noch auf zahlreichen – um nicht zu sagen auf allen Gebieten – ist der Sachverhalt der gleiche: Auf Grund einer möglichst umfassenden Induktion gelangen wir zu deduktiven Schlüssen, zu Erfahrungsregeln, ja zu Gesetzen und wenden sie nun auf Zukünftiges an. Hier handelt es sich, das ist klar, um Berechnung, Kalkulation oder Kombination.
Wenn auch nicht bestritten werden kann, daß die obigen Berechnungen auch irrtümlich sein können, daß ihr Umfang und Inhalt gewissen Beschränkungen unterliegt, daß auch unvorhergesehene und unvorhersehbare Momente sie modifizieren mögen, so wird es doch keinem Menschen einfallen, ein richtiges Resultat auf Zufall zurückzuführen. Vielmehr wird man geneigt sein, einen Mißerfolg damit zu erklären bzw. zu beschönigen.
2. Können wir das Eintreffen der Vorhersage eines zukünftigen Ereignisses dem Zufall zuschreiben.
Was ist Zufall?
»Zufall nennt man alles, was durch keine Gründe und Ursachen bedingt zu sein scheint, also das Unbeabsichtigte und das Unerklärliche. Der Begriff des Zufalls ist jedoch ein bloß subjektiver; denn an sich ist alles durch Ursachen bedingt. Aber ein Kausalzusammenhang kann für uns unter Umständen dunkel und unbekannt oder auch unbeabsichtigt sein. Zufällig heißt demnach dasjenige Ereignis, welches aus einem System von Ursachen entspringt, das nicht in der Macht des Wollenden oder der Kenntnis des Auffassenden liegt, z. B. eine [S. 143]Folge, die weder von uns beabsichtigt, noch auch vorhergesehen ist[72].«
Anders ausgedrückt: einen objektiven Zufall gibt es nicht, da mit seiner Annahme die Kausalität geleugnet würde. Es kann sich also – auch in allen für uns in Frage kommenden Fällen – niemals darum handeln, daß etwas keine Ursachen hat, sondern nur darum, daß wir diese 1. nicht kennen; 2. nicht beweisen können, daß der Erfolg auch wirklich beabsichtigt war.
Was das Nichtkennen betrifft, so schränkt sich naturgemäß dessen Bereich mit dem Fortschreiten der Wissenschaft immer mehr ein. Wir lernen mehr Gesetze, die die Welt beherrschen, kennen und haben deshalb immer weniger Veranlassung, unsere Unwissenheit durch Gebrauch des Wortes Zufall zu beschönigen. Hier tritt dann zuletzt bei genauer Ermittlung der Anwendungsbedingungen die Notwendigkeit an seine Stelle. So hat man vor noch gar nicht langer Zeit das Gedankenlesen für ein zwar geschicktes aber doch immerhin mehr oder minder zufälliges Erraten der Gedanken anderer gehalten, bis wir nunmehr positiv wissen, daß es Gedankenübertragung gibt[73]. [S. 144]Genau ebenso verhielt es sich mit der Hypnose und Suggestion, mit der Erprobung neuer Heilmittel usw. usw. Etwas anders ist der Sachverhalt etwa im folgenden Falle: A. geht an einem Hause in demselben Augenblick vorbei, in dem ein Ziegelstein herabfällt und ihn tot schlägt. Daß A. zur bestimmten Sekunde am Hause vorbei geht, ist durchaus kein Zufall, sondern damit hinlänglich begründet, daß er zu seinem Raseur will und kein anderer Weg hinführt. Ebenso hat der Fall des Ziegelsteines seine Ursache in einem Windstoß. Wenn also für jede der beiden Tatsachenreihen, das Vorbeigehen des A. und den Fall des Steines die kausale Begründung gegeben ist, so fehlt sie doch scheinbar für den Schnittpunkt, daß nämlich in derselben Sekunde der Stein fällt, in dem der Passant vorbeikommt.
Letzten Endes handelt es sich aber auch hier um ein Nichtwissen der Ursachen. Auch hier ist der Zufall subjektiv. Ein Architekt wird die Schadhaftigkeit des Daches bereits erkannt und vorhergesagt haben, daß ein Wind das Herabfallen von Ziegeln bewirken werde. Ein Meteorologe wird den Windstoß vorhersehen, und die Zeit seines Eintreffens an gedachter Stelle berechnen können. Er weiß allerdings so wenig wie der Architekt, ob gerade der bestimmte Windstoß einen Ziegel hinabschleudern wird. Was man aber wissen kann, ist, daß das Dach durch einen der nächsten beschädigt werden wird. Dadurch läßt sich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mit sehr [S. 145]kleinem Divisor aufstellen. Was endlich den Passanten betrifft, so war sein Vorbeikommen sehr leicht zu berechnen. So merkwürdig hier der Zufall also auch gespielt zu haben scheint, so läßt er sich doch in eine Rechnung fassen, deren Divisor keineswegs sehr groß zu sein braucht.
Schwierig ist oft im zweiten Fall der Nachweis, ob ein Erfolg auch beabsichtigt war. Um diese Art des Zufalles handelt es sich zumeist bei uns. Wie jedes Medikament neben der Wirkung, um derentwillen es verabreicht wird, auch – oft recht unerwünschte – Nebenwirkungen hat, so ist das mutatis mutandis fast bei allem und jedem, was wir tun, der Fall. Nur selten lassen sich alle Ursachen so beherrschen, daß unbeabsichtigte Nebenwirkungen oder Mißerfolge ausgeschlossen sind. So geht trotz der großen Zuverlässigkeit unserer Post dann und wann einmal ein Brief verloren; trotz der hohen Sicherheit unseres Verkehrswesen verunglückt auch hie und da ein Reisender; trotz der sorgfältigsten Herstellung unserer Geschütze und Munition kommt es doch bisweilen vor, daß ein Kanonenrohr platzt oder ein Geschoß zur unrechten Zeit explodiert. Kurz: es ereignet sich auch bei größter Genauigkeit in der Anwendung der klar erkannten Gesetze doch dann und wann ein unvorhergesehenes und selbstredend unbeabsichtigtes Mißgeschick, das wir dann als (unglücklichen) Zufall bezeichnen.
Je seltener ein solcher Zufall – so geheißen durchaus nicht, weil er nicht kausal begründet wäre, kennen wir doch oft die Ursache, etwa die gesprungene Schiene bei der Eisenbahnkatastrophe, sondern weil [S. 146]er unbeabsichtigt ist – nun eintritt, desto vollkommener ist eine Institution, eine Technik usw. Je häufiger, desto mangelhafter. Ja, es können Fälle eintreten, wo das Unbeabsichtigte so häufig oder fast so häufig ist, wie sein Gegenteil, wie wir das ja leider zu Beginn der lenkbaren Luftschiffahrt erleben mußten.
Um nun zu bestimmen was Absicht, was »Zufall« ist, bleibt uns nur der Weg der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Wenn jemand mit der Bahn von München nach Berlin reisend sein Ziel erreicht, wird es niemand einfallen, hier von Zufall zu reden. Denn die Gründe für das Gelingen der Reise sind bekannt, ebenso ist die Ankunft beabsichtigt. Und doch läßt sich mit Leichtigkeit eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufstellen.
Aus der Statistik der deutschen Eisenbahnen für das Rechnungsjahr 1900/1901 ergibt sich, daß ein tötlicher Unfall auf 168 Millionen in der Eisenbahn zurückgelegter Personenkilometer trifft. Nun beträgt die Bahnstrecke München–Berlin 700 klm. Wir erhalten also folgende Rechnung: Die Wahrscheinlichkeit Berlin zu erreichen, verhält sich zu der tötlich zu verunglücken wie 168 000 000 : 700 = 240 000.
Mit andern Worten: von 240 000 Reisenden auf der Strecke Berlin–München verunglückt einer tötlich. Diese Wahrscheinlichkeit von 1 : 240 000 ist derart gering, daß das tödliche Unglück als sehr seltener Zufall in praxi in die Kalkulation gar nicht einbezogen wird.
Aber eine so hohe Wahrscheinlichkeitsquote ist keineswegs erforderlich.
[S. 147]Von hundert dreißigjährigen Durchschnittsmännern stirbt in Deutschland einer im Jahr, also 1⁄12 im Monat, 1⁄360 am Tag. Anders ausgedrückt: Der normale dreißigjährige deutsche Mann hat eine Wahrscheinlichkeit von 1200 noch einen Monat, eine solche von 36 000 noch ein Jahr zu leben.
Keinem Menschen wird es einfallen zu sagen: es ist Zufall, wenn der dreißigjährige X. den kommenden Monat, oder gar den kommenden Tag erlebt. Man wird es vielmehr als Zufall bezeichnen, wenn das Gegenteil eintritt.
Im bürgerlichen Leben ist also die Wahrscheinlichkeit 1 : 100 schon groß, 1 : 1200 sehr groß, mit der 1 : 36 000 wird in der Praxis schon überhaupt nicht mehr gerechnet.
Übertragen wir nun das Gesagte auf die Prophetie!
Wenn ein Astrolog jemandem sein Todesjahr vorhersagt, so handelt es sich immer um eine Wahrscheinlichkeit geringer als 100, bei einem reiferen Mann sogar geringer als 50 oder 25. Macht er also genügend Horoskope, so wäre der Zufall immer zu irren viel größer, als der mal das Richtige zu treffen. Da wir nun in der Regel die Zahl der Horoskope nicht kennen, da ferner der Tod ein Ereignis ist, dessen Eintreffen absolut sicher ist und bei dem nur der Zeitpunkt in gewissen mehr oder minder engen Grenzen schwankt, so werden wir auf Grund derartiger Voraussagen niemals die Existenz einer übersinnlichen Prophetengabe, eines wirklichen zeitlichen Fernsehens beweisen können.
Ganz ähnlich verhält es sich bei der Vorhersage von Kriegen usw. Das alles sind Ereignisse, die im [S. 148]Leben eines Volkes schon so und so oft da waren und deren Wiederholung ganz und gar nicht verwunderlich ist. Die vierzigjährige Friedensperiode, die Deutschland – von den überseeischen Expeditionen abgesehen – jetzt genießt, ist schon anormal lang. Wenn also der eine Seher für 1912, der andere für 1913, der dritte für 1914 usf. einen Krieg prophezeit, wenn er die wenigen überhaupt in Frage kommenden Gegner namhaft macht, so ist das glückliche Eintreffen einer solchen Vorhersage ganz und gar nicht wunderbar und beweist nicht das Allergeringste für das Vorhandensein seiner Sehergabe.
Dies ist auch der Grund, weshalb eine weitere Häufung historischer Prophezeiungen, deren wir ja eine ganze Reihe in den vorhergehenden Kapiteln zusammentrugen, selbst in den Fällen, in denen ein Zweifel daran, daß sie wirklich vorher verkündet worden sind, ausgeschlossen ist, keinen Nutzen hätte. Wir kämen höchstens in den Verdacht, Vollständigkeit zu erstreben. Dieses Ideal aller Flachköpfe ist aber ganz und gar nicht das unsrige. Denn was wir anstreben, ist etwas ganz anderes.
Wir sagten oben, daß das richtige Eintreffen eines vorhergesagten Ereignisses entweder eine Folge der Berechnung oder des Zufalles sein kann. Ist beides nicht der Fall, dann bleibt als
3. Möglichkeit nur mehr die, daß es sich hier um eine uns nicht näher bekannte Ursache handelt, die wir mit Sehergabe oder Prophetie bezeichnen.
Wenn wir also auch nur in einem einzigen Fall den Nachweis erbringen können, daß ein richtig vorhergesagtes Ereignis weder durch [S. 149]Berechnung, noch durch Zufall eintraf, dann ist damit die Existenz des zeitlichen Fernsehens bewiesen. Demnach handelt es sich jetzt in unserer Beweisführung, darum Berechnung und Zufall auszuschalten.
Das ist nun viel leichter gesagt als getan. Denn wenn es auch nicht schwer sein wird, die Berechnung auszuschließen, so kann das für den Zufall nur dann gelingen, wenn wir eine außerordentlich hohe Wahrscheinlichkeit zu berechnen in der Lage sind. Da genügt keineswegs die Vorhersage des – sicheren – Todes einer bestimmten Person, sei es auch für einen bestimmten Tag. Beweiskräftig wäre das höchstens, wenn wir alle übrigen Todesvorhersagen kennen würden bzw. wüßten, daß keine andere existiert. Das ist aber so gut wie ausgeschlossen, denn man vergißt schnell falsche Prophezeiungen. Überdies wäre selbst in diesem Falle der Koeffizient nur 36 000 bei einem Dreißigjährigen, etwa ein Drittel so groß bei einem Fünfzigjährigen. Das würde nicht genügen, den Zweifler zu überzeugen, mir wenigstens nicht.
Noch viel weniger ist natürlich die Ankündigung eines Krieges oder anderer Ereignisse mit geringerem Nenner beweisend.
Wir müssen danach trachten, folgende Formel zu erhalten:
w (Wahrscheinlichkeit, Zufall) = n (Zahl der wirklichen Fälle) dividiert durch m (Zahl der möglichen Fälle) = unendlich klein oder 0
also:
[S. 150]Mathematisch genau wird sich dieses Resultat nicht errechnen lassen, wohl aber können wir zu einem Annäherungswert gelangen.
Stellen wir uns vor jemand werfe hundertmal eine Münze auf, und zwar so, daß jedesmal das Wappen nach oben kommt. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist:
gemäß der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Nun ist aber 2100 mehr als 1030 Quintillion. Darum – sagt Grimsehl gegen die Mathematiker Marbe und d’Alembert – weil eine so große Zahl von Würfen von allen Menschen der Erde erst in 20 Billionen Jahren ausgeführt werden können, kann die Wahrscheinlichkeitsrechnung hier 0 ansetzen[74].
Wenn schon die reine Mathematik bei einem so ungeheuren Divisor aus praktischen Erwägungen zum Resultat 0 gelangt, so können wir das um so eher. Nur muß allerdings auch unser Divisor außerordentlich groß sein.
Da wir zu ihm auf dem oben eingeschlagenen Wege nicht gelangen werden, müssen wir es auf einem andern versuchen.
Vor allem aber muß es unsere Aufgabe sein, festzustellen, wieviel Vorhersagen überhaupt existieren. Das ist in dieser Fassung eine unmögliche Forderung. Wohl aber läßt sich der gleiche Erfolg dadurch erzielen, daß wir das ganze Material eines Sehers betrachten und die eingetroffenen Vorhersagen [S. 151]zu den nicht eingetroffenen in ein Verhältnis bringen.
Setzen wir voraus, von einem Seher existierten fünf Prophezeiungen, von denen drei eintrafen, zwei ausblieben, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß er etwas Prophetengabe besaß. Trafen alle ein, so werden wir kaum zögern, ihn für einen richtigen, traf keine oder nur zwei ein, aber für einen falschen Propheten zu halten.
Diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, so einleuchtend sie scheint, ist trotzdem falsch. Denn sie operiert mit ungleichwertigen, inkommensurablen Größen.
Das bedarf einer näheren Ausführung, da es von außerordentlicher Wichtigkeit ist.
Wenn jemand »prophezeit«, er werde aus einem Kartenspiel rot ziehen, so ist die Wahrscheinlichkeit des richtigen Erratens ebenso groß, wie die des Irrens, da das Spiel genau ebenso viel rote, wie schwarze Karten aufweist.
Diese Wahrscheinlichkeit sinkt auf ¼, wenn es sich darum handelt, eine Karo zu treffen, auf ein ⅛ beim König und wenn jemand sich gar anheischig macht, den Karokönig zu ziehen, so hat er, bei einem Spiel von 32 Karten, nur 1⁄32 Wahrscheinlichkeiten.
Noch viel ungünstiger sind natürlich die Chancen, wenn jemand in einer Lotterie mit 100 000 Losen das Gewinnlos vorher richtig angeben will. Hier hat er nur 1⁄100 000 Wahrscheinlichkeit. Sollte das jemand gelingen – angenommen es existiert überhaupt nur eine derartige Vorhersage, denn wenn es deren viele gibt, dann ist die Chance 1⁄100 000 multipliziert mit allen [S. 152]anderen Vorhersagen – so werden wir kaum zögern ihm Sehergabe zuzuerkennen.
In allen den genannten Beispielen war die Zahl der Möglichkeiten bekannt. Wir wußten genau, daß das vorhergesagte Ereignis unbedingt eintreffen muß. Fraglich bleibt eben nur, ob es so eintrifft, wie der Prophet es vorhersagt.
Besser ausgedrückt: Wir wußten genau, daß eines der hunderttausend Lose mit dem großen Treffer gezogen werden mußte. Es fragte sich nur, ob die vorher bezeichnete Nummer richtig war.
Ganz anders verhält es sich, wenn ein vorhergesagtes Ereignis eintreffen oder auch ausbleiben kann.
Angenommen, ich bestimme jemandes Todestag. Daß er sterben wird, ist ganz sicher. Irren kann ich nur bezüglich des Datums. Wie aber, wenn ich jemand ankündige, daß er eine Reise um die Erde machen wird – was nichts weniger als notwendig ist – und den Tag der Abreise und Rückkehr richtig angebe?
Oder wenn ich vorhersage, daß jemand an einem bestimmten Tage durch einen bestimmten Unfall ums Leben kommt?
Oder – um den Divisor ins Ungeheure wachsen zu lassen – daß ihn an einem bestimmten Tage mit einem bezeichneten Mordinstrument ein Mann umbringen wird, dessen Namen ich richtig nenne. Hier handelte es sich um ungezählte Millionen oder Milliarden von Irrtumsmöglichkeiten, die der einen einzigen des richtigen Vorhersagens gegenüber stehen.
Oder wenn ich gar ein zukünftiges Parlament namentlich und richtig angebe?
Das Fazit dieser Erwägung ist klar: Der innere [S. 153]Wert der Vorhersagen kann schwanken zwischen 1 : 2 (rote Karte) und 1 : X Milliarden (letzter Fall). Wenn wir daher sagen: dieser Prophet ist jenem überlegen, weil unter fünf Vorhersagen bei ersterem vier, bei letzterem nur drei eintrafen, während ein dritter überhaupt keine prophetische Gabe besitze, denn von seinen fünf Vorhersagen sind nur zwei eingetroffen, also weniger als das arithmetische Mittel, so begehen wir damit eine ganz riesige Gedankenlosigkeit. Es ist gerade so, als wenn jemand Königreiche und Sandkörner als gleichwertige Größen in eine Rechnung einsetzen würde, etwa weil beide Ausdehnung besitzen.
So evident das Gesagte ist, so schwer verständlich mag manchem das Folgende scheinen.
Einer der beliebtesten Einwände gegen die Prophetie ist nämlich der, daß der Besitzer der Prophetengabe niemals irren dürfe. Man wendet ganz landläufig ein: X mag ja so und so oft die Zukunft richtig vorhergesagt haben; daß es sich hierbei aber nicht um Prophetie, sondern um Berechnung oder Zufall handelt, geht daraus hervor, daß er auch so und so oft irrte.
Das ist nun ein Denkfehler, weil man über eine noch völlig unbekannte Naturkraft etwas Positives aussagen will: nämlich daß diese Kraft jederzeit und in vollem Umfange zur Verfügung des mit ihr Begabten sein muß.
Wir kennen die Funktionen und Leistungen unserer Gewehre und Geschütze ganz genau und doch fällt es keinem Verständigen ein zu sagen: das ist alles Plunder, denn mit dem gleichen Gewehr, mit dem getroffen wird, [S. 154]wird auch gefehlt. Vielmehr wissen wir, daß auch ein guter Schütze fehlen kann, ja wir wissen, daß im Feldzuge auf hundert abgegebene Schüsse nur ein einziger Treffer kommt. Und endlich ist uns genau bekannt, daß auch ein tadellos abgegebener Schuß aus einem Idealgewehr fehlen kann, ja nur durch Zufall überhaupt trifft, wenn nämlich der Streuungskegel größer ist, als das Ziel.
Statt also zu sagen: es gibt keine Prophetie, weil es auch falsche Prophezeiungen gibt – auf diese Formel gebracht, ist jedermann der Paralogismus sofort klar –, muß es Aufgabe der Wissenschaft sein, festzustellen, unter welchen Bedingungen diese Kraft wirksam wird und den Streuungskegel bei ihr zu bestimmen.
Indem wir uns vorbehalten, im weiteren Verlaufe unserer Untersuchung darauf zurückzukommen und vielleicht einiges zur Klärung der Frage beisteuern werden, wollen wir nunmehr den weiteren Gang unserer Beweisführung näher präzisieren.
Wir wollen den Nachweis liefern, daß es ein wirkliches zeitliches Fernsehen, echte Prophetie, gibt.
Das kann uns nur dadurch gelingen, daß wir nachweisen, die richtige Vorhersage irgendwelcher Ereignisse sei weder auf Berechnung, noch auf Zufall zurückzuführen.
Die Ausschaltung der Berechnung ist sehr einfach, die des Zufalls überaus schwer und nur möglich
1. durch größtmögliche Festlegung des Materiales.
2. Durch Errechnung eines möglichst hohen Divisors, so daß sich das Resultat dem Werte Null nähert.
[S. 155]Während wir den zweiten, bei weitem schwierigeren Teil des Beweises für die Schlußkapitel aufsparen, beschränken wir uns in den folgenden auf den ersten, die Festlegung des Materiales.
Wie schon gesagt, ist es unmöglich, sämtliche umlaufende Prophezeiungen zu sammeln und in Hinblick auf die falschen und richtigen statistisch zu verarbeiten. Wir würden damit auch insofern wenig gewinnen, als gewisse Vorhersage – keineswegs alle – ungleichwertig sind, was ein rein äußerlich zahlenmäßiges Erfassen ausschließt.
Da es aber eine große Fülle von Vorhersagen gibt, die sich widersprechen, so daß entweder die eine oder die andere richtig sein muß; da ferner eine stattliche Reihe so beschaffen ist, daß die Wahrscheinlichkeit des Irrens nur gering ist – etwa bei Vorhersage eines Krieges für ein bestimmtes Jahr –, so ist eine gewisse Sichtung und Festlegung des Materiales keineswegs unnütz. Liegt es doch auf der Hand, daß es für die Beweisführung einen großen Unterschied bedeutet, ob aus ungezählten Millionen von Prophetien mal eine mit einem vielleicht höchst verblüffenden Inhalt eintrifft, oder ob dies bei ein und demselben Seher der Fall ist, womöglich mit mehreren oder gar allen Vorhersagen.
Deshalb soll es nun unsere nächste Aufgabe sein, möglichst das ganze prophetische Material einzelner Seher nachstehend zu sammeln und kritisch zu beleuchten.
[72] Vgl. Fr. Kirchner und Carl Michaëlis, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 4. Aufl., Leipzig 1903, Artikel Zufall. Ferner Windelband, Die Lehren vom Zufall, Berlin 1870. Übrigens existiert keine stichhaltige Lehre vom Zufall, wenigstens nicht vom absoluten, der dem Kausalitätsgesetz widerspricht. Mit dem relativen operieren die Wahrscheinlichkeitsrechnung, sowie die auf sie begründeten statistischen Methoden.
[73] Ich hatte Gelegenheit, den Experimenten beizuwohnen, die der italienische Gedankenleser Ernesto Bellini am 28. Januar 1911 vor Ärzten in München mit sich vornehmen ließ. Danach kann es nicht mehr dem allergeringsten Zweifel unterliegen, daß Gedankenübertragung existiert.
[74] Vgl. Constantin Gutberlet, Logik und Erkenntnistheorie, 4. Aufl., Münster 1909, S. 177.
Um 1300 soll ein Abt Hermann des Cisterzienserklosters Lehnin in der Mark folgende Prophezeiung über die Schicksale des Brandenburgischen Hauses verfaßt haben:
| 1) | Jetzo will ich, Lehnin, dir sorgsam singen die Zukunft[75], |
Nunc tibi cum cura, Lehnin! cano fata futura |
Die mir gezeigt der Herr, der alles einst hat geschaffen. |
Quae mihi monstravit Dominus, qui cuncta creavit; |
|
Denn obschon du erglänzest im hellen Licht, wie die Sonne, |
Nam licet insigni sicut sol splendeas igni, |
|
Und der Andacht allein dein ganzes Leben jetzt widmest, |
Et vitam totam nunc degas summe devotam, |
|
| 5) | Reichtum auch und der Segen des friedlichen Daseins dir zuströmt: |
Abundentque rite tranquillae commoda vitae: |
So wird doch kommen die Zeit, die dich nicht erschaut, wie du jetzt bist, |
Tempus erit tandem, quod te non cernet eandem, |
|
| [S. 158-159] Nein, kaum etwas von dir, ja richtig gesagt, vielmehr gar nichts. |
Immo vix ullam, aut, si bene dixero, nullam. |
|
Allzeit hat das Geschlecht dich geliebt, das einst dich begründet[76]. |
Quae te fundavit gens, haec te semper amavit. |
|
Sinkt es dahin, fällst auch du, und bleibst nicht liebwerte Mutter. |
Hac pereunte, peris, nec mater amabilis eris. |
|
| 10) | Und jetzt naht sich ohne Verzug die traurige Stunde, |
Et nunc, absque mora, propinquat flebilis hora, |
Da Ottos Geschlecht, die Zierde unserer Gegend, |
Qua stirps Othonis, nostrae decus regionis, |
|
Durch schweres Schicksal dahinsinkt, da Leibeserben nicht da sind. |
Magno ruit fato, nullo superstite nato; |
|
Und dann fällst du zuerst, doch noch nicht fällst du am tiefsten. |
Tuncque cadis primum, sed nondum venis ad imum. |
|
Unterdes wird die Mark durch schreckliche Drangsal geängstigt. |
Interea diris angetur Marchia miris. |
|
| 15) | Denn der Ottonen Haus wird werden die Höhle des Löwen[77]. |
Nam domus Ottonum fiet spelunca Leonum. |
Und verstoßen wird sein, wer echtem Blute entsproßte. |
Ac erit extrusus vero de sanguine fusus; |
|
Dann dringen Fremdlinge vor bis zum Dache des Klosters Chorin[78]. |
Quando peregrini venient ad claustra Chorini, |
|
| [S. 160-161] | Des Kaisers List aber bald beseitigt den höllischen (des Cerberus) Hochmut. |
Cerbereos fastus mox tollet Caesaris astus. |
Doch wird wenig die Mark sich freuen des sicheren Schutzes, |
Sed parum tuto gaudebit Marchia scuto. |
|
| 20) | Denn auf anderer Bahn wird wandeln der Löwenkönig. |
Regalis leo rursum tendit ad altera cursum, |
Nicht wird sehen das Land die wahren Herrn und Gebieter. |
Nec dominos veros haec terra videbit et heros. |
|
Alles werden Regenten verwirren und Schaden ihm machen; |
Omnia turbabunt rectores, damnaque dabunt |
|
Quälen wird allerwärts der reiche Adel die Bürger, |
Nobilitas dives vexabit undique cives, |
|
Und berauben den Klerus, ohne irgendwie Auswahl zu treffen. |
Raptabit clerum nullo discrimine rerum: |
|
| 25) | Und werden tun alsdann, was man tat zu den Zeiten des Heilands. |
Et facient isti, quod factum tempore Christi. |
Und vieler Leiber verkaufen, was gegen den göttlichen Willen[79]. |
Corpora multorum vendentur contra decorum. |
|
Daß dir Mark nicht völlig ein Herrscher fehle, so steigst du, |
Ne penitus desit tibi, qui, mea Marchia, praesit, |
|
Durch zwei Burgen berühmt, empor aus niederer Stellung, |
Ex humili surgis, binis nunc inclyte burgis, |
|
Zündest die Kriegsfackel an, da dein Name doch Friede bedeutet. |
Accendisque facem jactando nomine pacem, |
|
| 30) | Während die Wölfe du tötest, zerschneidest das Herz du den Schafen. |
Dumque lupos necas, ovibus praecordia secas. |
Wahrheit künde ich dir: dein Stamm von sehr langer Zukunft, |
Dico tibi verum, tua stirps longaeva dierum |
|
Wird mit schwacher Gewalt nur die heimischen Gaue beherrschen, |
Imperiis parvis patriis dominabitur arvis, |
|
| [S. 162-163] | Bis zu Boden gestreckt, die bisher mit Ehren bekleidet, |
Donec prostrati fuerint, qui tunc honorati |
Städte verwüsteten und die Herren am Herrschen gehindert[80]. |
Urbes vastabant, dominos regnare vetabant. |
|
| 35) | Wer dem Vater jetzt folgt, der nimmt dem Bruder sein Vorrecht, |
Succedens patri tollet privilegia fratri, |
Aber kein Testament macht Recht, was wider das Recht ist. (oder: Nicht wird machen das Grab, daß Unrecht für Recht wird geachtet) |
Nec faciet testum (andere Lesart: bustum) non justum credere justum. |
|
Ihm von mancherlei Krieg und Schicksalsschlägen ermüdet, |
Defesso bellis variis, sortisque procellis, |
|
Folgt bald zur Zeit des Tods der tapfere Heldenbruder[81], |
Mox frater fortis succedit tempore mortis, |
|
Tapfer ist dieser gewiß, doch auch der eitelsten einer. |
Fortis et ille quidem, sed vir vanissimus idem. |
|
| 40) | Während er denkt an den Berg, kann kaum er besteigen die Brücke. |
Dum cogitat montem, poterit vix scandere pontem. |
Schaut nur, er schärfet das Schwert! Weh euch, ihr armen Lehniner! |
En acuit enses! Miseri vos, o Lehninenses! |
|
Wie will schonen der Brüder, der die Väter sinnt zu vernichten?[82] |
Quid curet fratres, qui vult exscindere patres? |
|
| [S. 164-165] | Wer ihm folgt, der versteht durch Künste den Mars zu verspotten |
Alter ab hoc martem scit ludificare per artem, |
Und weissaget den Söhnen der Zukunft reichlichen Segen; |
Auspicium natis hic praebet felicitatis; |
|
| 45) | Solange man dessen gedenkt, ist riesiges Glück im entstehen. |
Quod dum servatur, ingens fortuna paratur. |
Gleiches Glückslos wird ja seinen Söhnen zuteil[83], |
Hujus erunt nati conformi sorte beati. |
|
Doch wird tragen ein Weib dann traurige Pest in die Lande. |
Inferet at tristem patriae tunc foemina pestem, |
|
Dieses Weib durchseucht vom Gifte der neuen Schlange. |
Foemina, serpentis tabe contacta recentis. |
|
Gar bis zum elften Glied wird dauern das Gift in dem Stammbaum[84]. |
Hoc et ad undenum durabit stemma venenum. |
|
| 50) | Nun wird der, oh Lehnin, der dich maßlos hasset, hervorgehn: |
Et nunc is prodit, qui te, Lehnin! nimis odit: |
Der dich wie ein Messer zerteilt, ein gottloser, ehbrechender Lüstling! |
Dividit ut culter, atheus, scortator, adulter! |
|
| [S. 166-167] | Er verwüstet die Kirche, versteigert die geistlichen Güter. |
Ecclesiam vastat, bona religiosa subhastat. |
Geh von dannen, mein Volk! kein Schützer wird dir verbleiben, |
Ite, meus populus! protector est tibi nullus, |
|
Bis die Stunde dir schlägt, die das Verlorne zurückbringt[85]. |
Hora donec veniet, qua restitutio fiet. |
|
| 55) | Des Wahnsinnigen Sohn billigt das Treiben des Vaters; |
Filius amentis probat instituta parentis; |
Gänzlich ohne Verstand, beugt er sich dem Willen des Pöbels; |
Insipiens totus, tamen audit vulgo devotus; |
|
Weil er nicht strenge genug, nennt ihn man den Besten der Helden. |
Nec sat severus, hinc dicitur optimus herus. |
|
Er darf aus seinem Geschlecht einen sehn, der nicht ist, wie er selber, (oder: Er darf aus seinem Geschlecht fünf sehn, wie er selber geraten) |
Huic datur ex genere, qui non (andere Lesart: Quinos) qualis ipse, videre, |
|
Und in dem Todesjahr an ehrbarem Orte verscheiden[86]. |
Et anno funesto vitam loco linquit honesto. |
|
| 60) | Fordern wird nun die Herrschaft des Volks, der städtisch Geborne (Meinhold übersetzt: Hierauf erklärt sein Sohn in einer Stadt sich zum Bischof). |
Postulat hinc turbae praeponi natus in urbe. |
Hegend mit Furcht sein Kind, das andere hegen mit Hoffnung. |
Spe caeteri sobolem; fovet hie formidine prolem. |
|
Was er fürchtet ist dunkel, doch sicher wird es geschehen[87]. – |
Quod timet obscurum: certe tamen, ecce, futurum. – |
|
Neu wird bald der Dinge Gestalt, da der Herr es gestattet! |
Forma rerum nova mox fit, patiente Jehova! |
|
| [S. 168-169] | Fehler an tausend hat er, dessen Leben so kurz ist, |
Mille scatet naevis, cujus duratio brevis. |
| 65) | Vieles verwirrt er durch seinen Befehl, noch mehr durch sein Schlagen, |
Multa per edictum, sed turbans plura per ictum. |
Doch was durch seine Befehle sich hat zum Schlechten gestaltet, |
Quae tamen in pejus mutantur jussibus ejus, |
|
Kann, o glaube es mir, durchs Schicksal zum Guten sich wandeln[88]. |
In melius fato converti posse putato. |
|
Markgraf wird nun wieder nach seinem Vater der Sohn sein, |
Post patrem natus princeps erit Marchionatus, |
|
Viele läßt straflos er leben gemäß seiner Geistesrichtung. |
Ingenio nullos non vivere sinit inultos. |
|
| 70) | Während zu viel er vertraut, frißt der Wolf ihm die arme Herde, |
Dum nimium credit, miserum pecus lupus edit, |
Und der schamlose Knecht folgt bald im Tode dem Herren[89]. |
Et sequitur servus domini mox fata protervus. |
|
Nunmehr kommen heran, die nach drei Burgen sich nennen, |
Tunc veniunt, quibus de burgis nomina tribus, |
|
Und ein großer Fürst läßt wachsen den Staat in die Breite[90]. |
Et crescit latus sub magno principe status, |
|
Sicherheit seinem Volk schafft die Kraft des tücht’gen Regenten: |
Securitas gentis fortitudo Regentis: |
|
| [S. 170-171] 75) | Doch nichts nützt es ihm, wenn die Klugheit schlafen gegangen[91]. |
Sed nil juvabit, prudentia quando cubabit. |
Wer ihm nachfolgen wird, folgt nicht den Spuren des Vaters. |
Qui successor erit, patris haud vestigis terit. |
|
Betet, ihr Brüder, und spart auch nicht die Tränen, ihr Mütter! |
Orate, fratres, lacrymis nec parcite matres! |
|
Täuschung ist ja sein Name, der frohe Regierung verheißet. |
Fallit in hoc nomen laeti regiminis omen. |
|
Nichts bleibt vom Guten zurück: ziehet aus, ihr alten Bewohner! |
Nil superest boni: veteres migrate coloni! |
|
| 80) | Und entseelt liegt er da, zerbrochen von außen, wie innen[92]. |
Et jacet exstinctus, foris quassatus et intus. |
Bald braust ein Jüngling daher, die große Gebärerin seufzet, |
Mox juvenis fremit, dum magna puerpera gemit. |
|
Doch wer könnte den Staat wieder aufbaun nach solcher Zerrüttung? |
Sed quis turbatum poterit refingere statum? |
|
Nehmen wird er die Fahne, doch grauses Schicksal beklagen: |
Vexillum tanget, sed fata crudelia planget: |
|
Während der Südwind weht, will sein Leben vertraun er den Klöstern[93]. (Meinhold übersetzt: »Weht es im Süden hierauf, will Leben er borgen den Klöstern«). |
Flantibus hinc austris, vitam vult credere claustris. |
|
| [S. 172-173] 85) | Der ihm als Schlechtesten folgt ahmt nach böse Sitten der Väter, |
Qui sequitur, pravos imitatur pessimus avos. |
Hat weder Kräfte des Geists, noch Gottesfurcht lebt jetzt im Volke; |
Non robur menti, non adsunt Numina genti. |
|
Der, des Hilf’ er begehrt, wird feindlich entgegen ihm treten, |
Cujus opem petit, contrarius hic sibi stetit: |
|
Und er im Wasser sterben, das Oberste kehren zu unterst[94], |
Et perit in undis, dum miscet summa profundis. |
|
| [S. 174-175] | Blühen wird aber sein Sohn und erhalten, was nie er gehofft hat, |
Natus florebit; quod non sperasset, habebit: |
| 90) | Doch sein trauriges Volk wird weinen in selbigen Zeiten. |
Sed populus tristis flebit temporibus istis. |
Denn von erstaunlicher Art scheint sich das Schicksal zu nahn. |
Nam sortis mirae videntur fata venire, |
|
Und es ahnt nicht der Fürst, welch neue Macht da heranwächst[95]. |
Et princeps nescit, quod nova potentia crescit. |
|
Endlich führet der Letzte von diesem Stamme das Zepter. |
Tandem sceptra gerit, qui stemmatis ultimus serit: |
|
Israel, wagt eine Tat, unaussprechlich, mit dem Tod nur zu sühnen[96]. |
Israël infandum scelus audet, morte piandum. |
|
| 95) | Und die Herde der Hirt, Germania den König erhält nun[97], |
Et pastor gregem recipit, Germania regem. |
| [S. 176-177] | Jegliches Unglück vergißt die Mark nun völlig und gänzlich, |
Marchia, cunctorum penitus oblite malorum, |
Wagt es die Ihren zu pflegen, kein Fremdling darf mehr frohlocken. |
Ipsa suos audet fovere, nec advena gaudet, |
|
Und von Lehnin und Chorin ersteht die alte Bedachung, |
Priscaque Lehnini surgunt et tecta Chorini, |
|
Und die Geistlichkeit glänzt nach alter Weise in Ehren |
Et veteri more clerus splendescit honore, |
|
| 100) | Und es stellet kein Wolf mehr nach dem edlen Schafstall. |
Nec lupus nobili plus insidiatur ovili. |
Wie bereits kurz erwähnt, wird die Lehninsche Prophezeiung als Werk eines Bruders Hermann aus dem Zisterzienserkloster Lehnin in der Mark Brandenburg ausgegeben, bzw. gibt sich selbst als solche aus. Wenn sich auch zahlreiche Abschriften der 100 leonischen Verse erhalten haben, so existiert doch keine, die in die mittelalterlichen Jahrhunderte hinaufreicht.[98] Vielmehr gehen die ältesten existierenden Handschriften auf das Ende des 17. Jahrhunderts – etwa 1690 – [S. 178]zurück. Im Druck erschien das Vaticinium Lehniense zuerst von G. P. Schulz bis auf 4 Verse vollständig in »das gelahrte Preußen II. Teil S. 290« (Königsberg 1723), dann, ohne Angabe des Druckortes, im Jahre 1741 und hierauf noch außerordentlich oft.
Legt das Fehlen alter Handschriften schon den Gedanken nahe, es handle sich insofern um eine Fälschung, als einer neueren Dichtung aus irgendwelchen Gründen ein wesentlich höheres Alter zugeschrieben wurde, so wird diese Vermutung noch durch zwei andere Momente gestützt.
Erstens sind die »Prophezeiungen« aus den mittelalterlichen Jahrhunderten (Vers 1–75), wenn auch häufig verschwommen in der Fassung, so doch inhaltlich ausnahmslos zutreffend, während die neuzeitlichen (Vers 76–100) zum Teil falsch sind. Das legt den Verdacht nahe, daß es sich für die älteren Zeiten um ein Vaticinium post eventum handelt, d. h. daß der Verfasser seine historischen Kenntnisse nachträglich in die Form einer Prophezeiung kleidete. Es sei nicht verschwiegen, daß sich hiergegen auch in der Literatur, die außerordentlich reich ist[99], Stimmen erhoben haben, die für die Authentizität auch des ältesten Teiles und die Verfasserschaft eines der im 13. Jahrhundert in Lehnin nachweisbaren Äbte mit dem Namen Hermann eintreten[100]. Besonders seien hier genannt: Wilhelm Meinhold, Die [S. 179]Lehninsche Weissagung, Leipzig 1849, Neuausgabe von Paul Majunke, Regensburg 1896. Ferner Johannes Ponk (Knop), Schrammen-Lehnin. Untersuchung, ob in dem Schriftchen: »Des seligen Bruders Hermann aus Lehnin Prophezeiung über die Schicksale und das Ende der Hohenzollern von Johannes Schrammen« die Lehninsche Prophezeiung unwiderleglich als Fälschung nachgewiesen ist. Regensburg 1896. Daß ausschließlich kirchliche Kreise bisher Verteidiger stellten macht umso mißtrauischer als, worauf wir noch zurückkommen werden, die Prophezeiung zweifellos der Kirche und zwar der katholischen Kirche wohl will.
Anderseits darf man nicht vergessen, daß alle weltlichen Gelehrten und Schriftsteller von dem ungeprüften Dogma ausgehen, daß Prophezeiungen unmöglich sind, während die Kirchen deren Möglichkeit zugeben, ohne im einzelnen Falle für die Wirklichkeit offiziell einzutreten. Wenigstens nicht für die Wirklichkeit der nachevangelischen Prophezeiungen, die uns ja in unserer Untersuchung allein interessieren. Deshalb ist – so merkwürdig es klingen mag – in dieser Frage die Kirche aufgeklärter – ja freiheitlicher als die profane Wissenschaft. Denn der dogmatischen Gebundenheit der letzteren mit ihrem Zwange die Möglichkeit der Prophetie a limine abzulehnen und als Schwindel oder Zufall zu erklären, steht das kirchlicherseits gewährte Prüfungsrecht, jedes einzelnen derartigen Phänomens gegenüber bei gleichzeitigem Zwange die Möglichkeit der Prophetie prinzipiell anzuerkennen. Da also der Kirchengläubige das Recht der unbeschränkten [S. 180]Prüfung besitzt, der »voraussetzungslose« Gelehrte aber verwerfen muß, so ist in diesem Falle dem ersteren von vorn herein mehr Vertrauen entgegenzubringen.
Das zweite für die Abfassung der Weissagung in späteren Jahrhunderten sprechende Moment ist der in ihr zutage tretende tendenziöse Geist. Es war überhaupt das Unglück dieser Prophezeiung, daß sie, statt ruhiger wissenschaftlicher Prüfung unterzogen zu werden, seit je Parteizwecken dienen mußte. Waren es z. B. im Jahre 1848 die Demokraten, die frohlockend auf den Sturz des preußischen Königtums hinwiesen, so waren es seit dem Kulturkampf die Ultramontanen, die den Sieg des Papsttums aus den Worten des Sehers ableiteten.
Sehen wir uns die Schrift mit Rücksicht auf die in ihr waltende Tendenz näher an, dann werden wir die merkwürdige Beobachtung machen, daß zwar jeder Kommentator von ihr spricht, aber auch fast jeder eine andere in ihr findet.
Während der Pfarrer J. C. Weiß in Lehnin bereits im Jahre 1746 durch das Buch »Vaticinium metricum D. F. Hermanni in Lenyn . . .« die Schrift widerlegte, war es das Ziel späterer Forscher den Verfasser zu ermitteln und das besonders aus der Tendenz des Gedichtes heraus.
Wilken erklärte, 1827 von König Friedrich Wilhelm III. mit Nachforschungen betraut, den im Jahre 1693 verstorbenen Kammergerichtsrat Martin Friedrich Seidel für den Autor. Das bestreitet u. a. Giesebrecht, weil Seidel weder Katholik, noch Feind des Hauses Hohenzollern gewesen, gegen das die [S. 181]Weissagung als Schmähschrift gerichtet sei. Giesebrecht macht dafür einen ehemaligen Rittmeister Oelven namhaft.
Heffter entgegnet mit anderen, daß der Verfasser des Gedichtes keineswegs Katholik gewesen sein müsse und bestreitet auch die antihohenzollernsche Tendenz. Daß andrerseits die Tatsache, daß Seidel, der sich im Besitze einer Abschrift befand, zu einzelnen Versen Zusätze gemacht hat – z. B. zu Vers 95, daß innerhalb fünfzig Jahren kein Reformierter und innerhalb hundert Jahren kein Lutheraner mehr in der Mark sein würde, sondern nur mehr Katholiken – kein Beweis für seine Autorschaft ist, liegt allerdings auf der Hand. Uns interessiert am meisten, daß die Vertreter Seidels in dem Verfasser einen Protestanten sehen, der unmutig über die damaligen relativ toleranten Maßregeln der brandenburgischen Regierung, seinen lauen Glaubensgenossen das künftige Schicksal der Mark in kirchlicher Beziehung habe vor Augen führen wollen und zu dem Zweck die Maske eines prophetischen Katholiken angenommen habe.
Andere glauben einen gewissen Andreas Fromm identifizieren zu können. Fromm war Probst zu St. Petri in Berlin bis 1666, wurde dann seines Amtes entsetzt, trat 1668 in Prag zum Katholizismus über und erhielt, trotz seiner Verheiratung daselbst ein Dekanat, dann zu Leitmeritz ein Kanonikat. Das Vaticinium wäre dann nichts als ein Racheakt. Er starb, etwa siebzigjährig, im Jahre 1685. Dagegen wird angeführt, daß er dazu zu früh gestorben sei, da die wirkliche Abfassung in die Jahre 1691 [S. 182]oder 1692 falle, ferner, daß der Verfasser ja nicht durchaus ein Katholik gewesen sein müsse. Was den Einwurf des frühen Todes betrifft, so ist er genau genommen eine petitio principii, da wir die Entstehungszeit des Gedichtes keineswegs genau kennen. Das einzige, was wir in dieser Hinsicht mit Bestimmtheit wissen, ist der von Gieseler[101] erbrachte Nachweis, daß die Weissagungen spätestens seit 1693 bekannt sind. Ferner ist es richtig, daß das ausgehende 17. Jahrhundert zu weissagen liebte. Aber das ist keine Spezialität dieser Zeit, denn das ganze Mittelalter hatte dieselbe Neigung.
Andere sehen in der Prophezeiung eine Staatsschrift gegen den Kurfürsten Friedrich III., nachmaligen ersten König von Preußen, unter Billigung seiner Stiefmutter gerichtet in der Absicht den großen Kurfürsten zur Enterbung seines ältesten Sohnes zu Gunsten des Markgrafen von Schwedt zu bestimmen.
Nach Heinrich Pröhle[102] ist der Grundgedanke der Weissagung keineswegs der Haß gegen die Hohenzollern, sondern das Verlangen nach einer Rückgabe der geistlichen Güter. Das Thema sei das Glück der Mönche, das, wie das Kloster Lehnin zeige, immer wieder im Wechsel der Zeiten zum Vorschein komme. Für den Verfasser hält Pröhle – wie [S. 183]schon früher Gieseler – den Abt von Huysburg, von Zitzwitz. (Geb. 1643, gest. 1704).
Ist diese Vermutung richtig, dann wäre die ganze Prophezeiung entstanden, weil im Jahre 1691 Lehnin eine Kolonie reformierter Schweizer erhielt. Das soll den zum Katholizismus übergetretenen Zitzwitz empört haben. Andrerseits wäre es auch eine Zurücksetzung der lutherischen märkischen Bauern gewesen. Zitzwitz soll bei Abfassung des Vaticinium Virgils Hirtengedichte nachgeahmt haben. Guhrauer vermutet einen Jesuiten Friedrich Wolf († 1708) als Autor.
Uns ist es recht gleichgültig, wer der Verfasser der Prophezeiungen war. Feststellen wollen wir aber, daß kein genügender Gegenbeweis für das hohe Alter des Vaticinium erbracht ist, wenn es auch sehr wahrscheinlich ist, daß es erst am Ausgang des 17. Jahrhunderts, keinesfalls später, entstand. Ferner, daß aus der Unsicherheit des Verfassers sowohl wie seiner Tendenz hervorgeht, daß es keineswegs so überaus leicht ist die Weissagung als Fälschung zu brandmarken.
Mir scheint sogar die Strittigkeit der Tendenz die Vermutung nahe zu legen, daß eine solche überhaupt nicht vorhanden ist. Das schließt ja gewiß nicht aus, daß der Verfasser, auf dem Boden einer bestimmten Weltanschauung stehend, die Dinge durch eine konfessionelle Brille betrachtet. Aber braucht das in gehässiger Absicht zu geschehen? Ist der Gedanke so unerhört, daß jemand aus keinem anderen Grunde prophezeit als dem, die Wahrheit zu entschleiern? Jedenfalls können wir das annehmen.
[S. 184]Da das für uns einzig wertvolle der Nachweis ist, daß es zu allen Zeiten mit Sehergabe ausgerüstete Menschen gab, ihr Name aber recht gleichgültig ist, so lassen wir uns nicht auf irgendwie strittige Momente ein, sondern konzedieren den Gegnern sowohl die Abfassung am Ende des 17. Jahrhunderts, als auch die katholische Richtung. Nicht weil wir beides für bewiesen hielten, sondern lediglich weil es wenig Wert hat sich mit Fragen aufzuhalten, deren unumstößlich richtige Beantwortung kaum möglich ist.
Selbst mit der obigen Einräumung bleiben immerhin noch reichlich zwei Jahrhunderte, für die geweissagt wird, ohne daß die Möglichkeit eines Schwindels gegeben wäre.
Wir haben bereits früher die historischen Tatsachen notiert, die auf die Weissagungen bezogen werden können. Daß dazu etwas guter Wille nötig ist, sei keineswegs geleugnet. Aber ihn brauchen wir naturgemäß bei jeder Auslegung, und das um so mehr, je dunkler der Text ist. Wir bestreiten aber ausdrücklich, daß hierzu mehr bona fides unsererseits nötig ist, als beim Gegner mala fides, um das Unsinnige des Vaticinium zu beweisen. Ja, wir gehen so weit, zu behaupten, daß eine Reihe von Vorhersagen nur durch Unwissenheit oder Gehässigkeit mißzuverstehen sind. Denn da nun einmal das profane Dogma zu Recht besteht, daß ein Enthüllen der Zukunft unmöglich sei, wird jede Beweisführung mit dem Endziel und der unausgesprochenen Voraussetzung geführt, daß alles Geweissagte falsch sein müsse.
Nichts liegt uns, die wir ohne jegliche Tendenz an die Prüfung des Phänomens herantreten und nicht, [S. 185]wie die Gegner behaupten werden, uns zum Anwalt der Prophetie machen, weil wir a priori ihre Richtigkeit voraussetzen, sondern im Gegenteil, weil a potiori sie uns beweisbar und bewiesen dünkt, ferner als die These, alles, was prophezeit sei, müsse auch eintreffen. Im Gegenteil zögern wir nicht, zuzugeben, daß sowohl die Vorhersage, der elfte im Stammbaum werde auch der letzte protestantische Herrscher aus dem Hause Hohenzollern sein, falsch ist, als auch die andere, daß Deutschland zum Katholizismus zurückkehren wird, sich bis dato nicht erfüllt hat und auch hoffentlich nie erfüllen wird.
Das hindert aber nicht, die verblüffende Übereinstimmung der Weissagung mit vielem, was sich später ereignete, anzuerkennen. Daß auch die zünftige Geschichtsschreibung so ein unbestimmtes Gefühl hat, geht schlagend aus der Tatsache hervor, daß man am liebsten das ganze Vaticinium als nachträglich konstruiert hinstellen möchte und mit Bedauern nur anerkennt, daß es unbedingt spätestens im Jahre 1692 in der vorliegenden Form abgefaßt war.
Ein sehr wichtiger Punkt ist noch vorauszuschicken: Wir nehmen an, daß die Verse 72 und 73 sich auf den Großen Kurfürsten beziehen, was ja auch die Gegner zugeben. Während diese aber noch die beiden folgenden ihm zuschreiben, geben wir sie mit Meinhold und anderen Friedrich I. Und zwar nicht allein deshalb, weil nur auf diese Weise das Folgende einen Sinn, und zwar einen erstaunlich zutreffenden Sinn erhält. Wiewohl auch dieser Grund völlig zulässig wäre. Denn wie jeder Herausgeber eines alten Schriftstellers so lange Konjekturen macht – und [S. 186]oft was für welche! – und deutelt, bis sein Autor etwas Vernünftiges sagt, so besteht gar kein Grund, dieses Recht dem Interpreten einer Weissagung zu beschneiden. Um so weniger, als kein Wort verändert, noch ein Vers umgestellt werden muß.
Wir sind noch deshalb hierzu vollauf berechtigt, weil Vers 73 von einem princeps spricht, während Vers 74 ausdrücklich den Regens, denjenigen, der Rex ist – wie die wohlwollende Interpretation um so eher annehmen kann, je mehr sie den Standpunkt vertritt, die Prophezeiung stamme erst aus dem Ende des 17. Jahrhunderts – nennt und dazu in Gegensatz stellt. Auf Friedrich I. beziehen sich dann also die Verse 74 und 75, die folgenden 76–80 aber auf den Soldatenkönig. Daß aber Vers 78 wieder von regimen spricht, ist ein weiterer Hinweis darauf, daß der Seher die Erhebung Preußens zum Königreich im Auge hatte.
Die Gegner beziehen, mindestens ebenso übelwollend wie wir wohlwollend, die vier Verse von 72–75 auf den Großen Kurfürsten, ohne sich am Worte Regens zu stoßen. Daß dann alle weiteren Verse bis zum Schluß Unsinn enthalten müssen, und das um so mehr, je präziser und verblüffender ihre Angaben sind, das stört sie nicht nur nicht, ist im Gegenteil gerade das Motiv, das sie zu dieser Zuteilung veranlaßte.
Auch auf einem Umwege, Majunke folgend, kommen wir zu demselben Resultat. Wir argumentieren dann: die konkreten Tatsachen der Verse 72 und 73 deuten, was noch niemand bestritt, zweifellos auf den Großen Kurfürsten. Ebenso die konkreten [S. 187]Tatsachen des Verses 77, der Jammer im Lande über das brutale Aushebungssystem, auf Friedrich Wilhelm I. Also müssen – allerdings unter einer Voraussetzung, die wir nicht teilen, daß nämlich jede Prophezeiung eintreffen müsse – die dazwischen liegenden Verse auf den ersten König Preußens bezogen werden. Das ist ja gewiß nicht zwingend, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit unserer Zuteilung. Und dies um so mehr, als das nunmehr in allen wichtigen Punkten – von dem bereits erwähnten Irrtum bezüglich der elften Generation abgesehen – mit den historischen Tatsachen harmonierende Vaticinium gewiß den Anspruch erheben darf, nicht sinnwidrig ausgelegt zu werden. Wenn wir auch keinem Menschen Unfehlbarkeit einräumen, so werden wir doch bei einem als klug bekannten Manne jedem Ausspruch mehr Beachtung schenken, als bei einem Toren und sogar in gewissen Fällen geneigt sein, bei Worten, die uns anstößig erscheinen, den Fehler eher bei uns, als beim andern zu suchen. Diesen Analogieschluß fordern wir auch für das Vaticinium.
Daß Vers 80 nur teilweise auf den Soldatenkönig paßt, sei nicht geleugnet. Der Seher sah eben nicht nur bisweilen falsch, er sah auch manchmal unklar, wie das ja bei Weissagungen sehr häufig ist.
Dies berücksichtigt muß jeder, der tendenzlos an die Weissagung herantritt, zugeben, daß ihr Inhalt in ganz wunderbarer Weise von der späteren Geschichte bestätigt wurde.
Friedrich der Große ist nicht minder treffend charakterisiert, wie sein Neffe und Nachfolger Friedrich [S. 188]Wilhelm II., auch wenn man nicht zugeben wollte, daß er im Wasser gestorben ist. Desgleichen Friedrich Wilhelm III., dessen Regierung bedeutend günstiger endete, als er es nach seinen Fähigkeiten und der politischen Konstellation Europas je hätte hoffen dürfen. Und zwar, wie das Vaticinum ganz richtig andeutet, durch eine neu heranwachsende Macht, nämlich durch den Patriotismus eines Volkes, das sich mündig zu fühlen beginnt.
Der letzte des Stammes, Friedrich Wilhelm IV., soll nicht heißen der letzte Hohenzoller, wie aus Vers 49 hervorgeht, sondern der letzte Protestant. Denn das durch das verruchte Weib in die Familie getragene und elf Generationen fortwirkende Gift, ist ja der Protestantismus. Daß die Hohenzollern noch heute Protestanten sind, ist hinlänglich bekannt. Trotzdem stimmt die Prophezeiung wunderbar in anderer Beziehung, da Friedrich Wilhelm der letzte absolute Beherrscher Preußens war. Wer aber das wichtigste Ereignis in der Regierungszeit dieses hochbegabten Monarchen angeben wollte, würde die Revolution des Jahres 1848 nennen müssen mit ihren konstitutionellen Folgen. Und mit diesem Ereignis sind tatsächlich die beiden einzigen Verse, die von diesem König handeln, Vers 93 und 94, ausgefüllt.
Und wer wird endlich die verblüffende Wahrheit des 95. Verses leugnen wollen? Hier ist ja mit klaren und deutlichen Worten, ohne jede symbolisierende Einkleidung, die Neuerrichtung des deutschen Reiches unter Wilhelm I. vorhergesagt. Diesen Vers hatte übrigens bereits Seyler in seiner im Jahre 1741 zu Frankfurt und Leipzig erschienenen Schrift: »Weitere [S. 189]Ausführung derer ohnlängst bekannt gewordenen, und jetzo in einem Zusammenhang gebrachten, auf das allerdurchlauchtigste Königliche Haus Preußen und dessen noch bevorstehende glückliche Fata, abzielender, nachdenklichen, wundersamen und in gegenwärtigen Zeiten eingeschlagenen Weissagungen usw.« richtig interpretiert. Allerdings glaubte er – was er ja nach der damaligen politischen Konstellation auch glauben mußte – ein König von Preußen würde zum römischen Kaiser erwählt werden.
Sind wir also auch der Ansicht, daß es sich in diesem Vaticinium um eine Weissagung handelt, deren Inhalt in einer stattlichen Reihe von Punkten in Erfüllung gegangen ist, so ist damit allerdings noch nichts über die Gründe dafür gesagt. Mancher, der unserer Ansicht in materieller Beziehung beipflichten wird, mag den Zufall als Erklärungsgrund zur Hilfe nehmen. Wir sind nicht in der Lage diesen Skeptiker zu widerlegen. Aber wir halten es für höchst unwahrscheinlich, daß eine so lange und komplizierte Reihe von Vorhersagen durch weiter nichts als den Zufall in Erfüllung gegangen sein soll.
Doch wollen wir vorläufig das Urteil hierüber noch dem Leser überlassen.
Fahren wir in unserem Beweise fort. Wir gingen von einzelnen Prophezeiungen, bei denen Zufall oder Berechnung eine mehr oder minder große, bisweilen ausschlaggebende Rolle spielen können, aus, um im Vaticinium lehniense eine ganze Reihe von Vorhersagen derselben Person, anzuführen, und finden, daß die große Mehrzahl der Vorhersagen in Erfüllung ging. Allerdings haben wir es hier mit Versen, also [S. 190]mit stilisierten Visionen zu tun, was in mancher Hinsicht freilich ihre Realisierung desto erstaunlicher macht.
Gegen das Vaticinium lehniense kann der Einwand erhoben werden, man kenne noch nicht einmal den Verfasser – wiewohl das sachlich ja gar nichts ändert – auch die Interpretationen stammten nicht vom Seher selbst, sondern zum Teil von uns. Deshalb wollen wir im folgenden das Rohmaterial einiger Personen anführen, deren historische Persönlichkeit völlig einwandfrei identifizierbar ist und die womöglich selbst ihre Visionen deuteten.
[75] Übersetzt in Anlehnung an Wilhelm Meinhold. Die Lehninsche Weissagung, Neuausgabe von Paul Majunke, Regensburg 1896, S. 156 ff. Die Anmerkungen sind zum Teil Meinhold (S. 172–234) entnommen, zum Teil M. W. Heffter, Die Geschichte des Klosters Lehnin, Brandenburg 1851, S. 95 ff.
[76] Lehnin wurde im Jahre 1180 vom Markgrafen Otto I. aus dem Hause der Askanier, dem Vater Albrechts des Bären, begründet. Das Haus ging 1313 unter, tatsächlich sehr schnell (V. 10), da Leutinger (Topograph. March. Tom. II, Opera 1119 nov. edit.) erzählt, daß neunzehn Fürsten aus diesem Stamme innerhalb zweier Jahre gestorben seien. Der letzte war Waldemar.
[77] Die »Höhle der Löwen«, da sowohl die Wittelsbacher, die von 1323–1373 über die Mark herrschten, als auch die Luxemburger, von 1373–1415 Herren der Mark, den Löwen im Wappen führen. Der 16. Vers bezieht sich auf den sogenannten falschen Waldemar, der 1319 die Leiche eines fremden Mannes als die seinige hatte begraben lassen und nach Jerusalem pilgerte. Den nach 28 Jahren Zurückgekehrten erkannte fast das ganze Land an, auch Kaiser Karl IV., der ihn am 3. Oktober 1348 feierlich zum zweiten Male mit allen Landen, die er früher besessen hatte, belehnte. Da der junge Ludwig dagegen sich auflehnte, entbrannte ein vierjähriger Kampf, bis sich Waldemar nach Dessau zurückzog.
[78] Bezieht sich vielleicht auf den Einfall der Polen und Littauer in die Mark 1326. Ob Chorin, ein um 1272 angelegtes Tochterkloster von Lehnin, dabei berührt wurde, läßt sich nicht feststellen. Meinhold glaubt dagegen, die »Fremdlinge« seien Karl IV., der mit seinen Söhnen Wenzel und Sigismund 1374 nach Chorin kam, und die in Bruderzwist geratenen Wittelsbacher Otto, Stephan und Friedrich, drei Brüder gleich den drei Häuptern des Cerberus, bändigte, indem er seinem Schwiegersohn Otto die Mark für 200 000 Dukaten abkaufte.
[79] Da Karl die Mark bald verließ, Sigismund sie gar an Jobst von Mähren, der sie schamlos ausbeutete, verpfändete, der Adel (Quitzow, Jagow, Bredow usw.) sein Unwesen trieb, so ist das düstere Bild historisch.
[80] V. 27–34 betreffen Friedrich I. von Hohenzollern, seit 1415 Markgraf von Brandenburg († 1440), der durch Unterwerfung des Adels (Wölfe) natürlich auch die Untertanen (Schafe), wenigstens vorübergehend, schädigte. Ob Meinhold (S. 182) das Richtige trifft, wenn er longaeva dierum adverbaliter auffassend, übersetzt: »dein Stamm wird nach langen Zeiten mit geringer Gewalt die väterlichen Fluren beherrschen«, als Vorahnung der Konstitution des 19. Jahrhunderts, lassen wir dahingestellt. Grammatikalisch dürfte diese Übersetzung zulässig sein.
[81] Nach dem Recht der Erstgeburt wäre Friedrichs Nachfolger sein Sohn Johann der Alchymist gewesen. Friedrich aber bestimmte ihn, zugunsten des tapferen Friedrich II. zu verzichten. »Ermüdet« durch immerwährende Kriege zog er sich auf die Plassenburg zurück, nachdem er seinem jüngeren Bruder Albrecht die Regierung übergeben hatte. Er starb am 11. Februar 1471. Die Lesart bustum (Grab) könnte als Anspielung darauf gedeutet werden, daß Friedrich II. und Johann im gleichen Kloster Heilsbronn bestattet wurden. (Vers 35–38.)
[82] Albrecht Achilles folgte »zur Zeit des Todes« – 1472 war eine heftige Pest – seinem Bruder. Seine Fehden gegen Nürnberg (»den Berg«) sind bekannt. Er konnte kaum das kleine Heersbrück (»die Brücke«) erobern. Vielleicht ist hier auch eine Anspielung auf seine Niederlage bei Brück an der Rednitz gemacht. Er war einer der prunkliebendsten Fürsten seiner Zeit. Lehnin hat er nichts getan, wohl aber mit zwei Bischöfen, dem von Würzburg und dem von Bamberg, in Fehde gelegen. Er starb 1486. (Vers 39–42.)
[83] Johannes Cicero, Freund der schönen Künste und sehr beredt. Er soll durch seine Rednergabe die Versöhnung des römischen Königs Matthias mit den Königen Kasimir von Polen und Wladislaw von Böhmen vermittelt haben. Kurz vor seinem Tode (1499) ermahnte er seine Söhne, guttätig, gottesfürchtig, gerecht und treue Stützen ihrer Untertanen zu sein, denn – so heißt es am Schlusse des noch erhaltenen Briefes: »lebt und regiert ihr gerecht, so werden euch die Guten lieben, und die Bösen fürchten, und unsterblicher Ruhm wird euer Teil werden.« Das ging in Erfüllung, da beide Söhne Kurfürsten wurden: Joachim von Brandenburg und Albert Erzbischof von Mainz. (Vers 43–46.)
[84] Gemeint ist die Kurfürstin Elisabeth, Gemahlin Joachims I., Tochter Königs Johann von Dänemark, die der Reformation (»traurige Pest«) zuneigte. Tatsächlich dauert das »Gift« schon länger als 11 Generationen, denn folgende Hohenzollern sind protestantisch gewesen bzw. sind es noch heute: Johann Georg, Joachim Friedrich, Johann Sigismund, Georg Wilhelm, Friedrich Wilhelm (der Große Kurfürst), Friedrich I., Friedrich Wilhelm I., Friedrich der Große, Friedrich Wilhelm II., Friedrich Wilhelm III., Friedrich Wilhelm IV. (als elfter!), Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II. Bis heute also 14 Generationen. Aber selbst wenn wir die Kinderlosen Friedrich den Großen und Friedrich Wilhelm IV., weil genau genommen keinen Stammbaum (Stemma) bildend, streichen, sind es bereits 12 Generationen. Stimmt also diese Prophezeiung auch nicht wörtlich, so ist sie doch richtig hinsichtlich der langen Reihe protestantischer Herrscher. Diese ließ sich um so weniger voraussehen, als inzwischen das Glaubensbekenntnis der deutschen Herrscherfamilien stark gewechselt hat. Man denke an die protestantischen pfälzischen Wittelsbacher, deren Nachkommen heute als katholische Könige herrschen, ferner an den Glaubenswechsel im Königreich Sachsen, den bevorstehenden in Württemberg usw. (Vers 46–49.)
[85] Joachim II. trat mit seinem Lande dem Protestantismus bei, hob 1542 die Klöster, auch Lehnin, auf, brach den seinem Vater geleisteten Eid, dem Katholizismus treu zu bleiben, und führte ein lockeres Leben. Er starb 1571. (Vers 50–54.)
[86] Johann Georg setzte die Reformation fort, befehdete die Calvinisten und war schwach. Er starb im Pestjahr 1598 in seinem prächtigen Schloß zu Köln an der Spree. (Vers 55–59.)
[87] Joachim Friedrich war der erste in Berlin geborene Kurfürst, ein eifriger Anhänger des Luthertums, der, mit Recht, den Übertritt seines Sohnes zum verhaßten Calvinismus befürchtete. Er starb 1608. (Vers 60–62.)
[88] Joachim Sigismund trat zum Calvinismus über (eine Erfüllung des Vers 58) und verursachte durch sein dahingehendes Edikt viel Verstimmung, mehr aber noch durch die Ohrfeige, die er 1613 dem Pfalzgrafen von Neuburg in Wesel bei der Tafel gab. Der Prophet hält (Vers 66) den Calvinismus für noch schlechter als das Luthertum. Der Kurfürst konnte seine Ansprüche auf das Jülische Erbe nicht voll durchsetzen und litt unter der Übermacht der Städte. Er starb 1620. (Vers 63–67.)
[89] Georg Wilhelm war ein schwacher Fürst, unter dessen zwischen den Schweden und dem Kaiser schwankenden Regierung das Land durch den Dreißigjährigen Krieg schwer litt. Sein Vertrauen zum allmächtigen Grafen Adam von Schwarzenberg, dem österreichischen Gesandten am Berliner Hof, schädigte das Land. Der Kurfürst starb am 21. November 1690, schon 3½ Monate später Schwarzenberg (4. März 1691), der allerdings nicht sein Diener war. »Schamlos« wird er wohl genannt, weil er Gustav Adolf nicht energisch begegnete. (Vers 68–71.)
[90] Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, in der Prophezeiung interessanterweise »groß« genannt, hat tatsächlich sein Land bedeutend vergrößert, nämlich um etwa 30 000 qkm. Die dritte Burg (Nürnberg, Brandenburg) wäre das im Westfälischen Frieden zu Preußen geschlagene Magdeburg. Der Große Kurfürst starb 1688. (Vers 72–73.)
[91] Diese Verse könnten auf den klugen Kurfürst Friedrich III., als König Friedrich I. Anwendung finden, sind allerdings sehr verschwommen. Daß er Preußen zum Königreich erhob, hätte immerhin betont werden können. Allerdings scheint das Wort Regens (statt des sonstigen dominus, heros, princeps) eine Anspielung auf die Königswürde zu enthalten. (Vers 74–75.)
Übrigens darf nicht verschwiegen werden, daß nicht notwendigerweise die Verse 72–75 auf zwei Herrscher bezogen werden müssen, doch ist es nach dem Wortlaut der Prophezeiung zulässig.
[92] Friedrich Wilhelm I., Sohn des Vorigen, trat allerdings nicht in die Fußtapfen des Vaters, was aber sicherlich für Preußen kein Unglück war. Der Name täuschte insofern, als Friedrich Wilhelm bekanntlich ein Soldatenkönig war. Seine brutale Werbemethode mag auch die Tränen der Mütter erklären. Voltaire meinte, die damalige Türkei sei ein wahrer Freistaat gegen das damalige Preußen gewesen. Der König, der 1740 an der Wassersucht starb, war allerdings sehr entstellt, aber keineswegs innerlich gebrochen. Mag es damals in Preußen auch barbarisch und ungemütlich zugegangen sein, so steht doch fest, daß Friedrich Wilhelm das Schwert schmiedete, dessen sein Sohn sich bediente. (Vers 76–89.)
[93] Die Verse 83–84 beziehen sich auf Friedrich den Großen, der als achtundzwanzigjähriger Jüngling den Krieg mit Maria Theresia, der »großen Gebärerin«, die damals mit Joseph II. in der Hoffnung war und im ganzen 15 Kinder hatte, begann. Die schweren Leiden des Staates im Siebenjährigen Kriege sind hinlänglich bekannt. Was das Beklagen des »grausen Schicksals« betrifft, so schrieb der große König am 28. Oktober 1760 an den Marquis d’Argens (Hinterlassene Werke, Bd. 10, S. 292): »Ich habe alle meine Freunde, meine geliebtesten Verwandten verloren, mich trifft jede nur mögliche Art von Unglück; mir bleibt gar keine Hoffnung übrig; ich sehe mich von meinen Feinden verspottet, und ihr Stolz trifft Anstalten, mich unter die Füße zu treten. Ach! Marquis,
Wenn alles uns verläßt, die Hoffnung selber flieht,
Dann wird das Leben Schmach, und eine Pflicht der Tod!«
Daß auch das »Seufzen« der Königin, zumal sie ja geschlagen wurde, historisch ist, bedarf keiner näheren Ausführung. Was den Südwind (auster) betrifft, so liegt die Anspielung auf Österreich nahe genug. Sogar das Kloster spielte eine vorübergehende Rolle in Friedrichs Leben. Denn im Zweiten Schlesischen Kriege (1745) mußte er, vor einer Schwadron ungarischer Husaren fliehend, sich im Kloster Kamenz verbergen. Hier wurde er als Zisterziensermönch verkleidet und unter die übrigen Mönche im Chor versteckt. König Friedrich Wilhelm IV. ließ sich im Jahre 1846 noch die Stelle in der Klosterkirche von Kamenz zeigen, wo Friedrich im Chor als Mönch verkleidet gesessen und mitgesungen hatte. Flautibus austris mit »vor den heranstürmenden Österreichern« mit Ponk (Knop) zu übersetzen, will mir doch zu kühn scheinen, wenn es auch dem Sinne nach sicher richtig ist. Aber wenn wir sogar »vor den wehenden Südwinden will er sein Leben den Klöstern anvertrauen« übersetzen, womit wir keinerlei Gewalt antun, ist der Sinn klar und die Erfüllung buchstäblich eingetroffen.
[94] Friedrich Wilhelm II., der Neffe Friedrichs des Großen – daß hier der Prophet die Bezeichnung als Sohn, was doch sonst bei ihm die Regel ist, fortließ, ist auf alle Fälle merkwürdig, zumal Friedrich Wilhelms Nachfolger in den späteren Versen wieder richtig als Sohn bezeichnet wird – war tatsächlich ein nach jeder Richtung schlechter Herrscher, der auch insofern die Sitten der Väter nachahmte, als er an seinem Hofe eine schamlose Maitressenwirtschaft einführte. Daß die Religiosität damals wie überall, so auch in Preußen danieder lag – wenigstens wenn wir unter Religiosität Kirchengläubigkeit verstehen – ist hinreichend bekannt. Auch die öffentliche Sittlichkeit stand sehr tief. Vgl. Ed. Vehse, Geschichte des preußischen Volks und Adels. I. Abt., 5. Bd. und Paulig, Friedrich Wilhelm II., sein Privatleben und seine Regierung.
Vers 87 mag sich auf Kaiser Franz II. beziehen, der sich 1792 am Kriege gegen Frankreich beteiligte, und im Frieden von Basel, am 5. April 1795, von ihm im Stich gelassen wurde. Friedrich Wilhelm erleichterte dadurch zweifellos die späteren Erfolge der Franzosen gegen Deutschland. Massenbach schreibt »Der Staat war seiner Auflösung nahe«.
Der König starb (1797) tatsächlich im Wasser, nämlich in seinem von Seen umgebenen Schlosse zu Potsdam an der Wassersucht.
Interessant ist, daß der König sich nicht lange vor seinem Tode die Lehninsche Prophezeiung kommen ließ, und zwar das älteste Exemplar der in der Berliner Bibliothek vorhandenen Handschriften. Er gab es nicht zurück. Es soll das Original der Weissagungen gewesen sein. (Vgl. Otto Glagau »Kulturkämpfer«, Heft 93, S. 32.) (Vers 85–88.)
[95] Die ersten beiden Verse (89 und 90) passen in erstaunlicher Weise auf Friedrich Wilhelm III. Denn tatsächlich hat dieser schwache und unfähige Monarch, nachdem er im Tilsiter Frieden alles Land westlich der Elbe hatte abtreten müssen, so daß Preußen von 5551 qkm und 8 687 000 Einwohnern unter seinem Vorgänger auf 2859 qkm mit 4 940 000 Einwohnern zusammengeschmolzen war, am Ende seiner Regierung wieder über 5050 qkm mit 10 400 000 Einwohnern verfügt. Ja, das Rheinland und einen großen Teil Sachsens hatte er neu gewonnen. Die furchtbaren Leiden des Volkes während der Napoleonischen und Freiheitskriege sind hinlänglich bekannt, ebenso, daß das Volk und durchaus nicht der König die Wiederaufrichtung des Staates ermöglichte. Ferner ist zu beachten, daß in die Regierung des Königs die Säkularisationen von Klöstern und Kirchengut fallen, was wenigstens der katholischen Bevölkerung schmerzlich war. Die neu heranwachsende Macht des Volkes, die sein Sohn verspüren sollte, ahnte Friedrich Wilhelm III. allerdings nicht. Daß die Untertanen durch ihr Gut und Blut das Schicksal abwenden und nach vollbrachter Tat sich ruhig knechten lassen sollten, war seine naive Auffassung. (Vers 89–92.)
[96] Vers 93 und 94 beziehen sich auf Friedrich Wilhelm IV. Ohne gewaltsame Interpretation anzuwenden, werden wir finden, daß auch sie wunderbar zutreffen. Allerdings ist der König nicht der letzte protestantische Hohenzoller, wohl aber der letzte, der das Zepter führt im Sinne eines absoluten Monarchen. Denn die Märztage des Jahres 1848, auf die Vers 94 deutlich anspielt, brachten bekanntlich die Konstitution, die Friedrich Wilhelm III. zwar zu geben geschworen, aber nicht gehalten hatte, wirklich. Beziehen wir Vers 92 statt auf Friedrich Wilhelm III., auf seinen Sohn, so trifft es ebenfalls vortrefflich zu. Denn beide Fürsten hatten keine Ahnung davon, was für eine Macht im Verlangen des Volkes, sein Schicksal selbst mit zu bestimmen, heranwuchs.
[97] Am verblüffendsten ist das Eintreffen des 95. Verses: Das 1871 durch Wilhelm I. errichtete deutsche Kaisertum.
Ob die folgenden Verse nun in Erfüllung gehen oder nicht, d. h. ob der Katholizismus wieder ausschließlich herrschen wird, können wir der Zukunft überlassen. Richtig ist ja leider, daß die Klostergründungen ebenso wie die Macht des Zentrums in den letzten Dezennien beängstigend zugenommen haben.
[98] Vgl. M. W. Heffter, Die Geschichte des Klosters Lehnin, Brandenburg 1851, S. 103 ff. Dagegen führt Ponk (Schrammen-Lehnin S. 15 ff.) eine Reihe von Zeugnissen für die Existenz weit älterer Handschriften an. Zwingende Beweiskraft hat keines, wenn auch höchst merkwürdig die Tatsache anmutet, daß die Prophezeiung des P. Speer über Bayern zum Teil wörtlich mit der Lehninschen übereinstimmt. Da Speer aber bereits 1632 starb, muß entweder unsere fast ein Jahrhundert älter sein, als behauptet wird, oder aber der angebliche Hermann hat Speer kopiert. –
[99] Sabell, Literatur der sogenannten Lehninschen Weissagung. Heilbronn 1879.
[100] Nämlich Hermann I. 1234–1243; Hermann II. 1248–1257 und Hermann III. bis 1296. Vgl. D. B. Dettmar, Lehnin und seine Fürstengräber, Regensburg 1885, S. 119.
[101] J. C. L. Gieseler, Die Lehninsche Weissagung gegen das Haus Hohenzollern als ein Gedicht des Abtes von Huysburg, Nicolaus von Zitzwitz, aus dem Jahre 1692 nachgewiesen, erklärt und in Hinsicht auf Veranlassung und Zweck beleuchtet. Erfurt 1849.
[102] Die Lehninsche Weissagung, Berlin 1888, S. VII.
[S. 191]
Unter den außerordentlich zahlreichen vermeintlichen und wirklichen Sehern des 17. Jahrhunderts verdient die Jungfrau Christina Ponitowssken schon deshalb Beachtung, weil es gar keinem Zweifel unterliegen kann, daß sie von der Göttlichkeit ihrer Mission und dem hohen Wert ihrer Visionen überzeugt war. Was letzteres betrifft, so sind wir darüber allerdings anderer Ansicht und neben Bewunderern hat es auch unter ihren Zeitgenossen nicht an solchen gefehlt, die ihnen allen Wert absprachen[103].
Tatsächlich handelt es sich auch in der Regel um recht allgemeine, phantastisch verbrämte, biblische Redensarten und Ermahnungen, deren Unterlassung die Welt nicht aus ihren Gleisen geworfen hätte.
Als Beispiel für die Art der Visionen, aber auch um ihres Inhaltes willen, den man immerhin auf die Schwedenkriege beziehen kann, sei nachstehend eine Vision vom 13. Januar 1628 mitgeteilt.
[S. 192]Es sei vorausgeschickt, daß Christina die Tochter eines böhmischen Geistlichen war, etwa sechzehnjährig in eine schwere Krankheit verfiel und von da ab zahlreiche Visionen hatte, die im Jahre 1629 im Druck erschienen. Die erste auf die hin sie dann krank wurde, trat am 2. November 1627 ein. Sie sah eine blutige Rute am Himmel, deren Stiel gegen Mitternacht, deren Spitzen aber gegen Mittag gekehrt war. Daß nach dem Einfall Gustav Adolfs diese Vision als Voranzeige des Schwedenkrieges, der ja wenige Jahre später ausbrach, gedeutet wurde, ist nahe liegend.
Die Vision vom 13. Januar lautet[104]:
»Donnerstags hatte ich um 2 Uhr nach Mittage [S. 193]folgendes Gesicht: Erstlich kam zu mir der HERR, in schöner Gestalt, both mir die Handt, und sprach: Mein Segen sey mit dir jmmer und zu ewigen Zeiten. Weiter sprach er: Komm mit mir: Und ich ging mit ihm, gleich als in einen schönen Garten, da kam zu uns der Alte[105], grüßte mich mit Handgebung, giengen also spatzieren, der HErr mir zur Rechten, der Alte zur Linken, ich aber in der Mitten, von ihren beyden Händen geführet: Da klagte ich dem Alten mein Elend, daß ich nun gantzer 8 Tage meine Ohren verstopfft, und meine Zunge gebunden hette gehabt, unnd bahte, daß er mir meine Ohren öffnen, unnd meine Zunge wieder lösen wolte, weil der HErr, solches zu thun, sich geweigert, und gesaget, Er der Alte, hette eben die Gewalt als er, weil sie gleich an Macht und Ehren: Darauff sprach der Alte: Wie bistu doch so ungeduldig, unnd warumb klagest du also? Ich antwortet: Darumb O HErr ist mein Herz betrübet gewesen, weil ich gedachte, das were eine Straffe und Züchtigung von dir, und eine Anzeigung deines Zorns gegen mir, wie ich denn weiß, daß ich nicht allein zeitliche, sondern auch wol ewige Straffe verdienet: Er sprach abermal: Worbey merckestu, daß das ein Zornzeichen sey, an deiner Zunge und an deinen Ohren[106]?«
Überspringen wir die Wechselreden, um zum tatsächlichen Inhalt der Vision zu kommen: »Mit den Worten ergriff er mich bey der lincken, und der [S. 194]HERR bey der rechten Hand, und führeten mich an einen Ort des Gartens, und als bald kam gelauffen ein großer Löw, und von der andern Seithen her ein anderer, auch sehr groß, daß ich mich sehr fürchte: Unnd einer war roth der ander blaw, und ein jeder hatte ein sehr großes Schwerdt in den fördern füßen, auff den hindern aber stunden sie, und hatten auch sehr lange scharffe und spitzige Klawen. Siehe für dich sprach der Alte: und siehe, da kam ein überauss großes weißes Pferdt, auch auff zweyen Füßen her getretten, unnd hatte zween große Köpffe, in den fördern Füßen aber hilt es eine eisserne glüende Kugel, das gieng und tratt starck unter sich, daß der Erdbodem erschutterte, als es aber zu den Löwen nahete, gieng es langsam und mählich, gleich als wenn es sich für jnen fürchtete, die Löwen aber stunden muthig gegen einander, und sahen das Pferd an, neigeten auch bissweilen die Köpffe zusammen, als wenn sie heimlich mit einander redeten, unnd gaben doch gute Achtung auff das Pferdt: Als nun das Pferdt hart an sie kam, warff es die Kugel unter sie hin, gleichsam in Hoffnung, wann sie sich mit einander darumb rauffen würden, es unter dessen ungehindert davon kommen köndte: aber die Löwen ließen die Kugel ligen, setzen an das Pferdt, rießen ihm beyde Köpffe herunter, zermalmeten es auch in kleine Stücklein, redeten abermahls was mit einander, unnd stießen die Kugel von sich: Unnd der Alte sprach: Siehe ferner, und mercke auff: Und als bald sahe ich einen Baum, der war hoch und breit, stunde mitten unter den Löwen, und bedecket sie mit seinen Asten, weil er so groß war: Und sihe, auff dem [S. 195]Wipffel desselben Baums sahe ich ein Adler sitzen, der war sehr groß, und hatte 2. Köpffe, 4. Füße, 4. Flügel, 2. Schwäntze, und ich hörete daß der Adler ein groß Geschrey führete, davon ich aber nichts verstund, sondern fragte den Alten, warumb, und was doch der Vogel also schrie? Der Alte sprach: Dieser Vogel ruffet also: Sihe, ich sitze hoch, und bin erhöhet uber alle, darumb wer ist so keckes Hertzens, das er keme, und mich von meinem Ort vertreibe? Niemand ist, es wird auch niemand seyn. Als er aber ausgeredt, tratten die Löwen zu dem Baum, machten sich dran, rüttelten ihn mit solcher Gewalt, daß der Vogel herunter fiel, unnd von den Löwen zerrissen unnd verzehret wurde, eben wie das Pferdt. Abermahl sprach der Alte: Komm noch weiter mit mir, unnd sie beyde brachten mich zu einem großem Wasser, darbey abermahl ein uberauss großer Baum stund, der sich sehr aussbreitet: Der Alte sprach: Merck auff: Unnd siehe, die Löwen kamen wieder, hieben und hackten in den Baum, zerbrachen und zerspelten ihn mit großem Krachen, kratzen auch die Wurzeln mit den Klauen auss der Erden, worffen das alles ins Wasser, und verscharreten die Löcher, da die Wurtzeln gestanden, unnd vertratens wieder fein glatt, daß kein Anzeigung, wo der Baum gestanden, uberbliebe. Der Alte sprach weiter: Komm, jetzt soltu das Ende sehen: Und ich gieng, und sahe ein trefflich schön unnd wolgebawtes Hauss, von lauter Werckstücken erbawet, und volles Glantzes: Da fragte ich den Alten, was das für ein schön unnd wol gebawtes Hauss were? Er antwortet: Diss Hauss ist das Widerspenstige, stachlichte [S. 196]unnd verstockte Hauss, von außen scheinet unnd glentzet es zwar, aber innwendig ist es voll Unreinigkeit, Grewel, Boßheit, unnd aller Gottlosigkeit. Ist das große Babel, dessen Fall nun vorhanden: Dann es ist gar unmüglich, daß es lenger solte stehen bleiben, darumb, daß seine Sünde unnd Missethat nunmehr biss an den Himmel reichen: Derohalben mercke fleißig drauff, was geschehen wird. Bald kamen die vorigen zween Löwen, unnd neben ihnen noch einer schneeweiß: Diese alle drey fielen das Hauss an, brachen einen Stein nach dem andern herauss, (der weiße Löw thet allhier das beste) biss das Hauss also untergraben wurde, daß es uber einen Hauffen fiel, unnd ward zu malmet wie Sandt. Und die drey Löwen spatzierten auff dem Sande hin und her, und schryen uber laut: Babel ist gefallen, Babel ist gefallen: Das große Hauss ist gefallen: Siehe, das prächtige hochmütige Hauss ist gefallen, und soll nicht wieder erbawet werden. Es ist vollkömlich das Hauss, so voller Grewel und Hurerey war, umbgekehret: Doch nicht durch unsere Macht, sondern durch Krafft des starcken Löwens von dem Stamm Juda[107]. Mit den Worten giengen die Löwen von einander, und der Dritte kam mir auch auss dem Gesichte: Unnd bald hernach erhub sich ein starcker Wind, unnd zerstrewet den Sand so gar, daß nichts davon uberblieb. Der Alte aber sprach: Hastu gesehen, was da geschehen ist? Ich sagte: Ja Herr: Ich bitte aber, [S. 197]unterrichte mich, was durch das Pferd, den Adler, den Baum unnd das Hauss verstanden werde? Er sprach: Durch diss alles, soltu nichts anderes verstehen, als das große F. unnd P. unnd den gantzen Antichristischen Anhang, welches alles in kurtzer Zeit uber die massen schnell verderbet, unnd aussgerottet werden wird. Die Löwen aber sind V. T. T. Sch. D. St. E. F. U. S. W. durch diese wird Babylon, Antichrist, und das gantze Reich des Teuffels erstritten, niedergerissen unnd zerstöret, wie du selbst gesehen, daß sie diss alles so grawsam weg gereumbt, zu mahl das große Hauss: Welches alles zwar, sie nicht hetten können einreißen, sondern der dritte Löwe auss dem Stamm Juda muste kommen: Wie ernstlich er ihnen geholffen, hastu wol gesehen; Der wird ihre Krafft und Stärcke seyn, daß sie in seiner Krafft werden siegen können . . .«
Wer diesen Bericht liest, wird nicht zögern alles für einen Fiebertraum oder, noch einfacher, für Blödsinn zu erklären. Nun werden wir aber noch im weiteren Verlaufe dieser Untersuchung wiederholt die Beobachtung machen, daß sich Visionen in symbolische Gestalt hüllen, und zwar Visionen, deren Richtigkeit durch den folgenden Gang der Ereignisse zweifellos bewiesen wird. Meistens wird auch das symbolische Bild sofort vom Seher selbst richtig gedeutet.
Wenn uns also auch der Bericht höchst befremdlich anmutet, so ist das noch durchaus kein zureichender Grund, um ihn als Hirngespinst oder völlig wertlos zu verwerfen. Wir werden überhaupt sehr gut daran tun in unserem Urteil uns einer weitgehenden Zurückhaltung zu befleißigen. Denn da [S. 198]es sich hier um Dinge handelt, die noch so gut wie garnicht untersucht sind, gibt uns keine genaue Kenntnis des Sachverhaltes das Recht gewisse Forderungen aufzustellen, also etwa zu verlangen, daß es sich nicht um symbolische Visionen, sondern ausschließlich um klare und greifbare Bilder handelt, etwa wie die, die wir im Traume sehen.
Nun liegt es mir natürlich völlig fern für die Sehergabe der Poniatowssken Lanzen zu brechen. Was ich ganz allein beweisen will und auch beweisen werde, ist, daß es echte Prophetie gibt. Das ist etwas ganz anderes als sich für die übersinnliche Gabe einer bestimmten Person zu erwärmen, oder gar an irgend eine noch nicht eingetroffene Prophezeiung zu glauben.
Hier sei ausschließlich betont, daß das befremdliche Bild, unter dem hier die Zukunft enthüllt werden soll, nicht zur Annahme zwingt, als handle es sich um Phantasmagorien eines hysterischen jungen Mädchens. Das kann ja sein, muß aber nicht sein.
Wenn wir auch keine in Einzelheiten richtige Interpretation der merkwürdigen Vision geben wollen oder können, so ist doch immerhin die Deutung auf Gustav Adolfs Einfall in Deutschland zulässig. Was die Buchstaben zu bedeuten haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Berücksichtigt man, daß die Seherin Protestantin ist und in den politisch und konfessionell erregten Zeiten des Dreißigjährigen Krieges die Gegner jeder im andern den Antichrist verabscheute, dann wird der Ton so wenig wunder nehmen, wie der Vergleich der katholischen Gegner bzw. des österreichischen Kaiserhauses mit Babel, des Schwedenkönigs aber mit dem Löwen aus Juda.
[S. 199]Doch mag dem sein, wie ihm wolle. So viel ist sicher, daß die Jungfrau von ihrer Mission überzeugt war. Also um eine Schwindlerin handelt es sich keinesfalls. Denn sonst wäre es völlig unverständlich, daß sie sich den Gefahren einer Reise zu Wallenstein unterzog, um ihm, dem damals Allmächtigen, sehr unangenehme Dinge zu sagen. Wir werden später noch häufig auf Ähnliches stoßen, daß nämlich ein Seher, völlig überzeugt von seiner göttlichen Mission, ohne jegliche Rücksicht auf persönliche Nachteile und Gefahren den ihm seiner Überzeugung nach erteilten Auftrag ausführt.
Die Mission an Wallenstein ward der Poniatowssken am 25. Januar aufgetragen und zwar folgendermaßen:
»Am Tag Pauli Bekehrung, hatte ich abermahls ein Gesicht. Es kam zu mir der HErr selbst, bot mir die Hand und sprach: Die Krafft meiner Gegenwart sey mit dir: Ich wil, daß du einen Brieff schreibest, mit den Worten, welche du hören wirst: Wann du aber den wirst geschrieben haben, so leg ihn zusammen, versiegle ihn mit drey Siegeln, und trag ihn selbst hin nach Gitzschin, und ubergieb ihn dem rasenden Hund, dem von Wallenstein, wirst ihn aber nicht zu Hause finden, so übergieb ihn seinem Weibe, ihr selbsten, und ich wil verschaffen, daß er dem Bluthunde in seine eigne Hände zu kommen wird. Denn so war als ich lebe, spricht der HErr, meine Seele haz keinen Gefallen am Todte des Gottlosen, unnd seine Lust am Untergange der Unbußfertigen: Sondern das ist mein Wille, daß sich der Ruchlose von seinem bösen Wege bekehre und lebe. Darumb vermahne ich diesen Gottlosen [S. 200]Mann selbst, und stelle ihm die größe seiner Sünden vor Augen unnd seine Tyranney, damit er doch in sich gehen, sich entsetzen, unnd erkennen wolle, daß ich der HErr alle seine Wercke gesehen habe, und sie sehr wol kenne, unnd daß ich vergelten wil, einem jeden nach seinen Wercken, wie er gehandelt hat, wider umbkehren, seine Sünde für mich berewen, unnd sich also von dem Blut, welches er uberflüssig vergossen, reinigen, so wil ich die Gnadenthür noch für ihm öffnen, und seine Schuldt von ihm nehmen, wie groß die auch sey. Wird er sich aber nicht bedencken, sondern meine Warnung für Schimpff und Schertz halten, und sich hinfort nicht bekehren, siehe, so wil ich auch mein Hertz wieder ihn verkehren wie Eisen und Stahl, und mein Schwerdt wieder ihn wetzen, und meinen Bogen spannen, und zu seinem Hertzen zielen: Ich wil mir auch tödtlichen Geschoß zu richten, und damit in sein Hertz schießen, biss ich ihn umbbracht unnd ausgerottet habe. Dieses aber soltu wissen, daß, wo er nicht auf gewiese Zeit, die ich ihm noch bestimmt, sich bekehret, er schon wie ein Kalb zum ewigen Schlachten übergeben sey. Mein Aug sol sich nicht mehr erbarmen, es sol sich, sag ich, nicht erbarmen, jhn auch nicht mehr anschawen. Du aber thu also, wie ich dir befehle: Künftigen Freytag fahre hin gen Gitzschin, mit denen Personen, so ich darzu erkohren, welche du zu Zeugen haben wirst. Furchte dich aber für dem Tyrannen nicht, noch für andern, die dir zu schaden bekehren möchten: Denn sihe, ich bin bey dir: Wil auch meine Engel zum Schutz und Wache mit dir schicken, dieselben, welche du offt sihest, und sie kennest, ja [S. 201]auch der andern eine große Menge, die du noch nie gesehen: mit denen wil ich dich, wie mit einer fewrigen Mawer umbgeben, und du wirst sie auch mit deinen leiblichen Augen sehen. Wenn du aber hin kommst, sorge nicht, was du reden solt, denn ich werde bey und in dir seyn, und wird dir, kein Mensch etwas thun können, darumb, daß ich bey dir bin. Am Sambstage aber, wirstu den Brief erst ubergeben, und ein wenig daselbst verharren. Dennn (sic!) ich wil dir erscheinen, und die Hertzen derer, so dich sehen werden, bewegen und erschrecken.«
Die Jungfrau reiste tatsächlich nach Gitschin, traf Wallenstein nicht anwesend und wurde nach verschiedenen Schwierigkeiten von der Fürstin in Audienz empfangen.
»Als ich aber ein wenig da gesessen, ward ich entzückt, und der HErr erscheint mir und sprach: Wie sicher du hierher gekommen bist, also sicher wirstu auch von hinnen kommen. Sihe aber, ich werde mich allhie nicht lange seumen, denn diess gottloss Hauss ist meiner Gegenwart nicht werth: darumb so gehe auch du bald weg. Hiermit bot er mir die Hand, und schied von mir: Ich kam auch zu mir selbst, und sahe alle die Umstehenden, und die Fürstin selbst, erschrocken und weinend: gieng aber bald von dannen, und vermahnete die, so mit mir wahren, daß wir uns bald von dannen machten, wie auch geschehen. etc.«
Man mag von dieser Vision halten, was man will und wird sich gewiß nicht darüber wundern, daß Wallenstein darüber spottete, daß der Kaiser nur Briefe aus Rom, Konstantinopel, Madrid usw. [S. 202]erhielte, er selbst aber sogar aus dem Himmel[108]. Das ändert aber nichts an der merkwürdigen Tatsache, daß der oben gesperrt gedruckte Passus, der Wallensteins gewaltsamen Tod verkündet, als einziger auch im Original fett gedruckt ist und das fünf Jahre vor der Ermordung des großen Feldherrn in Eger. Mag sein, daß nur die ewige Verdammnis und nicht der leibliche Tod hier verkündet wird. Daß die Beteiligten es anders auffaßten, scheint aus den Tränen der Fürstin mit Sicherheit hervorzugehen.
Wir führten diesen stark gekürzten Visionsbericht nicht als Beweismaterial für die Existenz echter Prophetie an, sondern mehr als Beispiel für die verschwommene Art, in der in der Regel in der Vergangenheit geweissagt wurde. Aber auch zur Illustration unserer Behauptung, daß auch den phantastischsten Visionen ein wahrer Kern inne wohnen kann.
Von ganz anderem Werte und ganz anderer Beweiskraft ist der folgende Visionsbericht, obgleich auch er in symbolischem Gewande auftritt.
[103] Gottfried Arnold nennt in seiner »Kirchen- und Ketzer-Historie«, 3. Teil, Frankfurt a. M. 1700, S. 216, § 16, Überzeugte und Zweifler. Übrigens heißt die Ponitowssken bei ihm fälschlich Poniatovia oder Poniatowizsch.
[104] Zitiert nach »Göttliches Wunderbuch, darinnen auffgezeichnet und geschrieben stehen, 1. Himlische Offenbahrungen und Gesichte, einer gottfürchtigen Jungfrawen auss Böhmen, vom Zustand der Christlichen Kirchen, deren Erlösung, und schrecklichen Untergang ihrer Feinde usw.« (Stettin) 1629. Der Sammelband Nr. 5502, Weissagungen 2 der kgl. Bibliothek in Berlin enthält noch eine große Zahl von Prophezeiungen von 1613–1689.
Vom rationalistischen Standpunkte aus behandelt Adelung in seiner anonym erschienenen »Geschichte der menschlichen Narrheit«, Leipzig 1785 noch eine Reihe von Sehern, die er als Schwindler oder Narren hinstellt, darunter auch VI. Bd., S. 267 ff. die Poniatowssken, von ihm Poniatowa genannt. Er stützt sich auf Comenius, der an sie glaubt, als Zeugen und Gewährsmann ohne das Original der Visionen von 1629 zu kennen.
Außer den vielen Sehern bei Arnold und im obigen Sammelbande behandelt Adelung unter anderen noch aus dem 16. Jahrhundert Elisabeth Barton, I. Bd., S. 301, Johannes Cario, III. Bd., S. 118 ff., und Lucas Gauricus, II., S. 261 ff., die teilweise viel Falsches prophezeien. Besonders viel Unsinn produzierte Christoph Kotter, eb. VI., S. 231 ff. Ein interessanter Seher des beginnenden 18. Jahrhunderts ist Durand Fage, eb. III., S. 93 ff.
[105] Erschien ihr öfter.
[106] Die Seherin hatte eine Zeit lang Gehör und Sprache verloren. Die höchst uninteressante Unterredung geht noch eine Zeit lang so fort.
[107] Was hier gesperrt wurde, ist es auch im Original.
[108] Vgl. Arnold, l. c. p. 218.
[S. 203]
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts erregte ein Mann namens Christian Heering in Prossen bei Königstein (Sachsen) durch seine Visionen um so mehr Aufsehen, als sich bald herausstellte, daß sie in wunderbarer Weise eintrafen. Seinem Beichtvater Johann Gabriel Süße, der sich jahrelang mit dem Phänomen beschäftigte und seine Erfahrungen unter dem Titel »Umständliche Nachricht von dem sogenannten Prossner Manne, Christian Heerings, eines Elb-Fischers und Innwohners zu Prossen bey Königstein, seit etliche zwanzig Jahren bekannt gewordene Voraussagungen betreffend«[109] am 11. Juli [S. 204]1759 niederschrieb, im Jahre 1772 aber in Dresden und Leipzig erscheinen ließ, haben wir die zuverlässigen Nachrichten über den merkwürdigen Mann zu danken.
Betrachten wir zunächst an Hand des Buches (S. 8–15) die Persönlichkeit des Sehers. Er war aus Postelwitz bei Schandau an der Elbe unweit der Böhmischen Grenze am Rande der sogenannten Sächsischen Schweiz, um 1710 geboren als Sohn eines Fischers, der gleichfalls die Gabe des Hellsehens besaß. Von Jugend auf wurde er von seinem Vater auf der Elbe zur Ausübung des Fischergewerbes angehalten und blieb in Postelwitz, wo er von seinem Vater ein Haus und Garten erbte, bis zum Jahre 1746. Nun übersiedelte er nach Prossen, da seine Frau von ihrem Vater Hanns Schmidt, einem Häußler und Schiffer, dort ein Haus mit Garten geerbt hatte. Durch diesen Wohnungswechsel kam Heering als Beichtkind in die Obhut des Diakonen Johann Gabriel Süße, unseres Gewährsmannes.
Dieser stellt der religiösen und sittlichen Führung seines Beichtkindes, das er 13 Jahre unter Augen hatte, bevor er die »Umständliche Nachricht« schrieb, diese aber wiederum 12 Jahre zurückhielt, um die Wahrheit der Prophezeiungen prüfen zu [S. 205]können, mithin Heering 25 Jahre kannte, ein in jeder Beziehung glänzendes Zeugnis aus. Er war ein guter Hausvater, der seine Kinder zu allem Guten anleitete, ein fleißiger Kirchengänger und andächtiger Zuhörer der Predigt usw. Seine Bildung war mangelhaft. Denn da er schon als Kind dem Vater helfen mußte, beschränkten sich seine Schulkenntnisse auf fließendes Lesen und das Schreiben seines Namens.
»Von Weltlicher oder politischer Erkäntniss hat der Fischer Heering gar wenig erlangen können, indem ihm seine Berufs- und Lebensumstände, da er seine Zeit von Jugend auf Tag und Nacht mehrenteils auf dem Wasser zugebracht, auch sonst noch jetzo keine Gesellschaft liebt, niemals zugelassen, noch ihn auch sonst seine Neigung dahin angetrieben, weder Zeitungen, noch Geschichtsbücher zu lesen, oder Umgang mit belesenen und cultivirten Personen zu haben, von welchen er etwa von alten und neuen Staatssachen etwas hören oder lernen möge; sondern in Betracht einer politischen Einsicht kann man von dem Fischer Heering wenig oder nichts, jedoch sonst mit Wahrheit dieses sagen, daß er ein so genannter guter einfältiger Mann sey.«
Diese Charakteristik des Bildungsgrades ist von erhöhtem Interesse im Hinblick auf den Inhalt der Visionen. Wir machen sehr oft die Erfahrung, daß die Seher den unteren Ständen angehören und Visionen haben, deren Inhalt ihrem Interessenkreis fernliegt.
In seinem Benehmen zeichnete er sich durch Ehrerbietung und Gehorsam gegen Vorgesetzte und Obrigkeit, durch Verträglichkeit gegen die Nachbarn und Bescheidenheit und Dienstfertigkeit gegen jedermann [S. 206]aus. In seinem Fischhandel war er sehr billig, da er viel Glück im Fang hatte und glaubte, Gott verpflichte ihn durch den ihm zugehenden reichen Fischsegen zu Billigkeit. Er hatte bei mäßigem Vermögen und Zufriedenheit stets sein Auskommen gehabt und auch alle seine Kinder versorgt. In seinen alten Tagen zog er als Austrägler mit seiner Frau zu seiner ältesten verheirateten Tochter, der er sein Prossener Haus übergab, übte aber – unter andächtigem Gesang – immer noch sein Fischergewerbe aus. Wegen seiner redlichen Führung verwaltete er jahrelang das Amt eines Gerichtsschöppen.
Was nun endlich seine Konstitution betrifft, so war er bis zu seinem sechzigsten Lebensjahre kräftig und gesund, trotz der schwersten Arbeit, die er von Jugend auf bei Hitze und Frost verrichten mußte. Die einzigen Spuren dieser Tätigkeit waren ein etwas gebückter Gang und – eine Folge des schweren Ziehens – ein etwas verdickter Hals. Er hatte einen Sprachfehler und stockte in der Rede.
Sein Gesicht war aufrichtig, sein Wesen beständig freundlich, sein Temperament sanguinisch-cholerisch, »und wenn auch etwas vom Temperamento Melancholico bey ihm influiret, so hat man doch zu keiner Zeit das geringste Unordentliche, oder etwas Vitiös-Melancholisches in seiner Gesinnung, Thun und Lassen verspüret, immaßen er sonst auch bey der Prossner Gemeinde nicht als ein Gerichtsschöppe hätte mögen bestellet und gebrauchet werden können. Und wie er mit keiner Melancholie behaftet ist, so kann man in seinem Wandel weder ein herrschendes Laster überhaupt, noch insonderheit einen Ehrgeiz oder [S. 207]Hochmuth an ihm finden, indem er sich sowohl in seiner Kleidung sparsam und gering hält, als auch in seinen Worten, Werken, Thun und Lassen, im äußerlichen Bezeigen, alle Demuth und Niedrigkeit von sich an den Tag leget, und sich darneben mit geringer Kost begnüget.
So ist auch der Fischer am allerwenigsten ein Sonderling, oder einer falsch eingebildeten vorzüglichen Heiligkeit, eines schwärmerischen enthusiastischen Unwesens, noch irgend einem andern sektirischen Wesen zugetan, sondern hält sich in seiner Evangelischen Bekäntniss zur Lauterkeit in unserer Religion, und unter Göttlichen Beystande in der Thätigkeit des Glaubens zu denen Schranken, in welchen ein Christ suchen muß, sein Gewissen allenthalben zu bewahren, worbey er sich jedoch unausgesetzt als einen armen Sünder vor GOtt demüthig bekennt.«
Zum Schluß ruft Süße die ganze Gemeinde und alle die Heering kennen, zum Zeugen auf, daß er in keiner Weise bezüglich seiner Personalien übertrieben habe. Wir glauben das um so eher, als – von äußeren Gründen ganz abgesehen – der Bericht das Zeugnis innerer Wahrheit an der Stirne trägt.
Fassen wir die wichtigsten Momente aus der Charakteristik zusammen, so steht fest, daß es sich beim Prossener nicht um einen überspannten Schwärmer, sondern um einen an Körper und Seele gesunden, in Arbeit ergrauten, ehrlichen, fleißigen Bürger und Familienvater handelt, dessen soziales Niveau gleich dem seiner Bildung tief liegt[110].
[S. 208]Daß Heering die Gabe der Prophezeiung besaß, war bald im Volke bekannt. Während man ihm aber Visionen andichtete, die er nie gehabt hatte, hat sein Beichtvater Süße bereits seit dem Jahre 1756, als die Weissagungen ernsten Inhalt bekamen und schon mit Rücksicht auf den beginnenden Krieg bedenklicher wurden, den Mann gewissenhaft beobachtet und darüber einen Aufsatz verfaßt, in dem er Heerings Charakteristik und Vergangenheit skizzierte. Und zwar tat er das auf Veranlassung des Prossener hin, nicht aber umgekehrt. Damit fällt der Verdacht, Süße habe, um sich interessant zu machen oder aus anderen Gründen, Heering »entdeckt« oder habe ihn gar zu kirchlichen Propagandazwecken benutzt[111].
Zwar enthielt der erwähnte Aufsatz, die Art, in der die Visionen sich einstellten, angegeben, nichts aber von deren Inhalt, mit alleiniger Ausnahme der Voraussage einer damals noch nicht existierenden hohen Allianz.
Dieser Aufsatz war also lediglich zu privaten [S. 209]Zwecken verfaßt worden, um nämlich Süße als Grundlage für weitere Forschung an Heering zu dienen, ferner um Freunden, die sich bei ihm über den merkwürdigen Mann erkundigten, Auskunft erteilen zu können. Wiewohl also die Absicht der Publikation nicht bestand, hat ein Freund Süßes eine Abschrift ohne sein Wissen und Willen und ohne Revision, auch nicht vollständig, veröffentlicht, und zwar in zwei einzelnen halben Druckbogen. Dadurch sah sich Süße veranlaßt in Nr. XXXVIII der »Dresdner wöchentlichen Frag- und Anzeigen des politischen Blats« vom Jahre 1757 dagegen öffentlich Stellung zu nehmen.
Die Verwahrung, die für uns, wenn wir an Süßes Ehrenhaftigkeit zweifeln wollten, doppelt wertvoll ist, da sie beweist, wie frühzeitig schon die Öffentlichkeit sich mit dem interessanten Phänomen beschäftigte und wie viele Jahre lang Süße nachweisbar den Mann unter Augen hatte, lautet:
»Man siehet ohne beniemten Ort des Abdrucks im Druck: Zuverlässige Nachricht derer außerordentlichen Anzeigen und Voraussagungen Christian Heerings, eines Fischers zu Prossen bey Königstein, 1757[112].
Es ist dieses ein Aufsatz, mit welchem sich der Verfasser veranlasset gesehen, einestheils denen, über den Fischer Heering und seine neuerliche Anzeigen, [S. 210]bisher rouillirenden so mancherley Andichtungen, ungleichen Beurtheilen, und auch wohl einem unbilligen Verspotten, Einhalt zu thun; anderntheils verschiedenen Anfragen in einer zuverlässigen Nachricht eine Idee, oder einen wahren Begriff von dem Fischer Heering und seinen Anzeigen zu machen, wie auch die Schranken wohlmeynend anzuzeigen, wornach von dergleichen außerordentlichen Begebenheiten und Vorfällen, bewandten Umständen nach, ein christbilliges Urtheil zu fällen seyn möchte.
Es ist indessen dieser Aufsatz weder von dem Verfasser selbst, noch sonst mit seinem Wissen und Willen, dem Druck überlassen worden, da er, erwehntermaßen, solchen Aufsatz nur zu einer Privatnachricht für einige Anfragende, in und außer seiner Kirchfahrt, entworfen, und das Manuscript davon, oder eine Abschrift desselben, in den Druck zu geben nie gesonnen gewesen. Daher auch dem Verfasser, dem allerdings dieser eigenmächtig, und ohne vorher von ihm geschehene Revision seines Aufsatzes unternommene Druck, nicht anders als zuwider sein muß, keinen Antheil an solchem sub- und obreptitie zum Vorschein gekommenen Abdruck nimmt.
M. S.«
Trotz dieser Verwahrung erschien noch ein zweimaliger Abdruck der inkriminierten Schrift, d. h. der vorgenannten Halbbogen, in Sammlungen von Prophezeiungen. Den Titel dieser Schriften nennt Süße nicht. Sie hätten ja auch schließlich nur bibliographischen Wert. Endlich erschien ohne Angabe des Druckortes und anonym im Jahre 1758 ein Schriftchen mit dem Titel »Einige Prophezeiungen, [S. 211]welche von einem Fischer und Einwohner in einem Dorfe bey Königstein, auf die Jahre 1759 und 1760 gestellet sind«. Da Süße auch dieser Publikation fern stand, wir in ihnen also kein authentisches Dokument zu erblicken haben – ein Exemplar befindet sich auf der kgl. Bibliothek in London – ist sie für uns ohne Interesse.
Süße konstatiert sogar ausdrücklich (S. 5 f), daß bis auf einen Punkt, daß nämlich die Türkei sich in den Krieg mischen würde, keine einzige der genannten Prophezeiungen mit den authentischen des Fischers übereinstimme, daß ihm vielmehr vieles angedichtet worden sei, woran er nicht gedacht habe, und daß er sich deshalb ausdrücklich Süße und anderen gegenüber darüber beklagt habe.
Was nun zunächst die Zahl der Prophezeiungen betrifft, so war sie durchaus nicht so groß, wie Fernstehende meinten (S. 16). Sie traten schon in seiner Jugend auf, um sich später zu mehren.
Gehen wir nun auf den Inhalt der Visionen ein!
Die erste, von der wir Kenntnis haben, fällt in das Jahr 1744, als Heering ein Mann von etwa 34 Jahren war. Süße schreibt darüber (S. 16 f):
»So begegnete ihm im Jahre 1744 die Erscheinung, als er sich noch bey Tage bey Postelwitz zu Lande, am Ufer des Elbstroms, auf dem Wege nach Hause zu gehen befand, daß er eine Menge Menschen und den HErrn JEsum sahe, wie er seine Hand über die wenige Ihn begleitende Nachfolger Aufhub, worbey Heering das Lied, weil die mehresten Menschen den breiten Weg zur Verdammnis giengen, von einem derer Nachfolger JEsu anstimmen hörete:
[S. 212]
Welche Erscheinung mir der Fischer zu wiederholten malen mit innigster Gemüthsbewegung und vergossenen Thränen erzehlet hat.«
Begreiflicher Weise können wir mit dieser Vision oder Halluzination nicht das geringste anfangen. Sie hat für uns keinen anderen Wert als den festzustellen, daß der sonst nüchterne Mann zeitweilig religiösen Exaltationen unterworfen war. Das ist bei einer anscheinend sehr religiösen oder doch kirchlichen Natur nicht weiter verwunderlich.
Ganz anders liegt der Fall bei der zweiten Vision des Jahres 1744. Wenn auch sie religiösen Ursprungs war, insofern ihm das fünfte Kapitel des Propheten Jeremias, eine Klage über Unglauben und Ruchlosigkeit in allen Ständen, erschien, so ist der weitere Verlauf doch von höchstem Interesse. Es wurde ihm nämlich »vom HErrn gezeigt«. Daß ein Held mit seinem feindlichen Heer würde nach Sachsen kommen, und das Schwerdt bis an das Heft ins Blut tauchen, und dieser Held würde hernach zu Dresden wie in einem offenen Garten einziehen, aber bald darauf wieder zum Obern Thor hinaus ziehen.«
Hier haben wir die erste kontrollierbare Prophezeiung vor uns, interessant sowohl durch ihren dem einfachen Bildungsgrade des Fischers an sich fernliegenden politischen Inhalt, als nicht minder durch die begleitenden Nebenumstände.
[S. 213]Heering muß von dem bedeutungsvollen Inhalt der Vision aufs heftigste berührt worden sein, denn er begab sich nach Dresden, um von ihr hohen Orts persönlich Mitteilung zu machen. Er hielt sich in der Landeshauptstadt mehrere Wochen »in einem hohen Hause« auf und ließ sich hinsichtlich seiner Aufführung und Charakters prüfen, auch ob er dem Trunk ergeben oder geldgierig wäre. Gleichzeitig ließ er einen umständlichen Bericht von seiner Prophezeiung machen und war bemüht, ihn dem König einzuhändigen[113].
Aus der, wie gesagt nicht authentischen, »Zuverlässigen Nachricht« von 1756 erfahren wir Näheres. Heering »suchte seine damaligen Voraussagungen schriftlich in die Hände des Cabinets-Ministri, Grafen von Brühl Excellenz zu bringen, er ließ auch eine Zeit hernach, in eben diesem Jahre, um Johannis-Tag, einen Aufsatz an Ihro Majestät unserm allergnädigsten König selber richten, und übergab solchen Sr. Hochwürden, den Königl. Beichtvater, Herrn P. Ludovico Ligeritz S. J., welcher Herigen zwar anhörete, ihm aber antwortete, weil er sein Glaubens-Genoß nicht sey, so könne er sich mit der Sache nichts zu thun machen, er müsse sich an seinen Beicht-Vater wenden.
Der Herr Pater gab Herigen hierauf etliche Groschen Geld, welche Herig anzunehmen sich weigerte, und sagte, daß er Geldes wegen zu Sr. Hochwürden nicht gekommen wäre, doch dabey durch [S. 214]fernere Verweigerung dem Respect nicht entgegen handeln wolte.«
Mag der Bericht, dem wir diese Stelle entnehmen, auch apokryph sein, so haben wir doch um so weniger Grund an der Wahrheit zu zweifeln, als Graf Brühl, der allmächtige Premierminister, erst 1763 starb, und man es kaum gewagt haben würde, seinen Namen oder den des Beichtvaters Ligeritz zu mißbrauchen. Dasselbe gilt von dem weiter unten genannten Grafen Hennicke. Die Vermutung liegt nahe, daß Süße die Namen aus Gründen der Diskretion verschwieg. Im Kern stimmen übrigens die Berichte ja völlig überein, nur daß der anonyme eine Ergänzung liefert.
Diese Prophezeiung nun traf im vollen Umfange ein! Als Heering die Vision hatte, operierten die Preußen noch in Schlesien, niemand konnte etwas von ihrem Übergreifen auf Sachsen, geschweige denn dem Ausgang der Operationen sagen. Die Schlacht bei Kesselsdorf, in der Leopold von Dessau die Sachsen schlug, fand ja erst am 15. Dezember 1745 statt, Dresden wurde besetzt, doch schon am 25. Dezember daselbst der Friede zwischen Preußen, Sachsen und Österreich geschlossen. Berücksichtigt man noch, daß es Preußen im Jahre 1744, als Heering die Vision hatte, militärisch sehr übel ging, so erscheint das Eintreffen der Prophezeiung noch merkwürdiger.
Das muß auch – nach der »Zuverlässigen Nachricht« – Graf von Hennicke gefühlt haben, denn er ließ nach der Schlacht bei Kesselsdorf den Fischer zu sich kommen »und sich von im mündlich anzeigen, [S. 215]was Herigen fast 2 Jahr vor der Kesselsdorffer Bataille (wie Herig zu reden pfleget) vom HErrn gezeiget, und anzuzeigen befohlen worden, bey welchem Verhör aber Herig, wie er erzehlet, abermals wenig Glauben gefunden, sondern weil er unter seinen Anführungen unter andern anzeigete, daß er auch bey dem ihm angezeigeten Sachsenlande bevorstehenden Ungewitter das fünfte Capitel des Propheten Jeremiä aufgeschlagen, wäre er von vorerwehnten hohen Minister mit dem Bescheide dimittiret worden, daß Herig verschiedenes aus der Bibel nehme, und solches auf künftig geschehen sollende Dinge, und auf sich applicire.« Heering ist seitdem viele Jahre lang seiner Vorahnungen wegen nicht wieder nach Dresden gekommen.
Die rationalistische Erklärung des Grafen Hennicke ist zweifellos die nächstliegende. Wir würden sie uns auch ohne weiteres zu eigen machen und den Fischer als Eideshelfer für die bei einigen Personen bestehende Prophetengabe nicht nennen, wenn dem nicht die gewichtigsten Bedenken entgegenstehen würden.
Zunächst ist es auffällig, daß – selbst angenommen, er habe biblische Verhältnisse auf seine Zeit übertragen – diese Übertragung durch die Tatsachen bestätigt wurde. Denn statt von Sachsen, Dresden, dem Oberen Tor und der kurzen Frist des Abzuges, hätte er auch von ganz anderen Parteien und Lokalitäten reden können. Immerhin ist die Möglichkeit, es handle sich hier lediglich um Zufall, nicht völlig von der Hand zu weisen. Stutzig macht allerdings die in den »Zuverlässigen Nachrichten« mitgeteilte [S. 216]Äußerung des Generals Bose, Kommandierenden in Dresden, der König Friedrich antwortete: »Aus einem Lustgarten könne er sich nicht wehren«. Die Übereinstimmung dieser Worte bei Übergabe der Stadt mit den in der Vision gebrauchten, das Heer würde in Dresden »wie in einen offenen Garten einziehen«, ist auf alle Fälle erstaunlich.
Doch der Deutung auf Zufall bei Zugrundelegung dieses einzigen Falles steht noch ein anderes sehr gewichtiges Bedenken entgegen: Heering war es unbenommen, aus der Bibel nach Herzenslust zu prophezeien. Warum tut er es nur in diesem konkreten Falle? Warum ist er vor allem so sehr von der Richtigkeit des Geschauten überzeugt, daß er die langwierige und kostspielige Reise nach Dresden unternimmt und dabei zum mindesten Gefahr läuft als Phantast verspottet zu werden?
Mir persönlich scheint es sich hier tatsächlich um eine Vision zu handeln, die Heering vielleicht nachträglich – seinem Bildungsgrade und Ideenkreis entsprechend – biblisch verbrämte.
Doch unterlassen wir es, Erklärungsversuche zu machen, bevor die Tatsachen einwandfrei feststehen.
Die Vermutung, daß es sich hier tatsächlich um eine Vision handelt, wird zur Gewißheit erhoben durch die nachfolgenden Prophezeiungen desselben Mannes. Er fuhr nicht etwa fort, Biblisches auf seine Zeit zu übertragen – was bei dem Erfolge der ersten Prophezeiung das Nächstliegende gewesen wäre –, sondern er hat im Gegenteil mehr als ein volles Jahrzehnt überhaupt nichts mehr geweissagt.
[S. 217]Erst Mitte März 1756 stellte sich die erste Vision wieder ein und damals war es auch, daß er erstmalig, und zwar aus freien Stücken, zu seinem Beichtvater Süße kam. Das zweitemal suchte er Süße am Karfreitag des gleichen Jahres auf, zum drittenmal aber Ende Juli 1756, »bey welchem seinen dreymaligen Anbringen er einmal wie das andremal mit innigster Gemüthsbewegung, ja mit Jammern und mit Thränen anzeigete, wie er sein mir bereits etlichemal eröffnetes Anbringen nicht weiter mehr zu verbergen wüßte, er fände sich Tag und Nacht getrieben, es dem Allergnädigsten Landesvater anzuzeigen. Das Unglück wäre nahe und nicht weit mehr entfernet.«
Wiewohl nun Süße fürchtete, daß Heering kein Gehör finden würde, da er, wie bei seinem Bildungsgrade ja natürlich, keinen ordentlichen Vortrag halten konnte und überdies mit einem Sprachfehler behaftet war, konnte er ihm doch das verlangte Führungsattest nicht vorenthalten. Es war datiert vom 2. August 1756[114]. Gleichzeitig verschaffte Heering sich ein Attest von seinem ehemaligen Beichtvater M. Clauß, Pfarrer in Schandau.
Ausgestattet mit beiden Dokumenten ging er gleich nach Dresden, wurde von einem Minister gnädig aufgenommen, brachte seine Prophezeiung vor und ging dann »ruhig und freudig, sich seines Anliegens entledigt zu haben« wieder heim.
[S. 218]Auch der größte Skeptiker wird zugeben, daß es sich hier nicht um einen Schwindler handelt, sondern um einen Mann, der zweifellos persönlich von der Wahrheit und Wichtigkeit seiner Visionen überzeugt ist. Stellt sich nun heraus, daß diese auch objektiv zutreffen – und zwar nicht etwa nur in einem einzelnen Fall, sondern wiederholt und in mehreren Punkten, so daß der Zufall auszuscheiden scheint –, dann steht nichts im Wege, Heering unter die Zahl der mit Prophetie ausgestatteten Personen einzureihen.
Vorausgeschickt sei, daß nach Süße (S. 20) seine Visionen nicht »Glaubens – oder die H. Göttliche Offenbarung der Bibel angehende Sachen, sondern lediglich Dinge und Vorfälle sind, welche die bevorstehende Schicksale des Weltlichen Regiments, der Policey und Kirche vornämlich anbelangen.« Das bestärkt unsere Vermutung, daß es sich nur um unbewußte religiöse Einkleidung handelt.
Gehen wir nun auf den Inhalt der Prophezeiungen des Jahres 1756 ein!
Süße schreibt darüber (S. 20 f.): »Der HErr habe ihn sehen lassen, daß nächstens ein großes Ungewitter entstehen würde, durch welches unser Sächsisches Vaterland mit Krieg überzogen werde, und solches unsere hiesige Elbgegend zuerst betreffen würde. Hierbey würde es hart zugehen; Und dieses Ungewitter wäre sehr nahe, so, daß Ihro Königl. Majestät, unser Allergnädigster Landesvater, an Dero Reise nach Dero Königreichen würden gehindert werden, Höchst-Dieselben würden nicht von [S. 219]Dero Volke gehen[115]. Es würde aber das Ungewitter mit seiner Heftigkeit in unserer Gegend nicht von langer Dauer seyn[116], sondern es würde sich noch weiter ziehen und viel Blut vergossen werden. Besonders würde dieses Ungewitter in unsserm Vaterlande auch daher viel Elend nach sich ziehen, weil die junge Mannschaft würde viel leiden müssen. Er hätte auch Brandstätte gesehen, und er wäre sogar auf selbigen herumgeführet worden. So sei ihm auch ein Acker gezeiget worden, welcher als ein bisher unfruchtbar gelegner Acker hätte müssen umgerissen und von neuem geflüget und besäet werden, und dis darum, weil der Acker theils gar unfruchtbar und verwildert gelegen, theils Gerste darauf gesäet worden. Gerste bringe aber ein herbes Brot.
Ferner zeigte der Fischer mit an: Wie ihm [S. 220]auch zwo Kirchen gezeiget worden wären, eine in der Stadt, die andere außer der Stadt, in welchen man aber dem HErrn nur das halbe Herz gegeben habe; der Herr hätte aber gesprochen: Ich will das ganze Herz haben, das ganze Herz will ich haben, und das will ich mit dem Finger des Heil. Geistes rühren[117].
Noch ferner führete der Fischer an: Daß sich Dresden ihm in den Prospekt eines Gartens gezeiget hätte, aus welchem Garten die stärksten Bäume wären mit den Wurzeln herausgerissen, und vom Lande hinweggeführet worden[118]. So habe er auch gesehen, daß der alte Grundstein wäre herausgerissen, und ein neuer gelegt, auch die Kirche außer der Stadt geschlossen worden.
Der angegebene Hauptzweck von allen diesen Anzeigen war endlich dieser, daß der Fischer Heering sagte, daß ihm der Herr befohlen hätte, dem Allergnädigsten Landesvater es anzuzeigen, daß um [S. 221]des herannahenden Ungewitters willen, möchte ernstlich im Lande Buße geprediget, und die Verbindung mit Süd-Ost und Süd-West möchte verlassen werden, so wolle Gott dem Hause Sachsen wohlthun.
Fragte ich den Fischer Heering, woher dieses von ihm beniemte herannahende Ungewitter entstehen sollte; so antwortete er mir folgendergestalt: Es würde sich Süd-Ost und Süd-West mit einander wider Nord-West verbinden, Süd-West wäre gedemüthiget worden, wie Vier Helden neben einander gegen Süd-Ost und Süd-West stünden, welche vier Helden so lange hinter und neben einander stehen würden, bis Süd-Ost und Süd-West von einander abließen. Er setzte hinzu: Es wäre ihm endlich gezeiget worden, daß der aus Morgen, welcher ihm mit dem Namen wäre genennet worden, daß es der Türke sey[119], herangezogen wäre, worauf sich der Krieg seitwärts gegen Norden gezogen hätte.«
[S. 222]Auf diese ziemlich unklaren Äußerungen hin fragte Süße sein Beichtkind, was er denn unter den Himmelsrichtungen verstehe. Er erfuhr dabei, daß Heering die Potentaten nach der Lage ihrer Länder bezeichne, daß also Süd-Osten die Kaiserin Maria Theresia sei, Süd-Westen aber König Ludwig XV. von Frankreich und daß er eine zwischen beiden Mächten sich vollziehende Alliance vorhersehe. Das war um so merkwürdiger, als das Publikum – und demnach auch der Fischer – von diesen hohen Bündnissen nichts ahnte und auch tatsächlich ein Vertrag zwischen Wien und Versailles noch gar nicht geschlossen war.
Unter Nord-Westen verstand Heeringen den König Friedrich den Großen von Preußen. Wer aber die drei Helden wären, »welche mit des Königs von Preußen Majestät zusammen vier Helden neben einander stehend, ausmacheten, konnte er mir damals so wenig, als noch jetzo anzeigen. Es müßten also vermutlich die Preußischen Alliierten seyn, worüber sich aber Heering, etwa wegen Mangel der Erkenntnis derer Geschichte und derer Staaten, eigentlich aber, wie er ausdrücklich sagt: weils ihm nicht weiter gezeigt worden wäre, nicht deutlicher zu erklären wußte[120]. Der Fischer setzte dieser seiner Anzeige nur noch dieses hinzu, die vier Helden wären jetzo noch nicht beysammen, sie würden aber schon noch erscheinen, und da werde der Held aus Nord-Westen, der König in Preußen, wenn er ziemlich ins Enge getrieben, und matt geworden sey, neue Kräfte bekommen; [S. 223]diese Hilfsvölker des einen zu des Königs in Preußen getretenen Helden, wären grün gekleidet gewesen. Hierauf wären die vier Helden standhaft bey einander gestanden, und wären nicht gewichen, bis ein neuer Grundstein wäre geleget worden[121].«
Süße ließ darauf die Prophezeiungen auf sich beruhen und ermahnte den Fischer zur Ruhe, ja er dachte gar nicht weiter an Heering und seine seit etwa dem 15. März 1756 und dann noch einige Male dem Geistlichen erzählten Visionen. Da fand er auf einmal in Nummer 61 der Erlanger Zeitung vom 22. Juni des Jahres die Bekanntgabe des »Unions-Freundschafts-Defensiv-Traktats« zwischen Maria Theresia und Ludwig XV. Und zwar war er am 1. Mai 1756 zu Versailles geschlossen worden, also tatsächlich etwa sieben Wochen später, als der Fischer die Vision gehabt hatte. Die Erlanger Zeitung aber fing jetzt erst an ihre Stellungnahme dem Vertrag gegenüber zu ändern, hatte sie sich doch noch in ihrer Nummer 51 vom 15. Mai des Jahres in dem Artikel »von allgemeinen Staatshändeln« ablehnend verhalten.
Damals hatte sie nämlich (S. 393) geschrieben, man hätte verschiedentlich in den Zeitungen einen rätselhaften Artikel gelesen, nach dem zwischen zwei der vornehmsten Höfe wichtige Verhandlungen im [S. 224]Gange wären. Diese Höfe, so sei leicht zu raten, sei der österreichische und französische. Sie brachte dann aus der Leydener Zeitung zwei Artikel mit der Mitteilung, zwischen Wien und Versailles bestehe die Absicht ein Bündnis zu schließen, ja es sei bereits geschlossen. Das war also am 15. Mai!
Daß vorher der Fischer nicht die allergeringste Ahnung von den Vorgängen der hohen Politik haben konnte, liegt auf der Hand. Aber selbst die Vermutung, er habe sich – was nach Lebensstellung und Bildungsgrade völlig ausgeschlossen ist – mit politischem Instinkt begabt, zum Sprachrohr der öffentlichen Meinung machen wollen, schießt völlig daneben.
Wie die öffentliche Meinung noch zwei Monate nach seiner Vision den Bündnisfall beurteilte, geht deutlich aus der Erlanger Zeitung vom 15. Mai hervor. Sie fährt fort: »Diesen beyden Artickeln öffentlich zu widersprechen, sehn wir uns sowohl aus natürlichem Trieb, als Pflicht halber, verbunden.
. . . . Wie gesagt, es streiten diese Gerüchte sowohl wider die Vernunft als die Erfahrung . . .
Es ist offenbar, daß dergleichen wunderliche Gerüchte bloß von gall- und milz- und hirnsüchtigen Gemüthern, die ihren Mäusekoth auch gern für politischen Pfeffer verkaufen wollen, herrühren, und ob sie wohl nicht ungeahndet bleiben werden, dennoch nicht die geringste Attention des Publici verdienen.« Auf S. 481 der Nr. 61 revoziert die Zeitung natürlich alles. Das war also schon damals so!
Daraus geht zur Evidenz hervor, daß wir es bei der Vorhersehung des Bündnisses [S. 225]zwischen Österreich und Frankreich mit einer richtigen Prophezeiung zu tun haben. Denn 1. lag das Geschaute völlig außerhalb des Interessen- oder Wissensbereichs des Fischers. 2. Wußte er von dem Vertrage schon geraume Zeit, bevor er überhaupt abgeschlossen war. Ja, noch nach seiner Unterzeichnung hielt die öffentliche Meinung ihn für eine Unmöglichkeit. Damit fällt aber die Vermutung, Heering habe kombiniert, in sich zusammen. Wie bei der Voransage des Jahres 1744 handelt es sich also auch hier um eine richtige Vision.
Das war auch Süße sofort klar und gerade dem Umstande, daß sich unter seinen Augen ein solches auffallendes Phänomen abgespielt hatte, ist es zuzuschreiben, daß er Heering hinfort erhöhte Aufmerksamkeit schenkte.
Merkwürdig ist übrigens, daß nicht nur Heering sich bei der Prophezeiung des Bildes eines Unwetters bediente bzw. daß ein solches ihm erschien, sondern daß auch die Erlanger Zeitung in ihrer Nummer 75 vom 10. August 1756 (S. 393) – wie Süße feststellt – die gleiche Metapher gebraucht.
Nachdem sie von den täglich bedenklicher werdenden Zeichen der Zeit gesprochen, fährt sie fort: ». . . Alles, was uns zu sagen erlaubt seyn mag, besteht darinnen, daß, wenn bey schwülen Tagen heftige trübe Wolken aufsteigen, und selbige sich thürmen, anzünden und zusammenstoßen, gemeiniglich Blitz, Donner, Hagel und andere schwere Wetterschäden darauf zu folgen pflegen . . . Wolken ziehen auf (geharnischte Wolken), das sehen wir vor Augen. Ob sie sich aber thürmen, zusammenstoßen, blitzen und donnern werden, steht zu erwarten.«
[S. 226]Süße macht dazu die Anmerkung (S. 29), daß das Zusammenstoßen, Blitzen und Donnern, das der Zeitung im August noch ungewiß erschienen war, bereits im Oktober des gleichen Jahres 1756 eintraf. Denn am 1. Oktober hörte man in der Prossner Gegend den Schlachtendonner von Lobositz und als am 12. Oktober das Lager der Sachsen aufbrach, ging es auch nicht ohne Blitzen und Donnern ab. Tatsächlich hatte Heering den Ausbruch des Siebenjährigen Krieges sechs und einen halben Monat früher unter dem Bilde eines Unwetters gesehen und prophezeit.
Es ist dies also die zweite Vision des Jahres 1756, die in Erfüllung ging.
Es liegt auf der Hand, daß die verblüffende Übereinstimmung der Aussagen des ungelehrten Fischers mit den sich später einstellenden hochpolitischen Ereignissen im Lande bekannt wurde. Als daher um die Mitte des August die Sachsen auf dem Marsche gegen Pirna bei Schandau eine Schiffbrücke schlugen, sondierte man Heeringen, der sich damals gerade dort aufhielt, was er von der Brücke hielte.
»Worauf er, ob er schon merkte, daß man ihn mehr spöttisch aufziehen, als im Ernst befragen wollte, diese Antwort gab: Daß diese Brücke hier nicht viel nütze seyn, und nicht gebraucht werden würde, aber Leipzig möchte man wohl verwahren, da habe er fremde Völker ankommen sehen.« (S. 31.)
Damals wußte man weder, daß die Schiffbrücke unnütz sei – denn sonst hätte man sie ja nicht geschlagen – noch auch vermutete man den am [S. 227]29. August erfolgten Einzug der Preußen in Leipzig, der den Hof zur Flucht zwang.
Dies war also die dritte richtige Prophezeiung Heerings im gleichen Jahre, und zwar ging sie diesmal bereits nach 14 Tagen in Erfüllung.
Im Oktober 1757 aber kamen auch fremde Kontingente bestehend aus der kombinierten Reichs- und der französischen Auxiliararmee, nach Leipzig, so daß auch diese Prophezeiung, wenn auch nicht sofort, so doch nach einiger Zeit eintraf.
Endlich prophezeite Heering Süße und anderen einen Rückzug an, der während die sächsischen Truppen zwischen Pirna und Königstein lagerten, vom Hauptlager Struppen aus über Markersbach versucht, aber durch den preußischen Kordon verhindert wurde. Das geschah einige Wochen vor der Ausführung.
Bedeutungsvoller war eine weitere Vision des Fischers neun Tage vor der Schlacht bei Roßbach am 5. November 1757. »Nach seinem gewöhnlichen Trieb, wie sonst, ohne das geringste Veranlassen und dessein,« kam er zu Süße und zeigte ihm an, daß wieder etwas Wichtiges bevorstehe, »worbei er ebenfalls, wie sonst ängstlich wünschte, daß er solches Hohen Orts möchte eröffnen können. Er sagte indessen so viel hiervon:
Man möchte Gott ernstlich anrufen, daß das vorseyende Unternehmen möchte können abgewendet werden, indem es in der Schärfe nicht gut hinaus gehen würde. Es zögen nämlich zwey Heere in unserm Lande gegen einander, ein großes und ein kleines, von welchen er gesehen, daß das letztere gesieget [S. 228]hätte, und das große wäre ganz zerstreuet worden.« (S. 32.)
Als diese Prophezeiung wider Erwarten in Erfüllung ging, kam Heering zu Süße und erinnerte ihn, ob er auch an seine Vorhersage gedacht hätte.
Also wieder eine erfüllte Vision!
Am meisten Aufmerksamkeit erregte der Fischer mit zwei Prophezeiungen des Jahres 1758 sowohl bei den Landeseinwohnern, als auch bei den beiden sich in der Königsteiner Gegend gegenüber stehenden Armeen.
»Er zeigete nämlich fast ein Vierteljahr vorher, ehe und bevor in der Mitte des Augusts erwehnten 1758sten Jahres die Annäherung der Kayserlichen und Reichsarmee in unserer Elbgegend geschahe, an glaubwürdige noch lebende und es allezeit geständige Personen des Schandauer Kirchspiels an, wie er gesehen hätte, daß auf dem Schandauer so genannten Kirchstück am Elbufer wäre geschanzt, und gegen das sogenannte Krippner Horn über, eine Schiffsbrücke geschlagen worden, über welche er fremde Völker hätte sehen übergehen.«
Diese Vision ging in der Zeit vom 14. zum 19. August in Erfüllung!
Tatsächlich wurde von fremden Kriegsvölkern am angegebenen Orte eine Schiffsbrücke geschlagen, sowohl bei Krippen, als auch am andern Elbufer zwischen Postelwitz und Schandau. Auf dem vorgezeichneten Schandauer Kirchstück, wurde ein Brückenkopf gebaut und Schanzen, die nebst den Bäckereigebäuden [S. 229]der kaiserlichen Regimenter und der Reichsarmee noch in späteren Jahren zu sehen waren. Die Brücke aber passierten die Truppen des Lagers, das im August 1758 auf der Höhe der Rathmansdorfer Felder neben Schandau errichtet wurde.
Die zweite Prophezeiung dieses Jahres erregte noch größeres Aufsehen. Heering erzählte seinem Beichtvater und einigen Bekannten bei Annäherung der kaiserlichen und der Reichsarmee folgendes:
»Die Zeit ist nun da, wen das Schwert trift, den wirds treffen. Über der Elbe (d. h. auf dem Königstein gegenüberliegenden Ufer) wird sich vornehmlich noch ein größeres Heer zusammenziehen, bey selbigen wird es blutig zugehen, und es wird auch endlich noch herüber über die Elbe kommen müssen.« (S. 53 f.)
Diese Vision ging in Erfüllung, als die große Daunsche Armee eintraf, von deren Herannahen in der Königsteiner Gegend noch niemand etwas Näheres wußte oder wissen konnte.
Der Prophezeiung fügte Heering die Worte hinzu:
»Der Herr zeigete mir endlich, daß das heranziehende Reichsheer sich wiederum über die Berge nach Böhmen zurückzog. Ich sahe recht eigentlich die Maulthiere nach einander hinüberziehen, und jenes Heer (das preußische) zog hernach, da erst alles vollbracht war, auch in Frieden aus Sachsen.«
Die Erfüllung dieser Prophezeiung war damals ganz unwahrscheinlich mit Rücksicht auf die gegen Dresden im Vormarsch befindliche große Heeresmacht und die überall getroffenen festen Dispositionen. [S. 230]Als trotzdem die Vision sich nach drei Monaten bewahrheitete, war jedermann verwundert und viele Standespersonen, besonders ein damals in Pirna bei der kaiserlichen Armee liegender Fürst, trugen Verlangen den Fischer vor ihrem Abmarsch zu sehen und zu sprechen. Da er so Gelegenheit hatte, seine Prophezeiungen hohen Orts vorzubringen, war er befriedigt und hielt sich – auch auf den wiederholten Rat Süßes hin – ruhig. Er sah damals nur noch, daß es jenseits der Elbe und im Norden von Sachsen am schlimmsten zugehen würde und daß jenseits Neustadt bei Dresden »ein Balgen« sein würde, sowie daß endlich eine solche Heeresmacht in Sachsen sich versammeln würde, daß das Land wie eine Tenne zertreten würde und die Hufeisenspuren auf der Erde unzählig seien. Im übrigen bat und flehte er nur noch, daß das Werk der Buße und Besserung unter den Menschen noch mehr zunehmen möchte. Hierbei bezog er sich weinend auf Christi Bußgleichnis (Luc. 13).
Die Vision läßt sich ungezwungen auf die Schlacht bei Kunnersdorf 1760 deuten, sowie auf das Eintreffen der Österreicher bei Dresden-Neustadt, die vergebliche Belagerung Dresdens durch Friedrich II. und den berühmten Finkenfang bei Maxen, alles im Jahre 1760.
Sollte jemand an der Wahrhaftigkeit Süßes zweifeln, was mir nach dem ganzen Tenor des Berichtes ausgeschlossen scheint, so mag er sich daran halten, daß die Prophezeiungen auch in außerkirchlichen Kreisen Aufsehen erregten.
[109] Der Titel geht noch fort: »benebst einer Historisch-Theologischen Abhandlung der Casual-Frage: Ob es noch heut zu Tage neue Offenbarungen von wichtigen Revolutionen in der Kirche, im Staat, und von besonderen Schicksalen einzelner Personen gebe, und was von selbigen zu halten sey? Auf Veranlassen des dieserhalben längst begierig gewesenen Publici entworfen, und zusammt Johannis Charliers, sonst Gerson genannt, Tractat: von der Prüfung derer Geister, allhier ins Teutsche übersetzt und mit Anmerkungen erläutert, dem Druck überlassen von M. Johann Gabriel Süßen, Pfarrern zu Königstein, und der Societät Christl. Liebe und der Wissenschaften zu Dresden Mitglied.« Der Bericht von 1759 wurde bis 1771 von Süße zurückgehalten, um, wie er im »Vorbericht« sagt, das Eintreffen von weiteren Prophezeiungen abzuwarten. Der Bericht erschien unverändert in der Fassung von 1759, nur in einigen Anmerkungen nimmt der Verfasser auf Späteres Bezug.
[110] Ich lege Gewicht auf die Feststellung, daß Heering kein Hysteriker war, wiewohl das ja selbstredend auch nur ein Name ist, der nicht das allergeringste zur Aufklärung des Phänomens beiträgt, aus folgendem Grunde. Im »Türmer« 1910, S. 842, hatte ich u. a. auch auf die unbedingt feststehende, aber z. Z. noch unerklärte Tatsache der Stigmatisation des heil. Franz von Assisi hingewiesen. Dagegen erschien ein Aufsatz eines Dr. Karl Oetker in der Züricher Zeitschrift »Wissen und Leben«, (S. 358–372) indem er (S. 366) folgende goldene Worte schreibt. »Daß der heilige Franz von Assisi einer der interessantesten Hysteriker war, die je gelebt haben, das wußte man längst . . . doch was ist da schließlich Besonderes daran? Einer muß doch der größte sein.« So erklärt die moderne Wissenschaft!!
[111] »Umständliche Nachricht«, S. 1 ff. Auch ein Exemplar der weiter unten genannten »Zuverlässigen Nachricht« liegt mir vor.
[112] In Süßes Werk ist der Name Heering in der »Zuverlässigen Nachricht« aber Herig geschrieben. Süße zitiert hier also unkorrekt. Zugleich lehrt dieses Beispiel, wie lange man die mittelalterliche Gleichgültigkeit gegen Namensformen beibehielt.
[113] Eine Anfrage beim Staatsarchiv in Dresden führte zu keinem Resultat. Danach scheint das Original des Berichtes in Verlust geraten zu sein.
[114] Abgedruckt in »Zuverlässige Nachricht«, S. 11. Der Zweifler möge daraus ersehen, daß wenigstens die in der »Umständlichen Nachricht« berichteten Nebenumstände richtig sind. Denn die »Zuverlässige Nachricht« erschien ja bereits 1756 im Druck.
[115] Diese Prophezeiung ging insofern in Erfüllung, als Friedrich August II. am 10. September ins Lager bei Pirna ging, dann, als die Armee kapitulierte, auf den Königstein flüchtete. Später begab er sich allerdings nach Warschau und kehrte erst nach dem Friedensschluß wieder nach Sachsen zurück. Daß die junge Mannschaft viel leiden mußte, erfüllte sich ganz, denn Friedrich der Große stellte die gefangenen Sachsen in sein eigenes Heer ein und zwang sie, so gegen ihr Vaterland zu fechten.
[116] Zu dieser Stelle bringt Süße die Anmerkung: »Die erste Heftigkeit des unsere Gegend betroffenen Kriegs müßten etwa 7 bis 8 Wochen seyn, da gleich zu Anfang des Krieges 1756 vom Anfang des Septembr. bis zur Mitte des Octbr. die Preußische Armee einen Cordon um unsere Elbgegend des Sächsischen Lagers gezogen, und solche auf drey Meilen lang und zwey Meilen breit eingeschlossen hatten.«
[117] Die zwei Kirchen sind zweifellos eine symbolische Anspielung auf die beiden Konfessionen, da bekanntlich das sächsische Fürstenhaus (die Kirche in der Stadt) katholisch war, das Volk aber protestantisch. Die Vision fordert augenscheinlich Freiheit des Glaubens.
[118] Anm. S. 22: »Dieser Bäume wegen meynete man, als der Fischer Veranlassung und Erlaubnis bekam, seine Anzeigen vor Hohen Personen zu eröffnen, er hätte damit seine Rücksicht auf die Worte der Johannitischen Bußpredigt, Matth. III, 10. Daher der Fischer befraget wurde, ob die Bäume abgehauen, und ins Feuer geworfen worden wären? Worauf er geantwortet: Die Bäume wären ausgerissen, und vom Lande weggeführet worden. Wovon man sonst einen Parallelausdruck findet, 1. Buch der Könige XIV. v. 15.« Vielleicht ist es eine symbolische Andeutung auf die Flucht der Vornehmen.
[119] Anm. zu S. 23: »Als Referent und Concipient dieses Vorberichts, unter den 4ten März 1758 aus einer ausländischen Residenz, durch den Secretair der Gemahlin eines vornehmen Ministers, vermittelst eines Briefes, sondiret wurde, was denn, bey denen damaligen Kriegstroublen, der Proßner Fischer (welches ehrlichen Mannes vormals entdeckte Gedanken gar nicht zu verwerfen gewesen, sondern in billige Erwegung zu ziehen wären) noch gegenwärtig äußere, und ich derhalben den Fischer auf sein Gewissen fragte, blieb er beharrlich bey seinen bisherigen Anzeigen, und bat mit Thränen, den endlichen ihm gezeigten Heranzug des Türken, besonders und ausdrücklich mit zu melden.«
[120] Es werden wohl außer Friedrich dem Großen, dessen Bruder Heinrich, und der Herzog von Braunschweig gemeint sein. Vielleicht ist der vierte Zar Peter III.
[121] Der »neue Grundstein« ist zweifellos der russische Regierungswechsel, als auf den Freund Friedrichs, den Zaren Peter III., die preußenfeindliche Katharina II. folgte. Mit den Hilfsvölkern sind russische gemeint. Heering verwechselt überhaupt die Russen mit den Türken.
[S. 231]
Was nun die Art und Weise betrifft, in der sich bei Heering die Prophezeiungen einstellten, so gibt auch darüber Süße (S. 36 ff.) ausführlichen Bericht.
Er hatte seine Vorahnungen oder Visionen keineswegs im Schlaf, vielmehr sah er im Wachen »Gestalten, Vorbildungen und Prospekte«, hörte Stimmen oder verspürte in sich immerwährende »Anregungen, worbei er allemal eine Freudigkeit, es bald anzuzeigen, verspüret«.
So sah er bei der ersten Erscheinung des Jahres 1744 Gestalten, es war also eine richtige Vision. Die Vorahnung der Schlacht bei Kesselsdorf stellte sich als »Vorbildung« ein, wobei ihm das fünfte Kapitel Jeremiä aufgeschlagen wurde. (Wie man sich das zu denken hat, sagt Süße nicht. Ich kann mir daraus keinen Vers machen.)
Den Ein- und Auszug der Preußen in Dresden im Jahre 1745 sah er in einem »Prospekt«, also gleichfalls als Vision, ebenso den unfruchtbar liegenden Acker und das Unwetter des Jahres 1756, die sich gegenüberstehenden Mächte, das 1757 gegen die Preußen stehende Reichsheer im gleichen Jahre und [S. 232]endlich das Reichsheer im Jahre 1758 drei Monate vorher im Rückzuge auf Böhmen.
Als er Jesus und die beiden Kirchen sah, hörte er die Stimme Christi wieder. Hatte er eine solche Vision oder Eingebung gehabt, dann drängte es ihn, sie hohen Orts zu melden.
In einer Anmerkung (S. 38) des, wie bereits eingangs erwähnt, unveränderten Abdrucks von Heerings vom 11. Juli 1759 datiertem Bericht erwähnt er, daß er dem kranken Heering am 24. November 1760 das Abendmahl gereicht habe. Hierbei erzählte er, daß er »etwa vor drey Wochen, eine Versammlung gesehen, welche von einem, der das Handwerkszeug eines Maurers, besonders eine Maurerkelle, in der Hand gehabt, wäre angeführet worden, von welcher Versammlung er den Gesang: Allein GOtt in der Höh sey Ehr etc. hätte anstimmen und singen hören, und ohnerachtet sich immer noch mehrere zu dieser Versammlung hinzugefunden, welche das Getöse dieses Liedes immer heller gemacht, so wäre doch von beyden Seiten dieser Versammlung eine noch größere Menge gewesen, welche solchen Gesang mit seinen Worten: all’ Fehd hat nun ein Ende, nicht hätten stören wollen, und sich mit dem Gehöre Feldweg gewendet, es aber dennoch hätten hören müssen.«
Zu dieser Erscheinung bemerkt Süße (S. 39): »Ob dieses von dem nach zwey Jahren erfolgeten, aber von den Partheyen mit ganz ungleicher Gesinnung angenommenen Frieden, abermals eine Heeringische Voraussagung hat seyn mögen, solches überlasset man dem G(eneigten) L.(eser) zur selbstbeliebigen billigen Beurtheilung.«
[S. 233]Daß jeder Krieg einmal aufhören muß, wissen wir auch ohne besondere Inspiration. Deshalb scheint mir Süße mit seiner Reserve gut getan zu haben. Überhaupt will es mir scheinen, als hätten bei Heering die akustischen Erscheinungen weniger zu bedeuten, als die optischen, ganz zu geschweigen davon, daß hier der Verdacht, es handle sich lediglich um religiöse Exaltationszustände, nicht leicht von der Hand zu weisen ist. Ein Mann, der immer in die Kirche geht, viel die Bibel liest, bei jeder Gelegenheit zu seinem Beichtvater läuft, beweist dadurch, daß er völlig in der Weihrauchatmosphäre der Kirche lebt. Da dürfte auf religiöse Visionen auch dann wenig Gewicht gelegt werden, wenn nicht gleich mit so schwerem Geschütz, wie einer persönlichen Erscheinung und Anrede Christi aufgefahren wird.
Von seinen Visionen machte Heering meistens in Form eines Gleichnisses Mitteilung. Und zwar sagte er: »Ich prophezeye nicht, ich deute auch nicht, sondern ich zeige nur an, was mir der HErr anzuzeigen befohlen hat. Und darbey habe ich dem HErrn dreymal geschworen, daß ich von dem allen, was mir der HErr befohlen hat, nichts verhalten, und mich keine Furcht um meinet und der Meinigen willen abhalten lassen will.« Dabei weinte er heftig.
Was seine Empfindung oder richtiger, was sein Gefühl im Augenblick der Prophezeiung betrifft, so sagte er davon: »Es ist mir vom HErrn gegeben worden, der HErr hat mirs befohlen, der HErr hat mirs gezeigt, Er hat mirs sehen und – bisweilen – der HErr hat michs schmecken lassen.«
Der Fischer glaubte also zweifellos im göttlichen [S. 234]Auftrage zu handeln. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn er hätte täuschen wollen, was ja allerdings nach Lage des Falles unmöglich ist, so würde das nicht das allergeringste an dem wunderbaren Phänomen ändern, daß seine Prophezeiungen, soweit es sich um Irdisches und nicht um religiöse Phantasmagorien handelte, eintrafen.
Nachdem Süße in dieser eingehenden und gewissenhaften Weise seine Beobachtungen am Fischer niedergelegt hat, wobei er dem hartnäckigen Zweifler rät, doch den Prossener persönlich aufzusuchen, präzisiert er seine eigene Stellungnahme.
Er betont ausdrücklich (S. 42 f.), daß er »der Sache neuer Offenbarungen niemals zugethan gewesen, sondern jederzeit ein Mißtrauen gegen selbige gehabt habe.« Das ließ sich ja bei einem Mann der Aufklärungszeit, nicht zum mindesten bei einem protestantischen Geistlichen, voraussetzen und ist auch ganz der Standpunkt, den Schreiber dieses allen solchen Phänomenen gegenüber einnimmt. Aber jeder Zweifel muß bei einem denkenden und sich gegen jegliches Dogma, sei es nun ein kirchliches, naturwissenschaftliches, philosophisches oder sonst eines auflehnenden Menschen der Gewalt der Tatsachen gegenüber verstummen.
So ging es auch Süße. Und das, wiewohl er schon mit Rücksicht auf sein Amt aus einer gewissen Reserve nicht heraustrat, dem Fischer zahlreiche Einwendungen machte und keinen Beifall zeigte »und diss zwar aus der guten Absicht, dass ich eine etwa bey ihm excedirende Phantasey, und einen gemeiniglich damit verknüpften Hochmut, oder auch wohl [S. 235]einen ungeziemend partheyische Absichten verdeckt hegenden Sinn, nicht verstärken möchte.«
In seiner Ratlosigkeit, wie sich diese merkwürdige Gabe des Fischers erklären lasse, wandte sich Süße, aber erst nachdem er den Tatbestand, wie wir ihn oben finden, festgestellt hatte, an Werke protestantischer und katholischer Theologen. Was er dort fand, hat für uns wenig Interesse, deshalb unterlassen wir es, ihm in eine Literatur zu folgen, die der Erklärung nicht näher steht, als wir[122]. Nur mit dem Unterschied, daß wir ehrlich bekennen, bei dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft ein ignoramus aussprechen zu müssen.
Begeht die offizielle Wissenschaft den grotesken Fehler, die Tatsachen zu leugnen, weil sie keine befriedigende Erklärung weiß, so die Theologie den andern – allerdings weit geringeren –, daß sie eine Lösung des Rätsels gefunden zu haben glaubt, wenn sie mit Worten wie Gott, Heiliger Geist, Offenbarung usw. operiert. Uns genügt die Feststellung des Tatsächlichen, d. h. in diesem Falle:
daß der Fischer Heering aus Prossen die Gabe der Prophezeiung besaß.
[S. 236]Nun wird man zwar ohne weiteres zugeben müssen, daß die bei weitem überwiegende Zahl der Prophezeiungen in Erfüllung ging, aber man wird darauf hinweisen können, daß in unserem obigen Bericht bei einigen nichts vom Ausgang gesagt wurde. Deshalb wollen wir aus dem »Vorbericht« der »Umständlichen Nachricht«, der am 20. August 1771 abgeschlossen wurde, also 12 Jahre nach dem Tatbestand, wie wir ihn oben kennen lernten, einiges nachtragen.
Damals hatte Heering prophezeit, daß »das Preußische Heer, nachdem alles vollbracht war, in Frieden aus Sachsen zurückgezogen« werden würde. An dieser Voraussage hielt Heering fest, wiewohl der Krieg noch sechs Jahre währte und die Verhältnisse oft so kritisch waren, daß nichts ferner lag, als die Wahrscheinlichkeit, die Preußen würden friedlich aus Sachsen abziehen. Und doch trat dieser Fall ein!
Eine weitere Prophezeiung Heerings nach dem Friedensschluß, »daß er auf das künftige viel Brand-Stätte, wie auch viele entkleidete und beraubete Menschen in Pohlen gesehen« ging gleichfalls in Erfüllung.
Wir erinnern uns noch der die Türken (»der aus Morgen«) betreffenden Voranzeige, daß sie sich künftig in den Krieg einmischen würden. Der Fischer hatte gesagt: »daß nach denen damaligen, im Deutschen Reich, sich geendigten Troubeln, sich der Krieg nordwärts gezogen hätte«, daß es sich also nicht um kriegerische Verwicklungen mit Deutschland handeln würde. Da, wie wir sahen, alle Prophezeiungen [S. 237]Heerings in erstaunlich kurzer Zeit in Erfüllung gingen, so würde die Vermutung nahe liegen, daß das auch hier der Fall hätte sein müssen. Aber Heering sagte – wie auch sonst wiederholt – in diesem Falle ausdrücklich: »Zeit und Stunde hat mir der HErr hiervon nicht bestimmt«.
Unter diesen Umständen dürfte es nicht allzugewagt erscheinen, auch die Erfüllung dieser Prophezeiung allerdings erst nach einem Jahrzehnt zuzugeben, und zwar mit dem Eingreifen der Türken in den Polnischen Krieg. Zur Verteidigung der Herrschaft des katholischen Glaubens in Polen und der Verfassung erhob sich im Jahre 1768 die Konföderation zu Bar unter Führung des Marschalls Michael Krasinski, wurde aber, da der polnische Senat die Russen zu Hilfe rief trotz Unterstützung durch die Türken, vernichtet.
Bei dieser Gelegenheit können wir Süßes Vorsicht bzw. Skepsis kennen lernen, schreibt er doch (Vorbericht, S. 25): »Indessen ist meine Absicht nicht, einen präzisen Apologeten, oder absoluten Verteidiger von des Fischer Heerings Visionssache überhaupt, abzugeben, indem ich nicht in Abrede seyn kann, daß ich ihn allemal, bey seinen verschiedenen eröfneten indeterminirten oder unbestimmten Ideen und Ausdrücken, und bey seiner bisweilen hervorgeblickten Neigung, zu gleichsam ecstatischen Umständen, für ein Objekt der Versuchung gehalten und ihn daher (wie er mir dessen Zeugniß geben wird) auf die genaueste Selbstprüfung einer vielleicht bey sich vorwaltend lassenden starken Imagination oder Vorbildung, geführet, und daß er sich dadurch nicht verleiten [S. 238]lassen möchte, sorgfältig angewiesen habe, und noch fernerweit anweisen werde . . .« Bemerkenswert ist auch, daß er auf Seite 6 der »Umständlichen Nachricht«, in einer Anmerkung zu der Türkenprophezeiung schreibt »GOtt gebe, und erhöre uns in dem demüthigen Gebet unserer Lithaney auch darinnen Gnädiglich, daß zu keiner Zeit, und auch jetzo, bey denen unter einander entrüsteten Hohen Mächten, die Interposition oder Einmischung, deren Türken nicht nöthig und erfolglich sey.« Aus einer Kleinigkeit, wie dem Stehnbleiben dieses Ausrufes, ergibt sich auch, daß der Bericht von 1759 unverändert abgedruckt wurde.
Mir scheint die Skepsis hier übertrieben. Heering sagte ausdrücklich, daß die Türken sich erst nach Friedensschluß einmischen würden. Der Hubertusburger Friede wurde 1763 geschlossen, die Türken aber griffen in die polnischen Unruhen 1768 ein, also fünf Jahre später. Das will mir nicht so ungeheuerlich erscheinen[123].
Wir wissen ja gar nichts über die zeitliche Begrenztheit der Prophetengabe. Im Gegenteil werden wir später noch sehen, daß es möglich ist, Ereignisse, die erst nach Jahrhunderten eintreten werden, genauestens vorher zu sehen. Daß die Erfüllung zumeist den Voraussagen Heerings auf den Fuß folgte, läßt den Schluß durchaus nicht zu, daß es aus inneren [S. 239]Gründen so sein mußte. Wir würden, wollten wir uns ablehnend gegen die Türkenvision verhalten, stillschweigend die enge zeitliche Begrenzung der Prophetie oder überhaupt irgendwelche gesetzmäßige Gebundenheit voraussetzen. Dazu sind wir aber bei dem geringen Grade unserer Kenntnis von dem ganzen Phänomen um so weniger berechtigt, als die ganze Schulwissenschaft ja bis zur Stunde überhaupt die Tatsache noch leugnet.
Erst wenn diese nicht nur einwandfrei festgestellt ist – was ja in vorliegender Schrift geschieht – sondern wenn wir auch Tausende von gesicherten Fakten kennen, erst dann können wir ein Gesetz oder – sagen wir bescheidener – eine Regel abstrahieren. So weit sind wir aber noch lange nicht und deshalb besteht kein triftiger Grund, die Erfüllung der Türkenvision nicht zuzugeben.
An eine völlig unbekannte Sache mit aprioristischen Regeln oder Gesetzen heranzutreten, verbietet die Logik. Das war und ist auch heute noch der Kardinalfehler der gelehrten Zunft, dem es zugeschrieben werden muß, wenn sie allen großen und genialen Neuerungen oder Entdeckungen gegenüber bankrott machte.
Zum Schluß noch eine Vision Heerings, die er »schon vor anderthalb Jahren« hatte, das wäre zu Beginn des Jahres 1770, da der »Vorbericht« das Datum des 20. August 1771 trägt: Unweit des Ortes Prossen erschien ihm die Gestalt eines kleinen Mädchens, die ein altes Büchlein in den Händen hatte, auf dessen einem Blatt die Worte standen: schwere und theure Zeit; »über welche Anzeige er sich noch immer beklagt, [S. 240]daß ihm damals niemand habe Glauben beymessen wollen«. (Vorbericht, S. 19, Anm.)
Resümieren wir, dann kann es nicht dem allergeringsten Zweifel unterliegen, daß – selbst, wenn wir annehmen wollen, die Interpretation einiger weniger Vorhersagen sei gewaltsam – doch die erdrückende Menge in Erfüllung ging. Daß Berechnung ausgeschlossen ist, wird kaum jemand bestreiten wollen. Also besteht nur die Annahme des Zufalls, wenn wir den Beweis für die Sehergabe Heerings nicht für erbracht halten.
Nun wollen wir nicht bestreiten, daß die Möglichkeit des Zufalls besteht. Denn es handelt sich in keinem einzigen Falle um ganz außerordentliche Dinge mit sehr hohem Divisor. Die möglichen Fälle sind vielmehr relativ begrenzt. Zugeben wird man uns aber müssen, daß es sich sicherlich um einen sehr merkwürdigen Zufall handelt.
Auf alle Fälle beweist auch diese Vision, daß Heering keineswegs nur ganz kurze Zeit vorher sehen konnte.
Es ist nun sehr interessant, daß Süße, als er am 20. August 1771 diesen Visionsbericht abschloß, noch nicht wissen konnte, daß er im nächsten Jahre in Erfüllung gehen würde, und zwar in ungeahnt schrecklicher Weise. Denn es kann nur die große Hungersnot gemeint sein, die im Jahre 1772 allein in Kursachsen 15 000 Menschen hinweg raffte. Wir haben hier also einen jener seltenen und günstigen Fälle, daß eine Prophezeiung vor ihrem Eintreffen im Druck erschienen ist. Das verleiht auch allen anderen Angaben Süßes in den Augen der unverbesserlichsten Hyperkritiker erhöhte Glaubwürdigkeit.
[122] Die von Süße genannten Schriften sind: 1. Johann Charlier, genannt Gerson, Traktat de discernendis veris visionibis a falsis. Helmstedt 1692. Als »Abhandlung von Prüfung derer Geister« ist die Übersetzung dieser Schrift im Anhang der »Umständlichen Nachricht« S. 131–164 abgedruckt. Hier auch 2. ein Auszug von D. Philipp Jacob Speners »Erklärung, was von den Gesichten zu halten sey«, S. 165–184. Frankfurt a. M. 3. Luthers und 4. Gottlieb Wernssdorfs Ansichten gibt Süße S. 106 bis 120 wieder. Endlich berücksichtigt er die Gutachten der Wittenberger theologischen Fakultät.
[123] Wahrscheinlicher ist allerdings die Deutung, Heering habe die Polen für Türken gehalten. Da er ja in seinen Visionen sah, also die Uniformen usw. agnostizieren mußte, scheint diese Interpretation nicht gewagt. Wir werden in einem spätern Kapitel noch darauf zurückkommen.
[S. 241]
Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts erregten die Prophezeiungen eines Landwirtes namens Johann Adam Müller vom Maisbacher Hofe, unweit Heidelberg viel Aufsehen. Dieser Mann, der in mancher Beziehung große Ähnlichkeit mit dem Fischer Heering aus Prossen besitzt, sollte sogar in die Politik eingreifen. Bevor wir auf seine Person des Näheren eingehen, sei das Protokoll hier wiedergegeben, das der Pfarrer Hautz in Mekels, nachmals in Neckargemünd, im Jahre 1808 nach dem mündlichen Bericht Müllers zu Papier gab[124].
[S. 242]Es lautet:
»Ein Jahr vor dem Anfang des letzten österreichischen Krieges erschien mir des Nachts eine ganz weiße Gestalt, die mich bei der Hand nahm, daß ich darüber erwachte; ich glaubte anfangs, es sey meine Frau, fand aber, daß diese ruhig neben mir schlief. Einige Zeit blieb ich wachend im Bette sitzen und die Gestalt verschwand. Darauf legte ich mich wieder nieder und fing an zu schlummern, aber kaum war ich eingeschlummert, als mich wieder etwas an der Hand faßte und mich aufweckte. Die Gestalt glich vollkommen einem Menschen. Sie ging hin zum Tisch in meiner Stube, und als ich mich ihr näherte, verschwand sie plötzlich; worauf außen vor dem Hause am Himmel ein sehr starker Blitz erfolgte. Ich öffnete das Fenster und sah an dem Himmel einen großen Zug Kanonen, der sich von Frankreich gegen Österreich hin bewegte. – Vierzehn Tage vor Weihnachten 1805 erhielt ich eine andere Erscheinung, die mich abermals erweckte, und mir sagte, daß bald auch ein Krieg zwischen Frankreich, Preußen und Rußland ausbrechen würde, und nach Verlauf eines Jahres müsse ich zum König von Preußen gehen; der russische Kaiser werde auch dazu kommen. Doch sagte mir diese Erscheinung noch nicht, was ich bei dem König von Preußen tun sollte.
Am 2. Mai 1806 tat es abends gleich nach Sonnenuntergang einen starken Blitz; ich stand unter der Haustüre und sah ein Schwert vom Himmel hin- und gerade durch den eben vollgewesenen Mond fahren; das Schwert wurde rot und fuhr dann gegen Norden.
[S. 243]Nach Verlauf eines Jahres dachte ich wohl wieder an diese Erscheinung, aber mein Herz dachte nicht daran fortgehen zu wollen. Am ersten Sonntag im Jahre 1807 kam jene weiße Gestalt wieder und sagte mir: ich sollte mich eilends aufmachen und zum König von Preußen gehen. Wenn ich zum König käme, sollte ich mich gar nicht besinnen, was ich sagen solle, denn Gott würde mir schon in den Sinn geben, was ich sagen solle. Der russische Kaiser würde auch dazu kommen, ich solle mich aber gar nicht vor ihnen scheuen, denn es werde mir nichts zuleide geschehen. Darauf versprach ich, daß ich fortgehen wolle; da verschwand die Gestalt. Weil ich nun aber nicht wußte, was ich bei dem Könige zu tun habe, so bat ich Gott, er möge mir dies doch offenbaren, und 14 Tage hernach erschien mir wieder die Gestalt, und sagte mir, ich sollte mich 7 Tage meiner Frau enthalten, dann würde mir offenbart werden, was ich dem König zu sagen hätte. Nach Verlauf dieser 7 Tage in der achten Nacht kam wieder etwas, und nahm mich bei der Hand. Als ich erwachte, war alles um mich her so hell (NB es war nachts 12 Uhr) als ob das ganze Haus im Brand stände. Ich sah aber wohl, daß es kein Brand war, denn es war so hell weiß, wie die Sonne am Mittag ist. Da stand ein alter Mann, dem Ansehn nach etwa 80 Jahr alt, der hatte zwei Bücher unter dem Arm, die ganz veraltet schienen, ohne Deckel und voller Falten. Ich betrachtete den Mann und besonders seine Bücher sehr aufmerksam. Er fragte mich, was mich so in Erstaunen setze? Ich schwieg stille und nun fragte er: ob es etwa die Bücher seien? Ich sagte ja! und [S. 244]nun antwortete er: darüber brauche ich mich weiter nicht zu wundern! So wie diese veraltet seien, so sei Gott, Jesus Christus und Gottes Wort, das in diesen Büchern stände, leider! auch veraltet. Darauf zog er das eine Buch unter dem Arm hervor, schlug den Jesaias auf, zeigte mir das 58ste bis in das 64ste Kapitel und sagte mir: ich solle mich jetzt schnell auf den Weg machen und zum König von Preußen gehn, und ihm so wie dem russischen Kaiser, wenn er dazu käme, diese Kapitel vorlegen und ihnen verkündigen, nach Anweisung dieser Kapitel sollen sie ihre Länder einrichten, denn so wie ich gesehen hätte, das Schwert durch den Mond fahren und hell rot werden, so werde die Finsternis bestraft werden, wenn sie sich nicht bekehre. Noch setzte er hinzu, ich solle mich nicht scheuen, er werde mich gesund hin, und wieder zurück zu meiner Frau und meinen Kindern bringen. Als ich versprochen hatte, dem Berufe zu folgen, kam ich auf einmal weg[125], und wußte gar nicht mehr, wo ich war, der alte Mann aber blieb bei mir. Wir kamen in eine Stadt, wo ein Haufen Wölfe, Bären und Löwen waren. Diese sprangen an mich hin; der alte Mann aber wehrte ihnen und beschützte mich. Wir kamen wieder weiter und an ein Wasser, ohne daß wir hinüber kommen konnten. Nach einigen Tagen kam ich aber hinüber ohne, zu wissen wie? Bald darauf kam abermals ein Haufen Wölfe, Bären und Löwen, die mich noch fürchterlicher anfielen. Mir war zugleich ich sei auf einem Wagen. Ein besonders [S. 245]großer Löwe verwundete mich, daß ich blutete. Der alte Mann fragte mich, ob es arg wäre? als ich nein! antwortete (ich blutete nur an der Nase), sagte er, es werde mir das nicht schaden, und mir auch sonst nichts mehr zuleide geschehen. Nun kamen wir zu Leuten, die Feuer hatten, aber ich konnte nicht sehen, von was das Feuer brannte. Sie hatten auch etwas, was ihnen zur Speise diente; mir aber kam es vor, als könne man es nicht essen. Ich fragte sie daher, von was sie lebten und welches ihnen recht gut schmecke. Dann kamen wir an einen sehr schönen gepflanzten Weinberg, worin einige Reihen Reben, dann eine Reihe von Obstbäumen, und dann ein Weg war. Da sagte mir der alte Mann: in diesem Weinberg würde ich eine Zeitlang bleiben. Darauf kam ich in eine große schöne Stadt, in welcher man mich überall herumführte. Mitten in der Stadt kam ich in eine ungemein große Kirche. In den 4 Ecken der Stadt standen vier Königsschlösser. Der alte Mann sagte mir nun, diese Stadt sei die Stadt Zion und Neu-Jerusalem, sie solle aber noch erst gebauet werden, zum Gedächtnis, wenn die Menschen sich gebessert und sich wieder zu Gott gewendet hätten. Er zeigte mir den Platz, wo die Stadt sollte hingebaut werden[126]. Darauf verschwand der alte Mann, und ich befand mich wieder, jedoch wachend, in meinem Bett.«
Ich muß den Leser um Entschuldigung bitten, daß ich alles dieses phantastische Zeug ihm wortgetreu [S. 246]aus dem Protokoll vorführe. Aber nur so dürfte das ausreichende Material zu einem Urteil gegeben sein. Daß Müller Visionen hatte, die er für reale Dinge hielt und daß er der festen Überzeugung war mit dem »alten Mann« leibhaftig zu verkehren, scheint festzustehen. Daß es sich – so merkwürdig und abenteuerlich alles anmutet – doch keineswegs nur um Phantastereien, wie zweifellos beim Traum von Neu-Jerusalem, handelt, ergibt sich aus dem Folgenden zwingend. Besonders merkwürdig ging die Vision (oder war es ein Traum?) von den wilden Tieren in Erfüllung. Es wird sich überhaupt empfehlen, das Mißbehagen bei Lektüre des Protokolles zu überwinden und auch, mit Rücksicht auf das Folgende, auf Einzelheiten zu achten.
Doch fahren wir im Protokoll (S. 30) fort!
»Jetzt wußte ich nicht, was ich tun sollte. Gern wäre ich fortgegangen, aber der Gedanke an meine Frau und Kinder hielt mich zurück; ich ließ es also anstehen. Zehn Tage darnach kam ein Mann von mittleren Jahren des Nachts zu mir, und sagte: wenn ich nicht fortginge, so würde all das Blut auf meinen Kopf kommen und von meinen Händen gefordert werden. Ich wußte nicht, was ich machen sollte, und fragte also einmal des Nachts meine Frau, was sie machen werde, wenn ich einmal ¼ oder ½ Jahr nicht bei ihr sein sollte. Sie antwortete: »Lieber Gott! da wüßte ich mir weder zu raten noch zu helfen!« Darauf nahm ich mir fest vor, nicht fort zu gehen, es möge kommen wie es wolle. Am dritten Tage aber ward ich unruhig im Gemüt, und diese Unruhe nahm mit jedem Tage zu. Am siebenten Tage sagte [S. 247]ich zu meiner Frau: Du siehst nun, es tut nicht gut, wenn ich dableibe, es gehe also in Gottes Namen wie es will, da antwortete sie: »So gehe denn in Gottes Namen hin und richte deinen Befehl aus.«
Darauf ließ ich meinen Schwager holen, wozu auch der Schuhmacher Sattler aus Nußloch gekommen war. Beiden legte ich die ganze Sache vor, erzählte ihnen alles ganz genau und verlangte von ihnen, sie sollten mir raten. Sie antworteten aber, sie könnten mir hierin nicht raten, die Sache sei zu wunderbar. Wenn es nur 30 Stunden Weges wäre, so wollten sie wohl noch eher dazu raten, aber dieser Weg sei zu weit; wie ich denn hin und wieder zurückkommen wollte? Am Ende wenn ich denn auch hingekommen wäre, so werde ich doch nicht vor den König kommen können. Ich versetze: das weiß ich sicher, daß ich hin, wieder zurück und auch vor den König kommen werde. Da sagte der Schuhmacher, ich sollte es meinem Pfarrer vorstellen und hören, was der davon halte. Ich antwortete ihm, wenn es ein Pfarrer wissen sollte, so würde es ihm unser Herr Gott schon gesagt haben; doch (setzte ich hinzu), wenn ich den Sonntag in die Kirche gehe, will ich mit unserm Pfarrer reden.
Am folgenden Sonntag blieb ich bis zuletzt in der Kirche, und wollte dann zu dem Pfarrer ins Haus gehen; als ich aber die Haustreppe hinauf stieg, zog mich etwas am Rock zurück, worauf ich denn auch fortging, ohne mit dem Pfarrer über die Sache zu reden. Zwei Nächte darauf hörte ich (jedoch ohne etwas zu sehen) eine Stimme, die zu mir sprach: »Ich sollte eilends fortgehen, der Verderber sei hinweg!«
[S. 248]Am folgenden Abend ging ich zu meinem Nachbar und vertrautesten Freunde und sagte ihm, daß ich fort müsse, ob er sich nicht in meiner Abwesenheit meiner Frau und meiner Kinder annehmen wolle. Ich verschwieg ihm aber, wohin ich gehen werde, und was ich auszurichten habe. Er versprach mir, meiner Frau zu helfen, so viel er könne, und setzte hinzu: ich solle nur in Gottes Namen fortgehen. Ich sagte also zu meiner Frau, ich werde des andern Morgens fortgehen, und belehrte sie, wie sie inzwischen ihre Geschäfte und Haushaltung besorgen solle. Des andern Morgens kochte mir meine Frau ein Stück Dörrfleisch ab, dies, ein Stück Brot und 15 Kreuzer an Geld[127] nahm ich mit, und so trat ich meine Reise, ohne Paß, in Gottes Namen an.«
Die Ähnlichkeit der Vorgeschichte des Ganges zum König mit der des Prossener ist unverkennbar. Beide handeln aus unwiderstehlichem inneren Drange in der unerschütterlichen Überzeugung, Werkzeuge in Gottes Hand zu sein. Daß in beiden Fällen alles Sensationelle, so merkwürdig die erzählten Vorgänge auch sein mögen, völlig ausgeschlossen ist, sei ausdrücklich hervorgehoben. Was Müllers Charakter betrifft, so werden wir noch später auf ihn zurückkommen. Den des Prossener kennen wir ja bereits als völlig einwandfrei.
Doch fahren wir fort (S. 32):
»Als ich in die Gegend von Frankfurt kam, sah ich einen Berg mit Weingärten, an dem ein Weg [S. 249]hinauf ging. Dieser Weg war mir früher durch den alten Mann gezeigt. Nachher kam ich in einen Wald und so von Dorf zu Dorf bis Miltenberg. Hier fragte ich nach dem Wege nach Würzburg. Von da ging ich nach Baireuth, dann über Leipzig, Wittemberg, Berlin, bis nach Prenzlow. Vor Prenzlow fragte mich ein Mann, wohin ich wolle? Ich antwortete, nach Stettin, um dort einen Badenschen Dragoner, meiner Frau Schwestersohn, zu besuchen. Da erbot er sich, mir den Weg um die Stadt herum zu zeigen, damit ich nicht nötig habe, durch die Stadt zu gehn, weil ich sonst leicht angehalten werden könnte. Ich nahm es aber nicht an, sondern ging durch die Stadt, weil ich sie als eine von denen erkannte, die mir der alte Mann gezeigt hatte.
Am Tore fragte mich die Bürgerwache, wohin ich wollte? und ob ich einen Paß habe? Ich antwortete: nach Stettin! Einen Paß hätte ich aber nicht. Da wurde ich denn durch einen Gefreiten vor den Stadtrat geführt. Dieser hatte nun eben gerade eine solche Gestalt und Kleidung, wie mir es durch den alten Mann vorgestellt worden war. Jetzt, als ich sah, wie alles, was mir früher vorgestellt war, in Erfüllung zu gehen anfange, lachte mir das Herz im Leibe. Auf dem Wege nach dem Rathaus bedauerte mich der Gefreite! »Mann! Ihr dauert mich,« sagte er, »denn Ihr werdet lange sitzen müssen, ehe Ihr fortkommt!« Ich antwortete aber, das habe nichts zu bedeuten. Vor dem Magistrat in Prenzlow wurde ich gefragt, wohin ich wolle? Ich antwortete: nach Stettin, um einen badischen Dragoner, meiner Frauen Schwestersohn, zu besuchen. Nun wurde ich zu dem [S. 250]französischen Kommandanten geführt. Mein Wächter bedauerte mich jetzt noch mehr, aber ich antwortete ihm abermals, er solle meinetwegen außer Sorgen sein. Der französische Kommandant fragte mich das Obige wieder, und ich beantwortete es gerade wie vorher. Er entließ mich mit den Worten: ich solle in Gottes Namen sehen, wie ich weiter nach Stettin komme. Beim Weggehen sagte jener Gefreite, ob ich denn nicht weiter wollte, als bis Stettin? Ich antwortete: Nein! aber er versetzte: Ihr geht doch weiter und müßt wohl einen ganz besonderen Auftrag haben. Nun! glückliche Reise! Zugleich brachte er mich auf den rechten Weg.
Bei meiner Ankunft in Stettin, ging ich gerade durch die Stadt durch, ohne angehalten zu werden, und doch mußte jeder andere seinen Paß vorzeigen. Mitten auf der Oderbrücke aber wurde auch ich angehalten, auf die Wache geführt und nach meinem Paß gefragt. Ich sagte jetzt, ich wolle nach Kolberg. Man führte mich nun zum französischen Kommandanten, welcher befahl, mich nicht über die Oderbrücke zu lassen. Ich ging also wieder in die Stadt, trank ein Glas Bier und wollte nun zur Stadt hinaus. Da rief mir ein badischer Dragoner zu, wo ich herkäme und wo ich hinwollte? Ich antwortete ihm das mehrmals Erwähnte, und er führte mich dann zu seinem Offizier, bei welchem er zugleich Bedienter war. Auch dieser fragte nach dem Zweck meiner Reise, und ich sagte auch ihm, ich wolle zu meiner Frau Schwestersohn. Es wurde nun ein Chirurgus gefragt, ob mein Vetter nicht etwa im Lazarett sei! Es hieß aber: Nein! auch konnte man mir nicht [S. 251]sagen, ob er in der Gegend von Kolberg oder Danzig sei.
Als ich wieder vor die Stadt kam, sah ich den mir früher vorgestellten Berg, zugleich auch ein Dorf, in welches ich ging und in einem Hause (es war das Pfarrhaus) einkehrte. Der Pfarrer kam mir entgegen und fragte mich, was ich wolle? Ich bat ihn, mir doch zu sagen, wo und wie ich über die Oder kommen könne? Zugleich entdeckte ich ihm etwas über den eigentlichen Zweck meiner Reise. Darauf ließ der Pfarrer einen Mann holen und fragte ihn, ob er, Müller von jenseits der Oder, die Bienen schon abgeholt habe? Es hieß: Nein! doch wisse man nicht, ob er sie heute oder morgen holen werde. Da sagte der Pfarrer zu dem Manne, er solle doch sorgen, daß ich mit über die Oder gebracht werde, wenn der Müller die Bienen hole, denn an mir könne man einen Gotteslohn verdienen. Er setzte mir auch Butterbrot vor und gab mir einen preußischen Gulden mit dem Zusatze, ich sollte mich in einem mir von ihm angewiesenen Wirtshause so lange aufhalten, ohne mich viel umzusehen, bis dieser Mann kommen werde mich abzuholen. Ich war aber kaum eine halbe Stunde in dem Wirtshause, als der Mann mich schon abholte.
Dann fuhr ich mit dem Manne über die Oder, ging mit ihm in sein Haus und blieb die Nacht bei ihm. Er riet mir nun, mich nach Stolpmünde hinzuwenden, da würde ich vielleicht ein Schiff treffen, mit welchem ich weiter reisen könnte. Eine Stunde von Stolpmünde blieb ich über Nacht, und hier traf ich das Brot, welches ich nicht essen konnte.
[S. 252]Des andern Tages (Sonntags) trank ich erst in einem Wirtshause ein Glas Branntwein[128]. Hier traf ich zwei preußische Soldaten, die sich selbst ranzioniert hatten. Sie erkundigten sich, wo ich hinwollte? Ich antwortete: nach Danzig. Sie baten mich bis Mittag zu warten, weil sie dann mit mir gehen wollten, und ich blieb. Ich ging indes in die Kirche. Während dem hatten die Bauern den Soldaten gesagt, ich sei ein Spion, sie mögen mich daher nach Kolberg abliefern. Es wurde auch wirklich ein Wagen bestellt, auf welchen ich mich mit den 2 Soldaten setzte. Man tat mir aber nichts zuleide. Im nächsten Dorfe, wo der Wagen gewechselt wurde, wollte einer der Soldaten mich mit Gewalt von dem Wagen reißen, aber er zerriß bloß meine Hutschnur. Ich sagte ihm er solle sich nicht unterstehen, mir etwas zuleide zu tun. Sie mögen mich zu den Preußen oder zu den Franzosen führen, ich werde mich allenthalben verantworten. Die Bauern drohten mir auf allerlei Art. Ein dabeistehender Edelmann aber sagte, sie sollten mich zufrieden lassen, sie sähen ja, daß ich mich gutwillig in alles ergäbe. Da ließen sie mich ruhig. In der Nacht kamen wir in ein anderes Dorf. Der Edelmann wollte uns aber nicht die Nacht dabehalten, auch keinen Wächter hergeben mich zu bewachen. Der eine von den 2 Soldaten wurde also grob gegen ihn und gegen mich und schlug mich mit seinem Stock über die Nase, daß sie blutete[129]. Der Edelmann [S. 253]fragte mich, ob es mir wehe täte? Ich antwortete aber: Nein. Auf des Edelmanns Befehl ward ich durchsucht, ob ich etwas Verdächtiges bei mir habe? Man fand aber nichts. Der eine Soldat versuchte meinen Stock zu zerbrechen, weil er glaubte, daß darin etwas verborgen sei. Er konnte es aber nicht und der Edelmann bemerkte, wenn er hohl sei, wäre er schon längst gewiß zerbrochen. Der Mann, setzte er dann gegen die Soldaten hinzu, ist ehrlicher als Ihr! Mir gab er jetzt ein Glas Branntwein. Als nun der Soldat immer noch drohte, er wolle mich erstechen, tröstete mich der Edelmann, das solle nicht geschehen dürfen, denn er werde mir zu meinem Schutze einige Bauern zu Pferde mitgeben. Dies geschah auch und zwar 1½ Meile von Rügenwalde.
In einem der folgenden Dörfer, wohin wir morgens um 2 Uhr abfuhren, bekamen wir einen frischen Wagen und wieder einige Bauern zur Wache. Bei Rügenwalde erhielten wir abermals eine frische Fuhre, die uns bis ein an der See liegendes Dorf brachte. Die Soldaten begehrten wieder eine Fuhre, der Schulze aber verweigerte sie. Der eine Soldat schimpfte darauf, und der Schulze drohte, ihn den Polacken [S. 254]zu überliefern. Wir gingen nun an den Strand hin gegen Stolpmünde, aber ich bedauerte insgeheim, mit einem so rohen Menschen gehen zu müssen, und bat Gott, mich von ihm zu erlösen. Nach einer halben Stunde zeigte der Soldat Lust, sich in die See zu stürzen. (Man meinte überhaupt, er sei nicht recht bei Verstand.) Sein Kamerad verwies ihm sein Betragen. Bisher, sagte er, hast du diesen (auf mich deutend) umbringen wollen, und nun willst du dich selbst töten. Du siehst daraus, was für ein böser Mensch du bist. Bald nachher fiel der andere Soldat im Gehen um und konnte auf keinem Fuße mehr stehen. Wir suchten ihm zu helfen, aber es ging nicht. Er bat daher seinen Kameraden, er möge dem Schulzen des nächsten Dorfes auftragen, ihn durch eine herausgeschickte Fuhre nachholen zu lassen. Der Soldat tat dies aber nicht. Ich erinnerte ihn zwar daran, er antwortete mir aber: Nein! Denn jener habe durch sein Betragen deutlich genug gezeigt, daß er nicht besser als ein Vieh sei. Auch wäre er schuld, daß ich so schlimm behandelt sei, er habe dafür von den Bauern Geld genommen. In Stolpmünde, in einem Wirtshause, trafen wir den Bedienten eines gewissen Herrn Inspektors. Der Bediente hatte von mir gesprochen. Der Herr Inspektor ließ mich also in der Nacht des Ostersamstags zu sich kommen. Ich erzählte ihm meinen Auftrag und mein Geschäft und blieb bis 2 Uhr morgens bei ihm. Ich sollte noch länger bei ihm bleiben, aber ich wollte nicht. Er erbot sich dazu, daß auch er sich vor dem Könige stellen wolle, wenn derselbe mir etwa nicht glauben wolle.
Es hieß, 3 Meilen unter Stolpmünde werde ein [S. 255]Schiff nach Danzig abgehen, es war aber keins da. Ich wurde also mit mehreren preußischen Soldaten, die sich selbst ranzioniert hatten, die Osterfeiertage über einquartiert. Am Osterdienstag hieß es, es werde ein Boot ausgerüstet, mit welchem wir nach Danzig fahren sollten. Wir gingen also die See aufwärts und fanden da wirklich ein großes Boot. Man sagte uns aber, wir sollten einen günstigen Wind abwarten. Ich wurde also zu 6 preußischen Soldaten einquartiert. In der Nacht segelten die andern ohne uns 7 ab. Früher schon sagten sie, sie nähmen uns nicht mit, es sei denn, daß ich ihnen verspräche, daß sie glücklich nach Danzig kommen würden. Ich hatte ihnen aber geantwortet: »Daß ich glücklich ankommen würde, wisse ich gewiß; wenn sie also mit mir reiseten, würden sie ja auch wohl glücklich ankommen!« 6 Stunden nach ihrer Abreise ohne uns mußten sie aber widrigen Windes halber wieder zurück. Wir 7 gingen nun zu Fuß wieder nach Rügenwalde zurück. Hier trafen wir einen Husarenwachtmeister vom Schillschen Korps an. Er erkundigte sich zuvor nach mir bei den 6 Soldaten und bezeigte sich dann ungemein liebreich und freundlich gegen mich. Schon am folgenden Tage wurden wir auf einem Boote nach Kolberg eingeschifft. Zwar wollten die Soldaten es nicht leiden, daß ich mit in das Boot käme, aber der Wachtmeister jagte sie aus dem Boote und ließ mich hinein kommen. Alle Mitfahrenden bekamen die Seekrankheit, ich aber nicht.
In Kolberg wurden wir alle vor den Kommandanten geführt. Er fragte mich nach dem Zweck meiner Reise und lachte anfangs darüber, war aber [S. 256]doch nachher zur Fortsetzung meiner Reise sehr behilflich. So schickte er einen Korporal mit mir an das Schiff, damit auch ich mit denjenigen Soldaten, die unter Schill nicht dienen wollten, nach Pillau gebracht werde. Es war ein so großes Schiff, daß 118 Mann, mehrere Pferde und Gewehre darauf fahren konnten. Mit anbrechendem Tag fuhren wir fort; ich legte mich nieder, und jene 6 Soldaten legten sich zu mir.
Gleich am ersten Tage spotteten 6 Offiziere über Gott und alles, was heilig ist. Ich konnte es zuletzt nicht mehr anhören und bestrafte sie. Mich, sagte ich, könnten sie verspotten; aber über Gott sollten sie nicht spotten, sondern bedenken, daß sie auf einem gefährlichen Platze wären. Sie spotteten jetzt aber noch viel mehr und sagten: der besorgt gewiß, der Teufel werde ihn holen. Ich erwiderte: Mich holt der Teufel nicht, aber an euch könnte wohl die Reihe kommen. In der Nacht darauf kam in dem Schiffe Feuer aus, und brannte es bis in der Nacht um 1 Uhr. Der Jammer ward unbeschreiblich und stieg noch höher, als es hieß, die Schiffsleute wollten sich von dem Schiffe wegbegeben. Jetzt ermahnte ich sie zur Ruhe und zum Beten zu Gott um Hilfe, und versicherte sie, daß keiner von uns umkommen solle. Jeder legte sich nun wieder auf seinen Platz und in Zeit von einer halben Stunde war das Feuer aus; die brennenden Bretter wurden abgehauen und ins Wasser geworfen. (NB. die Offiziere, die so sehr gespottet hatten, beteten nun am lautesten.)
Nun wurde es so stürmisch, daß die Wellen hoch über das Schiff hinweg schlugen. Die Matrosen [S. 257]mußten sogar angebunden werden, damit das Wasser sie nicht mit fortrisse. Am andern Tage stieg ich bei heiterem Wetter auf das Schiff, um Tabak zu rauchen, hatte aber mein Pfeifenrohr verloren. Die Offiziere wollte ich nicht um ein Rohr ansprechen, damit sie nicht aufs neue Gelegenheit zum Spotten bekämen, deshalb wendete ich mich an 3 badische Soldaten, die vor Kolberg gefangen genommen waren. Kaum aber bemerkten dies die Offiziere, so litten sie es nicht, sondern gaben selbst mir eine Pfeife mit dem Zusatz: wenn ich nicht gewesen wäre, würden sie alle zugrunde gegangen sein. Der Schiffskapitän erwiderte: Dieser (mich meinend) hätte können glücklich davon kommen und doch ihr alle versaufen, denn solche Spötter habe ich noch nie gehört. Geschieht dergleichen aber wieder einmal, so werde ich die Spötter in die See werfen.
In Pillau wollte der Schiffer mich auf dem Schiffe behalten; der Schiffskapitän aber wollte mich mitnehmen. Der Kommandant gab es jedoch nicht zu, weil ich erst verhört werden müßte. Man brachte mich daher auf die Wache, wo ich drei Tage warten mußte, bis der zurück kam, der mich verhören sollte. Am ersten dieser 3 Tage kam ein Offizier dahin und ließ mich in das Zimmer des wachthabenden Offiziers holen. Da fand ich ihrer mehrere, die sich mit mir über meinen Auftrag unterredeten. Einer von ihnen, ein kleiner Mensch, setzte mir den bloßen Degen auf die Brust und fragte mich, ob ich glaube, daß dieser Degen mich durchbohren könne? Ich antwortete ihm: Das können Sie probieren! Am zweiten Tage kamen wieder andere Offiziere auf die Wache [S. 258]und ließen mich holen. Sie legten mir zwei bloße Degen auf den Kopf und ließen mich schwören, daß ich kein Spion sei, welches ich denn auch mit gutem Gewissen tat. Dann fragten sie: Wenn sie mich nun aber nicht zum Könige ließen, sondern mich wieder zurückschickten? Ich antwortete: Zum Könige käme ich doch, wenn sie mich auch wieder zurückschickten. Darauf antworteten sie: Nun, so sollte ich dann zum Könige kommen. Endlich kam ich ins Verhör zu einem Offizier, den ich aber weiter nicht kenne. Ich setzte ihm alles auseinander, und er schrieb es auf. Am folgenden Tage ging ich mit unbewehrten Soldaten nach Königsberg. Ein Junker hatte das Protokoll über mich bei sich und trug es, während ich mit den Soldaten in der Wachtstube blieb, zum General Rüchel. Nach einer halben Stunde kam dessen Bedienter, um mich zu seinem Herrn zu holen. Es war Mittagsessenszeit, als ich zum General Rüchel kam. In dem Zimmer, in welches ich gebracht wurde, fand ich viele Offiziere, russische, schwedische, englische und preußische. Auch sie fragten mich nach meinem Geschäfte. Ich sagte es ihnen. Dann wollten sie wissen, ob ich ihnen denn auch alles gesagt hätte. Ich antwortete: »Ein paar Worte könne und dürfe ich nur dem Könige selbst sagen. An sie sei ich nicht gesandt. Wollte der König sie ihnen aber sagen, so habe ich nichts dawider.«
Einer derselben führte mich in ein anderes Zimmer und gab mir zu essen und Wein. Wohl 5–6mal fragte er mich über meine gehabten Erscheinungen, ich antwortete ihm aber jedesmal die Wahrheit. Dann wurde ich ins Bedientenzimmer geführt. Am andern [S. 259]Tage sollte ich vor die Königin. Ein Bedienter des General Rüchel führte mich dahin. Ich fand wohl an 200 Offiziere. Man fragte mich, ob ich denn der Königin nicht alles sagen wolle? »Nein!« antwortete ich, »wenn ich aber mit dem Könige rede, so kann die Königin dabei mir zuhören.« Ich wurde dann wieder nach Hause gebracht, bis der König käme. Die Königin konnte dies aber doch nicht erwarten, sondern sie und ihre Schwester ließen mich an demselben Tage wieder holen.
Ich fand niemand in dem Zimmer, als die Königin, ihre Schwester[130] und einen Prinzen. Die Königin fragte mich, ob ich ihr denn nicht alles sagen wolle? Und warum nicht? Ich antwortete: »Es schicke sich nicht, ihr dasjenige früher mitzuteilen, was ich dem Könige zu sagen habe.« Sie versicherte mich dann, der König sei ein braver Herr, ich sollte mich nur gar nicht vor ihm scheuen, sondern ihm alles ohne Furcht sagen. Ich antwortete ihr, daß ich mich auch gar nicht vor dem Könige scheue. Darauf gab sie Befehl, daß man mir täglich 1 Gulden gebe, und daß der General Rüchel mich speisen sollte, bis der König komme. Auch sie selbst gab mir etwas Geld. Die Sache wurde dem Könige gemeldet, und am fünften Tage nachher kam derselbe nach Königsberg. In der Nacht um 10 Uhr ward ich zum Könige geholt. Er war mit der Königin ganz allein. Er stand mir zur linken und sie zur rechten Seite. Ich machte dem Könige mein Kompliment und bat ihn, er möge es mir nicht übelnehmen, daß ich, als ein geringer [S. 260]Mann, es wage, ihm Vorschriften zu geben, wie er seine Sachen einrichten solle. Der König klopfte mir auf die Achsel und sagte: ich solle ihm gar nichts verhehlen, sondern ihm alles sagen, er nehme es mir nicht übel. Da erzählte ich ihm, daß ich die verschiedenen Erscheinungen gehabt, und daß der alte Mann mir die Kapitel aus dem Jesaias gezeigt habe, die er lesen und darnach sein Land regieren sollte. Daß er ferner seine Untertanen durch die Geistlichkeit auffordern solle, Buße zu tun und sich zu bessern, weil sonst nicht Friede werden könne. Wenn aber dies geschehe, so werde es wieder besser werden. Frankreich werde in drei Teile geteilt[131] und die neue Stadt zum Gedächtnis erbauet werden.
Der König antwortete: Er allein könne das nicht und die Köpfe der Leute seien zu verdreht. Ich erwiderte: Er solle nur seine Schuldigkeit tun, ich wolle die meinige auch tun. Der alte Mann habe mich versichert, daß Gott den König und den Kaiser von Rußland dazu ausersehen hätten.
Täten sie es aber nicht, so werde Gott durch Hungersnot und Pest strafen, so daß von 100 Mann nur 10 übrig blieben, diese aber würden dann Gott die Ehre geben und sich bekehren. Der König versprach, er wolle seine Schuldigkeit tun. Es wurde [S. 261]auch an den russischen Kaiser geschrieben, auch war es bestimmt, daß er kommen wolle, so daß der König und gar viele Offiziere ihm entgegen ritten, aber er kam nicht. Der König griff in die Tasche und wollte mir Geld geben; ich bedankte mich aber, weil ich kein Geld nötig hätte. Meine Kost hätte ich beim General Rüchel, sagte ich, und die Königin habe schon befohlen, daß man mir des Tages 1 Gulden gebe, und das sei mehr als genug. Die Königin sagte jetzt, ich sollte jetzt künftig 2 Gulden haben, welches ich aber ausschlug. Der König sagte, ich möchte das Geld nur nehmen, es sei teuer in Königsberg und Geld brauche man doch immer. Darauf drückte mir die Königin das Geld in die Hand.
Der König gab mir nun zu erkennen, daß ich fortgehen möge. Ich tat es. Vor dem Zimmer stand die Schwester der Königin. Auch sie selbst kam mir nach und beide sprachen noch ¾ Stunden mit mir, befragten mich nach der Gegend von Wiesloch, sowie nach manchen Gastwirten[132], ob sie noch lebten. Dann ging ich wieder in das Haus des General Rüchel.
Da der russische Kaiser nicht kam, fuhr der König wieder fort von Königsberg. Ich ließ die Sache wegen des russischen Kaisers auf sich beruhen, weil doch der König versprochen hatte, es zu besorgen.
Am 4. Junius hatte ich wieder eine Erscheinung. Ich sah nämlich die Franzosen gegen Königsberg anmarschieren und bemerkte deutlich, woher sie kamen. [S. 262]Ferner, daß es eine heiße Schlacht gebe und daß man meinen werde, es sei alles verloren; daß man aber nicht zurückweichen solle, denn am 17ten werde alles wieder gewonnen werden. Unter anderm wurde mir befohlen, ich möge mit 6000 Mann auf das flache Feld gehen, wo mir denn der Feind in die Hände gegeben werden solle. Ich bat aber mich damit zu verschonen, weil, wenn auch alles so geschehe, die Ehre doch immer nicht Gott werde gegeben werden. Darauf antwortete die Erscheinung: so möge ich es denn gehen lassen, es werde alles wieder gut werden. Aber es kam so weit nicht; – denn es wurde Waffenstillstand gemacht.
Am 4ten Julius abends, als ich eben zu Bette gehen wollte und nur bloß die Beinkleider an hatte, kam ich auf einmal weg und wußte nicht, wo ich war. Es schien mir, als wenn viele Soldaten an mir vorüber marschierten, ein Teil von Abend her, ein anderer von Mitternacht her, alle aber gegen Frankreich. Morgens, beim Aufstehen, erzählte mir der Kammerdiener: es werde bald Friede sein. Ich antwortete: das werde nichts helfen, der Friede werde nicht lange dauern, denn ich hätte in der vergangenen Nacht die eben erwähnte Erscheinung gehabt. Der Kammerdiener erzählte dies dem General Rüchel und dieser dem Geheimrat Simson und dem Grafen Brühl. Vielleicht hat er es auch dem König erzählt, doch weiß ich dies nicht. Darauf ging ich am Tage vor dem Einmarsch der Franzosen in Königsberg mit dem General Rüchel und seinem Gepäcke von Königsberg ab nach Memel. In Memel wurden wir im Hause des Kaufmann Wachs einquartiert. Als [S. 263]bald nachher der General Rüchel seinen Abschied bekommen hatte, ging er mit seinem Kammerdiener zu Wasser nach Stralsund.
Sein Adjutant, ein Hauptmann, sollte mir nun das Geld, täglich 1 Gulden, ausbezahlen, wie die Königin befohlen hatte; allein ich forderte es nicht und er ging ab, ohne es mir zu geben. Die Bedienten und Pferde blieben da und ich mit ihnen.
Unser Quartier war in Wachsens Hofe. Da sie denn aber nach Pommern abgehen wollten, verlangten sie, ich sollte mit ihnen reisen. Ich antwortete, ich müsse es noch einmal mit dem Könige besprechen, wogegen sie meinen, ich solle doch lieber an ihn schreiben.
Wirklich schrieb ich nun an den König und gab den Brief seinem Kammerdiener, erhielt aber keine Antwort darauf. Der Geheimrat Simson fragte mich bald darauf, ob ich keine Antwort bekommen habe? und ich versicherte ihn: Nein! Ei, meinte er, wenn der König meinen Brief bekommen habe, so hätte ich gewiß auch Antwort erhalten, er wisse nicht wie das sei. Als ich einige Tage nachher wieder zu ihm kam, fragte er mich, wo ich mich jetzt aufhielte? Ich antwortete in Wachsens Hofe und setzte hinzu: es seien aber dort lauter Russen. Da sagte er, ich möge doch am nächsten Sonntage in Bachmanns Hoff (Haus) kommen, dort sei General Knobloch einquartiert, und der Graf Brühl werde auch dahin kommen. Ich ging also hin. Als sie gespeist hatten, redeten sie mit mir und befahlen mir am andern Tage wieder zu kommen; der General werde mir geben, was ich brauche und der Hof-Inspektor das Essen.
[S. 264]Etwa einen bis zwei Tage nachher kamen der Graf Brühl und der Geheimrat Simson zu mir und ratschlagten, wie es anzufangen sei, daß ich den König sprechen könne. Ich teilte ihnen alles mit, was ich wußte, und setzte hinzu, daß alles so kommen werde, wie ich gesagt hätte, folglich schlimm, wenn man nicht tue, was ich angedeutet habe. Endlich beschlossen sie, ich möge alles aufschreiben z. E. was ich für Erscheinungen gehabt habe usw. Das tat ich dann und der Planinspektor mußte es abschreiben. Der Graf Brühl wollte es dem Könige übergeben, hat es aber nicht getan. So oft ich darnach fragte, antwortete er: er habe noch keine schickliche Gelegenheit dazu gefunden. Ich erwiderte, wenn es sich nicht schicken wolle, es dem König selbst zu geben, so möge er es seiner Gemahlin, der Königin geben. Er tat aber auch dies nicht.
Späterhin schrieb ich alles noch einmal auf und gab es auf die Post, da erhielt ich mit der Post folgende Antwort:
»Sr. Königl. Majestät von Preußen machen dem Johann Adam Müller hierdurch nachrichtlich bekannt, daß Sie seine unterm 3ten dieses eingereichte Eingabe wohl erhalten haben und die von ihm dabei gehabte gute Absicht nicht verkennen wollen.
Memel den 3ten Jannar 1808
Friedrich Wilhelm.«
Einige Zeit nachher hatte ich wieder eine Erscheinung. Ein Engel nämlich hatte ein Schwert in der Hand, so hell wie ich noch nie eins gesehen habe. Er gab es mir in die Hand und sagte: damit solle der Feind geschlagen werden. Ich möge aufstehen [S. 265]und dem Könige sagen, er solle den Propheten Amos und Jonas, aber beide Bücher ganz durchlesen.
Nicht lange nachher faßte mich des Nachts etwas bei der Hand. Ich erwachte, richtete mich auf und sah zwei weibliche Gestalten in ganz weißen Kleidern. Die zur Rechten hatte ein rotes, die zur Linken ein blaues Band um den Leib. Sie trugen ein großes Buch in die Hände auf mein Bette. Ich betrachtete die Krone genau und bemerkte ein Wort, dessen eine Hälfte auf der linken, die andere auf der rechten Seite der Krone stand. Das Wort war so geschrieben:
Bera – beae.
Ich fragte sie, wer sie wären? Sie antworteten sie wären zwei Königinnen. Sie hätten dem Könige der Ehren noch nie ein Lied gesungen, auch hätten sie kein Lied ihm damit zu dienen. Ich sann hin und her und dann versicherte ich sie, daß ich ihnen 2 Lieder machen wolle, wenn sie darauf warteten. Die Lieder würden von Gott und Jesu Christo handeln. Gut, antworteten sie, ich möge sie nur recht schön machen; und vor großer Freude darüber lächelten sie mich an. Dann aber sagten sie, sie hätten nicht länger Zeit darauf zu warten; doch wollten sie wieder kommen die Lieder abzuholen. Nun nahmen sie das Buch wieder zu sich und verschwanden. Über ihr schnelles Verschwinden erschrak ich[133].
[S. 266]Einige Tage nachher erschienen mir zwei Adler, ein schwarzer und ein gelber, und kämpften sehr lange miteinander, dicht vor meiner Bettlade. Endlich wurde der gelbe Adler besiegt, so daß er sich vor Mattigkeit auf den Boden legte. Da trat der schwarze auf ihn, bis der gelbe allmählich verging. Als dieser verschwunden war, verschwand auch nachher der schwarze.
Dann kam der alte Mann, der mir in meinem eigenen Hause erschienen war, zum drittenmal zu mir, und wurde es dabei wieder so hell, als das erstemal. Ich wachte vollkommen. Er setzte sich nun mir zur Seite und hatte ein Buch wie eine Handbibel, es war aber sehr prächtig und mit lauter goldenen Buchstaben. Er redete mir zu, ich sollte mich nicht fürchten und mutig verrichten, was ich zu tun habe; denn es solle mir kein Unglück widerfahren, er werde mir allemal helfen. Dann öffnete er mir das Buch und sagte: Die zwei Königinnen, die mir erschienen wären, seien zwei Königreiche, die das Christentum noch nicht angenommen hätten. Sobald die Christen sich gebessert hätten, würden sie kommen und den christlichen Glauben annehmen.
Dann las ich folgendes:
So ihr mich liebet, so werde ich euch wieder lieben, und so ihr mich ehret, so werde ich euch wieder ehren. Dann will ich mit meinem heiligen Engel vor euch hergehen und will für euch streiten. [S. 267]Und ein jeder soll erkennen, daß ich der Herr bin und tun kann, was ich will. Die aber, die es nicht auf- und annehmen und wollen mein Werk verhindern, auf die wird Feuer vom Himmel fallen und die Erde wird ihren Rachen auftun und sie verzehren, damit ein jeder erkennen müsse, daß ein Gott im Himmel sei.
Dann verschwand der alte Mann für diesmal.
Zum viertenmal erschien er mir in einem blauen Rocke. Da kam ich mit ihm weg und wußte nicht, wie mir war. Unterwegs gesellte sich einer zu uns mit einem weißen Kleide. Der alte Mann fragte ihn, wo er hin wollte? »Ich bin von Gott gesandt,« sagte er. Gut, antwortete der alte Mann, so komm und hilf mir streiten, damit der böse Feind überwunden werde, der so viele Menschen verderbt hat! Dies hat Gott gesagt. Darauf versprach der im weißen Kleide, er wolle ihm helfen kämpfen, aber er solle dann auch mit ihm gehen und ihm helfen, daß er seine Sache, die ihm Gott befohlen habe, auch ausrichten könne, worauf der alte Mann, ja! antwortete.
Mit einem Male befand ich mich wieder im Bette und wachte vollkommen, gerade wie zuvor. Dies alles habe ich ebenfalls dem Könige geschrieben.
Am 17. April erhielt ich folgenden ersten Brief von meiner Frau:
(Folgt Seite 56–58 der Brief, dessen wesentlicher Inhalt die Bitte um baldige Rückkehr ist. Der Familie Müller geht es gut.)
Ich war früher entschlossen gewesen, bald zu den Meinigen zurückzukehren, aber etwa sechs Wochen [S. 268]vorher hatte ich eine Erscheinung, wobei mir angekündigt wurde, ich werde noch acht Wochen in Memel bleiben, müsse aber vor meiner Abreise mein Schreiben an den König ihm selbst überreichen.
Der Kaufmann Concentius, in dessen Hause der König in Memel gewohnt hatte, brachte mir persönlich den Brief von meiner Frau und fragte mich, was ich zu tun willens sei? Ich antwortete, ich sei auch ohne diesen Brief schon zur Rückreise entschlossen gewesen, ich wollte bloß noch einmal mit dem Könige in Königsberg sprechen. Da bot er mir an, er wollte mir einen Kahn bis Königsberg bestellen und mir auch das nötige Reisegeld geben. Ich erfuhr aber, daß der General Knobloch zu Lande, und der Planinspektor zur See nach Königsberg reisen würden und daß ich mit dem Letzteren dahin kommen könne. Weil wir nun noch zwei Tage lang auf günstigen Wind zur Abfahrt warten mußten, so wurden die mir angekündigten acht Wochen gerade vollendet.
In Königsberg kam ich in das Haus des Planinspektors. Er übergab mir dann einen Brief von dem Herrn Concentius an Herrn Abegg und ein paar Zeilen an den Geheimenrat Simson und an den Herrn Oberhofprediger in Königsberg. Letzterer nahm mich sehr gütig auf und fragte mich, ob ich derjenige sei, von dem er schon so vieles gehört habe? Er wünschte meine Geschichte zu wissen, ich antwortete aber: sie sei zum Erzählen zu weitläuftig, aber ich habe alles zu Papier gebracht, um es dem Könige zu übergeben und wolle es ihm zum Durchlesen bringen.
Er las das Ganze durch und sagte dann: »Wollte [S. 269]doch Gott, daß alles das geschehe, was hierin geschrieben ist!« Darauf bot er mir seine Hilfe an, insofern ich ihrer bedürfe.
Da ich den König selbst zu sprechen wünschte, gab er mir den Rat, meinen Aufsatz am folgenden Tage dem Könige beim Exerzieren zu überreichen, so sich dazu die beste Gelegenheit finden werde. Ich antwortete ihm, ich scheue mich gar nicht vor dem König und wolle also lieber zu ihm ins Schloß gehen. Er hieß auch dies gut und bot mir noch einmal seine Hilfe an, wenn ich ihrer bedürfe. Als ich ans Schloß kam, standen so viele Offiziere da, daß ich nicht hinein gehen wollte; ich wartete also die Wachtparade ab. Indes hatte aber ein Offizier, der mich kannte, dem General Göcking gesagt: Müller sei da! Darauf kam dieser zu mir und fragte mich, was ich wolle? Ich bat ihn, mich beim Könige zu melden; aber er antwortete: das gehe nicht wohl an! Darauf wurde mich der Bruder des Königs gewahr. Zugleich sagte man mir, wenn ich etwas Schriftliches bei mir hätte, so sollte ich es nur abgeben, es werde besorgt werden. Ich gab also das Schreiben dem General Göcking und bemerkte dabei, daß es ja der König selbst erhalte. Wenn es dem Könige zu schwierig sein sollte, so möge er den Königsberger Oberhofprediger und noch irgendeinen andern Geistlichen dazu nehmen. Man versprach mir dies alles zu bestellen.
Am andern Tage kam der Graf Brühl zu mir und brachte mir vom Könige einen Louisdor; ich wollte ihn aber nicht nehmen. Er behauptete, ich müsse ihn nehmen, denn er habe Befehl vom Könige [S. 270]ihn mir zu geben. Zugleich erzählte er mir, die beiden Oberhofprediger, sowohl der von Berlin, als der von Königsberg, seien berufen worden. Der erstere habe aber die ganze Sache verworfen, und nichts daraus gemacht. »Die Herren meinen,« setzte Graf Brühl hinzu, »wenn sie nur in Berlin wären, so seien sie im Himmel!«
Am Himmelfahrtstage bezog sich der Oberhofprediger in Gegenwart der königlichen Prinzen in seiner Predigt auf meine Angelegenheit und wünschte, daß Gott alle Herzen regieren möge, damit alle sich bekehrten, denn sie sähen ja deutlich, die Hand des Herrn aufgehoben, sie zu strafen[134].
Am zweiten Tage danach kam der Graf Brühl zu mir und sagte: Der Hofmeister des einen königlichen Prinzen, der Geheimerrat Reimann, wünschte sehr mich zu sprechen, ich möchte doch also in das Graf Brühlsche Haus kommen, der genannte Hofmeister werde auch hinkommen. Doch stehe es in meinem Willen. Ich ging an demselben Abend 4½ Uhr hin und fand den Hofmeister und noch einen Offizier. Beide verlangten, ich solle ihnen die ganze Sache noch einmal erzählen, sie wollten sie aufsetzen, sie dem Könige, bei dem sie täglich wären, vortragen und dafür sorgen, daß sie nicht vergessen werde. Der Offizier, dessen Namen ich aber nicht weiß, mußte nun aufschreiben. Ich erzählte ihnen in drei verschiedenen Tagen alles vom Anfang bis zu Ende. Als alles aufgeschrieben war, las der Hofmeister es [S. 271]durch und sagte, dies sei eine Geschichte, wie keine besser in der Bibel stehe.
Er verlangte nun von mir zu wissen, was das oben angeführte fremde Wort bedeute? Ich antwortete: daß ich das nicht wisse. Er verstehe ja mehrere Sprachen, müsse es also wohl besser wissen, als ich. Dann fragte er, aus welcher Sprache denn das Wort sei? Ich antwortete: das wisse ich wohl, daß es griechisch sei. Dann besann er sich lange, und ich zeichnete ihm das Wort noch einmal vor, und die Krone dazu, gerade so, wie ich beide gesehen hatte. Darauf sagte er: das sehe er nun wohl ein, daß es ein griechisches Wort sei, auch wisse er nun, was es bedeute. Darauf bat er sich vom Grafen Brühl aus, das Schreiben mit nach Hause zu nehmen, mit dem Versprechen jedoch, es dem Grafen wieder zurück zu geben. – Mir gestand er, daß er bei der Königin im Anfange über meine Geschichte gelacht habe, jetzt aber einsehe, daß alles wahr sei, daß er nun nicht mehr darüber lachen werde. Auch wünschte er noch einmal mit mir zu sprechen, ehe ich fortginge.
Dann bat ich den Grafen Brühl, er möge mich mit dem Wagen, der nach Berlin gehe, abreisen lassen, aber er meinte, das werde mir zu beschwerlich sein, er wolle mir einen Freiplatz auf der Post besorgen. Wirklich tat er dies und ich hatte den Freiplatz schon abgegeben, als er sagte, ich könne noch nicht abreisen, weil das Reisegeld noch nicht beisammen sei. Ich holte mir also meinen Freiplatz von der Post wieder ab. Dann fragte mich aber Herr Abegg, ob ich denn wirklich am andern Tag abreisen werde? Ich erzählte ihm darauf den Vorfall mit dem Grafen [S. 272]Brühl. O, antwortete er, das kann noch lange so gehen! und redete mir dann zu, meine Reise zu beschleunigen, weil meine Frau so sehnlich nach mir verlange. Das nötige Reisegeld bot er selbst mir an und fragte mich deshalb, wie viel ich wolle? Zwanzig Taler, antwortete ich, aber er behauptete, daß ich damit nicht auskommen werde und gab mir fünfunddreißig Taler. Hierauf nahm ich Abschied beim Grafen Brühl und beim Oberhofprediger und beide versprachen mir, sie wollten gern alles anwenden, um die gute Sache zu fördern.
Am ersten Pfingsttage abends um 7 Uhr reiste ich mit der freien Post von Königsberg ab bis Berlin. Von Berlin bis Nürnberg bezahlte ich das Postgeld, von Nürnberg aus machte ich den Weg zu Fuße. Meine ganze Reise dauerte gerade drei Wochen. Die Meinigen fand ich gesund.
(Unterschrieben)
Hautz, Pfarrer in Meckesheim.
Johann Adam Müller.«
(Soweit das Protokoll.)
Außer obigem langem Protokoll hat Müller noch Briefe an den König Friedrich Wilhelm III. von Preußen verfaßt, in denen er immer wieder die Notwendigkeit betont an Gott und Christus zu glauben und mit biblischen Phrasen aufs verschwenderischste umgeht. Mit dem nichtssagenden Gefasel würden wir uns nicht weiter befassen, wenn nicht auch Stellen in den Briefen enthalten wären, die sich auf die seinerzeit dem König gemachten Prophezeiungen beziehen und beweisen, daß tatsächlich eine ganze Reihe [S. 273]von ihnen in Erfüllung gegangen ist. Es läßt sich durchaus nicht annehmen, daß ein Mann wie Müller, der nach Berichten, aber auch nach dem ganzen Tenor seines »Protokolles« zweifellos an seine Mission glaubte – warum hätte er sonst ohne Geld und Paß die weite Reise gewagt, was ihm doch neben der Trennung von Frau und fünf Kindern auch berufliche Schädigung brachte? – daß ein solcher Mann es hätte wagen sollen, sich auf Prophezeiungen zu beziehen, die er gar nicht gemacht hatte. Aber selbst wenn er diese ungewöhnliche Frechheit besessen hätte, so würde der König sie zweifellos haben zurückweisen lassen statt ihm zu danken.
Wir entnehmen dem Briefe Müllers vom 28. Januar 1815 an den König folgenden Passus[135]:
. . . Ihro Majestät, es wird Ihnen noch wohl bekannt sein, wie mich Gott zu Ihnen gesandt im Jahre Christ 1807, wie ich nach Königsberg gekommen bin, da wurde ich zum General Rüchel und Herrn General Blücher und sonst noch zu vielen Herren geführt, mit welchen ich wegen dessen sprach, um welches willen mich Gott zu Ihnen gesandt hatte. Dann hat der General Rüchel mich bei Ihro Majestät der Hochseeligen Königin gemeldet, und sie ließ mich bei sich kommen. Da ich mit ihr gesprochen hatte, da war Freude über Freude. Auch der Kronprinz hat mit zugehört, welcher noch alles wissen wird, was ich mit seiner seligen Frau Mutter gesprochen habe.
Da mich Gott mit seiner großen Vatergüte vor [S. 274]Sie gestellet hat, um mündlich mit Ihnen zu reden, was Sie tun sollten, habe ich Sie dabei getröstet, daß Sie ein größeres Reich bekommen sollten, als Sie je gehabt, und daß Frankreich in drei Teile geteilt werden solle, und daß Zion und Jerusalem gebauet werden soll, welches alles Sie mir als König heilig zugesagt haben. Ich habe es auch öfters schriftlich eingegeben und von Ihnen zur Antwort erhalten, daß Sie das Gute nicht verkennen wollten.
Und die drei Schlachten in Sachsen, welche mir Gott vorher gezeigt, daß Sie und Ihre Majestät der Kaiser von Rußland selbst dabei sein werden (habe ich Ihnen vorausgesagt). Sie sollten nur nicht verzagen, der Feind werde überwältigt werden.
Und daß mich der Hofmeister der Prinzen zum letztenmal verhört und alles zu Papier genommen hat, woran wir drei Tage gearbeitet. Dann hat der Hofmeister zu mir gesagt: »Müller, wenn wir aber mit allen Mächten Frieden halten und alles gehen lassen, so kann das nicht geschehen, was er hier sagt.« Da sagte ich zu dem Hofmeister: »Sie mögden machen, was Sie wollten, es würde doch geschehen[136].«
Müller erzählt dann noch einige religiöse Erlebnisse, um endlich noch folgende Vision (oder Traum) zu berichten:
»Ihro Majestät von Preußen, ich will Ihnen kund tun, daß ich eine Erscheinung gehabt habe und mir [S. 275]Gott zu wissen getan hat im Jahr Christi 1814 in der Christnacht, da mir der Geist Gottes erschien. Ich war da in einem großen Saale. Da sprach einer zu mir: Müller, ist er auch hier? Ich antwortete: Ja! Dann sagte der Mann zu mir: ich werde vor die Herren kommen.
Nun stand ich auf einem großen ebenen Felde. Da sind Sie, der König von Preußen, und der König von Hannover und der König von Würtemberg und der König von Baiern gegenwärtig gewesen, und es sind vier Pfähle aufgerichtet worden. Da es aber an den 4ten kam, so wollte der König von Baiern diesen nicht aufrichten lassen. Der Geist des Herrn sprach aber: Es muß sein! da ist es denn geschehen.
Eine Weile nachher war der König von Baiern sehr freundlich.
In der zweiten Christnacht erschien mir der Geist des Herrn abermals und brachte mich auf eine Anhöhe. Da sahe ich eine so fürchterliche Schlacht, daß ich vor lauter Feuer zuletzt nichts mehr erkennen konnte. Dann zogen sich die Deutschen von einander und die Franzosen drangen hinein, aber über eine kleine Weile sprach der Geist des Herrn:
Die Franzosen sind alle gefangen[137]!«
Da der Brief, den wir hier abbrechen wollen, verloren ging, schickte am 12. März Müller ein Duplikat, dessen Empfang der König bestätigt:
»Ich schätze den religiösen Sinn, welcher den Johann Adam Müller seine Erbauung in der heiligen Schrift finden läßt und lasse auf seine Eingabe vom [S. 276]12ten d. M. seinen guten Gesinnungen Gerechtigkeit widerfahren.
Wien den 29sten März 1815.
Friedrich Wilhelm[138].«
Unzweifelhaft ist der Brief erstaunlich kühl. Wenn auch kein Mensch dem König zumuten kann, daß er an dem biblischen Bombast der Müllerschen Diktion Gefallen fand, so hätte er doch immerhin anerkennen können, daß eine Reihe von Vorhersagen eintrafen, als niemand es geahnt hatte. Der Gedanke, der König, nun wieder im Glück, habe Müller so gern vergessen, wie die seinem Volke versprochene Verfassung, liegt ja allerdings nahe.
Für uns hat diese Korrespondenz den großen Wert, dokumentarischer Beweis dafür zu sein, daß Müller mit dem Hofe wirklich in Verbindung stand und – das wird wohl der größte Skeptiker zugeben müssen – zum wenigsten sich selbst für einen Seher gehalten hat.
Eine nicht uninteressante Wiederholung der Prophezeiungen enthält auch der Brief, den Müller am 4. August an den König Friedrich Wilhelm schrieb und auf den er ihm unterm 15. August von Paris aus noch kürzer dankt. Der einschlägige Passus lautet[139]:
»Da sagte ich Ihnen, daß Gott Sie und Sr. Majestät den Kaiser von Rußland ausersehen hätte, Frankreich zu demütigen und die Völker zu befreien; daß sie Mut und Vertrauen [S. 277]zu Gott, zu sich und zu Ihrem treuen Volke fassen sollten und daß Gott Sie und Ihr Reich größer als je machen wollte, wenn Gott und sein Wort wieder in Ihrem Lande gefürchtet und geehrt würde.
Damals in Königsberg hat mir auch die Erscheinung den Zug der nordischen Völker nach Frankreich und die Vernichtung des französischen Adlers gezeigt, ferner daß Ew. Majestät bei einer Schlacht in den sächsischen Gebirgen, wo Sie selbst kommandieren, den Feind besiegen würden usw.«
Nach einem ganzen Schwall biblischer Reminiszenzen fährt der Bauer fort: »Monarchen! Gott rufet Ihnen durch meinen Mund zu, was Sie tun sollen und bevor das nicht geschehen ist, wird keine Ruhe werden auf Erden.
Sie sollen Frankreich in drei Teile teilen, es soll nicht mehr Frankreich heißen, sondern mit einem andern Namen benannt werden.
Sie sollen dem Könige von Frankreich die Krone nicht geben, auch nicht dem jungen Napoleon, damit diese nicht eine Geißel werden über ganz Europa, wie Gott den Jehu wider Joram und Ahab gewendet hat. Gott hat befohlen und ich rufe es Ihnen in seinem Namen zu: Es ist ein Wort der Gerechtigkeit, dabei soll es bleiben, er hat uns alle berufen, daß wir seinen Willen ausrichten wie die Engel im Himmel.
Sie sollen, das hat mir die Erscheinung schon 1807 kund getan, zur Erinnerung für ewige Zeiten eine Bundesstadt erbauen, in derselben sollen die [S. 278]vier Monarchen: Preußen, Rußland, Österreich und England alle Jahr einmal zusammen kommen, sich über das Wohl ihrer Völker beraten und sollen alle gleichmäßig von hieraus über Frankreich herrschen.
Ich habe den Plan der Stadt, die nach Gottes Befehl Neujerusalem und die dabei liegende Burg Zion genannt werden soll, so wie sie mir die Erscheinung gezeigt und mich darin umhergeführt hat, auf Papier gezeichnet und gedachte sie Ihro Majestät dem Könige von Preußen bei Ihrer Durchreise zu übergeben. . . .«
Am 7. Oktober 1815 schrieb Müller noch einen dritten Brief an den König[140], in dem er wieder an seine Königsberger Prophezeiungen erinnert, die dem König im tiefsten Elend künftige Größe vorhergesagt habe. Er kommt wieder auf die Vierteilung Frankreichs und auf die Bundesstadt zurück und prophezeit, daß »alle Religionen sich zur Anbetung eines Gottes und Jesu Christi bekennen werden.«
Er beruft sich – mit Recht – auf die zahlreichen eingetroffenen Vorhersagen, die niemand glauben wollte – zuletzt habe er noch den Krieg von 1815 durch eine Erscheinung voraus gesehen – und stellt das Eintreffen der anderen in Aussicht.
Er bittet den König, ihn wiederum zu empfangen wie 1807 in Königsberg.
Der König lehnte in einem Schreiben, das Berlin, den 27. Oktober 1815 datiert ist, das Gesuch ab. Wir können es ihm nicht verübeln, denn wenn es überhaupt etwas gibt, was selbst den Sanftesten zur [S. 279]Raserei bringen kann, dann sind es die schwülstigen mit biblischen Zutaten durchsetzten Expektorationen Müllers. Hie und da möchte man glauben, er sei vom religiösen Wahnsinn befallen worden. Aber ob uns dieser ungebildete und ehrliche, recht selbstbewußte Bauer sympathisch ist oder nicht: die Billigkeit fordert es seine Vorhersagen zu prüfen.
Und da finden wir denn, daß, abgesehen von denen, die sich auf Frankreichs Teilungen beziehen und einige religiösen Inhalts, fast alles in Erfüllung ging.
Wir tun am besten das Urteil Ehrlichs, der sich eingehend mit der Person Müllers und seine Vorhersagen beschäftigt, nachstehend wiederzugeben.
Müller hatte, wie so oft die ehrlichen Seher, nur den einen Wunsch, daß die Wahrheit und nichts als sie über ihn verbreitet würde. Deshalb kam er Ehrlichs Bemühungen, sie zu ergründen, durchaus entgegen. Letzterer sammelte alles, was Müller betraf, vollständig[141].
Wie er dazu kam, erzählt er auf S. 5 ff. der Vorrede seiner Geschichte dieses Mannes. Als er im Jahre 1807 und 1808 in Königsberg bei der preußischen Königsfamilie weilte und merkte, daß Geheimrat Reimann, der Erzieher des Prinzen Friedrich, über ihn lachte, sagte er: »Ich sage und tue, was ich muß und kümmere mich weiter um nichts.« Auf Reimanns [S. 280]Einwendungen hin sagte er: »Von dem allen verstehe ich nichts; aber es wird doch so kommen, wie ich gesagt habe, denn der Geist, der es mich versichert hat, kann nicht lügen, und ich habe es durch denselben ja selbst gesehen.« Endlich veranlaßte diese Sicherheit Müllers doch Reimann, die Sache ernst zu nehmen. Er verfaßte also ein langes Protokoll über Müllers Aussagen, das er sorgfältig aufhob und das nach seinem Tode in die Hände Ehrlichs gelangte.
Letzterer war sich über die Ehrlichkeit Müllers klar. Im Lobe seiner Redlichkeit, Mäßigkeit und Arbeitsamkeit stimmten alle überein, besonders der Pfarrer Hautz in Neckargemünd, der sehr lange in Müllers Geburtsort Meckersheim Pfarrer gewesen war, versicherte, daß er eine treue und ehrliche Seele war. Auch andere Pfarrer, die ihn kannten, bestätigten dies Urteil. Die Frage, ob er ein Betrogener oder Schwärmer sei, beantwortet er damit, daß Müller das Glück Preußens zu einer Zeit voraussagte, als es im allertiefsten Unglück war. Das hatte er damals schon felsenfest selbst gegen die Einwürfe des Königs und der Königin behauptet, wiewohl man seine Aussagen albern und unmöglich nannte. Im Laufe der Zeit aber sollte er nicht nur in der Hauptsache recht behalten, sondern selbst in Nebenumständen.
Der Krieg Frankreichs von 1812 mit Rußland, Frankreichs Niederlage und der ungeheure Brand Moskaus, die Verfolgung durch die Russen, der Enthusiasmus des preußischen Volkes für Freiheit und König, Preußens Krieg mit Frankreich und die Besiegung der Franzosen, [S. 281]bei welcher namentlich Schlachten in Sachsen erwähnt sind, in denen der König von Preußen und der Kaiser von Rußland kommandieren würden. Ferner der Übergang der Deutschen über den Rhein, Müllers persönliche Begrüßung des Königs bei dieser Gelegenheit, das und noch manches andere steht in diesen Papieren, die schon 1807 auf 1808 für den preußischen Hof niedergeschrieben wurden.
Ehrlich so gut wie die über Müller befragten Pfarrer waren sich darin einig, daß sie am liebsten die Prophezeiungen Müllers fortgeleugnet hätten. Aber es ging nicht, da so manches, was früher lächerlich erschienen war, später in Erfüllung ging.
Ehrlich genoß in kurzer Zeit Müllers Vertrauen, daher kann er wertvolle Nebenumstände mitteilen. Als er am 4. Januar 1815 das Gespräch auf seine neuesten Erscheinungen brachte, erzählte er, daß bald ein blutiger Krieg mit Frankreich ausbrechen werde.
»Gerade damals fanden sehr ernste Spannungen zwischen Österreich, Preußen, Bayern, Rußland, Frankreich usw. statt; ich bezog daher – politisch vernünftelnd – alles, was er mir sagte, darauf, und wünschte seine Gründe zu wissen, weshalb er so bestimmt glaube, daß es zum Kriege unter den Erwähnten kommen müsse. Er lächelte aber ruhig und heiter, gerade wie ein Mensch, welcher jenseits der Wolken und Stürme sicher steht, über mein Vernünfteln, Politisieren und Zweifeln, und sagte zuletzt:
›Ja, das verstehe ich alles nicht, aber der Geist hat mir gesagt, daß es wieder Krieg mit Frankreich gibt, und das bald!‹
[S. 282]Er besuchte mich seit der Zeit sehr oft, ungeachtet ich ihm – absichtlich! – nie ein Geschenk gab und jedesmal sein Gegner war und blieb[142].
Allmählich ließen die Spannungen auf dem Wiener Kongreß nach. Die Angelegenheiten mit Polen, Sachsen usw. kamen eine nach der andern in Ordnung, und ein tiefer Friede wurde (dem Anschein nach) mit jedem Tage gewisser. Jetzt durfte Müller nur die Türe öffnen, so scherzte ich schon mit ihm und spöttelte (jedoch freundlich heiter!) über seinen baldigen blutigen Krieg gegen Frankreich. Sein Benehmen dabei blieb sich immer gleich. Er erzählte nämlich stets aufs neue seine Erscheinungen in den Weihnachtsträumen, und schloß jedesmal damit: ›Sie werden sehen, daß alles zutrifft, und das bald! Denn der Geist kann nicht lügen!‹
Endlich in den ersten Tagen des März 1815 kam er abermals zu uns; diesmal um Abschied von uns zu nehmen, weil wir verreisen wollten. Jetzt war, nach aller Vernünftigen Meinung, an gar keinen Krieg mehr zu denken! Ich scherzte wie gewöhnlich mit ihm; ergriff ihn unter anderm am Kinn und wiegte schäkernd seinen Kopf hin und her mit den Worten: ›Nun, mein lieber Müller! Nun ist es mit dem blutigen Kriege gegen Frankreich rein aus, denn jetzt ist tiefer, tiefer Friede!‹ (Zugleich erzählte ich ihm den ganzen Stand der politischen Verhältnisse.)
Er hörte mich ganz aus, antwortete dann aber [S. 283]mit ungewöhnlicher Lebhaftigkeit: ›Und ich sage Ihnen, nun dauert’s gar nicht lange mehr! Nun geht’s gleich los in Frankreich.‹
Wir lachten gegenseitig über unsere, so höchst verschiedenen Behauptungen, schieden aber, wie immer, als gute Freunde voneinander.
Am Nachmittage desselben Tages ließ unsere Reisegesellschafterin uns bitten, die beabsichtigte Reise noch einige Tage auszusetzen, weil sie sich nicht ganz wohl befinde. Wir willigten ein. Ehe aber noch ihre Kränklichkeit völlig gehoben war, erfuhren wir schon aus den öffentlichen Blättern, daß Napoleon in Frankreich gelandet sey. In demselben Augenblicke, in welchem ich dies las, strafte ich mich selbst durch den unwillkürlichen Ausruf: Nun hat Müller doch recht! –
Jetzt begriff jedermann, daß ein Krieg, und wahrscheinlich ein sehr blutiger Krieg entstehen müsse. Die Reihe wäre also nun an Müllern gewesen, uns auszulachen, aber er tat es nicht, sondern sagte bloß – etwa wie ein Mensch, dem man etwas abgestritten hat, was er doch vor Augen sah: – ›Ich sagte es Ihnen ja immer! Geschehen mußte es durchaus! Denn – Gott kann ja nicht lügen.‹«
Soweit der Bericht Ehrlichs. Wir sperrten nur die Stellen, die auch im Original gesperrt sind.
Ferner versicherte Müller, daß die Gegend von Mannheim und Heidelberg in diesem Kriege von 1815 vom Feinde verschont bleiben werde. Aber auch diese Prophezeiung war außerordentlich gewagt und keineswegs, wie der Zweifler in solchen Fällen gern [S. 284]annimmt, Resultat einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Denn diese Gegend war damals fast ganz von Truppen entblößt, die russische Armee noch sehr weit zurück und, wie leider unsere Geschichte lehrt, der Weg den Franzosen nur zu gut bekannt. Deshalb zitterte alles vor der drohenden Gefahr. Und doch behielt Müller recht. Daß die mit Haut und Haar dem Dogma der Unmöglichkeit jeglicher Prophetie Verschriebenen nachher sagten, es hätte so kommen müssen, ist selbstverständlich.
Ehrlich betont ausdrücklich, daß er weder für noch gegen Müller Partei ergreife, sondern nur Tatsachen berichte und es jedem überlasse, darüber zu denken, was er wolle. Ehrlich weist daher auch ruhig auf die Irrtümer Müllers hin.
Die Erscheinung, die er in den Weihnachtsnächten 1814 hatte, stimmen vollkommen mit den Begebenheiten des 16. und 18. Juni 1815 überein. Aber die zweite Schlacht zwischen Elsaß und Lothringen, die Müller vorhergesehen hatte, wurde nicht geschlagen, weil die außerordentlichen Leistungen der Preußen Napoleon entscheidende Niederlagen beigebracht hatten. Sie wäre wahrscheinlich gewesen, aber sie war nicht wirklich. Ebenso wäre es in jeder Beziehung besser gewesen, Napoleon wäre damals gefallen, wie Müller wahrsagt bzw. andeutet, als er ihn mit seinen Generalen am Rande eines frischen Grabes stehen sah. Und doch erfüllte sich diese, wie wir gleich sehen werden falsch interpretierte, Vision nicht. Wie wir ja bei allen Wahrsagern die Beobachtung machen, daß hie und da ein Spruch nicht in Erfüllung geht.
Dem »Protokoll« sind noch einige Visionsberichte [S. 285]mit Müllers Unterschrift aus den Jahren 1815 und 1816 angereiht. Daß die Prophezeiung von Napoleons Grab nicht in Erfüllung ging, hatte bereits Ehrlich konstatiert.
Wir lassen hier den Bericht (S. 120 f.) folgen:
»Am 18. April 1815, Dienstag nachts um 12 Uhr, brachte mich der Geist des Herren auf eine Anhöhe im Elsaß und zeigte mir ein frischgemachtes Grab mit den Worten: ›Es sei für Napoleon. Er wird gleich selbst kommen!‹ setzte der Geist hinzu.
Bald darauf kam Napoleon mit zwei Generalen, diese blieben jedoch 200–300 Schritte zurück. Napoleon aber ging grade auf sein Grab los, und zwar so ganz dicht darauf zu, daß man glauben mußte, er werde jetzt, und jetzt hineinstürzen. Er betrachtete es lange und aufmerksam.
Dann sagte ich zu ihm, er hätte bleiben sollen, wo er gewesen wäre. Darauf sahe er mich sehr verdrießlich an, und sprach viel Französisch, welches ich nicht verstand.
Nun ging er zu den Generalen zurück, und damit hörte meine Erscheinung auf.
Johann Adam Müller.«
Da Napoleon vom Grabe zu den Generalen zurück ging, muß daraus meines Erachtens gefolgert werden, daß er nicht sterben würde. Die Vision würde also höchstens so zu deuten sein, daß er in großer Gefahr war, oder daß er sich mit dem Gedanken getragen habe zu sterben, d. h. wohl den Tod zu suchen und es dann unterließ. Ehrlich geht also hier in seiner Skepsis zu weit, denn von einer [S. 286]falschen Prophezeiung kann gar keine Rede sein, höchstens von einer falschen Interpretation.
Dagegen ist die zweite Vision Müllers vom 12. August 1815 nicht in Erfüllung gegangen. Darin heißt es, Frankreich würde unter die vier Monarchen geteilt werden, die vier Religionen, die heidnische, türkische, jüdische und christliche würden miteinander vereint werden und eine Bundesstadt müsse gebaut werden.
In der dritten Vision wird Müller auf den Römerbrief, Kapitel 5, hingewiesen, was er – am 26. September 1815 – so deutet: »Jetzt werde nun alles gut werden, Friede kommen, die Erkenntnis Christi und die Befolgung seiner Lehre ausbreiten usw., aber, meint er ferner, die früher erwähnte Schlacht müsse doch wohl noch erst erfolgen. Es werde auf jeden Fall noch etwas Hartes vorfallen.«
Mit dem Frieden – einer erstaunlich langen Friedensperiode – behielt Müller recht, ebenso mit einer anderen Vision, daß die Russen nicht wieder nach Deutschland kämen. Das hat sich ja nun ein Jahrhundert bewahrheitet und war damals sicher nicht vorauszusehen, da in den Jahren Müllers sehr häufige Grenzüberschreitungen stattfanden.
Auch daß Napoleon von St. Helena aus nicht wieder in den Gang der Weltereignisse eingreifen würde, war eine richtige, wenn auch sehr nahe liegende Vorhersage.
Dann folgen noch zwei religiöse und zwei politische Visionen, letztere auf einen Krieg Österreichs mit Frankreich deutend, also falsch.
Unser Bericht wäre unvollständig, würden wir [S. 287]nicht die Kritik erwähnen, die Ehrlich (S. 90–119) an einem Schriftchen »Neue Prophezeiungen des Johann Adam Müller«, das anonym und ohne Wissen Müllers erschien, übt.
Es enthält massenhaft falsche Daten, die Ehrlich, auf Grund von Müllers Angaben, berichtigt. Dadurch sind wir zu dem Schluß berechtigt, daß die unwidersprochen gebliebenen Behauptungen der kleinen Schrift auf Wahrheit beruhen.
Indem wir von einer Reihe an sich nicht uninteressanter Momente absehen, sei folgendes wiedergegeben: »Die erste meiner Erscheinungen hatte ich in der Nacht des neuen Jahres von 1804 auf 1805.« Ein Geist trat da an sein Bett und sagte: »Dies Jahr entsteht ein Krieg zwischen Frankreich und Österreich, und wenn letzteres nicht Friede macht, so wird es alles verlieren. Hierauf blitzte es am Himmel und die Gestalt verschwand. Ich ging nach dem Fenster, durch das der Blitz leuchtete, da sah ich deutlich am Himmel Artillerie von Frankreich gegen Österreich zu fahren, welcher Zug ¾ Stunden währte. Pferde, Knechte, Kanonen, Pulverwagen, alles war deutlich zu erkennen, nur daß sie ganz feurig waren.«
Müller beachtete diese Vision weiter nicht und erzählte erst von ihr, als er nach einer Schlappe der Franzosen einige Leute die Befürchtung aussprechen hörte, Österreich würde siegen. Daß diese ganze Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist, steht fest. (S. 96 f.)
Auf die gleiche Weise wurde Müller in der Neujahrsnacht 1805 auf 1806 der Krieg Frankreichs mit Preußen verkündet.
[S. 288]Andere Visionen hatte er 1807. Ein Mann (Geist) trug ihm auf, zu dem König von Preußen zu gehen und ihm zu sagen, er solle gemäß Jesaias, Kapitel 53 bis 64 handeln. Frankreich müsse unter vier Monarchen verteilt werden und Preußen werde so groß werden, wie es noch niemals war. Dann würden sich die Heiden und Türken taufen lassen und zuletzt die Juden und es werde nur eine Religion geben und tausendjährigen Frieden. Der »Geist« führte Müller dann nach Königsberg durch vier Städte und zeigte ihm alles, was er auf dem Wege erleben würde. So sah er Stettin, Königsberg, Memel und eine Stadt am Rhein zwischen Philippsburg und Nußloch, die für die vier Monarchen zu einmaliger Zusammenkunft jedes Jahr bestimmt war. (S. 98–102.)
Auf wiederholte Mahnung hin trat er dann seine weite Reise, von der das »Protokoll« eingehend berichtet, mit 15 Kreuzern in der Tasche und ohne jedes Gepäck an. Überall fand er kostenlose Unterkunft und Verpflegung, weil er dem Befehle des »Geistes« folgte und dort einkehrte, wo eine innere Stimme ihn hinwies. (S. 102–108.)
Friedrich Wilhelm III. hatte schon schriftlichen Bericht über Müller erhalten. Er mußte dem König alle angezeigten Kapitel aus der Bibel auslegen. Als er dem König die Treue seiner Untertanen, die Gut und Blut opfern würden, rühmte, antwortete er – und das ist bezeichnend für die allgemeine Lage, beweisend aber dafür, daß Müller unmöglich durch Kombinationen zu seinen Vorhersagen gekommen ist: »Ach nein! Es ist mir jetzt alles abtrünnig geworden!« (S. 108, Anm.)
[S. 289]Müller prophezeite dem König, daß Frankreich im Norden zugrunde gehen würde, daß Preußen so groß werden würde, wie noch nie, ferner die Vereinigung der Religionen und die Erbauung der bewußten Stadt. Als Friedrich Wilhelm erwiderte, daß er den Krieg ja nicht fortsetze und daher alles Geweissagte nicht eintreffen könne, gab Müller zur Antwort, der König möge machen, was er wolle, es würde doch so geschehen.
Auf die Frage, welche Religion denn übrig bleiben werde, antwortete Müller regelmäßig: »Die Religion, welche bleiben werde, sei weder die katholische, noch die lutherische, noch die reformierte, sondern diejenige, welche Christus selbst gelehret habe.« (Seite 109, Anm.)
Es folgen dann die Vorhersagen, die wir im »Protokoll« schon eingehend kennen lernten.
In Heidelberg hatte Müller eine halbstündige Unterredung mit König Friedrich Wilhelm III. Auch Blücher hat manches Pfeifchen mit Müller geraucht und manche Stunde mit ihm verplaudert. Die von Ehrlich ausgesprochene Vermutung Müllers felsenfeste Versicherungen der Jahre 1807 und 1808 hätten in den Freiheitskriegen im alten Marschall Vorwärts nachgewirkt, läßt sich jedenfalls hören. Seinem Adjutanten hatte er 1814, am 13. Juni, aufgetragen: »Er solle den Blücher von dem Müller grüßen und er werde nun bald viel mit den Franzosen zu tun kriegen, wenn er (der Adjutant) anders noch früh genug komme, um dies vorher bestellen zu können.« (S. 114 f., Anm.) Da die Schlacht schon am 15. begann, kam dieser Bote zu spät.
[S. 290]Übrigens erwartete Müller 1815 noch einen kurzen Krieg, da nicht sämtliche Prophezeiungen in Erfüllung gegangen seien, vor allem die auf die Teilung Frankreichs bezügliche und die, welche eine große, sehr blutige Schlacht zwischen Deutschen und Franzosen vorhersagt.
Endlich hatte er noch eine merkwürdige Vision. Er sah eine große Zahl Equipagen mit vornehmen Insassen. Dahinter kam der Teufel in einem Wagen. Diese Vision soll auf den Wiener Kongreß Bezug haben.
Für die Beurteilung Müllers ist nicht unwichtig Ehrlichs Versicherung, daß er, wiewohl nur Eigentümer eines kleinen Gutes von acht Morgen, doch niemals um Geschenke bat, sie auch nur von Reichen annahm. Wiewohl er durch seine Gabe ein wohlhabender, wenn nicht gar reicher Mann hätte werden können, verschmähte er es doch.
Auch seine Mäßigkeit ist bemerkenswert und schneidet von vorn herein den Verdacht ab, seine Visionen – ganz abgesehen von ihrer späteren Erfüllung – seien Wirkungen des Alkohols gewesen, wie ja mancher doppelt sieht oder gar weiße Mäuse zu erkennen glaubt. Wein und Branntwein trank er seit 6 bis 8 Jahren – also gerade in der Zeit seiner Visionen – überhaupt nicht. Ebenso Kaffee nur bei festlichen Gelegenheiten. Bei Gastmählern, zu denen er oft geladen wurde, begnügte er sich mit Suppe, Gemüse und Fleisch ohne je Braten usw. anzurühren. Nur auf dringende Bitten griff er zur Mehlspeise. In Memel und Königsberg war seine Nahrung durch fast volle neun Monate nur trockenes Brot und etwas Milch. Und das, wiewohl er natürlich viel Besseres hätte haben können.
[S. 291]Das Protokoll, das wir oben in extenso brachten ist nicht das Königsberger, das verloren gegangen zu sein scheint oder vielleicht noch einmal aus einem Archiv das Tageslicht erblicken wird. Trotzdem ist es durchaus authentisch, denn es wurde im Jahre 1808, also vor sämtlichen Ereignissen aufgenommen und befand sich seit dieser Zeit in den Händen des Pfarrers Hautz und seit mehreren Jahren (d. h. vor 1816) des Kirchenrates Abegg.
Übrigens scheint das Protokoll nicht alles zu enthalten, was Müller seinerzeit dem König Friedrich Wilhelm III. mitteilte. Denn er sagte darüber Ehrlich:
»Ich war in betreff dieser Punkte nur an den König von Preußen gesandt, also hielt ich es für Pflicht, gegen hiesige Menschen davon zu schweigen. Außerdem riet es mir auch die Klugheit, denn hier war damals alles noch im höchsten Grade französisch gesinnt. Man hätte mich vielleicht umgebracht, wenn ich das alles schon damals hier bekannt gemacht hätte.«
Der seltene Fall, daß von durchaus glaubwürdiger Seite – Ehrlich hat stets die Prophezeiungen Müllers nach seinem Diktat niedergeschrieben – eingehende Berichte über einen Seher vorliegen, und daß, wie aus den Briefen des Königs Friedrich Wilhelm, wie auch aus einem bei Ehrlich abgedruckten Brief, der die Anfrage der russischen Kaiserin enthält, hervorgeht, jede Mystifikation ausgeschlossen ist, rechtfertigen es, wenn wir uns eingehend mit Müller befaßten.
Für unsere Beweisführung im Speziellen aber ergibt sich folgendes Resultat:
Wir haben das gesamte Material eines Sehers zur Verfügung und konnten auf dieser Grundlage [S. 292]feststellen, daß nicht nur die wichtigsten und zur Zeit ihrer Verbreitung am wenigstens glaubwürdigen Vorhersagen in Erfüllung gingen, sondern auch die erdrückende Mehrheit. Daraus geht aber hervor, daß der Einwand, man entsinne sich nur der erfüllten, vergesse aber die unerfüllten Weissagungen, wenn es sich um »Seher« handelt, hinfällig ist.
Was nun den Inhalt der Vorhersagen betrifft, so sind sie gewiß zum Teil sehr merkwürdig. Aber keine einzige ist darunter, die so erstaunlich wäre, daß wir eine Gleichung mit einem Divisor aufstellen könnten, die den Zufall ausschließt.
Desto verblüffender sind die folgenden Weissagungen.
[124] Zitiert nach »Geschichte, Erscheinungen und Prophezeiungen des Joh. Adam Müller eines Landmanns auf dem Maisbacher Hofe, zwei Stunden von Heidelberg. Aus seinem eignen Munde aufgesetzt. Nebst allen dazu gehörigen Original-Briefen in getreuen Abschriften und der Widerlegung von 37 Unrichtigkeiten in der ohne sein Wissen, erschienenen Schrift: Johann Adam Müller, der neue Prophet usw. Mit dem getreuen Bildnisse des Mannes, einer genauen Nachahmung seiner Handschrift, der Abbildung seines Wohnhauses nebst der Umgegend, und dem von ihm selbst entworfenen Plane der noch zu erbauenden Bundesstadt Neu-Jerusalem und der Burg Zion. Frankfurt a. M., bei den Gebrüdern Wilmans 1816«, S. 25 ff. Ich benutzte wie bei Heering das Exemplar der Kgl. Bibliothek in Berlin.
[125] Heißt bei Müller jedesmal: »Ich geriet in Verzückung«.
[126] Ein Stadtplan von Neu-Jerusalem, nach dem Entwurf von Müller gezeichnet von F. L. Hoffmeister, befindet sich im Anhang der zitierten Schrift.
[127] Eigentlich waren es 24 Kreuzer. In Heidelberg aber trank er ½ Maass Bier und kaufte sich 2 Päckchen Tabak, behielt also nur noch 15 Kreuzer (Anm. im Original).
[128] Damals trank er noch, wiewohl selten, wenig, und nur vor Mattigkeit, Branntwein. Seit 6–8 Jahren gar nicht mehr. (Anm. des Protokolls Seite 36 des Buches.)
[129] Hier und im folgenden handelt es sich deutlich um eine Erfüllung des Gesichts vor Antritt der Reise, als die Feinde ihm in Gestalt von wilden Tieren erschienen. Hier dürfte es angezeigt sein, auf den Aufsatz von Rudolf Kleinpaul »Die Traumsprache« im »Magazin für die Literatur des In- und Auslandes«, 55. Jahrg., 1886, S. 241 ff. und 265 ff. hinzuweisen. Die Frage der Traumsymbolik ist selbst von solchen, die ihre Realität zugeben, noch keineswegs gelöst. Es gibt hier eine unerschöpfliche Mannigfaltigkeit des Ausdrucks – man denke im Gegensatz zu Müller an Kerner – und daher sind Fehler der Interpretation sehr naheliegend.
[130] Die damalige verwitwete Prinzessin Ludwig, nachmalige Herzogin von Cumberland.
[131] Diese Vorhersage kehrt immer wieder. Tatsächlich wurde Frankreich ja später verkleinert, aber von einer Dreiteilung zu reden, ist doch nicht angängig. Auch Neu-Jerusalem vergißt Müller nie. Daß solche Prophezeiungen religiöser Art nicht in Erfüllung gehen, konnten wir schon wiederholt beobachten. Das dürfte zum Teil daher kommen, daß es sich hier gar nicht um Fernsehen, sondern um biblische Reminiszenzen handelt.
[132] Beide sind durch jene Gegenden gereist (Anm. des Protokolls S. 48).
[133] Ich bemerke eventuellen Vermutungen gegenüber, daß ich durchaus nicht Spiritist bin und daher an eine objektive »Erscheinung« auch nicht glauben kann. Vielmehr dürfte es sich hier um nichts anderes als Träume handeln. Daß es zum guten Teil Wahrträume sind, geht aus der folgenden Erscheinung hervor. Müller hatte sich zweifellos in die Rolle einer Art von Glaubensapostel hineingelebt.
[134] Frau von St. . .s hat diese Predigt mit angehört, und versichert, daß sie allgemeinen und sehr tiefen Eindruck gemacht habe. (Anm. des Protokolls, S. 61.)
[135] Geschichte, Erscheinungen und Prophezeiungen des Joh. Adam Müller, Frankfurt a. M., 1816, S. 73 ff.
[136] Von mir gesperrt.
[137] Von mir gesperrt.
[138] a. a. O., S. 79.
[139] a. a. O., S. 80 ff.
[140] a. a. O., S. 84 ff. Die zweite Antwort des Königs ist abgedruckt auf S. 84, die dritte auf S. 89.
[141] »Geschichte, Erscheinungen und Prophezeiungen des Joh. Adam Müller«, Frankfurt a. M. 1816. Auf dem Titel steht kein Verfassername, sondern Wilhelm Ehrlich hat die Vorrede (S. 3–24), der wir obige Angaben über Müllers Person und Prophezeiungen, soweit sie nicht im »Protokoll« enthalten sind, entnehmen, unterzeichnet.
[142] Ehrlich verhält sich zu Müller also geradeso skeptisch, wie ein halbes Jahrhundert früher Süße gegenüber Heering.
[S. 293]
Eine der berühmtesten Weissagungen, der des Klosters Lehnin an Ruf wohl vergleichbar, ist die des Jaques Cazotte[143], die uns Laharpe überliefert. Sie gilt im allgemeinen, besonders bei allen jenen, die Prophetie für unmöglich halten, als ein stilistisches Meisterwerk [S. 294]Laharpes[144], zugleich aber auch als Produkt seiner Phantasie. Bevor wir diese Frage näher prüfen wollen, sei der Wortlaut der Weissagung nach der Übersetzung von Jung-Stilling[145] nachstehend mitgeteilt:
»Es dünkt mich, als sei es gestern geschehen, und doch geschah es im Anfang des Jahres 1788. Wir waren zu Tische bei einem unserer Kollegen an der Akademie, einem vornehmen und geistreichen Manne. Die Gesellschaft war zahlreich und aus allen Ständen ausgewählt, Hofleute, Richter, Gelehrte, Akademiker usw. Man hatte sich an einer wie gewöhnlich wohlbesetzten Tafel recht wohl sein lassen. Beim Nachtisch erhöhte der Malvasier und der Capwein die Fröhlichkeit und vermehrte in guter Gesellschaft [S. 295]jene Art Freiheit, die sich nicht immer in den genauen Schranken hält.
Man war damals in der Welt auf den Punkt gekommen, wo es erlaubt war, alles zu sagen, wenn man den Zweck hatte Lachen zu erregen. Chamfort[146] hatte uns von seinen gotteslästerlichen und unzüchtigen Erzählungen vorgelesen und die vornehmen Damen hörten sie an, ohne sogar zum Fächer ihre Zuflucht zu nehmen. Hierauf folgte ein ganzer Schwall von Spöttereien auf die Religion. Der eine führte eine Tirade aus der Pucelle von Voltaire an; der andere erinnerte an jene philosophischen Verse Diderots, worin er sagt: »Mit den Gedärmen des letzten Priesters schnüret dem letzten König die Gurgel zu!« und alle klatschten Beifall. Ein anderer steht auf, hält das volle Glas in die Höhe und ruft: »Ja, meine Herren! ich bin ebenso gewiß, daß kein Gott ist, als ich gewiß bin, daß Homer ein Narr ist;« – und in der Tat, er war von dem einen so gewiß, wie von dem anderen, und man hatte gerade von Homer und von Gott gesprochen, und es waren Gäste da, die von dem einen und dem anderen Gutes gesagt hatten.
Die Unterredung wurde nun ernsthafter. Man spricht mit Verwunderung von der Revolution, die [S. 296]Voltaire bewirkt hat, und man stimmte ein, daß sie der vorzüglichste Grund seines Ruhmes sei. Er habe seinem Jahrhundert den Ton gegeben; er habe so geschrieben, daß man ihn in den Vorzimmern, wie in den Sälen liest. Einer der Gäste erzählte uns lachend, daß sein Friseur ihm, während er ihn puderte, sagte: »Sehen Sie, mein Herr, wenn ich gleich nur ein elender Geselle bin, so hab’ ich dennoch nicht mehr Religion als ein anderer.« Man schloß, daß die Revolution unverzüglich vollendet sein würde, und daß durchaus Aberglauben und Fanatismus der Philosophie Platz machen müßten; man berechnete die Wahrscheinlichkeit des Zeitpunktes, und wer etwa von der Gesellschaft das Glück haben würde, die Herrschaft der Vernunft zu erleben. Die älteren bedauerten, daß sie sich dessen nicht schmeicheln dürften. Die jüngeren freuten sich über die wahrscheinliche Hoffnung, daß sie dieselben erleben würden; und man beglückwünschte besonders die Akademie, daß sie das große Werk vorbereitet habe und der Hauptort, der Mittelpunkt, die Triebfeder der Freiheit zu denken gewesen sei.
Ein einziger von den Gästen hatte an aller dieser fröhlichen Unterhaltung keinen Anteil genommen und hatte sogar ganz sachte einige Scherzreden in Rücksicht unseres so schönen Enthusiasmus eingestreut. Es war Mr. Cazotte, ein liebenswürdiger, origineller Mann, der aber unglücklicherweise von den Träumereien derer, die an eine höhere Erleuchtung glaubten, ganz eingenommen war. Er nahm nun das Wort und sagte mit dem ernsthaftesten Tone: »Meine Herren! freuen Sie sich; Sie alle [S. 297]werden Zeugen jener großen und erhabenen Revolution sein, die Sie so sehr wünschen. Sie wissen, daß ich mich ein wenig aufs Prophezeien lege; ich wiederhole es Ihnen: Sie werden sie sehen.«
»Dazu braucht man eben keine Prophetengabe«, antwortete man ihm.
»Das ist wahr,« erwiderte er, »aber wohl etwas mehr für das, was ich Ihnen noch zu sagen habe. Wissen Sie, was aus dieser Revolution – wo nämlich die Vernunft gegenüber der geoffenbarten Religion triumphiert – entstehen wird? was sie für alle, die hier sind, sein wird? Was ihre unmittelbare Folge ihre unleugbare und anerkannte Wirkung sein wird? –«
»Laßt uns sehen,« sagte Condorcet[147] mit seiner sich einfältig stellenden Miene; – »einem Philosophen ist es nicht leid, einen Propheten anzutreffen.«
»Sie, Mr. Condorcet« – fuhr Cazotte fort – »Sie werden ausgestreckt auf dem Boden eines unterirdischen Gefängnisses den Geist aufgeben; Sie werden an dem Gift sterben, das Sie verschluckt haben werden, um den Henkern zu entgehen, an dem Gift, welches Sie das Glück der Zeiten, die alsdann sein werden, zwingen wird, immer bei sich zu tragen.«
Dies erregte anfangs großes Staunen, aber man erinnert sich bald, daß der gute Cazotte bisweilen [S. 298]wachend träumte, und bricht in ein lautes Gelächter aus.
»Mr. Cazotte« – sagte einer der Gäste – »das Märchen, das Sie uns da erzählen, ist nicht gar so lustig, wie Ihr »Verliebter Teufel«; was für ein Teufel hat Ihnen denn das Gefängnis, das Gift und die Henker eingegeben? Was hat denn dies mit der Philosophie der Vernunft gemein?«
»Dies ist es gerade, was ich Ihnen sage,« versetzte Cazotte. – »Im Namen der Philosophie, im Namen der Menschlichkeit, der Freiheit, unter der Vernunft, wird es eben geschehen, daß Sie ein solches Ende nehmen werden; und alsdann wird doch wohl die Vernunft herrschen, denn sie wird Tempel haben; ja, es wird in derselben Zeit in ganz Frankreich keine anderen Tempel geben, als Tempel der Vernunft.«
»Wahrlich« – sprach Chamfort mit einem höhnischen Lächeln – »Sie werden keiner von den Priestern dieser Tempel da sein.«
Cazotte erwiderte: »Dies hoffe ich; aber Sie, Mr. de Chamfort, der Sie einer derselben sein werden und sehr würdig sind, es zu sein, Sie werden sich die Adern mit 22 Einschnitten mit dem Schermesser öffnen, und dennoch werden Sie erst einige Monate darauf sterben.«
Man sieht sich an und lacht wieder. Cazotte fährt fort:
»Sie, Mr. Vicq. d’Azir[148], Sie werden sich die Adern nicht selbst öffnen; aber hernach werden Sie [S. 299]sich dieselben an einem Tage sechsmal in einem Anfall von Podagra öffnen lassen, um Ihrer Sache desto gewisser zu sein, und in der Nacht werden Sie sterben.«
»Sie, Mr. Nicolai[149], Sie werden auf dem Schaffot sterben.«
»Sie, Mr. Bailly[150], auf dem Schaffot.«
»Sie, Mr. de Malesherbes[151], auf dem Schaffot.«
»Gott sei gedankt!« – ruft Mr. Roucher[152] – »Es scheint Mr. Cazotte hat es nur mit der Akademie zu tun; er hat eben ein schreckliches Gemetzel unter ihr angerichtet: ich – dem Himmel sei es gedankt . . .«
Cazotte fiel ihm in die Rede: »Sie? – Sie werden auch auf dem Schaffot sterben.«
[S. 300]»Ha! was gilt die Wette?« – ruft man aller Orten aus – »er hat geschworen alles auszurotten.« Er: »Nein, ich habe es keineswegs geschworen.«
Die Gesellschaft: »So werden wir denn von Türken und Tartaren unterjocht werden? Und dennoch –«
Er: »Nichts weniger; ich habe es Ihnen schon gesagt, Sie werden alsdann allein unter der Regierung der Philosophie und der Vernunft stehen. Die, welche Sie so behandeln, werden lauter Philosophen sein, werden immer dieselben Redensarten führen, die Sie seit einer Stunde auskramen, werden alle Ihre Maximen wiederholen, werden, wie Sie, die Verse Diderots und der ›Pucelle‹ anführen.«
Man sagte sich ins Ohr: »Sie sehen wohl, daß er den Verstand verloren hat (denn er blieb bei diesen Reden sehr ernsthaft). Sehen Sie nicht, daß er spaßt? – Und Sie wissen, daß er in alle seine Scherzreden Wunderbares einmischt.«
»Ja!« sagte Chamfort, »aber ich muß gestehen, sein Wunderbares ist nicht lustig; es ist allzu galgenartig. Und wann soll denn dies alles geschehen?«
Er: »Es werden nicht sechs Jahre vorbeigehen, daß nicht alles, was ich Ihnen sage, erfüllt ist.«
»Dies sind viele Wunder« (diesmal war ich es, nämlich Laharpe, der das Wort nahm) – und von mir sagen Sie nichts?«
»Bei Ihnen,« antwortete Cazotte, »wird ein Wunder vorgehen, das wenigstens ebenso außerordentlich sein wird: Sie werden alsdann ein Christ sein.«
Allgemeines Ausrufen! »Nun bin ich beruhigt,« [S. 301]rief Chamfort, »kommen wir erst um, wenn Laharpe ein Christ ist, so sind wir unsterblich.«
»Wir, vom weiblichen Geschlecht,« sagte hierauf die Herzogin von Grammont, »wir sind glücklich, daß wir bei der Revolution nichts gelten werden. Wenn ich sage ›nichts‹, so heißt das nicht so viel, als ob wir uns nicht ein wenig darein mischten; aber es ist so Brauch, daß man sich deswegen nicht an uns und unser Geschlecht hält.«
Er: »Ihr Geschlecht, meine Damen, wird Ihnen diesmal nicht zum Schutze dienen, und Sie mögen noch so sehr sich in nichts mischen wollen, man wird Sie gerade wie die Männer behandeln und in Ansehung Ihrer keinen Unterschied machen.«
Sie: »Aber was sagen Sie uns da, Mr. Cazotte? Sie predigen uns ja das Ende der Welt.«
Er: »Das weiß ich nicht; was ich aber weiß, ist, daß Sie, Frau Herzogin, werden zum Schaffot geführt werden, Sie und viele andere Damen mit Ihnen, und zwar auf dem Schinderkarren, mit auf den Rücken gebundenen Händen.«
Sie: »In diesem Falle hoffe ich doch, daß ich eine schwarz ausgeschlagene Kutsche haben werde.«
Er: »Nein, Madame! Vornehmere Damen als Sie werden auf dem Schinderkarren, die Hände auf den Rücken gebunden, geführt werden.«
Sie: »Vornehmere Damen? – Wie? – Die Prinzessinnen von Geblüt?«
Er: »Noch vornehmere.«
Jetzt bemerkte man in der ganzen Gesellschaft eine sichtbare Bewegung, und der Herr vom Hause nahm eine finstere Miene an; man fing an einzusehen, [S. 302]daß der Scherz zu weit getrieben werde. Madame de Grammont ließ, um das Gewölk zu zerstreuen, diese letzte Antwort fallen und begnügte sich, im scherzhaftesten Tone zu sagen: »Sie werden sehen, daß er mir nicht einmal den Trost eines Beichtvaters lassen wird.«
Er: »Nein, Madame, man wird Ihnen keinen geben, weder Ihnen noch sonst jemandem. Der letzte Hingerichtete, der aus Gnaden einen Beichtvater haben wird« – hier hielt er einen Augenblick inne.
Sie: »Nun, wohlan! Wer wird denn der glückliche Sterbliche sein, dem man diesen Vorzug gönnen wird?«
Er: »Es wird der einzige Vorzug sein, den er noch behält; und es wird dies der König von Frankreich sein.«
Nun stand der Herr vom Hause schnell vom Tisch auf und alle mit ihm. Er ging zu Mr. Cazotte und sagte zu ihm mit tief bewegtem Tone:
»Mein lieber Herr Cazotte! Dieser klägliche Scherz hat lange genug gedauert. Sie treiben ihn zu weit und bis auf einen Grad, wo Sie die Gesellschaft, in der Sie sich befinden, und sich selbst in Gefahr bringen.«
Cazotte antwortete nichts und schickte sich an wegzugehen, als Madame de Grammont, die immerfort verhindern wollte, daß man die Sache ernst nähme, und sich bemühte, die Fröhlichkeit wieder herzustellen, zu ihm hinging und sagte:
»Nun, mein Herr Prophet! Sie haben uns allen gewahrsagt; aber von Ihrem eigenen Schicksal sagen Sie uns nichts?«
Er schwieg, schlug die Augen nieder; dann sprach [S. 303]er: »Haben Sie, Madame, die Geschichte der Belagerung Jerusalems im Josephus gelesen?«
Sie: »Freilich. Wer wird sie nicht gelesen haben? Aber tun Sie, als wenn ich sie nicht gelesen hätte.«
Er: »Wohlan, Madame! Während dieser Belagerung ging ein Mann sieben Tage nacheinander auf den Wällen um die Stadt, im Angesichte der Belagerer und Belagerten, und schrie unaufhörlich mit kläglicher Stimme: ›Wehe Jerusalem! Wehe Jerusalem!‹ Am siebenten Tage schrie er: ›Wehe Jerusalem! Wehe auch mir!‹ – und im selben Augenblicke zerschmetterte ihn ein ungeheurer Stein, den die Maschinen der Feinde geschleudert hatten.«
Nach diesen Worten verbeugte sich Mr. Cazotte und ging fort.«
Soweit der Bericht bei Laharpe.
Nichts liegt näher als der Einwand, gerade weil alles so eintraf, wie es angeblich Cazotte prophezeite, sei es ein vaticinium post eventum, eine Dichtung des Laharpe.
Bereits Jung-Stilling nimmt zu dieser Frage Stellung. Seine Ausführungen können immerhin einiges Interesse beanspruchen. Wir setzen sie deshalb im Auszuge hierher:
»Ich frage jeden wahrheitsliebenden Kenner der Kunst, der Ideale von getreuen Kopien der Kunst zu unterscheiden versteht, ob diese Erzählung erdichtet sein könne? Sie hat so viele kleine Nuancen und Umständlichkeiten, die keinem Dichter eingefallen wären, und die er auch nicht für nötig gehalten hätte. Und dann, was konnte diese Erdichtung für einen Zweck haben? Ein Freigeist konnte sie nicht erdichten, [S. 304]weil er dadurch allen seinen Grundsätzen entgegen arbeitete; denn er verbreitete dadurch Vorstellungen, denen er todfeind ist, und die er für den dümmsten Aberglauben hält. Will man annehmen, ein Fanatiker, ein Schwärmer habe sie erdichtet, um etwas recht Auffallendes zu sagen, so widerspricht dieser Vermutung die Natur der Erzählung selbst, die nicht so wie ein Gedicht aussieht, und dann die Gewißheit, daß sie der selige Laharpe eigenhändig geschrieben hat . . . Gewiß, apodiktisch gewiß ist, daß Laharpe die Erzählung selbst geschrieben hat. Dies kann aus oben angeführten Gründen nicht geschehen sein, als er noch Freigeist war, und wer die gründliche Bekehrung dieses großen Mannes und großen Freigeistes weiß, denen kann der Gedanke nicht einfallen, daß er in diesem bußfertigen Zustand, wo er sein voriges Leben mit blutigen Tränen beweinte, einen solchen gottesvergessenen Frevel sollte begangen haben, so etwas zu erdichten; das ist moralisch unmöglich. Diese Sache vor seinem Tode bekannt zu machen, das war in der Zeit, in der er starb, nicht ratsam, und noch weniger durften es die Gäste vor der Revolution und während derselben erzählen[153].«
Die Möglichkeit der Erdichtung des Vorganges ist trotz der »vielen kleinen Nuancen und Umständlichkeiten« keineswegs von der Hand zu weisen. Mit solcher literarisch-ästhetischen Kritik kommt man nicht weit[154]. Andrerseits ist zuzugeben, daß Laharpe, von [S. 305]dem das Schriftstück zweifellos herrührt und aus dessen Nachlaß es herausgegeben wurde, während der Periode seines sogenannten Freidenkertumes unmöglich eine derartige Arbeit, die, wenn sie nicht wahr ist, zweifellos im hohen Grade mystisch genannt werden muß, abgefaßt haben kann. Wohl aber wäre das nachträglich möglich gewesen. Denn es hätte doch sicherlich einen nicht geringen Reiz, sich einen Mann vorzustellen, der die Zukunft bis in alle Einzelheiten genau vorhergesehen hatte, und ihn in das bewegte und geistig hochstehende Milieu dieser Gesellschaft zu stellen. Den »gottvergessenen Frevel« dieses Vorganges können wir uns nicht recht klar machen.
Die einzigen Punkte, in denen Jung-Stilling unbedingt rechtzugeben ist, wären demnach folgende: daß Laharpe, angenommen, alles hätte sich wirklich so ereignet, wie er es berichtet, aus politischen Gründen von einer Veröffentlichung in der kritischen Zeit, also vor Ausbruch der Revolution, Abstand nehmen mußte. Und dann als weiterer, zwar nichts Positives aussagender, der, daß er in der Periode des Freidenkertums die Dichtung – angenommen, es handelte sich um eine solche – nicht abgefaßt oder auch nur konzipiert haben konnte.
Damit kommen wir aber nicht weiter. Denn die [S. 306]Möglichkeit der späteren Dichtung ist keineswegs beseitigt. Sie auszuschalten, haben wir folgende Wege:
1. Eine Erklärung Laharpes, daß es sich um tatsächliche Vorgänge handelt. Eine solche ist zwar nicht unbedingt beweiskräftig, denn wenn es sich um eine Mystifikation handeln sollte, so läge der Gedanke nahe, der Autor habe mit allen Mitteln versucht, sie aufrecht zu erhalten. Beispiele dafür bietet die Literaturgeschichte in nicht geringer Anzahl.
2. Die Erklärung von Zeugen, die entweder dem Gastmahle selbst beiwohnten, oder aber vor Eintritt der verkündeten Ereignisse von den Vorgängen Kenntnis erhielten. Auch das ist kein unbedingt zwingender Beweis, da bekanntlich Gedächtnisfehler nichts weniger als selten sind. Immerhin würde – die Glaubwürdigkeit der Zeugen vorausgesetzt – daraus zu folgern sein, zwar nicht, daß sich alles gerade so verhielt, wie Laharpe mit großer Künstlerschaft erzählt, wohl aber, daß bemerkenswerte Vorhersagen auf die Revolution und wohl auch auf den Tod einiger Personen aus dem Munde Cazottes tatsächlich vorliegen.
3. Einen authentischen Bericht irgendeines Teilnehmers oder einer anderen Person, die von Cazotte oder einem Teilnehmer informiert war, vorausgesetzt, dieser Bericht sei vor Eintritt der prophezeiten Ereignisse schriftlich festgelegt worden. Letzteres allein wäre ein absolut zwingender Beweis. Es bliebe, gelänge es den gedachten Nachweis zu erbringen, nicht mehr der Ausweg, die Cazottesche Vorhersage zu bezweifeln. Nur die Erklärung bliebe frei, insofern Skeptiker nicht Prophetie, sondern Berechnung oder [S. 307]den beliebten Zufall heranziehen könnten. Allerdings ohne Aussicht zu haben, viel Gläubige zu finden.
Versuchen wir nun den Weg des Beweises, vom Unsicheren zum Sicheren fortschreitend, so zurückzulegen, wie wir ihn oben skizzierten.
Walter Bormann, der sich große Verdienste nicht nur um das Studium des Fernsehens in Raum und Zeit, sondern auch besonders um Aufhellung der Cazotteschen Prophezeiung erworben hat, führt in Ergänzung von Jung-Stillings Beweisführung Tatsachen an, die zweifellos geeignet sind, nachdenklich zu machen[155].
Die Niederschrift der Prophetie von Laharpes eigener Hand befand sich nach dem Tode des Autors im Besitz eines Herrn Boulard. Sie besaß noch einen Zusatz, den der Verleger aus irgendwelchen Gründen bei der Herausgabe der gesammelten Schriften Laharpes unterdrückte. Nach Mitteilung des vorgenannten Herren Boulard machte ihn die Zeitschrift »L’Imprimée« in Nr. 40 des Jahrganges 1820 bekannt. Er lautet:
»Jemand hat mir gesagt: »Das wäre wahr? Das, was Sie mir da erzählen, wäre wahr?« – Was nennt ihr denn wahr? Habt ihr es denn nicht gesehen mit euren eigenen Augen? – Ja, die Tatsachen; aber die Prophezeiung, eine so außerordentliche Prophezeiung? – Das will sagen, daß alles, was euch daran höchstens wunderbar erscheint, die Prophezeiung ist. Ihr täuscht euch zweifellos; die Kenntnis der Zukunft gehört nur Gott, und keiner ist Prophet, es wäre denn durch Gottes Eingebung. Allein das [S. 308]ist kein so ganz seltenes Wunder. Gott hat davon tausend verbürgte Beispiele gegeben, und es widerstreitet keiner moralischen, noch philosophischen Anschauung, daß er die Kenntnis der Zukunft, wenn es ihm gefällt, mitteilen könne. Dagegen ein Wunder, oder vielmehr eine Menge von Wundern, die in ganz anderer Weise außergewöhnlich sind, das ist diese Häufung von unerhörten und ungeheuerlichen Tatsachen, die jedweder bisher bekannten Anschauung widerstreiten, welche alle menschlichen Begriffe von Grund aus umstürzen, sogar im Schlechten und in dem, was man von den Verbrechen des Menschen wußte. Seht, das ist das reale Wunder, so wie die Prophezeiung bloß etwas Vorausgesetztes ist, und wenn ihr noch immer nicht dazu gekommen seid, in dem, was wir gesehen haben, etwas anderes zu erblicken als das, was man eine Revolution heißt; wenn ihr glaubt, daß diese so sei, wie eine andere, dann habt ihr sie nicht gelesen, noch bedacht, noch gefühlt. In diesem Falle würde sogar die Prophezeiung, wenn sie so stattgefunden hätte, höchstens ein Wunder sein, das für euch nur verloren wäre, wie für die anderen, und dies wäre dann das größte Unglück.«
Aus diesen Worten Laharpes läßt sich nicht viel machen. Dazu sind sie zu unklar. So viel ist aber sicher, daß er an Prophetie glaubt und sagen will, daß sie nicht so wunderbar ist, als die Ereignisse selbst. Auf die Erklärung durch Gott brauchen wir natürlich nicht einzugehen. Sie heißt nicht mehr und nicht weniger als ein X durch eine andere unbekannte Größe, deren Existenz noch nicht einmal [S. 309]beweisbar ist, erklären zu wollen. Indem wir uns vorbehalten, später auf Laharpes Ausführung zurückzukommen, wollen wir zunächst im Anschluß an Bormann versuchen, Zeugen für die Weissagung Cazottes aufzutreiben.
Deren gibt es nun mehrere: 1. Hat ein Herr de N. – also leider ein Anonymus – in den Pariser Zeitungen erzählt, daß er oft von Cazotte, den er gut kannte, die Ankündigung der schweren Drangsale Frankreichs gehört habe, während alle Welt noch in vollkommener Sicherheit lebte[156]. Derselbe [S. 310]Gewährsmann bestätigt auch die Wahrheit der Erzählung, daß Cazotte seine nach drei Tagen erfolgende Hinrichtung vorhergesagt habe. Ob das von ihm Vernommene sich mit Larharpes Darstellung deckte, sagt er allerdings nicht. Immerhin beweist dieser Zeuge, daß Cazotte eine gewisse Gabe des zeitlichen Fernsehens besessen hat.
2. Bekundet die Gräfin de Genlis schriftlich folgendes: »Ich habe das hundert Male Mr. de Laharpe vor der Revolution erzählen hören und immer durchweg genau, wie ich es gedruckt gesehen habe, und wie er selbst es hat drucken lassen. Im November 1825. Comtesse de Genlis[157].« Diese Zeugin ist die bekannte Erzieherin der Kinder des Herzogs von Orléans. Als sie dies Zeugnis ablegt, ist sie bereits 79 Jahre alt. Alte Leute leiden oft an Gedächtnisschwäche, erinnern sich aber auch andrerseits fast stets mit wunderbarer Klarheit an Vorgänge aus ihrer Jugend. Wenn wir uns also auch hüten müssen, aus diesem Zeugnis zu folgern, daß Laharpe tatsächlich wörtlich Cazottes Vorhersage wiederholt und überliefert habe, so werden wir doch nicht umhin können zuzugeben, daß irgendeine wunderbare Prophezeiung kursiert haben muß.
3. Der Sohn von Jaques Cazotte sagt nur aus, daß sein Vater oft Proben seines zeitlichen Fernsehens abgelegt habe, was übrigens Jung-Stilling auch von [S. 311]anderer Seite erfahren hatte. Ob die Darstellung Laharpes in allen Ausdrücken genau ist, weiß er nicht anzugeben. Er bestätigt aber jenen Vorfall, wo die Schwester ihren 72jährigen Vater den Mordbanden entriß und Cazotte darauf seinen nach drei Tagen bevorstehenden Tod richtig prophezeite. – Diese Zeugenschaft beweist zweifellos – und das ist sehr wichtig – daß Cazotte im Rufe eines Sehers stand und auch Sehergabe besaß. Die Annahme dürfte daher nahe liegen, daß es sich gar nicht um eine Dichtung Laharpes, sondern um dichterisch verklärte Wahrheit handelt. Denn wenn Cazotte, was ja nach dem Zeugnis des Sohnes nicht bezweifelt werden kann – Hellseher war, dann besteht gar kein triftiger Grund an der Wahrheit des Berichtes bzw. daran, daß ihm ein wahrer Kern zugrunde liegt, zu zweifeln.
4. Bezeugt ein Anonymus Mr. N. in Rennes, daß der bekannte Arzt Vicq. d’Azir mehrere Jahre vor der Revolution die Weissagungen Cazottes die er mit angehört hatte, und die trotz seines Unglaubens ihn beunruhigt hätten, erzählte. Es wird nicht angegeben, ob er sie genau so erzählte, wie Laharpe überliefert. Aber selbst wenn das wäre, könnten wir darauf nicht bauen, da das Gedächtnis besonders hinsichtlich des Wortlautes höchst unzuverlässig ist. Immerhin ist dieses Zeugnis – wenn wir ihm trotz seiner Anonymität Glauben schenken wollen – nicht ohne hohen Wert. Denn wenn es auch nichts über den Inhalt der Prophetie verrät, so beweist es doch, wie das der Gräfin de Genlis, daß mindestens Gerüchte von Vorhersagen umliefen. [S. 312]Daran und daß ihnen irgend etwas Reales zugrunde lag, werden wir kaum mehr zweifeln dürfen. Aber – das sei ohne weiteres zugegeben – für den konkreten Fall ist damit nicht allzuviel gewonnen.
Rekapitulieren wir kurz den gegenwärtigen Stand der Untersuchung:
1. Es ist absolut feststehend, daß Cazotte Visionen hatte, die in Erfüllung gingen.
2. Es kursierten zweifellos, anscheinend schon vor der Revolution, Gerüchte, nach denen Teilnehmer an jener Abendgesellschaft – die Gräfin Genlis nennt Laharpe, der vierte Zeuge in Rennes den Arzt d’Azir, der erste gar Cazotte selbst als Gewährsmann – aus Cazottes Munde Unglück verheißende Aussagen über die Zukunft Frankreichs gehört haben.
Damit können wir noch nicht viel anfangen. Denn wenn es auch sicher interessant ist zu wissen, daß Vorhersagen der Revolution – wie übrigens wohl fast jedes bedeutenden Ereignisses der Weltgeschichte existieren, so ist das noch ein großer Unterschied von Cazottes Prophetie, die jedem einzelnen Teilnehmer sein Ende vorhersagt. Gerade bei dieser überaus wunderbaren Weissagung kommt alles aufs Detail an und hiervon wissen wir gar nichts.
Zudem haben wir bisher noch keine unbedingt zuverlässigen Zeugnisse dafür, daß die Gerüchte bereits vor der Revolution umliefen. Gewiß könnte man aus dem Fehlen solcher Zeugen nichts gegen die Wahrheit folgern, denn es ist klar, daß man sich in stürmischen oder kritischen Zeiten hüten wird, solch gefährliche Prognosen zu verbreiten. [S. 313]Aber das genügt uns nicht. Die ein Menschenalter später ausgestellten Beglaubigungen sind aber nicht beweiskräftig genug.
Deshalb kann uns auch das fünfte Zeugnis nicht genügen, wiewohl es an tatsächlichen Angaben so ungefähr alles enthält, was wir nur wünschen können. Es handelt sich um die schriftliche Bekundung des Barons Delamothe-Langon des Inhalts, daß eine Gräfin Beauharnais als Teilnehmerin an jener Abendgesellschaft ihm und vielen anderen Personen, die 1833 bei Abgabe dieses Zeugnisses noch lebten und es bezeugen konnten, die Wahrsagungen Cazottes in der Wiedergabe Laharpes als echt bestätigten. Allerdings erfahren wir auch hier weder, wo diese Abendgesellschaft stattgefunden hatte, noch auch in welchem Jahre die Gräfin Beauharnais dieses Zeugnis abgelegt hat. Wir freuen uns immerhin darüber als neuerliche Bestätigung dafür, daß Weissagungen, die auf Cazotte zurückgeführt wurden, kursierten.
So müßten wir also mit einem Non liquet schließen, wenn wir nicht noch ein 6. und wichtigstes Zeugnis, das Deleuze unbekannt war und von Bormann in seiner Bedeutung erstmalig voll gewürdigt wurde, heranziehen könnten.
Wir finden es in den Memoiren der Baronin Oberkirch, die als Tochter des Barons Waldner-Freundstein auf Schloß Schweighausen im Oberelsaß 1753 geboren wurde und sich mit dem Baron Oberkirch, in zweiter Ehe mit dem Grafen Montbrison vermählte. Die Denkwürdigkeiten dieser hochgebildeten Frau, die mit den bedeutendsten Zeitgenossen in Frankreich und Deutschland in Verbindung stand, wurden [S. 314]nach ihren eigenen Angaben in ihrem 35. Lebensjahre 1789 verfaßt. Sie erschienen zuerst 1852 in englischer Sprache, von ihrem Enkel Montbrison herausgegeben, und erst das folgende Jahr in französischer Übersetzung in drei Bänden.
Daß die letzte Zeile des Werkes wirklich noch 1789 geschrieben wurde, beweist der Schluß des 3. Bandes, der in Übersetzung lautet:
»Mein Werk ist zu Ende. Um die Welt möchte ich nicht der scheußlichen Morde gedenken, welche sich rings um mich ausbreiten, mit Verheerung drohend allem, was ich liebe und verehre. Ein Lebewohl also rufe ich dieser genußreichen Beschäftigung, den glücklichen Stunden, die ich schildernd verbrachte, zu; dahin seid ihr Tage, die ich in der Gesellschaft teurer Freunde genoß. Mein Herz sinkt, wenn ich die Wolken schaue, die am Horizont auftauchen und mit Unglück für unser unseliges Land beladen scheinen. In welchen unglücklichen Stunden habe ich unsere Kinder geboren! Eine von Unsternen erfüllte Zukunft scheint ihnen entgegen zu schreiten. Gott wende von uns die furchtbaren Vorzeichen!«
Daraus geht hervor, daß das Werk vor Ausbruch der wirklichen Revolution mit allen ihren Schrecknissen beendet wurde, augenscheinlich bald nach dem Sturm auf die Bastille, deren erschütternden Eindruck wir in diesen Zeilen nachklingen fühlen.
In diesem Werk nun, das nach Angabe der Verfasserin und, wie eben gezeigt, auch aus inneren Gründen im Jahre 1789, also vor der eigentlichen Revolution und jedenfalls vor Eintreffen der in der Prophezeiung Cazottes vorhergesagten [S. 315]Ereignisse beendet war, heißt es im letzten Kapitel, daß »viele Personen die Prophezeiungen Cazottes angehört hätten, deren Realität zu bezweifeln unmöglich sei«.
Ferner berichtet die Verfasserin über ein merkwürdiges Erlebnis aus den letzten Tagen von 1788 oder dem Beginn des folgenden Jahres, das ihre bereits damalige Bekanntschaft mit schriftlichen Aufzeichnungen Laharpes über die bewußten Prophezeiungen Cazottes bezeugt.
In Straßburg bei dem Marquis de Puységur, dem Entdecker des Somnambulismus, wohnte die Baronin Oberkirch Experimenten mit einer bedeutenden Somnambulen, einem jungen Mädchen aus dem Schwarzwalde, bei, als der Maréchal de Stainville hereintrat und das Ersuchen stellte, die Somnambule einige Minuten zu befragen. Diese aber sagte ihm, daß sie den Grund seines Kommens wisse: er wolle sie über die Zukunft Frankreichs befragen und sei über das Schicksal der Königin besorgt. In der Tat wollte der Marschall sie das fragen.
Zitieren wir nun die Baronin Oberkirch[158]!
»Das ist vollkommen wahr,« sagte Herr von Stainville verwundert.
Damals sprach jeder Mensch von den Prophezeiungen des M. de Cazotte[159], und die Mehrzahl der Leute war geneigt, sie für Träume oder [S. 316]Wahngebilde einer überreichen Einbildungskraft zu halten. Der Marschall dachte, dies sei eine gute Gelegenheit, um sie auf ihre Wahrheit hin zu prüfen, und frug das Mädchen, ob sie sich je erfüllen würden.
Gerade als er seine Frage beendet hatte, öffnete sich die Tür, und es trat der Marquis de Peschery ein, dem wir erklärten, was vorging. Darauf wiederholte der Marschall seine Frage.
»Bevor ich antworte, muß ich nachdenken,« sagte das Mädchen. »Diese Dinge sind so wichtig und gegenwärtig noch so verworren.«
»Sagen Sie mir nur, ob die Prophezeiungen, welche ich gehört habe, sich erfüllen werden, und ob ich daran glauben kann?«
»Sie können an alle glauben,« antwortete sie ohne zu zögern.
Wir sahen uns entsetzt an, und ich gestehe, daß ich zitterte, da ich erst am Abend vorher M. de Cazottes Prophezeiungen gelesen hatte, welche mir von der Großherzogin geschickt worden waren. –
»Was,« sagte der Marschall, »alle diese Dinge sollen sich wirklich ereignen!«
»Alle und mehr noch.«
»Wann?«
»Von heute an in einigen Jahren.«
»Können Sie die Zeit nicht genau angeben?«
Sie zögerte einige Augenblicke und sagte dann: »Sie werden noch in diesem selben Jahre beginnen und werden vielleicht ein Jahrhundert lang andauern.«
»Wir werden demnach deren Erfüllung nicht erleben?«
[S. 317]»Viele von Ihnen werden den Anfang nicht sehen.« Das war eine schreckliche Ankündigung.
Nach einer kleinen Weile sagte der Marschall: »Was geht jetzt in Frankreich vor?«
»Eine Verschwörung ist im Gange, und der, welcher verschwört, wird das Opfer seiner eigenen Schlechtigkeit werden. Eine Weile lang wird er triumphieren, aber sein Geschick wird das seiner Opfer sein. O mein Gott! Mein Gott! Welch Ströme von Blut! Es ist zu grauenhaft.«
»Sie sind sicher, daß das vielen erhabenen Persönlichkeiten prophezeite Geschick sich erfüllen wird?«
»Ich bin es.«
»Was, sie werden eines gewaltsamen Todes sterben?«
»Sie werden eines gewaltsamen Todes sterben.«
»Und ich! Werde ich teilhaben an den meiner Familie prophezeiten Unglücksfällen?«
»Sie werden es nicht.«
»Ach! Werde ich mich abseits von diesem Getümmel (mélée) halten? Das würde einem alten Soldaten, wie mir, nicht passen.«
Die Somnambule schwieg.
»Was wird mein Schicksal sein?«
Sie wollte nicht antworten.
»Sie fürchten sich, es mir zu sagen. Meine Freunde werden geköpft werden, und vielleicht blüht mir etwas Schlimmeres. Werde ich gehenkt? Das wäre ein Schicksal, unwürdig eines Kavaliers. Aber sprechen Sie; der Tod und ich sind alte Bekannte; wir haben uns oft ins Angesicht gesehen.«
Während einer langen Weile weigerte sich das [S. 318]Mädchen zu antworten, aber auf die Bitte des Marschalls bestand Herr de Puységur auf ihrer Antwort.
»Armer Herr!« sagte sie langsam, »warum frägt er mich, was er in einigen Monaten selbst wissen wird?«
»In einigen Monaten?« sagte der Marschall. »Werde ich in einigen Monaten sterben? Ach! Um so besser, so werde ich den Ruin und die Entehrung Frankreichs nicht sehen. Ich danke Gott dafür; werde ich in meinem Bett sterben?«
»Sie werden,« sagte sie, aber mit so leiser Stimme, daß wir sie nur mit Mühe hören konnten.
Aus dieser Aussage folgt mit einer jeden Zweifel ausschließenden Sicherheit, daß gleich nach der bewußten Abendgesellschaft, auf der Cazotte durch seine Prophezeiungen allgemeines Entsetzen verursacht hatte, die Vorgänge aufgezeichnet wurden. Denn, wie Laharpe selbst erzählt, fand die Gesellschaft 1788 statt, während der Séance beim Marquis de Puységur am Schlusse des gleichen oder zu Beginn des nächsten Jahres abgehalten wurde[160]. Damals aber war der Bericht Laharpes aus Rußland bereits wieder zurückgekehrt.
Die Beweiskraft des bereits 1789, also, um es nochmals zu konstatieren, vor Eintritt der Ereignisse schriftlich abgelegten Zeugnisses ist absolut. Dadurch wird aber auch den früher genannten Bestätigungen Sanktion erteilt. Und zwar sowohl den Gewährsmännern, die vor der Revolution aus Laharpes [S. 319]Munde die Erzählung jener Wahrsagungen in Übereinstimmung mit seinem posthumen Bericht vernommen haben wollen, als auch den Zeugen, die von anderen Teilnehmern der bewußten Abendgesellschaft von solchen Prophezeiungen Cazottes hörten.
Nun ist noch eine Inkongruenz zu beseitigen, die auf den ersten Blick recht frappierend wirkt. Wir bewiesen aus den Memoiren der Frau von Oberkirch soeben, daß Laharpe die Aufzeichnung von Cazottes Prophezeiungen sehr bald nach der Gesellschaft, jedenfalls aber noch im gleichen Jahre, niedergeschrieben haben muß. Denn schon 1788 sandte er sie nach Rußland. Und doch beginnt der Bericht mit den Worten: »Es dünkt mich, als sei es gestern geschehen und doch geschah es im Anfang des Jahres 1788.« Daraus geht hervor, daß schon Jahre darüber hingegangen waren, als Laharpe diese Zeile schrieb.
Hier ergibt sich also ein scheinbar unlöslicher Widerspruch.
Wie, wenn Laharpe nach vielen vielen Jahren das Originalmanuskript wieder hervor holte und ihm nun diese Zeilen der Einleitung vorausschickte?
Das ist gewiß möglich. Wahrscheinlicher ist aber etwas anderes: Laharpe hat auf Grund seines wahrheitsgetreuen Berichtes nach Jahren einen, Wahrheit mit Dichtung verquickenden, gemacht und dieser ist es, den wir vor uns haben. Vielleicht schrieb er ihn nur aus dem Gedächtnis nieder, da ja das Original in Rußland war. Sehr groß kann die Abweichung aber nicht sein, da Bormann mit Recht es als unglaublich bezeichnet, daß Laharpe eine unechte Darstellung [S. 320]gab, nachdem er vor Jahren durch die echte die Welt in Staunen versetzt hatte[161].
Mit dem Einwurf, die Gräfinnen Genlis und Beauharnais bestätigten ausdrücklich die Übereinstimmung von Laharpes Erzählung mit dem gedruckten Text, finden wir uns leicht ab. Denn selbst ein gutes Gedächtnis wird das nach Jahren nicht mehr zu konstatieren vermögen. Zwingend allerdings geht sowohl aus diesem Zeugnis, wie aus dem anderen hervor, daß auch die echte Prophezeiung Cazottes, bzw. der authentische Bericht von Laharpes Hand, nennen wir ihn die erste Redaktion, genug der verblüffenden Vorhersagen enthielt die nachher in Erfüllung gingen.
Da die Baronin Oberkirch so wenig wie die anderen Zeugen auf die Details eingehen, fehlt uns die Möglichkeit, die Laharpesche Prophezeiung mit dem ersten Bericht von Cazottes Seherworten zu vergleichen. Wir können also unmöglich den uns vorliegenden Bericht einfach mit dem tatsächlichen Vorkommnis identifizieren.
Was wir aber können, ja müssen, ist die Feststellung, daß Cazotte bereits vor der großen Revolution diese vorhergesagt hat, und zwar auch mit schrecklichen und später in Erfüllung gegangenen Einzelheiten, so der Hinrichtung der Königin und anderen illustren Personen. Möglich ist, daß ja alles sich so verhielt, wie es Laharpe uns hinterließ. Aber es ist nicht gewiß. Gewiß aber ist auch, daß wir in der Prophezeiung des Cazotte eine der bedeutendsten [S. 321]der Geschichte zu erblicken haben. Denn es ist, wie Bormann richtig betont, vollkommen ausgeschlossen, daß zwischen den Vorhersagen Cazottes und der folgenden Erfüllung größere Inkongruenzen liegen. Denn Laharpe hätte damit einen Propheten, dessen Vorhersagen vielen Zeitgenossen bekannt waren, nicht gefeiert, sondern lächerlich gemacht. Als Ganzes, darüber kann gar kein Zweifel mehr obwalten, ist daher die Cazottesche Prophezeiung historisch und durch die nachfolgenden Tatsachen bestätigt worden. Wenn wir auch nicht berechtigt sind, jeden einzelnen Zug als beglaubigt anzusehen, so geht doch Hübbe-Schleiden mit der Annahme, daß Cazotte zu verschiedenen Zeiten und privatim den genannten Personen ihr trauriges Schicksal vorhergesagt habe, unbedingt zu weit. Die Gesellschaft hat stattgefunden.
Greifen wir nun noch einmal auf Laharpes oben zitiertes Nachwort zurück, das leider nur als Bruchstück auf uns gekommen ist!
Ihr Sinn ist zweifellos der, daß den ewig Blinden, denen die furchtbaren Ereignisse der großen Revolution nicht die Augen darüber geöffnet haben, daß durch Gott die größten Wunder gewirkt werden, auch nicht gedient ist, wenn die Vorhersage der Schrecknisse auf Wirklichkeit beruht. Denn das ist das geringere Wunder, das größere aber – in des frommen Laharpe Augen – wäre die zeitlich unglaublich rasche Folge der grauenhaftesten Begebenheiten und noch dazu die Zusammendrängung so vieler Personen, denen das alles widerfuhr, an demselben Orte.
[S. 322]Es läßt sich nicht leugnen, daß sich Laharpe in dem Satz: »Voilà le prodige réel comme la prophétie n’est que supposée« mißverständlich ausgedrückt hat. Bormann übersetzt meines Erachtens richtig: »Seht, das ist das reale Wunder, so wie die Prophezeiung bloß vorausgesetzt ist,« und fährt dann fort: »Laharpe setzt also das Wunder der handgreiflichen Tatsachen, die ein jeder mit seinen Sinnen tasten konnte, dem Wunder einer Prophezeiung mit inneren Vorgängen des Sehers gegenüber, die eben nur zu glauben sind. Etwas Vorausgesetztes, Angenommenes, Geglaubtes bleibt ja die Echtheit und das ›Wunder‹ jeder Prophezeiung, insofern der Zusammenhang zwischen ihr und dem entsprechenden Ereignisse als Probe geheimnisvoller Geisteskraft, welche den Zufall ausschließt, von uns erst aufgefaßt wird und nicht unmittelbar mit sinnlicher Bestimmtheit wahrgenommen werden kann. Das Wort ›supposer‹ bedeutet aber zuweilen, obwohl seltener, auch: ›unterschieben, fälschen.‹ Es muß zugegeben werden, daß es ohne Würdigung aller Umstände, das eine hier so gut bedeuten konnte, wie das andere. Der letzte Satz des Nachwortes werde noch einmal wiederholt. Er heißt: ›In diesem Falle‹, d. h. gemäß den vorhergehenden Worten Laharpes: ›Wenn ihr die besondere Furchtbarkeit dieser Revolution in ihrem Unterschiede von allen anderen nicht faßt.‹ – »In diesem Falle würde sogar die Prophezeiung, wenn sie stattgefunden hätte, höchstens ein Wunder sein, das für euch nur verloren wäre wie für die anderen, und das wäre dann das schlimmste Unglück. – Gerade dieser Satz scheint mir, trotz dem eingestreuten Bedingungssatz, der wohl [S. 323]das Urteil flüchtiger Beurteiler gefangen nehmen mag, sehr kräftig für die Echtheit der Prophezeiungen zu sprechen. Laharpe sagt deutlich hier, er wolle über die Echtheit der Weissagungen gar kein Wort verlieren, weil ihm das als das schlimmste Unglück erschiene, wenn die Prophezeiung in ihrer Echtheit den ewig Blinden, welche nicht einmal die Wunderstimme der Geschichte hören, als Wunder höchstens doch verloren sein würde. Die aber, meint er, welche die Taten der Geschichte als Wunder begreifen, werden auch an dem viel geringeren Wunder der Prophezeiungen kaum zu zweifeln brauchen.«
So weit Bormann, dem wir uns anschließen.
Für uns wäre es natürlich von allerhöchstem Interesse zu wissen, in welchem Umfange der Wortlaut der echten Vorhersage Cazottes mit der Niederschrift Laharpes übereinstimmt. Das festzustellen ist uns nicht möglich, wohl aber in der Zukunft nicht ausgeschlossen, da ja der Originalbericht Laharpes an die Großfürstin Maria Feodorowna geborene Prinzessin Sophie Dorothea von Montbéliard vielleicht noch einmal ans Tageslicht gefördert wird.
Bis dahin müssen wir uns mit der Feststellung begnügen, daß Cazotte tatsächlich die große Revolution und sogar einzelne Details aus ihr vorhergesehen hat.
Als weitere Zeugnisse für Cazottes Prophezeiung führt Hübbe-Schleiden (l. c. S. 75 ff.) an: 1. Die Memoiren der Du Barry, der letzten Mätresse Ludwigs XV., die der Herausgeber E. L. de la Motte Houdancourt in der Vorrede zur 2. Aufl., Paris 1829, als »historischen Roman« bezeichnet. Da er aber in der Nachschrift [S. 324]zum 4. Bd. (S. 450 f.) erklärt, daß es sich durchweg um originale Aufzeichnungen handle, die er nur sprachlich modernisiert habe, kommt ihnen wohl doch Glaubwürdigkeit zu. Sie schreibt (Bd. VI, S. 391): »Dann erzählte mir die Herzogin de Gramont eines Abends, als sie Cazotte in einer großen Gesellschaft getroffen habe, sei man in ihn gedrungen, die Planeten zu befragen nach dem Schicksal der Anwesenden. Dies habe er durchaus abgelehnt und jede nur erdenkliche Ausflucht gesucht. Jedoch als man unbedingt die Wahrheit habe wissen wollen, sei soviel herausgekommen: daß kaum einer von der ganzen Gesellschaft einem gewaltsamen und öffentlichen Tode entgehen werde, und daß auch der König und die Königin nicht ausgenommen sein würden.« Natürlich ist der Ausdruck »die Planeten befragen« ganz falsch.
2. Die Memoiren der Marquise de Créquy (1719 bis 1803), die von einem Individuum namens Couson als »Souvenirs de 1710 à 1803 par la Marquise De Créquy« 1834/35 in 7 Bänden erschienen und sehr viele Fälschungen enthalten. Es befinden sich hier mehrere auf Cazottes Prophezeiung bezügliche Stellen. S. 43 f. des VIII. Bandes der Ausgabe von 1840 lautet: »Es ist wahr, daß Cazotte der Herzogin de Gramont eine schreckliche Prophezeiung gemacht hat in Gegenwart der Damen de Simiane und de Tessé. Aber soweit ich mich deren erinnere, war sie keineswegs so genau, wie man es nach den Angaben vermuten könnte, die La Harpe davon machte, seitdem er aus dem Gefängnis entlassen ist . . .«
[143] Jaques Cazotte, geb. 1719, war ein fruchtbarer Schriftsteller. Er war sehr fromm, beschäftigte sich mit mystischen Studien und trat zur Sekte der Martinisten über. Er hatte häufig Visionen. Seine berühmtesten Werke sind das Schlummerlied »Tout au beau des Ardennes«, das Rittergedicht »Olivier« (Paris 1762, 2 Bde.) und »Le diable amoureux« (Paris 1772), ein Märchen, das heute noch gelesen wird. Seine Gewandtheit im Versemachen bewies er, als er in einer einzigen Nacht einen siebenten Gesang zu Voltaires »Guerre civile de Genève« hinzudichtete. Seine Gesamtwerke erschienen unter dem Titel »Oeuvres badines et morales, historiques et philosophiques de Cazotte«, Paris 1816–17, 4 Bde. Als ausgesprochener Feind der Revolution wurde er am 10. August 1792 gefangen gesetzt. Als man ihm zur Rettung durch seine Tochter, die ihn mit heroischem Mute den Händen der Mörderbande entriß, gratulierte, sagte er: »In drei Tagen werde ich guillotiniert.« Er schilderte ein ausführliches Gesicht seiner Abführung vor das Revolutionstribunal und seiner Hinrichtung. Er war seiner Sache so gewiß, daß er alle seine Angelegenheiten ordnete und die letzten Grüße an seine Frau bestellte. Am 25. Sept. 1792 fiel sein Haupt unter dem Fallbeil. Das Original »Prophétie de Cazotte, rapportée par Laharpe«, gedruckt in Laharpe, »Oeuvres choisies et posthumes«, 1806, I, p. XXI–XXVI.
[144] Jean François de Laharpe, geb. 1739, einer der besten Stilisten der französischen Literatur, war anfangs ein Freund, nachdem er 1794 fünf Monate im Gefängnis gesessen hatte, heftigster Gegner der Revolution. Von seinen zahlreichen Bühnenwerken sind die Tragödie »Warwick« (1763) und das Drama »Mélanie« (1770) die bedeutendsten. Besonders geschätzt waren seine Vorlesungen über Literatur, die unter dem Titel »Lycée ou Cours de Littérature« (Paris 1799 ff.) erschienen. Er starb 1803.
[145] Johann Heinrich Jung genannt Stilling, »Theorie der Geisterkunde«, Frankfurt und Leipzig 1808, S. 122 ff. Die Übersetzung ist von mir etwas korrigiert. Abdruck auch in Bormanns »Nornen«, S. 173 ff. Die dort befindlichen Noten sind hier wiederholt verwertet.
[146] Sebastien Chamfort (1741–1794), durch geistreiche Konversation, kaustischen Humor und Zynismus ausgezeichnet, unterstützte die Revolution literarisch und wurde Sekretär des Jakobinerklubs. Angewidert von der Schreckensherrschaft wurde er verhaftet, dann wieder in Freiheit gesetzt. Einer ihm drohenden neuerlichen Verhaftung entzog er sich durch einen Selbstmordversuch, an dessen Folgen er starb.
[147] Marie Jean Marquis de Condorcet (1743–1794), Mathematiker, stimmte in der Assemblée nationale meist mit den Girondisten. Er wurde im Oktober 1793 von der Bergpartei als Mitschuldiger des Girondisten Brissot angeklagt, hielt sich fünf Monate versteckt und wurde dann verhaftet. Man fand ihn am ersten Morgen seiner Gefangenschaft, wahrscheinlich vergiftet, tot am Boden liegen.
[148] Bekannter Arzt.
[149] Nicht zu identifizieren.
[150] Jean Bailly, (1736–1793) Astronom, war Präsident der ersten Assemblée nationale und Maire von Paris. Den Jakobinern verdächtig geworden, zog er sich zurück, ward aber in der Schreckenszeit verhaftet und guillotiniert.
[151] Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (1721–94) war Jurist und Staatsmann von seltener Gerechtigkeit und Freimütigkeit. Er trat der Willkür des Absolutismus schon unter Ludwig XV. entgegen und wurde unter Ludwig XVI. zweimal Minister, ohne jedoch mit seinen edlen Absichten durchdringen zu können. Als dem König der Prozeß gemacht wurde, verteidigte er ihn vor dem Konvent und flehte nach der Verurteilung um einen Appell an das Volk. Als er nach der Hinrichtung des Königs den Konvent heftig angriff, wurde er mit seiner Familie festgenommen. Er verteidigte nur die Seinen, nicht sich selbst und starb mutig auf dem Schaffot.
[152] Jean Antoine Roucher, (1745–94), mittelmäßiger Dichter, der die Gräuel der Revolution heftig bekämpfte. Er wurde nachts verhaftet und schnell hingerichtet, nachdem er sich noch am Tage vor seinem Tode für seine Familie hatte malen lassen.
[153] Jung-Stilling, Theorie der Geisterkunde, S. 149 f.
[154] Hübbe-Schleiden z. B. kommt in den Psychischen Studien, XXXVIII. Bd. 1911, 1. und 2. Heft, aus psychologischen Erwägungen zum entgegengesetzten Resultat. Er schreibt (S. 22): »Die Schilderung dieses Auftrittes ist ein elendes Machwerk im Stile eines Hintertreppenromans ohne irgendeine seelische oder geistige Feinheit darin. Die dichterische Erfindung ist so plump wie unwahr, sie ist dramatisch sensationell, aber nur eine abgeschmackte Effekthascherei . . .« Natürlich beweist dieses Urteil nicht mehr gegen die Prophezeiung, als Jungs Darlegungen für sie.
[155] »Nornen«, Leipzig 1909, S. 182 ff. Die Übersetzung weiter unten nach Bormann.
[156] Vgl. Jung-Stilling, »Theorie der Geisterkunde«, S. 130 ff. Das Gesicht Cazottes vor seiner Hinrichtung ist recht mitteilenswert. De N. . . berichtet Cazottes Worte: »Ja, mein Freund! In drei Tagen sterbe ich auf dem Schaffot.« Indem er dies sagte, war er innigst gerührt und setzte hinzu: »Kurz vor Ihrer Ankunft sah ich einen Gensdarmen hereintreten, der mich auf Befehl des Pethion abholte; ich ward genötigt, ihm zu folgen; ich erschien vor dem Maire von Paris, der mich in die Conciergerie abführen ließ, und von da kam ich vor das Revolutionsgericht. Sie sehen also – (aus diesem Gesicht nämlich, das Herr Cazotte gehabt hatte) – mein Freund! daß meine Stunde gekommen ist, und ich bin so sehr davon überzeugt, daß ich alle meine Geschäfte in Ordnung bringe. Hier sind Papiere, an welchen mir viel gelegen ist, daß sie meiner Frau zugestellt werden; ich bitte Sie, ihr dieselben zu übergeben und sie zu trösten.« Alles traf ganz genau nach den Vorhersagen ein. Jung-Stilling, S. 131. Dieser Bericht, soweit er die Todesahnung Cazottes betrifft, trägt in so hohem Grade den Stempel der Wahrheit an sich, daß wir ihn auch glauben müßten, wenn ihn nicht – wie wir weiter unten sehen werden – Cazottes Sohn noch ausdrücklich bestätigte. Jungs Quelle ist eine in Frankfurt bei Silbermann gedruckte Broschüre »Merkwürdige Vorhersage, die französische Schreckens-Revolution betreffend: Aus den hinterlassenen Papieren des Herrn La Harpe . . .«
[157] Der bekannte Arzt und Magnetiseur Joseph Phil. Deleuze hat in seiner 1836 erschienenen Schrift »Mémoire sur la faculté de prévision« mehrere solche Zeugenaussagen gesammelt, die wir nachstehend, im Anschluß an Bormanns »Nornen«, S. 185 f., wiedergeben. Die Originalausgabe war mir nicht zugänglich.
[158] Memoirs of the Baronesse d’Oberkirch, Countes de Montbrison, III. Bd., London 1852, S. 301 ff. Der oben zitierte Schluß steht p. 317 f.
[159] Nächst dem Folgenden von mir gesperrt. Die unten genannte »Großherzogin« ist die Großfürstin Maria Feodorowna.
[160] Wir haben keinen Grund, zu zweifeln, daß Laharpe selbst schon damals den Bericht verfaßt hatte. Was den angekündigten Tod Stainvilles betrifft, so trat er tatsächlich bald nach der Sitzung ein.
[161] Vgl. Bormann, Psychische Studien, 38. Jahrgang, 1911, S. 174 f.
[S. 325]
Frau von Ferriëm (dies der Mediumname), eine in Berlin wohnende Dame mit der Gabe des räumlichen und zeitlichen Fernsehens, hat fast täglich Visionen, über die sie in ihrem Büchlein »Mein geistiges Schauen in die Zukunft« berichtet. Neben den abenteuerlichsten Gesichten: über den Untergang des Mohammedanismus (S. 81), den kommenden Weltreformator (S. 88), einen neuen König in Jerusalem (S. 91), den Sieg des Christentums in Ostasien (S. 93) oder gar über den Untergang des Papsttums, eine neue Zeitrechnung und eine »neue Erde« (S. 98 f.), Visionen, deren religiös-phantastischer Inhalt uns die Weisheit der alten Theologen bewundern läßt, die die Unmöglichkeit von den Glauben betreffenden Prophezeiungen behaupteten, finden sich profane von allerhöchstem Interesse.
Das möge die nachstehend angeführte Reihe von Beispielen beweisen!
Die »Zeitschrift für Spiritismus«, vom 24. Juni 1899[162] brachte folgenden Artikel:
[S. 326]In Nr. 46, Jahrgang 1898, der amerikanischen Wochenschrift »Lichtstrahlen«, Zeitschrift für Philosophie, Wissenschaft usw. West-Point, Nebr., befindet sich folgender Redaktionsartikel[163]:
Erfüllte Voraussage. Im Juniheft der in Leipzig erscheinenden »Psychischen Studien« finden wir eine Notiz, in der über einen Artikel in dem »Illustrierten Wiener Extrablatt« Nr. 114 vom 26. April 1898 bezüglich der Aussagen der Berliner Seherin berichtet wird. In derselben lautet ein Ausspruch der Seherin, welche über eine blutige Zukunft in Deutschland, Krieg und viele Duelle in Frankreich berichtet, wie folgt: »Ich sehe viel Blut in Frankreich; Dreyfus kommt von der Insel fort.« – Dies wurde im April 1898 gegeben, als noch niemand eine so große Bewegung zu Gunsten Dreyfus, wie sie augenblicklich in ganz Frankreich im Gange ist, ahnen konnte, und scheint bereits in Bezug auf Dreyfus seine Bestätigung gefunden zu haben; denn den neuesten telegraphischen Meldungen nach zu urteilen, scheint Dreyfus nicht mehr auf der Teufelsinsel zu sein und bereiten sich in Frankreich unangenehme Dinge vor.
Zu der Zeit als die »Lichtstrahlen« diese Mitteilung brachten (23. September 1898), hatte Dreyfus [S. 327]indes die Insel noch nicht verlassen; jedoch nunmehr – am 8. Juni 1899 – ist die bezügliche Weissagung der Berliner Clairvoyante (de Ferriëm) eingetroffen.«
Das heißt mit anderen Worten: Frau de Ferriëm hat nachweisbar, und zwar durch vorher im Druck erschienene Voraussagen, die Freilassung des Hauptmann Dreyfus 1½ Jahre vor ihrem Eintritt prophezeit.
Im Januar 1898 erschien in den »Neuen Spiritualistischen Blättern« in Berlin folgender Visionsbericht der Frau de Ferriëm:
Brand im Hafen von New York. (Die Seherin blickt anscheinend auf einen ca. 5 Meter von ihr entfernten Punkt des Fußbodens starr mit weit geöffneten Augen hin und spricht darauf nach wenigen Augenblicken stillen Verhaltens in dieser Stellung folgendes):
»Das ist ein großer Brand, ein mächtiges Feuer. So viele Schiffe. Es brennt ein Schiff. (Das Medium senkt das Haupt und schließt die Augen dabei.) Alles schwarzer Rauch, kohlrabenschwarzer Rauch; o, und wie dick! Das ist am Land. Das brennt im Hafen. Oh, o, das ist aber schlimm. (Hebt den Kopf etwas und senkt ihn wieder. Dann schlägt es die Augen auf und sagt): Nimm ab, nimm mal das Tuch ab[164]. (Noch etwas benommen, ruft sie darauf): Ist ein Riesenbrand in New York. Ich sehe ihn ja.« (Das Medium war schon in New York und hat daher die in der Vision erschaute Stadt jedenfalls als New York erkannt.)
[S. 328]Eine weitere, dasselbe Ereignis betreffende Prophezeiung erschien u. a. im Maiheft 1899 der »Psyche«, Berlin, und im Juniheft 1899, der »Übersinnlichen Welt«, S. 205, Anm., Berlin, gelegentlich eines Visionsberichtes der Dame über Ereignisse im 20. Jahrhundert. Sie lautet:
»Ich sehe ein brennendes Schiff im Hafen von New York und höre einen furchtbaren Knall. Soviel ich sehe, ist es kein amerikanisches Schiff. Die Stadt ist New York; ich irre mich nicht, weil ich sie genau von meiner Amerikareise her kenne.«
Bekanntlich traf diese doppelte Prophezeiung am 30. Juni 1900 ein. Damals ereignete sich die furchtbare Schiffbrandkatastrophe im Hafen von New York, durch die der Norddeutsche Lloyd schweren Schaden erlitt, aber keine amerikanische Gesellschaft geschädigt wurde. Das Feuer griff vom Hafen auf einen Teil der Hafenanlagen von Hoboken über.
Daß diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen war – was ja mit dem schlechtesten Willen niemand wird bestreiten können – konstatierte der New York »Herald« bereits am anderen Tage. Dieses große Blatt hatte auch am 25. April 1899 die Vorhersage der Frau von Ferriëm bereits publiziert gehabt[165].
Auch die furchtbare Erdbebenkatastrophe auf der Insel Martinique wurde von Frau de Ferriëm vorher gesehen.
Die »Zeitschrift für Spiritismus« brachte in ihrer Nummer 23 vom 7. Juni 1902 darüber folgenden Bericht:
[S. 329]Die furchtbare Katastrophe, von welcher die Antillen-Insel Martinique heimgesucht worden ist – durch die entfesselten Kräfte der Erde wurde am Himmelfahrtstage (1902) die Stadt Pierre und deren Umgebung, ein paradiesisch schöner Fleck Erde, vollständig verheert, wobei Zehntausende von Menschen auf die entsetzlichste Weise ihren Tod fanden – ruft folgenden Ausspruch der Berliner Somnambulen Ferriëm, welcher zuerst in der »Zeitschrift für Spiritismus« vom 24. Juni 1899 (S. 221), sowie weiterhin in der Schrift »Die Seherin (de) Ferriëm« Ausgabe 2, vom 20. September 1899, und in der »Spiritistischen Rundschau«, Berlin, Juli 1901, publiziert worden ist, lebhaft in Erinnerung:
»Berlin, 10. Mai (1899). (Die Clairvoyante nicht im Trance:) ›In wenigen Jahren wird sich ein großes Erdbeben ereignen. Es dürfte im Jahre 1902 sein. Ich habe es aus den Gestirnen berechnet. Ich könnte höchstens um ein Jahr zurückgerechnet haben. Die Sache differiert zwischen 3 und 4 Jahren; aber 4 Jahre werden nicht voll von jetzt an gezählt. Das Beben wird so furchtbar sein, daß selbst Kabelzerstörungen vorkommen werden.«
Die Voraussage wurde also genau drei Jahre vor der Katastrophe gegeben. Durch die Erwähnung der Kabelzerstörungen wurde in der Prognose darauf hingewiesen, daß das schreckliche Ereignis sich, wie geschehen, auch speziell am Meere abspielen würde. Infolge des den Eruptionen des Mont Pelé vorangegangenen und dieselben begleitenden starken Erdbebens zerrissen die Kabel, sodaß die Verbindung zwischen Martinique und der Außenwelt [S. 330]während der Katastrophe vollständig abgeschnitten war. Eine weitere Meldung besagt: Der Kommandant des Kreuzers »Suchet« hat die Stadt und die Umgebung durchforscht und berichtet, daß sich im nördlichen Teile der Insel große Spalten gebildet haben, daß das ganze Gelände sich in Bewegung befindet und daß sich plötzlich neue Täler bilden[166].
Man wird bei einiger Skepsis gegen diese Prophezeiung, deren hoher Wert ja gleichfalls darin besteht, daß sie vorher, noch dazu an mehreren Stellen, im Druck erschienen ist, einwenden, daß irgendmal an irgendeinem Ort der Erde mit Naturnotwendigkeit Erdbeben eintreten müssen. Das ist ja gewiß richtig. Da eine Ortsbezeichnung – auch nur ungefährer Art – fehlt, so käme ja der ganze Erdball in Frage.
Und doch ist dem entgegen zu halten, daß das Unglück von Martinique seit dem im Jahre 1883 erfolgten furchtbaren Ausbruch von Krakatau in der Sundastraße, der direkt oder indirekt auf der ganzen Erde sich bemerkbar machte, das größte seiner Art im letzten halben Jahrhundert war. Ferner, daß die Prophezeiung wenigstens zeitlich, wenn auch nicht örtlich, erstaunlich genau eintraf. Immerhin geben wir gerne zu, daß die vorher genannten Vorhersagen für die Tatsache, daß es Prophezeiungen bzw. Menschen gibt, die die Gabe des zeitlichen Fernsehens besitzen, beweiskräftiger sind.
Was übrigens den von Frau de Ferriëm gebrauchten Ausdruck »aus den Gestirnen berechnet« und »zurückgerechnet« betrifft, so bemerkt die Dame [S. 331]dazu, daß sie sich nicht mit astrologischer Berechnung befaßt und eine solche auch hier nicht vorliegt. Vielmehr meint sie damit die Deutung von Erscheinungen, die sie »mit geistigem Auge am Sternenhimmel beobachtete«[167]. Ich gebe zu, daß ich mir von diesem Modus des Hellsehens keine rechte Vorstellung machen kann. Doch das will ja um so weniger für die Sache selbst bedeuten, als uns der Weg, auf dem die Somnambulen zu ihren Prophezeiungen gelangen, zurzeit überhaupt noch dunkel ist.
Während die vorige Prophezeiung der Frau de Ferriëm den Ort mit Namen und der Szenerie nach genauestens angab, sowie den Verlauf der Katastrophe schilderte, ist diese interessant durch ihre Zeitangabe. Wie die Seherin sagt – und wie ja ein Vergleich der wiedergegebenen Prophezeiungen auch ergibt – kommen bestimmte Zeitangaben bezüglich des Eintreffens ihrer Gesichte fast gar nicht vor. Erfahrungsgemäß sind aber Zeitangaben von Sehern, auch wo sie gemacht sind, ziemlich unzuverlässig, und zwar aus einem sehr naheliegenden Grunde. Da es sich bei den Gesichten doch um räumlich anschauliche Vorgänge handelt, die die Aufmerksamkeit des Sehers ganz und gar auf sich ziehen, so verwirren sich eventuelle zeitliche Bestimmungen in allen derartigen Angaben leicht. Dazu kommt aber noch ein Moment: Je deutlicher die Vorgänge gesehen werden, desto näher steht – das ist aber natürlich nur Vermutung – ihr Eintritt bevor. Mag dieser Anhaltspunkt richtig sein, so fehlt doch ein fester [S. 332]Maßstab vollkommen. Es handelt sich naturnotwendig um eine Taxe. Wie sollte denn in einem räumlichen Bilde, sagen wir dem der Landschaft oder eines untergehenden Schiffes auch eine Zeitangabe unterzubringen sein? Höchstens daß neben die visuelle Vision noch eine akustische treten müßte, die das Datum zuruft. Oder daß durch Zufall etwa ein Abreißkalender mit bestimmtem Datum erblickt wird. Sonst ist ja der Natur der Sache nach eine bestimmte zeitliche Fixierung ausgeschlossen. Es kann sich – von seltenen Ausnahmen abgesehen – immer nur um approximative Schätzungen handeln. Aber auch sie sind aus inneren Gründen nur dann richtig, wenn ein und dieselbe Seherin aus zahlreichen Selbstbeobachtungen eine gewisse Praxis in der zeitlichen Fixierung eines räumlichen Bildes gewonnen hat.
Erfahrungsgemäß ist die Mehrzahl der Gesichte tragisch. Ob das daher kommt, daß das Tragische im Leben überwiegt, oder weil sehr unglückliche Ereignisse die Nerven am stärksten erregen? Genug, es ist so. Dabei zeigt sich aber, daß häufig ein Ereignis nach der schlimmen Seite hin noch übertrieben wird.
Frau de Ferriëm führt als Beweis dafür die Vorhersage des im Mai 1897 eingetroffenen furchtbaren Brandes des Wohltätigkeitsbazars in Paris an[168].
Diese Katastrophe wurde unter anderm auch in dem in England weitverbreiteten, Prophezeiungen für das laufende Jahr enthaltenden Volkskalender »Old Moores Almanack« vorhergesagt. Die betreffende [S. 333]Stelle in der bereits 1896 erschienenen Ausgabe für 1897 lautet: »Fast mit Sicherheit werden wir in den letzten Tagen des April eine Nachricht von einem furchtbaren Feuer in Paris hören, welches viele Menschenopfer verschlingen wird, während eine Schar Banditen unter den Trümmern Beute zu machen suchen wird.« Die Schar Banditen sind Irrtum. Frau de Ferriëm glaubt ihn damit erklären zu können, daß der Seher in der Vision Leute nach den Erkennungszeichen, Kleinodien und Leichenresten suchen sah. Für denjenigen, der die Existenz von Visionen, die wir uns etwa einer in unser Inneres verlegten Fata Morgana ähnlich vorzustellen haben, zugibt – und das muß doch wohl oder übel jeder, der die Macht der Tatsachen höher bewertet, als ein gegenwärtig noch herrschendes aber bald gleich anderem Gerümpel aus der Zeit des Materialismus ad acta gelegten Dogma – hat dieser Erklärungsversuch viel Wahrscheinlichkeit für sich.
Übrigens sei im Vorbeigehen bemerkt, daß »Old Moore« damals in seinem Kalender den Tod des Herzogs von Clarence auf den Tag vorausgesagt hat. Auch der Untergang der »Victoria« stand in seinem Kalender prognostiziert, nur irrte sich der Alte um eine Woche.
Daß Übertreibungen nach der schlimmen Seite hin an der Tagesordnung sind, ist nichts weniger als verwunderlich. Denn wenn wir einen großen Brand oder ein Unglück sehen, stellen wir es uns ja auch im ersten Schrecken fast ausnahmslos bedeutend schlimmer vor, als es in Wirklichkeit ist. Man lese nur die Unglücksfälle in irgendeiner Zeitung nach [S. 334]und wird finden, daß mit seltenen Ausnahmen die ersten Nachrichten stark übertrieben wurden, um erst allmählich ihre richtigen Dimensionen anzunehmen.
Am 15. Mai 1897 erschien im »Führer«, Milwaukee (Wisc.) und am 18. September 1897 in der »Kritik«, Wochenschrift des öffentlichen Lebens, Berlin, folgender Visionsbericht:
»Kohlengruben-Unglück bei Brüx (Dux), Böhmen.
Erstes Gesicht. (Die Dame schließt die Augen und spricht): Schrecklich, die Menschen alle hier bei der Grube! Wie bleich sie aussehen! – Wie die Leichen. – Ach, das sind ja auch lauter Leichen. Ja, sie kommen heraus und werden jetzt alle fortgebracht. Und die ganze Gegend ist so schwarz, und es sind lauter kleine Hütten da. Die Leute, die ich sehe, reden eine andere Sprache, auch verschiedene Sprachen, – alles durcheinander. Und so leichenblaß sind sie alle! – Jetzt wird da einer herausgebracht, welcher einen Gurt mit einer blanken Schnalle um hat. Es ist Weihnachten bald; eine Hundekälte. Dort ist einer, der hat eine Lampe mit einem Gitter. – Es ist ein Kohlenbergwerk. Es ist alles so schwarz und so kahl. Ich sehe bloß die alten Hütten. Die ganze Gegend ist so öde. – Ich verstehe, was der eine da jetzt sagt. Er sagt: »Die Ärzte kommen alle aus Brüx« . . . Ach, das ist ein böhmischer Ort . . . Siehst du denn nicht? (Ich sehe nicht) . . . Was? Du siehst nichts! (Letzteres sagt die Seherin sozusagen erschreckt und schlägt die Augen auf.)
Zweites Gesicht. (Am Nachmittage des auf [S. 335]die erste Vision folgenden Tages.) Wie traurig das hier aussieht! Die Menschen alle: O weh, so viele! – So viele Frauen sind da; wie sie weinen! Die Männer sind tot; es leben nicht viele mehr. Sie sind alle heraufgebracht worden. Ach, Gott, die Armen tun mir so leid! Sieh mal, die Kinder alle! Wie die Männer aussehen, sie sind ganz von Rauch geschwärzt, sind gewiß alle in der Erde erstickt. – Das sind Böhmen. Die Weiber und die Kinder haben Kopftücher um. Ja, das sind Böhmen. Ach, die armen Menschen nun gerade um die Weihnachtszeit. Ist doch schrecklich! – Mit solch einem Zug, der eben angekommen, bin ich schon gefahren. Da steht es dran; der kommt doch über Eger. Ja, es ist Böhmen. – Wie sie dort liegen! – Das sind wohl Ärzte, die da reiben? – Feine Männer. Viele haben Binden mit einem Kreuz um die Arme. – Was haben die Frauen und Kinder denn da in der Hand? Eine Kette. Wozu haben sie die Kette? Ach, sie bekreuzigen sich jetzt. Das ist ein Rosenkranz. Ach, sie beten; aber sie weinen doch alle! – An dem Eisenbahnzug sehe ich einen österreichischen Adler, einen Doppeladler. – Ach, das ist wohl ein Schaffner, der da steht? Ich höre, was er sagt. »In den Kohlengruben von Dux,« sagt er; ich lese aber Brüx. Der da hat’s an der Binde. – Ach, die sind von der Sanitätswache. – Aber sie können nichts machen mit den armen Menschen. Sie fahren sie alle auf so komischen Wagen fort. (Die Somnambule erwacht.)«
Diese Vision hatte Frau de Ferriëm[169] bereits im [S. 336]Jahre 1896. Vier Jahre später nun fand in den Kohlenbergwerken von Dux bei Brüx in Böhmen ein Gruben-Unglück statt, bei dem sehr viele Bergleute ums Leben kamen.
Da das Unglück aber nach der Mitte des September 1900 sich ereignete, so stimmt die Zeitangabe bezüglich Weihnachtszeit und Kälte nicht. Wie aber Godefroy, der die Vision nachgeschrieben hatte[170], dem Dr. Walter Bormann schrieb[171], dauerte die Herausschaffung der Leichen aus den Gruben mehrere Wochen. Noch Ende Oktober wurde bei starker Kälte eine Anzahl der Opfer zutage gefördert. Also ging diese Vision vollkommen in Erfüllung.
Diese Prophezeiungen sind für uns von unschätzbarem Werte aus dem naheliegenden Grunde, weil sie alle vorher im Druck erschienen sind, was ja leicht nachkontrolliert werden kann. Mag man auch zur Wahrhaftigkeit eines Zeugen, der das nachherige Eintreten einer Voraussage behauptet, das größte Vertrauen haben, so wird man doch die Möglichkeit eines Erinnerungsfehlers nie bestreiten können. Man wird auch gern einwenden, daß der betreffende nur [S. 337]von den Fällen spricht, die wirklich eintrafen, jene aber, die sich nicht erfüllten, verschweigt. Es wird sich also mehr oder minder immer um ein Glauben handeln. In unseren oben angeführten Fällen dagegen handelt es sich um ein Wissen. Das gibt ihnen eine ganz außerordentliche Bedeutung. Denn auch der größte Zweifler wird nicht leugnen können, daß es sich um ganz ungewöhnliche Ereignisse handelt, bei denen wir nicht leicht mit dem Zufall operieren können.
Bormann weist mit Recht auf die große Anschaulichkeit der angeführten Weissagungen hin. »Alles, was die Seherin angibt, stellt sich bewegt und farbenfrisch ganz unmittelbar dem Auge dar, und noch die Ortsbezeichnungen Dux und Brüx werden durch die Aufschriften am Eisenbahnzuge, durch die Binde eines Mannes und durch die mit dem Ohr vernommenen Worte eines Schaffners uns vermittelt. Auch bei solchem zeitlichen Fernsehen also ist hier nichts bloß abgezogenes Denken; alles ist ein Schauen des Lebens, und obwohl keine vorhandene Erscheinung der Gegenwart und noch nichts Wirkliches im menschlichen Sinne, wird es doch räumlich wahrgenommen, als ob diese Zukunft bereits sinnliche Gegenwart wäre[172].«
Bormann, der sich als Vorsitzender der »Gesellschaft für wissenschaftliche Psychologie« in München viel und gründlich mit diesen Phänomenen beschäftigte, sagt mit Recht, die Erklärbarkeit dieses zugleich zeitlichen und räumlichen Fernsehens sei ein schwer zu lösendes Rätsel. Wir wollen uns auch [S. 338]nicht darauf einlassen, sondern nur feststellen, daß, wenn uns überhaupt etwas diese Phänomene, an deren Existenz zu zweifeln nur wohl mehr Böswilligkeit noch vermag, verständlich machen kann, es solche authentische Berichte sind. Auch wir haben ja im Traum Ähnliches alle schon erlebt, nur handelt es sich hier um Vergangenes. Wenn wir aber den Vergleich des Traumes festhalten, dann werden uns sofort Irrtümer in der Interpretation der Visionen klar. Das Gesicht entschwindet oft, wenn wir einen bestimmten Punkt festhalten wollen. Es löst sich in Nebel auf, und im Bestreben, zu rekonstruieren, erfinden wir. Oder die Seherin sieht zwar eine Gegend ganz deutlich vor sich. Da sie aber nirgends, weder auf Stationschildern, noch auf Reklamen oder sonst wo den Namen des Ortes lesen kann, auch nicht ihn rufen hört oder das Gelände aus der Erinnerung wiederzuerkennen vermag, so hat sie zwar eine richtige Vision, weiß aber nicht, wohin den Schauplatz zu verlegen. Oder sie glaubt eine Gegend wiederzuerkennen und irrt sich dabei. Natürlich wird dann die Prophezeiung, weil irrig lokalisiert, auch nicht eintreffen. Solche und ähnliche Fehlerquellen existieren immer. Deshalb ist es desto verwunderlicher, wenn alles genau zutrifft.
Doch wir werden später noch auf dieses Thema zurückkommen. Wunderbarerweise sind wir nämlich noch keineswegs am Ende der eingetroffenen Prophezeiungen der Frau de Ferriëm angelangt.
Im Oktober 1900 wurde in Nr. 43 der »Zeitschrift für Spiritismus« (Köln) folgende Vision der Dame mitgeteilt:
[S. 339]»Es taucht vor mir eine schwarze Masse auf. – Was es ist? – Ich kann’s noch nicht deutlich erkennen. – Ja, so, ein Felsen im Meer, daran es zerschmettert ist. Sehe nämlich ein deutsches Kriegsschiff. Die schwarze Masse ist ein Teil des untergegangenen Schiffes. – Viele Menschen gehen beim Untergange desselben zugrunde. Ich sehe sie deutlich verzweifelt mit den Wellen kämpfen. Alles deutsche Matrosen. – Es ist bestimmt ein Kriegsschiff. Ich sehe den Kommandanten, wie er seine Hände zum Himmel hochstreckt. Er schreit noch seine letzten Befehle. Er trägt einen Bart, wie ihn Kaiser Friedrich trug, nur kürzer und ziemlich dunkel, fast schwarz. – Das Wasser ist fast ganz ruhig geworden. – – Ich sehe auch, daß es in fremdem Lande ist – – Naht denn keine Rettung? – Noch nicht. – Ein Schiff in Sicht. Hurra! – Und doch, es ist wenig Aussicht auf Rettung. – Und naht denn keine Hilfe? – Ja, ja, aber viel zu spät.« Godefroy hatte diese Prophezeiung von der Seherin stenographiert aus Österreich erhalten.«
Anderthalb Monate später, am 7. Dezember 1900, ging diese Vision mit dem Untergang des deutschen Schulschiffes Gneisenau in Erfüllung.
Bormann schreibt darüber[173]:
»Der ›Gneisenau‹ scheiterte am Felsen Morro Levante (im Vorhafen von Malaga). Sein Untergang traf auch in einzelnem erstaunlich mit der Weissagung überein. Der Schiffskommandant hob in der Tat [S. 340]seine Arme gen Himmel, indem er laut seine Mannschaften in Gottes Hut befahl. Es ist auch richtig, daß die Bemannung nicht mit dem Schiffe zugrunde ging; die Leute stürzten sich in die Wellen und gingen im Kampfe mit ihnen zahlreich unter. Der Bart des Schiffskommandanten Beckmann ist in der Tat gewesen wie der des Kaisers Friedrich, nur kürzer, wie Bilder ausweisen. Wie die Farbe des Bartes war, weiß ich nicht. Die Seherin sah das Gesicht ungewöhnlich deutlich und kündigte daher dessen schnelle Erfüllung an, wie es auch geschah.« Übrigens sah sie noch, daß das Schiff nicht völlig unter der Wasseroberfläche verschwand, wie es auch in Wirklichkeit der Fall war.
Daß gottlob der Untergang eines deutschen Kriegsschiffes zu den größten Seltenheiten gehört, ist hinlänglich bekannt. Aus diesem verblüffenden Zusammentreffen einer Reihe von ganz seltenen Fällen – man denke an den Bart des Kapitäns! – eine Wahrscheinlichkeitsrechnung zu konstruieren, dürfte jedoch auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen.
Eine Prophezeiung der Frau de Ferriëm über das lenkbare Luftschiff ist deshalb außerordentlich interessant und kann unbedenklich als Beweis für die Tatsache der Prophetie gelten, weil zur Zeit der Vision – 1899 – und auch noch viel später ein solches Fahrzeug von den ersten Autoritäten für unmöglich erklärt wurde. In vieler Erinnerung wird die schmähliche Behandlung sein, die noch drei Jahre später dem Grafen Zeppelin auf dem deutschen Ingenieurtage in Kiel zuteil wurde. Man verspottete ihn als Phantasten. Erst seit dem Jahre 1906 hatten seine Versuche Erfolg.
[S. 341]Wie das breite Publikum im Jahre der Vision (1899) dachte, geht u. a. aus der Faschingsnummer der Münchner Neuesten Nachrichten vom 12. Februar gleichen Jahres hervor. Da heißt es als Mitteilung aus dem Jahre 2899: »Aus St. Franzisko kommt uns folgende Lichtstrahlendepesche zu: Heute Nacht 11 Uhr 47 Minuten (Welteinheitszeit) ist das Luft-Expreßschiff Nr. 724 der »Union-Aero-Expreß-Companie-Comfortable« in 3000 m Höhe über Meer mit einem Meteor zusammengestoßen.«
Fast möchte man glauben, der Verfasser dieser Ulknotiz habe selbst die Gabe des Hellsehens besessen, denn bis auf das Vergreifen im Datum um fast ein Jahrtausend – man sieht daraus, wie entfernt, ja unmöglich die Zukunftsphantasie damals noch allen erschien – stimmt alles verblüffend. Die Höhe von 3000 m wurde inzwischen erreicht, der erste, zwar verunglückte, aber zum Teil auch gelungene Versuch des Überfliegens des Weltmeeres wurde im Herbst 1910 von Wellmann unternommen, ja – und das ist das Erstaunlichste – wir haben von ihm durch »Lichtstrahlendepeschen«, nämlich durch drahtlose Telegraphie, von der damals noch niemand eine Ahnung haben konnte – Mitteilung erhalten.
Doch nun zur Vision der Frau de Ferriëm. Der Bericht lautet:
»Das elektrische Luftschiff, das große, vollkommen lenkbare Luftschiff mit elektrischer Bewegung und Beleuchtung der Zukunft wird bald erfunden werden. Kapitäne werden Patent auf das Fahren mit diesem adlergleich dahin fliegenden oder segelnden Luftschiff erhalten, und man wird mit dem letzteren [S. 342]es dazu bringen, in zweimal 24 Stunden den Atlantischen Ozean zu überfliegen. Dasselbe wird so eingerichtet sein, daß, wenn in der Luft Unglück bei der Fahrt über das Meer passiert, man sich noch aufs Wasser retten kann. Die Erfindung wird vor 1950 gemacht und vervollkommnet sein; viele werden allerdings noch wegen Grübeleien darüber ins Irrenhaus müssen. Ich habe den Erfinder gesehen, wie er die erste Konstruktion vorführte; derselbe beherrschte mehrere Sprachen, die deutsche sprach er gebrochen. – Eine furchtbare Arbeit durch die Luft machte es, als ich’s über das Meer brausen sah. – Das ist der feurige Drache, von dem Propheten schon vor Christi Geburt sprachen[174].«
Erwähnen wir noch, daß neuerdings tatsächlich Patente, die zur Führung von lenkbaren Luftschiffen berechtigen, ausgestellt werden, so wird man nicht umhin können, die Prophezeiung im wesentlichen für erfüllt anzusehen, auch wenn man betreffs des biblischen feurigen Drachens sich etwas reserviert verhalten sollte.
Ferner hatte Frau de Ferriëm noch Visionen, die die Erreichung des Nordpols mit Luftschiffen und Schlitten betreffen. Die letztere Prognose ist ja schon in Erfüllung gegangen. Was die erstere betrifft, so scheint auch ihre Realisierung in die Wege geleitet zu sein, da bekanntlich Graf Zeppelin dieses Unternehmen plant[175].
[S. 343]Fassen wir unser Urteil über die Prophezeiungen der Frau de Ferriëm zusammen, so steht es fest, daß zwar eine Reihe von Prognosen nicht eintrafen bzw. noch nicht eintrafen, daß dafür aber andere in erstaunlicher Weise in Erfüllung gingen.
Wer die Visionsberichte liest, kann nicht darüber im Zweifel sein, daß es sich durchaus nicht um verstandesmäßige Berechnungen oder Vermutungen handelt, sondern um echte Visionen, um traumartige Bilder, die in der Seherin auf eine uns nicht näher bekannte Weise erzeugt werden.
Dem Einwand, es könne sich hier um Halluzinationen handeln, denen nichts Reales entspricht, muß entgegengehalten werden, daß wir keine einwandfreie Definition von Halluzination einerseits und Vision andrerseits besitzen[176]. Ferner handelt es sich hier durchaus nicht um »Erscheinungen«, von denen behauptet wird, daß sie außerhalb der Person der Seherin liegen sollen, sondern lediglich um Vorgänge in ihrem Innern, die nur kontrollierbar sind durch die Art, in der die Seherin von ihnen Kenntnis gibt [S. 344]und durch ihr späteres Eintreffen. Und dieses letztere kann für uns ganz allein ausschlaggebend sein.
Wenn es auch nicht mehr viele geben mag, die auf Grund obigen Materials noch Lust haben, die Eselsbrücke des Zufalls zu betreten, sondern wohl die überwältigende Mehrheit der Leser nunmehr von der Existenz des zeitlichen Fernsehens überzeugt sein wird, so muß doch auch hier die Möglichkeit des Zufalls geprüft werden.
An der Vorhersage des Seebebens von Martinique wird man das Fehlen der Ortsangabe rügen. Beim Untergang der Gneisenau gleichfalls. Was die Erreichung des Nordpoles betrifft, so kann man auf den prophezeiten Weg auch durch Berechnung kommen. Beim Hafenbrand in Neuyork dürfte es schon recht schwer fallen, mit der Kritik einzusetzen, denn da alle Vorhersagen der Frau de Ferriëm sich im Laufe weniger Jahre erfüllen, wird man kaum einwenden können, ein ähnliches Ereignis spiele sich früher oder später in jedem Hafen ab. Ebenso kann nur, wer den damaligen Stand der Frage gar nicht kennt, sich mit der Vorhersage des lenkbaren Luftschiffes leicht abfinden.
Besonders winden wird sich aber der Skeptiker bzw. materialistische Dogmatiker bei der Vorhersage des Grubenunglückes von Brüx-Dux. Gewiß läßt sich für jede Grube eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufstellen und so errechnen, wann an sie die Reihe kommt. Aber hier haben wir die ausdrückliche Konstatierung, daß die Katastrophe bald eintreten wird. Ja, als sie nach zwei Jahren noch aussteht, wird in verschiedenen Blättern darauf hingewiesen, daß sie [S. 345]nunmehr bald kommen müsse. Das soll ein zufälliges Zusammentreffen von Vorhersage und Ereignis sein?
Alle Vorgänge werden mit einer Deutlichkeit geschildert, wie sie nur ein Augenzeuge zu bieten vermag. Daß Traum und Vision, nicht aber Phantasie die Plastik und Greifbarkeit des sinnlich Wahrgenommenen besitzen, hat schon Schopenhauer festgestellt. Deshalb ist es schlechterdings ausgeschlossen, daß die von der Seherin geschauten Bilder Erzeugnisse ihrer überhitzten Phantasie sind, sondern wir haben es ganz unzweifelhaft hier mit echtem zeitlichen Fernsehen zu tun.
Leider ist es in allen obigen Fällen kaum angängig, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mit hohem Divisor aufzustellen. Um nun aber dem unverbesserlichen Skeptiker die letzte Möglichkeit, sich auf den Zufall hinauszureden, zu nehmen, werden wir im nächsten Kapitel unser schwerstes Geschütz auffahren.
[162] Leipzig, 3. Bd., Nr. 25, S. 220.
[163] Zitiert nach de Ferriëm, Mein geistiges Schauen in die Zukunft, Berlin 1905, S. 67 f. Die im Text angegebenen Zitate der Druckorte und Daten wurden von mir nachgeprüft und, bei mangelhafter Wiedergabe, korrigiert. Einige seltene Zeitschriften, so die »Lichtstrahlen«, konnten nicht verglichen werden. Da aber stets Organe herangezogen wurden, in denen die angekündigten Ereignisse vor ihrem Eintritt veröffentlicht waren, so ist auch in diesen Fällen das Material einwandfrei.
[164] Dieser Zuruf gilt ihrem Begleiter, Kerkau bzw. Godefroy, dem wir die stenographischen Berichte verdanken.
[165] Gleichfalls zitiert nach de Ferriëm a. a. O.
[166] Ferriëm, »Mein geistiges Schauen usw.«, S. 661.
[167] Eb. S. 67.
[168] S. 68, Anm. Hier auch das Folgende »Old Moore« betreffende, das ich leider nicht kontrollieren konnte.
[169] Vgl. »Mein geistiges Schauen in die Zukunft«, S. 63 f. Den »Führer« und die »Kritik« konnte ich nicht einsehen, wohl aber ist im 3. Band der Zeitschrift für Spiritismus, S. 71, am 4. März 1899, darauf hingewiesen, daß die Erfüllung der Vision noch ausstehe, ebenso auf S. 57, am 18. Februar in der gleichen Zeitschrift. Also vor Eintreffen!
[170] Im Druck erschienen in den von Godefroy (Kerkau) herausgegebenen gedruckten Berichten, Nr. 2 vom 20. September 1899, also ein Jahr vor dem Unglück. Godefroy hatte dazu bemerkt: »Das Gesicht dürfte sich jedenfalls bald erfüllen, bzw. in einem der kommenden Jahre.«
[171] Vgl. Walter Bormann »Die Nornen. Forschungen über Fernsehen in Raum und Zeit«. Leipzig 1909, S. 130.
[172] »Nornen«, S. 130 f.
[173] »Nornen«, S. 134. Die Vision selbst in »Mein geistiges Schauen«, S. 65.
[174] Vgl. Kerkau, Zeitschrift für Spiritismus, 3. Bd., 1899, Nr. 8, vom 25. Februar 1899, S. 62 f.
[175] »Mein geistiges Schauen«, S. 84, und Zeitschrift für Spiritismus, 2. Bd., 1898, S. 53 f.
[176] Lucian Pusch, »Spiritualistische Philosophie ist erweiterter Realismus« (Broschüre), Leipzig 1886, der selbst hell sieht, behauptet, die Gegenstände des Hellsehens seien klarer, als die der Halluzinationen. Das ist aber kein objektives Kriterium und setzt die Existenz beider Phänomene voraus. Überdies ist es falsch, weil suggerierte Halluzinationen ebenso lebhaft empfunden werden, wie die »Geister«. Vgl. Sphinx, 2. Bd. 1886, S. 342. Danach müßten Visionen auch an anderen beobachtenden Personen kontrolliert werden können, wären also etwas objektives, außerhalb der wahrnehmenden Person Vorhandenes. Mir scheint auf diesem Gebiete die nötige Klarheit noch nicht zu herrschen.
[S. 346]
Michael Nostradamus wurde am 14. Dezember 1503 zu St. Remy geboren und starb 1566 in Salon. Eigentlich hieß er Michel und war jüdischer Herkunft. Sein Vater war Leibarzt des bekannten romantischen Königs René. Sein Großvater mütterlicherseits, Johann de St. Remy, Leibarzt des Herzogs von Kalabrien, erzog den kleinen Michel und weckte in ihm die Liebe zur Naturkunde. Vielleicht bildete er auch das jenem angeborene übersinnliche Wahrnehmungsvermögen aus.
Nach dem Tode des Großvaters trieb Nostradamus in Avignon humanistische und philosophische Studien, siedelte dann aber nach Montpellier über, um Medizin zu studieren. Dort erwarb er auch den Doktorhut.
Seine ärztliche Praxis übte er in Agen aus, wo er innige Freundschaft mit dem berühmten Philologen Julius Caesar Scaliger schloß. Hier heiratete er ein adeliges Fräulein, verlor sie und die beiden Kinder dieser Ehe aber bald durch den Tod. Dieses tragische Schicksal suchte er durch eine zehnjährige Reise [S. 347]durch Frankreich und Italien zu vergessen. Im Jahre 1544 ließ er sich in Salon nieder und heiratete eine Patriziertochter Anna Pontia Gemella. Bei der großen Pest des Jahres 1546 zeichnete er sich so aus, daß ihm die Stadt Salon als einem um das öffentliche Wohl hochverdienten Mann für längere Zeit einen Jahresgehalt aussetzte. Auch in Lyon erwarb er sich als Pestarzt den Dank der Leidenden.
Nach Salon zurückgekehrt gab der gefeierte Arzt seine Praxis gänzlich auf, da er als heimlicher Kalvinist angefeindet wurde. Er hatte mit der äußeren Welt abgeschlossen und zog sich ganz in die innere zurück. Wie er in der Vorrede zu seinen Centuries sich ausdrückt, erhob diese ihn über die Schranken der Endlichkeit und – das hintereinander Stehende nebeneinander stellend und in ein großes Bild zusammen fassend – führte sie ihm die Geschichte in ihrem Zusammenhang und ohne Vermittlung der Zeitformen an seinem inneren Blick vorüber[177].
Bei Nacht zog er sich in ein kleines Kabinett, das ihm die Übersicht über den ganzen Horizont seines Wohnortes gestattete, zurück. Man zeigt es noch jetzt in Salon. Von hier aus beobachtete er die Sterne und ließ zugleich in seinem Inneren jenes wunderbare Licht heller leuchten, dessen er sich bereits früher bewußt geworden war[178].
[S. 348]Diese Stelle ist von Bedeutung, weil aus ihr hervorgeht, daß es sich nicht um reine Astrologie handelt, sondern daß diese abenteuerliche Wissenschaft nur ergänzend zur Sehergabe hinzutritt. Übrigens wird man gut tun, sich über das Zustandekommen der Prophezeiungen möglichst vorsichtig zu äußern, solange noch ihre Tatsächlichkeiten von der offiziellen Wissenschaft bestritten wird.
Sicher ist, daß Nostradamus die Sehergabe – vorausgesetzt, daß wir ihm eine solche auf Grund des Folgenden zugestehen – von seinen Vorfahren geerbt hat. Das ist interessant, weil wir schon früher wiederholt auf Fälle von Erblichkeit der Gabe gestoßen sind. Daß Nostradamus keineswegs an eine Vererbung der rechnerischen Kunst der Astrologie, also von einer Art Geschäftsgeheimnis, denkt, sondern ganz zweifellos an seine prophetische Veranlagung, geht aus der Vorrede zu seinen Centurie, die er an seinen Sohn Cäsar als Säugling richtet, klar hervor.
Hier sagt er, daß er »geoffenbarte Inspirationen« erhielt, »wenn er bisweilen in der Woche sympathisch[179] angeregt worden sei und sich die [S. 349]Nächte durch lange Berechnungen versüßt habe.« Er konnte also die Zukunft nur völlig ermitteln, wenn er seine astrologischen Berechnungen in einer Art von Trance ausführte.
Nach Nostradamus’ Anschauung ist alles Seiende Notwendig und notwendig so, wie es ist, und alles Geschehende geschieht notwendig in der Weise, zu der Zeit und an dem Ort, wie und wo es geschieht. Dadurch ist jedem Ereignis eine bestimmte Stelle und Zahl gegeben, die sich berechnen läßt.
Wenn nun in gewissen Stunden die Ereignisse der Zukunft vor dem inneren Auge des Nostradamus vorüberzogen, so schrieb er sie in französischer Prosa, aber in mystischen Ausdrücken oder – wie er selbst sagt – in dunklen und verworrenen Sätzen nieder, um weder zu viel Klarheit zu geben, noch auch zu großen Irrtum zu verursachen. Ferner um eine gewisse Scheu und Ehrfurcht vor seinen Weissagungen zu erwecken.
Als er diese Sprache später immer noch für zu offen hielt, übertrug er sie aus der Prosa in gebundene Rede und stellte sie in vierzeilige Strophen, Quatrains, zusammen. Diese teilte er nach Hunderten als Centuries ab. Bei dieser Versifikation wurde die ohnehin dunkle Sprache noch mystischer, obschon sie dem Seher immer noch zu offen schien und er sich deshalb lange nicht zur Herausgabe seiner Verse entschließen konnte. Um auch keine chronologische Handhabung zur Deutung der Vorhersagen zu geben, mischte er überdies die für die verschiedensten [S. 350]Zeiten geltenden Sprüche noch durcheinander. Erst als verschiedene vorausgesagte Ereignisse, die Abdankung Karls V., der Tod Heinrichs II. und die Hugenottenkriege nahe bevorstanden, entschloß er sich 1555 die ersten sieben Centuries herauszugeben. Drei Jahre darauf folgten weitere drei Centuries, die Nostradamus Heinrich II. zueignete.
Kaum waren die Prophezeiungen erschienen, als sie mit Hohn und Spott überschüttet wurden. Man zögerte nicht, Nostradamus als Betrüger und Scharlatan zu erklären. Katharina von Medici aber ließ den Astrologen am 15. August 1556 an ihren Hof kommen und ihren vier Söhnen in Blois die Nativität stellen. Er sagte ihnen wahrheitsgemäß voraus, daß drei Könige werden würden, verschwieg aber diplomatisch, daß die Krönung des einen durch den Tod des andern bedingt würde.
So hatte auch Cornelius Agrippa dreißig Jahre früher Karl von Bourbon zwar die Einnahme Roms vorhergesagt, seinen Tod dabei aber verheimlicht.
Mit Gold und Ehren überhäuft, kehrte Nostradamus nach Salon zurück. Er war so berühmt geworden, daß Fälscher Prophetien unter seinem Namen herausgaben. Dadurch, durch die Dunkelheit seiner echten Prophetien und das Fehlen der Jahreszahlen wurden viele am Können des Sehers irre.
Da ging während des Nostradamusstreites eine Prophezeiung in Erfüllung, die er im 35. Quatrain der ersten Centurie gegeben hatte.
In der in Lyon im Jahre 1555 erschienenen ersten, noch unvollständigen Ausgabe seiner Prophezeiungen finden wir folgenden Vierzeiler:
[S. 351]
Auf deutsch:
Le Pelletier[180], der diesen Quatrain kommentiert, umschreibt classe mit κλάσις brisur, ébrachement und une als una, die erste. Daher sind wir zu obiger Übersetzung berechtigt.
Nun die Erklärung:
Im Juli 1559, gelegentlich der Doppelhochzeit von Töchtern Heinrichs II. – Elisabeth heiratete Philipp II. von Spanien, Margarete den Herzog Emanuel Philibert von Savoyen – streckte der »junge Löwe« Graf Montgomery den »alten« König Heinrich II. von Frankreich in den Sand, und zwar im Tjost, bei dem einer gegen den anderen, also einzeln (par singulier duel) die Kräfte maß. Das steht im Gegensatz zu den zur Ritterzeit gebräuchlichen Buhurt, einem ungefährlichen Reiterspiel mit stumpfen Waffen, oder dem Turnier, wo größere Scharen von Rittern gleichzeitig gegeneinander die – stumpfen – Lanzen [S. 352]verstechen[181]. Dabei drang seine Lanze durch das goldene Visier des Helmes (cage d’or) ins rechte Auge. Der König starb am 10. Juli erst vierzigjährig an der erhaltenen Wunde. Das war der erste gewaltsame Bruch am Aste der Valois.
Der zweite ereignete sich am 1. August 1589, als der junge fanatische Dominikanermönch Jaques Clément König Heinrich III. im Lager zu St. Cloud mit einem Dolche den Unterleib durchbohrte. Der König starb noch am gleichen Abend unter furchtbaren Schmerzen und mit ihm erlosch das berühmte Geschlecht im Mannesstamme.
Daß diese Prophezeiung richtig gedeutet wurde, wissen wir nicht nur von Hörensagen und aus der Tatsache, daß von nun an Nostradamus ein berühmter Mann war, sondern auch aus der gleichzeitigen Literatur. Brantôme in seinen Vies des Hommes illustres erzählt in dem Heinrich II. gewidmeten Abschnitt ebenso wie Guynaud in seiner Concordance des Prophétie de Nostradamus die Umstände bei diesem Turnier genau. Ja, wir wissen auch, daß dem König, der sich in Kraftproben gefiel, das bevorstehende Unglück vorhergesagt worden war, jedoch ohne ihn von seinem Vorhaben abzubringen.
Einst besuchte Herzog Philibert Emanuel von Savoyen mit seiner Gemahlin Margarete den Seher. Als letztere in gesegneten Umständen war, ließ sie Nostradamus zu sich nach Nizza kommen und befragte ihn über das Geschlecht des zu erhoffenden Kindes. Er antwortete, daß es ein Sohn sein werde, [S. 353]der Karl getauft und ein großer Feldherr werde. Am 12. Januar 1562 kam der Knabe zur Welt und Nostradamus stellte ihm die Nativität[182].
In dieser Nativität hieß es, daß er in einem bestimmten Jahre verwundet, aber nicht sterben werde, als bis eine 9 vor einer 7 komme. Der Prinz, der sein Horoskop sorgfältig verwahrte, sprach eines Tages mit dem Grafen Carignan über das geheimnisvolle und unsichere Helldunkel der astrologischen Prognostika und erzählte, daß ihm Nostradamus für das laufende Jahr eine bedeutende Verwundung vorhergesagt habe. Der Graf konnte nicht begreifen, wie er im tiefsten Frieden schwer verwundet werden könne, worauf der Prinz rasch aufstand, um die Nativität herbeizuholen. In der Eile stieß er den Tisch um, der ihm auf ein Bein fiel und es bedeutend verletzte.
Da sich die erste Prophezeiung so schlagend bewahrheitet hatte, glaubte Prinz Karl, daß nun auch die zweite bezüglich seines Alters eintreffen würde und rechnete auf 97 Jahre. Als er aber schon im 69. Jahre starb, erkannte man, daß auch hier eine 9 vor einer 7 komme, weil auf 69 unmittelbar 70 folgt. So war der Prophet gerechtfertigt. Allerdings beweist dieser Fall – wie zahllose andere – auch die große Schwierigkeit der Interpretation selbst einer richtigen Vorhersage.
Im Jahre 1564, als der junge König Karl IX. mit seiner Mutter den berühmten Propheten aufsuchte, weissagte er letzterer im geheimen, daß ihr Lieblingssohn, der damalige Herzog Heinrich von [S. 354]Anjou, den Thron besteigen würde. Auch Heinrich von Navarra, dem nachmaligen König Heinrich IV., weissagte Nostradamus die Krone.
Übrigens ernannte Karl IX. den Seher zu seinem Leibarzt und überreichte ihm ein Geschenk von zweihundert Goldtalern, Katharina aber fügte noch hundert aus eigener Tasche hinzu. So fehlte es ihm weder an Geld noch an Ehren. Da er ein Wohltäter der Armen und Kranken war, ein aufopfernder, pflichtgetreuer Arzt, so wußten auch seine Mitbürger ihn zu schätzen.
Sein Freund Jean Aimè Chavigni – latinisiert Janus Gallicus – erzählt[183], daß er des Nostradamus’ Krankenbett spät in der Nacht des 1. Juli 1566 verließ und mit Sonnenaufgang wiederzukehren versprach. Der Kranke, der die letzten sechzehn Lebensmonate an der Gicht gelitten hatte und bereits acht Tage vor seinem Tode das Abendmahl empfing, zwei Tage vorher aber sein Testament machte, antwortete dem Freund: »Der Sonnenaufgang wird mich nicht mehr unter den Lebenden finden.«
Da er jedoch leicht atmete und man überhaupt keine Anzeichen des herannahenden Todes an ihm wahrnahm, zogen sich alle zurück, um einige Stunden der Ruhe zu pflegen. Als man dann in der Morgendämmerung ins Krankenzimmer trat, fand man Nostradamus tot auf einer Bank in einer Stellung, die deutlich bewies, daß er ein sanftes Ende gefunden hatte.
Man entdeckte unter den Papieren des Verstorbenen folgendes nach seiner Rückkehr von Arles, wohin Karl IX. im Jahre 1564 ihn hatte kommen [S. 355]lassen, geschriebene Quatrain, in dem er die Umstände seines Todes schildert[184]:
Zurückgekehrt legt’ ich des Königs Gabe nieder; |
De retour d’Ambassade, don de Roi mis au lieu; |
Die Arbeit ist vollbracht, ich geh zu Gott; |
Plus n’en fera: sera allé à Dieu: |
Mir nahn Verwandte, Freunde, Blutesbrüder – |
Parans plus proches, amis, freres du sang – |
Bei einer Bank an meinem Bett werd’ ich gefunden tot. |
Trouvé tout mort près du lict et du banc. |
Am 2. Juli wurde Nostradamus links vom Haupteingang der Minoritenkirche in Salon in einer Nische beigesetzt, was auch einer Prophezeiung entsprach. Hier möge es offen bleiben, ob sein Grab nicht danach gewählt wurde.
Nostradamus hinterließ außer den Centuries noch in Prosa geschriebene Prophezeiungen, die Chavigni in zwölf Büchern zusammenstellte. Sie sollen klarer gewesen sein, als die Centuries, gingen aber verloren.
Die Prophetien beginnen im Jahre 1555 und enden am Schlusse des ersten angeblichen Geschichtsweltalters im Jahre 3797 n. Chr. Räumlich behandeln sie, wie Nostradamus im Anschreiben an Heinrich II. mitteilt, ganz Europa und einen Teil Afrikas und Asiens, während sie den Osten Asiens oder Indien nicht umfassen. Besonders zahlreich sind die auf Frankreich bezüglichen Sprüche, und auch hier ist es besonders sein Heimatland Provence und das angrenzende Piemont.
[S. 356]Bevor wir weiter auf die Prophezeiungen eingehen, die besser überliefert sind, als man bei der Schwierigkeit der Sprache und den zahlreichen eingestreuten Provinzialismen, Fremdworten und Neubildungen – die dem Abschreiber bzw. Drucker natürlich große Schwierigkeit bereiteten – erwarten sollte, wollen wir einen Blick auf die Fälschungen werfen.
Sie sind zahlreich und in der Regel nur auf Grund alter Ausgaben bzw. der kritischen von Le Pelletier festzustellen. Dann allerdings ohne Schwierigkeit. Bis in die allerneueste Zeit haben sich Fälscher oder Spaßvögel des Namens des großen Astrologen bedient.
So zirkulierte etwa im Jahre 1903 folgendes nicht in einer Originalausgabe enthaltene Quatrain:
Hieraus las man den Untergang der Seeherrschaft Englands zur Zeit der Luftschiffe, Hohlgeschosse und Unterseebote. Natürlich war es eine Fälschung.
Im Jahre 1870 tauchte ein anderer angeblicher Quatrain des Nostradamus auf, in dem dem zweiten Kaiserreich eine Lebensdauer von genau 17¾ Jahren »et pas un jour de plus« vorausgesagt war. Da es vom 2. Dezember 1852 bis zum 2. Dezember 1870 dauerte, so war die Prophezeiung richtig, nur findet sich leider bei Nostradamus nichts davon[185].
[S. 357]Mit welchem geradezu unglaublichen Mangel an Logik zu Werke gegangen wird, wenn es gilt, eine unangenehme Tatsache aus der Welt zu schaffen, zeigt sich hier wieder einmal deutlich. Man folgert daraus, daß es auch gefälschte Prophezeiungen gibt, etwas gegen die echten! Und doch könnte jeder des Lesens Kundige sich durch einen Blick in alten Ausgaben überzeugen, daß es auch echte gibt und zwar sehr viele. Es ist ein Vorrecht der Ignoranz apodiktisch aufzutreten, und die gerade modernen wissenschaftlichen Theorien scheinen zu ihrer Unterstützung die gröbsten logischen Schnitzer nicht entbehren zu können.
Wir wollen nun aus der großen Zahl von eingetroffenen Prophezeiungen einige herausgreifen. Wir betonen dabei wiederum, daß eine einzige wahre Vorhersage, d. h. eine, die Zufall und Berechnung ausschließt, die Tatsächlichkeit des Phänomens bereits beweist.
[S. 358]Der 75. Quatrain der VI. Centurie lautet:
Diese Vorhersage ging schon sehr bald in Erfüllung. Wollen wir sie zunächst übersetzen und mit Le Pelletier kommentieren[186].
»Der große Pilot wird vom König mit einem Amt betraut werden (mandé = mandatus, das Mandat erhalten). Er wird die Flotte verlassen, um zu einem noch höheren Range emporzusteigen: Sieben Jahre nachher wird er Schleichhändler sein (d. h. sich gegen die legitimen Gewalten auflehnen), eine barbarische Armee wird Venedig Furcht einjagen.«
Gaspard de Coligny wurde vom König Heinrich II. zum Admiral befördert im Jahre 1552. Er dankte im Jahre 1559, beim Tode des Königs, ab, um als Parteihaupt der Kalvinisten tatsächlich eine mächtigere Stellung einzunehmen. Hier wurde er im Jahre 1562 zum ersten General-Leutnant ernannt. Im Jahre 1567, also sieben Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem königlichen Dienst, stand er auf der Höhe als Organisator des Bürgerkrieges (Contrebandé). In die Jahre 1567 bis 1569 fallen die drei großen von den Protestanten gelieferten Schlachten bei Saint-Denis, Jarnac und Moncontour. In der letzten war Coligny Höchstkommandierender. Diese Ereignisse fielen zeitlich zusammen mit dem bedrohlichen Vordringen der Waffen des Sultans Selim II., der Venedig im Jahre 1570 [S. 359]die Insel Zypern abnahm. Im gleichen Jahre 1570 schlossen die Protestanten und Katholiken zu St.-Germain Frieden.
Daß diese Ereignisse sich gut mit dem Quatrain identifizieren lassen, wird wohl niemand bestreiten. Ja, sie müssen sogar identifiziert werden, da gar nicht so viele Jahre in Frage kommen, in denen Venedig vor den Türken zittern mußte. Ferner dürfte Coligny der einzige Admiral gewesen sein, der es zum Führer der Revolution gebracht hat. Auch die Zeitangabe von sieben Jahren wird stutzig machen. Immerhin können wir den Einwand nicht widerlegen, daß diese Ereignisse, weil teils noch zu Lebzeiten des Nostradamus, teils kurz nach seinem Tode eintretend, durch Kombination von ihm hätten erraten werden können, oder daß man Ereignisse später dem Quatrain unterlegte.
Obiger Quatrain diene übrigens als gutes Beispiel für die schwer verständliche Sprache des Astrologen. pillot ist ein italienisches Wort (piloto, pillotare); la classe, von classis abgeleitet ist lateinisch, contrebandé ebenso wie mandé ist romanisch. Dazu kommt die Inversion des letzten Verses, der natürlich gelesen werden muß: Venise craindra une armée barbare qui viendra. Diese Dunkelheit bewirkt, daß es nahezu unmöglich ist, eine Prophezeiung zu verstehen, bevor sie eingetreten ist. Ist dies aber der Fall gewesen, dann wird alles, fast jedes Wort, erstaunlich klar.
Um nicht den Vorwurf zu riskieren, wir verschwiegen etwas, was zu Ungunsten des Nostradamus angeführt werden kann, sei mitgeteilt, daß man den [S. 360]Nachweis erbrachte, daß er zahlreiche Prophezeiungen älterer und auch zeitgenössischer Seher in seine Sammlung aufgenommen habe. Das gilt in den Augen von manchen als Beweis seiner betrügerischen Scharlatanerie.
Abgesehen davon, daß viele Seher ebenso handelten, kommt es doch ganz allein darauf an, daß eine Prophezeiung auch wirklich eintrifft. Damit, daß Nostradamus da und dort Sprüche anderer aufnimmt, um sie seinem eigenen Werke einzuverleiben, übernimmt er für sie auch die Verantwortung. Er wird sie zweifellos, schon mit Rücksicht auf seinen Namen, vorher nachgeprüft haben. Es wäre von ihm sehr töricht gewesen, wenn er wertvolle Vorhersagen nur deshalb aus seinem Werke fortgelassen hätte, weil sie nicht von ihm selbst stammen. Das wäre ja etwa so, als wenn jemand über irgend eine Wissenschaft, sagen wir über Chemie schriebe, und dabei ausschließlich das im Buche aufführte, was er selbst entdeckt hat.
Auch der Vorwurf des Plagiates wäre vorschnell. Denn abgesehen davon, daß das Mittelalter den Begriff kaum kannte, wäre es ja eine ganz unmögliche Forderung im Quatrain den Namen des Autors anzugeben.
Gehen wir jetzt zu weiteren Prophezeiungen des großen Sehers über in der Hoffnung, allmählich selbst dem hartnäckigsten Zweifler die Augen zu öffnen.
Wir nehmen einen Quatrain, der uns beweiskräftig scheint, weil die Identifizierung sehr leicht ist. Es ist der 55. der III. Centurie und lautet:
[S. 361]
Mit Le Pelletier[187], dem gründlichsten Kenner und liebevollsten Interpreten unseres Astrologen, übersetzen und kommentieren wir wie folgt:
Im Jahre, in welchem ein Einäugiger in Frankreich herrschen wird, wird der Hof in einer höchst unangenehmen Verlegenheit sein: Der Große von Blois (d. h. der König von Frankreich, der sein lit de Justice in Blois abhielt)[188] wird seinen Freund töten; das Königreich, in üble und unsichere Situation versetzt, wird (sera ist zu ergänzen) doppelt sein, d. h. in zwei Teile gespalten werden.
Diese Vorhersage muß auf das Jahr 1559 datiert werden, weil es das einzige in der ganzen französischen Geschichte ist, in dem es einen einäugigen König gab. Wie wir schon früher gesehen haben, war ja Heinrich II. vom Grafen von Montgomery das Auge ausgestochen worden, eine Verwundung, die der König kurze Zeit überlebte. Gerade vom Jahre 1559 ab ereigneten sich aber die ungünstigen Dinge, die Nostradamus andeutet, wenn sie sich auch allerdings nicht im gleichen Jahre schon erfüllten, so daß man ev. sagen könnte, der Seher habe sich in der Zeit geirrt.
[S. 362]Der französische Hof wurde damals in die allerunangenehmste Lage versetzt. Heinrichs II. Nachfolger, der sechzehnjährige, schwache Franz II., unter dem die Hugenotten sich empörten – auch der Name tritt jetzt zuerst auf – war in keiner Weise fähig, den beginnenden Religionskrieg im Keime zu ersticken. Als er schon 1560 starb und der zehnjährige Karl IX. unter der Regentschaft der Katharina von Medici folgte, wurde es nicht besser. Er beteiligte sich bekanntlich persönlich am Blutbad der Bartholomäusnacht, in der Tausende der Hugenotten ermordet wurden. Die Guise spielten im Reich die erste Rolle. Gegen Heinrich III., Karls Nachfolger, konspirierten sie. Da holte er zu einem Gewaltstreich aus, bei dem er seine Generalstände nach Blois berief und dort den Herzog von Guise in seinem Kabinett ermorden ließ. Vorher hatte er mit ihm als Beweis für seine Freundschaft die Hostie geteilt (daher son amy). Die Folge der Bluttat war, daß sich die zwei feindlichen Parteien, die Royalisten und die Ligisten, mit höchster Wut bekämpften. Paris ging zu offener Revolution über, die Sorbonne entband vom Treueid, und als Heinrich die Stadt belagern wollte, wurde er ermordet[189].
Man kann nicht sagen, daß die Voraussage des Nostradamus weniger wunderbar ist, weil sie sich bereits nach vier Jahren erfüllte; denn daß dieser Quatrain bereits in der im Jahre 1555 abgeschlossenen und edierten unvollständigen Ausgabe steht, ist sicher. Wenn wir das Phänomen der Prophetie beweisen wollen, dann ist es aber ganz gleichgültig, ob eine [S. 363]Vorhersage sich nach einigen Tagen oder einigen Jahrhunderten realisiert. Ausschlaggebend muß nur sein, daß es sich weder um Zufall, noch um Berechnung handelt.
Was das letztere betrifft, so wird wohl kein Mensch auf der Welt so einfältig sein, zu behaupten, daß irgend jemand auf gewöhnlichem Wege ausrechnen könnte, daß Frankreich einmal von einem einäugigen König beherrscht werden würde. So etwas zu kombinieren – das kann ohne jegliches Zögern ausgesprochen werden – ist schlechthin unmöglich.
Tatsächlich ereignete sich in Blois – der Name ist ja angegeben – das scheußliche Verbrechen mit seinen Folgen! Jedes Wort beruht auf Wahrheit!
Bleibt noch der Zufall. Da sich diese Ereignisse: die Einäugigkeit des Königs, das Zusammentreffen der Einäugigkeit mit dem späteren Vorgang, insofern Frankreich, von einem erfahrenen und energischen Monarchen geleitet, wohl kaum die Wirren hätte erdulden müssen, die es unter Kindern und Unreifen erlitt, die Tat des Königs, der Ort Blois, der »Freund«, die Zerspaltung Frankreichs und die üble Lage des Hofes, weil z. T. überhaupt Unica bildend, nicht gut in eine Wahrscheinlichkeitsrechnung einfangen lassen, wollen wir vorläufig darauf verzichten, den Koeffizienten zu berechnen.
Übrigens nimmt auch der 51. Quatrain der III. Centurie auf den Mord in Blois Bezug:
Nachdenklich mag auch die Présage 58 stimmen:
[S. 364]
Le Roy-Roy, der doppelte König, ist Heinrich III. der, wie bereits erwähnt, die Krone Polens vor der Frankreichs getragen hatte. Die Übersetzung lautet:
Der zweifache König stirbt (n’estre = n’est plus) als Mordtat des Süßen. (pernicie = lateinisch pernicies Verderben, Untergang).
Im unglückseligen Jahr, wenn die Anstifter der Unruhen sorgenvoll sind.
Daß der, der halten wird, nicht los läßt! den Großen nicht zur Freude. (letitie = lateinisch laetitia).
Und er wird das Ziel passieren, das ihm die Spötter (cavilleux = railleur vom lat. cavillator) bestimmt haben.
Daß König Heinrich ermordet wird von einem »Süßen«, ist ein offenbarer Unsinn, denn Mörder pflegen mit diesem Epitheton nicht belegt zu werden. Wie aber, wenn wir hören, daß der Mörder Clément hieß? Was dem Sinne nach ungefähr dasselbe bedeutet? Das legt den Gedanken nahe, Nostradamus habe den Namen gekannt, aber absichtlich zum Zweck der Verdunklung durch ein Synonym ausgedrückt.
Ja, ist es denn möglich, daß die Prophetie uns sogar die Namen zukünftiger geschichtlicher Personen enthüllt?
Wir sehen hier, daß es aller Wahrscheinlichkeit nach sogar wirklich ist. Aber erst wenn wir durch spätere Quatrains den zwingenden Beweis, daß sogar die Angabe des Namens im Bereiche von Nostradamus [S. 365]wunderbarer Kunst lag, erbracht haben, fordern wir vom Leser, daß er sich auch hier bekehrt und zugibt, daß »du Doux« gleichbedeutend mit »Clement« ist.
Alles andere stimmt ganz genau mit der Wahrheit überein. Heinrich III. wurde 1589 ermordet, einem Jahre, das besonders durch Bürger- und Religionskrieg verhängnisvoll sich vor anderen auszeichnete (pestilent). Die Revolutionäre waren damals tatsächlich sehr besorgt (nubileux), denn der König zog ja vor Paris und hätte es unzweifelhaft erobert und die Ligisten vernichtet, wäre die Mörderhand nicht dazwischen gekommen[190].
Geradezu bewundernswert ist das »Tien’qui tiendra«, wenn wir Heinrich IV., damals noch König von Navarra, substituieren. Er, der später die Krone tragen wird, soll nur ja nicht loslassen! Das wird allerdings seinen großen Gegnern, Philipp II., Mayenne, Herzog von Aumale und den anderen katholischen Herren wenig angenehm sein. Tatsächlich überschritt Heinrich IV. das Ziel, das die Spötter von der Partei der Guise ihm gesteckt hatten in jeder Hinsicht durch die Macht, die er, der einstige Kalvinist und Herr des kleinen Navarra, als König ausübte.
Daß dieser Quatrain im vollen Umfange in Erfüllung gegangen ist, wird ja kaum jemand bestreiten wollen. Da das erst 25 Jahre nach dem Tode des Sehers eintrat, ist Kombination ausgeschlossen und der Beweis für die Existenz echter Prophetie wäre hinreichend erbracht.
[S. 366]Doch wir wollen uns nicht mit der Feststellung der Tatsache begnügen, sondern auch den Umfang der Gabe zu bestimmen versuchen. Die schwersten Proben werden zweifellos richtige Angaben von Namen und Jahreszahlen sein. Denn gegen die tatsächlichen Vorgänge werden unverbesserliche Skeptiker immer wieder anführen können: irgend etwas ereignet sich immer mal in der Weltgeschichte, und sei es die verwegenste Konstruktion, zumal wenn man – wie bei Nostradamus – zwei Jahrtausende Zeit hat, seine Auswahl zwecks Identifikation zu treffen. Da hier der Gegenbeweis sehr schwer wäre, wollen wir also durch Namen, die sich in der Weltgeschichte durchaus nicht wiederholen und stets Identifizierung der Nation, häufig auch sogar Datierung gestatten, dem Gegner die Rückzugslinie abschneiden.
Der 18. Quatrain der IX. Zenturie lautet:
An Namen ist hier kein Mangel. Übersetzen wir nun mit Le Pelletier (I., p. 113):
»Die Lilie des (bisherigen) Dauphin (die Lilie [S. 367]war bekanntlich das Wappen der Bourbons; Dauffois ist Synkope für Dauphinois = Dauphin) wird nach Nancy kommen und wird bis nach Flandern einen Kurfürsten des Reiches unterstützen (portera = supportera).
Neues Gefängnis (obturée lateinisch = obturare, einsperren) dem großen Montmorency.
Außerhalb des dazu bestimmten Ortes (prouvés für approuvés) wird er ausgeliefert werden dem Clerepeyne (oder: einer berühmten Strafe).«
Alle angegebenen Daten und Namen passen auf Ludwig XIII., den wir auch aus einem anderen Grunde mit dem lys-Dauffois identifizieren müssen.
Seine Truppen drangen am 24. September 1633 in Nancy ein und der König selbst folgte am andern Tage. Daß Nancy, die Hauptstadt des Herzogtums Lothringen, nicht zu Frankreich gehörte, es sich vielmehr um einen Kriegszug handelt, weil Lothringen französische Rebellen unterstützte, ist immerhin erwähnenswert. Er drang im Jahre 1635 bis nach Flandern vor, um die Sache des Kurfürsten von Trier, der 1635 in spanische Gefangenschaft geraten und nach Brüssel entführt worden war, zu unterstützen. Und zwar war diese Gefangennahme Anlaß der Kriegserklärung und Ludwig belagerte Löwen in Flandern. Etwa um die gleiche Zeit – im Jahre 1632 – wurde Heinrich II. Montmorency wegen Rebellion gegen seinen Herren Ludwig XIII. im neu erbauten Gefängnis des Rathauses in Toulouse eingesperrt (neusve obturée). Darauf wurde er einem Soldaten namens Clerepeyne übergeben, der ihm nicht an dem dafür bestimmten Orte (hors lieux prouvés), das wäre der Stadtplatz, [S. 368]place du Salin, in Toulouse gewesen, sondern – als Gnade – im verschlossenen Hofe des Rathauses am 30. Oktober 1632 den Kopf abschlug vor der Statue seines Paten, Heinrichs IV., dem sein Vater zum Teil die Krone Frankreichs verdankte. Auch ersteres war eine Gnade, die die Familie Montmorency beim König erwirkte, daß nämlich der Verurteilte von der entehrenden Hand des Henkers verschont bleiben sollte.
Was den Namen des Soldaten betrifft, so bezeugt der Zeitgenosse Etienne Joubert[192] dieses Faktum nicht minder, wie der Chevalier de Jant, wie Le Pelletier feststellt. Motret[193] hat diesem höchst merkwürdigen Sachverhalt, merkwürdig insofern als jedes Wort des Nostradamus in verblüffender Weise durch die nachträglichen Ereignisse bestätigt wurde, eine eingehende Untersuchung gewidmet.
Übrigens haben wir hier neuerdings ein Beispiel für die ungeheure Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit die Quatrains zu deuten, bevor sie sich erfüllt haben. clere peyne würde – auch wenn es nicht der Familienname des mit der Exekution betrauten Soldaten gewesen wäre – einen völlig zutreffenden Sinn geben. Denn es ist zweifellos eine berühmte Strafe, wenn ein Herzog hingerichtet wird.
Zugetroffen sind also in diesem Quatrain: 1. der [S. 369]Name Dauphin, da Ludwig XIII. seit einem Jahrhundert d. h. seit dem Jahre 1566, als die IX. Centurie erschien, der erste König von Frankreich war, der vor seiner Thronbesteigung diesen Titel geführt hatte.
2. Die Ortsnamen Nancy, das der König eroberte, und Flandern, in das er eindrang, womit implicite auch zwei Kriege richtig prophezeit sind.
3. Die Person des Kurfürsten, der den Krieg verursacht hatte.
4. Der Name Montmorency, mit dessen Tode die Hauptlinie des uralten Geschlechtes erlosch, und der mit Recht »der Große« heißt[194]. Denn mit 17 Jahren war er bereits Admiral, zeichnete sich bei der Eroberung von La Rochelle aus und setzte 1630 den Grafen Doria gefangen.
5. Der Name des hinrichtenden Soldaten Clerepeyne.
Endlich die Nebenumstände als: Neubau des Rathauses, die Hinrichtung außerhalb der Richtstätte und zwar nicht durch Henkershand, sondern durch einen Soldaten.
Der Beweis, daß Nostradamus die Namen, und zwar gleich eine ganze Reihe, richtig zu bestimmen wußte, ist durch dieses Quatrain über jeden Zweifel sicher erbracht.
[S. 370]Nun wir diese Gewißheit erlangt haben, werden wir auch nicht mehr zögern, den Namen »Doux« oben richtig in den Eigennamen des Mörders Clement aufzulösen. Aus welchen Gründen Nostradamus damals das Synonym wählte, vielleicht, weil das Ereignis zu nahe seiner Lebenszeit lag, bleibe dahingestellt.
Schon jetzt wird niemand es Vermessenheit nennen können, wenn wir Nostradamus die Gabe der Prophetie in hohem, ja, wie wir noch sehen werden, in bisher nie wieder erreicht hohem Grade zuerkennen. Es handelt sich bei ihm nicht um ein Tappen im Dunkeln, um ein Herumraten und Aufstellen von Luftschlössern, deren Realisierung er der Weltgeschichte überläßt. Es ist durchaus unzulässig anzunehmen – wie wir das früher hypothetisch taten – daß die Prophezeiungen nur deshalb zum Teil in Erfüllung gehen, weil eben alles, was Menschen sich nur ausdenken können, irgend einmal und irgendwo in der Geschichte greifbare Gestalt annimmt.
Das Gegenteil ist der Fall: Der Seher sieht hell in die Zukunft. Aber er hat Gründe, seine Sprüche so zu redigieren, daß sie erst nach ihrer Erfüllung verstanden werden können. Er weiß also viel mehr, als er sagt. Noch ein paar Beispiele mögen den Beweis unterstützen. Dabei möchten wir bemerken, [S. 371]daß von den annähernd zwei Jahrtausenden, auf die sich die Prophezeiungen erstrecken, ja erst dreieinhalb Jahrhunderte verflossen sind, so daß es ganz selbstverständlich ist, daß auch erst ein Bruchteil der Quatrains hat identifiziert werden können. Immerhin sind es schon gegen 200, die Le Pelletier sammelte und die neuerdings noch vermehrt werden konnten. Für unsere Beweisführung würde freilich ein einwandfrei feststehender Fall genügen – und wir haben deren ja schon eine stattliche Reihe – aber wir setzen voraus, daß der Leser, dem Zeit und Lust fehlen, bei Le Pelletier sich zu informieren, einiges Interesse an weiteren Voraussagen hat.
Der 92. Quatrain der II. Centurie lautet:
Zu deutsch:
Da »Le nepveu« (neveu) der ständige Name Napoleons III. bei Nostradamus ist, wird auch der Geschichtsunkundige ohne Schwierigkeit feststellen können, daß die Katastrophe von Sedan gemeint ist.
[S. 372]Jedes Wort stimmt hier wieder. Das brennende Sedan als Hintergrund. Der Hochgeborene, eigentlich der Höhergeborene, ist König Wilhelm I., ein treffender Gegensatz zu der kurzen Familiengeschichte des Franzosenkaisers. Der Fall der Gefangennahme einer so großen Armee war tatsächlich ein wunderbares Vorkommnis. Die Weltgeschichte bietet hierzu bis zum heutigen Tage kein weiteres Beispiel. Besonders verblüffend, mehr noch als die Vorhersage der furchtbar blutigen Schlachten und der Gefangennahme des Neffen des großen Napoleon ist die letzte Zeile. Bekanntlich war es dem dritten Napoleon vollkommener Ernst, als er in dem berühmten durch den Grafen Reille Wilhelm I. überreichten Briefe schrieb: »N’ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes etc.« Er hatte den Heldentod gesucht, aber das Schicksal war grausam genug, dem unglücklichen Manne diese letzte Gunst zu versagen. »Morts d’espactacles« nennt es Nostradamus, gemeint ist dasselbe.
Die Worte »faict cas merveilleux« scheinen, wie Albert Kniepf, der zuerst den Quatrain identifizierte[195] bemerkt, eine Reminiszenz an 1806 und Jena zu sein.
[S. 373]Le Pelletier hatte seine Erläuterungen zu den Quatrains am 1. Januar 1867 abgeschlossen und bemerkt, daß er sich in bezug auf die Zukunft des Kaisers »eine gewisse Reserve auferlege, da einige Quatrains sich noch auf dessen Fatum kurz über lang zu beziehen scheinen«[196]. Er hatte also augenscheinlich diese Vorhersage, die nicht allzuschwer zu identifizieren war, nachdem man wußte, daß »le neveu«, der Neffe des großen Napoleons war, schon bemerkt, verschwieg sie aber aus persönlichen Gründen. Eine Vorsicht, die also nicht nur Nostradamus walten ließ, als er seine Vorhersagen möglichst verdunkelte, die noch bis zum heutigen Tage jeder Seher beobachtet. Es ist ja sehr naheliegend, aus welchen Gründen.
Der 34. Quatrain der IX. Centurie lautet in der im Todesjahre des Nostradamus (1566) zu Lyon erschienenen Ausgabe von Rigaud folgendermaßen:
Le Pelletier, der seine Ausgabe aufs sorgfältigste nach dem alten Druck von Pierre Rigaud (Lyon 1558–1566) mit den Varianten der folgenden Ausgaben hergestellt hat, erklärt die altfranzösischen etc. Ausdrücke wie folgt:
Part ist = époux, Gatte; soluz = solus, lateinisch: also seul, allein; mary = affligé, betrübt, par in der letzten Zeile ist soviel wie parmi, unter; coutaux [S. 374]= lateinisch custos, Wächter, Hüter. Avous = lateinisch avus, aieux, Vorfahren. Tiltré = tituliert.
Demnach heißt der Vierzeiler: Der Gatte wird einsam betrübt mit der Mitra geschmückt werden nach seiner Rückkehr. Ein Angriff wird geschehen auf den Tuille durch fünfhundert: ein Verräter wird sein Narbon mit hohem Titel und Saulce unter seinen Vorfahren Hüter des Öls (habend).
Die Sprache ist zweifellos höchst dunkel. Das Wort hat eben, wie Bormann, der diesem Quatrain eingehende Untersuchungen widmet, denen wir uns nachstehend anschließen[197], richtig bemerkt, in der gedrängten Orakelsprache oft weittragenden Sinn unter Bezug auf lange Begebenheiten.
Wenn wir allerdings die historischen Begebenheiten als Auflösung in die Rechnung einsetzen, dann sind wir gezwungen, die Prophezeiung zu den verblüffendsten zu rechnen, die überhaupt möglich sind.
Am 20. Juni 1791 ereignete sich bekanntlich die Flucht des Königs Ludwigs XVI. von Frankreich und seiner Gemahlin Marie Antoinette. Genau ein Jahr später, am 20. Juni 1792 fand die Massendemonstration der Jakobiner gegen den König statt und der Einfall eines Pöbelhaufens in die Tuilerien. Dabei wurden der König sowie seine Gemahlin nicht nur beschimpft, sondern ihnen auch die rote Jakobinermütze aufs Haupt gesetzt, bzw. er setzte sie sich nach anderen Berichten selbst auf.
Jetzt hat der erste Satz einen erstaunlichen Sinn erhalten, wie kaum jemand wird bestreiten können. [S. 375]Er heißt also: Der betrübte Gatte, nämlich Ludwig XVI., wird allein – denn er war von der Königin getrennt, die im Beratungssaal der Minister ähnlichen Kränkungen wie der König im Saale Oeil de Boeuf ausgesetzt war – mit der Mütze geschmückt nach seiner Rückkehr. Jedes Wort stimmt!
Übersetzt man mit Bormann mitré mit Infuliert, was durchaus zulässig wäre, so würde die bittere Ironie desto drastischer wirken, da hier statt des Priesters der »Gatte« infuliert wird. Übrigens sei bemerkt, daß die bischöfliche Mitra gleich der Jakobinermütze rot ist.
Der eigentliche Angriff auf die Tuilerien (le thuille) erfolgte in der Nacht vom 9. auf den 10. August 1792, als die sogenannten Fünfhundert féderés marseillais, die den schlimmsten Auswurf der großen Hafenstadt enthielten, sich in die Hauptstadt ergossen hatten. Die Folge war bekanntlich die Niedermetzelung der tapferen Schweizergarde sowie die Gefangennahme des Königs und das Ende des Königtums. Also sogar die Zahl, die ja den Mordbrennern ihren Namen gab, wird im Quatrain richtig angegeben!
Ebenso der Ort. Katharina von Medici hatte erst kurz vor dem Tode des Nostradamus (1564) an der Stelle, wo früher Ziegeleien standen – daher der Name – den Grundstein zu den Tuilerien gelegt. Das Schloß wurde später von den Königen erweitert. Bekanntlich war die gewöhnliche Residenz nicht dieses Schloß, sondern das von Versailles, das Ludwig XIV. mit ungeheurer Pracht und Verschwendung gebaut hatte. Ludwig XVI. war erst, dem Zwange folgend, am 5. Oktober 1789 in das Pariser Schloß übergesiedelt. Berücksichtigt man noch, daß das älteste [S. 376]Königsschloß der Louvre war, so ist diese Ortsbestimmung nur desto verblüffender. Als Nostradamus seine Prophezeiungen schrieb, ja als sie – 1566 – bereits im Druck erschienen, existierten die Tuilerien noch gar nicht.
Um das Rätselhafte der Prophezeiung voll zu machen, wollen wir noch auf die Namen eingehen.
Narbon »mit hohem Titel« wird als »Verräter« bezeichnet. Dieser Narbon ist natürlich identisch mit Louis Graf Narbonne-Lara (1755–1813), der vom Dezember 1791 bis 10. März 1792 Kriegsminister Ludwigs XVI. war. Seine Mutter, aus spanischem Geschlecht, war eine natürliche Tochter Ludwigs XV. Er selbst wurde am königlichen Hofe in Frankreich erzogen und auf alle Weise bevorzugt, wie ja schon daraus hervorgeht, daß er im Alter von 36 Jahren ein Minister-Portefeuille inne hatte.
Da er über den Parteien stehen wollte und sowohl dem Königtum, wie der neuen Verfassung gerecht zu werden trachtete, das Königtum im Kriege gegen das Ausland, Österreich und Preußen, stärken wollte und gleichzeitig vor der Nationalversammlung Reden voll Elan über die militärischen Hilfsmittel Frankreichs hielt, wurde er von beiden Parteien verdächtigt. Der König entließ ihn unter dem Einfluß der Hofkreise kurzer Hand durch einen lakonischen ungnädigen Brief.
Ein Verräter war der Graf, der am 10. August von den Jakobinern fast umgebracht worden wäre, dann nach England floh, später in die Dienste Napoleons trat und dessen Gesandter in Wien wurde, sicherlich nicht.
Da nun aber, wie Kiesewetter in einer Untersuchung [S. 377]der Prophezeiungen des Nostradamus feststellt, diese durchgehends vom royalistischen Standpunkt aus geschrieben sind, ist es begreiflich, daß unter diesem Gesichtswinkel der Enkel Ludwigs XV., der nicht unbedingt seinem König durch dick und dünn beisteht, sondern über den Parteien schweben will, als Verräter gilt.
Der andere Verräter ist Saulce »unter seinen Ahnen Hüter des Öls«.
Auch dieser Name ist historisch.
Sauce, ohne l, hieß nämlich der Krämer und Gastwirt in Varennes, der Ludwig XVI. auf der Flucht erkannte und anhalten ließ. Wie Le Pelletier feststellte, waren schon die Vorfahren von Sauce seit langem Inhaber dieses Krämerladens. Wie Madame Campan[198] erzählt, saß in diesem Laden Marie Antoinette zwischen zwei Paketen Talglichtern im Gespräch mit der Frau des Inhabers Sauce. Was das »Hüter des Öls« betrifft, so entspricht dieser Ausdruck, wie auf der Hand liegt, etwa unserem »Heringsbändiger«. Er soll als despektierliche Bezeichnung des kleinen Krämers im Gegensatz zum vornehmen Narbonne dienen.
Übrigens wurde der Verrat des Sauce, bestehend in der Verhinderung der Flucht des Königs am 18. August 1791, durch Beschluß der Nationalversammlung feierlich anerkannt und durch eine Dotation von 20 000 Livres belohnt.
Hyperkritikern, die aus der Namensverschiedenheit bzw. der verschiedenen Schreibweise Saulce und [S. 378]Sauce Einwände herleiten zu können glauben, sei eröffnet, daß beide Worte dasselbe bedeuten, nämlich Brühe, und daß der Ausfall eines Konsonanten im modernen Französischen gegenüber dem hochmittelalterlichen eine außerordentlich häufige Erscheinung ist.
Der überaus erstaunliche Inhalt des Quatrain legt den Verdacht nahe, es handle sich hier um eine Fälschung, d. h. er sei erst nachträglich von einem Verehrer des Nostradamus eingeschoben worden. Da mit der Echtheit dieser Vorhersage eines unserer Hauptargumente für die Existenz eines wirklichen Fernsehens in der Zeit steht und fällt, dürfen wir uns keine Mühe verdrießen lassen, die Frage aufs gründlichste zu untersuchen.
Le Pelletier hat zu Beginn des I. Bandes seiner großen Nostradamusausgabe eine lange Reihe alter Drucke angeführt. Er benützte davon die erste unvollständige Ausgabe der »Centuries« von 1555 (Lyon Macé Bonhomme), die äußerst selten ist, ebenso die erste vollständige Edition, die Pierre Rigaud von 1558 bis 1566 in Lyon druckte. Von letzterer befindet sich ein Exemplar in der Pariser Nationalbibliothek, in der die beiden ersten Verse des Vierzeilers am Schluß der Seite 144, die beiden folgenden am Anfang der Seite 145 in Wortlaut und Schreibweise, wie wir sie oben gaben, stehen.
Da es nun von hohem Wert wäre, zu wissen, ob diese Ausgabe wirklich in den angeblichen Erscheinungsjahren herauskam und es sich nicht um eine Fälschung handelt, die später zurückdatiert wurde, wandte sich Dr. Bormann an die Nationalbibliothek, von der er folgende Auskunft erhielt:
[S. 379]»Quant à la date de l’entrée à la Bibliothèque des ›Prophéties de Nostradamus‹ de 1566, il ne m’est pas possible de la préciser. Tout ce que je puis vous dire, c’est que le vol. est depuis longtemps sur nos rayons.
Paris, 10. Octobre 1908
Da diese Auskunft insofern unbefriedigend war, als »lange« noch nichts Genügendes sagt, also immerhin die Möglichkeit einer Fälschung nicht völlig von der Hand zu weisen wäre, sahen Bormann, wie auch der Schreiber dieses die Kölner Ausgabe von 1689 an. Ihr Titel – ein Exemplar befindet sich auf der Münchner Hof- und Staatsbibliothek – lautet: »Les Vrayes Centuries et Prophéties de Maistre Michael Nostradamus, où se void réprésenté tout ce, que s’est passé tant en France, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre qu’autres parties du monde. Reveuës et corrigées suivant les Editions imprimées à Lyon l’an 1644 et à Amsterdam 1668. Avec la vie de L’Autheur à Cologne, chez Jean Volcker, Marchand libraire l’an 1689.«
Da diese Kölner Ausgabe bereits ein volles Jahrhundert vor den in Frage kommenden Ereignissen erschienen ist und sich auf ältere Editionen beruft bzw. sie nachdruckt, so ist jede Fälschung vollkommen ausgeschlossen.
Wir sehen, daß selbst die vorsichtigste Kritik dieses erstaunliche und in der Geschichte der Prophezeiungen wohl ziemlich vereinzelte Faktum anzuerkennen gezwungen ist.
[S. 380]Meinen Nachforschungen auf der Münchner Hof- und Staatsbibliothek, die von Herrn Oberbibliothekar Dr. Leidinger in der liebenswürdigsten Weise gefördert wurden, gelang es nun, noch die folgenden Ausgaben aufzufinden und einzusehen[199]:
1. Mit dem Titel: »Les Propheties de M. Michel Nostradamus. Dont il y en a trois cents qui n’ont iamais esté imprimés. Adioustées de nouveau par ledit Autheur. A Lyon chez André Olier, en ruë Tupin.«
Auf dem Titelblatt befindet sich ein Holzschnitt, Nostradamus darstellend, der, wie Dr. Leidinger, Bibliothekar Fr. Freys und ich feststellen konnten, dem ausgehenden 16. Jahrhundert angehört.
Der 34. Quatrain der IX. Centurie ist durch Druckfehler zum 24. geworden. Daß nur ein Druckfehler vorliegt, ist zweifellos, weil der vorangehende Quatrain als 33., der folgende als 35. bezeichnet ist. Er befindet sich auf der 135. Seite und lautet genau so, wie wir den Text wiedergaben.
2. Eine Ausgabe vom Jahre 1665, zu Lyon erschienen, mit genau demselben Titel wie die vorige. Unser 34. Quatrain befindet sich auf S. 135 und [S. 381]lautet, wie bekannt, mit der einzigen Änderung, daß »thuile« mit einem l geschrieben ist, daß bei »trahyr« das Schluß-r fehlt und daß es in der vierten Zeile coûteaux heißt, also mit Akzent cirkumflex.
3. Eine Ausgabe mit folgendem Titel: »Les Vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michael Nostradamus, où se void representé tout ce qui s’est passé, tant en France, Espagne, Italie, Alemagne, Angleterre, qu’autres parties du monde. Reveuës & corrigées suyvant les premieres Editions imprimées en Avignon en l’an 1556 et à Lyon en l’an 1558. Avec la vie de l’Autheur. Imprimé à Leyde, chez Pierre Leffen, l’An 1650.«
Diese Leydener Ausgabe, in der unser 34. Quatrain der IX. Zenturie auf S. 136 steht, hat einige kleine Abweichungen vom guten alten Text. Hier lauten die Verse:
Die Kölner Ausgabe endlich von 1689, in der unser Quatrain sich auf S. 155 befindet, schreibt wie der alte Olier mit der Abweichung, daß das erste Wort Lepart heißt und später »trahyt« geschrieben wird.
In Summa sind die Abweichungen also außerordentlich minimal.
Erwähnen wir nun noch, daß diese Bücher im Jahre 1803 aus den säkularisierten Klöstern in die Staatsbibliothek kamen und daß sie handschriftliche Eintragungen der Eigentümernamen in den charakteristischen [S. 382]Zügen früherer Jahrhunderte aufweisen, dann muß auch der größte Skeptiker zugeben, daß an der Authentizität der Druckwerke ein Zweifel unmöglich ist.
Wir begnügen uns aber keineswegs mit der einwandfreien Feststellung, daß die genannten Ausgaben vor 1791 erschienen, sondern legen das größte Gewicht auf die Konstatierung, daß wir die Originalausgabe benutzten und daß alle Quatrains, auf die wir in diesem Kapitel Bezug nehmen, bereits in ihr enthalten sind.
Daß es sich bei der unter 1. oben genannten Ausgabe, ebenso bei der früher zitierten der 8. bis 10. Centuries, die Baudraud veranstaltete, um die Originale handelt, oder, vorsichtiger ausgedrückt, daß diese Ausgaben ganz zweifellos aus dem 16. Jahrhundert stammen, was ja für uns das Ausschlaggebende ist, geht nicht nur aus dem Titelblatt hervor – das ja gefälscht sein könnte – es ist auch einwandfrei feststellbar an den Drucktypen, Papier, Wasserzeichen usw. Das bestätigten mir so hervorragende Kenner wie die Herren Oberbibliothekar Dr. Georg Leidinger, Vorstand der Handschriftenabteilung, und Bibliothekar Dr. Freys, Herausgeber der neuen großen Inkunabeledition. Ich legte den Herren das dortige Exemplar vor, ohne zu sagen, worauf es für mich ankäme, um ihr Urteil nicht zu beeinflussen, und erhielt die Auskunft, daß es sich zweifellos um einen Druck vor 1600 handelt.
Damit ist jeder Einwand gegen unser Material widerlegt.
Um kurz den jetzigen Stand unserer Beweisführung zu rekapitulieren: Wir bewiesen, daß Nostradamus [S. 383]in zahlreichen Fällen weltgeschichtliche Ereignisse vorhergesehen hat. Den Einwand, daß sich schließlich alles einmal ereignen wird, daß wir daher mit der Deutung eines Geschehnisses auf ein bestimmtes Quatrain, eine Selbsttäuschung begingen, widerlegten wir dadurch, daß wir nachwiesen, Nostradamus habe sogar die Namen der handelnden Personen gekannt.
Das ist so ungeheuerlich und geradezu unheimlich, daß der nächstliegende Einwand der sein wird, das Material sei gefälscht, es handle sich gar nicht um Vorhersagen des Nostradamus, sondern um Einschiebsel. Diesen sehr begreiflichen Zweifel brachten wir zum Schweigen durch Hinweis auf die Originalausgabe und zahlreiche andere, die sich auf den Druck des 16. Jahrhunderts stützen und dabei sämtlich die einschlägigen Quatrains enthalten.
Wenn wir jetzt noch die Existenz der Prophetie bestreiten wollen – den Einwurf, es handle sich hier um Berechnung, wird niemand machen – so bleibt nur mehr der arme, berühmte, zu Tode gehetzte Zufall.
Gegen ihn holen wir nun zum vernichtenden Schlage aus.
Betrachten wir noch einmal den 18. Quatrain der IX. Centurie: Die ersten beiden Zeilen lassen sich schwer oder gar nicht in eine Wahrscheinlichkeitsrechnung einfangen; wohl aber die beiden folgenden, wenigstens teilweise.
Dem großen Montmorency wird Gefängnis und Tod durch die Henkershand des Clerepeyne vorhergesagt. Das trat 1632 ein, also rund 80 Jahre nach der ersten Veröffentlichung der Prophezeiungen.
Für diese zweieinhalb Generationen kommen nun [S. 384]acht Montmorency in Frage, da die Familie in diesem Zeitraum nicht mehr männliche Mitglieder hatte[200]. Von diesen aber genau genommen auch nur Heinrich II., da er damals der einzige war, der mit einigem Recht den Beinamen »der Große« führt. Da das damalige Frankreich etwa 20 Millionen Einwohner zählte, in zweieinhalb Generationen also 50 Millionen, erhielten wir als Dividend diese Zahl. Um aber auch den Anschein, wir rechneten zu günstig, zu vermeiden, wollen wir diese Zahl durch 10 dividieren. Denn es ist ja immerhin möglich, daß wir nicht alle männliche Sprossen gefunden haben, sowie die Hälfte, weil weiblich, abziehen.
Die so gewonnene Zahl 2½ Millionen müssen wir mit der, der im Jahre 1632 existierenden Clerepeyne multiplizieren. Dieser Name ist außerordentlich selten. Wenn wir daher annehmen, daß es damals in Frankreich fünf gab[201], die so hießen und alles Männer waren, die als Soldaten oder Henker in der Lage waren eine Exekution auszuführen – was sicherlich niemand glauben wird – so müssen wir die Einwohnerzahl von 20 Millionen durch 5 dividieren und erhalten dann, nach Abzug der weiblichen, 2 000 000.
[S. 385]Jetzt können wir folgende Wahrscheinlichkeitsrechnung aufstellen:
Die Wahrscheinlichkeit, daß Nostradamus die Namen Montmorency und Clerepeyne durch glücklichen Zufall richtig erriet, ist gleich 1 : 2½ Millionen mal 2 000 000 also = 1 : 5000 Milliarden, eine vierzehnzeilige Zahl!
Dabei lassen wir alle Nebenumstände, das neue Gefängnis, die ungewohnte Stätte usw. usw. völlig außer acht, ganz davon zu schweigen, daß die erste Hälfte dieses Quatrain die wunderbarsten gleichzeitig eingetroffenenen Voraussagen enthielt.
Anders ausgedrückt: wer immer noch glaubt, daß Nostradamus durch Zufall die Namen richtig ermittelte, muß sich klar machen, daß er eins gegen 5000 Milliarden Wahrscheinlichkeiten wettet.
Um das an einem Beispiel klar zu machen:
Die Wahrscheinlichkeit, daß Nostradamus zufällig die beiden Namen erriet, ist etwa um 20 Millionen mal kleiner als die, daß jemand auf der Fahrt von Berlin nach München tödlich verunglückt!
Rechnen wir also hier mit dem Zufall, dann müssen wir selbstverständlich alle unsere Fahrpläne abschaffen, die Post hat ihren Betrieb einzustellen usw. usw., weil es hier stets die Zahl der günstigen Fälle um das Vielmillionenfache unwahrscheinlicher ist, als im Falle Montmorency-Clerepeyne.
Noch grandioser wird die Rechnung beim 34. Quatrain der IX. Centurie.
Zwischen dem Erscheinungsdatum der Prophezeiungen und dem Eintritt des Ereignisses 1791 liegen 2¼ Jahrhunderte oder rund 7 Generationen. Damals hatte Frankreich eine ungefähre Bevölkerung von [S. 386]30 Millionen oder, des leichteren Rechnens wegen, von 28 Millionen. Wenn wir diese Zahl nun durch die 7 überhaupt in Frage kommenden Generationen der Grafen Narbon dividieren, erhalten wir als Koeffizienten die Zahl 4 Millionen, von denen die Hälfte als weibliche Personen ausscheidet. Dabei ist bemerkenswert, daß m. W. die Familie zur Zeit des Nostradamus noch gar nicht existierte.
Das heißt mit anderen Worten: Daß Nostradamus gerade auf den Namen Narbon verfiel, statt einen anderen zu wählen ist – als Zufall betrachtet – eben so groß, wie der aus 2 Millionen Losen, den Haupttreffer bei einmaligem Wählen zu finden.
Waren wir über die Zeit und demgemäß auch über die Generation, der Narbon angehörte, im ungewissen, so ist so viel sicher, daß Sausse sein Zeitgenosse ist. Wieviele Sausse es damals in Frankreich gab, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. Aber so viel ist sicher, daß der Name äußerst selten ist. Nehmen wir nun an, daß es 5 Sausse damals gegeben habe, die alle – also exorbitant hoch gegriffen – Krämer waren, ja, sogar schon seit Generationen! dann erhalten wir folgende Rechnung:
Die Einwohnerschaft von 30 Millionen dividiert durch 5 ergibt als Koeffizienten 6 Millionen, wovon die Hälfte als weiblich ausscheidet.
Diesen müssen wir mit den vorher gewonnenen multiplizieren, um die Wahrscheinlichkeit von 6000 Milliarden zu erreichen.
Aber das ist keineswegs alles, selbst wenn wir von den geschichtlichen Vorgängen, die zahlenmäßig nicht faßbar sind, absehen. »Thuille« Tuillerien, gab [S. 387]es nur einmal. Demnach müssen wir die Zahl von 6000 Milliarden mit der aller damals in Frankreich befindlichen Gebäude, oder doch zum mindesten aller Schlösser – denn jedes hätte Schauplatz des Kampfes sein können – multiplizieren. Nehmen wir nur an, das damalige Frankreich habe 10 000 Schlösser besessen, was annähernd richtig sein dürfte, dann gelangen wir zu folgender Rechnung:
Die Wahrscheinlichkeit die Namen und den Schauplatz der Tuilerien zu erraten Berücksichtigen wir den übrigen Inhalt des Quatrain, das mitré, ein Fall, der in der Geschichte ohne Analogen ist usw. usw., so werden wir sagen können
Wenn also das früher angeführte Beispiel der Münzen richtig ist, dann haben wir hier streng mathematisch den Beweis erbracht, daß Zufall praktisch unmöglich ist und Nostradamus ein echter Prophet war, ausgerüstet mit der Gabe des zeitlichen Fernsehens.
Nicht um weiteres Beweismaterial anzuführen, was nach Vorstehendem ganz überflüssig wäre, sondern lediglich des historischen Interesses wegen, wollen wir noch einige Quatrains mitteilen.
Geradezu unheimlich in seiner Fülle grausiger Gesichte ist der 20. Quatrain der IX. Centurie:
[S. 388]
Der Kommentar, den ja der Leser im Geiste selbst geben wird, läßt jedes Wort als zutreffend gewählt erkennen.
König Ludwig XVI. und die königliche Familie verließen in der Nacht vom 20. zum 21. Juni 1791 die Tuilerien durch eine Geheimtüre des Appartement der Königin. Die Gazette nationale (Moniteur Universel) vom 14. Juli 1791 erzählt dieses Detail. Diese Flucht, die in Varennes endete, war bekanntlich ein »Irrweg«, denn die königliche Familie wurde gefangen genommen und nach Paris zurück geführt. Hätte der König, wie er vor hatte, die Straße nach Verdun eingeschlagen, statt nach links (Varennes) abzubiegen, wäre der Ausgang vielleicht glücklicher gewesen. Marie Antoinette trug ein weißes Kleid (pierre blanche), während der König grau (gris) angezogen war. Übrigens könnte das »blanche« auch eine Anspielung darauf sein, daß die Königin, wie Mme. Campan erzählt [S. 389](II, p. 150), in der einen Nacht der Unglücksflucht weiße Haare bekommen hatte und plötzlich wie eine Siebzigjährige aussah. Sie hatte einen Ring für die Prinzessin Lamballe machen lassen, in den einige weiße Haare eingeschlossen waren. Er trug die Aufschrift: blanchis par le malheur.
Der letzte Vers ist noch besonders inhaltreich. Die Wahl des Kapetingers, d. h. die Verwandlung der absoluten französischen Monarchie in eine Konstitutionelle, wie sie die Nationalversammlung am 21. Juni 1791 und besonders am 1. September des gleichen Jahres vorgenommen hatte, war in gewisser Beziehung sicherlich die Ursache der folgenden Greuel. Ein eiserner, absoluter Monarch, der von seiner Gewalt umfassenden Gebrauch gemacht hätte – was die Beseitigung vieler Mißstände ja keineswegs ausgeschlossen hätte – würde jedenfalls der Revolution in ihren Anfängen noch Herr geworden sein. Das letzte Wort des Quatrain, Hackmesser oder Fallbeil war bekanntlich auch das Ende des großen Dramas[202].
Recht merkwürdig ist auch folgender Quatrain (II. Centurie, Nr. 93), den Le Pelletier noch nicht ganz richtig deuten konnte, weil er 1867 noch nicht in Erfüllung gegangen war:
Bekanntlich eroberten die Italiener, nachdem sie in die Porta Pia Bresche geschossen hatten, am 20. September 1870 Rom und beseitigten die weltliche Herrschaft des Papstes. Was die Tiberüberschwemmung betrifft, die im gleichen Jahre große Verwüstungen anrichtete, so fiel sie allerdings auf den 10. und 28. Dezember, also kurz nach und nicht, wie Nostradamus angibt, kurz vor dem politischen Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Er hat sich hier also in einem unwesentlichen Punkte geirrt[204].
Bekannt ist die Fabel von der Gefangenschaft des Papstes im Vatikan. Daß aber diese Fiktion bis zur Stunde von päpstlicher Seite aufrecht erhalten wird, gibt dem Seher recht.
Der 100. Quatrain der X. Centurie lautet:
Zu deutsch: Das große Reich England wird allmächtig (pempotam, zusammengesetzt aus dem Griechischen und Lateinischen = πᾶς und potens) sein mehr als drei Jahrhunderte.
[S. 391]Große Heere (copies-copia, Truppen lateinisch) werden zu Wasser und zu Lande kommen.
Die Spanier (Lateinisch Lusitani) werden darüber nicht erfreut sein[205].«
Berücksichtigt man, daß England, als Nostradamus dies schrieb, noch klein und unbedeutend war, – hat ja Elisabeth erst die Flotte geschaffen – während Spanien die Weltherrschaft besaß, um mit dem Untergang der großen Armada 1588 eine Wunde zu empfangen, die nie mehr ganz verheilen sollte, dann wird man nicht umhin können neuerdings zu staunen. Wann die 3 Jahrhunderte abgelaufen sind, läßt sich nicht gut voraussagen. Da von Englands Weltherrschaft erst nach dem Niederringen der Niederlande, also seit der Mitte des 17. Jahrhunderts gesprochen werden kann, würde ihm noch fast ein halbes Jahrhundert gegeben sein.
Napoleon I. und seinen Hof zum Gegenstand hat der 60. Quatrain der I. Centurie:
Ein Kaiser wird in Italiens Nähe (Korsika!) geboren werden, der seinem Reiche teuer zu stehen kommen wird.
Von den Leuten, mit denen er sich verbinden wird (die seinen Hof bilden werden), wird man sagen, daß man dort weniger Prinzen, als Metzger finden wird.
[S. 392]Ein Kommentar erübrigt sich!
Nun wird man noch sagen können, daß zwar Namen und Ereignisse bei Nostradamus wunderbar stimmen, daß aber etwas sehr Wichtiges, nämlich die Angabe der Jahreszahl, fehle. Dieser Einwurf ist um so berechtigter, als es sich ja um astrologische Berechnung handeln soll. Hier aber doch die Zahl leichter zu finden sein sollte, als etwa der Name. Ja, aus dem Fehlen der Zahlenangabe könnte man zur Folgerung verleitet werden, daß es sich gar nicht um Berechnung, sondern um Hellsehen handelt, was ja teilweise, nach des Sehers eigener Angabe, richtig ist.
Nostradamus hat selbst die Jahre der Ereignisse berechnet, und zwar bis zum Schluß des angeblich ersten Geschichtsweltzeitalters im Jahre 3797 n. Chr. Was es mit diesem Schluß für eine Bewandtnis hat, können wir ruhig dahingestellt sein lassen bzw. der Zukunft überantworten.
Die Daten teilt Nostradamus nicht mit bis auf zwei. Bevor wir sie untersuchen, seien erst noch einige weniger klar ausgesprochene Zahlenangaben mitgeteilt.
So bestimmt er die Regierungszeit des großen Napoleon ganz richtig auf 14 Jahre (vom 19. November 1799 bis zum 13. April 1814). Der Quatrain ist der 13. der VII. Centurie und lautet:
Zu deutsch: Der Mann mit den kurzen Haaren [S. 393](so wird Napoleon wiederholt bei Nostradamus genannt im Gegensatz zu den französischen Königen, die lange Haare trugen, und weil er sich auch bekanntlich sein langes Haar schneiden ließ zum Zeichen der Beendigung der Revolutionszeit) wird die Gewalt (la satrapie) in der Seestadt (Toulon, das cité marine auch in Cent. VIII, Quatrain 17 genannt wird), die tributpflichtig ist bzw. war (nämlich den Engländern), an sich reißen.
Er wird die Gemeinheit vertreiben (wohl das Direktoire), die ihm von da ab (puis = depuis) feindlich sein wird; vierzehn Jahre lang wird er die Tyrannis ausüben[207].
Daß die Tatsachen richtig sind, wird niemand leugnen. Aber wie erklärt es sich, daß auch die Jahre stimmen? Zufall?!
Für irgendeinen Zweifler an der Identität der Tête rasée mit Napoleon wollen wir aus den diversen Quatrains, die aus dem Leben des großen Korsen berichten, noch einen herausgreifen. Es ist der 88. der I. Centurie und lautet[208]:
Es handelt sich natürlich um die am 15. Dezember 1809 vollzogene Scheidung von Josephine Beauharnais bzw. die Wiederverheiratung mit Marie Luise. Wir übersetzen:
[S. 394]
Wer sich an die bald nach der Verheiratung mit Marie Luise von Österreich eintretenden Katastrophen, den russischen Feldzug usw. erinnert, wird die Richtigkeit auch dieses Quatrain nicht bestreiten.
Der hartnäckige Zweifler möge im Index der großen Ausgabe von Le Pelletier die auf die tête rasée bezüglichen Quatrains nachschlagen.
Doch gehen wir zu weiteren Zeitangaben über, nicht ohne vorauszuschicken, daß Nostradamus die Jahre, in welchen seine Vorhersagen in Erfüllung gehen sollten, zu kennen behauptet und absichtlich verschweigt. Das bemerkt er einmal ausdrücklich.
Nun kann es niemand verwehrt werden, daran zu zweifeln, wenn es nicht gelingen sollte, wenigstens durch Stichproben zu beweisen, daß der Seher seine Fähigkeit nicht höher veranschlug, als sie es verdiente.
Außer Perioden, wie oben bei Napoleon, die sich häufiger finden, sind mir aus Nostradamus drei positive Zeitangaben bekannt. Die erste finden wir in einem der X. Centurie angehängten Quatrain der Ausgabe von 1605.
[S. 395]
Zu deutsch:
Das ist heller Blödsinn. Daran ist auf den ersten Blick nicht zu zweifeln. Bei einigem Nachdenken werden wir aber finden, daß die ersten beiden Zeilen notwendig eine Zeitangabe enthalten müssen. Und das ist auch tatsächlich der Fall.
Le Pelletier[209] löst in folgender absolut überzeugender Weise auf:
Der Buchstabe V kann sehr wohl als Gabel bezeichnet werden. Dann entsteht, wenn wir in der Bildersprache fortfahren, durch Unterstützung des V mit je einem Pfahl an der Seite der Buchstabe M. Der Zahlenwert dieses lateinischen M ist aber 1000.
Ein Halb-Horn, d. h. die Hälfte eines Jagdhornes, bildet ein C, dessen Zahlenwert 100 entspricht.
Ein Paar geöffnete Scheren bildet ein X mit dem Zahlenwert zehn. Dann erhalten wir ein M, sechs C und sechs X zusammen schreibend, also MCCCCCCXXXXXX die Jahreszahl 1660.
[S. 396]Die Kröte war das Wappentier der ersten Merowinger, das erst unter den späteren durch die Lilie ersetzt wurde. Es handelt sich also um einen König von Frankreich, und zwar um einen sehr mächtigen, nämlich Ludwig XIV.
Dann aber heißt die Prophezeiung: Im Jahre 1660 wird der sehr mächtige Herrscher, Erbe des merowingischen Wappens, unter sein persönliches Regiment sein ganzes Reich bringen[210].
Und diese Prophezeiung stimmt. Denn nach dem Tode des allmächtigen Kardinals Mazarin, am 9. März 1661, ergriff tatsächlich der Sonnenkönig die Zügel der Regierung mit jener Energie, die ihn in der Geschichte als Prototyp des absoluten Monarchen fortleben läßt.
Aber – wird man einwerfen können – das ist ja alles sehr geistreich, doch müssen wir es so lange für Konstruktion halten, bis nicht aus ganz klar und eindeutig ausgesprochenen Zahlenangaben mit zwingender Gewalt hervorgeht, daß Nostradamus tatsächlich [S. 397]über die Zeit der Realisierung seiner Prophezeiungen informiert war. Erst wenn wir das wissen, geben wir auch zu, daß dieser Quatrain nur absichtlich dunkel gehalten ist. Und zwar von einer Dunkelheit, die sein Verständnis vor seiner Erfüllung geradezu zur Unmöglichkeit macht.
Glücklicherweise sind wir in der Lage, auch diesen Beweis mit unbedingter Logik führen zu können.
Wie schon gesagt, wollte Nostradamus möglichst dunkel sein und warf deshalb seine Quatrains, um ja keine chronologische Handhabe zu bieten, kunterbunt durcheinander. Nur ein einziges Mal machte er eine Ausnahme: Im Briefe an König Heinrich II., den er als Widmung der zweiten Sammlung seiner Centuries vorausschickt und vom 27. Juni 1558 datiert.
Hier finden wir neben einer Zusammenstellung der wichtigsten und sensationellsten Ereignisse auch die beiden Zahlenangaben. Der 89. der kurzen Abschnitte – im ganzen sind es 118 – lautet:
». . . et sera le commencement comprenant ce de ce que durera et començant icelle année sera faicte plus grande persecution à l’Eglise Chrestienne, que n’a esté faicte en Afrique, et durera ceste-icy iusques, à l’an mil sept cens nonante deux que l’ô cuydera estre une renouation de siecle[211].«
»Und dann wird der Anfang sein, versteht sich von dem, was dauern wird, und in diesem Jahre wird beginnend eine größere Verfolgung der christlichen Kirche stattfinden, wie die in Afrika war, und ebenso lange dauern; im gleichen Jahre 1792 wird man glauben, eine neue Zeitrechnung einzuführen.«
[S. 398]Hier haben wir also zwei datierte Ereignisse von welthistorischer Bedeutung, und beide Datierungen sind richtig!
Der neue Kalender der Republik, durch Dekret des Nationalkonventes vom 5. Oktober 1793 eingeführt, begann seine Zeitrechnung mit der Herbstnachtgleiche 22. September 1792 um Mitternacht[212].
Bekanntlich ist in den christlichen Staaten seit den anderthalb Jahrtausenden unserer Zeitrechnung niemals der Versuch gemacht worden, den Kalender bzw. die Zeitrechnung zu ändern. Die Kalenderkorrektur Gregors gehört nicht hierher, da sie ja an der christlichen Rechnung festhält und nur aus praktischen Gründen, um den Kalender wieder mit seiner astronomischen Grundlage in Harmonie zu bringen, die julianische Rechnung verbessert.
Was nun den »Glauben« betrifft, eine neue Zeitrechnung einzuführen, so war der Ausdruck nur zu berechtigt. Denn die Herrlichkeit des revolutionären Kalenders war von erschreckend kurzer Dauer. Schon im Jahre 1804 beseitigte ihn Napoleon, um der christlichen Rechnung wieder die offizielle Geltung zu verschaffen.
Auch die große Kirchenverfolgung, deren Ausdruck ja die Abschaffung der christlichen Zeitrechnung war, ist historisch. Bekanntlich war die Revolution gegen den Klerus nicht weniger gerichtet, wie gegen den Adel. Man konfiszierte im Jahre 1789 den Kirchenbesitz – man schätzte 3 Milliarden! – und zwang, allerdings mit sehr geringem [S. 399]Erfolge, den Klerus, den Bürgereid zu leisten. Wer ihn nicht leisten wollte – so wurde am 26. Januar 1791 bestimmt – hatte auf sein Amt zu verzichten. Nicht genug damit, wurde das Christentum ganz abgeschafft und dafür der alberne Kultus der Göttin der Vernunft eingeführt, als ob die Religion ein Verstandes- und nicht ein Gemütsbedürfnis sei. Damals – es war im Jahre 1793 – hatte man in der Kirche Notre Dame in Paris einen Tempel der Philosophie errichtet und irgendeine griechisch kostümierte Operndiva agierte dort in der Rolle der Göttin der Vernunft. Manche trugen sich mit dem Gedanken, die Kirchtürme niederzulegen. Daß der Kalender aus Haß gegen das Christentum geändert wurde und nicht etwa aus praktischen Gründen, ist wohl auch erwähnenswert.
Das alles geschah 1793. Am 7. November dieses Jahres erschien der konstitutionelle Bischof Gobel mit einer Anzahl Geistlicher vor dem Konvent, und entsagte feierlich seinem Amt, weil es keinen anderen Kultus als den der Freiheit und Gleichheit geben könne. Übrigens war der Kultus der Vernunft niemals Staatsreligion.
Wenn also auch der Höhepunkt des Kampfes erst ins Jahr 1793 fällt, so ist die Prophezeiung des Nostradamus doch vollkommen richtig, denn die Feindseligkeiten gegen die Kirche dauerten ja mehrere Jahre.
Daß die Verfolgung länger dauern werde wie in Afrika, womit nur die Unterdrückung der orthodoxen Kirche durch die arianischen Vandalen gemeint sein kann, ging auch in Erfüllung.
[S. 400]Denn seit der französischen Revolution herrscht eine Animosität gegen die Kirche, überhaupt gegen das Christentum, wie kaum zur Zeit der Reformation gegen erstere allein. Jedenfalls dachte Nostradamus an die Saecularisation, die Beseitigung der weltlichen Herrschaft des Papstes, an die Trennung von Staat und Kirche in Italien und Frankreich, die Vorgänge in Portugal, die antikirchliche Bewegung in Spanien usw. Nach den Proben seiner Kunst ist das keineswegs ausgeschlossen. Es erfordert nicht viel Urteilsfähigkeit, um auch für Deutschland über kurz oder lang eine antikirchliche Bewegung, die hoffentlich mit der Trennung vom Staate enden wird, vorherzusagen und an einen – diesmal geistigen – Aderlaß, der stärker sein wird als die Konfiskationen zu Beginn des vorigen Jahrhunderts.
Wenn wir endlich noch hören, daß Nostradamus den Untergang des Papsttumes prophezeit – deshalb stehen seine Werke auf dem römischen Index – dann wird man auch an dem Ausdruck »Verfolgung« und dem Vergleich mit afrikanischen Verhältnissen nur mit größter Reserve zu kritisieren wagen.
Sehr merkwürdig ist auch die Prophezeiung im Absatz 109 ff. des Widmungsbriefes an Heinrich II.
»Encores par la derniere foy trembleront tous les Royaumes de la Chrestienté, et aussi des infideles, par l’espace de vingt cinq ans; et seront plus grieves guerres et batailles; et seront villes, cités, chateaux et tous autres edifices bruslés . . .«[213]
»In dieser letzten Epoche werden alle Königreiche [S. 401]der Christenheit zittern, und ebenso die Ungläubigen, den Zeitraum von 25 Jahren hindurch; die blutigsten Kriege und Schlachten werden stattfinden, Städte, Ortschaften, Schlösser und allerlei andere Bauwerke werden in Flammen aufgehen und zerstört werden usw.«
Wir stehen – wie die vorhergehenden Abschnitte des Widmungsbriefes ergeben – in einer Periode, deren Beginn Nostradamus durch die Jahreszahl 1792 festlegt. Rechnen wir dazu 25 Jahre, so kommen wir zum Jahre 1817. In diesen Zeitraum – tatsächlich schloß die Kriegsperiode ja schon 1816 – fallen so viele Kriege, wie sie nur selten die Geschichte verzeichnen kann. Um nur die wichtigsten zu nennen: die republikanischen Feldzüge gegen Deutschland und Österreich, Napoleons Expedition nach Italien und Ägypten, die Kriege in Spanien und gegen England, seine Siege über Preußen und Österreich, die Expedition nach Rußland, die Feldzüge der Verbündeten und die Niederwerfung Frankreichs, endlich der letzte durch Napoleons Flucht von Elba entfachte Feldzug, der mit dem endgültigen Siege der Verbündeten endete. Also auch diese Prophezeiung, die durch zeitliche Fixierung und Angabe der Dauer beweist, daß Nostradamus über den Verlauf der europäischen Geschichte aufs beste unterrichtet war, sehen wir im vollen Umfange erfüllt.
Das Wesentliche ist, daß die wenigen Stichproben, die wir machen konnten, unbedingt zugunsten des Sehers ausfielen. Nostradamus konnte also nicht nur zukünftige Ereignisse, die Namen der in späteren Jahrhunderten handelnden [S. 402]Personen vorhersehen, er wußte auch das Jahr anzugeben, wann seine Vorhersagen in Erfüllung gehen würden.
Das sagt er selbst im 73. Abschnitt seines Widmungsbriefes an Heinrich II.: »Wenn ich gewollt hätte, hätte ich jedes Quatrain nach der Zeit seiner Erfüllung beziffern können.«
Wir haben allen Anlaß, dem Seher das zu glauben. Wenn er aber da und dort irrte, so beweist das nichts gegen seine Kunst, denn Unfehlbarkeit wird man billigerweise bei niemand fordern.
In Nummer 86–88 desselben Briefes gibt Nostradamus in Form von Planetenperioden sogar an, wie er zur Angabe des Jahres 1792 kam. Kniepf, der sich in astrologischen Berechnungen wohl auskennt, bemerkt jedoch, daß uns der Schlüssel dazu fehlt. Nostradamus hat die einschlägigen Schriften, die er von seinen Vorfahren geerbt hatte, vor seinem Tode verbrannt.
Sollte es also wirklich möglich sein, durch astrologische Berechnung die Zukunft zu ergründen?
Wir wissen es nicht, können es uns nicht vorstellen, sind auch nicht in der Lage zu ermitteln, welcher Anteil an den Weissagungen auf Konto der Astrologie, welcher auf hellseherische Veranlagung gesetzt werden kann: das alles liegt auch außerhalb des Rahmens einer historischen Untersuchung.
Was wir aber mit allem Nachdruck betonen müssen ist, daß Nostradamus die Zukunft enthüllen konnte, wie niemand vor ihm oder nach ihm, von dem wir wissen. Er ist eines der größten Genies der Weltgeschichte.
[177] Vgl. Karl Kiesewetter, Nostradamus und seine Prophezeiungen in »Sphinx«, 3. Bd., 1887, S. 41 ff.
[178] Wie er in der Widmung der achten Centurie an König Heinrich II. von Frankreich sagt, hat er seine Weissagungen »nach dem Laufe des Himmels berechnet, in Verbindung mit einer zu gewissen Stunden eintretenden Anregung, dem Erbtum seiner Urväter«. Er brachte seinen »natürlichen Instinkt in Zusammenhang und Einklang mit einer langen fortlaufenden Berechnung, indem er Seele, Geist und Gemüt von aller Sorge, Kümmernis und Aufregung frei machte durch Ruhe und Stille des Inneren«.
[179] oder »lymphatiquant«, was mit extatisch zu übersetzen wäre. Denn »Lympatiques« nannte man diejenigen, die vom Anblick eines schönen Mädchens liebestoll wurden. Da der erste dieser sinnlos Verliebten sich ins Wasser (lympha) stürzte, erhielt der Zustand diesen Namen. Vgl. »Eclaircissement des veritables Quatrains de Maistre Michel Nostradamus«, 1656 (ohne Erscheinungsort und Verfasser), S. 59. Die Stelle findet sich in der Nostradamus-Ausgabe von Le Pelletier II, p. 15.
[180] Anatole Le Pelletier, Les Oracles de Michel de Nostradame. Paris 1867, I, p. 72 f.
[181] Vgl. A. Schultz, Das höfische Leben zur Zeit der Minnesänger, 2. Bd., S. 111 ff.
[182] Vgl. – auch zum Folgenden – Kiesewetter, Sphinx, 3. Bd. 1887, S. 44 ff.
[183] Chavigneus, Jani Gallici Facies prior. Lion 1594, p. 4.
[184] Présage 141, Le Pelletier I., p. 91.
[185] Vgl. Albert Kniepf in den Psychischen Studien, 36. Bd., 1909. S. 247 und 276. Übrigens ist es auf alle Fälle merkwürdig, daß die Vossische Zeitung schon am 28. August 1870, also vor Sedan, die Prophezeiung abdruckte mit dem Zusatz, daß Napoleon seinen Untergang für den 2. September befürchte. Damals hatte noch gar niemand in Deutschland eine Ahnung davon, daß sich Napoleon bei Mac Mahons Armee befand. – Herr Dr. R. Hennig hat die Freundlichkeit, mir seinen Aufsatz »Zur Psychologie der Deutelsucht« in der »Zeitschrift für Psychotherapie und Medizinische Psychologie« zu übersenden. Hier finde ich auf S. 186 des 2. Bandes die Angabe, der gefälschte, aber doch in so wunderbarer Weise in Erfüllung gegangene Quatrain sei gedruckt in den »Ronces et Chardons« des Chevalier Jean Baptiste François Ernest de Chatelain, angeblich S. 181. Das Buch soll 1869 in London erschienen sein. Vielleicht stammt er von einem wirklichen Propheten, der sich des Namens seines großen Vorgängers bediente.
[186] Les Oracles de Nostradame, I., p. 87 f.
[187] Le Pelletier, I, S. 93 f.
[188] Übrigens heißt Heinrich III., als Person ein jämmerliches Individuum, insofern mit Recht an dieser Stelle »le Grand«, weil er zuerst König der Polen gewesen war und erst nach Karls XI. frühem Tode die Krone Frankreichs sich aufs Haupt setzte.
[189] Vgl. auch Theodor Lindner, Weltgeschichte seit der Völkerwanderung, 5. Bd., S. 184–202.
[190] Vgl. Th. Lindner, Weltgeschichte, 5. Bd., S. 198–201, und – zum Ganzen – Le Pelletier I., p. 103 f.
[191] In der mir vorliegenden ersten Ausgabe mit dem Titel »Les Prophéties de M. Michel Nostradamus. Centuries VIII. IX. X. Qui n’ont encore iamais esté imprimés. A. Lyon, Chez Antoine Boudraud, en rue confort à la Fortune« finden sich folgende unbedeutende Varianten: Nansy statt Nanci, und deliure statt delivré. Letzteres – so auch prouez statt prouvés – noch daher kommend, daß bekanntlich das Mittelalter zwischen u und v in der Schreibweise keinen Unterschied macht.
[192] Vgl. sein anonym und ohne Druckort im Jahre 1656 erschienenes »Eclaircissement des véritables quatrains de maistre Michel Nostradamus«, p. 18. Hier ist der Name angeführt unter einer beträchtlichen Anzahl anderer, die der Astrologe vorher gewußt hatte, und in einem Ton, als sei es eine bekannte Tatsache, die es damals ja wohl auch gewesen sein mag.
[193] Essai d’éxplication de deux Quatrains de Nostradamus, Nevers 1806, p. 30–39, (nach Le Pelletier).
[194] Was die Persönlichkeit Heinrichs II. Montmorency betrifft, so war er »der Abgott des Hofes und der Provinzen, des Volkes und der Armee«. Als der Kapitän Guitaut, gegen den er im Feuer gestanden hatte, vom Richter gefragt wurde, ob er den Herzog im Kampfe erkannt hätte, sagte er mit Tränen im Auge:
»Feuer, Blut und Rauch, die ihn bedeckten, hinderten mich erst ihn zu kennen. Aber als ich einen Mann sah, der, nachdem er sechs unserer Reihen durchbrochen hatte, noch in der siebenten Soldaten tötete, da war ich mir darüber klar, daß das nur M. de Montmorency sein könne.«
Der ganze Hochadel, Freund und Feind, verwandten sich umsonst für das Leben dieses Helden, dessen Leben und Tod überreich an echter Tragik ist.
Vgl. (Michaud) Biographie universelle, 2. Aufl., 29. Bd., S. 176 ff.
[195] Vgl. A. Kniepf, Echte und gefälschte Prophetien des Nostradamus, Psychische Studien, 36. Bd., 1909, S. 276 f. und 520 ff. Er meint im ersten Vers des Quatrains könnte »en terre veu« auch eine Anspielung auf die »Entrevue« Bismarcks und Napoleon III. sein. Nostradamus liebt zweifellos den Doppelsinn und sagt oft mit einem Worte zweierlei Dinge, die beide richtig sind. Vgl. z. B. Centurie IX., Quatrain 18, »claire peyne« = clara poena und = dem richtigen Eigennamen Clerepeyne. Der Spott Hennings über diese auf alle Fälle scharfsinnige Interpretation Kniepfs ist mir daher unverständlich. Vgl. Zeitschrift für Psychotherapie, 2. Bd., S. 177 ff.
[196] Le Pelletier, I., p. 279.
[197] Walter Bormann, »Die Nornen«, S. 245–264.
[198] Campan, Mémoires sur la vie privée de Marie Antoinette, Paris 1826, p. 158.
[199] Herr Karl Graf Klinkowstroem in München besitzt eine Sammlung von 10 Nostradamus-Ausgaben, darunter die ersten. Demnächst wird in der Zeitschrift für Bücherfreunde aus der Feder dieses Gelehrten eine Nostradamus-Bibliographie erscheinen. Für die mannigfachen Förderungen sei ihm an dieser Stelle mein wärmster Dank ausgesprochen. Nach diesem Kenner ist die Ausgabe von Pierre Rigaud erst zwischen 1605 und 1610 erschienen. Die unvollständige von A. du Rosne in Lyon schon 1557. Bereits 1605 tauchen falsche Quatrains auf, z. B. die der 11. und 12. Centurie. Die Ausgabe von Benoist Rigaud erschien als erste vollständige 1568.
[200] Soviel stellte ich bei M. Desormeaux, Histoire de la maison de Montmorency, Paris 1764, 3. Bd., fest. Eines dieser männlichen Mitglieder starb bereits in der Wiege.
[201] Im Adreßbuch von Paris, von dem mein Freund Herr Konsul A. Schillinger mehrere Jahrgänge einsah, kommt der Name Clerepeyne, Clairepeyne, Clairpeyn usw. usw. überhaupt nicht vor. Ebenso der Name Saulce, Sauce, Sause, Salce, Sosse oder Soce mit allen möglichen Varianten nur einmal im Adreßbuch 1889 in der Form Sausse, in der Person eines Gewürzkrämers und einer Versicherungsgesellschaft. 1911 gibt es einen Schreiner Saucet.
[202] Vgl. Le Pelletier, I., p. 174 ff.
[203] Le Pelletier, I., p. 305.
[204] Vgl. Ferdinand Gregorovius, Wanderjahre in Italien, 2. Bd. 7. Aufl., S. 185.
[205] Le Pelletier, I. p. 143 f.
[206] Le Pelletier, I. p. 168.
[207] Le Pelletier, I, p. 213.
[208] Le Pelletier, I, p. 216.
[209] I, p. 118 f.
[210] Wer uns etwa vorwirft, die Deutung dieses Verses sei gekünstelt, möge sich der in der Vergangenheit so beliebten Chronogramme erinnern. Beispiele hierfür sind etwa: LVtetIa Mater natos sVos DeVoraVIt, d. h. die Mutter Paris verschlang ihre eigenen Kinder. Es handelt sich um die Pariser Bluthochzeit im Jahre 1572. Diese Jahreszahl ist im Text enthalten: M = 1000, D = 500, L = 50, vier V = 20 und zwei I = 2. Als weiteres Beispiel mag das Distichon auf den Hubertusburger Frieden angeführt sein:
Zählen wir nach dem oben angegebenen Vorgang die Zahlzeichen zusammen, so erhalten wir das Jahr 1763.
[211] Le Pelletier, II. Bd., p. 157.
[212] Vgl. W. Bormann, »Nornen«, S. 257 f., und A. Kniepf, Psychische Studien, 36. Bd., 1909, S. 278 f.
[213] Le Pelletier, II. p. 160 f.
[S. 403]
Es ist sattsam bekannt, daß die Theologie zu allen Zeiten und auch heute noch die biblischen Prophezeiungen für »Offenbarungen«, unmittelbare Äußerungen Gottes, hielt und hält. Wir haben zu dieser Frage nicht Stellung zu nehmen. Der Historiker hat die Aufgabe, das Tatsächliche festzustellen. Er verläßt den sicheren Boden mit dem Augenblick, wo er die Ursachen einer Erscheinung klarzulegen versucht, um völlig in der Luft zu schweben, wenn er sich hierbei gar zu mystischen Hypothesen versteigt. Die Erklärung von Erscheinungen, die wir in den Rahmen unserer derzeitigen Kenntnis der Natur noch nicht einzupassen vermögen durch transzendentale Ursachen, ist eine Bankrotterklärung.
Es bedarf deshalb keiner besonderen Betonung, daß wir der Theologie auf diesem Wege zu folgen uns weigern. Nicht nur, daß wir die dem Historiker gezogenen Grenzen dann überschreiten würden, wir kämen auch dem Problem nicht um Haaresbreite näher. Denn – selbst das Dasein Gottes vorausgesetzt – da [S. 404]wir Umfang und Inhalt dieses Begriffes nicht kennen, würden wir ein uns wenigstens teilweise, d. h. als Erscheinung Bekanntes – nämlich die einzelnen Tatsachen der Prophezeiung – durch ein völlig Unbekanntes, ja in seiner Existenz vielfach angezweifeltes X (Gott) uns verstandesmäßig näher zu bringen suchen.
Das ist aber keine Erklärung. Denn klarer wird uns etwas nur dann, wenn wir es auf bekannte oder doch bekanntere Ursachen zurückführen. Daß das hier nicht der Fall wäre, ist klar.
Immerhin mag es nicht ohne einiges Interesse sein, sich einmal zu vergegenwärtigen, welche Stellung die Theologie dem Problem der nachbiblischen Prophezeiung gegenüber einnahm.
Wir werden finden, daß die Hauptsorge der Theologen die war, die Quelle der Prophezeiungen festzustellen und zu erörtern, ob es überhaupt noch nach dem Alten und Neuen Testament Propheten gegeben habe. Denn darin, daß es sich in diesen Werken um wirkliche, und zwar von Gott unmittelbar inspirierte Propheten handelt, war man sich bis zur Stunde immer und in allen theologischen Lagern einig.
Zur Zeit des Konstanzer Konzils schon suchte der große französische Gelehrte Jean Le Charlier de Gerson (geb. 14. Dez. 1363 in Gerson, gest. 12. Juli 1429 in Lyon), Doctor christianissimus wegen seiner hervorragenden Verdienste auf dem Konzil genannt, die Frage zu ergründen. Und zwar geschah dies in der Schrift De probatione spirituum[214] und dem [S. 405]zweiten Traktat De distinctione verarum visionum a falsis.
Der Inhalt beider Schriften[215] ist kurz folgender:
Der Apostel Johannes (1. Joh. 4, 1) befiehlt mit den Worten: »Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt« Vorsicht gegenüber Propheten und Prophezeiungen. Das geschieht, weil der Satan seine Hand im Spiele haben kann (2. Korinth. 11, 14).
Die Prüfung der Geister (d. h. Propheten, Visionen usw.) ist aber ein schwieriges Ding, denn der Heilige Geist hat nur wenigen die Befähigung dazu verliehen. Genaue Kenntnis der Hl. Schrift mag ja in manchen Fällen genügen (Modus doctrinalis), in anderen reicht ein größeres inneres Gefühl, eine innere Erfahrung dazu aus (Modus experimentalis). Da der normale menschliche Verstand aber zumeist versagt, ist innere Erleuchtung fast unerläßlich (Modus officialis) (1. Korinth. 12, 10). Die mit dieser Prüfungsgabe von Gott Ausgerüsteten sind sich ihres Besitzes bewußt und auch in der Lage, bei andern anzugeben, ob sie die gleiche Fähigkeit besitzen. Das sind aber nur wenige. Nur sie sind imstande, mit untrüglicher Gewißheit zu entscheiden.
So wenig man eine allgemeingültige Regel aufstellen kann, wodurch ein Traumgesicht sich von dem, was wir wachend sehen, unterscheidet, wiewohl doch [S. 406]der Wachende es weiß, was er wirklich sah, und sich erinnert, daß er ähnliches im Traum sah, so weiß auch der göttlich Erleuchtete, daß und wann er es ist. Und doch kann auch er auf den Gedanken kommen, teuflischem Blendwerk zum Opfer gefallen zu sein; denn wenn er auch wach ist, so kann er darum doch im höheren Sinne dem Göttlichen gegenüber schlafen. Das erkannte schon der selige Gregorius, als er schrieb: »Der Geist der Prophetie ist nicht immer in der Gewalt der Propheten, noch in ihrem eigenen klaren Bewußtsein[216].«
Die Prüfung modo doctrinandi, also auf Grund einer Lehrmethode, hat auf folgende Punkte ihr Augenmerk zu richten: 1. Auf die Person dessen, der eine Erscheinung hat. 2. Auf den Inhalt der Offenbarung. 3. Auf die Ursache der Mitteilung dieser Offenbarung. 4. Insbesondere zu wessen Beratung die Offenbarung geschieht und mitgeteilt werden soll. 5. Welchen Lebenswandel derjenige hat, dem etwas offenbart wurde, und 6. Woher diese Person stammt.
Auf diese einzelnen Fragen geht Gerson näher ein, wobei er eine Kritik beweist, die man dem Mittelalter im allgemeinen nicht zutrauen möchte. So sagt er z. B. zum 3. Punkt, der die Gründe prüft, aus denen sich jemand zur Mitteilung seiner Vision bewogen fühlt, u. a.:
Der Anhörende müsse sich hüten, dem Offenbarenden Beifall zu spenden, oder ihn zu bewundern. Vielmehr solle er widersprechen und tadeln, ihn als hochmütig verächtlich behandeln, weil er sich einbilde, [S. 407]mit Gott und den Engeln in Verkehr zu stehen. Man solle aus der Geschichte Beispiele dafür anführen, wie schädlich und trügerisch solche Einbildungen seien und wie verabscheuungswürdig die Sucht sei, Visionen zu erleben. Auch vor Täuschungen durch den Teufel müsse man warnen. Denn oft habe das Verlangen, zukünftige und verborgene Dinge zu wissen, Wunder zu sehen und zu tun, die Menschen betrogen und vom wahren Gottesdienst abgeführt.
Beim vierten Punkt macht Gerson den sehr verständigen Einwand, man solle doch bedenken, wenn etwas durch menschliche Mittel erreichbar sei, warum man dann noch nötig habe, eine unmittelbare Unterweisung des Himmels zu erwarten. Auch sei genau zu prüfen, welche Gründe jemand habe, seine Visionen mitzuteilen. Er rate, mit dem Apostel Petrus ehrerbietig zu sprechen: »Herr, gehe hinaus von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin zu gering und deiner Erscheinung unwürdig, die ich in diesem Leben weder verlange noch annehme, sondern vielmehr von mir abwende usw.«
Zum sechsten Punkt bemerkt Gerson, daß der hl. Bernhard niemals hätte bestimmen können, woher ein Geist (Vision) käme, wiewohl er öfter dessen Gegenwart gespürt habe. Deshalb müsse man mißtrauisch werden, wenn eine geringe Person genau zu wissen sich einbilde, woher der »Geist« komme. Wisse man doch noch nicht einmal im einzelnen Falle, woher eine Anfechtung komme. Dabei gäbe es viererlei Arten »Geist«: den Gottes, eines guten Engels, eines bösen Engels und den menschlichen, der sich wieder differenzieren lasse.
[S. 408]Soweit Gersons Ansichten in Nuce.
Besonders das 17. Jahrhundert beschäftige sich wieder viel mit unserer Materie, wobei die lutherischen Theologen begreiflicherweise sich an Luthers Ansichten anschlossen. Dieser hatte im 8. Schmalkaldischen Artikel von der Beichte sich dahin geäußert, daß alle nachtestamentliche religiöse Offenbarung ein Werk des Teufels sei, aber auch Prophezeiungen in weltlichen Dingen sei wenig Glauben beizumessen, wenn er deren Existenz auch nicht leugnet[217].
Es hat für uns wenig Interesse, im einzelnen den Streit der Theologen zu verfolgen. Wertvoll aber ist die Feststellung, daß man sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts so ziemlich darauf einigte, daß »noch heut zu Tage sich solche Offenbarungen ereignen könnten, welche den Zustand der Kirche, oder der Policey, oder das gemeine menschliche Leben insonderheit angiengen[218].« Offenbarungen religiöser Natur aber wurden verworfen.
[S. 409]Diese Konkordienformel am klarsten gefaßt hat Johann Olearius[219]. Aus dem Lateinischen übersetzt heißt sie:
»Man kann zwar nicht alle Erscheinungen oder besondere Offenbarungen leugnen, soweit sie die Zukunft [S. 410]der Kirche (soweit deren äußerer Zustand in Frage steht), oder des Staates, oder einer einzelnen Person (als da sind die Visionen Sterbender, Warnungen vor drohenden Gefahren usw.) betreffen. Nicht erlaubt jedoch ist, um in einzelnen Fragen des Glaubens oder der Sittlichkeit zu einer bestimmten Meinung zu gelangen, entweder auf eine unmittelbare innerliche oder äußerliche Offenbarung zu bauen oder eine solche von Gott zu erbitten oder gar mit Bestimmtheit zu erwarten. Noch viel weniger darf man glauben, ein Mensch könne durch sie (die Offenbarung) mit Gott inniger vereint und gleichsam vergöttlicht werden.«
War man sich so in der Anerkennung der Prophetie, wenigstens soweit das profane Leben in Frage kam, einig, so drängte sich doch naturgemäß die schon, wie wir sahen, Gerson beschäftigende Frage auf: wie erkennt man eine echte Offenbarung?
Löscher suchte in seiner Disputation die Beantwortung im wesentlichen in Gersons Kriterien, die er auf 8 vermehrt, durch Hinzunahme der Forderung, der Offenbarende müsse über seinen gesunden Menschenverstand verfügen und weder körperliche noch geistige Defekte haben, und ferner: eine Prophezeiung könne erst dann für wahr gelten, wenn sie eingetroffen ist und sie weder der wahren Glaubenslehre, noch den guten Sitten zuwiderläuft.
Man wird zugeben müssen, daß man mit dem besten Willen keinen strengeren Maßstab anlegen kann. Es kann gewiß nicht ohne Interesse sein, daß derselbe Kampf, der heute noch nicht ausgefochten ist, bereits vor 2 Jahrhunderten zugunsten der Prophetie [S. 411]entschieden wurde. Allerdings nicht auf dem Wege zwingender Beweise, sondern durch den Glauben. Während aber die heutige offizielle Wissenschaft treu ihrem guten alten Brauch die ausgetretensten Wege immer noch weiter auszutreten, dafür aber dem Neuen kein Verständnis entgegenzubringen, die Frage völlig ignoriert, so daß es auch hier wieder Aufgabe der Outsider ist, eine neue Wahrheit zu finden, hatte man vor zwei Jahrhunderten wenigstens Verständnis für ihre Bedeutung. Damals schon hat die neue und im Grunde Jahrtausende alte und durch tausendjährige Erfahrung bestätigte Lehre ihre Feuerprobe bestanden. Denn daß es nicht leicht war, Luthers Autorität und die Bedenken großer Theologen zu beseitigen, liegt auf der Hand. Allein es gelang doch, wie es in wenigen Jahrzehnten wieder gelungen sein wird.
Daß die Theologen mit der Ablehnung der Prophetie in religiösen Fragen das Richtige trafen, wenn auch aus ganz anderem Grunde, als sie meinten, scheint mir festzustehen. Auch wir machten bei der Kontrolle der Voraussagen die Beobachtung, daß sie sehr häufig eintreffen, wenn sie profaner Natur sind, dagegen aber phantastisch und unrealisierbar werden mit dem Moment, wo religiöse Vorstellungen sich einmischen.
Der Grund hierfür dürfte mit Mystik nicht das allergeringste zu tun haben. Er liegt, scheint mir, daran, daß die Hellseher und Hellseherinnen häufig – wiewohl das mit ihrer Gabe an sich nicht notwendig verbunden ist – zu religiösen Wahnideen neigen. Deshalb wogen in ihrem Unterbewußtsein alt- und neutestamentliche, oft unverstandene Vorstellungen [S. 412]und, oft wörtliche, Erinnerungen, extravagante Hoffnungen, Wünsche und Befürchtungen durcheinander. Dazu kommt wohl auch die – im wachen Zustande nicht eingeräumte – Einbildung, etwas Besonderes, womöglich ein neuer Messias zu sein, eine Einbildung, der die Somnambule willenlos die Zügel schießen läßt.
Bei der Vorhersage profaner Dinge sind diese Faktoren weit besser ausgeschaltet. Wenn auch die Kraft, durch deren Hilfe die Prophetie zustande kommt, wie ungezählte andere, uns noch nicht näher bekannt ist, so befinden wir uns doch hier, befreit von jeglicher Mystik, auf dem festen Boden des Experimentes.
Doch kehren wir zu den alten Theologen zurück!
Auf die Frage, was man von einer bestimmten Prophezeiung zu halten habe, gibt Gottlieb Wernßdorff in seiner Disputation »De Primordiis emendatae per Lutherum Religionis« (Wittenberg 1708)[220] folgende Antwort:
Man muß drei Fälle beim Eintreffen einer Prophezeiung unterscheiden: erstens daß sie Casu, durch Zufall, zweitens Iudicio, durch Berechnung, und drittens daß sie Afflatu Numinis, durch göttliche Eingebung sich erfüllten. Wir sehen hier also eine Weiterbildung Löschers! Der Gedankengang ist genau der gleiche, den wir, aus selbständigen Erwägungen dazu geführt, in dieser Untersuchung einhielten.
[S. 413]Für die Kritik, die Wernßdorff walten läßt, diene folgende Geschichte als Beispiel:
Als Johann Jessenius, ein böhmischer Arzt und Kanzler der Akademie zu Prag, als Gesandter aus Ungarn zurückkam, wurde er in Wien gefangen gesetzt. Bevor er sein Gefängnis wieder verließ, schrieb er die folgenden 5 Buchstaben an die Wand: I. M. M. M. M. Niemand konnte den Sinn enträtseln bis auf den Erzherzog Ferdinand, nachmaligen Kaiser Ferdinand II. Er las: Imperator Matthias Mense Martio Morietur, was später eintraf, denn Kaiser Mathias starb im März. Außerdem schrieb er aber darunter: Jesseni Mentiris, Mala Morte Morieris, d. h. Jessenius du lügst, du wirst eines bösen Todes sterben. Als das Jessenius hörte, sagte er – und das beweist, daß er die Mächtigen seiner Zeit kannte: »Wie ich nicht gelogen habe, so wird sich Ferdinand bemühen, nicht zum falschen Propheten zu werden.« Darin behielt er recht, denn er wurde 1620 hingerichtet.
Wiewohl also beide Vorhersagen eintrafen, führt Wernßdorff das doch lediglich auf Zufall zurück. So leichtgläubig, wie wir es gerne ihnen zuschreiben, waren unsere Vorfahren gar nicht!
Das Eintreffen durch Vorherberechnung ist zu einleuchtend, als daß wir uns hier weiter mit den Beispielen Wernßdorffs aufhalten wollten. Was der Verfasser Afflatu Numinis nennt, ist natürlich die einzige Art der Prophezeiung, die für uns in Frage kommt und der wir diese Untersuchung widmeten. Es ist eben die Prophezeiung auf einem Wege, der die fünf Sinne und das Denkvermögen ausschaltet, dafür aber Kräfte spielen läßt, die wir nicht weiter [S. 414]kennen und die auch nur eine verschwindende Minderheit besitzt oder wenigstens anwendet. Es handelt sich für uns zwar nicht um ein übernatürliches Phänomen – so wenig wie Hypnotismus und räumliches Fernsehen übernatürlich sind – wohl aber um ein übersinnliches.
Demnach genügt es keineswegs, wie Wernßdorff unter Hinweis auf Berechnung und Zufall richtig hervorhebt, daß eine Vorhersage eintrifft, um sie unter die Prophezeiungen aufzunehmen. Vielmehr ist es lediglich die Art und Weise, auf welche eine Vorhersage zuwege kam, die ihr ihren Platz unter den Prophezeiungen anweist. Am Charakter der Vision ändert auch die Tatsache nichts, daß diese oder jene – bei solchen religiöser Art fast alle – nicht in Erfüllung gehen. So wenig wie der verstümmelte Text etwas gegen die drahtlose Übermittlung einer Depesche beweist, oder so wenig jemand die menschliche Denkkraft leugnen wird, wiewohl es bekanntlich sehr wenig Menschen gibt, die immer fehlerlos und logisch richtig denken.
Ändert demnach das Nichteintreffen einer Prophezeiung auch nichts an ihrem visionären Charakter, so ist es doch in anderer Weise keineswegs bedeutungslos. Denn wir werden in Visionen, denen in der Wirklichkeit kein Äquivalent gegenübersteht, geneigt sein, Halluzinationen, nicht aber Äußerungen einer besonderen Prophetengabe zu erblicken.
Wenn wir auch weit davon entfernt sind zu versuchen, die Prophetie zu erklären – die Naturwissenschaft hat diese meist nur auf Prägung neuer Worte hinauslaufende Illusion längst aufgegeben – so reizt [S. 415]es doch möglichst die Fehlerquellen zu ermitteln. Denn daß solche existieren müssen, ist einleuchtend, da es sonst nicht verständlich wäre, weshalb Personen, die durch zahlreiche zutreffende, Zufall und Berechnung ausschließende, Prophezeiungen, den Beweis für ihre Gabe erbrachten, doch da und dort irren.
Es muß also unsere Aufgabe sein zu versuchen die Kriterien festzustellen, die erfahrungsgemäß sich bei den unerfüllten Prophezeiungen finden. Daß wir hier nicht aprioristisch oder deduktiv vorgehen können, ist einleuchtend. Denn wo es sich um eine zurzeit noch so rätselhafte Erscheinung handelt, wie die vorliegende, wäre die Aufstellung eines Dogmas oder auch nur einer Theorie Verblendung. Es kann sich also nur um schüchterne Hypothesen handeln.
Mit vollem Bewußtsein verlasse ich hier die historische Basis, um mich auf ein Gebiet zu begeben, das mir fremd ist. Sollte es mir trotzdem gelingen durch aus den Tatsachen selbst gewonnene Schlüsse das Richtige zu treffen, so wäre mir das eine nicht geringe Genugtuung.
Schon weiter oben konstatierten wir, daß 1. religiöse Visionen so gut wie nie eintreffen. Es handelt sich hier eben entweder überhaupt nicht um richtige Visionen, sondern um Ausflüsse einer überhitzten Phantasie, oder aber es wird der Wunsch Vater des Gedankens.
2. Sehen wir mit Frau de Ferriëm[221] eine Fehlerquelle in den von seiten der Sitzungsteilnehmer geäußerten Wünschen oder bestimmten Fragen! »Die Gesichte müssen am besten spontan eintreten. Die [S. 416]spontan kommenden Visionen und Weissagungen haben sich als die zuverlässigsten erwiesen und tritt die Clairvoyance auch spontan bei mir ein. Wenn jemand z. B. wünscht, ich soll ihm seine Zukunft sagen oder etwas über seine Vergangenheit – ich könnte es nicht bzw. könnte es wenigstens nicht so ohne weiteres. Wie bemerkt, sehe ich fast täglich geistig genug und vielerlei, aber ohne irgend etwas Bestimmtes in dieser Beziehung gewünscht zu haben. Wohl könnte die gewünschte Clairvoyance, in welcher ich dem Betreffenden die questionierten Mitteilungen über seine Person usw. machen kann, eintreten; zu garantieren vermag ich indes nicht dafür. Noch weniger vermag ich aber auch dann, wenn solche Visionsmitteilungen oder Weissagungen durch mich gegeben werden, nicht die Gewähr dafür zu übernehmen, ob das Gesagte, soviel auch sonst schon immer, wie konstatiert worden, nach dieser Richtung eingetroffen ist, auch wirklich eintrifft; denn ich fürchte leicht, daß infolge des geäußerten Wunsches und des dadurch, wenn auch unmerklich auf mich ausgeübten geistigen Druckes die Vision, die Weissagung auch, ohne daß ich es eben will, ein Bild meiner für mich selber unbemerkt einsetzenden Phantasie werden könnte.« Am wichtigsten ist der Satz der Frau de Ferriëm: »Was mich betrifft, so kann ich auf Wunsch fast nie prognostizieren oder hellsehen.«
Diese von der Seherin abgegebene Erklärung ist ohne weiteres einleuchtend. Sie dürfte auch für das Nichteintreffen vieler unter den erwähnten Bedingungen zustande gekommener Weissagungen genügende Begründung sein.
[S. 417]Damit beantwortet sich auch die Frage, was von Prophezeiungen der gewerbsmäßigen Wahrsagerinnen zu halten ist, ganz von selbst. Es soll weder bestritten werden, daß viele von ihnen die Gabe des Hellsehens besitzen, noch auch daß manche Vorhersage verblüffend genau, ja bis ins kleinste Detail, eintrifft, wie ja solche Personen auch oft aus der Vergangenheit Dinge wissen, die sie auf normalem Wege unmöglich in Erfahrung gebracht haben können.
Das hindert aber nicht, daß wir mit dem größten Mißtrauen diesen Prophetinnen begegnen müssen. Wer für einige Mark sich täglich so und so oft in einen Zustand versetzen soll, der nicht viel mehr vom Willen abhängig ist, wie der Fall eines Meteors, muß notgedrungen zum Schwindel greifen, um seine Kundschaft nicht zu verlieren. Er wird allgemeine Redensarten gebrauchen, die mehr oder minder für jeden passen. Er wird, selbst wenn er eine Vision haben sollte, sie vermittelst der Phantasie nach Tunlichkeit ausmalen. Er wird sich auch absichtlich möglichst dunkel und geheimnisvoll ausdrücken. Schließlich verstehen diese Frauen wohl auch oft mehr von den Menschen und ihren Wünschen, als von der Prophetie, so daß nicht dringend genug vor ihrer Konsultation gewarnt werden kann.
Aber selbst angenommen, die Wahrsagerinnen könnten wirklich dem einzelnen die Zukunft vorher verkünden – was wäre der Gewinn? Entweder sie stellen goldene Berge – buchstäblich und metaphorisch – in Aussicht, dann wird die Mehrzahl der mit solchem Prognostikon Beglückten durch die Gegenwart hasten, nur den Blick auf das verheißene Ziel gerichtet, um, [S. 418]selbst wenn sie es ja erlangen sollten, zu spät zu bemerken, daß sie um ihr Lebensglück, um den Genuß des Augenblickes, betrogen wurden.
Oder aber die Prophetie lautet traurig, dann wird das arme Opfer seiner unangebrachten Neugier wie Damokles sich keiner frohen und sorglosen Minute mehr erfreuen.
Das Leben eines jeden von uns ist nun mal ein großes Drama. Mögen die retardierenden Momente auch mehr oder minder zahlreich sein, mag der Abgang mit größerem oder geringerem Glanz, mit größerer oder geringerer Pein verbunden sein:
omnes una manet nox et calcanda semel via leti[222].
Schlimmer aber noch als das eigene Ende, ist die Trennung von unseren Lieben, ist der Verlust der Achtung vor sich selbst oder jahrelanges Siechtum. Und wie vielen von uns steht das bevor?!
Wenn wir daher dem Schicksal für etwas danken müssen, so ist es für seine Dunkelheit. Gibt es Prophezeiungen, gibt es Personen, die die wunderbare Gabe besitzen, unsern Lebensweg zu schauen, bevor wir ihn vollendeten; so bewahre uns ein gütiges Geschick davor, in ihren Bannkreis zu geraten!
So sehr es das Problem der Prophetie verdient, daß die Besten sich mühen, das Rätsel dieser Naturkraft zu lösen, – denn welche schönere Aufgabe könnte der Wissenschaft winken als die durch Findung einer neuen Wahrheit das Weltbild zu ergänzen? – so sehr wir bestrebt sein müssen, nach Ausschaltung der Fehlerquellen die allgemeingültige Formel in Händen [S. 419]zu halten, so sehr – das kann jetzt schon gesagt werden – wäre es zu beklagen, wenn der Einzelne sich dieses Instrumentes bedienen würde, um damit Dinge zu enthüllen, die eine gnädige Vorsehung in Dunkel tauchte.
3. Eine weitere Fehlerquelle ist die Gedankenübertragung. Mir ist sehr wohl bekannt, daß die gelehrte Zunft dieses Phänomen noch nicht anerkennt, wiewohl die Beweise dafür längst erbracht sind. Es ist hier nicht der Ort näher darauf einzugehen, wir wollen uns daher auf folgende Erwägung beschränken:
Wenn Gedankenübertragung überhaupt vorkommt, dann liegt es auf der Hand, daß wir sie am ehesten bei besonders sensiblen Individuen finden werden. Nun scheint es doch unbestreitbar zu sein, daß die mit der Gabe des Hellsehens ausgestatteten Personen besonders feinfühlig sind. Wir werden also bei ihnen auch zuerst Reaktion auf Gedanken anderer voraussetzen dürfen. Angenommen nun in einer prophetischen Sitzung denke jemand intensiv in einer bestimmten Richtung mit, so liegt die Vermutung einer dadurch herbeigeführten Beinflussung nahe. Sie wird zur Gewißheit durch die Bekundungen der Somnambulen selbst.
Wenn wir die Möglichkeit einiger Visionen zugeben, so braucht man durchaus nicht mit gewissen Spiritisten an ungezogene oder böswillige Kobolde zu glauben, die aus reiner Freude am Unfug falsche Bilder vorgaukeln. Man braucht auch mit Dr. Egbert Müller[223] nicht einverstanden zu sein, wenn er schreibt: [S. 420]»Nicht in Erfüllung gehende Visionen können dennoch wirkliche Visionen sein, weil es doch scheinen will, daß für die Vorgeschichte des Sehers von dem wirklich in der Zukunft geschehenden erst noch Zwischengesichte durchdrungen werden müssen, gerade wie wir mit unserem Denken oft erst durch eine Fülle unzutreffender Gedanken endlich zu dem brauchbar richtigen hingelangen.« Denn wenn wir so argumentieren, dann machen wir uns die Sache zu leicht. Eine richtige Vision kann doch nur da vorliegen, wo sich wirklich die Ereignisse so abspielen, wie der Seher sie schaut. Aufs Räumliche übertragen: das beste Fernrohr, das uns Dinge zeigt, die für das unbewaffnete Auge unsichtbar sind, sieht doch Dinge, die wirklich da sein müssen, wenn auch in großer Ferne. Machten wir uns den Gedanken Dr. Müllers zu eigen, dann könnte ein Fernrohr uns auch Objekte zeigen, die nicht existieren oder doch solche, die in Wirklichkeit anders aussehen. Denn was den »Zwischengesichten« in der Zeit entspricht, wären hier die räumlichen Strecken zwischen unserem Auge und dem Objekt.
Der Vergleich dürfte zeigen, daß Dr. Müllers Deutung irrig ist.
Die Vision muß, wenn sie als Prophezeiung gelten soll, unbedingt richtig sein. Allerdings braucht sie keineswegs den Schluß eines Vorganges, noch nicht einmal den wichtigsten Moment herauszugreifen. Es genügt völlig, wenn sie, wie etwa eine Platte des Kinematographen, nur einen Moment einer Handlung festhält.
Mir scheinen irrige Visionen – nicht etwa Halluzinationen [S. 421]– nicht wahrscheinlich. Wir sind auch nicht gehalten, sie anzunehmen. Denn wie wir ja auch in die größte Verlegenheit kämen, aus einem oder wenigen Momenten des kinographischen Vorganges die ganze Handlung, deren Vorstadien und besonders deren Ende zu rekonstruieren, so muß es auch auf die größten Schwierigkeiten stoßen, eine flüchtige Vision richtig zu interpretieren.
Méry meint, die vom Propheten verkündeten Ereignisse könnten doch von ihm nicht aus dem Schoß der Zukunft herausgenommen werden, wie etwa Zigarren aus ihrer Kiste. Vielmehr handle es sich um die Wahrnehmung entfernter Wirklichkeiten, deren Ursachen zur Zeit der Vorhersage bereits gegeben sind.
Verdient der letzte Satz unsere Zustimmung, so der vorhergehende unseren teilweisen Widerspruch.
»Genommen« wird vom Propheten gewiß nichts, denn die Visionen, wenigstens die echten und zuverlässigen, kommen ebenso spontan – darin müssen wir den Hellsehern glauben – wie die Träume. Die produzierende Tätigkeit des Sehers, wenigstens die bewußte, ist also annähernd gleich Null. Wohl aber sind die einzelnen Visionen so isoliert, wie es einzelne kinematographische Platten wären, die uns, aus dem Zusammenhang der Handlung gerissen, vor Augen gestellt würden. In diesem Sinne entsprechen also die Visionen allerdings den Zigarren, nur daß sie nicht von uns freiwillig aus der Kiste gewählt, sondern von einem andern uns in die Hand gedrückt werden.
Der Vergleich hinkt allerdings: zunächst ist eine Zigarre ein von der Umgebung losgelöster Einzelgegenstand, [S. 422]während die Vision gleich einem Relief stets mit dem Hintergrund – unserem Bewußtsein, Unterbewußtsein oder Phantasie, sagen wir kurz: unserer Seele – zusammenhängt. Sie kann deshalb nicht isoliert betrachtet werden.
Dazu kommt ein zweites, noch wichtigeres Moment: Die Vision ist doch kein Gegenstand, den wir nach Herzenslust und mit aller Gründlichkeit beliebig lange betrachten können, sondern sie ist in Bewegung, ein Vorüberhuschen, genau wie die Films des Kinematographen.
Nehmen wir an, jemand von uns solle einige Momente einer kinematographisch reproduzierten Handlung erzählen. Er würde nicht nur im Detail große Irrtümer begehen, er würde auch vor allem wichtige Momente übersehen, Nebensächliches in den Vordergrund rücken und so durch unrichtige Beleuchtung das Bild verzerren. Dazu aber kommen Kausalitätsbedürfnis und Kombination. Er wird also Vorstadien rekonstruieren, die seines Erachtens den veranschaulichten Momenten vorangingen, ohne sich dieser seiner Tätigkeit bewußt zu sein. Ferner wird er das Bild automatisch fortsetzen und auch dieses sein Phantasieprodukt für etwas wirklich Gesehenes halten.
Nun ist noch zu bedenken, daß auch das schnell vorbeiziehende Gemälde des Kinematographen aus Einzelbildern zusammengesetzt ist, von denen jedes wenigstens ganz scharfe Konturen hat. Die Folge der Einzelbilder ist nur zu schnell, um jedes scharf erfassen zu können, aber die Bilder selbst sind vollkommen deutlich.
[S. 423]Anders bei der Vision, oder doch bei sehr vielen Visionen. Hier ziehen die Bilder nicht nur oft mit großer Geschwindigkeit vorüber, sie sind auch in sich häufig unklar, nebelhaft.
Berücksichtigen wir diese Faktoren alle, so liegt die Erklärung – unter der Voraussetzung, die Vision sei echt und die Bilder wahr – für irrige Voraussagen auf der Hand: Sie beruhen auf Fehler des Sehens oder Hörens, auf Fehler des Gedächtnisses und endlich auf Fehler der Interpretation.
Denn daß die Auslegung des Gesehenen von ausschlaggebender Bedeutung ist, leuchtet ohne weiteres ein.
Folgende Fehler scheinen mir in der Natur der Sache zu liegen:
1. Die Seherin erblickt ein Landschaftsbild, das sie nicht kennt. Sie wird in diesem Falle eine allgemeine Voraussage machen, die zwar die Handlung bzw. die Geschehnisse – unter den obigen Einschränkungen – richtig enthält, aber den Ort offen läßt. Diese Vision hat dann durch ihre Unbestimmtheit weniger Wert und wird von den Skeptikern nicht als Beweis für die Tatsache der Prophezeiung zugelassen. Denn, so heißt es dann sogar mit einigem Recht: jedes Unglück wird sich mal irgendwo ereignen. Das würde man z. B. auch gegen die Vorhersage des Scheiterns der »Gneisenau« anführen können, wenn nicht andere Momente, etwa der Bart des Kapitäns, dagegen sprächen. Rein als Geschehnis genommen, d. h. Auflaufen eines deutschen Kriegsschiffes auf einen Felsen, hätte die Vision aber wenig Wert, da das ja ein Unfall ist, dem leider unsere Marine schon öfter Verluste zuzuschreiben hatte.
[S. 424]2. Die Seherin erblickt ein Landschafts- oder ein Stadtbild, das sie mit einem bekannten identifizieren zu können glaubt. Sie wird nun apodiktisch erklären: Xstadt wird von einem Erdbeben zerstört! Tatsächlich hat sie sich aber insofern geirrt, als das Stadtbild zwar richtig gesehen, aber falsch gedeutet war. Es war nämlich Astadt. Hier liegt dann der Fehler nicht in der Vision, sondern in der falschen Interpretation eines richtig gesehenen Vorganges.
Da auch die weitestgereiste Seherin unmöglich die ganze Erde kennen und ihr Bild – das ja noch dazu im Laufe der Jahre sich ändert – im Gedächtnis behalten kann, da auch Irrtümer in der Agnostizierung leicht vorkommen können, so werden die beiden genannten Lücken bzw. Fehler der Interpretation sehr häufig sein.
3. Die Seherin liest eine Inschrift oder ein Datum falsch, weil die betreffende Tafel ihr nur verschwommen erscheint.
4. Die Seherin liest zwar die Tafel richtig, kombiniert dann aber falsch.
Ein solcher Fall ist mir in der Praxis passiert: Eine bekannte Dame, Hellseherin, aber weder ausgebildet noch gegen Entgeld ausübend, erzählte mir, sie hätte den Tod des Prinzregenten von Bayern für den Herbst 1907 vorhergesehen. Natürlich fragte ich, wie sie das gemacht habe, da ich damals noch Visionen für unmöglich hielt und es mir die größte Freude gemacht hätte, die Dame ad absurdum zu führen. Sie teilte mir dann mit – und ich brachte es zu Papier – sie habe fürstlichen Trauerfeierlichkeiten, die sie beschrieb, in der Theatinerkirche beigewohnt, [S. 425]habe auch die Inschrift auf dem Katafalk gesehen, aber, wegen zu großer Entfernung, nur verschwommen lesen können. Immerhin konnte sie den Monat entziffern – es war der November – und vom Datum mit Bestimmtheit die erste Ziffer 1, und dann glaubte sie noch eine 3 oder 5 gesehen zu haben. Das wisse sie aber nicht genau.
Tatsächlich starb ein königlicher Prinz am 12. November des genannten Jahres und wurde, wie in der Vision gesehen, beigesetzt. Der Landesherr war es aber nicht. Hier war nicht die Vision falsch, sondern die Interpretation. Die Dame hatte sich gedacht, es sei der Regent.
Daß Irrtümer der sinnlichen Wahrnehmung auch beim Hören von Tönen vorkommen können, und daß ferner die irrige Interpretation sich auf alles erstrecken kann, leuchtet ein. Wir wollen daher auf diesem Punkt nicht weiter verharren, um mit der Konstatierung zu schließen, daß eine falsche Prophezeiung sehr wohl bei richtiger Vision möglich ist, ja daß sogar in der Regel die Prophezeiung keine exakte Wiedergabe des auf übersinnlichem Wege Wahrgenommenen sein wird. Deshalb beweist das Nichteintreffen einer Vorhersage gar nichts gegen die Tatsache, daß es richtige Prophezeiungen gibt.
Bisher nahmen wir an, daß es sich um richtige Visionen handelt, wenn sie auch – etwa durch Gedankenübertragung – beeinflußt sein mögen. Aber sehr häufig wird der Seher eine Vision zu haben glauben, und es ist gar keine; die Phantasie spielte ihm einen Streich.
Da die Grenzen zwischen Vision und Halluzination [S. 426]bzw. Phantasiebild sehr schwer zu ziehen sind, wohl oft noch schwerer als die zwischen Traum und Wachen, so kommt es zweifellos sehr häufig vor, daß die Somnambule in Trance gewesen zu sein glaubt, während sie wachte. Dann wird sie etwas als eine auf übersinnlichem Wege gewonnene Wahrheit verkünden, was nur ihr Phantasieprodukt ist.
Aus allen diesen Fehlerquellen, die wir hier aufzuzeigen versuchten, ohne uns einzubilden, Vollständigkeit erreicht zu haben[224], geht so viel mit Sicherheit hervor, daß es weder leicht ist eine richtige Vision bzw. Prophezeiung als solche zu erkennen und zu interpretieren, noch auch zulässig ist aus Irrtümern, die der Seher begeht, zu folgern, daß es kein zeitliches Fernsehen gibt.
Ein von mir im übrigen hochverehrter Gelehrter suchte sich über die Realität des Fernsehens zu informieren, indem er Hellseherinnen oder Personen, die im Rufe standen, es zu sein, die Fragen vorlegte: was er in der Tasche habe? was er heute Mittag gegessen habe? usw. Da die betreffenden Personen darauf meistens die Antwort schuldig bleiben mußten, [S. 427]so stand für den Professor die Tatsache fest, daß Prophetie Schwindel sei.
Der gute Mann forderte Allwissenheit. Das war ein kleiner Irrtum. Er war ferner naiv genug, zu glauben, man erforsche die Natur, indem man ihr Bedingungen stelle, statt daß man sich den von ihr aufgestellten unterordnet.
Ärzte finden sich mit dem Problem auch sehr leicht ab. Wo sie mit dem Zufall nicht auskommen, nennen sie es Hysterie. Denn wo Begriffe fehlen, da stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein. Übrigens ist es ziemlich leicht, schon äußerlich den mit der Gabe des zeitlichen Fernsehens ausgestatteten zu erkennen. Man sieht es an den Augen. Ich habe mich fast nie geirrt.
Dagegen möchten wir darauf hinweisen, daß auch der beste Schütze Fehlschüsse tut, daß sogar ein Idealgewehr in gewissen Fällen nicht treffen kann, wenn nämlich der Streuungskegel größer ist als das Ziel (vgl. S. 153 f.).
Wir haben festgestellt, daß es eine Kraft der Prophetie gibt, ein zeitliches Fernsehen. Aufgabe der Wissenschaft muß es nun in Zukunft sein, aufzudecken, unter welchen Voraussetzungen diese Kraft in Wirksamkeit tritt, ihre Stärke zu ermitteln und ihren Streuungskegel zu berechnen. Ist das alles geschehen, dann mag sie mit Kant und Schopenhauer nach einer metaphysischen Erklärung suchen, aber sie nicht schon in der Leugnung der Realität der Zeit gefunden zu haben glauben.
Wir, die wir als Historiker die Frage prüften, müssen uns mit folgender Konstatierung begnügen:
[S. 428]Der Glaube an Prophetie ist kein mittelalterlicher Aberglaube. Er ist eine neue Wahrheit, die wir erstmalig zwingend bewiesen. Wir wissen nunmehr von der Existenz des zeitlichen Fernsehens.
[214] Gedruckt in der Ausgabe du Pin, Antwerpen 1706, I. Bd., Spalte 37 ff., der folgende Traktat eb. Sp. 43 ff.
[215] Übersetzung beider Traktate nach der Ausgabe von Hardt (Helmstädt 1692) von Johann Gabriel Süße, als Anhang der »Umständlichen Nachricht von dem sogenannten Prossner Manne. Christian Heerings . . .« Dresden und Leipzig 1772.
[216] Spiritus Prophetarum non semper esse in potestate, vel distincta cogitatione Prophetarum.
[217] Die Geschichte des ganzen Streites ist eingehend von Süße behandelt unter dem Titel: »Historisch-Theologische Abhandlung über die Casual-Frage: Obs noch heut zu Tage neue Offenbarungen von wichtigen Revolutionen in dem Kirchen- und Weltlichen Staat, und von besondern Schicksalen einzelner Personen, gebe, und was von selbigen zu halten sey?« im Anhang der »Umständlichen Nachricht«, S. 49–124.
[218] Die wichtigste Literatur dieser Streitschriften dürfte nach Süße sein: Jacob Stolterfoht, »Schriftmäßiges Bedenken von Gesichten«, Lübeck 1632. Jacob Fabricius, »Probatio Visionum«, Nürnberg 1642 (von der theol. Fakultät zu Wittenberg in einem Gutachten zensuriert, vgl. Süße, S. 76 ff., gedruckt in den Consilia Theologica Wittenberg, p. 804–817). Jacob Stolterfohts Nothwendige Wahrheit- und Ehren-Rettung wider Fabricii Probationem Visionum invictam, Lübeck 1647. Johann Wilhelm Petersen, »Sendschreiben an einige Theologos und Gottesgelahrten, betreffend die Frage: Ob Gott nach der Auffahrt Christi nicht mehr heutiges Tages durch göttliche Erscheinung denen Menschen-Kindern sich offenbaren wolle, und sich dessen ganz begeben habe . . .«, Lübeck 1691. (Petersen behauptet göttliche Offenbarung auch in Glaubensfragen) dagegen u. a.: Valentin Ernst Löscher, Repetitio orthodoxae doctrinae de Visionibus et Revelationibus«, Wittenberg 1692. Caspar Löscher, »de Visionibus«, eb. 1693. Ph. Jac. Spener, »Theologisches Bedenken usw.«, 1692 von einem Anonymus ohne Druckort herausg. Ders., »Theologisches Bedenken Herrn D. Speners über Heinr. Kratzenstein usw.«, 1693. Ohne Druckort. (Ohne Einwilligung Speners erschienen.) Neudruck im gleichen Jahre mit dem Zusatz »Erklärung über die Frage: Was von Gesichten und Erscheinungen zu halten sey?« Frankfurt a. O. Ein Auszug aus diesen Schriften bei Süße, »Umständliche Nachricht«, S. 165 bis 184. Joh. Lysius, »Schelwigische Synopsi controversiarum«, 1712. Johann Mich. Heineccius, »Schriftmäßige Prüfung der sogenannten neuen Propheten«, Halle 1715. Joachim Lange, »Nöthiger Unterricht von unmittelbaren Offenbarungen«, eb. 1715. Joh. Porst, »Verhalten derer Gläubigen bey denen außerordentlichen Bewegungen und Aussprachen«, 1715. Joh. Lysius, »Wahrhaftige Erzehlung dessen, was zu Berlin mit einigen sogenannten Inspirirten vorgegangen«, 1715. Martin Chladenius, »De Inspiratis sine Spiritu«, Wittenberg 1715. Lysius, »Schutzschrift wider die Beschuldigungen Chladenii«, 1715. Christoph Ludwig Stieglitz, »Nothwendige Erinnerung an Herrn Johann Lysium«, Naumburg 1716, dagegen Repliken von Lysius und »Gegenvorstellung« von Stieglitz.
[219] Joh. Olearius, Synopses Controversiarum, Synops. V. concern. Controversias cura Fanaticis, Thes. IX., Quartausg. p. 7, Oktavausg. p. 485.
[220] Zweite erweiterte Aufl. 1717. S. 4–25 der Schrift werden die Weissagungen der Reformation durch Johannes Hus, Hieronimus von Prag, Johann Wessel, Johann Keisersberg, Sebastian Brand, Johan Hilten, Andreas Proles und Johann Spangenberg angeführt. Sie beruhten zwar zum Teil auf Zufall oder Berechnung, doch leuchte auch aus vielen etwas Göttliches heraus.
[221] »Mein geistiges Schauen in die Zukunft«, S. 102.
[222] Horaz, Carm. I, 28.
[223] Zitiert nach Ferriëm, S. 108 Anm.
[224] Der Interessent sei nachstehend auf die wichtigste einschlägige Literatur, soweit wir sie nicht im Text nannten, verwiesen. Ihre Bekanntschaft verdanke ich der Liebenswürdigkeit des Grafen Karl von Klinkowström. Ich bemerke aber ausdrücklich, daß ich sie nicht studierte, da ich bewußt als Historiker an das Thema herantrat und mir meine Unbefangenheit bis zum Schluß bewahren wollte. E. Parish, Zur Kritik des telepathischen Beweismaterials, 1897; M. Dessoir, »Doppelich«; L. Loewenfeld, »Somnambulismus und Spiritismus«, 1907; N. Kotik, »Die Emanation der psychophysischen Energie«, Wiesbaden 1908.
[S. 429]
Achilleus 44.
Agrippa, Cornelius, 350.
Aigospotamoi 40.
Amos 26 f.
Arago 4.
Argens, Marquis d’, 108 f., 172.
Arnold 97 f.
Astrologie 70 f., 79 ff., 347 ff., 402.
Athen 34 f.
Atia 65 f.
Aufklärung 8 f.
Augustinus 2.
Automobil, vorhergesagt, 120.
Babylonisches Exil 28.
Baid 10.
Barry, du, 323.
Barton, Elisabeth, 92.
Bassompierre 91.
Baudus, de, 116 ff.
Bazarbrand in Paris, vorhergesagt, 122 ff., 333.
Beauharnais 313.
Beaumont, Frau von, 63 f.
Beckmann 340.
Bellini 143.
Berechnung 141 f.
Bernhard, hl., 407.
Bertholon 3.
Bessières, Marschall, 116 f.
Biron, Herzog, 93 f.
Blake, W., 136.
Böhm 61 f.
Bormann, W., 307 ff., 313, 320 ff., 336 f., 339 f., 374 f., 378 f.
Bouland 307.
Bourbonen, Vorhersage des Unterganges, 96 f.
Boussénard 64.
Bouthors 53.
Bose, General, 216.
Brand, Sebastian, 412.
Brantôme 352.
Brugsch, H., 56.
[S. 430] Brühl, Graf, 213 f., 262, 264, 269 ff.
Brunswig, Alfred, Vorwort.
Brüx-Dux, Kohlenbergwerk, 334 ff.
Buddha 72.
Calpurnia 43.
Capelli, Bianca, 78.
Capistrano 88 f.
Capys 42.
Cardanus 87 f.
Carmine, Giuliano del, 106.
Cassius, Dio, 70.
Cazotte, 293, 296 ff., 306 ff.
Chavigni 354 f.
Chronogramme 396.
Chrysippos 41.
Cervoni 119.
Clarence, Herzog von, 333.
Coligny 358.
Collinitius-Tannstetter 14.
Comenius 192.
Condorcet 297.
Cornelius Balbus 42.
Couédon 122 ff.
Créqui, Marquise, 324.
Dariex 105.
Davidson 49 ff.
Davis, A. J., 119 ff.
Davy 3.
Eduard VII., Vorhersage des Todes, 86.
Eingeweideschau 44.
Engel 123.
England, Weltherrschaft, 390 f.
Ennius 69.
Erfurt, Vorhersage, 94 f.
Ervieux, d’, 105.
Eschenmayer 109 ff.
Eugen, Papst, 78.
Ezechiel 28 f.
Fage, Durand, 192 f.
Faure, Felix, 86.
Feldzug von 1805, Vorhersage, 287.
Feldzug von 1815, Vorhersage, 281 ff.
Ferdinand II., Kaiser, 413.
Ferdinand III., Kaiser, 85.
Fernsehen, räumliches, 54.
Franklin 4.
Frankreich, Niederlage u. a., 276 f.,
Revolution von 1789,
Franz II., Kaiser, 173.
Franz II. von Frankreich 362.
Franz von Assisi 29.
Fromm, A., 181 f.
Friedrich von Württemberg, Vorhersage des Todes, 109 ff.
Friedrich der Große 108 f., 171 f., 187, 219, 222.
Friedrich I. von Preußen 170, 185 f.
[S. 431] Friedrich III., deutscher Kaiser, 78.
Friedrich III. von Preußen 170, 182.
Friedrich August II. von Sachsen 219.
Friedrich Wilhelm der Große Kurfürst 169, 182, 185 f.
Friedrich Wilhelm I. von Preußen 171, 186.
Friedrich Wilhelm II. von Preußen 173, 188.
Friedrich Wilhelm III. von Preußen 174 f., 188, 259 ff., 273 ff., 288 f.
Friedrich Wilhelm IV. von Preußen 175, 188, 273.
Galilei 6.
Gallier, Vorhersage des Einfalls in Asien 40.
Galvani 3.
Gassendi 3.
Gedankenübertragung 419.
Genlis, Gräfin, 310 f.
Georg V. von England 86.
Giesebrecht 180 f.
Gieseler 182 f.
Gneisenau, Untergang des Kriegsschiffes, 339 f.
Godefroy siehe Kerkau.
Goldmayer 85.
Gramont, Herzogin, 301 ff., 323 f.
Greulich 94 ff.
Guhrauer 183.
Guise, Herzog von, 362.
Gustav Adolf von Schweden 84 f., 88 f.
Guynaud 352.
Hansen 10.
Hegel 3.
Heiligenliteratur 19 f.
Heinrich II. von Frankreich 85, 350 ff., 361, 397.
Heinrich III. von Frankreich 352, 354, 361 f., 364 f.
Heinrich IV. von Frankreich 90 ff., 354, 365.
Heliopolis, Orakel, 33 ff.
Helmolt, Dr. Hans F., Vorwort.
Helmont, van, 6.
Hennicke, Graf, 204 f.
Hermann von Lehnin 157, 177 ff.
Herodot 35.
Hieronymus von Prag 412.
Hilten, Joh., 412.
Hiskija 27 f.
Horoskop 14, vgl. auch Astrologie.
Homer 44.
Houdancaut, de la Motte, 323.
Hübbe-Schleiden 304 f., 321, 323.
Hufeland 112.
Hungersnot, Vorhersage, 240.
Hus, Joh., 412.
Jant, Chevalier de, 368.
Jeremia 28.
Jeremia, Deutero-, 29.
[S. 432] Jerobeam II. 26.
Jerusalem, Vorhersage, 27 f.
Jesaia 28.
Jesaia, Deutero-, 29.
Jessenius 413.
Joest, Wilhelm, 46 f.
Johann Philipp von Mainz 95.
Joubert 368.
Jung-Stilling 61, 294, 303 ff., 309 f.
Justi 69 f.
Kaiserproklamation, Vorhersage, 175.
Kalender, Einführung des revolutionären, 397 f.
Kara Mustapha 95.
Karl von Bourbon 350.
Karl VI., Kaiser, 15.
Karl von Savoyen 353 f.
Karl IX. von Frankreich 353 f., 362.
Keiserberg, Joh., 412.
Kerner, Justinus, 45 f.
Kesselsdorf, Vorhersage der Schlacht, 214.
Kiesewetter 347, 353, 372, 376 f.
Kirchenverfolgung 398 f.
Klein 109 ff.
Klinkowstroem, Graf, 380, 426.
Kotter 192.
Krämer 109 ff.
Krösus 33.
Kunnersdorf, Vorhersage der Schlacht, 230.
Küstrin, Vorhersage der Schlacht, 108.
Kurz, Isolde, 108.
Lakedämonier 35 f.
Langen 48.
Lannes, General, 118.
Lasalle, General, 118.
Lehninsche Weissagung 156 ff.
Leipzig, Schlachten, 274, 277.
Leopold I. 95.
Leovitius, Cyprianus, 81.
Le Pelletier 356 ff.
Leroy 10.
Ligeritz 213.
Lindemann, Ferdinand, Geheimrat, Vorwort.
Liszt, Franz von, 138.
Löscher 410.
Ludwig XIII. von Frankreich 367 ff.
Ludwig XIV. 395 f.
Ludwig XV. 223.
Ludwig XVI. 301 f., 374 ff., 388 f.
Macrobius 33.
Maillé, Graf von, 122 ff.
Majunke 186.
Makedonier 41.
Malesherbes 299.
Marchandon 105.
[S. 433] Margarete von Parma 107.
Maria Feodorowna 315.
Marie Antoinette 374 ff., 388 f.
Marie Luise 394.
Martinique, Erdbeben, 329 f.
Materialismus 10 f.
Maximilian I., Kaiser, 14.
Mayer, Robert, 4.
Medici: Alessandro 106 ff.
Katharina 93, 350, 353 f., 362.
Lorenzino 106 ff.
Maria 20 f.
Meinhold, W., 178.
Melanchton 82.
Melander 82 f.
Merkt 29.
Mesmer 10.
Messina, Vorhersage der Zerstörung, 128 f.
Micha 27 f.
Miller, J. A., 241 ff.
Montgomery 351.
Montmorency, Heinrich II., 366 ff., 383 f.
Morgan-Dawson 52.
Moskau, Vorhersage der Zerstörung, 84.
Motret 368.
Müller, Egbert, 419 f.
Musaios 40.
Napoleon I. 118 f., 283 ff., 391 ff.
Napoleonische Kriege, Vorhersage, 400 f.
Narbonne, Graf, 376 ff.
Nebukadnezar 28.
New-York, Vorhersage des Hafenbrandes, 327 f.
Ney, Marschall, 117.
Nick, Arzt, 110.
Nicolai 299.
Niederlande, Vorhersage ihrer Blüte, 89.
Nikolaus V., Parentucelli, Papst, 78.
Nostradamus 346 ff.
– gefälschte Quatrains 356 f.
Oberkirch, Baronin, 313 ff.
Octavius 65 ff.
Old Moore 332 f.
Olearius, Joh., 409.
Ölven, Rittmeister, 181.
Österreichisch-französisches Bündnis, Vorhersage, 222 f.
Österreichisch-Preußischer Krieg 59 f.
Otto Heinrich von der Pfalz 81.
Pallas 40.
Papsttum, Beseitigung der weltlichen Herrschaft, 389 f.
Paracelsus 6.
Pausanias 40.
Peare, A. J., 86.
Pest, Vorhersage, 34 ff.
Petrarcha 87.
Phännis 40.
[S. 434] Philibert Emanuel von Savoyen 352 f.
Philippos 41.
Piazzi 3.
Pierre d’Ailly 79.
Pius II., Piccolomini, Papst, 78.
Planet, neunter, Vorhersage, 119.
Plutarch 40.
Poniatowssken 191 ff.
Ponk-Knop 179.
Prel, Du, 140.
Preußen, Wiederaufrichtung, Vorhersage, 274, 276 f. etc.
Pröhle, H., 182.
Proles, Andreas, 412.
Prophetie, Unmöglichkeit, 3 ff., 8 f., 16.
– Allgemeines, 99 ff.
Prophezeiungen, falsche, 153 f.,
Gründe dafür: 415 ff.
Protestantismus, lange Dauer, Vorhersage, 88.
Pyrrhus 33.
Pythia 39 f.
Quincey 136.
Ravaillac 91.
Reuß 111.
Rizacasa 93.
Roßbach, Schlacht, Vorhersage, 227.
Roucher 299.
Rüchel, General, 258 ff., 273.
Rudolf II., Kaiser, 14.
Sarti 128 f.
Schoner, Joh., 82.
Scott, W., 136.
Schwedt, Markgraf von, 182.
Sedan, Vorhersage, 371 f.
Seidel, M. F., 180.
Semmelweiß 4.
Seyler 188.
Shelley 136.
Siebenjähriger Krieg, Vorhersage, 226.
Simiane, de, 324.
Simson, Geheimrat, 262 ff.
Soliman II. 358.
Spangenberg, Joh., 412.
Speer 177.
Stainville, Marschall, 315 ff.
Stieglitz 112.
Stoffler, Joh., 81.
Stromer-Reichenbach, Friedrich Frh. v., Vorwort.
Sully 90.
Süße, Joh. G., 203 ff., 405, 408.
Sybille 40.
Symbol, Symbolismus 46, 70, 99 ff.
Tannstetter-Collinitius 81.
Tessé, de, 324.
Testament, Altes, 23 ff.
Textor, J. W., 134 ff.
Thebes, Mme., 86.
Theogenes 71.
Thilton 49 ff.
[S. 435] Thomas 57.
Thukydides 34 ff.
Thurneyßer 78.
Tragik 332.
Traum 78, 134. Siehe auch Doppeltraum.
Traumsprache 253.
Vaudin 3.
Vergil 44.
Victor Emanuel 128 f.
Villandry 93.
Villani 107.
Virchow 10.
Visionen 337 f., 343 f, 420 ff.
Vogtius 84 f.
Vorahnungen 60 ff.
Vogelgesang-Zipelius 58.
Wahrsagerinnen 407.
Wahrsagung aus Kaffeesatz 101–106.
Wahrscheinlichkeitsrechnung 146 ff., 383 ff.
Wahrträume 45 ff. Siehe auch Traum.
Wanner 109 f.
Wernstorff 412 ff.
Wessel, Joh., 412.
Wien, Vorhersage von Belagerung und Pest, 95 f.
Wilhelm I., Kaiser, 59, 175, 188, 372.
Wilken 180.
Willensfreiheit 12 f.
Wittenbart 55 f.
Wittig 121.
Wolf, Fr., 183.
Zeitangaben 331 ff.
Zeppelin, Graf, 340.
Ziehen 82.
Zipelius 58.
Zitzwitz 182 f.
Zweifel 22.
Dr. MAX KEMMERICH
Kultur-Kuriosa
Erster Band (10. Tausend) – Zweiter Band (6. Tausend)
Jeder Band geheftet 3 Mark 50 Pfg., gebunden 5 Mark
Münchner Neueste Nachrichten: Wenn ich den Verfasser recht verstanden habe, so hat er mit dieser Veröffentlichung von Kulturdokumenten aller Zeiten und Völker das ethische Ziel verfolgt, im Spiegel der Vergangenheit das Bild der Gegenwart zu zeigen und dadurch auch seinerseits dazu beizutragen, daß Leben, Ehre, Freiheit und fremde Überzeugung jene Achtung genieße, die er mit vollem Recht als das wichtigste Kulturkriterium betrachtet, wichtiger als alle technischen und wissenschaftlichen Fortschritte und alle künstlerischen Großtaten.
Der Tag, Berlin: Ein ganz verflixtes Buch. Vom Standpunkt der Orthodoxie aus – hüben wie drüben – höchst verwerflich nach Tendenz und Inhalt. Und nun gar: wenn man sich »Töchterschülerinnen« als seine ungebetenen Leserinnen vorstellen wollte – einfach Pfui Deibel! Und dennoch: recht zum Nachdenken bewegend, zur Einkehr stimmend, zur Umschau anregend. Notabene: Für solche, die ihr bißchen Spiritus gewöhnt sind nicht nach einem irgendwie vorgeschriebenen Schema F einzustellen. Bei allem Pessimismus, der daraus spricht, eine sinnige Gabe für geborene Optimisten . . . . Der wahre Satiriker will nicht nur bloßstellen, sondern auch bessern; so will auch dies Buch bei aller Boshaftigkeit oder doch Ungeschminktheit den unserer »Bildung« durchaus nicht überall adäquaten Stand unserer sogenannten Kultur heben. Möchte es vor allen Dingen unter die Augen der Männer geraten, die es namentlich angeht!
(Dr. Hans F. Helmolt.)
Generalanzeiger Mannheim: Solche Bücher sind selten. Denn zu gern verschließt sich der Mensch solch grassem Bekenntnis der Wahrheit. Aber sie haben eben dadurch doppelten Wert. Kemmerichs »Kultur-Kuriosa« sollte jeder besitzen, der Anteil nimmt an menschlicher Kultur, und es ist jedem von uns heilsam, mitunter in dem Buche zu blättern.
Neue Züricher Zeitung: Eine Sammlung drastischer Anekdoten aus dem weiten Reiche der Kulturgeschichte mit viel Geschick ausgewählt zum Behufe des Nachweises, »daß unsere Kultur, soweit sie auf Befreiung von Grausamkeit, Intoleranz und Borniertheit beruht, noch sehr jungen Datums ist«. In der Tat ist es unglaublich, von welcher Barbarei wir herkommen, und in welcher Barbarei wir vielfach heute noch stecken, auf dem Gebiete des Rechts, der Ehe, der Sittlichkeit, des Glaubenslebens usw. Manchmal traut man seinen Augen nicht; aber der Verfasser beruft sich in einem überaus reichen Literaturnachweis durchgängig auf die besten Quellen.
Liberales Wochenblatt Straßburg i. E.: So wirkt das Büchlein kulturkräftig, als eine Mahnung zur Offenheit und Freimütigkeit in dem Eintreten für ein wahrhaft humanes, sittliches Kulturideal.
Albert Langen, Verlag, München
[S. 438]
Dr. MAX KEMMERICH
Dinge, die man nicht sagt
Siebentes Tausend
Geheftet 3 Mark 50 Pfg., gebunden 5 Mark
Straßburger Post: Mit diesem Bande ist uns ein ganz köstliches Buch geschenkt worden. Es handelt von allem, was das Leben an Erscheinungen und Fragen bringt, von Schule und Universität und von Nationalgefühl und Moral, von Kunst und Humanität und von Kritik und Polemik. Es wird keinen einzigen Leser finden – außer den Kritiklosen, die dies Buch nicht wert sind –, der mit einem einzigen seiner Aufsätze ganz einverstanden wäre. Aber auch keinen, der nicht gerade dort, wo er nicht zustimmt, über die rücksichtslose Offenherzigkeit und das fröhliche Draufgängertum sich freute, mit dem der Verfasser seine Meinung sagt. Dieser Mut zur Wahrhaftigkeit macht das Buch anziehend. Allerdings ist aber die besondere Gabe des Verfassers auf ein enges Gebiet begrenzt. Er ist ein überaus glücklicher Beobachter des bunten Treibens unserer »Gesellschaft«, das man in den beteiligten Kreisen als »unsere Kultur« bezeichnet. Aber zum tieferen Eindringen in die Probleme zeigt er hier entweder keine Lust oder kein Geschick. Darum sind die Abschnitte, deren Gegenstände am meisten ein Einsetzen der Kritik nicht an den Zweigen, sondern an der Wurzel erheischten, die unbefriedigendsten. Aber man soll sich durch die Gegenstände, deren Wahl ein Fehlgreifen ist, nicht den Genuß an dem andern, glücklich gewählten, verderben lassen.
Die Propyläen: Die »Kultur-Kuriosa« sind mehr als eine bloße Raritätensammlung, sie wollen den Nachweis führen, daß auch unser herrliches 20. Jahrhundert das dunkle Mittelalter noch immer nicht überwunden hat, während die »Dinge, die man nicht sagt« in systematischem Kriegsplan gegen die Gebrechen unserer Zeit vorgehen. Beide Bücher, insbesondere das zweite, das ich vorziehen möchte, müssen und wollen auf Schritt und Tritt anstoßen, aber sie enthalten eben doch einen wahren Kern, wie jeder zugeben muß, der sich von den Fesseln der Voreingenommenheit und der Phrase freimacht.
Niederschlesische Zeitung, Görlitz: Vielleicht ist man mit der Behandlung des einen oder anderen Themas nicht völlig einverstanden, aber in sehr vielen Punkten, ja man kann sagen in den meisten, muß man den Verfasser als einen grundgescheiten Menschen, der sich unter allen Umständen bestrebt, die Dinge ohne alle Schönfärberei zu betrachten, oder einfacher gesagt, der den Mut hat, vernünftig zu sein, recht geben. Wenn man ihm beispielsweise zuhört, wie er über »Wissensdurst und Universität« urteilt, wie er das zopfige Gelehrtentum herunterputzt, das an Stelle einer universellen lebendigen Darstellung stundenlanges trockenes Aufzählen der Quellen, der Werke, die der Darstellung zugrunde liegen, für die richtige geistige Kost hält, dann spricht einem der Verfasser aus dem Herzen! Nach dieser Richtung hin bietet das Buch eine Summe von Beobachtung aus dem täglichen Leben, und wenn nur die Hälfte von dem, was er sagt, Nachachtung fände, so würde es um vieles besser stehen um unsere Kultur.
Albert Langen, Verlag, München
[S. 439]
Druck von Hesse & Becker in Leipzig
Papier von Bohnenberger & Cie., Papierfabrik, Niefern bei Pforzheim
Einbände von E. A. Enders, Großbuchbinderei, Leipzig
Seite 24: „Assyrier“ ersetzt durch „Assyrer“: Wo sind die Babylonier, die Assyrer, die Griechen, Römer?
Seite 31: „eine“ ersetzt durch „ein“: . . ., ein Phänomen, für das, wie für so manches andere, die heutige Wissenschaft noch keine ausreichende Erklärung hat.
Seite 32: „panegyrischen“ ersetzt durch „panegyrische“: . . . soweit sie die tatsächlich unkritische und panegyrische religiöse Literatur betreffen . . .
Seite 35: „Peleponnes“ ersetzt durch „Peloponnes“: . . . und, was ein merkwürdiger Umstand war, die Peloponnes blieb gänzlich davon frei.
Seite 49: „ihnen“ ersetzt durch „Ihnen“: . . ., daß ich von heute in sechs Wochen einer dringenden Einladung von Ihnen folgend Sie besuchte.
Seite 50: Fehlendes öffnendes Anführungszeichen ergänzt: . . . fuhr die Dame fort, »daß ich beim Eintreten dieses Haus leer und verlassen fände . . .
Seite 65: „konnten“ ersetzt durch „konnte“: . . ., oder wenn starker Taufall seine Entscheidungen beeinflussen konnte.
Seite 70: „zweiflos“ ersetzt durch „zweifellos“: Es liegt hier zweifellos ein noch nicht näher ergründetes Phänomen der Prophetie vor.
Seite 81: „Konjunkturen“ ersetzt durch „Konjunktionen“: . . ., jahrtausendelange Erfahrung ein Zusammentreffen gewisser Ereignisse und Schicksale mit bestimmten Konjunktionen der Gestirne ergeben habe.
Seite 101: „Das“ ersetzt durch „Daß“: Daß es sich nicht um einen der biblischen Engel handeln kann, . . .
Seite 102: Einleitendes einfaches durch doppeltes Anführungszeichen ersetzt: »Eine Freundin von mir, Lady A., wohnte in den Champs-Elysées. . . .
Seite 113: „Tatbeberichte“ ersetzt durch „Tatberichte“: . . . das beweisen die zahlreichen von Flammarion veröffentlichten Tatberichte, . . .
Seite 123 (Fußnote): „phrophetischen“ ersetzt durch „prophetischen“: Die Erklärung für diese prophetischen »Geister« dürfte . . .
Seite 135: „Komppliment“ ersetzt durch „Kompliment“: . . ., sei herabgestiegen und habe ihm auf eine verbindliche Weise das Kompliment gemacht; . . .
Seite 136: „gestört“ ersetzt durch „gestöbert“: . . ., daß ich als Knabe unter seinen Büchern und Schreibkalendern gestöbert . . .
Seite 142: „Berechung“ ersetzt durch „Berechnung“: Hier handelt es sich, das ist klar, um Berechnung, Kalkulation oder Kombination.
Seite 142: „Unbeabsichtige“ ersetzt durch „Unbeabsichtigte“: . . ., also das Unbeabsichtigte und das Unerklärliche.
Seite 144: „Metereologe“ ersetzt durch „Meteorologe“: Ein Meteorologe wird den Windstoß vorhersehen, . . .
Seite 146: „verunglückten“ ersetzt durch „verunglücken“: Die Wahrscheinlichkeit Berlin zu erreichen, verhält sich zu der tötlich zu verunglücken . . . (– das Wort „tötlich“ wurde hier nicht korrigiert, da diese Schreibweise mehrfach vorkam.)
Seite 150: „Devisor“ ersetzt durch „Divisor“: Wenn schon die reine Mathematik bei einem so ungeheuren Divisor aus praktischen Erwägungen zum Resultat 0 gelangt, . . .
Seite 155: „wiedersprechen“ ersetzt durch „widersprechen“: Da es aber eine große Fülle von Vorhersagen gibt, die sich widersprechen, . . .
Seite 177: „Lehnische“ ersetzt durch „Lehninsche“: Wie bereits kurz erwähnt, wird die Lehninsche Prophezeiung als Werk eines Bruders Hermann . . .
Seite 177 (Fußnote): „wörtsich“ ersetzt durch „wörtlich“: . . ., daß die Prophezeiung des P. Speer über Bayern zum Teil wörtlich mit der Lehninschen übereinstimmt.
Seite 182 (Fußnote): „Leninsche“ ersetzt durch „Lehninsche“: J. C. L. Gieseler, Die Lehninsche Weissagung gegen das Haus Hohenzollern . . .
Seite 184: „wert“ ersetzt durch „Wert“: . . ., sondern lediglich weil es wenig Wert hat sich mit Fragen aufzuhalten, . . .
Seite 192: „Krankkeit“ ersetzt durch „Krankheit“: . . ., etwa sechzehnjährig in eine schwere Krankheit verfiel und . . .
Seite 192: „Stil“ ersetzt durch „Stiel“: Sie sah eine blutige Rute am Himmel, deren Stiel gegen Mitternacht, . . .
Seite 198: „Interprätation“ ersetzt durch „Interpretation“: Wenn wir auch keine in Einzelheiten richtige Interpretation der merkwürdigen Vision geben wollen . . .
Seite 208: „skizierte“ ersetzt durch „skizzierte“: . . . und darüber einen Aufsatz verfaßt, in dem er Heerings Charakteristik und Vergangenheit skizzierte.
Seite 208: „ihm“ ersetzt durch „ihn“: Damit fällt der Verdacht, Süße habe, um sich interessant zu machen oder aus anderen Gründen, Heering »entdeckt« oder habe ihn gar zu kirchlichen Propagandazwecken benutzt.
Seite 250: „Offfzier“ ersetzt durch „Offizier“: . . ., und er führte mich dann zu seinem Offizier, bei welchem er zugleich Bedienter war.
Seite 272: „Potokoll“ ersetzt durch „Protokoll“: Außer obigem langem Protokoll hat Müller noch Briefe an den König Friedrich Wilhelm III. von Preußen verfaßt, . . .
Seite 279: „religiöse“ ersetzt durch „religiösen“: . . . und einige religiösen Inhalts, fast alles in Erfüllung ging.
Seite 280: „Frankreich“ ersetzt durch „Frankreichs“: Der Krieg Frankreichs von 1812 mit Rußland, Frankreichs Niederlage und der ungeheure Brand Moskaus, . . .
Seite 291: „abgedruckter“ ersetzt durch „abgedruckten“: . . ., wie auch aus einem bei Ehrlich abgedruckten Brief, der die Anfrage der russischen Kaiserin enthält, hervorgeht, . . .
Seite 294 (Fußnote): Anführungszeichen vor „Lycée“ ergänzt: Besonders geschätzt waren seine Vorlesungen über Literatur, die unter dem Titel »Lycée ou Cours de Littérature« (Paris 1799 ff.) erschienen.
Seite 311: „Cräfin“ ersetzt durch „Gräfin“: . . ., so beweist es doch, wie das der Gräfin de Genlis, . . .
Seite 327: Anführungszeichen „«“ ersetzt durch schließende Klammer: (Das Medium war schon in New York und hat daher die in der Vision erschaute Stadt jedenfalls als New York erkannt.)
Seite 336 (Fußnote): Schließendes Anführungszeichen ergänzt: »Das Gesicht dürfte sich jedenfalls bald erfüllen, bzw. in einem der kommenden Jahre.«
Seite 341: „Luftschiff, Das“ ersetzt durch „Luftschiff, das“: Das elektrische Luftschiff, das große, vollkommen lenkbare Luftschiff mit elektrischer Bewegung . . .
Seite 358: „der“ ersetzt durch „des“: . . ., stand er auf der Höhe als Organisator des Bürgerkrieges (Contrebandé).
Seite 359: „Katkoliken“ ersetzt durch „Katholiken“: Im gleichen Jahre 1570 schlossen die Protestanten und Katholiken zu St.-Germain Frieden.
Seite 359: „Zeitabgabe“ ersetzt durch „Zeitangabe“: Auch die Zeitangabe von sieben Jahren wird stutzig machen.
Seite 361 (Fußnote): „Le Pelletrier“ ersetzt durch „Le Pelletier“: [187] Le Pelletier, I, S. 93 f.
Seite 369 (Fußnote): „bebetrifft“ ersetzt durch „betrifft“: Was die Persönlichkeit Heinrichs II. Montmorency betrifft, so war er . . .
Seite 385: Diese Stelle wurde nicht korrigiert: „. . . also = 1 : 5000 Milliarden, eine vierzehnzeilige Zahl!“ – Es müsste eigentlich „eine dreizehnstellige Zahl“ heißen.
Seite 386: „Das“ ersetzt durch „Daß“: Daß Nostradamus gerade auf den Namen Narbon verfiel, . . .
Seite 386: „war“ ersetzt durch „gab“: Wieviele Sausse es damals in Frankreich gab, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis.
Seite 388: „griechich“ ersetzt durch „griechisch“: (moyne, griechisch aus monos, allein)
Seite 405: schließende Klammer ergänzt: (Modus officialis)
Seite 416: „Phanthasie“ ersetzt durch „Phantasie“: . . ., ein Bild meiner für mich selber unbemerkt einsetzenden Phantasie werden könnte.
Seite 417: „gewerbsmässigen Wahrsagerinen“ ersetzt durch „gewerbsmäßigen Wahrsagerinnen“: Damit beantwortet sich auch die Frage, was von Prophezeiungen der gewerbsmäßigen Wahrsagerinnen zu halten ist, ganz von selbst.
Seite 417: „einem“ ersetzt durch „einen“: Wer für einige Mark sich täglich so und so oft in einen Zustand versetzen soll, . . .
Seite 426: „interprätieren“ ersetzt durch „interpretieren“, „zuläßig“ ersetzt durch „zulässig“: . . ., daß es weder leicht ist eine richtige Vision bzw. Prophezeiung als solche zu erkennen und zu interpretieren, noch auch zulässig ist aus Irrtümern, die der Seher begeht, . . .
Seite 427: „Steuungskegel“ ersetzt durch „Streuungskegel“: . . ., wenn nämlich der Streuungskegel größer ist als das Ziel . . .