Thomas Mann
Gesammelte Werke
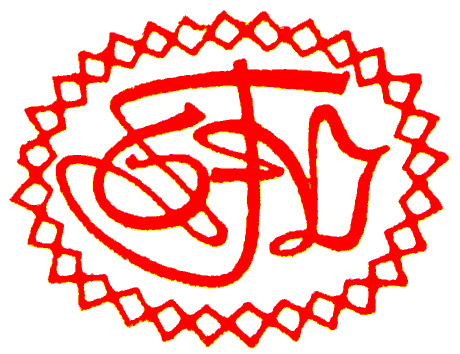
1924
S. Fischer / Verlag / Berlin
Title: Der Zauberberg
Erster Band
Thomas Mann
Gesammelte Werke
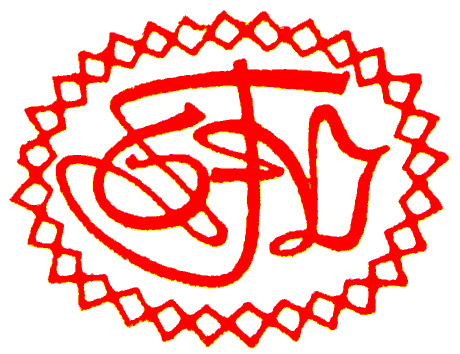
1924
S. Fischer / Verlag / Berlin
Thomas Mann
Roman
Erster Band
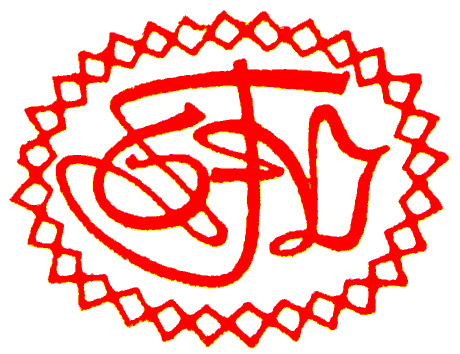
1924
S. Fischer / Verlag / Berlin
Erste bis zehnte Auflage
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung
Copyright 1924 by S. Fischer, Verlag, A.-G., Berlin
Der Zauberberg
Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzählen wollen, – nicht um seinetwillen (denn der Leser wird einen einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Menschen in ihm kennenlernen), sondern um der Geschichte willen, die uns in hohem Grade erzählenswert scheint (wobei zu Hans Castorps Gunsten denn doch erinnert werden sollte, daß es seine Geschichte ist, und daß nicht jedem jede Geschichte passiert): diese Geschichte ist sehr lange her, sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen.
Das wäre kein Nachteil für eine Geschichte, sondern eher ein Vorteil; denn Geschichten müssen vergangen sein, und je vergangener, könnte man sagen, desto besser für sie in ihrer Eigenschaft als Geschichten und für den Erzähler, den raunenden Beschwörer des Imperfekts. Es steht jedoch so mit ihr, wie es heute auch mit den Menschen und unter diesen nicht zum wenigsten mit den Geschichtenerzählern steht: sie ist viel älter als ihre Jahre, ihre Betagtheit ist nicht nach Tagen, das Alter, das auf ihr liegt, nicht nach Sonnenumläufen zu berechnen; mit einem Worte: sie verdankt den Grad ihres Vergangenseins nicht eigentlich der Zeit, – eine Aussage, womit auf die Fragwürdigkeit und eigentümliche Zwienatur dieses geheimnisvollen Elementes im Vorbeigehen angespielt und hingewiesen sei.
Um aber einen klaren Sachverhalt nicht künstlich zu verdunkeln: die hochgradige Verflossenheit unserer Geschichte rührt daher, daß sie vor einer gewissen, Leben und Bewußtsein tief zerklüftenden Wende und Grenze spielt ... Sie spielt, oder, um jedes Präsens geflissentlich zu vermeiden, sie spielte und hat gespielt vormals, ehedem, in den alten Tagen, der Welt vor dem großen Kriege, mit dessen Beginn so vieles begann, was zu beginnen wohl kaum schon aufgehört hat. Vorher also spielt sie, wenn auch nicht lange vorher. Aber ist der Vergangenheitscharakter einer Geschichte nicht desto tiefer, vollkommener und märchenhafter, je dichter „vorher“ sie spielt? Zudem könnte es sein, daß die unsrige mit dem Märchen auch sonst, ihrer inneren Natur nach, das eine und andre zu schaffen hat.
Wir werden sie ausführlich erzählen, genau und gründlich, – denn wann wäre je die Kurz- oder Langweiligkeit einer Geschichte abhängig gewesen von dem Raum und der Zeit, die sie in Anspruch nahm? Ohne Furcht vor dem Odium der Peinlichkeit, neigen wir vielmehr der Ansicht zu, daß nur das Gründliche wahrhaft unterhaltend sei.
Im Handumdrehen also wird der Erzähler mit Hansens Geschichte nicht fertig werden. Die sieben Tage einer Woche werden dazu nicht reichen und auch sieben Monate nicht. Am besten ist es, er macht sich im voraus nicht klar, wieviel Erdenzeit ihm verstreichen wird, während sie ihn umsponnen hält. Es werden, in Gottes Namen, ja nicht geradezu sieben Jahre sein!
Und somit fangen wir an.
Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos-Platz im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für drei Wochen.
Von Hamburg bis dort hinauf, das ist aber eine weite Reise; zu weit eigentlich im Verhältnis zu einem so kurzen Aufenthalt. Es geht durch mehrerer Herren Länder, bergauf und bergab, von der süddeutschen Hochebene hinunter zum Gestade des Schwäbischen Meeres und zu Schiff über seine springenden Wellen hin, dahin über Schlünde, die früher für unergründlich galten.
Von da an verzettelt sich die Reise, die solange großzügig, in direkten Linien vonstatten ging. Es gibt Aufenthalte und Umständlichkeiten. Beim Orte Rorschach, auf schweizerischem Gebiet, vertraut man sich wieder der Eisenbahn, gelangt aber vorderhand nur bis Landquart, einer kleinen Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen ist. Es ist eine Schmalspurbahn, die man nach längerem Herumstehen in windiger und wenig reizvoller Gegend besteigt, und in dem Augenblick, wo die kleine, aber offenbar ungewöhnlich zugkräftige Maschine sich in Bewegung setzt, beginnt der eigentlich abenteuerliche Teil der Fahrt, ein jäher und zäher Aufstieg, der nicht enden zu wollen scheint. Denn Station Landquart liegt vergleichsweise noch in mäßiger Höhe; jetzt aber geht es auf wilder, drangvoller Felsenstraße allen Ernstes ins Hochgebirge.
Hans Castorp – dies der Name des jungen Mannes – befand sich allein mit seiner krokodilsledernen Handtasche, einem Geschenk seines Onkels und Pflegevaters, Konsul Tienappel, um auch diesen Namen hier gleich zu nennen, – seinem Wintermantel, der an einem Haken schaukelte, und seiner Plaidrolle in einem kleinen grau gepolsterten Abteil; er saß bei niedergelassenem Fenster, und da der Nachmittag sich mehr und mehr verkühlte, so hatte er, Familiensöhnchen und Zärtling, den Kragen seines modisch weiten, auf Seide gearbeiteten Sommerüberziehers aufgeschlagen. Neben ihm auf der Bank lag ein broschiertes Buch namens „Ocean steamships“, worin er zu Anfang der Reise bisweilen studiert hatte; jetzt aber lag es vernachlässigt da, indes der hereinstreichende Atem der schwer keuchenden Lokomotive seinen Umschlag mit Kohlenpartikeln verunreinigte.
Zwei Reisetage entfernen den Menschen – und gar den jungen, im Leben noch wenig fest wurzelnden Menschen – seiner Alltagswelt, all dem, was er seine Pflichten, Interessen, Sorgen, Aussichten nannte, viel mehr, als er sich auf der Droschkenfahrt zum Bahnhof wohl träumen ließ. Der Raum, der sich drehend und fliehend zwischen ihn und seine Pflanzstätte wälzt, bewährt Kräfte, die man gewöhnlich der Zeit vorbehalten glaubt; von Stunde zu Stunde stellt er innere Veränderungen her, die den von ihr bewirkten sehr ähnlich sind, aber sie in gewisser Weise übertreffen. Gleich ihr erzeugt er Vergessen; er tut es aber, indem er die Person des Menschen aus ihren Beziehungen löst und ihn in einen freien und ursprünglichen Zustand versetzt, – ja, selbst aus dem Pedanten und Pfahlbürger macht er im Handumdrehen etwas wie einen Vagabunden. Zeit, sagt man, ist Lethe; aber auch Fernluft ist so ein Trank, und sollte sie weniger gründlich wirken, so tut sie es dafür desto rascher.
Dergleichen erfuhr auch Hans Castorp. Er hatte nicht beabsichtigt, diese Reise sonderlich wichtig zu nehmen, sich innerlich auf sie einzulassen. Seine Meinung vielmehr war gewesen, sie rasch abzutun, weil sie abgetan werden mußte, ganz als derselbe zurückzukehren, als der er abgefahren war, und sein Leben genau dort wieder aufzunehmen, wo er es für einen Augenblick hatte liegen lassen müssen. Noch gestern war er völlig in dem gewohnten Gedankenkreise befangen gewesen, hatte sich mit dem jüngst Zurückliegenden, seinem Examen, und dem unmittelbar Bevorstehenden, seinem Eintritt in die Praxis bei Tunder & Wilms (Schiffswerft, Maschinenfabrik und Kesselschmiede), beschäftigt und über die nächsten drei Wochen mit soviel Ungeduld hinweggeblickt, als seine Gemütsart nur immer zuließ. Jetzt aber war ihm doch, als ob die Umstände seine volle Aufmerksamkeit erforderten und als ob es nicht angehe, sie auf die leichte Achsel zu nehmen. Dieses Emporgehobenwerden in Regionen, wo er noch nie geatmet und wo, wie er wußte, völlig ungewohnte, eigentümlich dünne und spärliche Lebensbedingungen herrschten, – es fing an, ihn zu erregen, ihn mit einer gewissen Ängstlichkeit zu erfüllen. Heimat und Ordnung lagen nicht nur weit zurück, sie lagen hauptsächlich klaftertief unter ihm, und noch immer stieg er darüber hinaus. Schwebend zwischen ihnen und dem Unbekannten fragte er sich, wie es ihm dort oben ergehen werde. Vielleicht war es unklug und unzuträglich, daß er, geboren und gewohnt, nur ein paar Meter über dem Meeresspiegel zu atmen, sich plötzlich in diese extremen Gegenden befördern ließ, ohne wenigstens einige Tage an einem Platze von mittlerer Lage verweilt zu haben? Er wünschte, am Ziel zu sein, denn einmal oben, dachte er, würde man leben wie überall und nicht so wie jetzt im Klimmen daran erinnert sein, in welchen unangemessenen Sphären man sich befand. Er sah hinaus: der Zug wand sich gebogen auf schmalem Paß; man sah die vorderen Wagen, sah die Maschine, die in ihrer Mühe braune, grüne und schwarze Rauchmassen ausstieß, die verflatterten. Wasser rauschten in der Tiefe zur Rechten; links strebten dunkle Fichten zwischen Felsblöcken gegen einen steingrauen Himmel empor. Stockfinstere Tunnel kamen, und wenn es wieder Tag wurde, taten weitläufige Abgründe mit Ortschaften in der Tiefe sich auf. Sie schlossen sich, neue Engpässe folgten, mit Schneeresten in ihren Schründen und Spalten. Es gab Aufenthalte an armseligen Bahnhofshäuschen, Kopfstationen, die der Zug in entgegengesetzter Richtung verließ, was verwirrend wirkte, da man nicht mehr wußte, wie man fuhr und sich der Himmelsgegenden nicht länger entsann. Großartige Fernblicke in die heilig-phantasmagorisch sich türmende Gipfelwelt des Hochgebirges, in das man hinan- und hineinstrebte, eröffneten sich und gingen dem ehrfürchtigen Auge durch Pfadbiegungen wieder verloren. Hans Castorp bedachte, daß er die Zone der Laubbäume unter sich gelassen habe, auch die der Singvögel wohl, wenn ihm recht war, und dieser Gedanke des Aufhörens und der Verarmung bewirkte, daß er, angewandelt von einem leichten Schwindel und Übelbefinden, für zwei Sekunden die Augen mit der Hand bedeckte. Das ging vorüber. Er sah, daß der Aufstieg ein Ende genommen hatte, die Paßhöhe überwunden war. Auf ebener Talsohle rollte der Zug nun bequemer dahin.
Es war gegen acht Uhr, noch hielt sich der Tag. Ein See erschien in landschaftlicher Ferne, seine Flut war grau, und schwarz stiegen Fichtenwälder neben seinen Ufern an den umgebenden Höhen hinan, wurden dünn weiter oben, verloren sich und ließen nebelig-kahles Gestein zurück. Man hielt an einer kleinen Station, es war Davos-Dorf, wie Hans Castorp draußen ausrufen hörte, er würde nun binnen kurzem am Ziele sein. Und plötzlich vernahm er neben sich Joachim Ziemßens Stimme, seines Vetters gemächliche Hamburger Stimme, die sagte: „Tag, du, nun steige nur aus“; und wie er hinaussah, stand unter seinem Fenster Joachim selbst auf dem Perron, in braunem Ulster, ganz ohne Kopfbedeckung und so gesund aussehend wie in seinem Leben noch nicht. Er lachte und sagte wieder:
„Komm nur heraus, du, geniere dich nicht!“
„Ich bin aber noch nicht da“, sagte Hans Castorp verdutzt und noch immer sitzend.
„Doch, du bist da. Dies ist das Dorf. Zum Sanatorium ist es näher von hier. Ich habe ’nen Wagen mit. Gib mal deine Sachen her.“
Und lachend, verwirrt, in der Aufregung der Ankunft und des Wiedersehens reichte Hans Castorp ihm Handtasche und Wintermantel, die Plaidrolle mit Stock und Schirm und schließlich auch „Ocean steamships“ hinaus. Dann lief er über den engen Korridor und sprang auf den Bahnsteig zur eigentlichen und sozusagen nun erst persönlichen Begrüßung mit seinem Vetter, die sich ohne Überschwang, wie zwischen Leuten von kühlen und spröden Sitten, vollzog. Es ist sonderbar zu sagen, aber von jeher hatten sie es vermieden, einander beim Vornamen zu nennen, einzig und allein aus Scheu vor zu großer Herzenswärme. Da sie sich aber doch nicht gut mit Nachnamen anreden konnten, so beschränkten sie sich auf das Du. Das war eingewurzelte Gewohnheit zwischen den Vettern.
Ein Mann in Livree, mit Tressenmütze, sah zu, wie sie einander – der junge Ziemßen in militärischer Haltung – rasch und ein bißchen verlegen die Hände schüttelten, und kam dann heran, um sich Hans Castorps Gepäckschein auszubitten; denn er war der Concierge des Internationalen Sanatoriums „Berghof“ und zeigte sich willens, den großen Koffer des Gastes vom Bahnhof „Platz“ zu holen, indes die Herren direkt mit dem Wagen zum Abendbrot fuhren. Der Mann hinkte auffallend, und so war das erste, was Hans Castorp Joachim Ziemßen fragte:
„Ist das ein Kriegsveteran? Was hinkt er denn so?“
„Ja, danke!“ erwiderte Joachim etwas bitter. „Ein Kriegsveteran! Der hat es im Knie – oder hatte es doch, denn dann hat er sich die Kniescheibe herausnehmen lassen.“
Hans Castorp besann sich so rasch er konnte. „Ja, so!“ sagte er, indem er im Gehen den Kopf hob und sich flüchtig umblickte. „Du wirst mir doch aber nicht weismachen wollen, daß du noch so etwas hast? Du siehst ja aus, als ob du dein Portepee schon hättest und gerade aus dem Manöver kämst.“ Und er sah den Vetter von der Seite an.
Joachim war größer und breiter als er, ein Bild der Jugendkraft und wie für die Uniform geschaffen. Er war von dem sehr braunen Typus, den seine blonde Heimat nicht selten hervorbringt, und seine ohnehin dunkle Gesichtshaut war durch Verbrennung beinahe bronzefarben geworden. Mit seinen großen schwarzen Augen und dem dunklen Schnurrbärtchen über dem vollen, gut geschnittenen Munde wäre er geradezu schön gewesen, wenn er nicht abstehende Ohren gehabt hätte. Sie waren sein einziger Kummer und Lebensschmerz gewesen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt hatte er andere Sorgen. Hans Castorp fuhr fort:
„Du kommst doch gleich mit mir hinunter? Ich sehe wirklich kein Hindernis.“
„Gleich mit dir?“ fragte der Vetter und wandte ihm seine großen Augen zu, die immer sanft gewesen waren, in diesen fünf Monaten aber einen etwas müden, ja traurigen Ausdruck angenommen hatten. „Gleich wann?“
„Na, in drei Wochen.“
„Ach so, du fährst wohl schon wieder nach Hause in deinen Gedanken“, antwortete Joachim. „Nun, warte nur, du kommst ja eben erst an. Drei Wochen sind freilich fast nichts für uns hier oben, aber für dich, der du zu Besuch hier bist und überhaupt nur drei Wochen bleiben sollst, für dich ist es doch eine Menge Zeit. Erst akklimatisiere dich mal, das ist gar nicht so leicht, sollst du sehen. Und dann ist das Klima auch nicht das einzig Sonderbare bei uns. Du wirst hier mancherlei Neues sehen, paß auf. Und was du von mir sagst, das geht denn doch nicht so flott mit mir, du, ‚in drei Wochen nach Haus‘, das sind so Ideen von unten. Ich bin ja wohl braun, aber das ist hauptsächlich Schneeverbrennung und hat nicht viel zu bedeuten, wie Behrens auch immer sagt, und bei der letzten Generaluntersuchung hat er gesagt, ein halbes Jahr wird es wohl ziemlich sicher noch dauern.“
„Ein halbes Jahr? Bist du toll?“ rief Hans Castorp. Sie hatten sich eben vor dem Stationsgebäude, das nicht viel mehr als ein Schuppen war, in das gelbe Kabriolett gesetzt, das dort auf steinigem Platze bereit stand, und während die beiden Braunen anzogen, warf sich Hans Castorp empört auf dem harten Kissen herum. „Ein halbes Jahr? du bist ja schon fast ein halbes Jahr hier! Man hat doch nicht so viel Zeit –!“
„Ja, Zeit“, sagte Joachim und nickte mehrmals geradeaus, ohne sich um des Vetters ehrliche Entrüstung zu kümmern. „Die springen hier um mit der menschlichen Zeit, das glaubst du gar nicht. Drei Wochen sind wie ein Tag vor ihnen. Du wirst schon sehen. Du wirst das alles schon lernen“, sagte er und setzte hinzu: „Man ändert hier seine Begriffe.“
Hans Castorp betrachtete ihn unausgesetzt von der Seite.
„Du hast dich aber doch prachtvoll erholt“, sagte er kopfschüttelnd.
„Ja, meinst du?“ antwortete Joachim. „Nicht wahr, ich denke doch auch!“ sagte er und setzte sich höher ins Kissen zurück; doch nahm er gleich wieder eine schrägere Stellung ein. „Es geht mir ja besser“, erklärte er; „aber gesund bin ich eben noch nicht. Links oben, wo früher Rasseln zu hören war, klingt es jetzt nur noch rauh, das ist nicht so schlimm, aber unten ist es noch sehr rauh, und dann sind auch im zweiten Interkostalraum Geräusche.“
„Wie gelehrt du geworden bist“, sagte Hans Castorp.
„Ja, das ist, weiß Gott, eine nette Gelehrsamkeit. Die hätte ich gern im Dienste schon wieder verschwitzt“, erwiderte Joachim. „Aber ich habe noch Sputum“, sagte er mit einem zugleich lässigen und heftigen Achselzucken, das ihm nicht gut zu Gesichte stand, und ließ seinen Vetter etwas sehen, was er aus der ihm zugekehrten Seitentasche seines Ulsters zur Hälfte herauszog und gleich wieder verwahrte: eine flache, geschweifte Flasche aus blauem Glase mit einem Metallverschluß. „Das haben die meisten von uns hier oben“, sagte er. „Es hat auch einen Namen bei uns, so einen Spitznamen, ganz fidel. Du siehst dir die Gegend an?“
Das tat Hans Castorp, und er äußerte: „Großartig!“
„Findest du?“ fragte Joachim.
Sie hatten die unregelmäßig bebaute, der Eisenbahn gleichlaufende Straße ein Stück in der Richtung der Talachse verfolgt, hatten dann nach links hin das schmale Geleise gekreuzt, einen Wasserlauf überquert und trotteten nun auf sanft ansteigendem Fahrweg bewaldeten Hängen entgegen, dorthin, wo auf niedrig vorspringendem Wiesenplateau, die Front südwestlich gewandt, ein langgestrecktes Gebäude mit Kuppelturm, das vor lauter Balkonlogen von weitem löcherig und porös wirkte wie ein Schwamm, soeben die ersten Lichter aufsteckte. Es dämmerte rasch. Ein leichtes Abendrot, das eine Weile den gleichmäßig bedeckten Himmel belebt hatte, war schon verblichen, und jener farblose, entseelte und traurige Übergangszustand herrschte in der Natur, der dem vollen Einbruch der Nacht unmittelbar vorangeht. Das besiedelte Tal, lang hingestreckt und etwas gewunden, beleuchtete sich nun überall, auf dem Grunde sowohl wie da und dort an den beiderseitigen Lehnen, – an der rechten zumal, die auslud, und an der Baulichkeiten terrassenförmig aufstiegen. Links liefen Pfade die Wiesenhänge hinan und verloren sich in der stumpfen Schwärze der Nadelwälder. Die entfernteren Bergkulissen, hinten am Ausgang, gegen den das Tal sich verjüngte, zeigten ein nüchternes Schieferblau. Da ein Wind sich aufgemacht hatte, wurde die Abendkühle empfindlich.
„Nein, ich finde es offen gestanden nicht so überwältigend“, sagte Hans Castorp. „Wo sind denn die Gletscher und Firnen und die gewaltigen Bergesriesen? Diese Dinger sind doch nicht sehr hoch, wie mir scheint.“
„Doch, sie sind hoch“, antwortete Joachim. „Du siehst die Baumgrenze fast überall, sie markiert sich ja auffallend scharf, die Fichten hören auf, und damit hört alles auf, aus ist es, Felsen, wie du bemerkst. Da drüben, rechts von dem Schwarzhorn, dieser Zinke dort, hast du sogar einen Gletscher, siehst du das Blaue noch? Er ist nicht groß, aber es ist ein Gletscher, wie es sich gehört, der Scaletta-Gletscher. Piz Michel und Tinzenhorn in der Lücke, du kannst sie von hier aus nicht sehen, liegen auch immer im Schnee, das ganze Jahr.“
„In ewigem Schnee“, sagte Hans Castorp.
„Ja, ewig, wenn du willst. Doch, hoch ist das alles schon. Aber wir selbst sind scheußlich hoch, mußt du bedenken. Sechzehnhundert Meter über dem Meer. Da kommen die Erhebungen nicht so zur Geltung.“
„Ja, war das eine Kletterei! Mir ist angst und bange geworden, kann ich dir sagen. Sechzehnhundert Meter! Das sind ja annähernd fünftausend Fuß, wenn ich es ausrechne. In meinem Leben war ich noch nicht so hoch.“ Und Hans Castorp nahm neugierig einen tiefen, probenden Atemzug von der fremden Luft. Sie war frisch – und nichts weiter. Sie entbehrte des Duftes, des Inhaltes, der Feuchtigkeit, sie ging leicht ein und sagte der Seele nichts.
„Ausgezeichnet!“ bemerkte er höflich.
„Ja, es ist ja eine berühmte Luft. Übrigens präsentiert sich die Gegend heute abend nicht vorteilhaft. Manchmal nimmt sie sich besser aus, besonders im Schnee. Aber man sieht sich sehr satt an ihr. Wir alle hier oben, kannst du mir glauben, haben sie ganz unaussprechlich satt“, sagte Joachim, und sein Mund wurde von einem Ausdruck des Ekels verzogen, der übertrieben und unbeherrscht wirkte und ihn wiederum nicht gut kleidete.
„Du sprichst so sonderbar“, sagte Hans Castorp.
„Spreche ich sonderbar?“ fragte Joachim mit einer gewissen Besorgnis und wandte sich seinem Vetter zu ...
„Nein, nein, verzeih, es kam mir wohl nur einen Augenblick so vor!“ beeilte sich Hans Castorp zu sagen. Er hatte aber die Wendung „Wir hier oben“ gemeint, die Joachim schon zum dritten- oder viertenmal gebraucht hatte und die ihn auf irgendeine Weise beklemmend und seltsam anmutete.
„Unser Sanatorium liegt noch höher als der Ort, wie du siehst“, fuhr Joachim fort. „Fünfzig Meter. Im Prospekt steht ‚hundert‘, aber es sind bloß fünfzig. Am allerhöchsten liegt das Sanatorium Schatzalp dort drüben, man kann es nicht sehen. Die müssen im Winter ihre Leichen per Bobschlitten herunterbefördern, weil dann die Wege nicht fahrbar sind.“
„Ihre Leichen? Ach so! Na, höre mal!“ rief Hans Castorp. Und plötzlich geriet er ins Lachen, in ein heftiges, unbezwingliches Lachen, das seine Brust erschütterte und sein vom kühlen Wind etwas steifes Gesicht zu einer leise schmerzenden Grimasse verzog. „Auf dem Bobschlitten! Und das erzählst du mir so in aller Gemütsruhe? Du bist ja ganz zynisch geworden in diesen fünf Monaten!“
„Gar nicht zynisch“, antwortete Joachim achselzuckend. „Wieso denn? Das ist den Leichen doch einerlei ... Übrigens kann es wohl sein, daß man zynisch wird hier bei uns. Behrens selbst ist auch so ein alter Zyniker – ein famoses Huhn nebenbei, alter Korpsstudent und glänzender Operateur, wie es scheint, er wird dir gefallen. Dann ist da noch Krokowski, der Assistent – ein ganz gescheutes Etwas. Im Prospekt ist besonders auf seine Tätigkeit hingewiesen. Er treibt nämlich Seelenzergliederung mit den Patienten.“
„Was treibt er? Seelenzergliederung? Das ist ja widerlich!“ rief Hans Castorp, und nun nahm seine Heiterkeit überhand. Er war ihrer gar nicht mehr Herr, nach allem andern hatte die Seelenzergliederung es ihm vollends angetan, und er lachte so sehr, daß die Tränen ihm unter der Hand hervorliefen, mit der er, sich vorbeugend, die Augen bedeckte. Joachim lachte ebenfalls herzlich – es schien ihm wohlzutun –, und so kam es, daß die jungen Leute in großer Aufgeräumtheit aus ihrem Wagen stiegen, der sie zuletzt im Schritt, auf steiler, schleifenförmiger Anfahrt vor das Portal des Internationalen Sanatoriums Berghof getragen hatte.
Gleich zur Rechten, zwischen Haustor und Windfang, war die Concierge-Loge gelegen, und von dort kam ein Bediensteter von französischem Typus, der, am Telephon sitzend, Zeitungen gelesen hatte, in der grauen Livree des hinkenden Mannes am Bahnhof ihnen entgegen und führte sie durch die wohlbeleuchtete Halle, an deren linker Seite Gesellschaftsräume lagen. Im Vorübergehen blickte Hans Castorp hinein und fand sie leer. Wo denn die Gäste seien, fragte er, und sein Vetter antwortete:
„In der Liegekur. Ich hatte Ausgang heute, weil ich dich abholen wollte. Sonst liege ich auch nach dem Abendbrot auf dem Balkon.“
Es fehlte nicht viel, daß Hans Castorp aufs neue vom Lachen überwältigt wurde.
„Was, ihr liegt noch bei Nacht und Nebel auf dem Balkon?“ fragte er mit wankender Stimme ...
„Ja, das ist Vorschrift. Von acht bis zehn. Aber komm nun, sieh dir dein Zimmer an und wasch’ dir die Hände.“
Sie bestiegen den Lift, dessen elektrisches Triebwerk der Franzose bediente. Im Hinaufgleiten trocknete Hans Castorp sich die Augen.
„Ich bin ganz entzwei und erschöpft vor Lachen“, sagte er und atmete durch den Mund. „Du hast mir soviel tolles Zeug erzählt ... Das mit der Seelenzergliederung war zu stark, das hätte nicht kommen dürfen. Außerdem bin ich doch auch wohl ein bißchen abgespannt von der Reise. Leidest du auch so an kalten Füßen? Gleichzeitig hat man dann so ein heißes Gesicht, das ist unangenehm. Wir essen wohl gleich? Mir scheint, ich habe Hunger. Ißt man denn anständig bei euch hier oben?“
Sie gingen geräuschlos den Kokosläufer des schmalen Korridors entlang. Glocken aus Milchglas sandten von der Decke ein bleiches Licht. Die Wände schimmerten weiß und hart, mit einer lackartigen Ölfarbe überzogen. Eine Krankenschwester zeigte sich irgendwo, in weißer Haube und einen Zwicker auf der Nase, dessen Schnur sie sich hinter das Ohr gelegt hatte. Offenbar war sie protestantischer Konfession, ohne rechte Hingabe an ihren Beruf, neugierig und von Langerweile beunruhigt und belastet. An zwei Stellen des Ganges, auf dem Fußboden vor den weiß lackierten numerierten Türen, standen gewisse Ballons, große, bauchige Gefäße mit kurzen Hälsen, nach deren Bedeutung zu fragen Hans Castorp fürs erste vergaß.
„Hier bist du“, sagte Joachim. „Nummer Vierunddreißig. Rechts bin ich, und links ist ein russisches Ehepaar, – etwas salopp und laut, muß man wohl sagen, aber das war nicht anders zu machen. Nun, was sagst du?“
Die Tür war doppelt, mit Kleiderhaken im inneren Hohlraum. Joachim hatte das Deckenlicht eingeschaltet, und in seiner zitternden Klarheit zeigte das Zimmer sich heiter und friedlich, mit seinen weißen, praktischen Möbeln, seinen ebenfalls weißen, starken, waschbaren Tapeten, seinem reinlichen Linoleum-Fußbodenbelag und den leinenen Vorhängen, die in modernem Geschmacke einfach und lustig bestickt waren. Die Balkontür stand offen; man gewahrte die Lichter des Tals und vernahm eine entfernte Tanzmusik. Der gute Joachim hatte einige Blumen in eine kleine Vase auf die Kommode gestellt, – was eben im zweiten Grase zu finden gewesen war, etwas Schafgarbe und ein paar Glockenblumen, von ihm selbst am Hange gepflückt.
„Reizend von dir“, sagte Hans Castorp. „Was für ein nettes Zimmer! Hier läßt es sich gut und gern ein paar Wochen hausen.“
„Vorgestern ist hier eine Amerikanerin gestorben“, sagte Joachim. „Behrens meinte gleich, daß sie fertig sein würde, bis du kämest, und daß du das Zimmer dann haben könntest. Ihr Verlobter war bei ihr, englischer Marineoffizier, aber er benahm sich nicht gerade stramm. Jeden Augenblick kam er auf den Korridor hinaus, um zu weinen, ganz wie ein kleiner Junge. Und dann rieb er sich die Backen mit Cold-cream ein, weil er rasiert war und die Tränen ihn da so brannten. Vorgestern abend hatte die Amerikanerin noch zwei Blutstürze ersten Ranges, und damit war Schluß. Aber sie ist schon seit gestern morgen fort, und dann haben sie hier natürlich gründlich ausgeräuchert, mit Formalin, weißt du, das soll so gut sein für solche Zwecke.“
Hans Castorp nahm diese Erzählung mit einer angeregten Zerstreutheit auf. Mit zurückgezogenen Ärmeln vor dem geräumigen Waschbecken stehend, dessen Nickelhähne im elektrischen Lichte blitzten, warf er kaum einen flüchtigen Blick zu der weißmetallenen, reinlich bedeckten Bettstatt hinüber.
„Ausgeräuchert, das ist famos“, sagte er gesprächig und etwas ungereimt, indem er sich die Hände wusch und trocknete. „Ja, Methylaldehyd, das hält die stärkste Bakterie nicht aus, – H₂CO, aber es sticht in die Nase, nicht? Selbstverständlich ist strengste Sauberkeit eine Grundbedingung ...“ Er sagte „Selbstvers-tändlich“ mit dem getrennten st, während sein Vetter sich, seit er Student war, die verbreitetere Aussprache angewöhnt hatte, und fuhr mit großer Geläufigkeit fort: „Was ich noch sagen wollte ... Wahrscheinlich hatte der Marineoffizier sich mit dem Sicherheitsapparat rasiert, möchte ich annehmen, man macht sich doch leichter wund mit den Dingern, als mit einem gut abgezogenen Messer, das ist wenigstens meine Erfahrung, ich gebrauche abwechselnd eins und das andere ... Na, und auf der gereizten Haut tut das Salzwasser natürlich weh, da war er wohl vom Dienst her gewöhnt, Cold-cream anzuwenden, es fällt mir nichts auf daran ...“ Und er plauderte weiter, sagte, daß er zweihundert Stück von Maria Mancini – seiner Zigarre – im Koffer habe, – die Revision sei höchst gemütlich gewesen – und richtete Grüße von verschiedenen Personen in der Heimat aus. „Wird hier denn nicht geheizt?“ rief er plötzlich und lief zu den Röhren, um die Hände daran zu legen ...
„Nein, wir werden hier ziemlich kühl gehalten“, antwortete Joachim. „Da muß es anders kommen, bis im August die Zentralheizung angezündet wird.“
„August, August!“ sagte Hans Castorp. „Aber mich friert! Mich friert abscheulich, nämlich am Körper, denn im Gesicht bin ich auffallend echauffiert, – da, fühle doch mal, wie ich brenne!“
Diese Zumutung, man solle sein Gesicht befühlen, paßte ganz und gar nicht zu Hans Castorps Natur und berührte ihn selber peinlich. Joachim ging auch nicht darauf ein, sondern sagte nur:
„Das ist die Luft und hat nichts zu sagen. Behrens selbst hat den ganzen Tag blaue Backen. Manche gewöhnen sich nie. Na, go on, wir kriegen sonst nichts mehr zu essen.“
Draußen zeigte sich wieder die Krankenschwester, kurzsichtig und neugierig nach ihnen spähend. Aber im ersten Stockwerk blieb Hans Castorp plötzlich stehen, festgebannt von einem vollkommen gräßlichen Geräusch, das in geringer Entfernung hinter einer Biegung des Korridors vernehmlich wurde, einem Geräusch, nicht laut, aber so ausgemacht abscheulicher Art, daß Hans Castorp eine Grimasse schnitt und seinen Vetter mit erweiterten Augen ansah. Es war Husten, offenbar, – eines Mannes Husten; aber ein Husten, der keinem anderen ähnelte, den Hans Castorp jemals gehört hatte, ja, mit dem verglichen jeder andere ihm bekannte Husten eine prächtige und gesunde Lebensäußerung gewesen war, – ein Husten ganz ohne Lust und Liebe, der nicht in richtigen Stößen geschah, sondern nur wie ein schauerlich kraftloses Wühlen im Brei organischer Auflösung klang.
„Ja,“ sagte Joachim, „da sieht es böse aus. Ein österreichischer Aristokrat, weißt du, eleganter Mann und ganz wie zum Herrenreiter geboren. Und nun steht es so mit ihm. Aber er geht noch herum.“
Während sie ihren Weg fortsetzten, sprach Hans Castorp angelegentlich über den Husten des Herrenreiters. „Du mußt bedenken,“ sagte er, „daß ich dergleichen nie gehört habe, daß es mir völlig neu ist, da macht es natürlich Eindruck auf mich. Es gibt so vielerlei Husten, trockenen und losen, und der lose ist eher noch vorteilhafter, wie man allgemein sagt, und besser, als wenn man so bellt. Als ich in meiner Jugend („in meiner Jugend“ sagte er) Bräune hatte, da bellte ich wie ein Wolf, und sie waren alle froh, als es locker wurde, ich kann mich noch dran erinnern. Aber so ein Husten, wie dieser, war noch nicht da, für mich wenigstens nicht, – das ist ja gar kein lebendiger Husten mehr. Er ist nicht trocken, aber lose kann man ihn auch nicht nennen, das ist noch längst nicht das Wort. Es ist ja gerade, als ob man dabei in den Menschen hineinsähe, wie es da aussieht, – alles ein Matsch und Schlamm ...“
„Na,“ sagte Joachim, „ich höre es ja jeden Tag, du brauchst es mir nicht zu beschreiben.“
Aber Hans Castorp konnte sich gar nicht über den vernommenen Husten beruhigen, er versicherte wiederholt, daß man förmlich dabei in den Herrenreiter hineinsähe, und als sie das Restaurant betraten, hatten seine reisemüden Augen einen erregten Glanz.
Im Restaurant war es hell, elegant und gemütlich. Es lag gleich rechts an der Halle, den Konversationsräumen gegenüber, und wurde, wie Joachim erklärte, hauptsächlich von neu angekommenen, außer der Zeit speisenden Gästen, und von solchen, die Besuch hatten, benutzt. Aber auch Geburtstage und bevorstehende Abreisen wurden dort festlich begangen, sowie günstige Ergebnisse von Generaluntersuchungen. Manchmal gehe es hoch her im Restaurant, sagte Joachim; auch Champagner werde serviert. Jetzt saß niemand als eine einzelne etwa dreißigjährige Dame darin, die in einem Buche las, aber dabei vor sich hin summte und mit dem Mittelfinger der linken Hand immerfort leicht auf das Tischtuch klopfte. Als die jungen Leute sich niedergelassen hatten, wechselte sie den Platz, um ihnen den Rücken zuzuwenden. Sie sei menschenscheu, erklärte Joachim leise, und esse immer mit einem Buche im Restaurant. Man wollte wissen, daß sie schon als ganz junges Mädchen in Lungensanatorien eingetreten sei und seitdem nicht mehr in der Welt gelebt habe.
„Nun, dann bist du ja noch ein junger Anfänger gegen sie mit deinen fünf Monaten und wirst es noch sein, wenn du ein Jahr auf dem Buckel hast“, sagte Hans Castorp zu seinem Vetter; worauf Joachim mit jenem Achselzucken, das ihm früher nicht eigen gewesen war, zur Menukarte griff.
Sie hatten den erhöhten Tisch am Fenster genommen, den hübschesten Platz. An dem cremefarbenen Vorhang saßen sie einander gegenüber, die Gesichter beglüht vom Schein des rot umhüllten elektrischen Tischlämpchens. Hans Castorp faltete seine frisch gewaschenen Hände und rieb sie behaglich-erwartungsvoll aneinander, wie er zu tun pflegte, wenn er sich zu Tische setzte, – vielleicht weil seine Vorfahren vor der Suppe gebetet hatten. Ein freundliches, gaumig sprechendes Mädchen in schwarzem Kleide mit weißer Schürze und einem großen Gesicht von überaus gesunder Farbe bediente sie, und zu seiner großen Heiterkeit ließ Hans Castorp sich belehren, daß man die Kellnerinnen hier „Saaltöchter“ nenne. Sie bestellten eine Flasche Gruaud Larose bei ihr, die Hans Castorp noch einmal fortschickte, um sie besser temperieren zu lassen. Das Essen war vorzüglich. Es gab Spargelsuppe, gefüllte Tomaten, Braten mit vielerlei Zutat, eine besonders gut bereitete süße Speise, eine Käseplatte und Obst. Hans Castorp aß sehr stark, obgleich sein Appetit sich nicht als so lebhaft erwies, wie er geglaubt hatte. Aber er war gewohnt, viel zu essen, auch wenn er keinen Hunger hatte, und zwar aus Selbstachtung.
Joachim tat den Gerichten nicht viel Ehre an. Er hatte die Küche satt, sagte er, das hätten sie alle hier oben, und es sei Brauch, auf das Essen zu schimpfen; denn wenn man hier ewig und drei Tage sitze ... Dagegen trank er mit Vergnügen, ja mit einer gewissen Hingebung von dem Wein, und gab unter sorgfältiger Vermeidung allzu gefühlvoller Wendungen wiederholt seiner Genugtuung Ausdruck, daß jemand da sei, mit dem man ein vernünftiges Wort reden könne.
„Ja, es ist brillant, daß du gekommen bist!“ sagte er, und seine gemächliche Stimme war bewegt. „Ich kann wohl sagen, es ist für mich geradezu ein Ereignis. Das ist doch einmal eine Abwechslung, – ich meine, es ist ein Einschnitt, eine Gliederung in dem ewigen, grenzenlosen Einerlei ...“
„Aber die Zeit muß euch eigentlich schnell hier vergehen“, meinte Hans Castorp.
„Schnell und langsam, wie du nun willst“, antwortete Joachim. „Sie vergeht überhaupt nicht, will ich dir sagen, es ist gar keine Zeit, und es ist auch kein Leben, – nein, das ist es nicht“, sagte er kopfschüttelnd und griff wieder zum Glase.
Auch Hans Castorp trank, obgleich sein Gesicht nun wie Feuer brannte. Aber am Körper war ihm noch immer kalt, und eine besondere freudige und doch etwas quälende Unruhe war in seinen Gliedern. Seine Worte überhasteten sich, er versprach sich des öfteren und ging mit einer wegwerfenden Handbewegung darüber hin. Übrigens war auch Joachim in belebter Stimmung, und um so freier und aufgeräumter ging ihr Gespräch, als die summende, pochende Dame ganz plötzlich aufgestanden und davongegangen war. Sie gestikulierten beim Essen mit den Gabeln, machten, einen Bissen in der Backe, wichtige Mienen, lachten, nickten, hoben die Schultern und hatten noch nicht ordentlich hinuntergeschluckt, wenn sie schon weitersprachen. Joachim wollte von Hamburg hören und hatte das Gespräch auf die geplante Elbregulierung gebracht.
„Epochal!“ sagte Hans Castorp. „Epochal für die Entwicklung unserer Schiffahrt, – gar nicht zu überschätzen. Wir setzen fünfzig Millionen als sofortige einmalige Ausgabe dafür ins Budget, und du kannst überzeugt sein, wir wissen genau, was wir tun.“
Übrigens sprang er, bei aller Wichtigkeit, die er der Elbregulierung beimaß, gleich wieder ab von diesem Thema und verlangte, daß Joachim ihm Weiteres von dem Leben „hier oben“ und von den Gästen erzähle, was auch bereitwillig geschah, da Joachim froh war, sich erleichtern und mitteilen zu können. Das von den Leichen, die man die Bob-Bahn hinuntersandte, mußte er wiederholen und noch einmal ausdrücklich versichern, daß es auf Wahrheit beruhe. Da Hans Castorp wieder vom Lachen ergriffen wurde, lachte auch er, was er herzlich zu genießen schien, und ließ andere komische Dinge hören, um der Ausgelassenheit Nahrung zu geben. Eine Dame sitze mit ihm am Tische, namens Frau Stöhr, ziemlich krank übrigens, eine Musikersgattin aus Cannstatt, – die sei das Ungebildetste, was ihm jemals vorgekommen. „Desinfiszieren“ sage sie, – aber in vollstem Ernst. Und den Assistenten Krokowski nenne sie den „Fomulus“. Das müsse man nun hinunterschlucken, ohne das Gesicht zu verziehen. Außerdem sei sie klatschsüchtig, wie übrigens die meisten hier oben, und einer anderen Dame, Frau Iltis, sage sie nach, sie trage ein „Sterilett“. „Sterilett nennt sie das, – das ist doch unbezahlbar!“ Und halb liegend, gegen die Lehnen ihrer Stühle zurückgeworfen, lachten sie so sehr, daß ihnen der Leib bebte und sie fast gleichzeitig Schluckauf bekamen.
Zwischendurch betrübte Joachim sich und gedachte seines Loses.
„Ja, da sitzen wir nun und lachen,“ sagte er mit schmerzendem Gesicht und zuweilen von den Erschütterungen seines Zwerchfelles unterbrochen; „und dabei ist gar nicht abzusehen, wann ich hier wegkomme, denn wenn Behrens sagt: noch ein halbes Jahr, dann ist es knapp gerechnet, man muß sich auf mehr gefaßt machen. Aber es ist doch hart, sage mal selbst, ob es nicht traurig für mich ist. Da war ich nun schon genommen, und im nächsten Monat könnte ich meine Offiziersprüfung machen. Und nun lungere ich hier herum mit dem Thermometer im Mund und zähle die Schnitzer von dieser ungebildeten Frau Stöhr und versäume die Zeit. Ein Jahr spielt solch eine Rolle in unserem Alter, es bringt im Leben unten so viele Veränderungen und Fortschritte mit sich. Und ich muß hier stagnieren wie ein Wasserloch, – ja, ganz wie ein fauliger Tümpel, es ist gar kein zu krasser Vergleich ...“
Sonderbarerweise antwortete Hans Castorp hierauf nur mit der Frage, ob man hier eigentlich Porter bekommen könne, und als sein Vetter ihn etwas erstaunt betrachtete, sah er, daß jener im Einschlafen begriffen war, – eigentlich schlief er schon.
„Aber du schläfst ja!“ sagte Joachim. „Komm, es ist Zeit, zu Bett zu gehen, für uns beide.“
„Es ist überhaupt keine Zeit“, sagte Hans Castorp mit schwerer Zunge. Aber er ging doch mit, etwas gebückt und steifbeinig, wie ein Mensch, der von Müdigkeit förmlich zu Boden gezogen wird, – nahm sich jedoch gewaltsam zusammen, als er in der nur noch matt erleuchteten Halle Joachim sagen hörte:
„Da sitzt Krokowski. Ich muß dich, glaube ich, rasch noch vorstellen.“
Dr. Krokowski saß im Hellen, am Kamin des einen Konversationszimmers, gleich bei der offenen Schiebetür, und las eine Zeitung. Er stand auf, als die jungen Leute auf ihn zutraten und Joachim in militärischer Haltung sagte:
„Darf ich Ihnen, bitte, meinen Vetter Castorp aus Hamburg vorstellen, Herr Doktor. Er ist eben erst angekommen.“
Dr. Krokowski begrüßte den neuen Hausgenossen mit einer gewissen heiteren, stämmigen und aufmunternden Herzhaftigkeit, als wollte er andeuten, daß Aug in Auge mit ihm jede Befangenheit überflüssig und einzig fröhliches Vertrauen am Platze sei. Er war ungefähr fünfunddreißig Jahre alt, breitschultrig, fett, bedeutend kleiner als die beiden, die vor ihm standen, so daß er den Kopf schräg zurücklegen mußte, um ihnen ins Gesicht zu sehen, – und außerordentlich bleich, von durchscheinender, ja phosphoreszierender Blässe, die noch gehoben wurde durch die dunkle Glut seiner Augen, die Schwärze seiner Brauen und seines ziemlich langen, in zwei Spitzen auslaufenden Vollbartes, der bereits ein paar weiße Fäden zeigte. Er trug einen schwarzen, zweireihigen, schon etwas abgenutzten Sakkoanzug, schwarze, durchbrochene, sandalenartige Halbschuhe zu dicken, grauwollenen Socken und einen weich überfallenden Halskragen, wie Hans Castorp ihn bis dahin nur bei einem Photographen in Danzig gesehen hatte und welcher der Erscheinung Dr. Krokowskis in der Tat ein ateliermäßiges Gepräge verlieh. Herzlich lächelnd, so daß in seinem Barte die gelblichen Zähne sichtbar wurden, schüttelte er dem jungen Manne die Hand, indem er mit baritonaler Stimme und etwas fremdländisch schleppenden Akzenten sagte:
„Seien Sie uns willkommen, Herr Castorp! Möchten Sie sich rasch einleben und sich wohlfühlen in unserer Mitte. Sie kommen zu uns als Patient, wenn ich mir die Frage erlauben darf?“
Es war rührend zu sehen, wie Hans Castorp arbeitete, um sich artig zu erweisen und seiner Schläfrigkeit Herr zu werden. Er ärgerte sich, so schlecht in Form zu sein und sah mit dem mißtrauischen Selbstbewußtsein junger Leute in dem Lächeln und dem aufmunternden Wesen des Assistenten Zeichen nachsichtigen Spottes. Er antwortete, indem er von den drei Wochen sprach, auch seines Examens erwähnte und hinzufügte, daß er, gottlob, ganz gesund sei.
„Wahrhaftig?“ fragte Dr. Krokowski, indem er seinen Kopf wie neckend schräg vorwärts stieß und sein Lächeln verstärkte ... „Aber dann sind Sie eine höchst studierenswerte Erscheinung! Mir ist nämlich ein ganz gesunder Mensch noch nicht vorgekommen. Was für ein Examen haben Sie abgelegt, wenn die Frage erlaubt ist?“
„Ich bin Ingenieur, Herr Doktor“, antwortete Hans Castorp mit bescheidener Würde.
„Ah, Ingenieur!“ Und Dr. Krokowskis Lächeln zog sich gleichsam zurück, büßte an Kraft und Herzlichkeit für den Augenblick etwas ein. „Das ist wacker. Und Sie werden hier also keinerlei ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen, weder in körperlicher noch in psychischer Hinsicht?“
„Nein, ich danke tausendmal!“ sagte Hans Castorp und wäre fast einen Schritt zurückgewichen.
Da brach das Lächeln Dr. Krokowskis wieder siegreich hervor, und indem er dem jungen Manne aufs neue die Hand schüttelte, rief er mit lauter Stimme:
„Nun, so schlafen Sie denn wohl, Herr Castorp, – im Vollgefühl Ihrer untadeligen Gesundheit! Schlafen Sie wohl und auf Wiedersehn!“ – Damit entließ er die jungen Leute und setzte sich wieder zu seiner Zeitung nieder.
Der Aufzug hatte keine Bedienung mehr, und so legten sie zu Fuß die Treppen zurück, schweigend und etwas verwirrt von der Begegnung mit Dr. Krokowski. Joachim begleitete Hans Castorp auf Nummer Vierunddreißig, wo der Hinkende das Gepäck des Ankömmlings richtig eingeliefert hatte, und sie plauderten noch eine Viertelstunde, während Hans Castorp Nacht- und Waschzeug auspackte und eine dicke, milde Zigarette dazu rauchte. Zur Zigarre kam er heute nicht mehr, was ihm wunderlich und außerordentlich erschien.
„Er sieht sehr bedeutend aus“, sagte er, indem er beim Sprechen den eingeatmeten Rauch hervorsprudelte. „Wachsbleich ist er. Aber mit seiner Chaussure, höre mal, da steht es scheußlich. Grauwollene Socken und dann diese Sandalen. War er zum Schluß eigentlich beleidigt?“
„Er ist etwas empfindlich“, gab Joachim zu. „Du hättest die ärztliche Behandlung nicht so brüsk zurückweisen sollen, wenigstens nicht die psychische. Er sieht es nicht gern, wenn man sich dem entzieht. Auf mich ist er auch nicht besonders zu sprechen, weil ich ihm nicht genug anvertraue. Aber dann und wann erzähl ich ihm doch einen Traum, damit er was zu zergliedern hat.“
„Nun, dann hab ich ihn eben vor den Kopf gestoßen“, sagte Hans Castorp verdrießlich; denn es machte ihn unzufrieden mit sich selbst, jemanden gekränkt zu haben, und so kam denn die Müdigkeit auch mit erneuter Stärke über ihn.
„Gute Nacht“, sagte er. „Ich falle um.“
„Um acht hole ich dich zum Frühstück“, sagte Joachim und ging.
Hans Castorp machte nur flüchtige Nachttoilette. Der Schlaf übermannte ihn, kaum daß er das Nachttischlämpchen gelöscht hatte, aber er schreckte noch einmal auf, da er sich erinnerte, daß in diesem Bette vorgestern jemand gestorben sei. „Es wird nicht das erstemal gewesen sein“, sagte er zu sich, als könne ihm das zur Beruhigung dienen. „Es ist eben ein Totenbett, ein gewöhnliches Totenbett.“ Und er schlief ein.
Aber sobald er eingeschlafen war, begann er zu träumen und träumte fast unaufhörlich bis zum anderen Morgen. Hauptsächlich sah er Joachim Ziemßen in sonderbar verrenkter Lage auf einem Bobschlitten eine schräge Bahn hinabfahren. Er war so phosphoreszierend bleich wie Dr. Krokowski, und vorneauf saß der Herrenreiter, der sehr unbestimmt aussah, wie jemand, den man lediglich hat husten hören, und lenkte. „Das ist uns doch ganz einerlei, – uns hier oben“, sagte der verrenkte Joachim, und dann war er es, nicht der Herrenreiter, der so grauenhaft breiig hustete. Darüber mußte Hans Castorp bitterlich weinen und sah ein, daß er in die Apotheke laufen müsse, um sich Cold-cream zu besorgen. Aber am Wege saß Frau Iltis mit einer spitzen Schnauze und hielt etwas in der Hand, was offenbar ihr „Sterilett“ sein sollte, aber nichts weiter war als ein Sicherheits-Rasierapparat. Das machte Hans Castorp nun wieder lachen, und so wurde er zwischen verschiedenen Gemütsbewegungen hin und her geworfen, bis der Morgen durch seine halboffene Balkontür graute und ihn weckte.
Hans Castorp bewahrte an sein eigentliches Elternhaus nur blasse Erinnerungen; er hatte Vater und Mutter kaum recht gekannt. Sie starben weg in der kurzen Frist zwischen seinem fünften und siebenten Lebensjahr, zuerst die Mutter, vollkommen überraschend und in Erwartung ihrer Niederkunft, an einer Gefäßverstopfung infolge von Nervenentzündung, einer Embolie, wie Dr. Heidekind es bezeichnete, die augenblicklich Herzlähmung verursachte, – sie lachte eben, im Bette sitzend, es sah so aus, als ob sie vor Lachen umfiele, und dennoch tat sie es nur, weil sie tot war. Das war nicht leicht zu verstehen für Hans Hermann Castorp, den Vater, und da er sehr innig an seiner Frau gehangen hatte, auch seinerseits nicht der Stärkste war, so wußte er nicht darüber hinwegzukommen. Sein Geist war verstört und geschmälert seitdem; in seiner Benommenheit beging er geschäftliche Fehler, so daß die Firma Castorp & Sohn empfindliche Verluste erlitt; im übernächsten Frühjahr holte er sich bei einer Speicherinspektion am windigen Hafen die Lungenentzündung, und da sein erschüttertes Herz das hohe Fieber nicht aushielt, so starb er trotz aller Sorgfalt, die Dr. Heidekind an ihn wandte, binnen fünf Tagen und folgte seiner Frau unter ansehnlicher Beteiligung der Bürgerschaft ins Castorpsche Erbbegräbnis nach, das auf dem St. Katharinenkirchhof sehr schön, mit Blick auf den Botanischen Garten, gelegen war.
Sein Vater, der Senator, überlebte ihn, wenn auch nur um ein weniges, und die kurze Zeitspanne, bis er auch starb – übrigens gleichfalls an einer Lungenentzündung, und zwar unter großen Kämpfen und Qualen, denn zum Unterschiede von seinem Sohn war Hans Lorenz Castorp eine schwer zu fällende, im Leben zäh wurzelnde Natur – diese Zeitspanne also, es waren nur anderthalb Jahre, verlebte der verwaiste Hans Castorp in seines Großvaters Hause, einem zu Anfang des abgelaufenen Jahrhunderts auf schmalem Grundstück im Geschmack des nordischen Klassizismus erbauten, in einer trüben Wetterfarbe gestrichenen Haus an der Esplanade, mit Halbsäulen zu beiden Seiten der Eingangstür, in der Mitte des um fünf Stufen aufgetreppten Erdgeschosses, und zwei Obergeschossen außer der Beletage, wo die Fenster bis zu den Fußböden hinuntergezogen und mit gegossenen Eisengittern versehen waren.
Hier lagen ausschließlich Repräsentationsräume, eingerechnet das helle, mit Stuck verzierte Eßzimmer, dessen drei weinrot verhangene Fenster auf das rückwärtige Gärtchen blickten, und wo während der achtzehn Monate Großvater und Enkel alltäglich um 4 Uhr allein miteinander zu Mittag aßen, bedient von dem alten Fiete mit den Ohrringen und den silbernen Knöpfen am Frack, der zu diesem Frack eine ebensolche battistene Halsbinde trug, wie der Hausherr selbst, auch auf ganz ähnliche Art das rasierte Kinn darin barg, und den der Großvater duzte, indem er plattdeutsch mit ihm sprach; nicht scherzender Weise – er war ohne humoristischen Zug –, sondern in aller Sachlichkeit und weil er es überhaupt mit Leuten aus dem Volk, mit Speicherarbeitern, Postboten, Kutschern und Dienstboten so hielt. Hans Castorp hörte es gern, und sehr gern hörte er auch, wie Fiete antwortete, ebenfalls platt, indem er sich beim Servieren von links hinter seinem Herrn herumbeugte, um ihm in das rechte Ohr zu sprechen, auf dem der Senator bedeutend besser hörte als auf dem linken. Der Alte verstand und nickte und aß weiter, sehr aufrecht zwischen der hohen Mahagonilehne des Stuhles und dem Tisch, kaum über den Teller gebeugt, und der Enkel, ihm gegenüber, betrachtete still, mit tiefer und unbewußter Aufmerksamkeit, die knappen, gepflegten Bewegungen, mit denen die schönen, weißen, mageren alten Hände des Großvaters mit den gewölbten, spitz zulaufenden Nägeln und dem grünen Wappenring auf dem rechten Zeigefinger einen Bissen aus Fleisch, Gemüse und Kartoffeln auf der Gabelspitze anordneten und unter einem leichten Entgegenneigen des Kopfes zum Munde führten. Hans Castorp sah auf seine eigenen, noch ungeschickten Hände und fühlte darin die Möglichkeit vorgebildet, späterhin ebenso wie der Großvater Messer und Gabel zu halten und zu bewegen.
Eine andere Frage war, ob er je dazu gelangen würde, sein Kinn in einer solchen Binde zu bergen, wie sie die geräumige Öffnung des sonderbar geformten, mit den scharfen Spitzen die Wangen streifenden Halskragens des Großvaters ausfüllte. Denn dazu mußte man so alt sein wie dieser, und schon heute trug außer ihm und seinem alten Fiete weit und breit niemand mehr solche Binden und Kragen. Das war schade, denn dem kleinen Hans Castorp gefiel es besonders wohl, wie der Großvater das Kinn in die hohe, schneeweiße Binde lehnte; noch in der Erinnerung, als er erwachsen war, gefiel es ihm ausgezeichnet: es lag etwas darin, was er aus dem Grund seines Wesens billigte.
Wenn sie fertig gegessen und ihre Servietten zusammengelegt, gerollt und in die silbernen Ringe gesteckt hatten, ein Geschäft, mit dem Hans Castorp damals nicht leicht zu Rande kam, da die Servietten so groß waren wie kleine Tischtücher, so stand der Senator vor dem Stuhle auf, den Fiete hinter ihm wegzog, und ging mit schlürfenden Schritten ins „Kabinett“ hinüber, um sich seine Zigarre zu holen; und zuweilen folgte der Enkel ihm dorthin.
Dieses „Kabinett“ war dadurch entstanden, daß man das Eßzimmer dreifenstrig gemacht und durch die ganze Breite des Hauses gelegt hatte, weshalb nicht, wie sonst bei diesem Haustypus, Raum für drei Salons, sondern nur für zwei übriggeblieben war, von denen jedoch der eine, senkrecht zum Eßsaal gelegene, mit nur einem Fenster nach der Straße, unverhältnismäßig tief ausgefallen wäre. Darum hatte man etwa den vierten Teil seiner Länge von ihm abgesondert, eben das „Kabinett“, einen schmalen Raum mit Oberlicht, dämmerig und nur mit wenigen Gegenständen ausgestattet: einer Etagere, auf der des Senators Zigarrenschrank stand, einem Spieltisch, dessen Schublade anziehende Dinge enthielt: Whistkarten, Spielmarken, kleine Markierbrettchen mit aufklappbaren Zähnchen, eine Schiefertafel nebst Kreidegriffeln, papierne Zigarrenspitzen und anderes mehr; endlich mit einem Rokoko-Glasschrank aus Palisanderholz in der Ecke, hinter dessen Scheiben gelbseidene Vorhänge gespannt waren.
„Großpapa“, konnte der kleine Hans Castorp im Kabinett wohl sagen, indem er sich auf die Zehenspitzen erhob und zu dem Ohr des Alten emporstrebte, „zeig mir doch, bitte, die Taufschale!“
Und der Großvater, der ohnedies den Schoß seines langen und weichen Gehrocks vom Beinkleid zurückgerafft und sein Schlüsselbund aus der Tasche gezogen hatte, öffnete damit den Glasschrank, aus dessen Innerem es dem Knaben eigentümlich angenehm und merkwürdig entgegenduftete. Es waren allerlei außer Gebrauch befindliche und eben darum fesselnde Gegenstände darin aufbewahrt: ein Paar geschweifte silberne Armleuchter, ein zerbrochenes Barometer mit figürlicher Holzschnitzerei, ein Album mit Daguerreotypien, ein Likörkasten aus Zedernholz, ein kleiner Türke, hart anzufassen unter seinem buntseidenen Anzug, mit einem Uhrwerk im Leibe, das ihn dereinst befähigt hatte, über den Tisch zu laufen, nun aber schon lange den Dienst versagte, ein altertümliches Schiffsmodell und ganz zu unterst sogar eine Rattenfalle. Der Alte aber nahm von einem mittleren Fach eine stark angelaufene runde silberne Schale, die auf einem ebenfalls silbernen Teller stand, und wies beide Stücke dem Knaben vor, indem er sie voneinander nahm und unter schon oft gegebenen Erklärungen einzeln hin und her wandte.
Becken und Teller gehörten ursprünglich nicht zueinander, wie man wohl sah, und wie sich der Kleine aufs neue belehren ließ; doch seien sie, sagte der Großvater, seit rund hundert Jahren, nämlich seit Anschaffung des Beckens, im Gebrauche vereinigt. Die Schale war schön, von einfacher, edler Gestalt, geformt von dem strengen Geschmack der Frühzeit des letzten Jahrhunderts. Glatt und gediegen, ruhte sie auf rundem Fuße und war innen vergoldet; doch war das Gold von der Zeit schon zum gelblichen Schimmer verblichen. Als einziger Zierat lief ein erhabener Kranz von Rosen und zackigen Blättern um ihren oberen Rand. Den Teller angehend, so war sein weit höheres Alter ihm von der Innenseite abzulesen. „Sechzehnhundertundfünfzig“ stand dort in verschnörkelten Ziffern, und allerlei krause Gravierungen umrahmten die Zahl, ausgeführt in der „modernen Manier“ von damals, schwülstig-willkürlich, Wappen und Arabesken, die halb Stern und halb Blume waren. Auf der Rückseite aber fanden sich in wechselnder Schriftart die Namen der Häupter einpunktiert, die im Gange der Zeit des Stückes Inhaber gewesen: Es waren ihrer schon sieben, versehen mit der Jahreszahl der Erb-Übernahme, und der Alte in der Binde wies mit dem beringten Zeigefinger den Enkel auf jeden einzelnen hin. Der Name des Vaters war da, der des Großvaters selbst und der des Urgroßvaters, und dann verdoppelte, verdreifachte und vervierfachte sich die Vorsilbe „Ur“ im Munde des Erklärers, und der Junge lauschte seitwärts geneigten Kopfes, mit nachdenklich oder auch gedankenlos-träumerisch sich festsehenden Augen und andächtig-schläfrigem Munde auf das Ur-Ur-Ur-Ur, – diesen dunklen Laut der Gruft und der Zeitverschüttung, welcher dennoch zugleich einen fromm gewahrten Zusammenhang zwischen der Gegenwart, seinem eigenen Leben und dem tief Versunkenen ausdrückte und ganz eigentümlich auf ihn einwirkte: nämlich so, wie es auf seinem Gesichte sich ausdrückte. Er meinte modrig-kühle Luft, die Luft der Katharinenkirche oder der Michaeliskrypte zu atmen bei diesem Laut, den Anhauch von Orten zu spüren, an denen man, den Hut in der Hand, in eine gewisse, ehrerbietig vorwärts wiegende Gangart ohne Benutzung der Stiefelabsätze verfällt; auch die abgeschiedene, gefriedete Stille solcher hallender Orte glaubte er zu hören; geistliche Empfindungen mischten sich mit denen des Todes und der Geschichte beim Klang jener dumpfen Silbe, und dies alles mutete den Knaben irgendwie wohltuend an, ja, es mochte wohl sein, daß er um des Lautes willen, um ihn zu hören und nachzusprechen, gebeten hatte, die Taufschale wieder einmal betrachten zu dürfen.
Dann stellte der Großvater das Gefäß auf den Teller zurück und ließ den Kleinen in die glatte, leicht goldige Höhlung sehen, die aufschimmerte von dem einfallenden Oberlicht.
„Nun sind es bald acht Jahre,“ sagte er, „daß wir dich darüber hielten und daß das Wasser, mit dem du getauft wurdest, da hinein floß ... Küster Lassen von St. Jacobi goß es unserem guten Pastor Bugenhagen in die hohle Hand, und von da lief es über deinen Schopf hier in die Schale. Aber wir hatten es gewärmt, damit du nicht erschrecken und nicht weinen solltest, und das tatst du auch nicht, sondern im Gegenteil, du hattest vorher geschrien, so daß Bugenhagen es nicht leicht gehabt hatte mit seiner Rede, aber als das Wasser kam, da wurdest du still, und das war die Achtung vor dem heiligen Sakrament, wollen wir hoffen. Und vierundvierzig Jahre sind es in den nächsten Tagen, da war dein seliger Vater der Täufling, und von seinem Kopf floß das Wasser hier hinein. Das war hier im Haus, seinem Elternhaus, drüben im Saal, vor dem mittleren Fenster, und es war noch der alte Pastor Hesekiel, der ihn taufte, derselbe, den die Franzosen als jungen Menschen beinahe erschossen hätten, weil er gegen ihre Räubereien und Brandschatzungen gepredigt hatte, – der ist nun auch schon lange, lange bei Gott. Aber vor fünfundsiebenzig Jahren, da war ich es selber, den sie tauften, auch da im Saal, und meinen Kopf hielten sie über die Schale hier, wie sie da auf dem Teller steht, und der Geistliche sprach dieselben Worte wie bei dir und deinem Vater, und ebenso floß das warme, klare Wasser von meinem Haar (es war nicht viel mehr damals, als ich jetzt auf dem Kopfe habe) da in das goldene Becken hinein.“
Der Kleine blickte empor auf des Großvaters schmales Greisenhaupt, das eben wieder über die Schale geneigt war, wie zu der längst verflossenen Stunde, von der er erzählte, und ein schon erprobtes Gefühl kam ihn an, die sonderbare, halb träumerische, halb beängstigende Empfindung eines zugleich Ziehenden und Stehenden, eines wechselnden Bleibens, das Wiederkehr und schwindelige Einerleiheit war, – eine Empfindung, die ihm von früheren Gelegenheiten her bekannt war, und von der wieder berührt zu werden er erwartet und gewünscht hatte: sie war es zum Teil, um derentwillen ihm die Vorzeigung des stehend wandernden Erbstücks angelegen gewesen war.
Prüfte der junge Mann sich später, so fand er, daß das Bild seines Ältervaters sich ihm viel tiefer, deutlicher und bedeutender eingeprägt hatte als das seiner Eltern: was möglicherweise auf Sympathie und physischer Sonderverwandtschaft beruhte, denn der Enkel sah dem Großvater ähnlich, soweit eben ein rosiger Milchbart einem gebleichten und starren Siebziger ähnlich sehen kann. Hauptsächlich aber war es doch wohl für den Alten bezeichnend, der ohne Frage die eigentliche Charakterfigur, die malerische Persönlichkeit in der Familie gewesen war.
Im öffentlichen Sinne gesprochen, so war die Zeit über Hans Lorenz Castorps Wesen und Willensmeinungen schon lange vor seinem Abscheiden hinweggegangen. Er war ein hochchristlicher Herr gewesen, von der reformierten Gemeinde, streng herkömmlich gesinnt, auf aristokratische Einengung des gesellschaftlichen Kreises, in dem man regierungsfähig war, so hartnäckig bedacht, als lebte er im vierzehnten Jahrhundert, wo das Handwerkertum gegen den zähen Widerstand des altfreien Patriziertums sich Sitz und Stimme im städtischen Rat zu erobern begonnen hatte, und für das Neue zu schwer zu haben. Sein Wirken war in Jahrzehnte eines heftigen Aufschwungs und vielfältiger Umwälzungen gefallen, Jahrzehnte des Fortschritts in Gewaltmärschen, die an den öffentlichen Opfer- und Wagemut beständig so hohe Anforderungen gestellt hatten. An ihm aber, dem alten Castorp, das wußte Gott, hatte es nicht gelegen, wenn der Geist der Neuzeit die weit bekannten, glänzenden Siege gefeiert hatte. Er hatte auf Vätersitte und alte Institutionen weit mehr gehalten als auf halsbrecherische Hafenerweiterungen und gottlose Großstadt-Alfanzereien, hatte gebremst und abgewiegelt, wo er nur konnte, und wäre es nach ihm gegangen, so sah es in der Verwaltung noch heutigentages so idyllisch-altfränkisch aus wie seinerzeit in seinem eigenen Kontor.
So stellte der Alte, zu seinen Lebzeiten und nachher, sich dem bürgerlichen Auge dar, und wenn der kleine Hans Castorp auch nichts von Staatsangelegenheiten verstand, so machte sein still anschauendes Kinderauge im wesentlichen doch ganz dieselben Wahrnehmungen, – wortlose und also unkritische, vielmehr nur lebensvolle Wahrnehmungen, die übrigens auch später, als bewußtes Erinnerungsbild, ihr wort- und zergliederungsfeindliches, schlechthin bejahendes Gepräge durchaus bewahrten. Wie gesagt, war da Sympathie im Spiele, jene ein Glied überspringende Nächstverbundenheit und Wesensverwandtschaft, die nichts Seltenes ist. Kinder und Enkel schauen an, um zu bewundern, und sie bewundern, um zu lernen und auszubilden, was erblicherweise in ihnen vorgebildet liegt.
Senator Castorp war hager und hochgewachsen. Die Jahre hatten ihm Rücken und Nacken gekrümmt, aber er suchte die Krümmung durch Gegendruck auszugleichen, wobei sein Mund, dessen Lippen nicht mehr von Zähnen gehalten wurden, sondern unmittelbar auf dem leeren Zahnfleisch ruhten (denn sein Gebiß legte er nur zum Essen an), sich auf würdig-mühsame Art nach unten zog, und hierdurch eben, wie auch wohl als Mittel gegen eine beginnende Unfestigkeit des Kopfes, kam die ehrenstreng aufgeruckte Haltung und Kinnstütze zustande, die dem kleinen Hans Castorp so zusagte.
Er liebte die Dose – es war eine längliche, mit Gold eingelegte Schildpattdose, die er handhabte, – und benutzte aus diesem Grunde rote Taschentücher, deren Zipfel ihm aus der hinteren Tasche seines Gehrocks zu hängen pflegte. War das eine heitere Schwäche in seiner Erscheinung, so wirkte sie doch durchaus als Alterslizenz, als eine Nachlässigkeit, wie die Betagtheit sie sich entweder bewußt und jovialerweise gestattet oder in ehrwürdiger Unbewußtheit mit sich bringt; und jedenfalls blieb sie die einzige, die Hans Castorps kindlicher Scharfblick je an des Großvaters Äußerem gewahrte. Für den Siebenjährigen aber sowohl wie später in der Erinnerung des Herangewachsenen war die alltägliche Erscheinung des Alten nicht seine eigentliche und wirkliche. In eigentlicher Wirklichkeit sah er noch anders, weit schöner und richtiger aus, als gewöhnlich, – nämlich so, wie er auf einem Gemälde, einem lebensgroßen Bildnis erschien, das früher im elterlichen Wohnzimmer gehangen hatte und dann zusammen mit dem kleinen Hans Castorp an die Esplanade übergesiedelt war, wo es seinen Platz über dem großen rotseidenen Sofa im Empfangszimmer erhalten hatte.
Es zeigte Hans Lorenz Castorp in seiner Amtstracht als Ratsherrn der Stadt – dieser ernsten, ja frommen Bürgertracht eines verschollenen Jahrhunderts, die ein zugleich gravitätisches und verwegenes Gemeinwesen durch die Zeiten mitgeführt und in pomphaftem Gebrauch erhalten hatte, um zeremoniellerweise die Vergangenheit zur Gegenwart, die Gegenwart zur Vergangenheit zu machen und den steten Zusammenhang der Dinge, die ehrwürdige Sicherheit ihrer Handlungsunterschrift zu bekunden. Senator Castorp stand da in ganzer Figur, auf rötlich gepflastertem Boden, in einer Pfeiler- und Spitzbogen-Perspektive. Er stand, das Kinn gesenkt, den Mund nach unten gezogen, die blauen, sinnig blickenden Augen mit den Tränensäcken darunter ins Weite gerichtet, in dem schwarzen und mehr als knielangen, talarartigen Überrock, der, vorne offen, am Rande und Saume eine breite Pelzverbrämung zeigte. Aus weiten, hochgepufften und bordierten Oberärmeln kamen engere Unterärmel von schlichtem Tuch hervor, und Spitzenmanschetten bedeckten die Hände bis zu den Knöcheln. Die schlanken Greisenbeine staken in schwarzseidenen Strümpfen, die Füße in Schuhen mit silbernen Schnallen. Um den Hals aber lag ihm die breite, gestärkte und vielfach gefältete Tellerkrause, vorn niedergedrückt und an den Seiten aufwärts geschwungen, unter welcher hervor zum Überfluß noch ein gefältetes Batistjabot auf die Weste hing. Unter dem Arme trug er den altertümlichen Hut mit breiter Krempe, dessen Kopf sich nach oben verjüngte.
Es war ein vortreffliches Bild, von namhafter Künstlerhand geschaffen, mit gutem Geschmack in dem altmeisterlichen Stile gehalten, den der Gegenstand nahelegte, und in dem Beschauer allerlei spanisch-niederländisch-spätmittelalterliche Vorstellungen weckend. Der kleine Hans Castorp hatte es oft betrachtet, nicht mit Kunstverstand natürlich, aber doch mit einem gewissen allgemeineren und sogar eindringlichen Verstande; und obgleich er den Großvater so, wie die Leinwand ihn darstellte, in Person nur ein einziges Mal, bei einer feierlichen Auffahrt am Rathaus, und auch da nur flüchtig gesehen hatte, konnte er, wie wir sagten, nicht umhin, diese seine bildhafte Erscheinung als seine eigentliche und wirkliche zu empfinden und in dem Großvater des Alltags sozusagen einen Interims-Großvater, einen behelfsweise und nur unvollkommen angepaßten zu erblicken. Denn das Abweichende und Wunderliche in dieser seiner Alltagserscheinung beruhte offenbar auf solcher unvollkommenen, vielleicht etwas ungeschickten Anpassung, es waren nicht ganz zu tilgende Reste und Andeutungen seiner reinen und wahren Gestalt. So waren die Vatermörder, die hohe weiße Binde altmodisch; aber unmöglich war diese Bezeichnung anwendbar auf das bewunderungswürdige Kleidungsstück, wovon jene nur die Interimsandeutung bildeten, nämlich auf die spanische Krause. Und ebenso verhielt es sich mit dem unüblich geschweiften Zylinder, den der Großvater auf der Straße trug, und dem in höherer Wirklichkeit der breitkrempige Filzhut des Gemäldes entsprach; mit dem langen und faltigen Gehrock, als dessen Urbild und Eigentlichkeit dem kleinen Hans Castorp der bordierte, pelzverbrämte Talar erschien.
So war er denn auch im Herzen einverstanden, daß der Großvater in seiner Richtigkeit und Vollkommenheit prangte, als es eines Tages hieß, Abschied von ihm zu nehmen. Das war im Saale, demselben Saal, wo sie so oft am Eßtisch einander gegenüber gesessen; in seiner Mitte lag Hans Lorenz Castorp nun auf der von Kränzen umstellten und umlagerten Bahre im silberbeschlagenen Sarge. Er hatte die Lungenentzündung durchgekämpft, hatte zäh und lange gekämpft, obgleich er doch, wie es schien, im gegenwärtigen Leben nur anpassungsweise zu Hause gewesen war, und lag nun, man wußte nicht recht ob siegreich oder überwunden, auf jeden Fall mit streng befriedetem Ausdruck und stark verändert und spitznäsig vom Kampfe auf seinem Paradebett, den Unterkörper von einer Decke verhüllt, auf welcher ein Palmzweig lag, den Kopf vom seidenen Kissen hochgestützt, so daß das Kinn aufs schönste in der vorderen Einbuchtung der Ehrenkrause ruhte; und zwischen die halb von den Spitzenmanschetten bedeckten Hände, deren Finger bei künstlich-natürlicher Anordnung Kälte und Unbelebtheit nicht verhehlten, hatte man ihm ein Elfenbeinkreuz gesteckt, auf das er mit gesenkten Lidern unverwandt niederzublicken schien.
Hans Castorp hatte den Großvater zu Anfang von dessen letzter Krankheit wohl mehrmals, gegen das Ende hin aber nicht mehr gesehen. Mit dem Anblick des Kampfes, der auch zu seinem Hauptteile nächtlicherweile vor sich gegangen war, hatte man ihn gänzlich verschont, nur mittelbar, durch die beklommene Atmosphäre des Hauses, die roten Augen des alten Fiete, das An- und Wegfahren der Doktoren, war er davon berührt worden; das Ergebnis aber, vor das er sich im Saale gestellt fand, ließ sich dahin zusammenfassen, daß der Großvater der Interimsanpassung nun feierlich überhoben und in seine eigentliche und angemessene Gestalt endgültig eingekehrt war, – ein billigenswertes Ergebnis, wenn auch der alte Fiete weinte und ununterbrochen den Kopf schüttelte, und wenn auch Hans Castorp selber weinte, wie er beim Anblick seiner unvermittelt gestorbenen Mutter und seines bald darauf ebenfalls still und fremd daliegenden Vaters geweint hatte.
Denn es war ja nun schon das drittemal binnen so kurzer Zeit und bei so jungen Jahren, daß der Tod auf den Geist und die Sinne – namentlich auch auf die Sinne – des kleinen Hans Castorp wirkte; neu war ihm der Anblick und Eindruck nicht mehr, sondern bereits recht wohl vertraut, und wie er schon die beiden ersten Male sich durchaus gesetzt und verläßlich, keineswegs nervenschwach, wenn auch mit natürlicher Betrübnis dagegen verhalten hatte, so auch jetzt, und in noch höherem Grade. Unkundig der praktischen Bedeutung der Ereignisse für sein Leben oder auch kindlich gleichgültig dagegen, in dem Vertrauen, daß die Welt schon so oder so für ihn sorgen werde, hatte er an den Särgen eine gewisse ebenfalls kindliche Kühle und sachliche Aufmerksamkeit an den Tag gelegt, welche beim drittenmal durch das Gefühl und den Ausdruck erfahrener Kennerschaft noch eine besondere, altkluge Abschattung erhielt, – häufiger Tränen der Erschütterung und der Ansteckung durch andere als einer selbstverständlichen Rückwirkung nicht weiter zu gedenken. In den drei oder vier Monaten, seit sein Vater gestorben war, hatte er den Tod vergessen; nun erinnerte er sich, und alle Eindrücke von damals stellten sich genau, gleichzeitig und durchdringend in ihrer unvergleichbaren Eigentümlichkeit wieder her.
Aufgelöst und in Worte gefaßt, hätten sie sich ungefähr folgendermaßen ausgenommen. Es hatte mit dem Tode eine fromme, sinnige und traurig schöne, das heißt geistliche Bewandtnis und zugleich eine ganz andere, geradezu gegenteilige, sehr körperliche, sehr materielle, die man weder als schön, noch als sinnig, noch als fromm, noch auch nur als traurig eigentlich ansprechen konnte. Die feierlich-geistliche Bewandtnis drückte sich aus in der pomphaften Aufbahrung der Leiche, der Blumenpracht und den Palmenwedeln, die bekanntlich den himmlischen Frieden bedeuteten; ferner und noch deutlicher in dem Kreuz zwischen den gestorbenen Fingern des ehemaligen Großvaters, dem segnenden Heiland von Thorwaldsen, der zu Häupten des Sarges stand, und in den zu beiden Seiten aufragenden Kandelabern, die bei dieser Gelegenheit ebenfalls einen kirchlichen Charakter angenommen hatten. Alle diese Anstalten hatten ihren genaueren und guten Sinn offenbar in dem Gedanken, daß der Großvater nun auf immer zu seiner eigentlichen und wahren Gestalt eingegangen war. Außerdem aber hatten sie, wie der kleine Hans Castorp wohl bemerkte, wenn auch nicht mit Worten sich eingestand, allesamt, im besonderen aber die Menge der Blumen und unter diesen wieder besonders die vielfach vertretenen Tuberosen, noch einen weiteren Sinn und nüchternen Zweck, nämlich den, die andere, weder schöne noch eigentlich traurige, sondern eher fast unanständige, niedrig körperliche Bewandtnis, die es mit dem Tode hatte, zu beschönigen, in Vergessenheit zu bringen oder nicht zum Bewußtsein kommen zu lassen.
Mit dieser Bewandtnis hing es zusammen, daß der tote Großvater so fremd, ja eigentlich nicht als der Großvater, sondern als eine lebensgroße, wächserne Puppe erschien, die der Tod statt seiner Person eingeschoben hatte, und mit der nun all dieser fromme und ehrenvolle Aufwand getrieben wurde. Der da lag, oder richtiger: was da lag, war also nicht der Großvater selbst, sondern eine Hülle, – die, wie Hans Castorp wußte, nicht aus Wachs bestand, sondern aus ihrem eigenen Stoff; nur aus Stoff: das eben war das Unanständige und kaum auch Traurige, – traurig so wenig, wie Dinge traurig sind, die mit dem Körper zu tun haben und nur mit diesem. Der kleine Hans Castorp betrachtete den wachsgelben, glatten und käsig-festen Stoff, aus dem die lebensgroße Todesfigur bestand, das Gesicht und die Hände des ehemaligen Großvaters. Eben ließ eine Fliege sich auf die unbewegliche Stirne nieder und begann, ihren Rüssel auf und ab zu bewegen. Der alte Fiete verscheuchte sie vorsichtig, indem er sich hütete, die Stirn dabei zu berühren und mit einer ehrbaren Verfinsterung seiner Miene, so, als dürfe und wolle er von dem, was er da tat, nichts wissen, – einem Ausdruck von Sittsamkeit, der sich offenbar auf die Tatsache bezog, daß der Großvater nur noch Körper und nichts weiter mehr war; allein nach schweifendem Auffluge nahm die Fliege auf den Fingern des Großvaters, in der Nähe des Elfenbeinkreuzes, kurz aufsitzend wieder Platz. Während aber dies geschah, glaubte Hans Castorp deutlicher als bisher jene von früher her vertraute leise, aber so ganz eigentümlich zähe Ausdünstung zu verspüren, die ihn beschämenderweise an einen mit einem lästigen Übel behafteten und darum allerseits gemiedenen Schulkameraden erinnerte, und die zu übertäuben der Duft der Tuberosen unter der Hand bestimmt war, ohne es bei aller schönen Üppigkeit und Strenge imstande zu sein.
Er stand wiederholt an der Leiche: einmal allein mit dem alten Fiete, das zweitemal zusammen mit seinem Großonkel Tienappel, dem Weinhändler, und den beiden Onkeln James und Peter, und dann noch ein drittes Mal, als eine Gruppe von sonntäglich gekleideten Hafenarbeitern einige Augenblicke am offenen Sarge stand, um sich von dem ehemaligen Chef des Hauses Castorp und Sohn zu verabschieden. Dann kam das Begräbnis, bei dem der Saal voller Leute war und Pastor Bugenhagen von der Michaeliskirche, derselbe, der Hans Castorp getauft hatte, angetan mit der spanischen Halskrause, die Gedächtnisrede hielt und sich nachher in der Droschke, der ersten gleich hinter dem Leichenwagen, der dann eine lange, lange Reihe folgte, sehr freundlich mit dem kleinen Hans Castorp unterhielt, – und dann war auch dieser Lebensabschnitt zu Ende, und Hans Castorp wechselte gleich darauf Haus und Umgebung, – zum zweitenmal tat er das ja bereits in seinem jungen Leben.
Zu seinem Schaden geschah es nicht, denn er kam zu Konsul Tienappel ins Haus, seinem bestellten Vormund, und hatte da nichts zu vermissen: in Hinsicht auf seine Person gewiß nicht, und ebensowenig, was die Betreuung seiner weiteren Interessen betraf, von denen er noch nichts wußte. Denn Konsul Tienappel, ein Onkel von Hansens seliger Mutter, verwaltete die Castorpsche Hinterlassenschaft, er brachte die Immobilien zum Verkauf, nahm auch die Liquidation der Firma Castorp und Sohn, Import und Export in die Hand, und was er herausschlug, waren noch ungefähr vierhunderttausend Mark, Hans Castorps Erbe, das Konsul Tienappel in mündelsicheren Papieren anlegte, indem er, seiner verwandtschaftlichen Gefühle unbeschadet, an jedem Quartalsbeginn zwei Prozent Provision von den fälligen Zinsen für sich in Abzug brachte.
Das Tienappelsche Haus lag im Hintergrunde eines Gartens am Harvestehuder Weg und blickte auf eine Rasenfläche, in der auch nicht das kleinste Unkraut geduldet wurde, auf öffentliche Rosenanlagen und dann auf den Fluß. Der Konsul ging jeden Morgen, obgleich er schönes Fuhrwerk besaß, zu Fuß in sein Geschäft in der Altstadt, um doch ein bißchen Bewegung zu haben, denn manchmal litt er an Blutstauungen im Kopfe, und kehrte um fünf Uhr abends auch so zurück, worauf bei Tienappels mit aller Kultur zu Mittag gegessen wurde. Er war ein gewichtiger Mann, in beste englische Stoffe gekleidet, mit wasserblau vorquellenden Augen hinter der goldenen Brille, einer blühenden Nase, grauem Schifferbart und einem feurigen Brillanten an dem gedrungenen kleinen Finger seiner Linken. Seine Frau war längst tot. Er hatte zwei Söhne, Peter und James, von denen der eine bei der Marine und wenig zu Hause, der andere im väterlichen Weinhandel tätig und designierter Erbe der Firma war. Den Hausstand führte seit vielen Jahren Schalleen, eine Goldschmiedstochter aus Altona mit weißen Stärkrüschen um ihre walzenförmigen Handgelenke. Sie stand dafür ein, daß der Frühstücks- und Abendtisch reichlich mit kalter Küche, mit Krabben und Lachs, Aal, Gänsebrust und Tomato Catsup zum Roastbeef bestellt war; sie hatte ein wachsames Auge auf die Lohndiener, wenn Herrendiner bei Konsul Tienappel war, und sie war es auch, die bei dem kleinen Hans Castorp, so gut sie konnte, Mutterstelle vertrat.
Hans Castorp wuchs auf bei miserablem Wetter, in Wind und Wasserdunst, wuchs auf im gelben Gummimantel, wenn man so sagen darf, und fühlte sich im ganzen recht munter dabei. Ein bißchen blutarm war er ja wohl von Anfang an, das sagte auch Dr. Heidekind und ließ ihm täglich zum dritten Frühstück, nach der Schule, ein gutes Glas Porter geben, – ein gehaltvolles Getränk, wie man weiß, dem Dr. Heidekind blutbildende Wirkung zuschrieb und das jedenfalls Hans Castorps Lebensgeister auf eine ihm schätzenswerte Weise besänftigte, seiner Neigung, zu „dösen“, wie sein Onkel Tienappel sich ausdrückte, nämlich mit schlaffem Munde und ohne einen festen Gedanken ins Leere zu träumen, wohltuend Vorschub leistete. Sonst aber war er gesund und richtig, ein brauchbarer Tennisspieler und Ruderer, wenn er auch lieber, statt selber die Riemen zu handhaben, an Sommerabenden bei Musik und einem guten Getränk auf der Terrasse des Uhlenhorster Fährhauses saß und die beleuchteten Boote betrachtete, zwischen denen Schwäne auf dem bunt spiegelnden Wasser dahinzogen; und wenn man ihn sprechen hörte: gelassen, verständig, ein bißchen hohl und eintönig, mit einem Anflug von Platt, ja, wenn man ihn auch nur ansah in seiner blonden Korrektheit, mit seinem gut geschnittenen, irgendwie altertümlich geprägten Kopf, in dem ein ererbter und unbewußter Dünkel sich in Gestalt einer gewissen trockenen Schläfrigkeit äußerte, so konnte kein Mensch bezweifeln, daß dieser Hans Castorp ein unverfälschtes und rechtschaffenes Erzeugnis hiesigen Bodens und glänzend an seinem Platze war, – er selbst hätte es, wenn er sich daraufhin auch nur geprüft hätte, nicht einen Augenblick lang bezweifelt.
Die Atmosphäre der großen Meerstadt, diese feuchte Atmosphäre aus Weltkrämertum und Wohlleben, die seiner Väter Lebensluft gewesen war, er atmete sie mit tiefem Einverständnis, mit Selbstverständlichkeit und gutem Behagen. Die Ausdünstungen von Wasser, Kohlen und Teer, die scharfen Gerüche gehäufter Kolonialwaren in der Nase, sah er an den Hafenkais ungeheure Dampfdrehkrane die Ruhe, Intelligenz und Riesenkraft dienender Elefanten nachahmen, indem sie Tonnengewichte von Säcken, Ballen, Kisten, Fässern und Ballons aus den Bäuchen ruhender Seeschiffe in Eisenbahnwagen und Schuppen löschten. Er sah die Kaufmannschaft in gelben Gummimänteln, wie er selbst einen trug, um Mittag zur Börse strömen, woselbst es scharf herging, seines Wissens, und jemand ganz leicht Veranlassung bekommen konnte, in aller Eile Einladungen zu einem großen Diner zu verschicken, um seinen Kredit zu fristen. Er sah (und hier lag ja später sein besonderes Interessengebiet) das Gewimmel der Werften, sah die Mammutleiber gedockter Asien- und Afrikafahrer, turmhoch, Kiel und Propeller entblößt, von baumdicken Streben gestützt, in ihrer monströsen Unbehilflichkeit auf dem Trockenen, bedeckt mit zwerghaften Heeren scheuernder, hämmernder, tünchender Arbeiter; sah auf den überdachten Hellings, von rauchigem Nebel umsponnen, die Spantenskelette entstehender Schiffe ragen und Ingenieure, Konstruktionszeichnung und Lenztafel zur Hand, den Bauleuten ihre Weisungen geben, – vertraute Gesichte dies alles für Hans Castorp von Jugend auf und lauter Empfindungen gemütlich-heimatlicher Zugehörigkeit in ihm erweckend, Empfindungen, die ihren Höhepunkt etwa in jener Lebenslage fanden, wenn er Sonntagvormittags mit James Tienappel oder seinem Vetter Ziemßen – Joachim Ziemßen – im Alsterpavillon warme Rundstücke mit Rauchfleisch nebst einem Glase alten Portweins frühstückte, und sich danach, mit Hingebung an seiner Zigarre ziehend, im Stuhle zurücklehnte. Denn namentlich darin war er echt, daß er gern gut lebte, ja, seines dünnblütig verfeinerten Äußern ungeachtet, innig und fest, wie ein schwelgerischer Säugling an der Mutterbrust, an des Lebens derben Genüssen hing.
Bequem und nicht ohne Würde trug er auf seinen Schultern die hohe Zivilisation, welche die herrschende Oberschicht der handeltreibenden Stadtdemokratie ihren Kindern vererbt. Er war so gut gebadet wie ein Baby und ließ sich von jenem Schneider kleiden, der das Vertrauen der jungen Leute seiner Sphäre besaß. Der kleine, sorgfältig gezeichnete Wäscheschatz, den die englischen Züge seines Schrankes bargen, ward von Schalleen aufs beste betreut; noch als Hans Castorp auswärts studierte, schickte er ihn regelmäßig zur Reinigung und Ausbesserung nach Hause (denn seine Maxime war, daß man außer in Hamburg im Reiche nicht zu bügeln verstehe), und eine aufgerauhte Stelle an der Manschette eines seiner hübschen farbigen Hemden hätte ihn mit heftigem Unbehagen erfüllt. Seine Hände, obgleich nicht sonderlich aristokratisch in der Form, waren gepflegt und frisch von Haut, mit einem Kettenring aus Platin und dem großväterlichen Erbsiegelring geschmückt, und seine Zähne, die etwas weich waren und mehrfach Schaden gelitten hatten, mit Gold ergänzt.
Im Stehen und Gehen schob er den Unterleib etwas vor, was einen nicht eben strammen Eindruck machte; aber seine Haltung bei Tische war ausgezeichnet. Er wandte den aufrechten Oberkörper höflich dem Nachbarn zu, mit dem er plauderte (verständig und etwas platt), und seine Ellenbogen lagen leicht an, während er sein Stück Geflügel zerlegte oder geschickt mit dem dazu bestimmten Tafelgerät das rosige Fleisch aus einer Hummerschere zog. Sein erstes Bedürfnis nach beendeter Mahlzeit war die Fingerschale mit parfümiertem Wasser, das zweite die russische Zigarette, die unverzollt war, und die er unterderhand, auf dem Wege gemütlicher Durchstecherei bezog. Sie ging der Zigarre voran, einer sehr schmackhaften Bremer Marke namens Maria Mancini, von der noch die Rede sein wird, und deren würzige Gifte sich so befriedigend mit denen des Kaffees vereinigten. Hans Castorp entzog seine Tabakvorräte den schädlichen Einflüssen der Dampfheizung, indem er sie im Keller aufbewahrte, wohin er jeden Morgen hinabstieg, um seinem Etui den Tagesbedarf einzuverleiben. Nur widerstrebend hätte er Butter gegessen, die ihm in einem Stück und nicht vielmehr in Form geriefelter Kügelchen vorgesetzt worden wäre.
Man sieht, daß wir darauf denken, alles zu sagen, was für ihn einnehmen kann, aber wir beurteilen ihn ohne Überschwang und machen ihn weder besser noch schlechter, als er war. Hans Castorp war weder ein Genie noch ein Dummkopf, und wenn wir das Wort „mittelmäßig“ zu seiner Kennzeichnung vermeiden, so geschieht es aus Gründen, die nicht mit seiner Intelligenz und kaum etwas mit seiner schlichten Person überhaupt zu tun haben, nämlich aus Achtung vor seinem Schicksal, dem wir eine gewisse überpersönliche Bedeutung zuzuschreiben geneigt sind. Sein Kopf genügte den Anforderungen des Realgymnasiums, ohne sich überanstrengen zu müssen, – aber dies zu tun, wäre er auch ganz bestimmt unter keinen Umständen und um keines Gegenstandes willen geneigt gewesen: weniger aus Furcht, sich weh zu tun, als weil er unbedingt keinen Grund dazu sah oder, richtiger gesagt: keinen unbedingten Grund; und eben darum vielleicht mögen wir ihn nicht mittelmäßig nennen, weil er das Fehlen solcher Gründe auf irgendeine Weise empfand.
Der Mensch lebt nicht nur sein persönliches Leben als Einzelwesen, sondern, bewußt oder unbewußt, auch das seiner Epoche und Zeitgenossenschaft, und sollte er die allgemeinen und unpersönlichen Grundlagen seiner Existenz auch als unbedingt gegeben und selbstverständlich betrachten und von dem Einfall, Kritik daran zu üben, so weit entfernt sein, wie der gute Hans Castorp es wirklich war, so ist doch sehr wohl möglich, daß er sein sittliches Wohlbefinden durch ihre Mängel vage beeinträchtigt fühlt. Dem einzelnen Menschen mögen mancherlei persönliche Ziele, Zwecke, Hoffnungen, Aussichten vor Augen schweben, aus denen er den Impuls zu hoher Anstrengung und Tätigkeit schöpft; wenn das Unpersönliche um ihn her, die Zeit selbst der Hoffnungen und Aussichten bei aller äußeren Regsamkeit im Grunde entbehrt, wenn sie sich ihm als hoffnungslos, aussichtslos und ratlos heimlich zu erkennen gibt und der bewußt oder unbewußt gestellten, aber doch irgendwie gestellten Frage nach einem letzten, mehr als persönlichen, unbedingten Sinn aller Anstrengung und Tätigkeit ein hohles Schweigen entgegensetzt, so wird gerade in Fällen redlicheren Menschentums eine gewisse lähmende Wirkung solches Sachverhalts fast unausbleiblich sein, die sich auf dem Wege über das Seelisch-Sittliche geradezu auf das physische und organische Teil des Individuums erstrecken mag. Zu bedeutender, das Maß des schlechthin Gebotenen überschreitender Leistung aufgelegt zu sein, ohne daß die Zeit auf die Frage Wozu? eine befriedigende Antwort wüßte, dazu gehört entweder eine sittliche Einsamkeit und Unmittelbarkeit, die selten vorkommt und heroischer Natur ist, oder eine sehr robuste Vitalität. Weder das eine noch das andere war Hans Castorps Fall, und so war er denn doch wohl mittelmäßig, wenn auch in einem recht ehrenwerten Sinn.
Wir haben hier nicht nur von des jungen Mannes innerem Verhalten während seiner Schulzeit, sondern auch von den darauffolgenden Jahren gesprochen, als er seinen bürgerlichen Beruf schon gewählt hatte. Was seine Laufbahn durch die Klassen betraf, so mußte er die eine und andere davon sogar repetieren. Im ganzen aber halfen seine Herkunft, die Urbanität seiner Sitten und schließlich auch eine hübsche, wenn auch leidenschaftslose Begabung für Mathematik ihm vorwärts, und als er das Einjährigenzeugnis hatte, beschloß er, die Schule durchzumachen, – hauptsächlich, die Wahrheit zu sagen, weil damit ein gewohnter, vorläufiger und unentschiedener Zustand verlängert und Zeit zu der Überlegung gewonnen wurde, was denn Hans Castorp am liebsten werden wollte, denn das wußte er lange nicht recht, wußte es auch in der obersten Klasse noch nicht, und als es sich dann entschied (daß nämlich er sich entschieden hätte, wäre beinah schon zu viel gesagt), fühlte er wohl, daß es sich ebensogut anders hätte entscheiden können.
Aber so viel war ja richtig, daß er an Schiffen immer großes Vergnügen gehabt hatte. Als kleiner Junge hatte er die Blätter seiner Notizbücher mit Bleistiftzeichnungen von Fischerkuttern, Gemüseevern und Fünfmastern gefüllt, und als er mit fünfzehn Jahren von einem bevorzugten Platze aus hatte zusehen dürfen, wie der neue Doppelschrauben-Postdampfer „Hansa“ bei Blohm & Voß vom Stapel lief, da hatte er in Wasserfarben ein wohlgetroffenes und bis weit ins Einzelne genaues Bildnis des schlanken Schiffes ausgeführt, das Konsul Tienappel in sein Privatkontor gehängt hatte, und auf dem namentlich das transparente Glasgrün der rollenden See so liebevoll und geschickt behandelt war, daß irgend jemand zu Konsul Tienappel gesagt hatte, das sei Talent, und daraus könne ein guter Marinemaler werden, – eine Äußerung, die der Konsul seinem Pflegesohn ruhig wiedererzählen konnte, denn Hans Castorp lachte bloß gutmütig darüber und ließ sich auf Überspanntheiten und Hungerleiderideen auch nicht einen Augenblick ein.
„Viel hast du nicht“, sagte sein Onkel Tienappel manchmal zu ihm. „Mein Geld bekommen im wesentlichen mal James und Peter, das heißt, es bleibt im Geschäft, und Peter bezieht seine Rente. Was dir gehört, liegt ja ganz gut und trägt dir was Sicheres. Aber von Zinsen zu leben, dabei ist heutzutage kein Spaß mehr, wenn man nicht wenigstens fünfmal so viel hat, wie du, und wenn du was vorstellen willst hier in der Stadt und leben wie du’s gewohnt bist, dann mußt du ordentlich zuverdienen, das merk’ du lieber, min Söhn.“
Hans Castorp merkte es sich und sah sich nach einem Berufe um, mit dem er vor sich selbst und den Leuten bestehen könnte. Und als er einmal gewählt hatte – es geschah auf Anregung des alten Wilms, in Firma Tunder & Wilms, der nämlich am sonnabendlichen Whisttisch zu Konsul Tienappel sagte, Hans Castorp solle doch Schiffbau studieren, das sei eine Idee, und bei ihm eintreten, dann wolle er wohl auf den Jungen ein Auge haben –, da dachte er sehr hoch von seinem Beruf und fand, daß es zwar ein verdammt komplizierter und anstrengender, dafür aber auch ein ausgezeichneter, wichtiger und großartiger Beruf sei und für seine friedliche Person jedenfalls bei weitem dem seines Vetters Ziemßen vorzuziehen, Stiefschwestersohns seiner seligen Mutter, der durchaus Offizier werden wollte. Dabei war Joachim Ziemßen nicht mal ganz fest auf der Brust, aber eben darum mochte ein Freiluft-Beruf, bei dem von geistiger Arbeit und Anspannung kaum ernstlich die Rede sein konnte, denn wohl das richtige für ihn sein, wie Hans Castorp mit leichter Geringschätzung urteilte. Denn vor der Arbeit hatte er den allergrößten Respekt, obwohl ihn persönlich die Arbeit ja leicht ermüdete.
Wir kommen hier auf unsere Andeutungen von früher zurück, die nämlich auf die Vermutung zielten, daß Beeinträchtigungen des persönlichen Lebens durch die Zeit geradezu den physischen Organismus des Menschen zu beeinflussen vermöchten. Wie hätte Hans Castorp die Arbeit nicht achten sollen? Es wäre unnatürlich gewesen. Wie alles lag, mußte sie ihm als das unbedingt Achtungswertste gelten, es gab im Grunde nichts Achtenswertes außer ihr, sie war das Prinzip, vor dem man bestand oder nicht bestand, das Absolutum der Zeit, sie beantwortete sozusagen sich selbst. Seine Achtung vor ihr war also religiöser und, so viel er wußte, unzweifelhafter Natur. Aber eine andere Frage war, ob er sie liebte; denn das konnte er nicht, so sehr er sie achtete, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie ihm nicht bekam. Angestrengte Arbeit zerrte an seinen Nerven, sie erschöpfte ihn bald, und ganz offen gab er zu, daß er eigentlich viel mehr die freie Zeit liebe, die unbeschwerte, an der nicht die Bleigewichte der Mühsal hingen, die Zeit, die offen vor einem gelegen hätte, nicht abgeteilt von zähneknirschend zu überwindenden Hindernissen. Dieser Widerstreit in seinem Verhältnis zur Arbeit bedürfte genau genommen der Auflösung. War es möglicherweise so, daß sein Körper sowohl wie sein Geist – zuerst der Geist und durch ihn auch der Körper – zur Arbeit freudiger und nachhaltiger willig gewesen wäre, wenn er im Grunde seiner Seele, dort, wo er selbst nicht Bescheid wußte, an die Arbeit als unbedingten Wert und sich selbst beantwortendes Prinzip zu glauben und sich dabei zu beruhigen vermocht hätte? Es wird damit wieder die Frage seiner Mittelmäßigkeit oder Mehr-als-Mittelmäßigkeit aufgeworfen, die wir nicht bündig beantworten wollen. Denn wir betrachten uns nicht als Hans Castorps Lobredner und lassen der Vermutung Raum, daß die Arbeit in seinem Leben einfach dem ungetrübten Genuß von Maria Mancini etwas im Wege war. –
Zum militärischen Dienst wurde er seinerseits nicht herangezogen. Seine innere Natur widerstrebte dem und wußte es zu verhindern. Auch mochte wohl sein, daß Stabsarzt Dr. Eberding, der am Harvestehuder Weg verkehrte, von Konsul Tienappel gesprächsweise gehört hatte, daß der junge Castorp in der Nötigung sich zu bewaffnen eine empfindliche Störung seiner soeben auswärts begonnenen Studien erblicken würde.
Sein Kopf, der langsam und gelassen arbeitete, zumal Hans Castorp die beruhigende Gewohnheit des Porterfrühstücks auch auswärts beibehielt, füllte sich mit analytischer Geometrie, Differentialrechnung, Mechanik, Projektionslehre und Graphostatik, er berechnete geladenes und ungeladenes Deplacement, Stabilität, Trimmverlagerung und Metazentrum, wenn es ihm zuweilen auch sauer wurde. Seine technischen Zeichnungen, diese Spanten-, Wasserlinien- und Längsrisse, waren nicht ganz so gut, wie seine malerische Darstellung der „Hansa“ auf hoher See, aber wo es galt, die geistige Anschaulichkeit durch die sinnliche zu unterstützen, Schatten zu tuschen und Querschnitte in munteren Materialfarben anzulegen, tat Hans Castorp es an Geschicklichkeit den meisten zuvor.
Wenn er in den Ferien nach Hause kam, sehr sauber, sehr gut angezogen, mit einem kleinen rotblonden Schnurrbart in seinem schläfrigen jungen Patriziergesicht und offenbar auf dem Wege zu ansehnlichen Lebensstellungen, so sahen die Leute, die sich mit kommunalen Dingen befaßten, auch mit Familien- und Personalverhältnissen gut Bescheid wußten – und das tun die meisten in einem sich selbst regierenden Stadtstaat –, so sahen seine Mitbürger ihn prüfend an, indem sie sich fragten, in welche öffentliche Rolle der junge Castorp wohl einmal hineinwachsen werde. Er hatte ja Überlieferungen, sein Name war alt und gut, und eines Tages, das konnte beinahe nicht fehlen, würde man mit seiner Person als mit einem politischen Faktor zu rechnen haben. Er würde dann in der Bürgerschaft oder dem Bürgerausschuß sitzen und Gesetze machen, würde im Ehrenamt an den Sorgen der Souveränität teilnehmen, einer Verwaltungsabteilung, der Finanzdeputation vielleicht oder der für das Bauwesen angehören, und seine Stimme würde gehört und mitgezählt werden. Man konnte neugierig sein, wie er wohl einmal Partei bekennen würde, der junge Castorp. Äußerlichkeiten mochten täuschen, aber eigentlich sah er ganz so aus, wie man nicht aussah, wenn die Demokraten auf einen rechnen konnten, und die Ähnlichkeit mit dem Großvater war unverkennbar. Vielleicht würde er ihm nacharten, ein Hemmschuh werden, ein konservatives Element? Das war wohl möglich – und ebensowohl auch das Gegenteil. Denn schließlich war er ja Ingenieur, ein angehender Schiffbaumeister, ein Mann des Weltverkehrs und der Technik. Da konnte es sein, daß Hans Castorp unter die Radikalen ging, ein Draufgänger wurde, ein profaner Zerstörer alter Gebäude und landschaftlicher Schönheiten, ungebunden wie ein Jude und pietätlos wie ein Amerikaner, geneigt, den rücksichtslosen Bruch mit würdig Überliefertem einer bedächtigen Ausbildung natürlicher Lebensbedingungen vorzuziehen und den Staat in wagehalsige Experimente zu stürzen, – das war auch denkbar. Würde er es im Blute haben, daß Ihre Wohlweisheiten, vor denen der Doppelposten am Rathaus präsentierte, alles am besten wüßten, oder würde er die Opposition in der Bürgerschaft zu unterstützen gestimmt sein? In seinen blauen Augen unter den rötlich blonden Brauen war keine Antwort auf solche Fragen mitbürgerlicher Neugier zu lesen, und er wußte auch wohl noch gar keine, Hans Castorp, dies unbeschriebene Blatt.
Als er die Reise antrat, auf der wir ihn betrafen, stand er im dreiundzwanzigsten Lebensjahr. Damals hatte er vier Semester Studienzeit am Danziger Polytechnikum hinter sich und vier weitere, die er auf den Technischen Hochschulen von Braunschweig und Karlsruhe verbracht hatte, war kürzlich ohne Glanz und Orchestertusch, aber mit gutem Anstande aus der ersten Hauptprüfung gestiegen und schickte sich an, bei Tunder & Wilms als Ingenieur-Volontär einzutreten, um auf der Werft seine praktische Ausbildung zu empfangen. An diesem Punkt nahm sein Weg nun erst einmal folgende Wendung.
Zur Hauptprüfung hatte er scharf und anhaltend arbeiten müssen und sah, als er heimkam, denn doch noch matter aus, als es zu seinem Typus paßte. Dr. Heidekind schalt, so oft er ihn sah, und forderte Luftveränderung, das heißt: eine gründliche. Mit Norderney oder Wyk auf Föhr, sagte er, sei es dieses Mal nicht getan, und wenn man ihn frage, so gehörte Hans Castorp, bevor er auf die Werft gehe, für ein paar Wochen ins Hochgebirge.
Das sei ganz gut, sagte Konsul Tienappel zu seinem Neffen und Pflegesohn, aber dann trennten sich diesen Sommer ihre Wege, denn ihn, Konsul Tienappel, bekämen ins Hochgebirge keine vier Pferde. Das sei nichts für ihn, er brauche einen vernünftigen Luftdruck, sonst kriege er Zufälle. Ins Hochgebirge solle Hans Castorp nur freundlichst alleine reisen. Er solle doch Joachim Ziemßen besuchen.
Das war ein natürlicher Vorschlag. Joachim Ziemßen nämlich war krank, – nicht krank wie Hans Castorp, sondern auf wirklich mißliche Weise krank, es war sogar ein großer Schrecken gewesen. Schon immer hatte er zu Katarrh und Fieber geneigt, und eines Tages war richtig auch roter Auswurf dagewesen, und Hals über Kopf hatte Joachim nach Davos gehen müssen, zu seinem größten Leidwesen und Kummer, denn eben stand er am Ziel seiner Wünsche. Ein paar Semester lang hatte er nach dem Willen der Seinen Jurisprudenz studiert, aber aus unwiderstehlichem Drange hatte er umgesattelt und sich als Fahnenjunker gemeldet und war auch schon angenommen. Und nun saß er seit über fünf Monaten im Internationalen Sanatorium „Berghof“ (dirigierender Arzt: Hofrat Dr. Behrens) und langweilte sich halb zu Tode, wie er auf Postkarten schrieb. Wenn also Hans Castorp denn schon eine Kleinigkeit für sich tun wollte, bevor er bei Tunder & Wilms seinen Posten antrat, so lag nichts näher, als daß er auch dort hinauf fuhr, um seinem armen Cousin Gesellschaft zu leisten, – für beide Teile war es das angenehmste.
Es war hoher Sommer geworden, als er sich zu der Reise entschloß. Die letzten Juli-Tage waren schon da.
Er fuhr auf drei Wochen.
Hans Castorp hatte gefürchtet, die Zeit zu verschlafen, da er so überaus müde gewesen war, aber er war früher als nötig auf den Beinen und hatte Muße im Überfluß, seinen Morgengewohnheiten ausführlich nachzukommen, hochzivilisierten Gewohnheiten, unter denen eine Gummiwanne sowie eine Holzschale mit grüner Lavendelseife nebst zugehörigem Strohpinsel eine Hauptrolle spielten, – und mit den Geschäften der Säuberung und der Körperpflege das andere des Auspackens und Einräumens zu verbinden. Während er den versilberten Hobel über seine mit parfümiertem Schaum bedeckten Wangen führte, erinnerte er sich seiner verworrenen Träume und schüttelte nachsichtig lächelnd, mit dem Überlegenheitsgefühl des im Tageslicht der Vernunft sich rasierenden Menschen den Kopf über so viel Unsinn. Sehr ausgeruht fühlte er sich eben nicht, aber frisch mit dem jungen Tage.
Indes er sich die Hände trocknete, trat er mit gepuderten Backen, in seiner file d’écosse-Unterhose und roten Saffian-Pantoffeln auf den Balkon hinaus, der durchlief und nur vermittelst undurchsichtiger, nicht ganz bis zum Geländer vortretender Glaswände in einzelne Zimmerbereiche geteilt war. Der Morgen war kühl und wolkig. Gestreckte Nebelbänke lagen unbeweglich vor den seitlichen Höhen, während massiges Gewölk, weißes und graues, auf das fernere Gebirge niederhing. Flecken und Streifen von Himmelsblau waren hie und da sichtbar, und wenn ein Sonnenblick einfiel, schimmerte die Ortschaft im Talgrunde weiß gegen die dunklen Fichtenwälder der Hänge. Irgendwo gab es Morgenmusik, wahrscheinlich in demselben Hotel, wo man auch gestern abend Konzert gehabt hatte. Choral-Akkorde klangen gedämpft herüber, nach einer Pause folgte ein Marsch, und Hans Castorp, der Musik von Herzen liebte, da sie ganz ähnlich auf ihn wirkte, wie sein Frühstücksporter, nämlich tief beruhigend, betäubend, zum Dösen überredend, lauschte wohlgefällig, den Kopf auf die Seite geneigt, mit offenem Munde und etwas geröteten Augen.
Drunten schlang sich die Wegschleife zum Sanatorium herauf, die er gestern abend gekommen war. Kurzstieliger, sternförmiger Enzian stand im feuchten Grase des Abhangs. Ein Teil der Plattform war als Garten eingezäunt; dort gab es Kieswege, Blumenrabatten und eine künstliche Felsengrotte zu Füßen einer stattlichen Edeltanne. Eine mit Blech gedeckte Halle, in der Liegestühle standen, öffnete sich gegen Süden, und daneben war eine rotbraun gestrichene Flaggenstange aufgerichtet, an deren Schnur zuweilen das Fahnentuch sich entfaltete, – eine Phantasiefahne, grün und weiß, mit dem Emblem der Heilkunde, einem Schlangenstab, in der Mitte.
Eine Frau ging im Garten umher, eine ältere Dame von düsterem, ja tragischem Aussehen. Vollständig schwarz gekleidet und um das wirre schwarzgraue Haar einen schwarzen Schleier gewunden, wanderte sie ruhelos und gleichmäßig rasch, mit krummen Knien und steif nach vorn hängenden Armen auf den Pfaden dahin und blickte, Querfalten in der Stirn, mit kohlschwarzen Augen, unter denen schlaffe Hautsäcke hingen, starr von unten geradeaus. Ihr alterndes, südlich blasses Gesicht mit dem großen, verhärmten, einseitig abwärts gezogenen Mund erinnerte Hans Castorp an das Bild einer berühmten Tragödin, das ihm einmal zu Gesichte gekommen, und unheimlich war es zu sehen, wie die schwarzbleiche Frau, offenbar ohne es zu wissen, ihre langen, gramvollen Tritte dem Takt der herüberklingenden Marschmusik anpaßte.
Nachdenklich teilnehmend blickte Hans Castorp auf sie hinab, und ihm war, als verdunkele ihre traurige Erscheinung die Morgensonne. Gleichzeitig aber faßte er noch etwas anderes auf, etwas Hörbares, Geräusche, die aus dem Nachbarzimmer zur Linken, dem Zimmer des russischen Ehepaars, nach Joachims Angabe, kamen und gleichfalls nicht zu dem heiteren, frischen Morgen passen wollten, sondern ihn irgendwie klebrig zu verunreinigen schienen. Hans Castorp erinnerte sich, daß er schon gestern abend dergleichen vernommen, doch hatte seine Müdigkeit ihn gehindert, darauf zu achten. Es war ein Ringen, Kichern und Keuchen, dessen anstößiges Wesen dem jungen Mann nicht lange verborgen bleiben konnte, obgleich er sich anfangs aus Gutmütigkeit bemühte, es harmlos zu deuten. Man hätte dieser Gutmütigkeit auch andere Namen geben können, zum Beispiel den etwas faden der Seelenreinheit, oder den ernsten und schönen der Schamhaftigkeit, oder die herabsetzenden Namen der Wahrheitsunlust und der Duckmäuserei, oder selbst den einer mystischen Scheu und Frömmigkeit, – von alledem war etwas in Hans Castorps Verhalten zu den Geräuschen nebenan, und physiognomisch drückte es sich aus in einer ehrbaren Verfinsterung seiner Miene, so, als dürfe und wolle er von dem, was er da hörte, nichts wissen: einem Ausdruck von Sittsamkeit, der nicht ganz originell war, den er aber bei bestimmten Gelegenheiten anzunehmen pflegte.
Mit dieser Miene also zog er sich von dem Balkon ins Zimmer zurück, um nicht länger Vorgänge zu belauschen, die ihm ernst, ja erschütternd schienen, obgleich sie sich unter Gekicher kundtaten. Aber im Zimmer war das Treiben jenseits der Wand nur noch deutlicher zu hören. Es war eine Jagd um die Möbel herum, wie es schien, ein Stuhl polterte hin, man ergriff einander, es gab ein Klatschen und Küssen, und hierzu kam, daß es nun Walzerklänge waren, die verbraucht melodiösen Phrasen eines Gassenhauers, die von außen und fernher die unsichtbare Szene begleiteten. Hans Castorp stand, das Handtuch in Händen, und horchte wider besseren Willen. Und plötzlich errötete er unter seinem Puder, denn was er deutlich hatte kommen sehen, war gekommen und das Spiel nun ohne allen Zweifel ins Tierische übergegangen. Herrgott, Donnerwetter! dachte er, indem er sich abwandte, um mit absichtlich geräuschvollen Bewegungen seine Toilette zu beenden. Nun, es sind Eheleute, in Gottes Namen, soweit ist die Sache in Ordnung. Aber am hellen Morgen, das ist doch stark. Und mir ist ganz, als hätten sie schon gestern abend keinen Frieden gehalten. Schließlich sind sie doch krank, da sie hier sind, oder wenigstens einer von ihnen, da wäre etwas Schonung am Platze. Aber das eigentlich Skandalöse ist selbstverständlich, dachte er zornig, daß die Wände so dünn sind und man alles so deutlich hört, das ist doch ein unhaltbarer Zustand! Billig gebaut natürlich, schändlich billig gebaut! Ob ich die Leute nachher zu sehen bekomme oder ihnen gar vorgestellt werde? Das wäre im höchsten Grade peinlich. Und hier wunderte sich Hans Castorp, denn er bemerkte, daß die Röte, die ihm vorhin in die frisch rasierten Wangen gestiegen war, nicht daraus weichen wollte, oder doch nicht das Wärmegefühl, wovon sie begleitet gewesen, sondern fix darin stand und nichts anderes als jene trockene Gesichtshitze war, an der er gestern abend gelitten, deren er im Schlafe ledig geworden, und die bei dieser Gelegenheit sich wieder eingestellt hatte. Das stimmte ihn nicht freundlicher gegen die benachbarten Eheleute, vielmehr murmelte er mit vorgeschobenen Lippen ein sehr absprechendes Wort gegen sie und beging dann den Fehler, sein Gesicht nochmals mit Wasser zu kühlen, was das Übel bedeutend verschlimmerte. So geschah es, daß seine Stimme mißmutig schwankte, als er seinem Vetter antwortete, der ihm zurufend an die Wand geklopft hatte, und daß er bei Joachims Eintritt nicht eben den Eindruck eines erfrischten und morgenfrohen Menschen machte.
„Tag“, sagte Joachim. „Das war ja nun deine erste Nacht hier oben. Bist du zufrieden?“
Er war fertig zum Ausgehen, sportlich gekleidet, in kräftig gearbeiteten Stiefeln, und trug über dem Arm seinen Ulster, in dessen Seitentasche sich die flache Flasche abzeichnete. Einen Hut hatte er auch heute nicht.
„Danke,“ erwiderte Hans Castorp, „es geht. Ich will weiter nicht urteilen. Etwas konfus geträumt habe ich, und dann hat das Haus ja den Nachteil, daß es sehr hellhörig ist, das ist etwas lästig. Wer ist denn die Schwarze da draußen im Garten?“
Joachim wußte sogleich, wer gemeint war.
„Ach, das ist ‚Tous-les-deux‘“, sagte er. „So wird sie allgemein genannt hier von uns, denn das ist das einzige, was man von ihr zu hören bekommt. Mexikanerin, weißt du, kann kein Wort deutsch und auch französisch fast gar nicht, nur ein paar Brocken. Sie ist seit fünf Wochen hier bei ihrem ältesten Sohn, einem vollständig hoffnungslosen Fall, der jetzt ziemlich rasch eingehen wird, – er hat es schon überall, durch und durch vergiftet ist er, kann man wohl sagen, das sieht dann zuletzt ungefähr wie Typhus aus, sagt Behrens, – scheußlich für alle Beteiligten jedenfalls. Vor vierzehn Tagen kam nun der zweite Sohn herauf, weil er den Bruder noch sehen wollte –, bildhübscher Kerl übrigens, wie auch der andere, – beide sind bildhübsche Kerle, so glutäugig, die Damen waren ganz aus dem Häuschen. Na, der jüngere hatte unten ja wohl schon ein bißchen gehustet, war aber sonst ganz munter gewesen. Und kaum ist er hier, was meinst du, kriegt er Temperatur, – aber gleich 39,5, höchstes Fieber, verstehst du, legt sich ins Bett, und wenn er noch aufkommt, sagt Behrens, dann hat er mehr Glück als Verstand. Jedenfalls sei es die höchste Zeit gewesen, sagt er, daß er heraufkam ... Ja, und seitdem geht die Mutter nun so herum, wenn sie nicht bei ihnen sitzt, und wenn man sie anspricht, sagt sie immer nur ‚Tous les deux!‘ denn mehr kann sie nicht sagen, und hier ist im Augenblick niemand, der spanisch versteht.“
„So ist es also mit der“, sagte Hans Castorp. „Ob sie es wohl auch zu mir sagen wird, wenn ich sie kennenlerne? Das wäre doch sonderbar, – ich meine, es wäre komisch und unheimlich zu gleicher Zeit“, sagte er, und seine Augen waren wie gestern: sie schienen ihm heiß und schwer, als habe er lange geweint, und jenen Glanz hatten sie wieder, den der neuartige Husten des Herrenreiters darin entzündet. Überhaupt kam es ihm vor, als habe er jetzt erst den Anschluß ans Gestrige gefunden, als sei er gleichsam wieder im Bilde, was nach seinem Erwachen zunächst so recht nicht der Fall gewesen war. Er sei übrigens fertig, erklärte er, indem er etwas Lavendelwasser auf sein Taschentuch träufelte und sich die Stirn und die Gegend unter den Augen damit betupfte. „Wenn es dir recht ist, können wir tous les deux zum Frühstück gehen“, scherzte er mit einem Gefühl von ausschweifendem Übermut, worauf Joachim ihn sanft anblickte und eigentümlich dazu lächelte, melancholisch und etwas spöttisch, wie es schien, – warum, das war seine Sache.
Nachdem Hans Castorp sich überzeugt, daß er zu rauchen bei sich habe, nahm er Stock, Mantel und Hut, auch diesen, trotzigerweise, denn er war seiner Lebensform und Gesittung allzu gewiß, um sich so leicht und auf bloße drei Wochen fremden und neuen Gebräuchen zu fügen –, und so gingen sie denn, gingen die Treppen hinab, und auf den Korridoren wies Joachim auf diese und jene Tür und nannte die Namen der Inwohner, deutsche Namen und solche von allerlei fremdem Klang, indem er kurze Anmerkungen über ihren Charakter und die Schwere ihres Falles hinzufügte.
Sie begegneten auch Personen, die schon vom Frühstück zurückkehrten, und wenn Joachim jemandem Guten Morgen sagte, lüftete Hans Castorp höflich den Hut. Er war gespannt und nervös wie ein junger Mensch, der im Begriffe ist, sich vielen fremden Leuten zu präsentieren und der dabei von dem deutlichen Gefühl geplagt ist, trübe Augen und ein rotes Gesicht zu haben, was übrigens nur teilweise zutraf, denn er war vielmehr blaß.
„Ehe ich es vergesse!“ sagte er plötzlich mit einem gewissen blinden Eifer. „Du kannst mich gern der Dame im Garten vorstellen, wenn es sich gerade so macht, dagegen habe ich nichts. Sie soll nur immerhin ‚tous les deux‘ zu mir sagen, das macht mir gar nichts, ich bin ja vorbereitet und verstehe den Sinn und werde schon das richtige Gesicht dazu machen. Aber mit dem russischen Ehepaar wünsche ich nicht bekanntzuwerden, hörst du? Das will ich ausdrücklich nicht. Es sind überaus unmanierliche Leute, und wenn ich schon drei Wochen lang neben ihnen wohnen soll und es nicht anders einzurichten war, so will ich sie doch nicht kennen, das ist mein gutes Recht, daß ich mir das mit aller Bestimmtheit verbitte ...“
„Schön“, sagte Joachim. „Haben sie dich denn so gestört? Ja, es sind gewissermaßen Barbaren, unzivilisiert mit einem Wort, ich hab es dir ja im voraus gesagt. Er kommt immer in einer Lederjoppe zum Essen, – abgeschabt sage ich dir, mich wundert immer, daß Behrens nicht dagegen einschreitet. Und sie ist auch nicht die Propperste, trotz ihrem Federhut ... Übrigens kannst du ganz unbesorgt sein, sie sitzen weit von uns fort, am Schlechten Russentisch, denn es gibt einen Guten Russentisch, wo nur feinere Russen sitzen –, und es ist kaum eine Möglichkeit, daß du mit ihnen zusammentriffst, selbst wenn du wolltest. Es ist überhaupt nicht leicht, Bekanntschaften zu machen, schon weil so viele Ausländer unter den Gästen sind, und ich selbst kenne persönlich nur wenige, so lange ich hier bin.“
„Wer ist denn krank von den beiden?“ fragte Hans Castorp. „Er oder sie?“
„Er, glaube ich. Ja, nur er“, sagte Joachim merklich zerstreut, während sie an den Garderobeständern vorm Speisesaal ablegten. Und dann traten sie ein in den hellen, flachgewölbten Raum, wo Stimmen schwirrten, Gerät klapperte und die Saaltöchter mit dampfenden Kannen umhereilten.
Sieben Tische standen im Speisesaal, die meisten in Längsrichtung, nur zwei in die Quere. Es waren größere Tafeln, für zehn Personen jede, wenn auch die Gedecke nicht überall vollzählig waren. Nur ein paar Schritte schräg in den Saal hinein, und Hans Castorp war schon an seinem Platz: er war ihm an der Schmalseite des Tisches bereitet, der mitten vorn stand, zwischen den beiden querstehenden. Aufrecht hinter seinem Stuhle, verbeugte Hans Castorp sich steif und freundlich gegen die Tischgenossen, mit denen Joachim ihn zeremoniell bekannt machte, und die er kaum sah, geschweige, daß ihm ihre Namen ins Bewußtsein gedrungen wären. Einzig Frau Stöhrs Person und Namen faßte er auf, und daß sie ein rotes Gesicht und fettige aschblonde Haare hatte. Man konnte ihr die Bildungsschnitzer wohl zutrauen, so störrisch unwissend war ihr Gesichtsausdruck. Dann setzte er sich und nahm beifällig wahr, daß man das erste Frühstück hier als eine ernste Mahlzeit behandelte.
Es gab da Töpfe mit Marmeladen und Honig, Schüsseln mit Milchreis und Haferbrei, Platten mit Rührei und kaltem Fleisch; Butter war freigebig aufgestellt, jemand lüftete die Glasglocke über einem tränenden Schweizer Käse, um davon abzuschneiden, und eine Schale mit frischem und trockenem Obst stand obendrein in der Mitte des Tisches. Eine Saaltochter in Schwarz und Weiß fragte Hans Castorp, was er zu trinken wünsche: Kakao, Kaffee oder Tee. Sie war klein wie ein Kind, mit einem alten, langen Gesicht, – eine Zwergin, wie er mit Schrecken erkannte. Er sah seinen Vetter an, aber da dieser nur gleichmütig mit Schultern und Brauen zuckte, als wollte er sagen: „Ja, nun, was weiter?“ so fügte er sich in die Tatsachen, bat mit besonderer Höflichkeit um Tee, da es eine Zwergin war, die ihn fragte, und begann Milchreis mit Zimt und Zucker zu essen, während seine Augen über die anderen Speisen hingingen, von denen zu kosten ihn verlangte, und über die Gästeschaft an den sieben Tischen, Joachims Kollegen und Schicksalsgenossen, die alle innerlich krank waren und schwatzend frühstückten.
Der Saal war in jenem neuzeitlichen Geschmack gehalten, welcher der sachlichsten Einfachheit einen gewissen phantastischen Einschlag zu geben weiß. Er war nicht sehr tief im Verhältnis zu seiner Länge und von einer Art Wandelgang umlaufen, in dem Anrichten standen und der sich in großen Bögen gegen den Innenraum mit den Tischen öffnete. Die Pfeiler, bis zu halber Höhe mit Holz in Sandelpolitur bekleidet, dann glatt geweißt, wie der obere Teil der Wände und die Decke, wiesen buntfarbige Bandstreifen auf, einfältige und lustige Schablonen, die sich an den weitgespannten Gurten des flachen Gewölbes fortsetzten. Mehrere Kronenleuchter, elektrisch, aus blankem Messing, schmückten den Saal, bestehend aus je drei übereinander gelagerten Reifen, welche mit zierlichem Flechtwerk verbunden waren und an deren unterstem wie kleine Monde Milchglasglocken im Kreise gingen. Es waren vier Glastüren da, – an der entgegengesetzten Breitseite zwei, die hinaus auf eine vorgelagerte Veranda gingen, eine dritte vorn links, die geradeswegs in die vordere Halle führte, und dann jene, durch die Hans Castorp von einem Flur aus eingetreten war, da Joachim ihn eine andere Treppe hinabgeführt hatte, als gestern abend.
Er hatte zur Rechten ein unansehnliches Wesen in Schwarz mit flaumigem Teint und matt erhitzten Backen, in der er etwas wie eine Nähterin oder Hausschneiderin sah, wohl auch weil sie ausschließlich Kaffee mit Buttersemmeln frühstückte und weil er die Vorstellung einer Hausschneiderin von jeher mit derjenigen von Kaffee und Buttersemmeln verbunden hatte. Zur Linken saß ihm ein englisches Fräulein, schon angejahrt gleichfalls, sehr häßlich, mit dürren, verfrorenen Fingern, die rundlich geschriebene Briefe aus der Heimat las und einen blutfarbenen Tee dazu trank. Neben ihr folgte Joachim und dann Frau Stöhr in einer schottischen Wollbluse. Die linke Hand hielt sie geballt in der Nähe ihrer Wange, während sie speiste, und bemühte sich sichtlich, beim Sprechen eine feingebildete Miene zu machen, indem sie die Oberlippe von ihren schmalen und langen Hasenzähnen zurückzog. Ein junger Mann mit dünnem Schnurrbart und einem Gesichtsausdruck, als habe er etwas Schlechtschmeckendes im Munde, setzte sich neben sie und frühstückte vollständig schweigend. Er kam herein, als Hans Castorp schon saß, senkte im Gehen und ohne jemanden anzublicken einmal zum Gruße das Kinn auf die Brust und nahm Platz, indem er es durch sein Verhalten rundweg ablehnte, sich mit dem neuen Gaste bekannt machen zu lassen. Vielleicht war er zu krank, um für solche Äußerlichkeiten noch Sinn und Achtung zu haben oder überhaupt an seiner Umgebung Interesse zu nehmen. Einen Augenblick saß ihm gegenüber ein außerordentlich mageres, hellblondes junges Mädchen, das eine Flasche Yoghurt auf seinen Teller entleerte, die Milchspeise auflöffelte und sich unverzüglich wieder entfernte.
Die Unterhaltung am Tisch war nicht lebhaft. Joachim plauderte formell mit Frau Stöhr, er erkundigte sich nach ihrem Befinden und vernahm mit korrektem Bedauern, daß es zu wünschen übrig lasse. Sie klagte über „Schlaffheit“. „Ich bin so schlaff!“ sagte sie gedehnt und zierte sich auf ungebildete Weise. Auch habe sie beim Aufstehen schon 37,3 gehabt, und wie werde es da erst nachmittags sein. Die Hausschneiderin bekannte sich zu derselben Körpertemperatur, erklärte aber, daß sie sich im Gegenteil aufgeregt fühle, innerlich gespannt und rastlos, so, als stände ihr etwas Besonderes und Entscheidendes bevor, was doch gar nicht der Fall sei, sondern es sei eine körperliche Erregung ohne seelische Ursachen. Sie war doch wohl keine Hausschneiderin, denn sie sprach sehr richtig und fast gelehrt. Übrigens fand Hans Castorp diese Aufgeregtheit oder doch die Äußerung davon irgendwie unangemessen, ja fast anstößig bei einem so unscheinbaren und geringen Geschöpf. Er fragte nacheinander die Nähterin und Frau Stöhr, wie lange sie schon hier oben seien (jene lebte seit fünf Monaten, diese seit sieben in der Anstalt), suchte hierauf sein Englisch zusammen, um von seiner Nachbarin zur Rechten zu erfahren, was für einen Tee sie da trinke (es war Hagebuttentee) und ob er denn gut schmecke, was sie fast stürmisch bejahte, und sah dann in den Saal hinein, in dem man kam und ging: das erste Frühstück war keine streng gemeinsame Mahlzeit.
Er hatte ein wenig Furcht vor schreckhaften Eindrücken gehabt, aber er fand sich enttäuscht: es ging ganz aufgeräumt zu hier im Saale, man hatte nicht das Gefühl, sich an einer Stätte des Jammers zu befinden. Gebräunte junge Leute beiderlei Geschlechts kamen trällernd herein, sprachen mit den Saaltöchtern und hieben mit robustem Appetit in das Frühstück ein. Auch reifere Personen waren da, Ehepaare, eine ganze Familie mit Kindern, die Russisch sprach, auch halbwüchsige Jungen. Die Frauen trugen fast sämtlich eng anliegende Jacken aus Wolle oder Seide, sogenannte Sweater, weiß oder farbig, mit Fallkragen und Seitentaschen, und es sah hübsch aus, wenn sie, beide Hände in diese Seitentaschen vergraben, standen und plauderten. An mehreren Tischen wurden Photographien herumgezeigt, neue, selbst angefertigte Aufnahmen ohne Zweifel; an einem anderen tauschte man Briefmarken. Es wurde vom Wetter gesprochen, davon, wie man geschlafen und wieviel man morgens im Munde gemessen. Die meisten waren lustig, – ohne besonderen Grund wahrscheinlich, sondern nur, weil sie keine unmittelbaren Sorgen hatten und zahlreich beisammen waren. Einzelne freilich saßen, den Kopf in die Hände gestützt, am Tische und starrten vor sich hin. Man ließ sie starren und achtete nicht auf sie.
Plötzlich zuckte Hans Castorp geärgert und beleidigt zusammen. Eine Tür war zugefallen, es war die Tür links vorn, die gleich in die Halle führte, – jemand hatte sie zufallen lassen oder gar hinter sich ins Schloß geworfen, und das war ein Geräusch, das Hans Castorp auf den Tod nicht leiden konnte, das er von jeher gehaßt hatte. Vielleicht beruhte dieser Haß auf Erziehung, vielleicht auf angeborener Idiosynkrasie, – genug, er verabscheute das Türenwerfen und hätte jeden schlagen können, der es sich vor seinen Ohren zuschulden kommen ließ. In diesem Fall war die Tür obendrein mit kleinen Glasscheiben gefüllt, und das verstärkte den Chok: es war ein Schmettern und Klirren. Pfui, dachte Hans Castorp wütend, was ist denn das für eine verdammte Schlamperei! Da übrigens in demselben Augenblick die Nähterin das Wort an ihn richtete, so hatte er keine Zeit, festzustellen, wer der Missetäter gewesen sei. Doch standen Falten zwischen seinen blonden Brauen, und sein Gesicht war peinlich verzerrt, während er der Nähterin antwortete.
Joachim fragte, ob die Ärzte schon durchgekommen seien. Ja, zum erstenmal seien sie dagewesen, antwortete jemand, – sie hätten den Saal verlassen fast in dem Augenblick, als die Vettern gekommen seien. Dann wollten sie gehen und nicht warten, meinte Joachim. Eine Gelegenheit zur Vorstellung werde sich im Laufe des Tages ja finden. Aber an der Tür wären sie fast mit Hofrat Behrens zusammengestoßen, der, gefolgt von Dr. Krokowski, im Geschwindschritt hereinkam.
„Hoppla, Achtung die Herren!“ sagte Behrens. „Das hätte leicht schlecht ablaufen können für die beiderseitigen Hühneraugen.“ Er sprach stark niedersächsisch, breit und kauend. „So das sind Sie“, sagte er zu Hans Castorp, den Joachim mit zusammengezogenen Absätzen präsentierte; „na, freut mich.“ Und er gab dem jungen Mann seine Hand, die groß war wie eine Schaufel. Er war ein knochiger Mann, wohl drei Köpfe höher als Dr. Krokowski, schon ganz weiß auf dem Kopf, mit heraustretendem Genick, großen, vorquellenden und blutunterlaufenen blauen Augen, in denen Tränen schwammen, einer aufgeworfenen Nase und kurzgeschnittenem Schnurrbärtchen, das schief gezogen war, und zwar infolge einer einseitigen Schürzung der Oberlippe. Was Joachim von seinen Backen gesagt hatte, bewahrheitete sich vollkommen, sie waren blau; und so wirkte sein Kopf denn recht farbig gegen den weißen Chirurgenrock, den er trug, einen über die Knie reichenden Gurtkittel, der unten seine gestreiften Hosen und ein paar kolossale Füße in gelben und etwas abgenutzten Schnürstiefeln sehen ließ. Auch Dr. Krokowski war im Berufskleide, allein sein Kittel war schwarz, aus einem schwarzen Lüsterstoff, hemdartig, mit Gummizügen an den Handgelenken, und hob seine Blässe nicht wenig. Er verhielt sich rein assistierend und beteiligte sich auf keine Weise an der Begrüßung, doch ließ eine kritische Spannung seines Mundes erkennen, daß er sein untergeordnetes Verhältnis als wunderlich empfinde.
„Vettern?“ fragte der Hofrat, indem er mit der Hand zwischen den jungen Leuten hin und her deutete und mit seinen blutunterlaufenen blauen Augen von unten blickte ... „Na, will er denn auch zum Kalbsfell schwören?“ sagte er zu Joachim und wies mit dem Kopf auf Hans Castorp ... „I, Gott bewahre, – was? Ich habe doch gleich gesehen“ – und er sprach nun direkt zu Hans Castorp –, „daß Sie so was Ziviles haben, so was Komfortables, – nichts so Waffenrasselndes wie dieser Rottenführer da. Sie wären ein besserer Patient als der, da möcht ich doch wetten. Das sehe ich jedem gleich an, ob er einen brauchbaren Patienten abgeben kann, denn dazu gehört Talent, Talent gehört zu allem, und dieser Myrmidon hier hat auch kein bißchen Talent. Zum Exerzieren, das weiß ich nicht, aber zum Kranksein gar nicht. Wollen Sie glauben, daß er immer weg will? Immerzu will er weg, tirrt mich und plagt mich und kann es nicht erwarten, sich da unten schinden zu lassen. So ein Biereifer! Kein halbes Jährchen will er uns schenken. Und dabei ist es doch ganz schön hier bei uns, – nun sagen Sie mal selbst, Ziemßen, ob es nicht ganz schön hier ist! Na, Ihr Herr Vetter wird uns schon besser zu würdigen wissen, wird sich schon amüsieren. Damenmangel ist auch nicht, – allerliebste Damen haben wir hier. Wenigstens von außen sind manche ganz malerisch. Aber Sie sollten sich etwas mehr Couleur anschaffen, hören Sie mal, sonst fallen Sie ab bei den Damen! Grün ist ja wohl des Lebens goldner Baum, aber als Gesichtsfarbe ist grün doch nicht ganz das Richtige. Total anämisch natürlich“, sagte er, indem er ohne weiteres auf Hans Castorp zutrat und ihm mit Zeige- und Mittelfinger ein Augenlid herunterzog. „Selbstverständlich total anämisch, wie ich sagte. Wissen Sie was? Das war gar nicht so dumm von Ihnen, daß Sie Ihr Hamburg mal auf einige Zeit sich selbst überließen. Ist ja eine höchst dankenswerte Einrichtung, dieses Hamburg; stellt uns immer ein nettes Kontingent mit seiner feuchtfröhlichen Meteorologie. Aber wenn ich Ihnen bei dieser Gelegenheit einen unmaßgeblichen Rat geben darf – ganz sine pecunia, wissen Sie –, so machen Sie, solange Sie hier sind, mal alles mit, was Ihr Vetter macht. In Ihrem Fall kann man gar nichts Schlaueres tun, als einige Zeit zu leben wie bei leichter tuberculosis pulmonum, und ein bißchen Eiweiß anzusetzen. Das ist nämlich kurios hier bei uns mit dem Eiweißstoffwechsel ... Obgleich die Allgemeinverbrennung erhöht ist, setzt der Körper doch Eiweiß an ... Na, und Sie haben schön geschlafen, Ziemßen? Fein, was? Also nun mal los mit dem Lustwandel! Aber nicht mehr als ’ne halbe Stunde! Und nachher die Quecksilberzigarre ins Gesicht gesteckt! Immer hübsch aufschreiben, Ziemßen! Dienstlich! Gewissenhaft! Sonnabend will ich die Kurve sehen! Ihr Herr Vetter soll auch gleich mitmessen. Messen kann nie was schaden. Morgen, die Herren! Gute Unterhaltung! Morgen ... Morgen ...“ Und Dr. Krokowski schloß sich ihm an, der weiter segelte, mit den Armen schlenkernd, die Handflächen ganz nach hinten gekehrt, indem er nach rechts und links die Frage richtete, ob man „schön“ geschlafen habe, was allgemein bejaht wurde.
„Sehr netter Mann“, sagte Hans Castorp, als sie nach freundschaftlicher Begrüßung mit dem hinkenden Concierge, der in seiner Loge Briefe ordnete, durch das Portal hinaus ins Freie traten. Das Portal war an der Südostflanke des weißgetünchten Gebäudes gelegen, dessen mittlerer Teil die beiden Flügel um ein Stockwerk überragte und von einem kurzen, mit schieferfarbenem Eisenblech gedeckten Uhrturm gekrönt war. Man berührte den eingezäunten Garten nicht, wenn man das Haus hier verließ, sondern war gleich im Freien, angesichts schräger Bergwiesen, die von vereinzelten, mäßig hohen Fichten und auf den Boden geduckten Krummholzkiefern bestanden waren. Der Weg, den sie einschlugen – eigentlich war es der einzige, der in Betracht kam, außer der zu Tale abfallenden Fahrstraße –, leitete sie leicht ansteigend nach links an der Rückseite des Sanatoriums vorbei, der Küchen- und Wirtschaftsseite, wo eiserne Abfalltonnen an den Gittern der Kellertreppen standen, lief noch ein gutes Stück in derselben Richtung fort, beschrieb dann ein scharfes Knie und führte steiler nach rechts hin den dünn bewaldeten Hang hinan. Es war ein harter, rötlich gefärbter, noch etwas feuchter Weg, an dessen Saume zuweilen Steinblöcke lagen. Die Vettern sahen sich keineswegs allein auf der Promenade. Gäste, die gleich nach ihnen ihr Frühstück beendet, folgten ihnen auf dem Fuße, und ganze Gruppen, auf dem Rückweg, kamen ihnen mit den stapfenden Tritten absteigender Leute entgegen.
„Sehr netter Mann!“ wiederholte Hans Castorp. „So eine flotte Redeweise hat er, es machte mir Spaß, ihm zuzuhören. ‚Quecksilberzigarre‘ für ‚Thermometer‘ ist doch ausgezeichnet, ich habe es gleich verstanden ... Aber ich zünde mir nun eine richtige an,“ sagte er stehenbleibend, „ich halte es nicht mehr aus! Seit gestern mittag habe ich nichts Ordentliches mehr geraucht ... Entschuldige mal!“ Und er entnahm seinem automobilledernen und mit silbernem Monogramm geschmückten Etui ein Exemplar von Maria Mancini, ein schönes Exemplar der obersten Lage, an einer Seite abgeplattet, wie er es besonders liebte, kupierte die Spitze mit einem kleinen, eckig schneidenden Instrument, das er an der Uhrkette trug, ließ seinen Taschenzündapparat aufflammen und setzte die ziemlich lange, vorn stumpfe Zigarre mit einigen hingebungsvoll paffenden Zügen in Brand. „So!“ sagte er. „Nun können wir meinethalben den Lustwandel fortsetzen. Du rauchst natürlich nicht vor lauter Biereifer.“
„Ich rauche ja nie“, antwortete Joachim. „Warum sollt ich denn gerade hier rauchen.“
„Das verstehe ich nicht!“ sagte Hans Castorp. „Ich verstehe es nicht, wie jemand nicht rauchen kann, – er bringt sich doch, sozusagen, um des Lebens bestes Teil und jedenfalls um ein ganz eminentes Vergnügen! Wenn ich aufwache, so freue ich mich, daß ich tagüber werde rauchen dürfen, und wenn ich esse, so freue ich mich wieder darauf, ja ich kann sagen, daß ich eigentlich bloß esse, um rauchen zu können, wenn ich damit natürlich auch etwas übertreibe. Aber ein Tag ohne Tabak, das wäre für mich der Gipfel der Schalheit, ein vollständig öder und reizloser Tag, und wenn ich mir morgens sagen müßte: heut gibt’s nichts zu rauchen, – ich glaube, ich fände den Mut gar nicht, aufzustehen, wahrhaftig, ich bliebe liegen. Siehst du: hat man eine gut brennende Zigarre – selbstverständlich darf sie nicht Nebenluft haben oder schlecht ziehen, das ist im höchsten Grade ärgerlich – ich meine: hat man eine gute Zigarre, dann ist man eigentlich geborgen, es kann einem buchstäblich nichts geschehn. Es ist genau, wie wenn man an der See liegt, dann liegt man eben an der See, nicht wahr, und braucht nichts weiter, weder Arbeit noch Unterhaltung ... Gott sei Dank raucht man ja in der ganzen Welt, es ist nirgendwo unbekannt, soviel ich weiß, wohin man auch etwa verschlagen werden sollte. Selbst die Polarforscher statten sich reichlich mit Rauchvorrat aus für ihre Strapazen, und das hat mich immer sympathisch berührt, wenn ich es las. Denn es kann einem sehr schlecht gehen, – nehmen wir mal an, es ginge mir miserabel; aber solange ich noch meine Zigarre hätte, hielte ich’s aus, das weiß ich, sie brächte mich drüber weg.“
„Immerhin ist es etwas schlapp,“ sagte Joachim, „daß du so daran hängst. Behrens hat ganz recht: Du bist ein Zivilist – er meinte es ja wohl mehr als Lob, aber du bist ein heilloser Zivilist, das ist die Sache. Übrigens bist du ja gesund und kannst tun, was du willst“, sagte er, und seine Augen wurden müde.
„Ja, gesund bis auf die Anämie“, sagte Hans Castorp. „Reichlich geradezu war es ja, wie er es mir so sagte, daß ich grün aussehe. Aber es stimmt, es ist mir selber aufgefallen, daß ich im Vergleich mit euch hier oben förmlich grün bin, zu Hause hab ich es nicht so bemerkt. Und dann ist es ja auch wieder nett von ihm, daß er mir so ohne weiteres Ratschläge gibt, ganz sine pecunia, wie er sich ausdrückt. Ich will mir gern vornehmen, es zu machen, wie er sagt, und mich ganz nach deiner Lebensweise richten, – was sollt’ ich denn sonst auch wohl tun bei euch hier oben, und es kann ja nicht schaden, wenn ich in Gottes Namen Eiweiß ansetze, obgleich es etwas widerlich klingt, das mußt du mir zugeben.“
Joachim hüstelte ein paarmal im Gehen, – die Steigung schien ihn doch anzustrengen. Als er zum drittenmal ansetzte, blieb er mit gerunzelten Brauen stehen. „Geh nur voran“, sagte er. Hans Castorp beeilte sich, weiterzugehen und sah sich nicht um. Dann verlangsamte er seinen Schritt und blieb schließlich fast stehen, da ihm war, als müsse er einen bedeutenden Vorsprung vor Joachim gewonnen haben. Aber er sah sich nicht um.
Ein Trupp von Gästen beiderlei Geschlechtes kam ihm entgegen, – er hatte sie droben auf halber Höhe des Hanges den ebenen Weg entlang kommen sehen, jetzt stapften sie abwärts, gerade auf ihn zu und ließen ihre verschiedenartigen Stimmen ertönen. Es waren sechs oder sieben Personen gemischten Alters, die einen blutjung, ein paar schon etwas weiter an Jahren. Er sah sie sich an mit seitwärts geneigtem Kopfe, während er an Joachim dachte. Sie waren barhaupt und braun, die Damen in farbigen Sweaters, die Herren meist ohne Überzieher und selbst ohne Stöcke, wie Leute, die ohne Umstände und die Hände in den Taschen ein paar Schritte vors Haus machen. Da sie bergab gingen, was keine ernsthaft tragende Anstrengung, sondern nur ein lustiges Bremsen und Anstemmen der Beine erfordert, damit man nicht ins Laufen und Stolpern gerät, ja eigentlich nichts weiter als ein Sichfallenlassen ist, hatte ihre Gangart etwas Beschwingtes und Leichtsinniges, was sich ihren Mienen, ihrer ganzen Erscheinung mitteilte, so daß man wohl wünschen konnte, zu ihnen zu gehören.
Nun waren sie bei ihm, Hans Castorp sah ihre Gesichter genau. Sie waren nicht alle gebräunt, zwei Damen stachen durch Blässe ab: die eine dünn wie ein Stock und elfenbeinern von Angesicht, die andere kleiner und fett, von Leberflecken verunziert. Sie sahen ihn alle an, mit einem gemeinsamen, dreisten Lächeln. Ein langes junges Mädchen in grünem Sweater, mit schlecht frisiertem Haar und dummen, nur halb geöffneten Augen strich dicht an Hans Castorp vorbei, indem es ihn fast mit dem Arme berührte. Und dabei pfiff sie ... Nein, das war verrückt! Sie pfiff ihn an, doch nicht mit dem Mund, den spitzte sie gar nicht, sie hielt ihn im Gegenteil fest geschlossen. Es pfiff aus ihr, indes sie ihn ansah, dumm und mit halbgeschlossenen Augen, – ein außerordentlich unangenehmes Pfeifen, rauh, scharf und doch hohl, gedehnt und gegen das Ende im Tone abfallend, so daß es an die Musik jener Jahrmarktsschweinchen aus Gummi erinnerte, die klagend ihre eingeblasene Luft fahren lassen und zusammensinken, drang irgendwie und unbegreiflicherweise aus ihrer Brust hervor, und dann war sie mit ihrer Gesellschaft vorüber.
Hans Castorp stand starr und blickte ins Weite. Dann wandte er sich hastig um und begriff wenigstens so viel, daß das Abscheuliche ein Scherz, eine abgekartete Fopperei gewesen sein mußte, denn er sah an den Schultern der Abziehenden, daß sie lachten, und ein untersetzter Jüngling mit Wulstlippen, welcher, beide Hände in den Hosentaschen, auf ziemlich unschickliche Art seine Jacke emporgerafft hielt, drehte sogar unverhohlen den Kopf nach ihm und lachte ... Joachim war herangekommen. Er grüßte die Gruppe, indem er nach seiner ritterlichen Gewohnheit beinahe Front machte und sich mit zusammengezogenen Absätzen verbeugte, und trat dann sanft blickend zu seinem Vetter.
„Was machst du denn für ein Gesicht?“ fragte er.
„Sie pfiff!“ antwortete Hans Castorp. „Sie pfiff aus dem Bauche, als sie an mir vorüberkam, willst du mir das erklären?“
„Ach“, sagte Joachim und lachte wegwerfend. „Nicht aus dem Bauche, Unsinn. Das war die Kleefeld, Hermine Kleefeld, die pfeift mit dem Pneumothorax.“
„Womit?“ fragte Hans Castorp. Er war außerordentlich erregt und wußte nicht recht in welchem Sinne. Er schwankte zwischen Lachen und Weinen, als er hinzufügte: „Du kannst nicht verlangen, daß ich euer Rotwelsch verstehe.“
„So komm doch weiter!“ sagte Joachim. „Ich kann es dir doch auch im Gehen erklären. Du bist ja wie angewurzelt! Es ist etwas aus der Chirurgie, wie du dir denken kannst, eine Operation, die hier oben häufig ausgeführt wird. Behrens hat große Übung darin ... Wenn eine Lunge sehr mitgenommen ist, verstehst du, die andere aber gesund oder vergleichsweise gesund, so wird die kranke mal einige Zeit von ihrer Tätigkeit dispensiert, um sie zu schonen ... Das heißt: man wird hier aufgeschnitten, hier irgendwo seitwärts, – ich kenne die Stelle ja nicht genau, aber Behrens hat es großartig los. Und dann wird Gas in einen hineingelassen, Stickstoff, weißt du, und so der verkäste Lungenflügel außer Betrieb gesetzt. Das Gas hält natürlich nicht lange vor, halbmonatlich etwa muß es erneuert werden, – man wird gleichsam aufgefüllt, so mußt du dirs vorstellen. Und wenn das ein Jahr lang geschieht oder länger, und alles geht gut, so kann die Lunge durch Ruhe zur Heilung kommen. Nicht immer, versteht sich, es ist wohl sogar eine gewagte Sache. Aber es sollen schon schöne Erfolge mit dem Pneumothorax erzielt worden sein. Alle haben ihn, die du da eben sahst. Frau Iltis war auch dabei – die mit den Leberflecken – und Fräulein Levi, die magere, du erinnerst dich, – sie hat so lange zu Bett gelegen. Sie haben sich zusammengefunden, denn so etwas wie der Pneumothorax verbindet die Menschen natürlich, und nennen sich ‚Verein Halbe Lunge‘, unter diesem Namen sind sie bekannt. Aber der Stolz des Vereins ist Hermine Kleefeld, weil sie mit dem Pneumothorax pfeifen kann, – das ist eine Gabe von ihr, es kann es durchaus nicht jeder. Wie sie es fertig bringt, das kann ich dir auch nicht sagen, sie selbst kann es nicht deutlich beschreiben. Aber wenn sie rasch gegangen ist, dann kann sie aus ihrem Inneren pfeifen, und das benutzt sie natürlich, um die Leute zu erschrecken, besonders die neuangekommenen Kranken. Ich glaube übrigens, daß sie Stickstoff dabei verschwendet, denn alle acht Tage muß sie aufgefüllt werden.“
Nun lachte Hans Castorp; seine Erregung hatte sich bei Joachims Worten zum Heiteren entschieden, und indem er im Gehen die Augen mit der Hand bedeckte und sich vorneigte, wurden seine Schultern von einem raschen und leisen Kichern erschüttert.
„Sind sie auch eingetragen?“ fragte er, und das Sprechen wurde ihm nicht leicht; es klang vor zurückgehaltenem Lachen weinerlich und leise jammernd. „Haben sie Statuten? Schade, daß du nicht Mitglied bist, du, dann könnten sie mich als Ehrengast zulassen oder als ... Konkneipant ... Du solltest Behrens bitten, daß er dich teilweise außer Betrieb setzt. Vielleicht würdest du auch pfeifen können, wenn du’s drauf anlegtest, es muß doch schließlich zu lernen sein ... Das ist das Komischste, was ich in meinem Leben gehört habe!“ sagte er tief aufseufzend. „Ja, verzeih, daß ich so davon spreche, aber sie selbst sind ja in der besten Laune, deine pneumatischen Freunde! Wie sie daherkamen ... Und zu denken, daß es der ‚Verein Halbe Lunge‘ war! ‚Tiuu‘ pfeift sie mich an, – eine tolle Person! Aber das ist doch heller Übermut! Warum sind sie so übermütig, du, willst du mir das mal sagen?“
Joachim suchte nach einer Antwort. „Gott,“ sagte er, „sie sind so frei ... Ich meine, es sind ja junge Leute, und die Zeit spielt keine Rolle für sie, und dann sterben sie womöglich. Warum sollen sie da ernste Gesichter schneiden. Ich denke manchmal: Krankheit und Sterben sind eigentlich nicht ernst, sie sind mehr so eine Art Bummelei, Ernst gibt es genau genommen nur im Leben da unten. Ich glaube, daß du das mit der Zeit schon verstehen wirst, wenn du erst länger hier oben bist.“
„Sicher“, sagte Hans Castorp. „Das glaube ich sogar sicher. Ich habe schon sehr viel Interesse gefaßt für euch hier oben, und wenn man sich interessiert, nicht wahr, dann kommt das Verstehen von selber ... Aber wie ist mir denn nur, – sie schmeckt nicht!“ sagte er und betrachtete seine Zigarre. „Ich frage mich die ganze Zeit, was mir fehlt, und nun merke ich, daß es Maria ist, die mir nicht schmeckt. Sie schmeckt wie Papiermaché, ich versichere dich, es ist gerade, wie wenn man einen völlig verdorbenen Magen hat. Das ist doch unbegreiflich! Ich habe ja ungewöhnlich viel zum Frühstück gegessen, aber das kann der Grund nicht sein, denn wenn man zu viel gegessen hat, so schmeckt sie zunächst sogar besonders gut. Meinst du, es kann daher kommen, daß ich so unruhig geschlafen habe? Vielleicht bin ich dadurch in Unordnung geraten. Nein, ich muß sie geradezu wegwerfen!“ sagte er nach einem neuen Versuch. „Jeder Zug ist eine Enttäuschung; es hat keinen Zweck, daß ich es forciere.“ Und nachdem er noch einen Augenblick gezögert, warf er die Zigarre den Abhang hinab zwischen das feuchte Nadelholz. „Weißt du, womit es meiner Überzeugung nach zusammenhängt?“ fragte er ... „Meiner festen Überzeugung nach hängt es mit dieser verdammten Gesichtshitze zusammen, an der ich nun schon wieder seit dem Aufstehen laboriere. Weiß der Teufel, mir ist immer, als wäre ich schamrot im Gesicht ... Hast du das auch so gehabt, als du ankamst?“
„Ja“, sagte Joachim. „Mir war auch zuerst etwas sonderbar. Mach dir nichts draus! Ich habe dir ja gesagt, daß es nicht so leicht ist, sich einzuleben bei uns. Aber du kommst schon wieder in Ordnung. Siehst du, die Bank steht hübsch. Wir wollen uns etwas setzen und dann nach Hause gehen, ich muß in die Liegekur.“
Der Weg war eben geworden. Er lief nun in der Richtung auf Platz Davos, etwa in Drittelhöhe des Hanges, und gewährte zwischen hohen, schmal gewachsenen und windschiefen Kiefern den Blick auf den Ort, der weißlich in hellerem Lichte lag. Die schlicht gezimmerte Bank, auf der sie sich setzten, lehnte sich an die steile Bergwand. Neben ihnen fiel ein Wasser in offener Holzrinne gurgelnd und plätschernd zu Tal.
Joachim wollte den Vetter über die Namen der umwölkten Alpenhäupter unterrichten, die das Tal im Süden zu schließen schienen, indem er mit der Spitze seines Bergstockes auf sie wies. Aber Hans Castorp blickte nur flüchtig hin, er saß vornüber gebeugt, zeichnete mit der Zwinge seines städtischen, silberbeschlagenen Stockes Figuren im Sand und verlangte anderes zu wissen.
„Was ich dich fragen wollte –“, fing er an ... „Der Fall in meinem Zimmer war also gerade eingegangen, als ich kam. Sind sonst schon viele Todesfälle vorgekommen, seit du hier oben bist?“
„Mehrere sicher“, antwortete Joachim. „Aber sie werden diskret behandelt, verstehst du, man erfährt nichts davon oder nur gelegentlich, später, es geht im strengsten Geheimnis vor sich, wenn einer stirbt, aus Rücksicht auf die Patienten und namentlich auch auf die Damen, die sonst leicht Zufälle bekämen. Wenn neben dir jemand stirbt, das merkst du gar nicht. Und der Sarg wird in aller Frühe gebracht, wenn du noch schläfst, und abgeholt wird der Betreffende auch nur zu solchen Zeiten, zum Beispiel während des Essens.“
„Hm“, sagte Hans Castorp und zeichnete weiter. „Hinter den Kulissen also geht so etwas vor sich.“
„Ja, so kann man sagen. Aber neulich, es ist nun, warte mal, möglicherweise acht Wochen her –“
„Dann kannst du nicht neulich sagen“, bemerkte Hans Castorp trocken und wachsam.
„Wie? Also nicht neulich. Du bist aber genau. Ich habe die Zahl ja nur so geraten. Also vor einiger Zeit, da habe ich doch einmal hinter die Kulissen gesehen, aus reinem Zufall, ich weiß es wie heute. Das war, als sie der kleinen Hujus, einer Katholischen, Barbara Hujus, das Viatikum brachten, das Sterbesakrament, weißt du, die letzte Ölung. Sie war noch auf, als ich hier ankam, und ausgelassen lustig konnte sie sein, so dalberig, recht wie ein Backfisch. Aber dann ging es rapide mit ihr, sie stand nicht mehr auf, drei Zimmer von meinem lag sie, und ihre Eltern kamen, und nun kam denn also der Priester. Er kam, während alles beim Tee war, nachmittags, es war kein Mensch auf den Gängen. Aber stelle dir vor, ich hatte verschlafen, ich war in der Hauptliegekur eingeschlafen und hatte das Gong überhört und mich um eine Viertelstunde verspätet. Da war ich nun im entscheidenden Augenblick nicht, wo alle waren, sondern war hinter die Kulissen geraten, wie du sagst, und wie ich über den Korridor gehe, da kommen sie mir entgegen, in Spitzenhemden und ein Kreuz voran, ein goldenes Kreuz mit Laternen, der eine trug es voran wie den Schellenbaum vor der Janitscharenmusik.“
„Das ist kein Vergleich“, sagte Hans Castorp nicht ohne Strenge.
„Es kam mir so vor. Ich wurde unwillkürlich daran erinnert. Aber höre nur weiter. Sie kommen also auf mich zu, marsch, marsch, im Geschwindschritt, zu dritt, wenn ich nicht irre, voran der Mann mit dem Kreuz, darauf der Geistliche, eine Brille auf der Nase, und dann noch ein Junge mit einem Räucherfäßchen. Der Geistliche hielt das Viatikum an der Brust, es war zugedeckt, und er hielt recht demütig den Kopf schief, es ist ja ihr Allerheiligstes.“
„Eben darum“, sagte Hans Castorp. „Eben aus diesem Grunde wundere ich mich, daß du von Schellenbaum sprechen magst.“
„Ja, ja. Aber warte nur, wenn du dabei gewesen wärst, wüßtest du auch nicht, was du für ein Gesicht machen solltest in der Erinnerung. Es war, daß man davon träumen könnte –“
„In welcher Hinsicht?“
„Folgendermaßen. Ich frage mich also, wie ich mich zu verhalten habe unter diesen Umständen. Einen Hut zum Abnehmen hatte ich nicht auf –“
„Siehst du wohl!“ unterbrach ihn Hans Castorp rasch noch einmal. „Siehst du wohl, daß man einen Hut aufhaben soll! Es ist mir natürlich aufgefallen, daß ihr keinen tragt hier oben. Man soll aber einen aufsetzen, damit man ihn abnehmen kann, bei Gelegenheiten, wo es sich schickt. Aber was denn nun weiter?“
„Ich stellte mich an die Wand,“ sagte Joachim, „in anständiger Haltung, und verbeugte mich etwas, als sie bei mir waren, – es war gerade vor dem Zimmer der kleinen Hujus, Nummer achtundzwanzig. Ich glaube, der Geistliche freute sich, daß ich grüßte; er dankte sehr höflich und nahm seine Kappe ab. Aber zugleich machen sie auch schon halt, und der Ministrantenjunge mit dem Räucherfaß klopft an, und dann klinkt er auf und läßt seinem Chef den Vortritt ins Zimmer. Und nun stelle dir vor und male dir meinen Schrecken aus und meine Empfindungen! In dem Augenblick, wo der Priester den Fuß über die Schwelle setzt, geht da drinnen ein Zetermordio an, ein Gekreisch, du hast nie so etwas gehört, drei, viermal hintereinander, und danach ein Schreien ohne Pause und Absatz, aus weit offenem Munde offenbar, ahhh, es lag ein Jammer darin und ein Entsetzen und Widerspruch, daß es nicht zu beschreiben ist, und so ein greuliches Betteln war es auch zwischendurch, und auf einen Schlag wird es hohl und dumpf, als ob es in die Erde versunken wäre und tief aus dem Keller käme.“
Hans Castorp hatte sich seinem Vetter heftig zugewandt. „War das die Hujus?“ fragte er aufgebracht. „Und wieso: ‚aus dem Keller‘?“
„Sie war unter die Decke gekrochen!“ sagte Joachim. „Stelle dir meine Empfindungen vor! Der Geistliche stand dicht an der Schwelle und sagte beruhigende Worte, ich sehe ihn noch, er schob immer den Kopf dabei vor und zog ihn dann wieder zurück. Der Kreuzträger und der Ministrant standen noch zwischen Tür und Angel und konnten nicht eintreten. Und ich konnte zwischen ihnen hindurch ins Zimmer sehen. Es ist ja ein Zimmer wie deins und meins, das Bett steht links von der Tür an der Seitenwand, und am Kopfende standen Leute, die Angehörigen natürlich, die Eltern, und redeten auch beschwichtigend auf das Bett hinunter, man sah nichts als eine formlose Masse darin, die bettelte und grauenhaft protestierte und mit den Beinen strampelte.“
„Sagst du, daß sie mit den Beinen strampelte?“
„Aus Leibeskräften! Aber es nützte ihr nichts, das Sterbesakrament mußte sie haben. Der Pfarrer ging auf sie zu, und auch die beiden anderen traten ein, und die Tür wurde zugezogen. Aber vorher sah ich noch: der Kopf von der Hujus kommt für eine Sekunde zum Vorschein, mit wirrem hellblonden Haar, und starrt den Priester mit weitaufgerissenen Augen an, so blassen Augen, ganz ohne Farbe und fährt mit Ah und Huh wieder unters Laken.“
„Und das erzählst du mir jetzt erst?“ sagte Hans Castorp nach einer Pause. „Ich verstehe nicht, daß du nicht schon gestern abend darauf zu sprechen gekommen bist. Aber, mein Gott, sie mußte doch noch eine Menge Kraft haben, so wie sie sich wehrte. Dazu gehören doch Kräfte. Man sollte den Priester nicht holen lassen, bevor einer ganz schwach ist.“
„Sie war auch schwach“, erwiderte Joachim. „... Ach, zu erzählen gäbe es viel; es ist schwer, die erste Auswahl zu treffen ... Schwach war sie schon, es war nur die Angst, die ihr soviel Kräfte gab. Sie ängstigte sich eben fürchterlich, weil sie merkte, daß sie sterben sollte. Sie war ja ein junges Mädchen, da muß man es schließlich entschuldigen. Aber auch Männer führen sich manchmal so auf, was natürlich eine unverzeihliche Schlappheit ist. Behrens weiß übrigens mit ihnen umzugehen, er hat den richtigen Ton in solchen Fällen.“
„Was für einen Ton?“ fragte Hans Castorp mit zusammengezogenen Brauen.
„‚Stellen Sie sich nicht so an!‘ sagt er“, antwortete Joachim. „Wenigstens hat er es neulich zu einem gesagt, – wir wissen es von der Oberin, die dabei war und den Sterbenden festhalten half. Es war so einer, der zu guter Letzt eine scheußliche Szene machte und absolut nicht sterben wollte. Da hat Behrens ihn angefahren: ‚Stellen Sie sich gefälligst nicht so an!‘ hat er gesagt, und sofort ist der Patient still geworden und ist ganz ruhig gestorben.“
Hans Castorp schlug sich mit der Hand auf den Schenkel und warf sich gegen die Rückenlehne der Bank, indem er zum Himmel aufblickte.
„Na, höre mal, das ist doch stark!“ rief er. „Fährt auf ihn los und sagt einfach zu ihm: ‚Stellen Sie sich nicht so an!‘ Zu einem Sterbenden! Das ist doch stark! Ein Sterbender ist doch gewissermaßen ehrwürdig. Man kann ihn doch nicht so mir nichts, dir nichts ... Ein Sterbender ist doch sozusagen heilig, sollte ich meinen!“
„Das will ich nicht leugnen“, sagte Joachim. „Aber wenn er sich nun doch dermaßen schlapp benimmt ...“
„Nein!“ beharrte Hans Castorp mit einer Heftigkeit, die zu dem Widerstand, den man ihm leistete, in keinem Verhältnis stand. „Das lasse ich mir nicht ausreden, daß ein Sterbender etwas Vornehmeres ist, als irgend so ein Lümmel, der herumgeht und lacht und Geld verdient und sich den Bauch vollschlägt! Das geht nicht –“ und seine Stimme schwankte höchst sonderbar. „Das geht nicht, daß man ihn so mir nichts, dir nichts –“ und seine Worte erstickten im Lachen, das ihn ergriff und ihn überwältigte, dem Lachen von gestern, einem tief heraufquellenden, leiberschütternden, grenzenlosen Gelächter, das ihm die Augen schloß und Tränen zwischen den Lidern hervorpreßte.
„Pst!“ machte Joachim plötzlich. „Sei still!“ flüsterte er und stieß den haltlos Lachenden heimlich in die Seite. Hans Castorp blickte in Tränen auf.
Auf dem Wege von links kam ein Fremder daher, ein zierlicher brünetter Herr mit schön gedrehtem schwarzen Schnurrbart und in hellkariertem Beinkleid, der, herangekommen, mit Joachim einen Morgengruß tauschte – der seine war präzis und wohllautend – und mit gekreuzten Füßen, auf seinen Stock gestützt, in anmutiger Haltung vor ihm stehen blieb.
Sein Alter wäre schwer zu schätzen gewesen, zwischen dreißig und vierzig mußte es wohl liegen, denn wenn auch seine Gesamterscheinung jugendlich wirkte, so war sein Haupthaar doch an den Schläfen schon silbrig durchsetzt und weiter oben merklich gelichtet: zwei kahle Buchten sprangen neben dem schmalen, spärlichen Scheitel ein und erhöhten die Stirn. Sein Anzug, diese weiten, hellgelblich karierten Hosen und ein flausartiger, zu langer Rock mit zwei Reihen Knöpfen und sehr großen Aufschlägen, war weit entfernt, Anspruch auf Eleganz zu erheben; auch zeigte sein rund umgebogener Stehkragen sich von häufiger Wäsche an den Kanten schon etwas aufgerauht, seine schwarze Krawatte war abgenutzt, und Manschetten trug er offenbar überhaupt nicht, – Hans Castorp erkannte es an der schlaffen Art, in der die Ärmel ihm um das Handgelenk hingen. Trotzdem sah er wohl, daß er einen Herrn vor sich habe; der gebildete Gesichtsausdruck des Fremden, seine freie, ja schöne Haltung ließen keinen Zweifel daran. Diese Mischung aber von Schäbigkeit und Anmut, schwarze Augen dazu und der weich geschwungene Schnurrbart, erinnerten Hans Castorp sogleich an gewisse ausländische Musikanten, die zur Weihnachtszeit in den heimischen Höfen aufspielten und mit emporgerichteten Sammetaugen ihren Schlapphut hinhielten, damit man ihnen Zehnpfennigstücke aus den Fenstern hineinwürfe. „Ein Drehorgelmann!“ dachte er. Und so wunderte er sich nicht über den Namen, den er zu hören bekam, als Joachim sich von der Bank erhob und in einiger Befangenheit vorstellte:
„Mein Vetter Castorp, – Herr Settembrini.“
Hans Castorp war ebenfalls zur Begrüßung aufgestanden, die Spuren seiner Heiterkeitsausschreitung noch im Gesicht. Aber der Italiener bat beide in höflichen Worten, sich nicht in ihrer Bequemlichkeit stören zu lassen und nötigte sie auf ihre Plätze zurück, während er selbst in seiner angenehmen Pose vor ihnen stehen blieb. Er lächelte, wie er da stand und die Vettern, namentlich aber Hans Castorp, betrachtete, und diese feine, etwas spöttische Vertiefung und Kräuselung seines einen Mundwinkels unter dem vollen Schnurrbart, dort, wo er sich in schöner Rundung aufwärts bog, war von eigentümlicher Wirkung, es hielt gewissermaßen zur Geistesklarheit und Wachsamkeit an und ernüchterte den trunkenen Hans Castorp im Augenblick, so daß er sich schämte. Settembrini sagte:
„Die Herren sind aufgeräumt, – mit Grund, mit Grund. Ein prächtiger Morgen! Der Himmel ist blau, die Sonne lacht –“ und er hob mit einem leichten und gelungenen Schwung seines Armes die kleine, gelbliche Hand zum Himmel, während er zugleich einen schrägen, heiteren Blick ebenfalls dort hinaufsandte. „Man könnte in der Tat vergessen, wo man sich befindet.“
Er sprach ohne fremden Akzent, nur an der Genauigkeit seiner Lautbildung hätte man allenfalls den Ausländer erkennen können. Seine Lippen formten die Worte mit einer gewissen Lust. Man hörte ihn mit Vergnügen.
„Und der Herr hat eine angenehme Reise zu uns gehabt?“ wandte er sich an Hans Castorp ... „Ist man schon im Besitz seines Urteils? Ich meine: hat die düstere Zeremonie der ersten Untersuchung schon stattgehabt?“ – Hier hätte er schweigen und warten müssen, wenn es ihm darauf ankam, zu hören; denn er hatte seine Frage gestellt, und Hans Castorp schickte sich an, zu antworten. Aber der Fremde fragte gleich weiter: „Ist sie glimpflich verlaufen? Aus Ihrer Lachlust –“ und er schwieg einen Augenblick, indes die Kräuselung seines Mundwinkels sich vertiefte, „lassen sich ungleichartige Schlüsse ziehen. Wieviel Monate haben unsere Minos und Radamanth Ihnen aufgebrummt?“ – Das Wort „aufgebrummt“ nahm sich in seinem Munde besonders drollig aus. – „Soll ich schätzen? Sechs? Oder gleich neun? Man ist ja nicht knauserig ...“
Hans Castorp lachte erstaunt, wobei er sich zu erinnern suchte, wer Minos und Radamanth doch gleich noch gewesen seien. Er antwortete:
„Aber wieso. Nein, Sie sind im Irrtum, Herr Septem–“
„Settembrini“, verbesserte der Italiener klar und mit Schwung, indem er sich humoristisch verneigte.
„Herr Settembrini, – Verzeihung. Nein, also Sie irren. Ich bin gar nicht krank. Ich besuche nur meinen Vetter Ziemßen auf ein paar Wochen und will mich bei dieser Gelegenheit auch ein bißchen erholen –“
„Potztausend, Sie sind nicht von den Unsrigen? Sie sind gesund, Sie hospitieren hier nur, wie Odysseus im Schattenreich? Welche Kühnheit, hinab in die Tiefe zu steigen, wo Tote nichtig und sinnlos wohnen –“
„In die Tiefe, Herr Settembrini? Da muß ich doch bitten! Ich bin ja rund fünftausend Fuß hoch geklettert zu Ihnen herauf –“
„Das schien Ihnen nur so! Auf mein Wort, das war Täuschung“, sagte der Italiener mit einer entscheidenden Handbewegung. „Wir sind tief gesunkene Wesen, nicht wahr, Leutnant“, wandte er sich an Joachim, der sich über diese Anrede nicht wenig freute, dies aber zu verbergen suchte und besonnen erwiderte:
„Wir sind wohl wirklich etwas versimpelt. Aber man kann sich schließlich wieder zusammenreißen.“
„Ja, Ihnen traue ich’s zu; Sie sind ein anständiger Mensch“, sagte Settembrini. „So, so, so“, sagte er dreimal mit scharfem S, indem er sich wieder gegen Hans Castorp wandte, und schnalzte dann ebensooft mit der Zunge leise am oberen Gaumen. „Sieh, sieh, sieh“, sagte er hierauf, ebenfalls dreimal und mit scharfem S-Laut, indem er dem Neuling so unverwandt ins Gesicht blickte, daß seine Augen in eine fixe und blinde Einstellung gerieten, und fuhr dann, seinen Blick wieder belebend, fort:
„Ganz freiwillig kommen Sie also herauf zu uns Heruntergekommenen und wollen uns einige Zeit das Vergnügen Ihrer Gesellschaft gönnen. Nun, das ist schön. Und welche Frist haben Sie in Aussicht genommen? Ich frage nicht fein. Aber es soll mich doch wundernehmen, zu hören, wieviel man sich zudiktiert, wenn man selbst zu bestimmen hat und nicht Radamanth!“
„Drei Wochen“, sagte Hans Castorp mit etwas eitler Leichtigkeit, da er merkte, daß er beneidet wurde.
„O dio, drei Wochen! Haben Sie gehört, Leutnant? Hat es nicht fast etwas Impertinentes, zu sagen: Ich komme auf drei Wochen hierher und reise dann wieder? Wir kennen das Wochenmaß nicht, mein Herr, wenn ich Sie belehren darf. Unsere kleinste Zeiteinheit ist der Monat. Wir rechnen im großen Stil, – das ist ein Vorrecht der Schatten. Wir haben noch andere, und sie sind alle von ähnlicher Qualität. Darf ich fragen, welchen Beruf Sie ausüben drunten im Leben – oder wohl richtiger: auf welchen Sie sich vorbereiten? Sie sehen, wir legen unserer Neugier keine Fesseln an. Auch die Neugier rechnen wir zu unseren Vorrechten.“
„Bitte recht sehr“, sagte Hans Castorp. Und er gab Auskunft.
„Ein Schiffsbaumeister! Aber das ist großartig!“ rief Settembrini. „Seien Sie überzeugt, daß ich das großartig finde, obgleich meine eigenen Fähigkeiten in anderer Richtung liegen.“
„Herr Settembrini ist Literat“, sagte Joachim erläuternd und etwas verlegen. „Er hat für deutsche Blätter den Nachruf für Carducci geschrieben, – Carducci, weißt du.“ Und er wurde noch verlegener, da sein Vetter ihn verwundert ansah und zu sagen schien: Was weißt denn du von Carducci? Ebenso wenig wie ich, sollte ich meinen.
„Das ist richtig“, sagte der Italiener kopfnickend. „Ich hatte die Ehre, Ihren Landsleuten von dem Leben dieses großen Poeten und Freidenkers zu erzählen, als es abgeschlossen war. Ich kannte ihn, ich darf mich seinen Schüler nennen. In Bologna habe ich zu seinen Füßen gesessen. Ihm verdanke ich, was ich an Bildung und Frohsinn mein eigen nenne. Aber wir sprachen von Ihnen. Ein Schiffsbaumeister! Wissen Sie, daß Sie zusehends emporwachsen in meinen Augen? Sie sitzen da plötzlich, als der Vertreter einer ganzen Welt der Arbeit und des praktischen Genies!“
„Aber Herr Settembrini – ich bin ja eigentlich noch Student und fange erst an.“
„Gewiß, und aller Anfang ist schwer. Überhaupt, alle Arbeit ist schwer, die diesen Namen verdient, nicht wahr?“
„Ja, das weiß der Teufel!“ sagte Hans Castorp, und es kam ihm von Herzen.
Settembrini zog rasch die Brauen empor.
„Sogar den Teufel rufen Sie an,“ sagte er, „um das zu bekräftigen? Den leibhaftigen Satan? Wissen Sie auch, daß mein großer Lehrer eine Hymne an ihn gerichtet hat?“
„Erlauben Sie,“ sagte Hans Castorp, „an den Teufel?“
„An ihn selbst. Sie wird in meiner Heimat zuweilen gesungen, bei festlichen Gelegenheiten. O salute, o Satana, o Ribellione, o forza vindice della Ragione ... Ein herrliches Lied! Aber dieser Teufel war es wohl kaum, den Sie im Sinne hatten, denn er steht mit der Arbeit auf ausgezeichnetem Fuß. Der, den Sie meinten, und der die Arbeit verabscheut, weil er sie zu fürchten hat, ist vermutlich jener andere, von dem es heißt, daß man ihm nicht den kleinen Finger reichen soll –“
Das alles wirkte recht sonderbar auf den guten Hans Castorp. Italienisch verstand er nicht, und das Übrige war ihm auch nicht behaglicher. Es schmeckte nach Sonntagspredigt, obgleich es in leichtem und scherzhaftem Plauderton vorgetragen wurde. Er sah seinen Vetter an, der die Augen niederschlug, und sagte dann:
„Ach, Herr Settembrini, Sie nehmen meine Worte viel zu genau. Das mit dem Teufel war nur so eine Redewendung von mir, ich versichere Sie!“
„Irgend jemand muß Geist haben“, sagte Settembrini, indem er melancholisch in die Luft blickte. Aber sich wieder belebend, erheiternd und anmutig einlenkend fuhr er fort:
„Jedenfalls schließe ich wohl mit Recht aus Ihren Worten, daß Sie da einen ebenso anstrengenden wie ehrenvollen Beruf erwählt haben. Mein Gott, ich bin Humanist, ein homo humanus, ich verstehe nichts von ingeniösen Dingen, so aufrichtig der Respekt ist, den ich Ihnen zolle. Aber vorstellen kann ich mir wohl, daß die Theorie Ihres Faches einen klaren und scharfen Kopf und seine Praxis einen ganzen Mann verlangt, – ist es nicht so?“
„Gewiß ist es so, ja, da kann ich Ihnen unbedingt zustimmen“, antwortete Hans Castorp, indem er sich unwillkürlich bemühte, ein wenig beredt zu sprechen. „Die Anforderungen sind kolossal heutzutage, man darf es sich gar nicht so klar machen, wie scharf sie sind, sonst könnte man wahrhaftig den Mut verlieren. Nein, ein Spaß ist es nicht. Und wenn man nun auch nicht der Stärkste ist ... Ich bin ja hier nur zu Gaste, aber der Stärkste bin ich doch auch nicht gerade, und da müßte ich lügen, wenn ich behaupten wollte, daß mir das Arbeiten so ausgezeichnet bekäme. Vielmehr nimmt es mich ziemlich mit, das muß ich sagen. Recht gesund fühle ich mich eigentlich nur, wenn ich gar nichts tue –“
„Zum Beispiel jetzt?“
„Jetzt? Oh, jetzt bin ich noch so neu hier oben, – etwas verwirrt, können Sie sich denken.“
„Ah, – verwirrt.“
„Ja, ich habe auch nicht ganz richtig geschlafen, und dann war das erste Frühstück wirklich zu ausgiebig ... Ich bin ja ein ordentliches Frühstück gewöhnt, aber das heutige war doch, wie es scheint, zu kompakt für mich, too rich, wie die Engländer sagen. Kurz, ich fühle mich etwas beklommen, und besonders wollte mir heute morgen meine Zigarre nicht schmecken, – denken Sie! Das passiert mir so gut wie nie, nur, wenn ich ernstlich krank bin, – und nun schmeckte sie mir heute wie Leder. Ich mußte sie wegwerfen, es hatte keinen Zweck, daß ich es forcierte. Sind Sie Raucher, wenn ich fragen darf? Nicht? Dann können Sie sich nicht vorstellen, was für ein Ärger und eine Enttäuschung das für jemanden ist, der von Jugend auf so besonders gern raucht, wie ich ...“
„Ich bin ohne Erfahrung auf diesem Gebiet,“ erwiderte Settembrini, „und befinde mich übrigens mit dieser Unerfahrenheit in keiner schlechten Gesellschaft. Eine Reihe von edlen und nüchternen Geistern haben den Rauchtabak verabscheut. Auch Carducci liebte ihn nicht. Aber da werden Sie bei unserem Radamanth Verständnis finden. Er ist ein Anhänger Ihres Lasters.“
„Nun, – Laster, Herr Settembrini ...“
„Warum nicht? Man muß die Dinge mit Wahrheit und Kraft bezeichnen. Das verstärkt und erhöht das Leben. Auch ich habe Laster.“
„Und Hofrat Behrens ist also Zigarrenkenner? Ein reizender Mann.“
„Sie finden? Ah, Sie haben also schon seine Bekanntschaft gemacht?“
„Ja, vorhin, als wir fortgingen. Es war beinahe so etwas wie eine Konsultation, aber sine pecunia, wissen Sie. Er sah gleich, daß ich ziemlich anämisch bin. Und dann riet er mir, hier ganz so zu leben, wie mein Vetter, viel auf dem Balkon zu liegen, und messen soll ich mich auch gleich mit, hat er gesagt.“
„Wahrhaftig?“ rief Settembrini ... „Vorzüglich!“ rief er nach oben in die Luft hinein, indem er sich lachend zurückneigte. „Wie heißt es doch in der Oper Ihres Meisters? ‚Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heisa, hopsassa!‘ Kurz, das ist sehr amüsant. Sie werden seinen Rat befolgen? Zweifelsohne. Wie sollten Sie nicht. Ein Satanskerl, dieser Radamanth! Und wirklich ‚stets lustig‘, wenn auch zuweilen ein wenig gezwungen. Er neigt zur Schwermut. Sein Laster bekommt ihm nicht – sonst wäre es übrigens kein Laster –, der Rauchtabak macht ihn schwermütig, – weshalb unsere verehrungswürdige Frau Oberin die Vorräte in Verwahrung genommen hat und ihm nur kleine Tagesrationen zuteilt. Es soll vorkommen, daß er der Versuchung unterliegt, sie zu bestehlen, und dann verfällt er der Schwermut. Mit einem Wort: eine verworrene Seele. Sie kennen auch unsere Oberin schon? Nicht? Aber das ist ein Fehler! Sie tun unrecht, sich nicht um ihre Bekanntschaft zu bewerben. Aus dem Geschlechte derer von Mylendonk, mein Herr! Von der mediceischen Venus unterscheidet sie sich dadurch, daß sie dort, wo sich bei der Göttin der Busen befindet, ein Kreuz zu tragen pflegt ...“
„Ha, ha, ausgezeichnet!“ lachte Hans Castorp.
„Mit Vornamen heißt sie Adriatica.“
„Auch das noch?“ rief Hans Castorp ... „Hören Sie, das ist merkwürdig! Von Mylendonk und dann Adriatica. Es klingt, als müßte sie längst gestorben sein. Geradezu mittelalterlich mutet es an.“
„Mein geehrter Herr,“ antwortete Settembrini, „hier gibt es manches, was ‚mittelalterlich anmutet‘, wie Sie sich auszudrücken belieben. Ich für meine Person bin überzeugt, daß unser Radamanth einzig und allein aus künstlerischem Stilgefühl dieses Petrefakt zur Oberaufseherin seines Schreckenspalastes gemacht hat. Er ist nämlich Künstler, – das wissen Sie nicht? Er malt in Öl. Was wollen Sie, das ist nicht verboten, nicht wahr, es steht jedem frei ... Frau Adriatica sagt es jedem, der es hören will, und den andern auch, daß eine Mylendonk Mitte des dreizehnten Jahrhunderts Äbtissin eines Stiftes zu Bonn am Rheine war. Sie selbst kann nicht lange nach diesem Zeitpunkt das Licht der Welt erblickt haben ...“
„Ha, ha, ha! Ich finde Sie aber spöttisch, Herr Settembrini.“
„Spöttisch? Sie meinen: boshaft. Ja, boshaft bin ich ein wenig –“, sagte Settembrini. „Mein Kummer ist, daß ich verurteilt bin, meine Bosheit an so elende Gegenstände zu verschwenden. Ich hoffe, Sie haben nichts gegen die Bosheit, Ingenieur? In meinen Augen ist sie die glänzendste Waffe der Vernunft gegen die Mächte der Finsternis und der Häßlichkeit. Bosheit, mein Herr, ist der Geist der Kritik, und Kritik bedeutet den Ursprung des Fortschrittes und der Aufklärung.“ Und im Nu begann er von Petrarca zu reden, den er den „Vater der Neuzeit“ nannte.
„Wir müssen nun aber in die Liegekur“, sagte Joachim besonnen.
Der Literat hatte seine Worte mit anmutigen Handbewegungen begleitet. Nun rundete er dies Gestenspiel mit einer Gebärde ab, die auf Joachim hinwies, und sagte:
„Unser Leutnant treibt zum Dienst. Gehen wir also. Wir haben den gleichen Weg, – ‚rechtshin, welcher zu Dis, des Gewaltigen, Mauern hinanstrebt‘. Ah, Virgil, Virgil! Meine Herren, er ist unübertroffen. Ich glaube an den Fortschritt, gewiß. Aber Virgil verfügt über Beiwörter, wie kein Moderner sie hat ...“ Und während sie sich auf den Heimweg machten, fing er an, lateinische Verse in italienischer Aussprache vorzutragen, unterbrach sich jedoch, als irgendein junges Mädchen, eine Tochter des Städtchens, wie es schien, und durchaus nicht sonderlich hübsch, ihnen entgegenkam, und verlegte sich auf ein schwerenöterhaftes Lächeln und Trällern. „T, t, t“, schnalzte er. „Ei, ei, ei! La, la, la! Du süßes Käferchen, willst du die Meine sein? Seht doch, ‚es funkelt ihr Auge in schlüpfrigem Licht‘“, zitierte er – Gott wußte, was es war – und sandte dem verlegenen Rücken des Mädchens eine Kußhand nach.
Das ist ja ein rechter Windbeutel, dachte Hans Castorp, und dabei blieb er auch, als Settembrini nach seiner galanten Anwandlung wieder zu medisieren begann. Hauptsächlich hatte er es auf Hofrat Behrens abgesehen, stichelte auf den Umfang seiner Füße und hielt sich bei seinem Titel auf, den er von einem an Gehirntuberkulose leidenden Prinzen erhalten habe. Von dem skandalösen Lebenswandel dieses Prinzen spreche noch heute die ganze Gegend, aber Radamanth habe ein Auge zugedrückt, beide Augen, jeder Zoll ein Hofrat. Ob die Herren übrigens wußten, daß er der Erfinder der Sommersaison sei? Ja, er, und kein anderer. Dem Verdienste seine Krone. Früher hätten im Sommer nur die Treuesten der Treuen in diesem Tale ausgeharrt. Da habe „unser Humorist“ mit unbestechlichem Scharfblick erkannt, daß dieser Mißstand nichts als die Frucht eines Vorurteils sei. Er habe die Lehre aufgestellt, daß, wenigstens so weit sein Institut in Frage komme, die sommerliche Kur nicht nur nicht weniger empfehlenswert, sondern sogar besonders wirksam und geradezu unentbehrlich sei. Und er habe dieses Theorem unter die Leute zu bringen gewußt, habe populäre Artikel darüber verfaßt und sie in die Presse lanciert. Seitdem gehe das Geschäft im Sommer so flott wie im Winter. „Genie!“ sagte Settembrini. „In-tu-i-tion!“ sagte er. Und dann hechelte er die übrigen Heilanstalten des Platzes durch und lobte auf beißende Art den Erwerbssinn ihrer Inhaber. Da sei Professor Kafka ... Alljährlich, zur kritischen Zeit der Schneeschmelze, wenn viele Patienten abzureisen verlangten, finde Professor Kafka sich gezwungen, rasch noch auf acht Tage zu verreisen, wobei er verspreche, nach seiner Rückkehr die Entlassungen vorzunehmen. Dann aber bleibe er sechs Wochen aus, und die Ärmsten warteten, wobei sich, am Rande bemerkt, ihre Rechnungen vergrößerten. Bis nach Fiume lasse man Kafka kommen, er aber reise nicht, bevor man fünftausend gute Schweizer Franken sichergestellt, worüber vierzehn Tage vergingen. Einen Tag nach der Ankunft des Celebrissimo sterbe alsdann der Kranke. Was Doktor Salzmann betreffe, so sage er dem Professor Kafka nach, daß er seine Spritzen nicht rein genug halte und den Kranken Mischinfektionen beibringe. Er fahre auf Gummi, sage Salzmann, damit seine Toten ihn nicht hörten, – wogegen wiederum Kafka behaupte, bei Salzmann werde den Patienten „des Rebstocks erheiternde Gabe“ in solchen Mengen aufgenötigt – nämlich ebenfalls behufs Abrundung ihrer Rechnungen –, daß die Leute wie die Fliegen stürben, und zwar nicht an Phthise, sondern an Trinkerleber ...
So ging es weiter, und Hans Castorp lachte herzlich und gutmütig über diesen Sturzbach zungenfertiger Lästerungen. Die Suade des Italieners lautete eigentümlich angenehm in ihrer unbedingten, von jeder Mundart freien Reinheit und Richtigkeit. Die Worte kamen prall, nett und wie neuschaffen von seinen beweglichen Lippen, er genoß die gebildeten, bissig behenden Wendungen und Formen, deren er sich bediente, ja selbst die grammatische Beugung und Abwandlung der Wörter mit einem offensichtlichen, sich mitteilenden und heiter stimmenden Behagen und schien viel zu klaren und gegenwärtigen Geistes, um sich auch nur ein einziges Mal zu versprechen.
„Sie sprechen so drollig, Herr Settembrini,“ sagte Hans Castorp, „so lebhaft, – ich weiß nicht, wie ich es nennen soll.“
„Plastisch, wie?“ entgegnete der Italiener und fächelte sich mit dem Taschentuch, obgleich es ja eher kühl war. „Das wird das Wort sein, das Sie suchen. Ich habe eine plastische Art zu sprechen, wollen Sie sagen. Aber halt!“ rief er. „Was sehe ich! Dort wandeln unsere Höllenrichter! Welch ein Anblick!“
Die Spaziergänger hatten die Wegbiegung schon wieder zurückgelegt. War es den Reden Settembrinis, dem Gefälle der Straße zu danken, oder hatten sie sich in Wahrheit weniger weit vom Sanatorium entfernt, als Hans Castorp geglaubt hatte, – denn ein Weg, den wir zum ersten Male gehen, ist bedeutend länger als derselbe, wenn wir ihn schon kennen –: jedenfalls war der Rückmarsch überraschend geschwind vonstatten gegangen. Settembrini hatte recht, es war das Ärztepaar, das dort unten auf dem freien Platz die Rückseite des Sanatoriums entlang strebte, voran der Hofrat im weißen Kittel, mit heraustretendem Genick und die Hände wie Ruder bewegend, auf seiner Fährte Dr. Krokowski im schwarzen Überhemd und desto selbstbewußter um sich blickend, als der klinische Brauch ihn nötigte, sich auf Dienstgängen hinter dem Chef zu halten.
„Ah, Krokowski!“ rief Settembrini. „Dort geht er und weiß alle Geheimnisse unserer Damen. Man bittet, die feine Symbolik seiner Kleidung zu beachten. Er trägt sich schwarz, um anzudeuten, daß sein eigenstes Studiengebiet die Nacht ist. Dieser Mann hat in seinem Kopf nur einen Gedanken, und der ist schmutzig. Ingenieur, wie kommt es, daß wir von ihm noch gar nicht gesprochen haben! Sie haben seine Bekanntschaft gemacht?“
Hans Castorp bejahte.
„Nun, und? Ich fange an, zu vermuten, daß auch er Ihnen gefallen hat.“
„Ich weiß wirklich nicht, Herr Settembrini. Ich bin ihm nur erst flüchtig begegnet. Und dann bin ich auch nicht sehr rasch von Urteil. Ich sehe mir die Leute an und denke: So bist du also? Nun gut.“
„Das ist Dumpfsinn!“ antwortete der Italiener. „Urteilen Sie! Dafür hat die Natur Ihnen Augen und Verstand gegeben. Sie fanden, ich spräche boshaft; aber wenn ich es tat, so geschah es vielleicht nicht ohne pädagogische Absicht. Wir Humanisten haben alle eine pädagogische Ader ... Meine Herren, der historische Zusammenhang von Humanismus und Pädagogik beweist ihren psychologischen. Man soll dem Humanisten das Amt der Erziehung nicht nehmen, – man kann es ihm nicht nehmen, denn nur bei ihm ist die Überlieferung von der Würde und Schönheit des Menschen. Einst löste er den Priester ab, der sich in trüben und menschenfeindlichen Zeiten die Führung der Jugend anmaßen durfte. Seitdem, meine Herren, ist schlechterdings kein neuer Erziehertyp mehr erstanden. Das humanistische Gymnasium, – nennen Sie mich rückschrittlich, Ingenieur, aber grundsätzlich, in abstracto, ich bitte, mich wohl zu verstehen, bleibe ich sein Anhänger ...“
Noch im Lift führte er dies weiter aus und verstummte erst, als die Vettern im zweiten Stockwerk den Aufzug verließen. Er selber fuhr bis zum dritten weiter, wo er, wie Joachim erzählte, ein kleines Zimmer nach hinten hinaus bewohnte.
„Er hat wohl kein Geld?“ fragte Hans Castorp, der Joachim begleitete. Es sah bei Joachim genau so aus wie drüben bei ihm.
„Nein,“ sagte Joachim, „das hat er wohl nicht. Oder doch nur gerade so viel, um den Aufenthalt hier bestreiten zu können. Sein Vater war auch schon Literat, weißt du, und ich glaube, der Großvater auch.“
„Ja, dann“, sagte Hans Castorp. „Ist er denn eigentlich ernsthaft krank?“
„Es ist nicht gefährlich, soviel ich weiß, aber hartnäckig und kommt immer wieder. Er hat es schon seit Jahren und war zwischendurch mal fort, mußte aber bald wieder einrücken.“
„Armer Kerl! Wo er doch so fürs Arbeiten zu schwärmen scheint. Riesig gesprächig ist er dabei, so leicht kommt er von einem aufs andere. Mit dem Mädchen war er ja etwas frech, es genierte mich momentan. Aber was er nachher von der menschlichen Würde sagte, klang doch famos, ganz wie bei einem Festakt. Bist du denn öfter mit ihm zusammen?“
Aber Joachim konnte nur noch behindert und undeutlich antworten. Er hatte aus einem rotledernen, mit Samt gefütterten Etui, das auf seinem Tische lag, ein kleines Thermometer genommen und das untere, mit Quecksilber gefüllte Ende in den Mund gesteckt. Links unter der Zunge hielt er es, so, daß ihm das gläserne Instrument schräg aufwärts aus dem Munde hervorragte. Dann machte er Haustoilette, zog Schuhe und eine litewkaartige Joppe an, nahm eine gedruckte Tabelle nebst Bleistift vom Tisch, ferner ein Buch, eine russische Grammatik – denn er trieb Russisch, weil er, wie er sagte, dienstlichen Vorteil davon erhoffte –, und so ausgerüstet nahm er draußen auf dem Balkon im Liegestuhl Platz, indem er eine Kamelhaardecke nur leicht über die Füße warf.
Sie war kaum nötig: schon während der letzten Viertelstunde war die Wolkenschicht dünner und dünner geworden, und die Sonne brach durch, so sommerlich warm und blendend, daß Joachim seinen Kopf mit einem weißleinenen Schirm schützte, der vermittelst einer kleinen, sinnreichen Vorrichtung an der Armlehne des Stuhles zu befestigen und dem Stande der Sonne nach zu verstellen war. Hans Castorp lobte diese Erfindung. Er wollte das Ergebnis der Messung abwarten und sah unterdessen zu, wie alles gemacht wurde, betrachtete auch den Pelzsack, der in einem Winkel der Loggia lehnte (Joachim bediente sich seiner an kalten Tagen) und blickte, die Ellenbogen auf der Brüstung, in den Garten hinab, wo die allgemeine Liegehalle nun von lesend, schreibend und plaudernd ausgestreckten Patienten bevölkert war. Übrigens sah man nur einen Teil des Inneren, etwa fünf Stühle.
„Aber wie lange dauert denn das?“ fragte Hans Castorp und wandte sich um.
Joachim hob sieben Finger empor.
„Die müssen doch um sein – sieben Minuten!“
Joachim schüttelte den Kopf. Etwas später nahm er das Thermometer aus dem Mund, betrachtete es und sagte dabei:
„Ja, wenn man ihr aufpaßt, der Zeit, dann vergeht sie sehr langsam. Ich habe das Messen, viermal am Tage, ordentlich gern, weil man doch dabei merkt, was das eigentlich ist: eine Minute oder gar ganze sieben, – wo man sich hier die sieben Tage der Woche so gräßlich um die Ohren schlägt.“
„Du sagst ‚eigentlich‘. ‚Eigentlich‘ kannst du nicht sagen“, entgegnete Hans Castorp. Er saß mit einem Schenkel auf der Brüstung, und das Weiße seiner Augen war rot geädert. „Die Zeit ist doch überhaupt nicht ‚eigentlich‘. Wenn sie einem lang vorkommt, so ist sie lang, und wenn sie einem kurz vorkommt, so ist sie kurz, aber wie lang oder kurz sie in Wirklichkeit ist, das weiß doch niemand.“ Er war durchaus nicht gewohnt, zu philosophieren und fühlte dennoch den Drang dazu.
Joachim widersprach.
„Wieso denn. Nein. Wir messen sie doch. Wir haben doch Uhren und Kalender, und wenn ein Monat um ist, dann ist er für dich und mich und uns alle um.“
„Dann paß auf“, sagte Hans Castorp und hielt sogar den Zeigefinger neben seine trüben Augen. „Eine Minute ist also so lang, wie sie dir vorkommt, wenn du dich mißt?“
„Eine Minute ist so lang ... sie dauert so lange, wie der Sekundenzeiger braucht, um seinen Kreis zu beschreiben.“
„Aber er braucht ja ganz verschieden lange – für unser Gefühl! Und tatsächlich ... ich sage: tatsächlich genommen“, wiederholte Hans Castorp und drückte den Zeigefinger so fest gegen die Nase, daß er ihre Spitze vollständig umbog, „ist das eine Bewegung, eine räumliche Bewegung, nicht wahr? Halt, warte! Wir messen also die Zeit mit dem Raume. Aber das ist doch ebenso, als wollten wir den Raum an der Zeit messen, – was doch nur ganz unwissenschaftliche Leute tun. Von Hamburg nach Davos sind zwanzig Stunden, – ja, mit der Eisenbahn. Aber zu Fuß, wie lange ist es da? Und in Gedanken? Keine Sekunde!“
„Hör mal,“ sagte Joachim, „was hast du denn? Ich glaube, es greift dich an hier bei uns?“
„Sei still! Ich bin sehr scharf im Kopf heute. Was ist denn die Zeit?“ fragte Hans Castorp und bog seine Nasenspitze so gewaltsam zur Seite, daß sie weiß und blutleer wurde. „Willst du mir das mal sagen? Den Raum nehmen wir doch mit unseren Organen wahr, mit dem Gesichtssinn und dem Tastsinn. Schön. Aber welches ist denn unser Zeitorgan? Willst du mir das mal eben angeben? Siehst du, da sitzst du fest. Aber wie wollen wir denn etwas messen, wovon wir genau genommen rein gar nichts, nicht eine einzige Eigenschaft auszusagen wissen! Wir sagen: die Zeit läuft ab. Schön, soll sie also mal ablaufen. Aber um sie messen zu können ... warte! Um meßbar zu sein, müßte sie doch gleichmäßig ablaufen, und wo steht denn das geschrieben, daß sie das tut? Für unser Bewußtsein tut sie es nicht, wir nehmen es nur der Ordnung halber an, daß sie es tut, und unsere Maße sind doch bloß Konvention, erlaube mir mal ...“
„Gut,“ sagte Joachim, „dann ist es wohl auch bloß Konvention, daß ich hier vier Striche zuviel habe auf meinem Thermometer! Aber wegen dieser fünf Striche muß ich mich hier herumräkeln und kann nicht Dienst machen, das ist eine ekelhafte Tatsache!“
„Hast du 37,5?“
„Es geht schon wieder herunter.“ Und Joachim machte die Eintragung in seine Tabelle. „Gestern abend waren es fast 38, das machte deine Ankunft. Alle, die Besuch bekommen, haben Erhöhung. Aber es ist doch eine Wohltat.“
„Ich gehe ja nun auch“, sagte Hans Castorp. „Ich habe noch eine Menge Gedanken über die Zeit im Kopf, – es ist ein ganzer Komplex, kann ich wohl sagen. Aber ich will dich jetzt nicht damit aufregen, da du sowieso zuviel Striche hast. Ich werde es schon alles behalten, und wir können später darauf zurückkommen, vielleicht nach dem Frühstück. Wenn es Frühstückszeit ist, rufst du mich wohl. Ich gehe jetzt auch in die Liegekur, es tut ja nicht weh, gottlob.“ Und damit ging er an der gläsernen Scheidewand vorbei in seine eigene Loge hinüber, wo gleichfalls ein Liegestuhl nebst Tischchen aufgeschlagen war, holte sich „Ocean steamships“ und sein schönes, weiches, dunkelrot und grün gewürfeltes Plaid aus dem reinlich aufgeräumten Zimmer und ließ sich nieder.
Auch er mußte sehr bald den Schirm aufspannen; sowie man lag, wurde der Sonnenbrand unerträglich. Man lag aber ganz ungewöhnlich bequem, das stellte Hans Castorp sogleich mit Vergnügen fest, – er erinnerte sich nicht, daß ihm je ein so angenehmer Liegestuhl vorgekommen sei. Das Gestell, ein wenig altmodisch in der Form – was aber nur eine Geschmacksspielerei war, denn der Stuhl war offenbar neu –, bestand aus rotbraun poliertem Holz, und eine Matratze mit weichem, kattunartigen Überzug, eigentlich aus drei hohen Polstern zusammengesetzt, reichte vom Fußende bis über die Rückenlehne hinauf. Außerdem war vermittelst einer Schnur eine weder zu feste noch zu nachgiebige Nackenrolle mit gesticktem Leinenüberzug daran befestigt, die von besonders wohltuender Wirkung war. Hans Castorp stützte einen Arm auf die breite, glatte Fläche der Seitenlehne, blinzelte und ruhte, ohne „Ocean steamships“ zu seiner Unterhaltung in Anspruch zu nehmen. Durch die Bögen der Loggia gesehen, wirkte die harte und karge, aber hell besonnte Landschaft draußen gemäldeartig und wie eingerahmt. Hans Castorp betrachtete sie gedankenvoll. Plötzlich fiel ihm etwas ein, und er sagte laut in der Stille:
„Es war ja eine Zwergin, die uns beim ersten Frühstück bediente.“
„Pst“, machte Joachim. „Leise doch. Ja, eine Zwergin. Und?“
„Nichts. Wir hatten uns noch gar nicht darüber ausgesprochen.“
Und dann träumte er weiter. Es war schon zehn Uhr gewesen, als er sich niedergelegt hatte. Eine Stunde verging. Es war eine gewöhnliche Stunde, nicht lang, nicht kurz. Als sie verflossen war, tönte ein Gong durch Haus und Garten, erst fern, dann näher, dann wieder fern.
„Frühstück“, sagte Joachim, und man hörte, daß er aufstand.
Auch Hans Castorp beendete für diesmal die Liegekur und ging ins Zimmer, um sich ein wenig zurechtzumachen. Die Vettern trafen sich auf dem Korridor und gingen hinunter. Hans Castorp sagte:
„Nun, es lag sich ja ausgezeichnet. Was sind denn das für Stühle? Wenn es die hier zu kaufen gibt, dann nehme ich mir einen mit nach Hamburg, man liegt ja darauf wie im Himmel. Oder meinst du, daß Behrens sie eigens nach seinen Angaben hat anfertigen lassen?“
Joachim wußte das nicht. Sie legten ab und betraten zum zweiten Male den Speisesaal, wo die Mahlzeit schon wieder in vollem Gange war.
Es schimmerte weiß im Saale vor lauter Milch: an jedem Platz stand ein großes Glas, wohl ein halber Liter voll.
„Nein“, sagte Hans Castorp, als er wieder an seinem Tischende zwischen der Nähterin und der Engländerin Platz genommen und ergeben seine Serviette entfaltet hatte, obgleich er noch so schwer belastet vom ersten Frühstück war. „Nein,“ sagte er, „Gott steh mir bei, Milch kann ich überhaupt nicht trinken und am wenigsten jetzt. Ist nicht vielleicht Porter da?“ Und er wandte sich zuerst höflich und zart an die Zwergin mit dieser Frage. Leider war keiner da. Aber sie versprach, Kulmbacher Bier zu bringen und brachte es auch. Es war dick, schwarz, braunschaumig und ersetzte den Porter aufs beste. Hans Castorp trank durstig davon aus einem hohen Halbliterglase. Er aß kalten Aufschnitt dazu auf Röstbrot. Wieder war Haferbrei aufgestellt und wieder viel Butter und Obst. Er ließ wenigstens seine Augen darauf ruhen, da er nicht fähig war, sich davon zuzuführen. Auch betrachtete er die Gästeschaft, – die Massen begannen sich für ihn zu teilen; Einzelpersonen traten hervor.
Sein eigener Tisch war komplett, bis auf den oberen Platz ihm gegenüber, welcher, wie er sich belehren ließ, der Doktorplatz war. Denn die Ärzte, wenn ihre Zeit es irgend erlaubte, beteiligten sich an den gemeinsamen Mahlzeiten und wechselten dabei die Tische: an einem jeden war zu oberst ein solcher Doktorplatz freigehalten. Jetzt war keiner von beiden anwesend; man sagte, sie seien bei einer Operation. Wieder kam der junge Mann mit dem Schnurrbart herein, senkte einmal das Kinn auf die Brust und setzte sich mit sorgenvoll-verschlossener Miene. Wieder saß die Hellblonde, Magere an ihrem Platze und löffelte Yoghurt, als ob dies ihre einzige Speise wäre. Neben ihr saß diesmal eine kleine, muntere alte Dame, die in russischer Zunge auf den stillen jungen Mann einredete, der sie sorgenvoll anblickte und nicht anders als mit Kopfnicken antwortete, wobei er jenes Gesicht machte, als habe er etwas Schlechtschmeckendes im Munde. Ihm gegenüber, an der anderen Seite der alten Dame, war ein weiteres junges Mädchen placiert, – hübsch war sie, von blühender Gesichtsfarbe und hoher Brust, mit kastanienbraunem, angenehm wellig geordnetem Haar, runden, braunen, kindlichen Augen und einem kleinen Rubin an ihrer schönen Hand. Sie lachte viel und sprach ebenfalls Russisch, nur Russisch. Sie hieß Marusja, wie Hans Castorp hörte. Ferner bemerkte er beiläufig, daß Joachim mit strengem Ausdruck die Augen niederschlug, wenn sie lachte und sprach.
Settembrini erschien durch den Seiteneingang und schritt schnurrbartkräuselnd zu seinem Platze, der am Ende des Tisches gelegen war, der schräg vor demjenigen Hans Castorps stand. Seine Tischgenossen brachen in schallendes Lachen aus, als er sich niedersetzte; wahrscheinlich hatte er eine Bosheit gesagt. Auch die Mitglieder des „Vereins Halbe Lunge“ erkannte Hans Castorp wieder. Hermine Kleefeld schob mit dummen Augen zu ihrem Tische dort drüben vor der einen Verandatür und begrüßte den wulstlippigen Jüngling, der vorhin so unschicklich seine Jacke emporgerafft hatte. Die elfenbeinfarbene Levi saß neben der fetten und leberfleckigen Iltis unter Unbekannten an dem querstehenden Tische rechts von Hans Castorp.
„Da sind deine Nachbarn“, sagte Joachim leise zu seinem Vetter, indem er sich vorneigte ... Das Paar ging dicht an Hans Castorp vorbei zu dem letzten Tisch rechts, dem „Schlechten Russentisch“ also, wo schon eine Familie mit einem häßlichen Knaben große Haufen Porridge verschlang. Der Mann war schmächtig gebaut und hatte graue und hohle Wangen. Er trug eine braune Lederjoppe und an den Füßen plumpe Filzstiefel mit Spangenverschluß. Seine Ehefrau, ebenfalls klein und zierlich, in wippendem Federhut, trippelte auf winzigen, hochgestöckelten Juchtenstiefelchen; eine unsaubere Boa aus Vogelfedern lag um ihren Hals. Hans Castorp betrachtete die beiden mit einer Rücksichtslosigkeit, die ihm sonst fremd war und die er selbst als brutal empfand; doch war es eben das Brutale daran, das ihm plötzlich ein gewisses Vergnügen verursachte. Seine Augen waren zugleich stumpf und zudringlich. Als in demselben Augenblick die Glastür zur Linken zufiel, schmetternd und klirrend, wie beim ersten Frühstück, zuckte er nicht zusammen wie heute früh, sondern schnitt nur eine träge Grimasse; und als er den Kopf nach jener Seite wenden wollte, fand er, daß ihm dies allzu schwer falle und daß es die Mühe nicht lohne. So kam es, daß er auch diesmal nicht zu der Feststellung gelangte, wer mit der Tür denn so liederlich umgehe.
Die Sache war die, daß das Frühstücksbier, sonst nur von mäßig benebelnder Wirkung auf seine Natur, den jungen Mann heute vollständig betäubte und lähmte, – es zeitigte Folgen, als hätte er einen Schlag vor die Stirn bekommen. Seine Lider waren wie Blei so schwer, die Zunge gehorchte dem einfachen Gedanken nicht recht, als er aus Artigkeit mit der Engländerin zu plaudern versuchte; auch nur die Richtung des Blicks zu verändern, erforderte große Selbstüberwindung, und hinzu kam, daß der abscheuliche Gesichtsbrand den gestrigen Grad nun wieder vollauf erreicht hatte: seine Wangen schienen ihm gedunsen vor Hitze, er atmete schwer, sein Herz pochte wie ein umwickelter Hammer, und wenn er unter all dem nicht sonderlich litt, so war es deshalb, weil sein Kopf sich in einem Zustand befand, als habe er zwei oder drei Atemzüge von Chloroform getan. Daß Dr. Krokowski doch noch beim Frühstück erschien und an seiner Tafel, ihm gegenüber, Platz nahm, bemerkte er nur traumweise, obgleich der Doktor ihn wiederholentlich scharf ins Auge faßte, während er mit den Damen zu seiner Rechten russisch konversierte, – wobei die jungen Mädchen, nämlich die blühende Marusja sowohl wie auch die magere Yoghurtesserin, unterwürfig und schamhaft die Augen vor ihm niederschlugen. Übrigens hielt Hans Castorp sich redlich, wie sich von selbst versteht, schwieg, da seine Zunge sich widerspenstig zeigte, lieber still und handhabte Messer und Gabel sogar mit besonderem Anstand. Als sein Vetter ihm zunickte und sich erhob, stand er ebenfalls auf, verneigte sich blind gegen die Tischgenossen und ging bestimmten Schrittes hinter Joachim hinaus.
„Wann ist denn wieder Liegekur?“ fragte er, als sie das Haus verließen. „Das ist das Beste hier, soviel ich sehe. Ich wollte, ich läge schon wieder auf meinem vorzüglichen Stuhl. Gehen wir weit spazieren?“
„Nein,“ sagte Joachim, „weit darf ich ja gar nicht gehen. Um diese Zeit gehe ich immer ein bißchen hinunter, durchs Dorf und bis Platz, wenn ich Zeit habe. Man sieht Läden und Leute und kauft ein, was man braucht. Man liegt vor Tische noch eine Stunde, und dann liegt man wieder bis vier Uhr, sei ganz unbesorgt.“
Sie gingen im Sonnenschein die Anfahrt hinab und überschritten den Wasserlauf und das schmale Geleise, die Berggestalten der rechten Tallehne vor Augen: das „Kleine Schiahorn“, die „Grünen Türme“ und den „Dorfberg“, die Joachim bei Namen nannte. Dort drüben, in einiger Höhe, lag der ummauerte Friedhof von Davos-Dorf, – auf diesen ebenfalls wies Joachim mit seinem Stocke hin. Und sie gewannen die Hauptstraße, die um ein Stockwerk über die Talsohle erhöht, die terrassierte Lehne entlang führte.
Von einem Dorf konnte übrigens nicht gut die Rede sein; jedenfalls war nichts davon als der Name übrig. Der Kurort hatte es aufgezehrt, indem er sich immerfort gegen den Taleingang hin ausdehnte, und der Teil der gesamten Siedelung, welcher „Dorf“ hieß, ging unmerklich und ohne Unterschied in den als „Davos Platz“ bezeichneten über. Hotels und Pensionen, alle mit gedeckten Veranden, Balkons und Liegehallen reichlich versehen, auch kleine Privathäuser, in denen Zimmer zu vermieten waren, lagen zu beiden Seiten; hier und da kamen Neubauten; manchmal setzte auch die Bebauung aus, und die Straße gewährte den Blick in die offenen Wiesengründe des Tals ...
Hans Castorp, in seinem Verlangen nach dem gewohnten, geliebten Lebensreiz, hatte sich wieder eine Zigarre angezündet, und wahrscheinlich dank dem vorangegangenen Biere vermochte er zu seiner unaussprechlichen Genugtuung hier und da etwas von dem ersehnten Aroma zu verspüren: nur selten und schwach freilich, – es war eine gewisse nervöse Anstrengung nötig, um eine Ahnung des Vergnügens zu empfangen, und der abscheuliche Ledergeschmack herrschte bei weitem vor. Unfähig, sich in seine Ohnmacht zu finden, rang er eine Weile nach dem Genuß, der sich ihm entweder versagte oder nur spottend ahnungsweise von ferne zeigte, und warf die Zigarre endlich ermüdet und angewidert fort. Trotz seiner Benommenheit fühlte er die Höflichkeitsverpflichtung, Konversation zu machen, und suchte sich zu diesem Zwecke der ausgezeichneten Dinge zu erinnern, die er vorhin über die „Zeit“ zu sagen gehabt hatte. Allein es erwies sich, daß er den ganzen „Komplex“ ohne Rest vergessen hatte und über die Zeit auch nicht den geringsten Gedanken mehr in seinem Kopfe beherbergte. Dafür begann er von körperlichen Angelegenheiten zu reden, und zwar etwas sonderbar.
„Wann mißt du dich denn wieder?“ fragte er. „Nach dem Essen? Ja, das ist gut. Da ist der Organismus in voller Tätigkeit, da muß es sich zeigen. Daß Behrens von mir verlangte, ich sollte mich ebenfalls messen, das war doch wohl nur Spaß, höre mal, – Settembrini lachte ja auch aus vollem Halse darüber, es hätte doch absolut keinen Sinn. Ich habe ja auch nicht mal ein Thermometer.“
„Nun,“ sagte Joachim, „das wäre das wenigste. Du brauchst dir nur einen zu kaufen. Hier sind überall Thermometer zu haben, beinahe in jedem Laden.“
„Aber wozu denn! Nein, die Liegekur, die lasse ich mir gefallen, die will ich wohl mitmachen, aber das Messen wäre zuviel für einen Hospitanten, das überlasse ich denn doch lieber euch hier oben. Wenn ich nur wüßte,“ fuhr Hans Castorp fort, indem er beide Hände zum Herzen führte wie ein Verliebter, „warum ich die ganze Zeit solches Herzklopfen habe, – es ist so beunruhigend, ich denke schon länger darüber nach. Siehst du, man hat Herzklopfen, wenn einem eine ganz besondere Freude bevorsteht oder wenn man sich ängstigt, kurz, bei Gemütsbewegungen, nicht? Aber wenn einem das Herz nun ganz von selber klopft, grundlos und sinnlos und sozusagen auf eigene Hand, das finde ich geradezu unheimlich, versteh mich recht, es ist ja so, als ob der Körper seine eigenen Wege ginge und keinen Zusammenhang mit der Seele mehr hätte, gewissermaßen wie ein toter Körper, der ja auch nicht wirklich tot ist – das gibt es gar nicht –, sondern sogar ein sehr lebhaftes Leben führt, nämlich auf eigene Hand: es wachsen ihm noch die Haare und Nägel, und auch sonst soll physikalisch und chemisch, wie ich mir habe sagen lassen, ein überaus munterer Betrieb darin herrschen ...“
„Was sind denn das für Ausdrücke“, sagte Joachim besonnen verweisend. „Ein munterer Betrieb!“ Und vielleicht rächte er sich damit ein wenig für den Verweis, den er heute früh wegen des „Schellenbaums“ erhalten.
„Aber es ist doch so! Es ist ein sehr munterer Betrieb! Warum nimmst du denn Anstoß daran?“ fragte Hans Castorp. „Übrigens erwähnte ich das nur nebenbei. Ich wollte nichts weiter sagen, als: es ist unheimlich und quälend, wenn der Körper auf eigene Hand und ohne Zusammenhang mit der Seele lebt und sich wichtig macht, wie bei solchem unmotivierten Herzklopfen. Man sucht förmlich nach einem Sinn dafür, einer Gemütsbewegung, die dazu gehört, einem Gefühl der Freude oder der Angst, wodurch es sozusagen gerechtfertigt würde, – so geht es wenigstens mir, ich kann nur von mir reden.“
„Ja, ja,“ sagte Joachim seufzend, „es ist wohl so ähnlich, wie wenn man Fieber hat – dabei herrscht auch ein besonders ‚munterer Betrieb‘ im Körper, um deinen Ausdruck zu gebrauchen, und da mag es schon sein, daß man sich unwillkürlich nach einer Gemütsbewegung umsieht, wie du sagst, wodurch der Betrieb einen halbwegs vernünftigen Sinn bekommt ... Aber wir reden so unangenehmes Zeug“, sagte er mit bebender Stimme und brach ab; worauf Hans Castorp nur mit den Achseln zuckte, und zwar ganz so, wie er es gestern abend zuerst bei Joachim gesehen hatte.
Sie gingen eine Weile schweigend. Dann fragte Joachim:
„Nun, wie gefallen dir denn die Leute hier? Ich meine die an unserem Tisch?“
Hans Castorp machte ein gleichgültig musterndes Gesicht.
„Gott,“ sagte er, „sie scheinen mir nicht sehr interessant. An den anderen Tischen sitzen, glaube ich, interessantere, aber das kommt einem vielleicht nur so vor. Frau Stöhr sollte sich das Haar waschen lassen, es ist so fett. Und diese Mazurka da, oder wie sie heißt, kommt mir etwas albern vor. Immer muß sie sich das Taschentuch in den Mund stopfen vor lauter Kichern.“
Joachim lachte laut über die Namensverdrehung.
„‚Mazurka‘ ist ausgezeichnet!“ rief er. „Marusja heißt sie, wenn du erlaubst, – das ist soviel wie Marie. Ja, sie ist wirklich zu ausgelassen“, sagte er. „Und dabei hätte sie allen Grund, gesetzter zu sein, denn sie ist gar nicht wenig krank.“
„Das sollte man nicht denken“, sagte Hans Castorp. „Sie ist so gut im Stand. Gerade für brustkrank sollte man sie nicht halten.“ Und er versuchte mit dem Vetter einen flotten Blick zu tauschen, fand aber, daß Joachims sonnverbranntes Gesicht eine fleckige Färbung zeigte, wie sonnverbrannte Gesichter sie annehmen, wenn das Blut daraus weicht, und daß sein Mund sich auf ganz eigentümlich klägliche Weise verzerrt hatte, – zu einem Ausdruck, der dem jungen Hans Castorp einen unbestimmten Schrecken einflößte und ihn veranlaßte, sofort den Gegenstand zu wechseln und sich nach anderen Personen zu erkundigen, wobei er Marusja und Joachims Gesichtsausdruck rasch zu vergessen suchte, was ihm auch völlig gelang.
Die Engländerin mit dem Hagebuttentee hieß Miß Robinson. Die Nähterin war keine Nähterin, sondern Lehrerin an einer staatlichen höheren Töchterschule in Königsberg, und dies war der Grund, weshalb sie sich so richtig ausdrückte. Sie hieß Fräulein Engelhart. Was die muntere alte Dame betraf, so wußte Joachim selber nicht, wie sie hieß, wie lange er auch schon hier oben war. Jedenfalls war sie die Großtante des Yoghurt essenden jungen Mädchens, mit dem sie beständig im Sanatorium lebte. Aber am kränksten von denen am Tisch war Dr. Blumenkohl, Leo Blumenkohl aus Odessa, – jener junge Mann mit dem Schnurrbart und der sorgenvoll verschlossenen Miene. Schon ganze Jahre war er hier oben ...
Es war jetzt städtisches Trottoir, auf dem sie gingen, – die Hauptstraße eines internationalen Treffpunktes, das sah man wohl. Flanierende Kurgäste begegneten ihnen, junge Leute zumeist, Kavaliere in Sportanzügen und ohne Hut, Damen, ebenfalls ohne Hut und in weißen Röcken. Man hörte Russisch und Englisch sprechen. Läden mit schmucken Schaufenstern reihten sich rechts und links, und Hans Castorp, dessen Neugier heftig mit seiner glühenden Müdigkeit kämpfte, zwang seine Augen, zu sehen und verweilte lange vor einem Herrenmodegeschäft, um festzustellen, daß die Auslage durchaus auf der Höhe sei.
Dann kam eine Rotunde mit gedeckter Galerie, in der eine Kapelle konzertierte. Hier war das Kurhaus. Auf mehreren Tennisplätzen waren Partien im Gange. Langbeinige, rasierte Jünglinge in scharf gebügelten Flanellhosen, auf Gummisohlen und mit entblößten Unterarmen spielten gebräunten und weiß gekleideten Mädchen gegenüber, die anlaufend sich in der Sonne steil emporreckten, um den kreideweißen Ball hoch aus der Luft zu schlagen. Wie Mehlstaub lag es über den gepflegten Sportfeldern. Die Vettern setzten sich auf eine freie Bank, um dem Spiele zuzusehen und es zu kritisieren.
„Du spielst hier wohl nicht?“ fragte Hans Castorp.
„Ich darf ja nicht“, antwortete Joachim. „Wir müssen liegen, immer liegen ... Settembrini sagt immer, wir lebten horizontal, – wir seien Horizontale, sagt er, das ist so ein fauler Witz von ihm. – Es sind Gesunde, die da spielen, oder sie tun es verbotenerweise. Übrigens spielen sie ja nicht sehr ernsthaft, – mehr des Kostüms wegen ... Und was das Verbotensein betrifft, da gibt es noch mehr Verbotenes, was hier gespielt wird, Poker, verstehst du, und in dem und jenem Hotel auch petits chevaux, – bei uns steht Ausweisung darauf, es soll das allerschädlichste sein. Aber manche laufen noch nach der Abendkontrolle hinunter und pointieren. Der Prinz, von dem Behrens seinen Titel hat, soll es auch immer getan haben.“
Hans Castorp hörte das kaum. Der Mund stand ihm offen, denn er konnte nicht recht durch die Nase atmen, ohne daß er übrigens Schnupfen gehabt hätte. Sein Herz hämmerte in falschem Takte zu der Musik, was er dumpf als quälend empfand. Und in diesem Gefühl von Unordnung und Widerstreit begann er einzuschlafen, als Joachim zum Heimgehen mahnte.
Sie legten den Weg fast schweigend zurück. Hans Castorp stolperte sogar ein paarmal auf der ebenen Straße und lächelte wehmütig darüber, indem er den Kopf schüttelte. Der Hinkende fuhr sie im Lift in ihr Stockwerk. Sie trennten sich vor Nummer vierunddreißig mit einem kurzen „Auf Wiedersehn“. Hans Castorp steuerte durch sein Zimmer auf den Balkon hinaus, wo er sich, wie er ging und stand, auf den Liegestuhl fallen ließ und ohne die einmal eingenommene Lage zu verbessern in einen schweren, von dem raschen Schlage seines Herzens peinlich belebten Halbschlummer sank.
Wie lange das dauerte, wußte er nicht. Als der Zeitpunkt gekommen war, ertönte das Gong. Aber es rief noch nicht unmittelbar zur Mahlzeit, es mahnte nur, sich bereit zu machen, wie Hans Castorp wußte, und so blieb er noch liegen, bis das metallische Dröhnen zum zweitenmal anschwoll und sich entfernte. Als Joachim durch das Zimmer kam, um ihn zu holen, wollte Hans Castorp sich umziehen, aber nun erlaubte Joachim es nicht mehr. Er haßte und verachtete Unpünktlichkeit. Wie man denn vorwärts kommen wolle und gesund werden, um Dienst machen zu können, sagte er, wenn man sogar zu schlapp sei, um die Essenszeit einzuhalten. Da hatte er natürlich recht, und Hans Castorp konnte lediglich darauf hinweisen, daß er ja nicht krank, dafür aber im höchsten Grade schläfrig sei. Er wusch sich nur rasch die Hände; dann gingen sie in den Saal hinunter, zum drittenmal.
Durch beide Eingänge strömten die Gäste herein. Auch durch die Verandatüren dort drüben, die offen standen, kamen sie, und bald saßen sie alle an den sieben Tischen, als seien sie nie davon aufgestanden. Dies war wenigstens Hans Castorps Eindruck, – ein rein träumerischer und vernunftwidriger Eindruck natürlich, dessen sein umnebelter Kopf sich jedoch einen Augenblick nicht erwehren konnte und an dem er sogar ein gewisses Gefallen fand; denn mehrmals im Laufe der Mahlzeit suchte er ihn sich zurückzurufen, und zwar mit dem Erfolge vollkommener Täuschung. Die muntere alte Dame redete wieder in ihrer verwischten Sprache auf den ihr schräg gegenübersitzenden Dr. Blumenkohl ein, der ihr mit besorgter Miene zuhörte. Ihre magere Großnichte aß endlich etwas anderes als Yoghurt, nämlich die seimige Crème d’orge, welche die Saaltöchter in Tellern serviert hatten; doch nahm sie nur wenige Löffel davon und ließ sie dann stehen. Die hübsche Marusja stopfte ihr Taschentüchlein, das ein Apfelsinenparfüm ausströmte, in den Mund, um ihr Kichern zu ersticken. Miß Robinson las dieselben rundlich geschriebenen Briefe, die sie schon heute morgen gelesen hatte. Offenbar konnte sie kein Wort deutsch und wollte es auch nicht können. Joachim sagte in ritterlicher Haltung etwas auf englisch zu ihr über das Wetter, was sie einsilbig kauend beantwortete, um dann ins Schweigen zurückzukehren. Was Frau Stöhr in ihrer schottischen Wollbluse betraf, so war sie heute vormittag untersucht worden und berichtete darüber, indem sie sich auf ungebildete Weise zierte und die Oberlippe von ihren Hasenzähnen zurückzog. Rechts oben, so klagte sie, habe sie Geräusch, außerdem klinge es unter der linken Achsel noch sehr verkürzt, und fünf Monate, habe „der Alte“ gesagt, müsse sie noch bleiben. In ihrer Unbildung nannte sie Hofrat Behrens „den Alten“. Übrigens zeigte sie sich empört darüber, daß „der Alte“ heute nicht an ihrem Tische sitze. Der „Tournee“ zufolge (sie meinte wohl „Turnus“) sei ihr Tisch heute mittag an der Reihe, während „der Alte“ schon wieder am Nebentische links sitze – (wirklich saß Hofrat Behrens dort und faltete seine riesigen Hände vor seinem Teller). Aber freilich, dort habe ja die dicke Frau Salomon aus Brüssel ihren Platz, die jeden Wochentag dekolletiert zum Essen komme, und daran finde „der Alte“ offenbar Gefallen, obgleich sie, Frau Stöhr, es nicht begreifen könne, denn bei jeder Untersuchung sähe er ja beliebig viel von Frau Salomon. Später erzählte sie in erregtem Flüstertone, daß gestern abend in der oberen gemeinsamen Liegehalle – der nämlich, die sich auf dem Dache befinde – das Licht ausgelöscht worden sei, und zwar zu Zwecken, die Frau Stöhr als „durchsichtig“ bezeichnete. „Der Alte“ habe es gemerkt und so gewettert, daß es in der ganzen Anstalt zu hören gewesen sei. Aber den Schuldigen habe er natürlich wieder nicht ausfindig gemacht, während man doch nicht auf der Universität studiert zu haben brauche, um zu erraten, daß es natürlich dieser Hauptmann Miklosich aus Bukarest gewesen sei, dem es in Damengesellschaft überhaupt nie dunkel genug sein könne, – ein Mensch ohne all und jede Bildung, obgleich er ein Korsett trage, und seinem Wesen nach einfach ein Raubtier, – ja, ein Raubtier, wiederholte Frau Stöhr mit erstickter Stimme, indem ihr auf Stirn und Oberlippe der Schweiß ausbrach. In welchen Beziehungen Frau Generalkonsul Wurmbrand aus Wien zu ihm stehe, das wisse ja Dorf und Platz, – man könne wohl kaum noch von geheimnisvollen Beziehungen sprechen. Denn nicht genug, daß der Hauptmann zuweilen schon morgens zu der Generalkonsulin aufs Zimmer komme, wenn diese noch im Bett liege, worauf er dann ihrer ganzen Toilette beiwohne, sondern am vorigen Dienstag habe er das Zimmer der Wurmbrand überhaupt erst morgens um vier Uhr verlassen, – die Pflegerin des jungen Franz auf Nummer neunzehn, bei dem neulich der Pneumothorax mißglückt sei, habe ihn selbst dabei betroffen und vor Scham die gesuchte Tür verfehlt, so daß sie sich plötzlich in dem Zimmer des Staatsanwalts Paravant aus Dortmund gesehen habe ... Schließlich erging Frau Stöhr sich längere Zeit über eine „kosmische Anstalt“, die sich drunten im Ort befinde, und in der sie ihr Zahnwasser kaufe, – Joachim blickte starr auf seinen Teller nieder ...
Das Mittagessen war sowohl meisterhaft zubereitet wie auch im höchsten Grade ausgiebig. Die nahrhafte Suppe eingerechnet, bestand es aus nicht weniger als sechs Gängen. Dem Fisch folgte ein gediegenes Fleischgericht mit Beilagen, hierauf eine besondere Gemüseplatte, gebratenes Geflügel dann, eine Mehlspeise, die jener von gestern abend an Schmackhaftigkeit nicht nachstand, und endlich Käse und Obst. Jede Schüssel ward zweimal gereicht – und nicht vergebens. Man füllte die Teller und aß an den sieben Tischen, – ein Löwenappetit herrschte im Gewölbe, ein Heißhunger, dem zuzusehen wohl ein Vergnügen gewesen wäre, wenn er nicht gleichzeitig auf irgendeine Weise unheimlich, ja abscheulich gewirkt hätte. Nicht nur die Munteren legten ihn an den Tag, die schwatzten und einander mit Brotkügelchen warfen, nein, auch die Stillen und Finsteren, die in den Pausen den Kopf in die Hände stützten und starrten. Ein halbwüchsiger Mensch am Nebentisch links, ein Schuljunge seinen Jahren nach, mit zu kurzen Ärmeln und dicken, kreisrunden Brillengläsern, schnitt alles, was er sich auf den Teller häufte, im voraus zu einem Brei und Gemengsel zusammen; dann beugte er sich darüber und schlang, indem er zuweilen mit der Serviette hinter die Brille fuhr, um sich die Augen zu wischen, – man wußte nicht, was da zu trocknen war, ob Schweiß oder Tränen.
Zwei Zwischenfälle ereigneten sich während der großen Mahlzeit und erregten Hans Castorps Aufmerksamkeit, soweit sein Befinden dies zuließ. Erstens fiel wieder die Glastür zu, – es war beim Fisch. Hans Castorp zuckte erbittert und sagte dann in zornigem Eifer zu sich selbst, daß er unbedingt diesmal den Täter feststellen müsse. Er dachte es nicht nur, er sagte es auch mit den Lippen, so ernst war es ihm. Ich muß es wissen! flüsterte er mit übertriebener Leidenschaftlichkeit, so daß Miß Robinson sowohl wie die Lehrerin ihn verwundert anblickten. Und dabei wandte er den ganzen Oberkörper nach links und riß seine blutüberfüllten Augen auf.
Es war eine Dame, die da durch den Saal ging, eine Frau, ein junges Mädchen wohl eher, nur mittelgroß, in weißem Sweater und farbigem Rock, mit rötlichblondem Haar, das sie einfach in Zöpfen um den Kopf gelegt trug. Hans Castorp sah nur wenig von ihrem Profil, fast gar nichts. Sie ging ohne Laut, was zu dem Lärm ihres Eintritts in wunderlichem Gegensatz stand, ging eigentümlich schleichend und etwas vorgeschobenen Kopfes zum äußersten Tische links, der senkrecht zur Verandatür stand, dem „Guten Russentisch“ nämlich, wobei sie die eine Hand in der Tasche der anliegenden Wolljacke hielt, die andere aber, das Haar stützend und ordnend, zum Hinterkopf führte. Hans Castorp blickte auf diese Hand, – er hatte viel Sinn und kritische Aufmerksamkeit für Hände und war gewöhnt, auf diesen Körperteil zuerst, wenn er neue Bekanntschaften machte, sein Augenmerk zu richten. Sie war nicht sonderlich damenhaft, die Hand, die das Haar stützte, nicht so gepflegt und veredelt, wie Frauenhände in des jungen Hans Castorp gesellschaftlicher Sphäre zu sein pflegten. Ziemlich breit und kurzfingrig, hatte sie etwas Primitives und Kindliches, etwas von der Hand eines Schulmädchens; ihre Nägel wußten offenbar nichts von Maniküre, sie waren schlecht und recht beschnitten, ebenfalls wie bei einem Schulmädchen, und an ihren Seiten schien die Haut etwas aufgerauht, fast so, als werde hier das kleine Laster des Fingerkauens gepflegt. Übrigens erkannte Hans Castorp dies eher ahnungsweise, als daß er es eigentlich gesehen hätte, – die Entfernung war doch zu bedeutend. Mit einem Kopfnicken begrüßte die Nachzüglerin ihre Tischgesellschaft, und indem sie sich setzte, an die Innenseite des Tisches, den Rücken gegen den Saal, zur Seite Dr. Krokowskis, der dort den Vorsitz hatte, wandte sie, noch immer die Hand am Haar, den Kopf über die Schulter und überblickte das Publikum, – wobei Hans Castorp flüchtig bemerkte, daß sie breite Backenknochen und schmale Augen hatte ... Eine vage Erinnerung an irgendetwas und irgendwen berührte ihn leicht und vorübergehend, als er das sah ...
Natürlich, ein Frauenzimmer! dachte Hans Castorp, und wieder murmelte er es ausdrücklich vor sich hin, so daß die Lehrerin, Fräulein Engelhart, verstand, was er sagte. Die dürftige alte Jungfer lächelte gerührt.
„Das ist Madame Chauchat“, sagte sie. „Sie ist so lässig. Eine entzückende Frau.“ Und dabei verstärkte sich die flaumige Röte auf Fräulein Engelharts Wangen um eine Schattierung, – was übrigens immer der Fall war, sobald sie den Mund öffnete.
„Französin?“ fragte Hans Castorp streng.
„Nein, sie ist Russin“, sagte die Engelhart. „Vielleicht ist der Mann Franzose oder französischer Abkunft, das weiß ich nicht sicher.“
Ob es der dort sei, fragte Hans Castorp noch immer gereizt und deutete auf einen Herrn mit vorhängenden Schultern am Guten Russentisch.
O nein, er sei nicht hier, entgegnete die Lehrerin. Er sei überhaupt noch nicht hier gewesen, sei hier ganz unbekannt.
„Sie sollte die Tür ordentlich zumachen!“ sagte Hans Castorp. „Immer läßt sie sie zufallen. Das ist doch eine Unmanier.“
Und da die Lehrerin den Verweis demütig lächelnd einsteckte, als sei sie selber die Schuldige, so war nicht weiter die Rede von Madame Chauchat. –
Das zweite Vorkommnis bestand darin, daß Dr. Blumenkohl vorübergehend den Saal verließ, – weiter war es nichts. Plötzlich verstärkte sich der leise angewiderte Ausdruck seines Gesichtes, sorgenvoller als sonst blickte er auf einen Punkt, schob dann mit bescheidener Bewegung seinen Stuhl zurück und ging hinaus. Hier aber zeigte sich Frau Stöhrs große Unbildung im vollsten Licht, denn wahrscheinlich aus gemeiner Genugtuung darüber, daß sie weniger krank war als Blumenkohl, begleitete sie seinen Weggang mit halb mitleidigen, halb verächtlichen Glossen. „Der Ärmste!“ sagte sie. „Der pfeift bald aus dem letzten Loch. Schon wieder muß er sich mit dem Blauen Heinrich besprechen.“ Ganz ohne Überwindung, mit störrisch unwissender Miene, brachte sie die fratzenhafte Bezeichnung „der blaue Heinrich“ über die Lippen, und Hans Castorp empfand ein Gemisch von Schrecken und Lachreiz, als sie es sagte. Übrigens kehrte Dr. Blumenkohl nach wenigen Minuten in der gleichen bescheidenen Haltung zurück, in der er hinausgegangen war, nahm wieder Platz und fuhr fort, zu essen. Auch er aß sehr viel, von jedem Gerichte zweimal, stumm und mit sorgenvoll verschlossener Miene.
Dann war das Mittagessen beendet: dank einer gewandten Bedienung – denn die Zwergin besonders war ein sonderbar raschfüßiges Wesen – hatte es nur eine gute Stunde gedauert. Hans Castorp, schwer atmend, und ohne recht zu wissen, wie er heraufgekommen war, lag wieder auf dem vorzüglichen Stuhl in seiner Balkonloge, denn nach dem Essen war Liegekur bis zum Tee, – sogar die wichtigste des Tages und streng einzuhalten. Zwischen den undurchsichtigen Glaswänden, die ihn von Joachim einerseits und dem russischen Ehepaar andererseits trennten, lag er und dämmerte mit pochendem Herzen, indem er Luft durch den Mund holte. Als er sein Taschentuch benutzte, fand er es von Blut gerötet, aber er hatte nicht die Kraft, sich Gedanken darüber zu machen, obgleich er ja etwas ängstlich mit sich war und von Natur ein wenig zu hypochondrischen Grillen neigte. Wieder hatte er sich eine Maria Mancini angezündet, und diesmal rauchte er sie zu Ende, mochte sie nun wie immer schmecken. Schwindelig, beklommen und träumerisch bedachte er, wie sehr sonderbar es ihm hier oben ergehe. Zwei- oder dreimal ward seine Brust von innerem Lachen erschüttert über die schauderhafte Bezeichnung, deren Frau Stöhr sich in ihrer Unbildung bedient hatte.
Drunten im Garten hob sich das Phantasie-Fahnentuch mit dem Schlangenstabe zuweilen im Windhauch. Der Himmel hatte sich wieder gleichmäßig bedeckt. Die Sonne war fort, und sogleich war es fast unwirtlich kühl geworden. Die gemeinsame Liegehalle schien voll besetzt; es herrschte Gespräch und Gekicher dort unten.
„Herr Albin, ich flehe Sie an, legen Sie das Messer fort, stecken Sie es ein, es geschieht ein Unglück damit!“ klagte eine hohe, schwankende Damenstimme. Und:
„Bester Herr Albin, um Gottes willen, schonen Sie unsere Nerven und bringen Sie uns das entsetzliche Mordding aus den Augen!“ mischte sich eine zweite darein, – worauf ein blondköpfiger junger Mann, welcher, eine Zigarette im Munde, seitwärts auf dem vordersten Liegestuhl saß, in frechem Tone erwiderte:
„Fällt mir nicht ein! Die Damen werden mir doch wohl erlauben, etwas mit meinem Messer zu spielen! Nun ja, gewiß, es ist ein besonders scharfes Messer. Ich habe es in Kalkutta einem blinden Zauberer abgekauft ... Er konnte es verschlucken, und gleich darauf grub sein Boy es fünfzig Schritte von ihm entfernt aus dem Boden ... Wollen Sie sehen? Es ist viel schärfer als ein Rasiermesser. Man braucht die Schneide nur zu berühren, und sie geht einem ins Fleisch wie durch Butter. Warten Sie, ich zeige es Ihnen näher ...“ Und Herr Albin stand auf. Ein Gekreisch erhob sich. „Nein, jetzt hole ich meinen Revolver!“ sagte Herr Albin. „Das wird Sie mehr interessieren. Ein ganz verflixtes Ding. Von einer Durchschlagskraft ... Ich hole ihn aus meinem Zimmer.“
„Herr Albin, Herr Albin, tun Sie es nicht!“ zeterten mehrere Stimmen. Aber Herr Albin kam schon aus der Liegehalle hervor, um auf sein Zimmer zu gehen, – blutjung und schlenkricht, mit rosigem Kindergesicht und kleinen Backenbartstreifen neben den Ohren.
„Herr Albin,“ rief eine Dame hinter ihm drein, „holen Sie lieber Ihren Paletot, ziehen Sie ihn an, tun Sie es mir zuliebe! Sechs Wochen haben Sie mit Lungenentzündung gelegen, und nun sitzen Sie hier ohne Überzieher und decken sich nicht einmal zu und rauchen Zigaretten! Das heißt Gott versuchen, Herr Albin, mein Ehrenwort!“
Aber er lachte nur höhnisch im Weggehen, und schon nach wenigen Minuten kehrte er mit dem Revolver zurück. Da kreischten sie noch alberner als vorhin, und man hörte, daß mehrere von den Stühlen springen wollten, sich in ihre Decken verwickelten und stürzten.
„Sehen Sie, wie klein und blank er ist,“ sagte Herr Albin, „aber wenn ich hier drücke, so beißt er zu ...“ Ein neues Gekreisch. „Er ist natürlich scharf geladen“, fuhr Herr Albin fort. „In dieser Scheibe hier stecken die sechs Patronen, die dreht sich bei jedem Schuß um ein Loch weiter ... Übrigens halte ich mir das Ding nicht zum Spaß“, sagte er, da er bemerkte, daß die Wirkung sich abnutzte, ließ den Revolver in die Brusttasche gleiten und setzte sich wieder mit übergeschlagenem Bein auf seinen Stuhl, indem er sich eine frische Zigarette anzündete. „Durchaus nicht zum Spaß“, wiederholte er und preßte die Lippen zusammen.
„Wozu denn? Wozu denn?“ fragten ahnungsvoll bebende Stimmen. „Entsetzlich!“ schrie plötzlich eine einzelne, und da nickte Herr Albin.
„Ich sehe, Sie fangen an, zu begreifen“, sagte er. „In der Tat, dazu halte ich ihn mir“, fuhr er leichthin fort, nachdem er trotz der überstandenen Lungenentzündung eine Menge Rauch eingezogen und wieder von sich geblasen hatte. „Ich halte ihn in Bereitschaft für den Tag, wo mir dieser Trödel hier zu langweilig wird und wo ich die Ehre haben werde, mich ergebenst zu empfehlen. Die Sache ist ziemlich einfach ... Ich habe einiges Studium darauf verwandt und bin mit mir im reinen darüber, wie sie am besten zu deichseln ist. (Bei dem Worte „deichseln“ ertönte ein Schrei.) Die Herzpartie schaltet aus ... Der Ansatz ist mir da nicht recht bequem ... Auch ziehe ich es vor, das Bewußtsein an Ort und Stelle auszulöschen, nämlich indem ich mir so einen hübschen kleinen Fremdkörper in dieses interessante Organ appliziere ...“ Und Herr Albin deutete mit dem Zeigefinger auf seinen kurzgeschorenen Blondschädel. „Man muß hier ansetzen –“ Herr Albin zog den vernickelten Revolver wieder aus der Tasche und klopfte mit der Mündung an seine Schläfe – „hier oberhalb der Schlagader ... Sogar ohne Spiegel ist es eine glatte Sache ...“
Mehrstimmiger, flehender Protest ward laut, in den sich sogar ein heftiges Schluchzen mischte.
„Herr Albin, Herr Albin, den Revolver weg, nehmen Sie den Revolver von Ihrer Schläfe weg, es ist nicht anzusehen! Herr Albin, Sie sind jung, Sie werden gesund werden, Sie werden ins Leben zurückkehren und sich der allgemeinen Beliebtheit erfreuen, mein Ehrenwort! Ziehen Sie nur Ihren Mantel an, legen Sie sich hin, decken Sie sich zu, machen Sie Kur! Jagen Sie den Bademeister nicht wieder fort, wenn er kommt, um Sie mit Alkohol abzureiben! Lassen Sie das Zigarettenrauchen, Herr Albin, hören Sie, wir bitten um Ihr Leben, Ihr junges, kostbares Leben!“
Aber Herr Albin war unerbittlich.
„Nein, nein,“ sagte er, „lassen Sie mich, es ist gut, ich danke Ihnen. Ich habe noch nie einer Dame etwas abgeschlagen, aber Sie werden einsehen, daß es unnütz ist, dem Schicksal in die Speichen zu fallen. Ich bin im dritten Jahr hier ... ich habe es satt und spiele nicht mehr mit, – können Sie mir das verargen? Unheilbar, meine Damen, – sehen Sie mich an, wie ich hier sitze, bin ich unheilbar, – der Hofrat selbst macht kaum noch ehren- und schandenhalber ein Hehl daraus. Gönnen Sie mir das bißchen Ungebundenheit, das für mich aus dieser Tatsache resultiert! Es ist wie auf dem Gymnasium, wenn es entschieden war, daß man sitzen blieb und nicht mehr gefragt wurde und nichts mehr zu tun brauchte. Zu diesem glücklichen Zustand bin ich nun endgültig wieder gediehen. Ich brauche nichts mehr zu tun, ich komme nicht mehr in Betracht, ich lache über das Ganze. Wollen Sie Schokolade? Bedienen Sie sich! Nein, Sie berauben mich nicht, ich habe massenweise Schokolade auf meinem Zimmer. Acht Bonbonnieren, fünf Tafeln Gala-Peter und vier Pfund Lindschokolade habe ich da oben, – das alles haben die Damen des Sanatoriums mir während meiner Lungenentzündung zustellen lassen ...“
Irgendwoher gebot eine Baßstimme Ruhe. Herr Albin lachte kurz auf, – es war ein flatternd-abgerissenes Lachen. Dann ward es still in der Liegehalle, so still, als sei ein Traum oder Spuk zerstoben; und sonderbar klangen die gesprochenen Worte im Schweigen nach. Hans Castorp lauschte ihnen, bis sie völlig erstorben waren, und obwohl ihm unbestimmt schien, als ob Herr Albin ein Laffe sei, so konnte er sich doch nicht eines gewissen Neides auf ihn erwehren. Namentlich jenes dem Schulleben entnommene Gleichnis hatte ihm Eindruck gemacht, denn er selbst war ja in Untersekunda sitzen geblieben, und er erinnerte sich wohl des etwas schimpflichen aber humoristischen, angenehm verwahrlosten Zustandes, dessen er genossen hatte, als er im vierten Quartal das Rennen aufgegeben und „über das Ganze“ hatte lachen können. Da seine Betrachtungen dumpf und verworren waren, so ist es schwer, sie zu präzisieren. Hauptsächlich schien ihm, daß die Ehre bedeutende Vorteile für sich habe, aber die Schande nicht minder, ja, daß die Vorteile der letzteren geradezu grenzenloser Art seien. Und indem er sich probeweise in Herrn Albins Zustand versetzte und sich vergegenwärtigte, wie es sein müsse, wenn man endgültig des Druckes der Ehre ledig war und auf immer die bodenlosen Vorteile der Schande genoß, erschreckte den jungen Mann ein Gefühl von wüster Süßigkeit, das sein Herz vorübergehend zu noch hastigerem Gange erregte.
Später verlor er das Bewußtsein. Nach seiner Taschenuhr war es halb vier, als Gespräch hinter der linken Glaswand ihn weckte: Dr. Krokowski, der um diese Zeit ohne den Hofrat die Runde machte, sprach dort russisch mit dem unmanierlichen Ehepaar, erkundigte sich, wie es schien, nach dem Befinden des Gatten und ließ sich seine Fiebertabelle zeigen. Dann aber setzte er seinen Weg nicht durch die Balkonlogen fort, sondern umging Hans Castorps Abteil, indem er sich auf den Korridor zurückbegab und durch die Zimmertür bei Joachim eintrat. Daß man solchergestalt einen Bogen um ihn beschrieb und ihn links liegen ließ, empfand Hans Castorp denn doch als etwas verletzend, obgleich ihn nach einem Zusammensein unter vier Augen mit Dr. Krokowski ja durchaus nicht verlangte. Freilich, er war eben gesund und zählte nicht mit, – denn bei denen hier oben, dachte er, lagen die Dinge so, daß derjenige nicht in Betracht kam und nicht gefragt wurde, der die Ehre hatte, gesund zu sein, und das ärgerte den jungen Castorp.
Nachdem Dr. Krokowski sich bei Joachim zwei oder drei Minuten verweilt hatte, ging er den Balkon entlang weiter, und Hans Castorp hörte den Vetter sagen, daß man nun aufstehen und sich zur Vespermahlzeit bereit machen könne. „Schön“, sagte er und stand auf. Aber es schwindelte ihn sehr vom langen Liegen, und der unerquickliche Halbschlaf hatte ihm das Gesicht aufs neue peinlich erhitzt, während er übrigens zum Frösteln neigte, – vielleicht hatte er sich nicht warm genug zugedeckt.
Er wusch sich Augen und Hände, ordnete sein Haar und seine Kleider und traf mit Joachim auf dem Korridor zusammen.
„Hast du diesen Herrn Albin gehört?“ fragte er, als sie die Treppen hinunter gingen ...
„Natürlich“, sagte Joachim. „Der Mensch müßte diszipliniert werden. Stört da die ganze Mittagsruhe mit seinem Geschwätz und regt die Damen so auf, daß er sie um Wochen zurückbringt. Eine grobe Insubordination. Aber wer will denn den Denunzianten machen. Und außerdem sind solche Reden ja den meisten als Unterhaltung willkommen.“
„Hältst du es für möglich,“ fragte Hans Castorp, „daß er Ernst macht mit seiner ‚glatten Sache‘, wie er sich ausdrückt, und sich einen Fremdkörper appliziert?“
„Ach, doch,“ antwortete Joachim, „ganz unmöglich ist es nicht. Dergleichen kommt vor hier oben. Zwei Monate bevor ich kam hat sich ein Student, der schon lange hier war, nach einer Generaluntersuchung im Walde drüben aufgehängt. Es war in meinen ersten Tagen noch viel die Rede davon.“
Hans Castorp gähnte erregt.
„Ja, gut fühle ich mich nicht bei euch,“ erklärte er, „das kann ich nicht sagen. Ich halte es für möglich, daß ich nicht bleiben kann, du, daß ich abreisen muß, – würdest du es mir weiter übelnehmen?“
„Abreisen? Was fällt dir ein!“ rief Joachim. „Unsinn. Wo du gerade erst angekommen bist. Wie willst du denn urteilen nach dem ersten Tage!“
„Gott, ist noch immer der erste Tag? Mir ist ganz, als wäre ich schon lange – lange bei euch hier oben.“
„Nun fange nur nicht wieder an, über die Zeit zu spintisieren!“ sagte Joachim. „Ganz konfus hast du mich heute morgen gemacht.“
„Nein, sei beruhigt, ich habe alles vergessen“, erwiderte Hans Castorp. „Den ganzen Komplex. Jetzt bin ich auch kein bißchen scharf mehr im Kopfe, das ist vorüber ... Nun gibt es also Tee.“
„Ja, und dann gehen wir wieder bis zu der Bank von heute morgen.“
„In Gottes Namen. Aber hoffentlich treffen wir Settembrini nicht wieder. Ich kann mich heute an keinem gebildeten Gespräch mehr beteiligen, das sage ich dir im voraus.“
Im Speisesaal wurden alle Getränke geschenkt, die zu dieser Stunde nur irgend in Betracht kommen. Miß Robinson trank wieder ihren blutroten Hagebuttentee, während die Großnichte Yoghurt löffelte. Außerdem gab es Milch, Tee, Kaffee, Schokolade, ja sogar Fleischbrühe, und überall waren die Gäste, die seit dem üppigen Mittagsmahl zwei Stunden liegend verbracht hatten, eifrig beschäftigt, Butter auf große Schnitten Rosinenkuchen zu streichen.
Hans Castorp hatte sich Tee geben lassen und tauchte Zwieback hinein. Auch etwas Marmelade versuchte er. Den Rosinenkuchen betrachtete er genau, doch erzitterte er buchstäblich bei dem Gedanken, davon zu essen. Abermals saß er an seinem Platze im Saal mit dem einfältig bunten Gewölbe, den sieben Tischen, – zum viertenmal. Etwas später, um sieben Uhr, saß er zum fünftenmal dort, und da galt es das Abendessen. In die Zwischenzeit, welche kurz und nichtig war, fiel ein Spaziergang zu jener Bank an der Bergwand, beim Wasserrinnsal – der Weg war jetzt dicht belebt von Patienten, so daß die Vettern häufig zu grüßen hatten – und eine neuerliche Liegekur auf dem Balkon, von flüchtigen und gehaltlosen anderthalb Stunden. Hans Castorp fröstelte heftig dabei.
Zur Abendmahlzeit kleidete er sich gewissenhaft um und aß dann zwischen Miß Robinson und der Lehrerin Juliennesuppe, gebackenes und gebratenes Fleisch nebst Zubehör, zwei Stücke von einer Torte, in der alles vorkam: Makronenteig, Buttercreme, Schokolade, Fruchtmus und Marzipan, und sehr guten Käse auf Pumpernickel. Wieder ließ er sich eine Flasche Kulmbacher dazu geben. Als er jedoch sein hohes Glas zur Hälfte geleert hatte, erkannte er klar und deutlich, daß er ins Bett gehöre. In seinem Kopfe rauschte es, seine Augenlider waren wie Blei, sein Herz ging wie eine kleine Pauke, und zu seiner Qual bildete er sich ein, daß die hübsche Marusja, die, vornüber geneigt, ihr Gesicht in der Hand mit dem kleinen Rubin verbarg, über ihn lache, obgleich er sich so angestrengt bemüht hatte, keinerlei Veranlassung dazu zu geben. Wie aus weiter Ferne hörte er Frau Stöhr etwas erzählen oder behaupten, was ihm als so tolles Zeug erschien, daß er in verwirrte Zweifel geriet, ob er noch richtig höre oder ob Frau Stöhrs Äußerungen sich vielleicht in seinem Kopfe zu Unsinn verwandelten. Sie erklärte, daß sie achtundzwanzig verschiedene Fischsaucen zu bereiten verstehe, – sie habe den Mut, dafür einzustehen, obgleich ihr eigener Mann sie gewarnt habe, davon zu sprechen. „Sprich nicht davon!“ habe er gesagt. „Niemand wird es dir glauben, und wenn man es glaubt, so wird man es lächerlich finden!“ Und doch wolle sie es heute einmal sagen und offen bekennen, daß es achtundzwanzig Fischsaucen seien, die sie machen könne. Das schien dem armen Hans Castorp entsetzlich; er erschrak, griff sich mit der Hand an die Stirn und vergaß vollkommen, einen Bissen Pumpernickel mit Chester, den er im Munde hatte, fertig zu kauen und hinunterzuschlucken. Noch als man von Tische aufstand, hatte er ihn im Munde.
Man ging durch die Glastür zur Linken hinaus, jene fatale, die immer zufiel und die geradewegs in die vordere Halle führte. Fast alle Gäste nahmen diesen Weg, denn es zeigte sich, daß um die Stunde nach dem Diner in der Halle und den anliegenden Salons eine Art von Geselligkeit stattfand. Die Mehrzahl der Patienten stand in kleinen Gruppen plaudernd umher. An zwei grün ausgeschlagenen Klapptischen lag man dem Spiele ob; es war Domino an dem einen, Bridge an dem anderen Tische, und hier waren es nur junge Leute, die spielten, darunter Herr Albin und Hermine Kleefeld. Ferner gab es ein paar unterhaltende optische Gegenstände im ersten Salon: einen stereoskopischen Guckkasten, durch dessen Linsen man die in seinem Innern aufgestellten Photographien, zum Beispiel einen venezianischen Gondolier, in starrer und blutloser Körperlichkeit erblickte; zweitens ein fernrohrförmiges Kaleidoskop, an dessen Linse man ein Auge legte, um sich, nur durch leichte Handhabung eines Rades, buntfarbige Sterne und Arabesken in zauberhafter Abwechslung vorzugaukeln; eine drehende Trommel endlich, in die man kinematographische Filmstreifen legte und durch deren Öffnungen, wenn man seitlich hineinsah, ein Müller, der sich mit einem Schornsteinfeger prügelte, ein Schulmeister, einen Knaben züchtigend, ein springender Seiltänzer und ein Bauernpärchen im Ländlertanz zu beobachten waren. Hans Castorp, die kalten Hände auf den Knien, blickte längere Zeit in jeden der Apparate. Er verweilte sich auch ein wenig am Bridgetische, wo der unheilbare Herr Albin mit hängenden Mundwinkeln und weltmännisch wegwerfenden Bewegungen die Karten handhabte. In einem Winkel saß Dr. Krokowski, begriffen in frischem und herzlichem Gespräch mit einem Halbkreise von Damen, zu welchem Frau Stöhr, Frau Iltis und Fräulein Levi gehörten. Die Inhaber des Guten Russentisches hatten sich in den anstoßenden kleineren Salon zurückgezogen, der nur durch Portieren vom Spielzimmer getrennt war, und bildeten dort eine intime Clique. Es waren außer Madame Chauchat: ein blondbärtiger, schlaffer Herr mit konkavem Brustkasten und glotzenden Augäpfeln; ein tief brünettes Mädchen von originellem und humoristischem Typus, mit goldenen Ohrringen und wirrem Wollhaar; ferner Dr. Blumenkohl, der sich ihnen zugesellt hatte, und noch zwei hängeschultrige Jünglinge. Madame Chauchat trug ein blaues Kleid mit weißem Spitzenkragen. Sie saß, als Mittelpunkt ihrer Gruppe, auf dem Sofa hinter dem runden Tisch, im Hintergrunde des kleinen Gemaches, das Gesicht dem Spielzimmer zugewandt. Hans Castorp, der die ungezogene Frau nicht ohne Mißbilligung betrachten konnte, dachte bei sich: Sie erinnert mich an irgend etwas, doch kann ich nicht sagen, an was ... Ein langer Mensch von etwa dreißig Jahren und mit gelichtetem Haupthaar spielte an dem kleinen braunen Pianoforte dreimal hintereinander den Hochzeitsmarsch aus dem „Sommernachtstraum“, und als einige Damen ihn darum baten, begann er das melodiöse Stück zum viertenmal, nachdem er einer nach der anderen tief und schweigend in die Augen geblickt hatte.
„Ist es erlaubt, sich nach Ihrem Befinden zu erkundigen, Ingenieur?“ fragte Settembrini, welcher, die Hände in den Hosentaschen, zwischen den Gästen umhergeschlendert war und nun vor Hans Castorp hintrat ... Noch immer trug er seinen grauen, flausartigen Rock und die hell karierten Beinkleider. Er lächelte bei seiner Anrede, und wieder empfand Hans Castorp etwas wie Ernüchterung beim Anblick dieses fein und spöttisch gekräuselten Mundwinkels unter der Biegung des schwarzen Schnurrbartes. Übrigens blickte er den Italiener ziemlich blöde, mit schlaffem Munde und rotgeäderten Augen an.
„Ach, Sie sind es“, sagte er. „Der Herr vom Morgenspaziergang, den wir bei dieser Bank da oben ... beim Wasserlauf ... Natürlich, ich habe Sie sofort wieder erkannt. Wollen Sie glauben,“ fuhr er fort, obgleich er wohl einsah, daß er es nicht hätte sagen dürfen, „daß ich Sie damals im ersten Augenblick für einen Drehorgelmann gehalten habe? ... Das war natürlich der reine Unsinn,“ setzte er hinzu, da er sah, daß Settembrini’s Blick einen kühl forschenden Ausdruck annahm, „– eine furchtbare Dummheit mit einem Wort! Es ist mir sogar vollständig unbegreiflich, wie in aller Welt ich ...“
„Beunruhigen Sie sich nicht, es hat nichts zu sagen“, erwiderte Settembrini, nachdem er den jungen Mann noch einen Augenblick schweigend betrachtet hatte. „Und wie haben Sie also Ihren Tag verbracht, – den ersten Ihres Aufenthaltes an diesem Lustorte?“
„Ich danke sehr. Ganz vorschriftsmäßig“, antwortete Hans Castorp. „Vorwiegend auf ‚horizontale Art‘, wie Sie es mit Vorliebe nennen sollen.“
Settembrini lächelte.
„Es mag sein, daß ich mich gelegentlich so ausgedrückt habe“, sagte er. „Nun, und Sie fanden sie kurzweilig, diese Lebensweise?“
„Kurzweilig und langweilig, wie Sie nun wollen“, erwiderte Hans Castorp. „Das ist zuweilen schwer zu unterscheiden, wissen Sie. Ich habe mich durchaus nicht gelangweilt, – dazu ist es doch ein allzu munterer Betrieb bei Ihnen hier oben. Man bekommt so viel Neues und Merkwürdiges zu hören und zu sehen ... Und doch ist mir auch andererseits wieder, als ob ich nicht nur einen Tag, sondern schon längere Zeit hier wäre, – geradezu, als ob ich hier schon älter und klüger geworden wäre, so kommt es mir vor.“
„Klüger auch?“ sagte Settembrini und zog die Brauen hoch. „Wollen Sie mir die Frage erlauben: Wie alt sind Sie eigentlich?“
Aber siehe da, Hans Castorp wußte es nicht! Er wußte im Augenblick nicht, wie alt er sei, trotz heftiger, ja verzweifelter Anstrengungen, sich darauf zu besinnen. Um Zeit zu gewinnen, ließ er sich die Frage wiederholen und sagte dann:
„... Ich ... wie alt? Ich bin natürlich im vierundzwanzigsten. Demnächst werde ich vierundzwanzig. Verzeihen Sie, ich bin müde!“ sagte er. „Und Müdigkeit ist noch gar nicht der Ausdruck für meinen Zustand. Kennen Sie das, wenn man träumt und weiß, daß man träumt und zu erwachen sucht und nicht aufwachen kann? Genau so ist mir zumut. Unbedingt muß ich Fieber haben, anders kann ich es mir gar nicht erklären. Wollen Sie glauben, daß ich bis zu den Knien hinauf kalte Füße habe? Wenn man so sagen darf, denn die Knie sind ja natürlich nicht mehr die Füße, – entschuldigen Sie, ich bin im höchsten Grade konfus, und das ist ja auch am Ende kein Wunder, wenn man schon am frühen Morgen mit dem ... mit dem Pneumothorax angepfiffen wird und nachher die Reden dieses Herrn Albin mit anhört und obendrein in horizontaler Lage. Denken Sie, mir ist immer, als dürfte ich meinen fünf Sinnen nicht mehr recht trauen, und ich muß sagen, das geniert mich noch mehr, als die Hitze im Gesicht und die kalten Füße. Sagen Sie mir offen: halten Sie es für möglich, daß Frau Stöhr achtundzwanzig Fischsaucen zu machen versteht? Ich meine nicht, ob sie sie wirklich machen kann – das halte ich für ausgeschlossen – sondern ob sie es auch nur wirklich vorhin bei Tische behauptet hat oder ob es mir nur so vorkam, – nur das möchte ich wissen.“
Settembrini sah ihn an. Er schien nicht zugehört zu haben. Wieder hatten seine Augen „sich festgesehen“, waren in eine fixe und blinde Einstellung geraten, und wie heute morgen sagte er je dreimal „so, so, so“ und „sieh, sieh, sieh“, – spöttisch-nachdenklich und mit scharfem S-Laut.
„Vierundzwanzig sagten Sie?“ fragte er dann ...
„Nein, achtundzwanzig!“ sagte Hans Castorp. „Achtundzwanzig Fischsaucen! Nicht Saucen im allgemeinen, sondern speziell Fischsaucen, das ist das Ungeheuerliche.“
„Ingenieur!“ sagte Settembrini zornig und ermahnend. „Nehmen Sie sich zusammen und lassen Sie mich mit diesem liederlichen Unsinn in Ruhe! Ich weiß nichts davon und will nichts davon wissen. – Im vierundzwanzigsten, sagten Sie? Hm ... gestatten Sie mir noch eine Frage oder einen unmaßgeblichen Vorschlag, wenn Sie so wollen. Da der Aufenthalt Ihnen nicht zuträglich zu sein scheint, da Sie sich körperlich und, wenn mich nicht alles täuscht, auch seelisch nicht wohl bei uns befinden, – wie wäre es denn da, wenn Sie darauf verzichteten, hier älter zu werden, kurz, wenn Sie noch heute nacht wieder aufpackten und sich morgen mit den fahrplanmäßigen Schnellzügen auf- und davonmachten?“
„Sie meinen, ich sollte abreisen?“ fragte Hans Castorp ... „Wo ich gerade erst angekommen bin? Aber nein, wie will ich denn urteilen nach dem ersten Tage!“
Zufällig blickte er ins Nebenzimmer bei diesen Worten und sah dort Frau Chauchat von vorn, ihre schmalen Augen und breiten Backenknochen. Woran, dachte er, woran und an wen in aller Welt erinnert sie mich nur. Aber sein müder Kopf wußte die Frage trotz einiger Anstrengung nicht zu beantworten.
„Natürlich fällt es mir nicht so ganz leicht, mich bei Ihnen hier oben zu akklimatisieren,“ fuhr er fort, „das war doch vorauszusehen, und deshalb gleich die Flinte ins Korn zu werfen, nur weil ich vielleicht ein paar Tage ein bißchen verwirrt und heiß sein werde, da müßte ich mich ja schämen, geradezu feig würde ich mir vorkommen und außerdem ginge es gegen alle Vernunft, – nein, sagen Sie selbst ...“
Er sprach auf einmal sehr eindringlich, mit erregten Schulterbewegungen, und schien den Italiener bestimmen zu wollen, seinen Vorschlag in aller Form zurückzunehmen.
„Ich salutiere der Vernunft“, antwortete Settembrini. „Ich salutiere übrigens auch dem Mute. Was Sie sagen, läßt sich wohl hören, es dürfte schwer sein, etwas Triftiges dagegen einzuwenden. Auch habe ich wirklich schöne Fälle von Akklimatisation beobachtet. Da war im vorigen Jahre Fräulein Kneifer, Ottilie Kneifer, durchaus von Familie, die Tochter eines höheren Staatsfunktionärs. Sie war wohl anderthalb Jahre hier und hatte sich so vortrefflich eingelebt, daß sie, als ihre Gesundheit vollkommen hergestellt war – denn das kommt vor, man wird zuweilen gesund hier oben –, daß sie auch dann noch um keinen Preis fort wollte. Sie bat den Hofrat von ganzer Seele, noch bleiben zu dürfen, sie könne und möge nicht heim, hier sei sie zu Hause, hier sei sie glücklich; da aber lebhafter Zudrang herrschte und man ihr Zimmer benötigte, so war ihr Flehen umsonst, und man beharrte darauf, sie als gesund zu entlassen. Ottilie bekam hohes Fieber, sie ließ ihre Kurve tüchtig ansteigen. Allein man entlarvte sie, indem man ihr das gebräuchliche Thermometer mit einer ‚Stummen Schwester‘ vertauschte, – Sie wissen noch nicht, was das ist, es ist ein Thermometer ohne Bezifferung, der Arzt kontrolliert ihn, indem er ein Maß daran legt und zeichnet die Kurve dann selbst. Ottilie, mein Herr, hatte 36,9, Ottilie war fieberfrei. Da badete sie im See, – wir schrieben Anfang Mai damals, wir hatten Nachtfröste, der See war nicht geradezu eiskalt, er hatte genau genommen ein paar Grad über Null. Sie blieb eine gute Weile im Wasser, um dies oder jenes abzubekommen, – allein der Erfolg? Sie war und blieb gesund. Sie schied in Schmerz und Verzweiflung, unzugänglich den Trostworten ihrer Eltern. ‚Was soll ich da unten?‘ rief sie wiederholt. ‚Hier ist meine Heimat!‘ Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist ... Aber mir scheint, Sie hören mich nicht, Ingenieur? Es kostet Sie Mühe, sich auf den Beinen zu halten, wenn mich nicht alles täuscht. Leutnant, hier haben Sie Ihren Vetter!“ wandte er sich zu Joachim, der eben herantrat. „Führen Sie ihn zu Bette! Er vereinigt Vernunft und Mut, aber heute abend ist er ein wenig hinfällig.“
„Nein, wirklich, ich habe alles verstanden!“ beteuerte Hans Castorp. „Die Stumme Schwester ist also nur eine Quecksilbersäule, ganz ohne Bezifferung, – Sie sehen, ich habe es vollkommen aufgefaßt!“ Aber dann fuhr er doch mit Joachim im Lift hinauf, zusammen mit mehreren anderen Patienten, – die Geselligkeit war beendet für heute, man ging auseinander und suchte Hallen und Loggien auf, zur abendlichen Liegekur. Hans Castorp ging mit auf Joachims Zimmer. Der Boden des Korridors mit dem Kokosläufer vollführte sanfte Wellenbewegungen unter seinen Füßen, aber er empfand es nicht weiter unangenehm. Er setzte sich in Joachims großen geblümten Lehnstuhl – ein solcher Stuhl stand auch in seinem eigenen Zimmer – und zündete sich eine Maria Mancini an. Sie schmeckte nach Leim, nach Kohle und manchem anderen, nur nicht, wie sie sollte; doch fuhr er trotzdem fort, sie zu rauchen, während er zusah, wie Joachim sich zur Liegekur fertig machte, seine litewkaartige Hausjoppe anlegte, darüber einen älteren Paletot zog und dann mit der Nachttischlampe und seinem russischen Übungsbuch auf den Balkon hinausging, wo er das Lämpchen einschaltete und auf dem Liegestuhl, das Thermometer im Munde, sich mit erstaunlicher Gewandtheit in zwei große Kamelhaardecken zu wickeln begann, die über den Stuhl gebreitet waren. Hans Castorp sah mit aufrichtiger Bewunderung, wie geschickt er es ausführte. Er schlug die Decken, eine nach der anderen, zuerst von links der Länge nach bis unter die Achsel über sich, hierauf von unten über die Füße und dann von rechts, so daß er endlich ein vollkommen ebenmäßiges und glattes Paket bildete, aus dem nur Kopf, Schultern und Arme hervorsahen.
„Das machst du ja ausgezeichnet“, sagte Hans Castorp.
„Es ist die Übung“, antwortete Joachim, indem er beim Sprechen das Thermometer mit den Zähnen festhielt. „Du lernst es auch. Morgen müssen wir uns unbedingt ein paar Decken für dich besorgen. Du kannst sie unten schon wieder brauchen, und hier bei uns sind sie unerläßlich, besonders da du ja keinen Pelzsack hast.“
„Ich lege mich aber bei Nacht nicht auf den Balkon“, erklärte Hans Castorp. „Das tue ich nicht, ich sage es dir gleich. Es würde mir gar zu sonderbar vorkommen. Alles hat seine Grenzen. Und irgendwie muß ich ja schließlich auch markieren, daß ich nur zu Besuch bin bei euch hier oben. Ich sitze hier noch etwas und rauche meine Zigarre, wie es sich gehört. Sie schmeckt miserabel, aber ich weiß, daß sie gut ist, und das muß mir für heute genügen. Jetzt ist die Uhr gleich neun, – allerdings, leider ist es noch nicht mal neun. Aber wenn es halb zehn ist, dann ist es ja schon so weit, daß man halbwegs normalerweise zu Bett gehen kann.“
Ein Frostschauer überlief ihn, – einer und dann mehrere rasch hintereinander. Hans Castorp sprang auf und lief zum Wandthermometer, als gelte es, ihn in flagranti ertappen. Nach Réaumur waren neun Grad im Zimmer. Er faßte die Röhren an und fand sie tot und kalt. Er murmelte etwas Ungeordnetes, des Inhalts, wenn auch August sei, so sei es doch eine Schande, daß nicht geheizt werde, denn nicht auf den Monatsnamen komme es an, den man eben schreibe, sondern auf die herrschende Temperatur, und die sei so, daß ihn friere wie einen Hund. Aber sein Gesicht brannte. Er setzte sich wieder, stand nochmals auf, bat murmelnd um Erlaubnis, Joachims Bettdecke nehmen zu dürfen und breitete sie sich, im Stuhle sitzend, über den Unterkörper. So saß er, hitzig und fröstelnd, und quälte sich mit der widerlich schmeckenden Zigarre. Ein großes Elendsgefühl überkam ihn; ihm war, als sei es ihm noch nie im Leben so schlecht ergangen. „Das ist ja ein Elend!“ murmelte er. Dazwischen aber berührte ihn plötzlich ein ganz absonderlich ausschweifendes Gefühl der Freude und Hoffnung, und als er es empfunden hatte, saß er nur noch da, um zu warten, ob es nicht vielleicht wiederkäme. Es kam aber nicht wieder; nur das Elend blieb. Und so stand er denn schließlich auf, warf Joachims Decke aufs Bett zurück, murmelte verzerrten Mundes etwas wie „Gute Nacht!“ und „Erfriere nur nicht!“ und „Zum Frühstück holst du mich ja wohl wieder“ und schwankte über den Korridor in sein Zimmer hinüber.
Beim Auskleiden sang er vor sich hin, jedoch nicht aus Fröhlichkeit. Mechanisch und ohne den rechten Bedacht erledigte er die kleinen Handgriffe und kulturellen Pflichten der Nachttoilette, goß hellrotes Mundwasser aus dem Reiseflakon ins Glas und gurgelte diskret, wusch sich die Hände mit seiner guten und milden Veilchenseife und zog das lange Batisthemd an, das auf der Brusttasche mit den Buchstaben H C bestickt war. Dann legte er sich und löschte das Licht, indem er seinen heißen, verstörten Kopf auf das Sterbekissen der Amerikanerin zurückfallen ließ.
Aufs bestimmteste hatte er erwartet, daß er sogleich in Schlaf sinken werde, doch stellte sich das als Irrtum heraus, und seine Lider, die er vorhin kaum offenzuhalten vermocht hatte, – jetzt wollten sie durchaus nicht geschlossen bleiben, sondern öffneten sich unruhig zuckend, sobald er sie senkte. Es war noch nicht seine gewohnte Schlafenszeit, sagte er sich, und dann hatte er wohl tagüber zuviel gelegen. Auch wurde draußen ein Teppich geklopft, – was ja wenig wahrscheinlich und in der Tat überhaupt nicht der Fall war; sondern es erwies sich, daß sein Herz es war, dessen Schlag er außer sich und weit fort im Freien hörte, genau so, als werde dort draußen ein Teppich mit einem geflochtenen Rohrklopfer bearbeitet.
Es war im Zimmer noch nicht völlig dunkel geworden; der Schein der Lämpchen draußen in den Logen, bei Joachim und bei dem Paare vom Schlechten Russentisch, fiel durch die offene Balkontür herein. Und während Hans Castorp mit blinzelnden Lidern auf dem Rücken lag, erneute sich ihm plötzlich ein Eindruck, ein einzelner des Tages, eine Beobachtung, die er mit Schrecken und Zartgefühl sogleich zu vergessen gesucht hatte. Es war der Ausdruck, den Joachims Gesicht angenommen hatte, als von Marusja und ihren körperlichen Eigenschaften die Rede gewesen war, – diese ganz eigentümlich klägliche Verzerrung seines Mundes nebst fleckigem Erblassen seiner gebräunten Wangen. Hans Castorp verstand und durchschaute, was es bedeutete, verstand und durchschaute es auf eine so neue, eingehende und intime Art, daß der Rohrklopfer da draußen seine Schläge sowohl der Schnelligkeit wie der Stärke nach verdoppelte und beinahe die Klänge des Abendständchens in „Platz“ übertäubte – denn es war wieder Konzert in jenem Hotel dort unten; eine symmetrisch gebaute und abgeschmackte Operettenmelodie klang durch das Dunkel herüber, und Hans Castorp pfiff sie im Flüstertone mit (man kann ja flüsternd pfeifen), während er mit seinen kalten Füßen unter dem Federdeckbett den Takt dazu schlug.
Das war natürlich die rechte Art nicht einzuschlafen, und Hans Castorp spürte jetzt auch gar keine Neigung dazu. Seit er auf so neuartige und lebhafte Weise verstanden, warum Joachim sich verfärbt hatte, schien die Welt ihm neu, und jenes Gefühl ausschweifender Freude und Hoffnung berührte ihn wieder in seinem Innersten. Übrigens wartete er noch auf etwas, ohne sich recht zu fragen, worauf. Als er aber hörte, wie die Nachbarn zur Rechten und Linken die abendliche Liegekur beendeten und ihre Zimmer aufsuchten, um die horizontale Lage draußen mit derjenigen drinnen zu vertauschen, gab er vor sich selbst der Überzeugung Ausdruck, daß das barbarische Ehepaar Frieden halten werde. Ich kann ruhig einschlafen, dachte er. Sie werden heute abend Frieden halten, das erwarte ich aufs Bestimmteste! Aber sie taten es nicht, und Hans Castorp hatte es auch gar nicht aufrichtig gedacht, ja, die Wahrheit zu sagen, hätte er es persönlich und seinerseits nicht einmal verstanden, wenn sie Frieden gegeben hätten. Trotzdem erging er sich in tonlos hervorgestoßenen Ausrufen des heftigsten Erstaunens über das, was er hörte. „Unerhört!“ rief er ohne Stimme. „Das ist enorm! Wer hätte dergleichen für möglich gehalten?“ Und zwischendurch beteiligte er sich wieder mit flüsternden Lippen an der abgeschmackten Operettenmelodie, die hartnäckig herübertönte.
Später kam der Schlummer. Aber mit ihm kamen die krausen Traumbilder, noch krausere, als in der ersten Nacht, aus denen er des öfteren schreckhaft oder einem wirren Einfall nachjagend emporfuhr. Ihm träumte, er sähe Hofrat Behrens mit krummen Knien und steif nach vorn hängenden Armen die Gartenpfade dahinwandeln, indem er seine langen und gleichsam öde anmutenden Schritte einer fernen Marschmusik anpaßte. Als der Hofrat vor Hans Castorp stehenblieb, trug er eine Brille mit dicken, kreisrunden Gläsern und faselte Ungereimtes. „Zivilist natürlich“, sagte er und zog, ohne um Erlaubnis zu bitten, Hans Castorps Augenlid mit Zeige- und Mittelfinger seiner riesigen Hand herunter. „Ehrsamer Zivilist, wie ich gleich bemerkte. Aber nicht ohne Talent, gar nicht ohne Talent zur erhöhten Allgemeinverbrennung! Würde mit den Jährchen nicht geizen, den flotten Dienstjährchen bei uns hier oben! Na, nun mal hoppla die Herren und los mit dem Lustwandel!“ rief er, indem er seine beiden enormen Zeigefinger in den Mund steckte und so eigentümlich wohllautend darauf pfiff, daß von verschiedenen Seiten und in verkleinerter Gestalt die Lehrerin und Miß Robinson durch die Lüfte geflogen kamen und sich ihm rechts und links auf die Schultern setzten, wie sie im Speisesaal rechts und links von Hans Castorp saßen. So ging der Hofrat mit hüpfenden Tritten davon, wobei er mit einer Serviette hinter die Brille fuhr, um sich die Augen zu wischen, – man wußte nicht, was da zu trocknen war, ob Schweiß oder Tränen.
Dann schien es dem Träumenden, als befinde er sich auf dem Schulhof, wo er so viele Jahre hindurch die Pausen zwischen den Unterrichtsstunden verbracht, und sei im Begriffe, sich von Madame Chauchat, die ebenfalls zugegen war, einen Bleistift zu leihen. Sie gab ihm den rotgefärbten, nur noch halblangen in einem silbernen Crayon steckenden Stift, indem sie Hans Castorp mit angenehm heiserer Stimme ermahnte, ihn ihr nach der Stunde bestimmt zurückzugeben, und als sie ihn ansah, mit ihren schmalen blaugraugrünen Augen über den breiten Backenknochen, da riß er sich gewaltsam aus dem Traum empor, denn nun hatte er es und wollte es festhalten, woran und an wen sie ihn eigentlich so lebhaft erinnerte. Eilig brachte er die Erkenntnis für morgen in Sicherheit, denn er fühlte, daß Schlaf und Traum ihn wieder umfingen, und sah sich alsbald in der Lage, Zuflucht vor Dr. Krokowski suchen zu müssen, der ihm nachstellte, um Seelenzergliederung mit ihm vorzunehmen, wovor Hans Castorp eine tolle, eine wahrhaft unsinnige Angst empfand. Er floh vor dem Doktor behinderten Fußes an den Glaswänden vorbei durch die Balkonlogen, sprang mit Gefahr seines Lebens in den Garten hinab, suchte in seiner Not sogar die rotbraune Flaggenstange zu erklettern und erwachte schwitzend in dem Augenblick, als der Verfolger ihn am Hosenbein packte.
Kaum jedoch hatte er sich ein wenig beruhigt und war wieder eingeschlummert, als sich der Sachverhalt folgendermaßen für ihn gestaltete. Er bemühte sich, mit der Schulter Settembrini vom Fleck zu drängen, welcher dastand und lächelte, – fein, trocken und spöttisch, unter dem vollen, schwarzen Schnurrbart, dort, wo er sich in schöner Rundung aufwärts bog, und dieses Lächeln eben war es, was Hans Castorp als Beeinträchtigung empfand. „Sie stören!“ hörte er sich deutlich sagen. „Fort mit Ihnen! Sie sind nur ein Drehorgelmann, und Sie stören hier!“ Allein Settembrini ließ sich nicht von der Stelle drängen, und Hans Castorp stand noch, um nachzudenken, was hier zu tun sei, als ihm ganz unverhofft die ausgezeichnete Einsicht zuteil wurde, was eigentlich die Zeit sei: nämlich nichts anderes, als einfach eine Stumme Schwester, eine Quecksilbersäule ganz ohne Bezifferung, für diejenigen, welche mogeln wollten, – worüber er mit dem bestimmten Vorhaben erwachte, seinem Vetter Joachim morgen von diesem Funde Mitteilung zu machen.
Unter solchen Abenteuern und Entdeckungen verging die Nacht, und auch Hermine Kleefeld sowie Herr Albin und Hauptmann Miklosich, welch letzterer Frau Stöhr in seinem Rachen davontrug und von Staatsanwalt Paravant mit einem Speere durchbohrt wurde, spielten ihre verworrene Rolle dabei. Einen Traum aber träumte Hans Castorp sogar zweimal in dieser Nacht und zwar beide Male genau in derselben Form, – das letztemal gegen Morgen. Er saß im Saal mit den sieben Tischen, als unter dem größten Geschmetter die Glastür ins Schloß fiel und Madame Chauchat hereinkam, im weißen Sweater, die eine Hand in der Tasche, die andere am Hinterkopf. Statt aber zum Guten Russentische zu gehen, bewegte die unerzogene Frau sich ohne Laut auf Hans Castorp zu und reichte ihm schweigend die Hand zum Kusse, – aber nicht den Handrücken reichte sie ihm, sondern das Innere, und Hans Castorp küßte sie in die Hand, in ihre unveredelte, ein wenig breite und kurzfingerige Hand mit der aufgerauhten Haut zu Seiten der Nägel. Da durchdrang ihn wieder von Kopf bis zu Fuß jenes Gefühl von wüster Süßigkeit, das in ihm aufgestiegen war, als er zur Probe sich des Druckes der Ehre ledig gefühlt und die bodenlosen Vorteile der Schande genossen hatte, – dies empfand er nun wieder in seinem Traum, nur ungeheuer viel stärker.
„Ist jetzt euer Sommer zu Ende?“ fragte Hans Castorp am dritten Tage ironisch seinen Vetter ...
Es war ein schrecklicher Wettersturz.
Der zweite Tag, den der Hospitant vollständig hier oben verlebt hatte, war prächtig-sommerlich gewesen. Tiefblau leuchtete der Himmel über den lanzenartigen Wipfeltrieben der Fichten, während die Ortschaft im Talgrunde grell in der Hitze schimmerte und das Geläut der Kühe, die umherwandelnd das kurze, erwärmte Mattengras der Lehnen rupften, heiter-beschaulich die Lüfte erfüllte. Die Damen waren schon zum ersten Frühstück in zarten Waschblusen erschienen, einige sogar mit durchbrochenen Ärmeln, was nicht alle gleich gut gekleidet hatte, – Frau Stöhr zum Beispiel kleidete es entschieden schlecht, ihre Arme waren zu schwammig, Duftigkeit der Kleidung eignete sich nun einmal nicht für sie. Auch die Herrenwelt des Sanatoriums hatte der schönen Witterung auf verschiedene Weise in ihrem Äußeren Rechnung getragen. Lüsterjacken und leinene Anzüge waren aufgetaucht, und Joachim Ziemßen hatte elfenbeinfarbene Flanellhosen zu seinem blauen Rock getragen, eine Zusammenstellung, die seiner Erscheinung ein vollständig militärisches Gepräge verlieh. Was Settembrini betraf, so hatte er zwar wiederholt das Vorhaben geäußert, den Anzug zu wechseln. „Teufel!“ hatte er gesagt, als er nach dem Lunch mit den Vettern in den Ort hinunterpromenierte, „wie die Sonne brennt! Ich sehe, ich werde mich leichter kleiden müssen.“ Aber trotzdem es gewählt ausgedrückt war, hatte er nach wie vor seinen langen Flaus mit den großen Aufschlägen und seine gewürfelten Beinkleider anbehalten, – wahrscheinlich war das alles, was er an Garderobe besaß.
Am dritten Tage jedoch war es genau, als ob die Natur zu Falle gebracht und jede Ordnung auf den Kopf gestellt würde; Hans Castorp traute seinen Augen nicht. Es war nach der Hauptmahlzeit, und man befand sich seit zwanzig Minuten in der Liegekur, als die Sonne sich eilig verbarg, häßlich torfbraunes Gewölk über die südöstlichen Kämme heraufzog und ein Wind von fremder Luftbeschaffenheit, kalt und das Gebein erschreckend, als käme er aus unbekannten, eisigen Gegenden, plötzlich durch das Tal fegte, die Temperatur umstürzte und ein ganz neues Regiment eröffnete.
„Schnee“, sagte Joachims Stimme hinter der Glaswand.
„Was meinst du mit ‚Schnee‘?“ fragte Hans Castorp darauf. „Du willst doch nicht sagen, daß es jetzt schneien wird?“
„Sicher“, antwortete Joachim. „Den Wind, den kennen wir. Wenn der kommt, dann gibt es Schlittenbahn.“
„Unsinn!“ sagte Hans Castorp. „Wenn mir recht ist, so schreiben wir Anfang August.“
Aber Joachim hatte wahr gesprochen, eingeweiht, wie er war in die Verhältnisse. Denn binnen wenigen Augenblicken setzte unter wiederholten Gewitterschlägen ein gewaltiges Schneetreiben ein, – ein Gestöber, so dicht, daß alles in weißen Dampf gehüllt erschien und man von Ortschaft und Tal fast nichts mehr erblickte.
Es schneite den ganzen Nachmittag fort. Die Zentralheizung ward angezündet, und während Joachim seinen Pelzsack in Benutzung nahm und sich im Kurdienste nicht stören ließ, flüchtete sich Hans Castorp in das Innere seines Zimmers, rückte einen Stuhl an die erwärmten Röhren und blickte von dort unter häufigem Kopfschütteln in das Unwesen hinaus. Am nächsten Morgen schneite es nicht mehr; aber obgleich das Außenthermometer einige Wärmegrade zeigte, war der Schnee doch fußhoch liegen geblieben, so daß eine vollkommene Winterlandschaft sich vor Hans Castorps verwunderten Blicken ausbreitete. Man hatte die Heizung wieder ausgehen lassen. Die Zimmertemperatur betrug sechs Grad über Null.
„Ist jetzt euer Sommer zu Ende?“ fragte Hans Castorp seinen Vetter mit bitterer Ironie ...
„Das kann man nicht sagen“, erwiderte Joachim sachlich. „Will’s Gott, so wird es noch schöne Sommertage geben. Selbst im September ist das noch sehr wohl möglich. Aber die Sache ist die, daß die Jahreszeiten hier nicht so sehr voneinander verschieden sind, weißt du, sie vermischen sich sozusagen und halten sich nicht an den Kalender. Im Winter ist oft die Sonne so stark, daß man schwitzt und den Rock auszieht beim Spazierengehen, und im Sommer, nun, das siehst du ja schon, wie es im Sommer hier manchmal ist. Und dann der Schnee – er bringt alles durcheinander. Es schneit im Januar, aber im Mai nicht viel weniger, und im August schneit es auch, wie du bemerkst. Im ganzen kann man sagen, daß kein Monat vergeht, ohne daß es schneit, das ist ein Satz, an dem man festhalten kann. Kurz, es gibt Wintertage und Sommertage und Frühlings- und Herbsttage, aber so richtige Jahreszeiten, die gibt es eigentlich nicht bei uns hier oben.“
„Das ist ja eine schöne Konfusion“, sagte Hans Castorp. Er ging in Überschuhen und Winterpaletot mit seinem Vetter in den Ort hinab, um sich Decken für die Liegekur zu besorgen, denn es war klar, daß er bei dieser Witterung mit seinem Plaid nicht auskommen werde. Vorübergehend erwog er sogar, ob er nicht zum Kauf eines Pelzsackes schreiten solle, nahm dann aber Abstand davon, ja, schreckte gewissermaßen vor dem Gedanken zurück.
„Nein, nein,“ sagte er, „bleiben wir bei den Decken! Ich werde unten schon wieder Verwendung für sie haben, und Decken hat man ja überall, es ist weiter nichts so Besonderes oder Aufregendes dabei. Aber so ein Pelzsack ist etwas gar zu Spezielles, – versteh’ mich recht, wenn ich mir einen Pelzsack anschaffe, käme ich mir selber vor, als ob ich mich hier häuslich niederlassen wollte und schon gewissermaßen zu euch gehörte ... Kurz, ich will nichts weiter sagen, als daß es ja absolut nicht lohnen würde, für die paar Wochen eigens einen Pelzsack zu kaufen.“
Joachim stimmte dem zu, und so erstanden sie denn in einem hübschen, reichhaltigen Geschäft des Englischen Viertels zwei solche Kamelhaardecken, wie Joachim sie hatte, ein besonders langes und breites, angenehm weiches Fabrikat in Naturfarbe, und gaben Order, daß sie sofort ins Sanatorium gesandt werden sollten, ins Internationale Sanatorium „Berghof“, Zimmertür 34. Gleich heute nachmittag wollte Hans Castorp sie zum erstenmal in Gebrauch nehmen.
Natürlich war es um die Zeit nach dem zweiten Frühstück, denn sonst bot die Tagesordnung keine Gelegenheit, in den Ort hinunterzugehen. Es regnete jetzt, und der Schnee auf den Straßen hatte sich in spritzenden Eisbrei verwandelt. Auf dem Heimwege holten sie Settembrini ein, welcher unter einem Regenschirm, wenn auch barhäuptig, ebenfalls dem Sanatorium zustrebte. Der Italiener sah gelb aus und befand sich ersichtlich in elegischer Stimmung. In reinen und wohlgeformten Worten jammerte er über die Kälte, die Nässe, unter der er so bitter litt. Wenn wenigstens geheizt würde! Aber diese elenden Machthaber ließen die Heizung ja ausgehen, sobald es zu schneien aufhöre, – eine stumpfsinnige Regel, ein Hohn auf alle Vernunft! Und als Hans Castorp einwandte, er denke sich, daß eine mäßige Zimmertemperatur wohl zu den Kurprinzipien gehöre, – man wolle einer Verwöhnung der Patienten offenbar damit vorbeugen, da antwortete Settembrini mit dem heftigsten Spott. Ei, in der Tat, die Kurprinzipien. Die hehren und unantastbaren Kurprinzipien! Hans Castorp spreche wahrhaftig in dem richtigen Tone von ihnen, nämlich in dem der Religiosität und der Unterwürfigkeit. Nur auffallend – wenn auch in einem durchaus erfreulichen Sinne auffallend, – daß gerade diejenigen unter ihnen so unbedingte Verehrung genössen, die mit den ökonomischen Interessen der Gewalthaber genau übereinstimmten, – während man denen gegenüber, bei denen dies weniger zutreffe, ein Auge zuzudrücken geneigt sei ... Und während die Vettern lachten, kam Settembrini auf seinen verstorbenen Vater zu sprechen, im Zusammenhang mit der Wärme, nach der er sich sehnte.
„Mein Vater,“ sagte er gedehnt und schwärmerisch, – „er war ein so feiner Mann, – empfindlich am Körper wie an der Seele! Wie liebte er im Winter sein kleines, warmes Studierstübchen, von Herzen liebte er es, stets mußten zwanzig Grad Réaumur darin herrschen, vermöge eines rotglühenden Öfchens, und wenn man an naßkalten Tagen oder an solchen, wenn der schneidende Tramontanawind ging, vom Flure des Häuschens her eintrat, so legte die Wärme sich einem wie ein linder Mantel um die Schultern, und die Augen füllten sich mit wohligen Tränen. Vollgepfropft war das Stübchen mit Büchern und Handschriften, worunter sich große Kostbarkeiten befanden, und zwischen den Geistesschätzen stand er in seinem Schlafrock aus blauem Flanell am schmalen Pult und widmete sich der Literatur, – zierlich und klein von Person, einen guten Kopf kleiner als ich, stellen Sie sich vor! aber mit dicken Büscheln aus grauem Haar an den Schläfen und einer Nase, so lang und fein ... Welch ein Romanist, meine Herren! Einer der Ersten seiner Zeit, ein Kenner unserer Sprache wie wenige, ein lateinischer Stilist wie sonst keiner mehr, ein uomo letterato nach Boccaccios Herzen ... Von weither kamen die Gelehrten, um sich mit ihm zu besprechen, der eine aus Haparanda, ein anderer aus Krakau, sie kamen ausdrücklich nach Padua, unserer Stadt, um ihm Hochachtung zu erweisen, und er empfing sie mit freundlicher Würde. Auch ein Dichter von Distinktion war er, welcher in seinen Mußestunden Erzählungen in der elegantesten toskanischen Prosa verfaßte, – ein Meister des idioma gentile“, sagte Settembrini mit äußerstem Genuß, indem er die heimatlichen Silben langsam auf der Zunge zergehen ließ und den Kopf dabei hin und her bewegte. „Sein Gärtchen baute er nach dem Beispiele Vergils,“ fuhr er fort, „und was er sprach, war gesund und schön. Aber warm, warm mußte er es haben in seinem Stübchen, sonst zitterte er und konnte wohl Tränen vergießen vor Ärger, daß man ihn frieren ließ. Und nun stellen Sie sich vor, Ingenieur, und Sie, Leutnant, was ich, der Sohn meines Vaters, an diesem verdammten und barbarischen Orte leiden muß, wo der Körper im hohen Sommer vor Kälte zittert und erniedrigende Eindrücke beständig die Seele foltern! Ach, es ist hart! Welche Typen, die uns umgeben! Dieser närrische Teufelsknecht von Hofrat. Krokowski“ – und Settembrini tat, als müsse er sich die Zunge zerbrechen – „Krokowski, dieser schamlose Beichtvater, der mich haßt, weil meine Menschenwürde mir verbietet, mich zu seinem pfäffischen Unwesen herzugeben ... Und an meinem Tische ... Welche Gesellschaft, in der ich zu speisen gezwungen bin! Zu meiner Rechten sitzt ein Bierbrauer aus Halle – Magnus ist sein Name – mit einem Schnurrbart, der einem Heubündel ähnelt. ‚Lassen Sie mich mit der Literatur in Ruhe!‘ sagt er. ‚Was bietet sie? Schöne Charaktere! Was fang ich mit schönen Charakteren an! Ich bin ein praktischer Mann, und schöne Charaktere kommen im Leben fast gar nicht vor.‘ Dies ist die Vorstellung, die er sich von der Literatur gebildet hat. Schöne Charaktere ... o Mutter Gottes! Seine Frau, ihm gegenüber, sitzt da und verliert Eiweiß, während sie mehr und mehr in Stumpfsinn versinkt. Es ist ein schmutziger Jammer ...“
Ohne daß sie sich miteinander verständigt hätten, waren Joachim und Hans Castorp eines Sinnes über diese Reden: sie fanden sie wehleidig und unangenehm aufrührerisch, freilich auch unterhaltsam, ja bildend in ihrer kecken und wortscharfen Aufsässigkeit. Hans Castorp lachte gutmütig über das „Heubündel“ und auch über die „schönen Charaktere“, oder vielmehr über die drollig verzweifelte Art, in der Settembrini davon sprach. Dann sagte er:
„Gott, ja, die Gesellschaft ist wohl ein bißchen gemischt in so einer Anstalt. Man kann sich die Tischnachbarn nicht aussuchen, – wohin sollte denn das auch führen. An unserem Tisch sitzt auch so eine Dame ... Frau Stöhr, – ich denke mir, daß Sie sie kennen? Mörderlich ungebildet ist sie, das muß man ja sagen, und manchmal weiß man nicht recht, wo man hinsehen soll, wenn sie so plappert. Und dabei klagt sie sehr über ihre Temperatur und daß sie so schlaff ist, und ist wohl leider gar kein ganz leichter Fall. Das ist so sonderbar, – krank und dumm – ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, aber mich mutet es ganz eigentümlich an, wenn einer dumm ist und dann auch noch krank, wenn das so zusammenkommt, das ist wohl das Trübseligste auf der Welt. Man weiß absolut nicht, was man für ein Gesicht dazu machen soll, denn einem Kranken möchte man doch Ernst und Achtung entgegenbringen, nicht wahr, Krankheit ist doch gewissermaßen etwas Ehrwürdiges, wenn ich so sagen darf. Aber wenn nun immer die Dummheit dazwischen kommt mit ‚Fomulus‘ und ‚kosmische Anstalt‘ und solchen Schnitzern, da weiß man wahrhaftig nicht mehr, ob man weinen oder lachen soll, es ist ein Dilemma für das menschliche Gefühl und so kläglich, daß ich es gar nicht sagen kann. Ich meine, es reimt sich nicht, es paßt nicht zusammen, man ist nicht gewöhnt, es sich zusammen vorzustellen. Man denkt, ein dummer Mensch muß gesund und gewöhnlich sein, und Krankheit muß den Menschen fein und klug und besonders machen. So denkt man es sich in der Regel. Oder nicht? Ich sage da wohl mehr, als ich verantworten kann“, schloß er. „Es ist nur, weil wir zufällig darauf kamen ...“ Und er verwirrte sich.
Auch Joachim war etwas verlegen, und Settembrini schwieg mit erhobenen Augenbrauen, indem er sich den Anschein gab, als warte er aus Höflichkeit das Ende der Rede ab. In Wirklichkeit hatte er es darauf abgesehen, Hans Castorp erst völlig aus dem Konzept kommen zu lassen, bevor er antwortete:
„Sapristi, Ingenieur, Sie legen da philosophische Gaben an den Tag, deren ich mich gar nicht von Ihnen versehen hätte! Ihrer Theorie zufolge müßten Sie weniger gesund sein, als Sie sich den Anschein geben, da Sie offenbar Geist besitzen. Erlauben Sie mir aber, Ihnen zu bemerken, daß ich Ihren Deduktionen nicht folgen kann, daß ich sie ablehne, ja ihnen in wirklicher Feindseligkeit gegenüberstehe. Ich bin, wie Sie mich da sehen, ein wenig unduldsam in geistigen Dingen und lasse mich lieber einen Pedanten schelten, als daß ich Ansichten unbekämpft ließe, die mir so bekämpfenswert scheinen wie die von Ihnen entwickelten ...“
„Aber, Herr Settembrini ...“
„Ge–statten Sie mir ... Ich weiß, was Sie sagen wollen. Sie wollen sagen, daß Sie es so ernst nicht gemeint haben, daß die von Ihnen vertretenen Anschauungen nicht ohne Weiteres die Ihren sind, sondern daß Sie gleichsam nur eine der möglichen und in der Luft schwebenden Anschauungen aufgriffen, um sich unverantwortlicherweise einmal darin zu versuchen. So entspricht es Ihrem Alter, welches männlicher Entschlossenheit noch entraten und vorderhand mit allerlei Standpunkten Versuche anstellen mag. Placet experiri“, sagte er, indem er das c von „Placet“ weich, nach italienischer Mundart sprach. „Ein guter Satz. Was mich stutzig macht, ist eben nur die Tatsache, daß Ihr Experiment sich gerade in dieser Richtung bewegt. Ich bezweifle, daß hier Zufall waltet. Ich befürchte das Vorhandensein einer Neigung, die sich charaktermäßig zu befestigen droht, wenn man ihr nicht entgegentritt. Darum fühle ich mich verpflichtet, Sie zu korrigieren. Sie äußerten, Krankheit mit Dummheit gepaart sei das Trübseligste auf der Welt. Ich kann Ihnen das zugeben. Auch mir ist ein geistreicher Kranker lieber als ein schwindsüchtiger Dummkopf. Aber mein Protest beginnt, wenn Sie Krankheit mit Dummheit im Verein gewissermaßen als einen Stilfehler betrachten, als eine Geschmacksverirrung der Natur und ein Dilemma für das menschliche Gefühl, wie Sie sich auszudrücken beliebten. Wenn Sie Krankheit für etwas so Vornehmes und – wie sagten Sie doch – Ehrwürdiges zu halten scheinen, daß sie sich mit Dummheit schlechterdings nicht zusammenreimt. Dies war ebenfalls Ihr Ausdruck. Nun denn, nein! Krankheit ist durchaus nicht vornehm, durchaus nicht ehrwürdig, – diese Auffassung ist selbst Krankheit oder sie führt dazu. Vielleicht rufe ich am sichersten Ihren Abscheu gegen sie wach, wenn ich Ihnen sage, daß sie betagt und häßlich ist. Sie rührt aus abergläubisch zerknirschten Zeiten her, in denen die Idee des Menschlichen zum Zerrbild entartet und entwürdigt war, angstvollen Zeiten, denen Harmonie und Wohlsein als verdächtig und teuflisch galten, während Bresthaftigkeit damals einem Freibrief zum Himmelreich gleichkam. Vernunft und Aufklärung jedoch haben diese Schatten vertrieben, welche auf der Seele der Menschheit lagerten, – noch nicht völlig, sie liegen noch heute im Kampfe mit ihnen; dieser Kampf aber heißt Arbeit, mein Herr, irdische Arbeit, Arbeit für die Erde, für die Ehre und die Interessen der Menschheit, und täglich aufs neue gestählt in solchem Kampfe, werden jene Mächte den Menschen vollends befreien und ihn auf den Wegen des Fortschrittes und der Zivilisation einem immer helleren, milderen und reineren Lichte entgegenleiten.“
Donnerwetter, dachte Hans Castorp bestürzt und beschämt, das ist ja eine Arie! Womit habe ich denn das herausgefordert? Etwas trocken kommt es mir übrigens vor. Und was er nur immer mit der Arbeit will. Immer hat er es mit der Arbeit, obgleich es doch wenig hierher paßt. Und er sagte:
„Sehr schön, Herr Settembrini. Es ist geradezu hörenswert, wie Sie das so zu sagen wissen. Man könnte es gar nicht ... gar nicht plastischer ausdrücken, meine ich.“
„Rückneigung,“ setzte Settembrini wieder ein, indem er seinen Regenschirm über den Kopf eines Vorübergehenden hinweghob, „geistige Rückneigung in die Anschauungen jener finsteren, gequälten Zeiten – glauben Sie mir, Ingenieur, das ist Krankheit, – eine sattsam erforschte Krankheit, für welche die Wissenschaft verschiedene Namen besitzt, einen aus der Sprache der Schönheits- und Seelenlehre und einen aus der der Politik, – Schulausdrücke, die nichts zur Sache tun und deren Sie gern entraten mögen. Da aber im Geistesleben alles zusammenhängt und eines sich aus dem andern ergibt, da man dem Teufel nicht den kleinen Finger reichen darf, ohne daß er die ganze Hand nimmt und den ganzen Menschen dazu ... da andererseits ein gesundes Prinzip immer nur lauter Gesundes zeitigen kann, gleichviel, welches man nun an den Anfang stelle, – so prägen Sie es sich ein, daß Krankheit, weit entfernt, etwas Vornehmes, etwas allzu Ehrwürdiges zu sein, um mit Dummheit leidlicherweise verbunden sein zu dürfen, vielmehr Erniedrigung bedeutet, – ja, eine schmerzliche, die Idee verletzende Erniedrigung des Menschen, die man im Einzelfalle schonen und betreuen möge, aber die geistig zu ehren Verirrung – prägen Sie sich das ein! – eine Verirrung und aller geistigen Verirrung Anfang ist. Diese Frau, deren Sie Erwähnung taten, – ich verzichte darauf, mich ihres Namens zu entsinnen – Frau Stöhr also, ich danke sehr – kurzum, diese lächerliche Frau, – nicht ihr Fall ist es, wie mir scheint, der das menschliche Gefühl, wie Sie sagten, in ein Dilemma versetzt. Krank und dumm, – in Gottes Namen, das ist die Misere selbst, die Sache ist einfach, es bleibt nichts als Erbarmen und Achselzucken. Das Dilemma, mein Herr, die Tragik beginnt, wo die Natur grausam genug war, die Harmonie der Persönlichkeit zu brechen – oder von vornherein unmöglich zu machen –, indem sie einen edlen und lebenswilligen Geist mit einem zum Leben nicht tauglichen Körper verband. Kennen Sie Leopardi, Ingenieur, oder Sie, Leutnant? Ein unglücklicher Dichter meines Landes, ein bucklichter, kränklicher Mann mit ursprünglich großer, durch das Elend seines Körpers aber beständig gedemütigter und in die Niederungen der Ironie herabgezogener Seele, deren Klagen das Herz zerreißen. Hören Sie dieses!“
Und Settembrini begann, italienisch zu rezitieren, indem er die schönen Silben auf der Zunge zergehen ließ, den Kopf hin und her bewegte und zuweilen die Augen schloß, unbekümmert darum, daß seine Begleiter kein Wort verstanden. Sichtlich war es ihm darum zu tun, sein Gedächtnis und seine Aussprache selbst zu genießen und vor den Zuhörern zur Geltung zu bringen. Endlich sagte er:
„Aber Sie verstehen nicht, Sie hören, ohne den schmerzlichen Sinn zu erfassen. Der Krüppel Leopardi, meine Herren, empfinden Sie dies ganz, entbehrte vor allem der Frauenliebe, und dies war es wohl namentlich, was ihn unfähig machte, der Verkümmerung seiner Seele zu steuern. Der Glanz des Ruhmes und der Tugend verblaßte ihm, die Natur erschien ihm böse – übrigens ist sie böse, dumm und böse, ich gebe ihm recht hierin – und er verzweifelte – es ist furchtbar zu sagen – er verzweifelte an Wissenschaft und Fortschritt! Hier haben Sie Tragik, Ingenieur. Hier haben Sie Ihr ‚Dilemma für das menschliche Gefühl‘, – nicht bei jener Frau dort, – ich lehne es ab, mein Gedächtnis um ihren Namen zu bemühen ... Sprechen Sie mir nicht von der ‚Vergeistigung‘, die durch Krankheit hervorgebracht werden kann, um Gottes willen, tun Sie es nicht! Eine Seele ohne Körper ist so unmenschlich und entsetzlich, wie ein Körper ohne Seele, und übrigens ist das erstere die seltene Ausnahme und das zweite die Regel. In der Regel ist es der Körper, der überwuchert, der alle Wichtigkeit, alles Leben an sich reißt und sich aufs widerwärtigste emanzipiert. Ein Mensch, der als Kranker lebt, ist nur Körper, das ist das Widermenschliche und Erniedrigende, – er ist in den meisten Fällen nichts Besseres als ein Kadaver ...“
„Komisch“, sagte Joachim plötzlich, indem er sich vorbeugte, um seinen Vetter anzusehen, der an Settembrinis anderer Seite ging. „Etwas ganz ähnliches hast du doch neulich auch gesagt.“
„So?“ sagte Hans Castorp. „Ja, es kann ja wohl sein, daß mir was ähnliches auch schon durch den Kopf ging.“
Settembrini schwieg während einiger Schritte. Dann sagte er:
„Desto besser, meine Herren. Desto besser, wenn dem so ist. Die Absicht lag mir fern, Ihnen irgendwelche Originalphilosophie vorzutragen, – das ist nicht meines Amtes. Wenn unser Ingenieur schon seinerseits Übereinstimmendes angemerkt hat, so bestätigt dies nur meine Mutmaßung, daß er geistig dilettiert, daß er nach Art begabter Jugend mit den möglichen Anschauungen vorläufig nur Versuche anstellt. Der begabte junge Mensch ist kein unbeschriebenes Blatt, er ist vielmehr ein Blatt, auf dem gleichsam mit sympathetischer Tinte alles schon geschrieben steht, das Rechte wie das Schlechte, und Sache des Erziehers ist es, das Rechte entschieden zu entwickeln, das Falsche aber, das hervortreten will, durch sachgemäße Einwirkung auf immer auszulöschen. Die Herren haben Einkäufe gemacht?“ fragte er veränderten, leichten Tones ...
„Nein, nichts weiter,“ sagte Hans Castorp, „das heißt ...“
„Wir haben ein paar Decken für meinen Vetter besorgt“, antwortete Joachim gleichgültig.
„Für die Liegekur ... Bei dieser Hundekälte ... Ich soll ja mitmachen die paar Wochen“, sagte Hans Castorp lachend und sah zu Boden.
„Ah, Decken, Liegekur“, sagte Settembrini. „So, so, so. Ei, ei, ei. In der Tat: Placet experiri!“ wiederholte er mit italienischer Aussprache und verabschiedete sich, denn sie hatten, begrüßt von dem hinkenden Concierge, das Sanatorium betreten, und in der Halle schwenkte Settembrini in die Konversationsräume ab, um vor Tische die Zeitungen zu lesen, wie er sagte. Die zweite Liegekur schien er schwänzen zu wollen.
„Gott bewahre!“ sagte Hans Castorp, als er mit Joachim im Lift stand. „Das ist wirklich ein Pädagog, – er sagte es ja neulich schon selbst, daß er so eine Ader habe. Man muß furchtbar aufpassen mit ihm, daß man kein Wort zu viel sagt, sonst gibt es ausführliche Lehren. Aber hörenswert ist es ja, wie er zu sprechen versteht, jedes Wort springt ihm so rund und appetitlich vom Munde, – ich muß immer an frische Semmeln denken, wenn ich ihm zuhöre.“
Joachim lachte.
„Das sage ihm lieber nicht. Ich glaube doch, er wäre enttäuscht, zu erfahren, daß du an Semmeln denkst bei seinen Lehren.“
„Meinst du? Ja, das ist noch gar nicht mal sicher. Ich habe immer den Eindruck, daß es ihm nicht ganz allein um die Lehren zu tun ist, vielleicht um sie erst in zweiter Linie, sondern besonders um das Sprechen, wie er die Worte springen und rollen läßt ... so elastisch, wie Gummibälle ... und daß es ihm gar nicht unangenehm ist, wenn man namentlich auch darauf achtet. Bierbrauer Magnus ist ja wohl etwas dumm mit seinen ‚schönen Charakteren‘, aber Settembrini hätte doch sagen sollen, worauf es denn eigentlich ankommt in der Literatur. Ich mochte nicht fragen, um mir keine Blöße zu geben, ich verstehe mich ja auch nicht weiter darauf und hatte bis jetzt noch nie einen Literaten gesehen. Aber wenn es nicht auf die schönen Charaktere ankommt, so kommt es offenbar auf die schönen Worte an, das ist mein Eindruck in Settembrinis Gesellschaft. Was er für Vokabeln gebraucht! Ganz ohne sich zu genieren spricht er von ‚Tugend‘ – ich bitte dich! Mein ganzes Leben lang habe ich das Wort noch nicht in den Mund genommen, und selbst in der Schule haben wir immer bloß ‚Tapferkeit‘ gesagt, wenn ‚virtus‘ im Buche stand. Es zog sich etwas zusammen in mir, das muß ich sagen. Und dann macht es mich etwas nervös, wenn er so schimpft, auf die Kälte und auf Behrens und auf Frau Magnus, weil sie Eiweiß verliert, und kurz, auf alles. Er ist ein Oppositionsmann, darüber war ich mir gleich im klaren. Er hackt auf alles Bestehende, und das hat immer etwas Verwahrlostes, ich kann mir nicht helfen.“
„Das sagst du so“, antwortete Joachim bedächtig. „Aber dann hat es doch wieder auch etwas Stolzes, was gar nicht verwahrlost anmutet, sondern im Gegenteil, er ist doch ein Mensch, der auf sich hält, oder auf die Menschen im allgemeinen, und das gefällt mir an ihm, das hat was Anständiges in meinen Augen.“
„Da hast du recht“, sagte Hans Castorp. „Er hat sogar etwas Strenges, – es wird einem öfter ganz ungemütlich, weil man sich – sagen wir mal: kontrolliert fühlt, doch, das ist gar keine schlechte Bezeichnung. Willst du glauben, daß ich immer das Gefühl hatte, er wäre nicht einverstanden damit, daß ich mir Decken zum Liegen gekauft habe, er hätte etwas dagegen und hielte sich irgendwie darüber auf?“
„Nein“, sagte Joachim erstaunt und besonnen. „Wie könnte das wohl sein. Das kann ich mir doch nicht denken.“ Und dann ging er, das Thermometer im Munde, mit Sack und Pack in die Liegekur, während Hans Castorp gleich begann, sich für die Mittagsmahlzeit zu säubern und umzukleiden, – es war ohnedies nur noch ein knappes Stündchen bis dahin.
Als sie vom Essen wieder heraufkamen, lag das Paket mit den Decken schon in Hans Castorps Zimmer auf einem Stuhl, und zum erstenmal machte er an diesem Tage Gebrauch davon, – der geübte Joachim erteilte ihm Unterricht in der Kunst, sich einzupacken, wie es alle hier oben machten und jeder Neuling es gleich erlernen mußte. Man breitete die Decken, eine und dann die andere, über das Stuhllager, so daß sie am Fußende ein reichliches Stück auf den Boden hingen. Dann nahm man Platz und begann, die innere um sich zu schlagen: zuerst der Länge nach bis unter die Achsel, hierauf von unten über die Füße, wobei man sich sitzend bücken und das gefaltete Ende doppelt fassen mußte, und dann von der anderen Seite, wobei der doppelte Fußzipfel gut an den Längsrand zu passen war, wenn die größtmögliche Glätte und Ebenmäßigkeit erzielt werden sollte. Danach beobachtete man genau dasselbe Verfahren bei der äußeren Decke, – ihre Handhabung war etwas schwieriger, und Hans Castorp, als Stümper und Anfänger, ächzte nicht wenig, indem er, sich bückend und wieder ausstreckend, die Griffe übte, die man ihn lehrte. Nur einige wenige Altgediente, sagte Joachim, könnten beide Decken gleichzeitig mit drei sicheren Bewegungen um sich schleudern, aber das sei eine seltene und geneidete Fertigkeit, zu der nicht nur langjährige Übung, sondern auch eine natürliche Anlage gehöre. Über dies Wort mußte Hans Castorp lachen, während er mit schmerzendem Rücken sich zurückfallen ließ, und Joachim, der nicht gleich verstand, was hier komisch war, sah ihn unsicher an, lachte dann aber auch.
„So,“ sagte er, als Hans Castorp ungegliedert und walzenförmig, die nachgiebige Rolle im Nacken und erschöpft von all der Gymnastik im Stuhle lag, „wenn es nun zwanzig Grad Kälte hätte, so könnte dir auch nichts passieren.“ Und dann ging er hinter die Glaswand, um sich ebenfalls einzupacken.
Das mit den zwanzig Grad Kälte bezweifelte Hans Castorp, denn ihn fror entschieden, Schauer überliefen ihn wiederholt, während er durch die Holzbögen in die sickernde, nieselnde Nässe dort draußen blickte, die jeden Augenblick auf dem Punkte schien, wieder in Schneefall überzugehen. Wie sonderbar übrigens, daß er bei all der Feuchtigkeit immer noch so trockenhitzige Backen hatte, als säße er in einem überheizten Zimmer. Auch fühlte er sich lächerlich angegriffen von den Übungen mit den Decken, – wahrhaftig, „Ocean steamships“ zitterte ihm in den Händen, sobald er es vor die Augen führte. So überaus gesund war er doch eben auch nicht, – total anämisch, wie Hofrat Behrens gesagt hatte, und deswegen neigte er wohl auch so zum Froste. Die unangenehmen Empfindungen jedoch wurden aufgewogen durch die große Bequemlichkeit seiner Lage, die schwer zu zergliedernden und fast geheimnisvollen Eigenschaften des Liegestuhles, die Hans Castorp beim ersten Versuche schon mit höchstem Beifall empfunden hatte, und die sich wieder und wieder aufs glücklichste bewährten. Lag es an der Beschaffenheit der Polster, der richtigen Neigung der Rückenlehne, der passenden Höhe und Breite der Armstützen oder auch nur der zweckmäßigen Konsistenz der Nackenrolle, genug, es konnte für das Wohlsein ruhender Glieder überhaupt nicht humaner gesorgt sein, als durch diesen vorzüglichen Liegestuhl. Und so war denn Zufriedenheit in Hans Castorps Herzen darüber, daß zwei leere und sicher gefriedete Stunden vor ihm lagen, diese durch die Hausordnung geheiligten Stunden der Hauptliegekur, die er, obgleich nur zu Gaste hier oben, als eine ihm ganz gemäße Einrichtung empfand. Denn er war geduldig von Natur, konnte lange ohne Beschäftigung wohl bestehen und liebte, wie wir uns erinnern, die freie Zeit, die von betäubender Tätigkeit nicht vergessen gemacht, verzehrt und verscheucht wird. Um vier erfolgte der Vespertee mit Kuchen und Eingemachtem, etwas Bewegung im Freien sodann, hierauf abermals Ruhe im Stuhl, um sieben das Abendessen, welches, wie überhaupt die Mahlzeiten, gewisse Spannungen und Sehenswürdigkeiten mit sich brachte, auf die man sich freuen konnte, danach ein oder der andere Blick in den stereoskopischen Guckkasten, das kaleidoskopische Fernrohr und die kinematographische Trommel ... Hans Castorp hatte den Tageslauf bereits am Schnürchen, wenn es auch viel zu viel gesagt wäre, daß er schon „eingelebt“, wie man es nennt, gewesen sei.
Im Grunde hat es eine merkwürdige Bewandtnis mit diesem Sicheinleben an fremdem Orte, dieser – sei es auch – mühseligen Anpassung und Umgewöhnung, welcher man sich beinahe um ihrer selbst willen und in der bestimmten Absicht unterzieht, sie, kaum daß sie vollendet ist, oder doch bald danach, wieder aufzugeben und zum vorigen Zustande zurückzukehren. Man schaltet dergleichen als Unterbrechung und Zwischenspiel in den Hauptzusammenhang des Lebens ein, und zwar zum Zweck der „Erholung“, das heißt: der erneuernden, umwälzenden Übung des Organismus, welcher Gefahr lief und schon im Begriffe war, im ungegliederten Einerlei der Lebensführung sich zu verwöhnen, zu erschlaffen und abzustumpfen. Worauf beruht dann aber diese Erschlaffung und Abstumpfung bei zu langer nicht aufgehobener Regel? Es ist nicht so sehr körperlich-geistige Ermüdung und Abnutzung durch die Anforderungen des Lebens, worauf sie beruht (denn für diese wäre ja einfache Ruhe das wiederherstellende Heilmittel); es ist vielmehr etwas Seelisches, es ist das Erlebnis der Zeit, – welches bei ununterbrochenem Gleichmaß abhanden zu kommen droht und mit dem Lebensgefühle selbst so nahe verwandt und verbunden ist, daß das eine nicht geschwächt werden kann, ohne daß auch das andere eine kümmerliche Beeinträchtigung erführe. Über das Wesen der Langenweile sind vielfach irrige Vorstellungen verbreitet. Man glaubt im ganzen, daß Interessantheit und Neuheit des Gehaltes die Zeit „vertreibe“, das heißt: verkürze, während Monotonie und Leere ihren Gang beschwere und hemme. Das ist nicht unbedingt zutreffend. Leere und Monotonie mögen zwar den Augenblick und die Stunde dehnen und „langweilig“ machen, aber die großen und größten Zeitmassen verkürzen und verflüchtigen sie sogar bis zur Nichtigkeit. Umgekehrt ist ein reicher und interessanter Gehalt wohl imstande, die Stunde und selbst noch den Tag zu verkürzen und zu beschwingen, ins Große gerechnet jedoch verleiht er dem Zeitgange Breite, Gewicht und Solidität, so daß ereignisreiche Jahre viel langsamer vergehen als jene armen, leeren, leichten, die der Wind vor sich her bläst, und die verfliegen. Was man Langeweile nennt, ist also eigentlich vielmehr eine krankhafte Kurzweiligkeit der Zeit infolge von Monotonie: große Zeiträume schrumpfen bei ununterbrochener Gleichförmigkeit auf eine das Herz zu Tode erschreckende Weise zusammen; wenn ein Tag wie alle ist, so sind sie alle wie einer; und bei vollkommener Einförmigkeit würde das längste Leben als ganz kurz erlebt werden und unversehens verflogen sein. Gewöhnung ist ein Einschlafen oder doch ein Mattwerden des Zeitsinnes, und wenn die Jugendjahre langsam erlebt werden, das spätere Leben aber immer hurtiger abläuft und hineilt, so muß auch das auf Gewöhnung beruhen. Wir wissen wohl, daß die Einschaltung von Um- und Neugewöhnungen das einzige Mittel ist, unser Leben zu halten, unseren Zeitsinn aufzufrischen, eine Verjüngung, Verstärkung, Verlangsamung unseres Zeiterlebnisses und damit die Erneuerung unseres Lebensgefühls überhaupt zu erzielen. Dies ist der Zweck des Orts- und Luftwechsels, der Badereise, die Erholsamkeit der Abwechslung und der Episode. Die ersten Tage an einem neuen Aufenthalt haben jugendlichen, das heißt starken und breiten Gang, – es sind etwa sechs bis acht. Dann, in dem Maße, wie man „sich einlebt“, macht sich allmähliche Verkürzung bemerkbar: wer am Leben hängt oder, besser gesagt, sich ans Leben hängen möchte, mag mit Grauen gewahren, wie die Tage wieder leicht zu werden und zu huschen beginnen; und die letzte Woche, etwa von vieren, hat unheimliche Rapidität und Flüchtigkeit. Freilich wirkt die Erfrischung des Zeitsinnes dann über die Einschaltung hinaus, macht sich, wenn man zur Regel zurückgekehrt ist, aufs neue geltend: die ersten Tage zu Hause werden ebenfalls, nach der Abwechslung, wieder neu, breit und jugendlich erlebt, aber nur einige wenige: denn in die Regel lebt man sich rascher wieder ein, als in ihre Aufhebung, und wenn der Zeitsinn durch Alter schon müde ist oder – ein Zeichen von ursprünglicher Lebensschwäche – nie stark entwickelt war, so schläft er sehr rasch wieder ein, und schon nach vierundzwanzig Stunden ist es, als sei man nie weg gewesen, und als sei die Reise der Traum einer Nacht.
Diese Bemerkungen werden nur deshalb hier eingefügt, weil der junge Hans Castorp ähnliches im Sinne hatte, als er nach einigen Tagen zu seinem Vetter sagte (und ihn dabei mit rotgeäderten Augen ansah):
„Komisch ist und bleibt es, wie die Zeit einem lang wird zu Anfang, an einem fremden Ort. Das heißt ... Selbstverständlich kann keine Rede davon sein, daß ich mich langweile, im Gegenteil, ich kann wohl sagen, ich amüsiere mich königlich. Aber wenn ich mich umsehe, retrospektiv also, versteh’ mich recht, kommt es mir vor, als ob ich schon wer weiß wie lange hier oben wäre, und bis dahin zurück, wo ich ankam und nicht gleich verstand, daß ich da war, und du noch sagtest: ‚Steige nur aus!‘ – erinnerst du dich? – das scheint mir eine ganze Ewigkeit. Mit Messen und überhaupt mit dem Verstand hat das ja absolut nichts zu tun, es ist eine reine Gefühlssache. Natürlich wäre es albern, zu sagen: ‚Ich glaube schon zwei Monate hier zu sein‘, – das wäre ja Nonsens. Sondern ich kann eben nur sagen: ‚Sehr lange‘.“
„Ja,“ antwortete Joachim, das Thermometer im Munde, „ich habe auch gut davon, ich kann mich gewissermaßen an dir festhalten, seit du da bist.“ Und Hans Castorp lachte darüber, daß Joachim dies so einfach, ohne Erklärung, sagte.
Nein, eingelebt war er noch keineswegs, weder was die Kenntnis des hiesigen Lebens in all seiner Eigentümlichkeit betraf, – eine Kenntnis, die er in so wenigen Tagen unmöglich gewinnen konnte und, wie er sich sagte (und es auch gegen Joachim aussprach), selbst in drei Wochen leider nicht würde gewinnen können; noch auch in bezug auf die Anpassung seines Organismus an die so sehr eigentümlichen atmosphärischen Verhältnisse bei „denen hier oben“, denn diese Anpassung wurde ihm sauer, überaus sauer, ja, wie ihm schien, wollte sie überhaupt nicht vonstatten gehen.
Der Normaltag war klar gegliedert und fürsorglich organisiert, man kam rasch in Trott und gewann Geläufigkeit, wenn man sich seinem Getriebe einfügte. Im Rahmen der Woche jedoch und größerer Zeiteinheiten unterlag er gewissen regelmäßigen Abwandlungen, die sich erst nach und nach einfanden, die eine zum erstenmal, nachdem die andere sich schon wiederholt hatte; und auch was die alltägliche Einzelerscheinung von Dingen und Gesichtern betraf, so hatte Hans Castorp noch auf Schritt und Tritt zu lernen, obenhin Angeschautes genauer zu bemerken und Neues mit jugendlicher Empfänglichkeit in sich aufzunehmen.
Jene bauchigen Gefäße mit kurzen Hälsen zum Beispiel, die auf den Gängen vor einzelnen Türen standen und auf die gleich am Abend seiner Ankunft sein Auge gefallen war, enthielten Sauerstoff, – Joachim erklärte es ihm auf Befragen. Reiner Sauerstoff war darin, zu sechs Franken der Ballon, und das belebende Gas wurde den Sterbenden zum Zweck einer letzten Anfeuerung und Hinhaltung ihrer Kräfte zugeführt, – sie schlürften es durch einen Schlauch. Denn hinter den Türen, vor denen solche Ballons standen, lagen Sterbende oder „moribundi“, wie Hofrat Behrens sagte, als Hans Castorp ihm einmal im ersten Stockwerk begegnete, – der Hofrat kam in weißem Kittel und mit blauen Backen den Korridor entlanggerudert, und sie gingen zusammen die Treppe hinauf.
„Na, Sie unbeteiligter Zuschauer Sie!“ sagte Behrens. „Was machen Sie denn, finden wir Gnade vor Ihren prüfenden Blicken? Ehrt uns, ehrt uns. Ja, unsere Sommersaison, die hats in sich, die ist nicht von schlechten Eltern. Habe es mir auch was kosten lassen, um sie ein bißchen zu poussieren. Aber schade ist es doch, daß Sie den Winter nicht mitmachen wollen bei uns, – Sie wollen ja bloß acht Wochen bleiben, hab ich gehört? Ach, drei? Das ist aber eine Stippvisite, das lohnt ja das Ablegen gar nicht; na, wie Sie meinen. Aber schade ist es doch, daß Sie den Winter nicht mitmachen, denn was so die Hotevoleh ist,“ sagte er mit scherzhaft unmöglicher Aussprache, „die internationale Hotevoleh da unten in Platz, die kommt doch nun mal erst im Winter, und die müßten Sie sehen, da täten Sie was für Ihre Bildung. Zum Kugeln, wenn die Kerls so Sprünge machen auf ihren Fußbrettern. Und dann die Damen, herrje, die Damen! Bunt wie die Paradiesvögel, sag ich Ihnen, und mächtig galant ... Nun muß ich aber zu meinem Moribundus,“ sagte er, „auf siebenundzwanzig hier. Finales Stadium, wissen Sie. Durch die Mitte ab. Fünf Dutzend Fiaskos Oxygen hat er gestern und heute noch ausgekneipt, der Schlemmer. Aber bis Mittag wird er wohl ad penates gehen. Na, lieber Reuter,“ sagte er, indem er eintrat, „wie wäre es, wenn wir noch einer den Hals brächen ...“ Seine Worte verloren sich hinter der Tür, die er zuzog. Aber einen Augenblick hatte Hans Castorp im Hintergrunde des Zimmers auf dem Kissen das wächserne Profil eines jungen Mannes mit dünnem Kinnbart gesehen, der langsam seine sehr großen Augäpfel zur Tür gerollt hatte.
Es war der erste Moribundus, den Hans Castorp in seinem Leben zu sehen bekam, denn seine Eltern sowohl wie der Großvater waren ja damals gleichsam hinter seinem Rücken gestorben. Wie würdevoll der Kopf des jungen Mannes mit aufwärts geschobenem Kinnbart auf dem Kissen gelegen hatte! Wie bedeutend der Blick seiner übergroßen Augen gewesen war, als er sie langsam zur Tür gedreht hatte! Hans Castorp, noch ganz vertieft in den flüchtigen Anblick, versuchte unwillkürlich, ebenso große, bedeutende und langsame Augen wie der Moribundus zu machen, während er weiter zur Treppe ging, und mit diesen Augen blickte er eine Dame an, die hinter ihm aus einer Tür getreten war und ihn am Treppenkopf überholte. Er erkannte nicht gleich, daß es Madame Chauchat war. Sie lächelte leise über die Augen, die er machte, stützte dann mit der Hand die Flechte an ihrem Hinterkopf und ging vor ihm die Treppe hinunter, geräuschlos, schmiegsam und etwas vorgeschobenen Kopfes.
Bekanntschaften machte er fast keine in diesen ersten Tagen und auch später noch lange nicht. Die Tagesordnung war dem im ganzen nicht günstig; auch war Hans Castorp ja zurückhaltenden Wesens, fühlte sich überdies als Gast und „unbeteiligter Zuschauer“ hier oben, wie Hofrat Behrens gesagt hatte, und ließ sich an Joachims Gespräch und Gesellschaft in der Hauptsache gern genügen. Die Krankenschwester auf dem Korridor freilich reckte so lange den Hals nach ihnen, bis Joachim, der ihr schon früher manchmal kleine Plaudereien gewährt hatte, seinen Vetter mit ihr bekannt machte. Das Kneiferband hinter dem Ohr, sprach sie nicht nur geziert, sondern geradezu gequält und machte bei näherer Prüfung den Eindruck, als habe unter der Folter der Langenweile ihr Verstand gelitten. Es war sehr schwer, wieder von ihr loszukommen, da sie vor der Beendigung des Gespräches eine krankhafte Furcht an den Tag legte und, sobald die jungen Leute Miene machten, weiterzugehen, sich mit hastigen Worten und Blicken, auch einem verzweifelten Lächeln an sie klammerte, so daß sie aus Erbarmen noch bei ihr stehen blieben. Sie sprach des langen und breiten von ihrem Papa, welcher Jurist, und ihrem Cousin, der Arzt sei, – offenbar um sich in ein vorteilhaftes Licht zu setzen und ihre Herkunft aus gebildeter Gesellschaftsschicht zu bekunden. Was ihren Pflegling dort hinter der Tür betraf, so war er der Sohn eines Koburger Puppenfabrikanten, Rotbein mit Namen, und neuerdings habe es sich bei dem jungen Fritz auf den Darm geworfen. Das sei hart für alle Beteiligten, wie die Herren sich wohl vorstellen könnten; namentlich wenn man nun einmal aus akademischem Hause stamme und die Feinfühligkeit der höheren Klassen besitze, so sei es hart. Und nicht den Rücken dürfe man kehren ... Neulich, was glaubten die Herren, komme sie von einem kurzen Ausgange zurück, nichts als ein wenig Zahnpulver habe sie sich besorgt, und finde den Kranken in seinem Bette sitzend, vor sich ein Glas dickes, dunkles Bier, eine Salamiwurst, ein derbes Stück Schwarzbrot und eine Gurke! All diese heimischen Leckerbissen hätten die Seinen ihm zugesandt zu seiner Kräftigung. Aber am nächsten Tage sei er natürlich mehr tot als lebendig gewesen. Er selbst beschleunige sein Ende. Aber das werde die Erlösung ja nur für ihn bedeuten, nicht auch für sie – Schwester Berta sei übrigens ihr Name, in Wirklichkeit Alfreda Schildknecht –, denn sie komme dann eben zu einem anderen Kranken, in mehr oder weniger vorgeschrittenem Stadium, hier oder in einem anderen Sanatorium, das sei die Perspektive, die sich ihr eröffne, und eine andere eröffne sich eben nicht.
Ja, sagte Hans Castorp, ihr Beruf sei gewiß schwer, aber doch auch befriedigend, sollte er denken.
Gewiß, antwortete sie, befriedigend sei er, – befriedigend, aber sehr schwer.
Nun, alles Gute für Herrn Rotbein. Und die Vettern wollten gehen.
Aber da klammerte sie sich an sie mit Worten und Blicken, und so jammervoll war es zu sehen, wie sie sich anstrengte, die jungen Leute ein wenig länger zu fesseln, daß es grausam gewesen wäre, ihr nicht noch eine Frist zu gewähren.
„Er schläft!“ sagte sie. „Er braucht mich nicht. Da bin ich für einige kurze Minuten auf den Gang hinausgetreten ...“ Und sie begann über Hofrat Behrens zu klagen und den Ton, in dem er mit ihr verkehre und der allzu zwanglos sei, um ihrer Herkunft zu entsprechen. Bei weitem gab sie Herrn Dr. Krokowski den Vorzug, – ihn nannte sie seelenvoll. Dann kam sie wieder auf ihren Papa und ihren Cousin. Ihr Hirn gab nichts weiter her. Vergebens rang sie danach, die Vettern noch ein wenig zu fesseln, indem sie plötzlich mit einem Anlauf die Stimme erhob und beinahe zu schreien begann, wenn sie gehen wollten, – sie entschlüpften ihr endlich und gingen. Aber die Schwester sah ihnen noch eine Weile mit vorgebeugtem Oberkörper und saugenden Blicken nach, als wollte sie sie mit den Augen zu sich zurückziehen. Dann entrang sich ein Seufzer ihrer Brust, und sie kehrte zu ihrem Pflegling ins Zimmer zurück.
Sonst wurde Hans Castorp in diesen Tagen nur noch mit der schwarzbleichen Dame bekannt, jener Mexikanerin, die er im Garten gesehen hatte und die „Tous les deux“ genannt wurde. Es geschah wirklich, daß auch er aus ihrem Munde die trübselige Formel hörte, die ihr zum Spitznamen geworden war; aber da er sich vorbereitet hatte, so bewahrte er gute Haltung dabei und konnte nachher zufrieden mit sich sein. Die Vettern trafen sie vor dem Hauptportal, als sie nach dem ersten Frühstück den vorgeschriebenen Morgenspaziergang antraten. In ein schwarzes Kaschmirtuch gehüllt, mit krummen Knien und langen, ruhelos wandernden Tritten erging sie sich dort, und gegen den schwarzen Schleier, der um ihr silbern durchzogenes Haar geschlungen und unter dem Kinn zusammengebunden war, schimmerte mattweiß ihr alterndes Gesicht mit dem großen, verhärmten Munde. Joachim, ohne Hut wie gewöhnlich, begrüßte sie durch Verneigung, und sie dankte langsam, während beim Schauen die Querfalten in ihrer engen Stirn sich vertieften. Sie blieb stehen, da sie ein neues Gesicht bemerkte, und erwartete, leise mit dem Kopfe nickend, die Annäherung der jungen Leute; denn offenbar hielt sie es für notwendig zu hören, ob der Fremde von ihrem Schicksal wisse, und seine Äußerung darüber entgegenzunehmen. Joachim stellte seinen Vetter vor. Sie reichte dem Gast aus der Mantille heraus die Hand, eine magere, gelbliche, hoch geäderte, mit Ringen geschmückte Hand, und fuhr fort, ihn nickend anzublicken. Dann kam es:
„Tous les dé, monsieur“, sagte sie. „Tous les dé vous savez ...“
„Je le sais, madame“, antwortete Hans Castorp gedämpft. „Et je le regrette beaucoup.“
Die schlaffen Hautsäcke unter ihren jettschwarzen Augen waren so groß und schwer, wie er es noch bei keinem Menschen gesehen. Ein leiser, welker Duft ging von ihr aus. Es war ihm sanft und ernst um das Herz.
„Merci“, sagte sie mit einer rasselnden Aussprache, die sonderbar zu der Gebrochenheit ihres Wesens stimmte, und der eine Winkel ihres großen Mundes hing tragisch tief hinab. Dann zog sie die Hand unter die Mantille zurück, neigte den Kopf und machte sich wieder ans Wandern. Hans Castorp aber sagte im Weitergehen:
„Du siehst, es hat mir nichts gemacht, ich bin ganz gut mit ihr fertig geworden. Ich werde überhaupt mit solchen Leuten ganz gut fertig, glaube ich, ich verstehe mich von Natur auf den Umgang mit ihnen, – meinst du nicht auch? Ich glaube sogar, ich komme mit traurigen Menschen im ganzen besser aus, als mit lustigen, weiß Gott, woran es liegt, vielleicht daran, daß ich doch Waise bin und meine Eltern so früh verloren habe, aber wenn die Leute ernst und traurig sind und der Tod im Spiele ist, das bedrückt mich eigentlich nicht und macht mich nicht verlegen, sondern ich fühle mich dabei in meinem Element und jedenfalls besser, als wenn es so forsch zugeht, das liegt mir weniger. Neulich dachte ich: Es ist doch eine Albernheit von den hiesigen Damen, sich dermaßen vor dem Tode zu graulen und allem, was damit zusammenhängt, daß man sie ängstlich davor bewahren muß und das Viatikum bringt, wenn sie gerade essen. Nein, pfui, das ist läppisch. Siehst du nicht ganz gern einen Sarg? Ich sehe ganz gern mal einen. Ich finde, ein Sarg ist ein geradezu schönes Möbel, schon wenn er leer ist, aber wenn jemand darin liegt, dann ist es direkt feierlich in meinen Augen. Begräbnisse haben so etwas Erbauliches, – ich habe schon manchmal gedacht, man sollte, statt in die Kirche, zu einem Begräbnis gehen, wenn man sich ein bißchen erbauen will. Die Leute haben gutes schwarzes Zeug an und nehmen die Hüte ab und sehen auf den Sarg und halten sich ernst und andächtig, und niemand darf faule Witze machen, wie sonst im Leben. Das habe ich sehr gern, wenn sie endlich mal ein bißchen andächtig sind. Manchmal habe ich mich schon gefragt, ob ich nicht Pastor hätte werden sollen, – in gewisser Weise hätte das, glaube ich, nicht schlecht für mich gepaßt ... Hoffentlich habe ich keinen Fehler im Französischen gemacht bei dem, was ich sagte?“
„Nein“, sagte Joachim. „Je le regrette beaucoup war ja soweit ganz richtig.“
Regelmäßige Abwandlungen des Normaltages fanden sich ein: zuerst ein Sonntag – und zwar ein Sonntag mit Kurmusik auf der Terrasse, wie er vierzehntägig erschien, eine Markierung der Doppelwoche also, in deren zweite Hälfte Hans Castorp von außen eingetreten war. An einem Dienstag war er gekommen, und so war es der fünfte Tag, ein Tag von Frühlingscharakter nach jenem abenteuerlichen Wettersturz und Rückfall in den Winter, – zart und frisch, mit reinlichen Wolken am hellblauen Himmel und mäßigem Sonnenschein über Hängen und Tal, die wieder ein ordnungsgemäßes Sommergrün angenommen hatten, da der Neuschnee denn doch zu raschem Versickern verurteilt gewesen war.
Es war deutlich, daß jedermann sich befliß, den Sonntag zu ehren und auszuzeichnen; Verwaltung und Gäste unterstützten einander in diesem Bestreben. Gleich zum Morgentee gab es Streußelkuchen, an jedem Platz stand ein Gläschen mit ein paar Blumen, wilden Gebirgsnelken und sogar Alpenrosen, welche die Herren sich in das Knopfloch des Aufschlages steckten (Staatsanwalt Paravant aus Dortmund hatte sogar einen schwarzen Schwalbenschwanz mit punktierter Weste angelegt), die Damentoiletten trugen das Gepräge festlicher Duftigkeit – Frau Chauchat erschien zum Frühstück in einer fließenden Spitzenmatinee mit offenen Ärmeln, worin sie, während die Glastür ins Schloß schmetterte, erst einmal Front machte und sich dem Saal gleichsam anmutig präsentierte, bevor sie sich schleichenden Schrittes zu ihrem Tisch begab, und die sie so ausgezeichnet kleidete, daß Hans Castorps Nachbarin, die Lehrerin aus Königsberg, sich ganz begeistert darüber zeigte – und sogar das barbarische Ehepaar vom Schlechten Russentisch hatte dem Gottestag Rechnung getragen, indem nämlich der männliche Teil seine Lederjoppe mit einer Art von kurzem Gehrock und die Filzstiefel mit Lederschuhwerk vertauscht hatte, sie freilich auch heute ihre unsaubere Federboa, darunter aber eine grünseidene Bluse mit Halskrause trug ... Hans Castorp runzelte die Brauen, als er der beiden ansichtig wurde, und verfärbte sich, wozu er hier auffallend neigte.
Gleich nach dem zweiten Frühstück begann die Kurmusik auf der Terrasse; allerlei Blech- und Holzbläser fanden sich dort ein und spielten abwechselnd flott und getragen, fast bis zum Mittagessen. Während des Konzertes war die Liegekur nicht streng obligatorisch. Zwar genossen einige den Ohrenschmaus auf ihren Balkons, und auch in der Gartenhalle waren drei oder vier Stühle besetzt; aber die Mehrzahl der Gäste saß an den kleinen, weißen Tischen auf der gedeckten Plattform, während leichte Lebewelt, der es zu ehrbar scheinen mochte, auf Stühlen zu sitzen, die steinernen Stufen besetzt hielt, die in den Garten hinunterführten, und dort viel Frohsinn entfaltete: jugendliche Kranke beiderlei Geschlechts, von denen Hans Castorp die meisten schon dem Namen nach oder von Ansehen kannte. Hermine Kleefeld gehörte dazu, sowie Herr Albin, der eine große geblümte Schachtel mit Schokolade herumgehen und alle daraus essen ließ, während er selbst nicht aß, sondern mit väterlicher Miene Zigaretten mit goldenem Mundstück rauchte; ferner der wulstlippige Jüngling vom „Verein Halbe Lunge“, Fräulein Levi, dünn und elfenbeinfarben, wie sie war, ein aschblonder junger Mann, der auf den Namen Rasmussen hörte und seine Hände nach Art von Flossen aus schlaffen Gelenken in Brusthöhe hängen ließ, Frau Salomon aus Amsterdam, eine rot gekleidete Frau von reicher Körperlichkeit, die sich ebenfalls der Jugend beigesellt hatte und in deren bräunlichen Nacken jener lange Mensch mit gelichtetem Haar, der aus dem „Sommernachtstraum“ spielen konnte und nun, mit den Armen seine spitzen Knie umschlingend, hinter ihr saß, unablässig seine trüben Blicke gerichtet hielt; ein rothaariges Fräulein aus Griechenland, ein anderes unbekannter Herkunft mit dem Gesicht eines Tapirs, der gefräßige Junge mit den dicken Brillengläsern, ein weiterer fünfzehn- oder sechzehnjähriger Junge, der ein Monokel eingeklemmt hatte und beim Hüsteln den lang gewachsenen, salzlöffelähnlichen Nagel seines kleinen Fingers zum Munde führte, ein kapitaler Esel offenbar – und noch andere mehr.
Dieser Junge mit dem Fingernagel, erzählte Joachim leise, sei nur ganz wenig leidend gewesen, als er gekommen sei, – ohne Temperatur, und nur der Vorsicht halber sei er von seinem Vater, einem Arzt, heraufgeschickt worden und habe nach des Hofrats Urteile etwa drei Monate bleiben sollen. Jetzt, nach drei Monaten, habe er 37,8 bis 38 und sei recht krank. Aber er lebe ja auch so unvernünftig, daß er Maulschellen verdiene.
Die Vettern hatten ein Tischchen für sich, etwas abseits von den übrigen, denn Hans Castorp rauchte zu seinem schwarzen Bier, das er vom Frühstück mit herausgenommen hatte, und von Zeit zu Zeit schmeckte ihm seine Zigarre ein wenig. Benommen vom Biere und von der Musik, die wie immer bewirkte, daß sein Mund sich öffnete und sein Kopf sich auf die Seite legte, betrachtete er mit geröteten Augen das sorglose Badeleben ringsumher, wobei das Bewußtsein ihn durchaus nicht störte, sondern im Gegenteil dem Ganzen eine erhöhte Merkwürdigkeit, einen gewissen geistigen Reiz verlieh, daß alle diese Leute in ihrem Inneren von einem schwer aufzuhaltenden Zerfall ergriffen waren und daß die meisten von ihnen in leichtem Fieber standen ... Man trank perlende Kunstlimonade an den Tischchen, und auf der Freitreppe wurde photographiert. Andere tauschten dort Briefmarken, und das rothaarige Fräulein aus Griechenland zeichnete Herrn Rasmussen auf einem Block, wollte ihm dann aber das Bild nicht zeigen, sondern wandte sich, mit breiten, weit auseinander stehenden Zähnen lachend, hin und her, so daß er es lange nicht vermochte, ihr den Block zu entreißen. Hermine Kleefeld saß mit nur halb geöffneten Augen auf ihrer Stufe und schlug mit einer zusammengerollten Zeitung den Takt zur Musik, während sie sich von Herrn Albin ein Sträußchen Wiesenblumen an ihrer Bluse befestigen ließ, und der Wulstlippige, zu Frau Salomons Füßen sitzend, plauderte gedrehten Halses zu ihr empor, indes der dünnhaarige Pianist ihr von hinten unverwandt in den Nacken blickte.
Die Ärzte kamen und mischten sich unter die Kurgesellschaft, Hofrat Behrens in weißem und Dr. Krokowski in schwarzem Kittel. Sie gingen die Reihe der Tischchen entlang, wobei der Hofrat beinahe an jedem ein gemütliches Witzwort fallen ließ, so daß ein Kielwasser heiterer Bewegung seinen Weg bezeichnete, und stiegen dann zur Jugend hinab, deren weiblicher Teil sich sofort mit Wippen und schrägen Blicken um Dr. Krokowski scharte, während der Hofrat dem Sonntage zu Ehren der Herrenwelt das Kunststück mit seinem Schnürstiefel zeigte: er setzte seinen gewaltigen Fuß auf eine höhere Stufe, löste die Bänder, ergriff sie nach einer besonderen Praktik mit einer Hand und wußte sie, ohne die andere zu Hilfe zu nehmen, mit solcher Fertigkeit kreuzweise einzuhaken, daß alle sich wunderten und mehrere umsonst versuchten, es ihm gleichzutun.
Später erschien auch Settembrini auf der Terrasse, – er kam, auf seinen Spazierstock gestützt, aus dem Speisesaal, auch heute in seinem Flaus und seinen gelblichen Hosen, mit feiner, geweckter und kritischer Miene, sah sich um und näherte sich dem Tische der Vettern, indem er „Ah, bravo!“ sagte und um die Erlaubnis bat, sich zu ihnen setzen zu dürfen.
„Bier, Tabak und Musik“, sagte er. „Da haben wir Ihr Vaterland! Ich sehe, Sie haben Sinn für nationale Stimmung, Ingenieur. Sie sind in Ihrem Elemente, das freut mich. Lassen Sie mich etwas teilnehmen an der Harmonie Ihres Zustandes!“
Hans Castorp nahm seine Züge zusammen, – hatte es schon getan, als er des Italieners nur ansichtig geworden war. Er sagte:
„Sie kommen aber spät zum Konzert, Herr Settembrini, es muß ja bald aus sein. Hören Sie nicht gern Musik?“
„Nicht gern auf Kommando“, erwiderte Settembrini. „Nicht nach dem Wochenkalender. Nicht gern, wenn sie nach Apotheke riecht und mir von oben herab aus sanitären Gründen zugemessen wird. Ich halte ein wenig auf meine Freiheit oder doch auf jenen Rest von Freiheit und Menschenwürde, der unsereinem übrigbleibt. Bei solchen Veranstaltungen hospitiere ich, wie Sie im großen bei uns hospitieren, – ich komme auf eine Viertelstunde und gehe wieder meiner Wege. Das gibt mir die Illusion der Unabhängigkeit ... Ich sage nicht, daß es mehr ist, als eine Illusion, aber was wollen Sie, wenn sie mir eine gewisse Genugtuung bereitet! Mit Ihrem Vetter, das ist etwas anderes. Für ihn ist es Dienst. Nicht wahr, Leutnant, Sie betrachten es als zum Dienst gehörig. Oh, ich weiß, Sie kennen den Trick, in der Sklaverei Ihren Stolz zu bewahren. Ein verwirrender Trick. Nicht jedermann in Europa versteht sich darauf. Musik? Fragten Sie nicht, ob ich mich als Liebhaber der Musik bekenne? Nun, wenn Sie ‚Liebhaber‘ sagen (eigentlich entsann Hans Castorp sich nicht, so gesagt zu haben), der Ausdruck ist nicht übel gewählt, er hat einen Anflug zärtlicher Leichtfertigkeit. Gut denn, ich schlage ein. Ja, ich bin ein Liebhaber der Musik, – womit nicht gesagt sein soll, daß ich sie sonderlich achte, – so etwa, wie ich das Wort achte und liebe, den Träger des Geistes, das Werkzeug, die glänzende Pflugschar des Fortschritts ... Musik ... sie ist das halb Artikulierte, das Zweifelhafte, das Unverantwortliche, das Indifferente. Vermutlich werden Sie mir einwenden, daß sie klar sein könne. Aber auch die Natur kann klar sein, auch ein Bächlein kann klar sein, und was hilft uns das? Es ist nicht die wahre Klarheit, es ist eine träumerische, nichtssagende und zu nichts verpflichtende Klarheit, eine Klarheit ohne Konsequenzen, gefährlich deshalb, weil sie dazu verführt, sich bei ihr zu beruhigen ... Lassen Sie die Musik die Gebärde der Hochherzigkeit annehmen. Gut! Sie wird damit unser Gefühl entflammen. Es kommt jedoch darauf an, die Vernunft zu entflammen! Die Musik ist scheinbar die Bewegung selbst, – gleichwohl habe ich sie im Verdachte des Quietismus. Lassen Sie mich die Sache auf die Spitze stellen: Ich hege eine politische Abneigung gegen die Musik.“
Hier konnte Hans Castorp nicht umhin, sich aufs Knie zu schlagen und auszurufen, so etwas habe er denn doch in seinem Leben noch nicht gehört.
„Ziehen Sie es trotzdem in Erwägung!“ sagte Settembrini lächelnd. „Die Musik ist unschätzbar als letztes Begeisterungsmittel, als aufwärts und vorwärts reißende Macht, wenn sie den Geist für ihre Wirkungen vorgebildet findet. Aber die Literatur muß ihr vorangegangen sein. Musik allein bringt die Welt nicht vorwärts. Musik allein ist gefährlich. Für Sie persönlich, Ingenieur, ist sie unbedingt gefährlich. Ich sah es sofort an Ihren Gesichtszügen, als ich kam.“
Hans Castorp lachte.
„Ach, mein Gesicht dürfen Sie nicht ansehen, Herr Settembrini. Sie glauben nicht, wie die Luft bei Ihnen hier oben mir zusetzt. Es fällt mir schwerer, als ich dachte, mich zu akklimatisieren.“
„Ich fürchte, Sie täuschen sich.“
„Nein, wieso! Weiß der Teufel, wie müde und heiß ich noch immer bin.“
„Ich finde doch, daß man der Direktion für die Konzerte dankbar sein muß“, sagte Joachim besonnen. „Sie betrachten die Sache ja von einem höheren Standpunkt, Herr Settembrini, sozusagen als Schriftsteller, und da will ich Ihnen nicht widersprechen. Aber ich finde doch, daß man hier dankbar sein muß für ein bißchen Musik. Ich bin gar nicht besonders musikalisch, und dann sind die Stücke, die gespielt werden, ja auch nicht weiter großartig, – weder klassisch noch modern, sondern nur einfach Blechmusik. Aber es ist doch eine erfreuliche Abwechslung. Es füllt ein paar Stunden so anständig aus, ich meine: es teilt sie ein und füllt sie im einzelnen aus, so daß doch etwas daran ist, während man sich hier sonst die Stunden und Tage und Wochen so schauderhaft um die Ohren schlägt ... Sehen Sie, so eine anspruchslose Konzertnummer dauert vielleicht sieben Minuten, nicht wahr, und die sind etwas für sich, sie haben Anfang und Ende, sie heben sich ab und sind gewissermaßen bewahrt davor, so unversehens im allgemeinen Schlendrian unterzugehen. Außerdem sind sie ja wieder noch vielfach eingeteilt, durch die Figuren des Stückes, und die wieder in Takte, so daß immer was los ist und jeder Augenblick einen gewissen Sinn bekommt, an den man sich halten kann, während sonst ... Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ...“
„Bravo!“ rief Settembrini. „Bravo, Leutnant! Sie bezeichnen sehr gut ein unzweifelhaft sittliches Moment im Wesen der Musik, nämlich dieses, daß sie dem Zeitablaufe durch eine ganz eigentümlich lebensvolle Messung Wachheit, Geist und Kostbarkeit verleiht. Die Musik weckt die Zeit, sie weckt uns zum feinsten Genusse der Zeit, sie weckt ... insofern ist sie sittlich. Die Kunst ist sittlich, sofern sie weckt. Aber wie, wenn sie das Gegenteil tut? Wenn sie betäubt, einschläfert, der Aktivität und dem Fortschritt entgegenarbeitet? Auch das kann die Musik, auch auf die Wirkung der Opiate versteht sie sich aus dem Grunde. Eine teuflische Wirkung, meine Herren! Das Opiat ist vom Teufel, denn es schafft Dumpfsinn, Beharrung, Untätigkeit, knechtischen Stillstand ... Es ist etwas Bedenkliches um die Musik, meine Herren. Ich bleibe dabei, daß sie zweideutigen Wesens ist. Ich gehe nicht zu weit, wenn ich sie für politisch verdächtig erkläre.“
Er sprach noch weiter in dieser Art, und Hans Castorp hörte auch zu, vermochte aber so recht nicht zu folgen, erstens seiner Müdigkeit wegen, und dann auch, weil er abgelenkt war durch die geselligen Vorgänge unter der leichten Jugend dort auf den Stufen. Sah er recht oder wie war das eigentlich? Das Fräulein mit dem Tapirgesicht war beschäftigt, dem Jungen mit dem Monokel einen Knopf an den Kniebund seiner Sporthose zu nähen! Und dabei ging ihr der Atem schwer und heiß vor Asthma, während er seinen salzlöffelähnlichen Fingernagel hüstelnd zum Munde führte! Sie waren ja krank, alle beide, aber trotzdem zeugte es von sonderbaren Verkehrssitten unter den jungen Leuten hier oben. Die Musik spielte eine Polka ...
So hob der Sonntag sich ab. Sein Nachmittag war überdies gekennzeichnet durch Wagenfahrten, die von verschiedenen Gästegruppen unternommen wurden: mehrere Zweispänner schleppten sich nach dem Tee die Wegschleife herauf und hielten vorm Hauptportal, um ihre Besteller aufzunehmen, Russen hauptsächlich, und zwar russische Damen.
„Russen fahren immer spazieren“, sagte Joachim zu Hans Castorp, – sie standen zusammen vor dem Portal und sahen zu ihrer Unterhaltung den Abfahrten zu. „Nun fahren sie nach Clavadell oder nach dem See oder ins Flüelatal oder nach Klosters, das sind so die Ziele. Wir können auch mal fahren während deiner Anwesenheit, wenn du Lust hast. Aber ich glaube, vorläufig hast du genug zu tun, um dich einzuleben, und brauchst keine Unternehmungen.“
Hans Castorp stimmte dem bei. Er hatte eine Zigarette im Munde und die Hände in den Hosentaschen. So sah er zu, wie die kleine, muntere, alte russische Dame mit ihrer mageren Großnichte und zwei anderen Damen in einem Wagen Platz nahm; es waren Marusja und Madame Chauchat. Diese hatte einen dünnen Staubmantel, mit einem Gurt im Rücken, angelegt, war jedoch ohne Hut. Sie setzte sich neben die Alte in den Fond des Wagens, während die jungen Mädchen die Rückplätze einnahmen. Alle vier waren lustig und regten unaufhörlich die Münder in ihrer weichen, gleichsam knochenlosen Sprache. Sie sprachen und lachten über die Wagendecke, in die sie sich unter Schwierigkeiten teilten, über das russische Konfekt, das die Großtante als Mundvorrat in einem mit Watte und Papierspitzen gepolsterten Holzkistchen mitführte und schon jetzt präsentierte ... Hans Castorp unterschied mit Anteil Frau Chauchats verschleierte Stimme. Wie immer, wenn ihm die nachlässige Frau vor Augen kam, bekräftigte sich ihm aufs neue jene Ähnlichkeit, nach der er eine Weile gesucht hatte und die ihm im Traume aufgegangen war ... Marusjas Lachen aber, der Anblick ihrer runden, braunen Augen, die kindlich über das Tüchlein hinwegblickten, womit sie den Mund bedeckte, und ihrer hohen Brust, die innerlich gar nicht wenig krank sein sollte, erinnerte ihn an etwas Anderes, Erschütterndes, was er neulich gesehen hatte, und so blickte er vorsichtig und ohne den Kopf zu bewegen zur Seite auf Joachim. Nein, gottlob, so fleckig im Gesicht sah Joachim nicht aus wie damals, und auch seine Lippen waren jetzt nicht so kläglich verzerrt. Aber er sah Marusja an – und zwar in einer Haltung, mit einem Augenausdruck, die unmöglich militärisch genannt werden konnten, vielmehr so trüb und selbstvergessen erschienen, daß man sie als ausgemacht zivilistisch ansprechen mußte. Dann raffte er sich übrigens zusammen und blickte rasch nach Hans Castorp, so daß dieser eben noch Zeit hatte, seine Augen von ihm fortzutun und sie irgendwohin in die Lüfte zu senden. Er fühlte sein Herz klopfen dabei, – unmotiviert und auf eigene Hand, wie es das hier nun einmal tat.
Der Rest des Sonntags bot nichts Außerordentliches, abgesehen vielleicht von den Mahlzeiten, die, da sie reicher als gewöhnlich nicht wohl gestaltet werden konnten, wenigstens eine erhöhte Feinheit der Gerichte aufwiesen. (Zum Mittagessen gab es ein Chaud-froid von Hühnern, mit Krebsen und halbierten Kirschen verziert; zum Gefrorenen Patisserie in Körbchen, die aus gesponnenem Zucker geflochten waren, und dann auch noch frische Ananas.) Abends, nachdem er sein Bier getrunken, fühlte Hans Castorp sich noch erschöpfter, frostiger und schwerer von Gliedern, als die Tage vorher, sagte seinem Vetter schon gegen neun Uhr gute Nacht, zog eilig das Federbett bis über das Kinn und schlief ein wie erschlagen.
Allein schon der folgende Tag, der erste Montag also, den der Hospitant hier oben verlebte, brachte eine weitere regelmäßig wiederkehrende Abwandlung des Tageslaufes: nämlich einen jener Vorträge, die Dr. Krokowski vierzehntägig im Speisesaal vor dem gesamten volljährigen, der deutschen Sprache kundigen und nicht moribunden Publikum des „Berghofes“ hielt. Es handelte sich, wie Hans Castorp von seinem Vetter hörte, um eine Reihe zusammenhängender Kollegien, einen populär-wissenschaftlichen Kursus unter dem Generaltitel „Die Liebe als krankheitbildende Macht“. Die belehrende Unterhaltung fand nach dem zweiten Frühstück statt, und es war, wie wiederum Joachim sagte, nicht zulässig, wurde zum mindesten höchst ungern gesehen, daß man sich davon ausschlösse, – weshalb es denn auch als erstaunliche Frechheit galt, daß Settembrini, obgleich des Deutschen mächtiger als irgend jemand, die Vorträge nicht nur niemals besuchte, sondern sich auch in den abschätzigsten Äußerungen darüber erging. Was Hans Castorp betraf, so war er vor allem aus Höflichkeit, dann aber auch aus unverhohlener Neugier sofort entschlossen, sich einzufinden. Vorher jedoch tat er etwas ganz Verkehrtes und Fehlerhaftes: er ließ sich einfallen, auf eigene Hand einen ausgedehnten Spaziergang zu machen, was ihm über alles Vermuten schlecht bekam.
„Jetzt paß auf!“ waren seine ersten Worte, als Joachim morgens in sein Zimmer trat. „Ich sehe, daß es mit mir nicht so weitergeht. Ich habe die horizontale Lebensweise nun satt, – das Blut schläft einem ja dabei ein. Mit dir ist es selbstverständlich was anderes, du bist Patient, dich will ich durchaus nicht verführen. Aber ich will nun mal gleich nach dem Frühstück einen ordentlichen Spaziergang unternehmen, wenn du es mir nicht übel nimmst, so ein paar Stunden aufs Geratewohl in die Welt hinein. Ich stecke mir einen Bissen zum Frühstück in die Tasche, dann bin ich unabhängig. Wir wollen doch sehen, ob ich nicht ein anderer Kerl bin, wenn ich nach Hause komme.“
„Schön!“ sagte Joachim, da er sah, daß es dem anderen ernst war mit seinem Begehren und Vorsatz. „Aber übertreibe es nicht, das rate ich dir. Es ist hier anders als wie zu Hause. Und dann sei pünktlich zum Vortrag zurück!“
In Wirklichkeit waren es noch andere Gründe, als nur der körperliche, die dem jungen Hans Castorp sein Vorhaben eingegeben hatten. Ihm war, als ob an seinem hitzigen Kopf, dem schlechten Geschmack, den er meistens im Munde hatte, und dem willkürlichen Klopfen seines Herzens viel weniger die Schwierigkeiten der Akklimatisation schuld seien, als solche Dinge, wie das Treiben des russischen Ehepaars nebenan, die Reden der kranken und dummen Frau Stöhr bei Tische, des Herrenreiters weicher Husten, den er täglich auf den Korridoren vernahm, die Äußerungen Herrn Albins, die Eindrücke, die er von den Verkehrssitten der leidenden Jugend empfangen hatte, der Gesichtsausdruck Joachims, wenn er Marusja betrachtete, und dergleichen Wahrnehmungen mehr. Er dachte, es müsse gut sein, dem Bannkreise des „Berghofes“ einmal zu entkommen, im Freien tief aufzuatmen und sich tüchtig zu rühren, um, wenn man abends müde war, doch wenigstens zu wissen, warum. Und so trennte er sich denn unternehmend von Joachim, als dieser nach dem Frühstück seinen dienstlich abgemessenen Lustwandel nach der Bank an der Wasserrinne antrat, und marschierte stockschwenkend die Fahrstraße hinab seine eigenen Wege.
Es war ein kühler, bedeckter Morgen – gegen halb neun Uhr. Wie er es sich vorgenommen, atmete Hans Castorp tief die reine Frühluft, diese frische und leichte Atmosphäre, die mühelos einging und ohne Feuchtigkeitsduft, ohne Gehalt, ohne Erinnerungen war ... Er überschritt den Wasserlauf und das Schmalspurgeleise, gelangte auf die unregelmäßig bebaute Straße, verließ sie gleich wieder und schlug einen Wiesenpfad ein, der nur ein kurzes Stück zu ebener Erde lief und dann schräg hin und ziemlich steil den rechtsseitigen Hang emporführte. Das Steigen freute Hans Castorp, seine Brust weitete sich, er schob mit der Stockkrücke den Hut aus der Stirn, und als er, aus einiger Höhe zurückblickend, in der Ferne den Spiegel des Sees gewahrte, an dem er auf der Herreise vorübergekommen war, begann er zu singen.
Er sang die Stücke, über die er eben verfügte, allerlei volkstümlich empfindsame Lieder, wie sie in Kommers- und Turnliederbüchern stehen, unter anderem eines, worin die Zeilen vorkamen:
„Die Barden sollen Lieb und Wein,
Doch öfter Tugend preisen“ –
sang sie anfangs leise und summend, dann laut und aus ganzer Kraft. Sein Bariton war spröde, aber heute fand er ihn schön, und das Singen begeisterte ihn mehr und mehr. Hatte er zu hoch eingesetzt, so verlegte er sich auf fistelnde Kopftöne, und auch diese erschienen ihm schön. Wenn sein Gedächtnis ihn im Stiche ließ, so half er sich damit, daß er der Melodie irgendwelche sinnlose Silben und Worte unterlegte, die er nach Art der Kunstsänger formenden Mundes und mit prunkendem Gaumen-R in die Lüfte sandte, und ging schließlich dazu über, sowohl was den Text als auch was die Töne betraf, nur noch zu phantasieren und seine Produktion sogar mit opernhaften Armbewegungen zu begleiten. Da es sehr anstrengend ist, zugleich zu steigen und zu singen, so wurde ihm bald der Atem knapp und fehlte ihm immer mehr. Aber aus Idealismus, um der Schönheit des Gesanges willen, bezwang er die Not und gab unter häufigen Seufzern sein Letztes her, bis er sich endlich in äußerster Kurzluftigkeit, blind, nur ein farbiges Flimmern vor Augen und mit fliegenden Pulsen unter einer dicken Kiefer niedersinken ließ, – nach so großer Erhebung plötzlich die Beute durchgreifender Verstimmung, eines Katzenjammers, der an Verzweiflung grenzte.
Als er mit leidlich wieder befestigten Nerven sich aufmachte, um seinen Spaziergang fortzusetzen, zitterte sein Genick sehr lebhaft, so daß er bei so jungen Jahren genau auf dieselbe Weise mit dem Kopfe wackelte, wie der alte Hans Lorenz Castorp es dereinst getan hatte. Er selbst fand sich durch die Erscheinung an seinen verstorbenen Großvater herzlich erinnert, und ohne sie als widerwärtig zu empfinden, gefiel er sich darin, die ehrwürdige Kinnstütze nachzuahmen, womit der Alte dem Kopfzittern zu steuern gesucht und die dem Knaben einst so zugesagt hatte.
Er stieg noch höher, in Serpentinen. Kuhglockengeläut zog ihn an, und er fand auch die Herde; sie graste in der Nähe einer Blockhütte, deren Dach mit Steinen beschwert war. Zwei bärtige Männer kamen ihm entgegen, mit Äxten auf den Schultern, und trennten sich, als sie nahe herangekommen. „Nun, so leb wohl und hab Dank!“ sagte der eine zum andern mit tiefer, gaumiger Stimme, legte seine Axt auf die andere Schulter und begann ohne Weg und mit knackenden Tritten zwischen den Fichten zu Tal zu schreiten. Es hatte so sonderbar in der Einsamkeit geklungen, dieses „Leb wohl und hab Dank“ und träumerisch Hans Castorps vom Steigen und Singen benommenen Sinn berührt. Er sprach es leise nach, indem er sich bemühte, die gutturale und feierlich-unbeholfene Mundart des Gebirglers nachzuahmen, und stieg noch ein Stück über die Almhütte hinaus, da es ihm darum zu tun war, die Baumgrenze zu erreichen; doch ließ er nach einem Blick auf die Uhr von diesem Vorhaben ab.
Er folgte linkshin, in der Richtung gegen den Ort, einem Pfade, der eben lief und dann abwärts führte. Hochstämmiger Nadelwald nahm ihn auf, und indem er ihn durchwanderte, begann er sogar wieder ein wenig zu singen, wenn auch mit Vorsicht und obgleich seine Knie beim Abstiege noch befremdlicher zitterten als vorher. Aber aus dem Gehölz hervortretend, stand er überrascht vor einer prächtigen Szenerie, die sich ihm öffnete, einer intim geschlossenen Landschaft von friedlich-großartiger Bildmäßigkeit.
In flachem, steinigem Bett kam ein Bergwasser die rechtsseitige Höhe herab, ergoß sich schäumend über terrassenförmig gelagerte Blöcke und floß dann ruhiger gegen das Tal hin weiter, von einem Stege mit schlicht gezimmertem Geländer malerisch überbrückt. Der Grund war blau von den Glockenblüten einer staudenartigen Pflanze, die überall wucherte. Ernste Fichten, riesig und ebenmäßig von Wuchs, standen einzeln und in Gruppen auf dem Boden der Schlucht sowie die Höhen hinan, und eine davon, zur Seite des Wildbaches schräg im Gehänge wurzelnd, ragte schief und bizarr in das Bild hinein. Rauschende Abgeschiedenheit waltete über dem schönen, einsamen Ort. Jenseits des Baches bemerkte Hans Castorp eine Ruhebank.
Er überschritt den Steg und setzte sich, um sich vom Anblick des Wassersturzes, des treibenden Schaums unterhalten zu lassen, dem idyllisch gesprächigen, einförmigen und doch innerlich abwechslungsvollen Geräusche zu lauschen; denn rauschendes Wasser liebte Hans Castorp ebensosehr wie Musik, ja vielleicht noch mehr. Aber kaum hatte er sichs bequem gemacht, als ein Nasenbluten ihn so plötzlich befiel, daß er seinen Anzug nicht ganz vor Verunreinigung schützen konnte. Die Blutung war heftig, hartnäckig und machte ihm wohl eine halbe Stunde lang zu schaffen, indem sie ihn zwang, beständig zwischen Bach und Bank hin und her zu laufen, sein Schnupftuch zu spülen, Wasser aufzuschnauben und sich wieder flach auf den Brettersitz hinzustrecken, das feuchte Tuch auf der Nase. So blieb er liegen als endlich das Blut versiegte – lag still, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, mit hochgezogenen Knien, die Augen geschlossen, die Ohren erfüllt vom Rauschen, nicht unwohl, eher besänftigt vom reichlichen Aderlaß und in einem Zustande sonderbar herabgesetzter Lebenstätigkeit; denn wenn er ausgeatmet hatte, fühlte er lange kein Bedürfnis, neue Luft einzuholen, sondern ließ mit stillgestelltem Leibe ruhig sein Herz eine Reihe von Schlägen tun, bis er spät und träge wieder einen oberflächlichen Atemzug aufnahm.
Da fand er sich auf einmal in jene frühe Lebenslage versetzt, die das Urbild eines nach neuesten Eindrücken gemodelten Traumes war, den er vor einigen Nächten geträumt ... Aber so stark, so restlos, so bis zur Aufhebung des Raumes und der Zeit war er ins Dort und Damals entrückt, daß man hätte sagen können, ein lebloser Körper liege hier oben beim Gießbache auf der Bank, während der eigentliche Hans Castorp weit fort in früherer Zeit und Umgebung stünde, und zwar in einer bei aller Einfachheit gewagten und herzberauschenden Situation.
Er war dreizehn Jahre alt, Untertertianer, ein Junge in kurzen Hosen, und stand auf dem Schulhof im Gespräch mit einem anderen, ungefähr gleichaltrigen Jungen aus einer anderen Klasse, – einem Gespräch, das Hans Castorp ziemlich willkürlich vom Zaune gebrochen hatte, und das ihn, obgleich es seines sachlichen und knapp umschriebenen Gegenstandes wegen nur ganz kurz sein konnte, doch im höchsten Grade erfreute. Es war die Pause zwischen der vorletzten und letzten Stunde, einer Geschichts- und einer Zeichenstunde für Hans Castorps Klasse. Auf dem Hofe, der mit roten Klinkern gepflastert und von einer mit Schindeln gedeckten und mit zwei Eingangstoren versehenen Mauer gegen die Straße abgetrennt war, gingen die Schüler in Reihen auf und nieder, standen in Gruppen, lehnten halb sitzend an den glasierten Mauervorsprüngen des Gebäudes. Es herrschte Stimmengewirr. Ein Lehrer im Schlapphut beaufsichtigte das Treiben, indem er in eine Schinkensemmel biß.
Der Knabe, mit dem Hans Castorp sprach, hieß Hippe, mit Vornamen Pribislav. Als Merkwürdigkeit kam hinzu, daß das r dieses Vornamens wie sch auszusprechen war: es hieß „Pschibislav“; und dieser absonderliche Vorname stimmte nicht schlecht zu seinem Äußeren, das nicht ganz durchschnittsmäßig, entschieden etwas fremdartig war. Hippe, Sohn eines Historikers und Gymnasialprofessors, notorischer Musterschüler folglich und schon eine Klasse weiter als Hans Castorp, obgleich kaum älter als dieser, stammte aus Mecklenburg und war für seine Person offenbar das Produkt einer alten Rassenmischung, einer Versetzung germanischen Blutes mit wendisch-slawischem – oder auch umgekehrt. Zwar war er blond, – sein Haar war ganz kurz über dem Rundschädel geschoren. Aber seine Augen, blaugrau oder graublau von Farbe – es war eine etwas unbestimmte und mehrdeutige Farbe, die Farbe etwa eines fernen Gebirges –, zeigten einen eigentümlichen, schmalen und genau genommen sogar etwas schiefen Schnitt, und gleich darunter saßen die Backenknochen, vortretend und stark ausgeprägt, – eine Gesichtsbildung, die in seinem Falle durchaus nicht entstellend, sondern sogar recht ansprechend wirkte, die aber genügt hatte, ihm bei seinen Kameraden den Spitznamen „der Kirgise“ einzutragen. Übrigens trug Hippe schon lange Hosen und dazu eine hochgeschlossene, blaue, im Rücken gezogene Joppe, auf deren Kragen einige Schuppen von seiner Kopfhaut zu liegen pflegten.
Nun war die Sache die, daß Hans Castorp schon von langer Hand her sein Augenmerk auf diesen Pribislav gerichtet, – aus dem ganzen ihm bekannten und unbekannten Gewimmel des Schulhofes ihn erlesen hatte, sich für ihn interessierte, ihm mit den Blicken folgte, soll man sagen: ihn bewunderte? auf jeden Fall ihn mit ausnehmendem Anteil betrachtete und sich schon auf dem Schulwege darauf freute, ihn im Verkehre mit seinen Klassengenossen zu beobachten, ihn sprechen und lachen zu sehen und von weitem seine Stimme zu unterscheiden, die angenehm belegt, verschleiert, etwas heiser war. Zugegeben, daß für diese Teilnahme kein recht zureichender Grund vorhanden war, wenn man nicht etwa den heidnischen Vornamen, das Musterschülertum (das aber unmöglich ins Gewicht fallen konnte) oder endlich die Kirgisenaugen für einen solchen nehmen wollte, – Augen, die sich zuweilen, bei einem gewissen Seitenblick, der nicht zum Sehen diente, auf eine schmelzende Weise ins Schleierig-Nächtige verdunkeln konnten – so machte Hans Castorp sich doch wenig Sorge um die geistige Rechtfertigung seiner Empfindungen oder gar darum, wie sie etwa notfalls zu benennen gewesen wären. Denn von Freundschaft konnte nicht gut die Rede sein, da er Hippe ja gar nicht „kannte“. Aber erstens lag nicht die geringste Nötigung zur Namengebung vor, da kein Gedanke daran war, daß der Gegenstand je zur Sprache gebracht werden könnte, – dazu eignete er sich nicht und verlangte auch nicht danach. Und zweitens bedeutet ein Name ja, wenn nicht Kritik, so doch Bestimmung, das heißt Unterbringung im Bekannten und Gewohnten, während Hans Castorp doch von der unbewußten Überzeugung durchdrungen war, daß ein inneres Gut, wie dieses, vor solcher Bestimmung und Unterbringung ein für allemal geschützt sein sollte.
Aber gut oder schlecht begründet, jedenfalls waren diese dem Namen und der Mitteilung so fernen Empfindungen von solcher Lebenskraft, daß Hans Castorp sich schon fast seit einem Jahr – ungefähr seit einem Jahr, denn genau waren ihre Anfänge nicht aufzufinden – im stillen damit trug, was zum mindesten für die Treue und Beständigkeit seines Charakters sprach, wenn man erwägt, welche riesige Zeitmasse ein Jahr in diesem Lebensalter bedeutet. Leider wohnt den Bezeichnungen von Charaktereigenschaften regelmäßig ein moralisches Urteil inne, sei es im lobenden oder tadelnden Sinn, obgleich sie alle ihre zwei Seiten haben. Hans Castorps „Treue“, auf die er sich übrigens weiter nichts zugute tat, bestand, ohne Wertung gesprochen, in einer gewissen Schwerfälligkeit, Langsamkeit und Beharrlichkeit seines Gemütes, einer erhaltenden Grundstimmung, die ihm Zustände und Lebensverhältnisse der Anhänglichkeit und des Fortbestandes desto würdiger erscheinen ließ, je länger sie bestanden. Auch war er geneigt, an die unendliche Dauer des Zustandes, der Verfassung zu glauben, worin er sich gerade befand, schätzte sie eben darum und war nicht auf Veränderung erpicht. So hatte er sich an sein stilles und fernes Verhältnis zu Pribislav Hippe im Herzen gewöhnt und hielt es im Grunde für eine bleibende Einrichtung seines Lebens. Er liebte die Gemütsbewegungen, die es mit sich brachte, die Spannung, ob jener ihm heute begegnen, dicht an ihm vorübergehen, vielleicht ihn anblicken werde, die lautlosen, zarten Erfüllungen, mit denen sein Geheimnis ihn beschenkte, und sogar die Enttäuschungen, die zur Sache gehörten und deren größte war, wenn Pribislav „fehlte“: dann war der Schulhof verödet, der Tag aller Würze bar, aber die hinhaltende Hoffnung blieb.
Das dauerte ein Jahr, bis es auf jenen abenteuerlichen Höhepunkt gelangte, dann dauerte es noch ein Jahr, dank der bewahrenden Treue Hans Castorps, und dann hörte es auf – und zwar ohne daß er mehr von der Lockerung und Auflösung der Bande merkte, die ihn an Pribislav Hippe knüpften, als er von ihrer Entstehung gemerkt hatte. Auch verließ Pribislav, infolge der Versetzung seines Vaters, Schule und Stadt; aber das beachtete Hans Castorp kaum noch; er hatte ihn schon vorher vergessen. Man kann sagen, daß die Gestalt des „Kirgisen“ unmerklich aus Nebeln in sein Leben getreten war, langsam immer mehr Deutlichkeit und Greifbarkeit gewonnen hatte, bis zu jenem Augenblick der größten Nähe und Körperlichkeit, auf dem Hofe, eine Weile so im Vordergrunde gestanden hatte und dann allmählich wieder zurückgetreten und ohne Abschiedsweh in den Nebeln entschwunden war.
Jener Augenblick aber, die gewagte und abenteuerliche Situation, in die Hans Castorp sich nun wieder versetzt fand, das Gespräch, ein wirkliches Gespräch mit Pribislav Hippe, kam folgendermaßen zustande. Die Zeichenstunde war an der Reihe, und Hans Castorp bemerkte, daß er seinen Bleistift nicht bei sich hatte. Jeder seiner Klassengenossen brauchte den seinen; aber er hatte ja unter den Angehörigen anderer Klassen diesen und jenen Bekannten, den er um einen Stift hätte angehen können. Am bekanntesten jedoch, fand er, war ihm Pribislav, am nächsten stand ihm dieser, mit dem er im stillen schon so viel zu tun gehabt hatte; und mit einem freudigen Aufschwunge seines Wesens beschloß er, die Gelegenheit – eine Gelegenheit nannte er es – zu benutzen und Pribislav um einen Bleistift zu bitten. Daß das ein ziemlich sonderbarer Streich sein werde, da er Hippe in Wirklichkeit ja nicht kannte, das entging ihm, oder er kümmerte sich doch nicht darum, verblendet von merkwürdiger Rücksichtslosigkeit. Und so stand er denn nun im Gewühle des Klinkerhofes wirklich vor Pribislav Hippe und sagte zu ihm:
„Entschuldige, kannst du mir einen Bleistift leihen?“
Und Pribislav sah ihn an mit seinen Kirgisenaugen über den vorstehenden Backenknochen und sprach zu ihm mit seiner angenehm heiseren Stimme, ohne Verwunderung oder doch ohne Verwunderung an den Tag zu legen.
„Gern“, sagte er. „Du mußt ihn mir nach der Stunde aber bestimmt zurückgeben.“ Und zog sein Crayon aus der Tasche, ein versilbertes Crayon mit einem Ring, den man aufwärts schieben mußte, damit der rot gefärbte Stift aus der Metallhülse wachse. Er erläuterte den einfachen Mechanismus, während ihre beiden Köpfe sich darüberneigten.
„Aber mach ihn nicht entzwei!“ sagte er noch.
Wo dachte er hin? Als ob Hans Castorp die Absicht gehabt hätte, den Stift etwa nicht zurückzuerstatten oder gar ihn fahrlässig zu behandeln.
Dann sahen sie einander lächelnd an, und da nichts mehr zu sagen blieb, so kehrten sie sich erst die Schultern und dann die Rücken zu und gingen.
Das war alles. Aber vergnügter war Hans Castorp in seinem Leben nie gewesen, als in dieser Zeichenstunde, da er mit Pribislav Hippes Bleistift zeichnete, – mit der Aussicht obendrein, ihn nachher seinem Besitzer wieder einzuhändigen, was als reine Dreingabe zwanglos und selbstverständlich aus dem vorhergehenden folgte. Er war so frei, den Bleistift etwas zuzuspitzen, und von den rot lackierten Schnitzeln, die abfielen, bewahrte er drei oder vier fast ein ganzes Jahr lang in einer inneren Schublade seines Pultes auf, – niemand, der sie gesehen hätte, würde geahnt haben, wie Bedeutendes es damit auf sich hatte. Übrigens vollzog die Rückgabe sich in den einfachsten Formen, was aber ganz nach Hans Castorps Sinne war, ja, worauf er sich sogar etwas Besonderes zugute tat, – abgestumpft und verwöhnt, wie er war, durch den intimen Verkehr mit Hippe.
„Da“, sagte er. „Danke sehr.“
Und Pribislav sagte gar nichts, sondern revidierte nur flüchtig den Mechanismus und schob das Crayon in die Tasche ...
Dann hatten sie nie wieder miteinander gesprochen, aber dies eine Mal, dank Hans Castorps Unternehmungsgeist, war es eben doch geschehen ...
Er riß die Augen auf, verwirrt von der Tiefe seiner Entrücktheit. „Ich glaube, ich habe geträumt!“ dachte er. „Ja, das war Pribislav. Lange habe ich nicht mehr an ihn gedacht. Wo sind die Schnitzel hingekommen? Das Pult ist auf dem Boden, zu Hause bei Onkel Tienappel. Sie müssen noch in der inneren kleinen Schublade links hinten sein. Ich habe sie nie herausgenommen. Nicht einmal soviel Aufmerksamkeit, sie wegzuwerfen, erwies ich ihnen ... Es war ganz Pribislav, wie er leibte und lebte. Ich hätte nicht gedacht, daß ich ihn je so deutlich wiedersehen würde. Wie merkwürdig ähnlich er ihr sah, – dieser hier oben! Darum also interessiere ich mich so für sie? Oder vielleicht auch: habe ich mich darum so für ihn interessiert? Unsinn! Ein schöner Unsinn. Ich muß übrigens gehen, und zwar schleunigst.“ Aber er blieb doch noch liegen, sinnend und sich erinnernd. Dann richtete er sich auf. „Nun, so leb wohl und hab Dank!“ sagte er und bekam Tränen in die Augen, während er lächelte. Damit wollte er aufbrechen; aber er setzte sich, Hut und Stock in der Hand, rasch noch einmal nieder, denn er hatte bemerken müssen, daß seine Knie ihn nicht recht trugen. „Hoppla,“ dachte er, „ich glaube, das wird nicht gehen! Und dabei soll ich Punkt elf Uhr zum Vortrag im Eßsaal sein. Das Spazierengehen hat hier sein Schönes, aber auch seine Schwierigkeiten, wie es scheint. Ja, ja, aber hierbleiben kann ich nicht. Es ist nur, daß ich vom Liegen etwas lahm geworden bin; in der Bewegung wird es schon besser werden.“ Und er versuchte nochmals, auf die Beine zu kommen, und da er sich gehörig zusammennahm, so ging es.
Immerhin wurde es eine klägliche Heimkehr, nach einem so hochgemuten Auszug. Wiederholt mußte er am Wege rasten, da er fühlte, daß sein Gesicht plötzlich weiß wurde, kalter Schweiß ihm auf die Stirne trat und das regellose Verhalten seines Herzens ihm den Atem benahm. Kümmerlich kämpfte er sich so die Serpentinen hinab; als er aber in der Nähe des Kurhauses das Tal erreichte, sah er klar und deutlich, daß er die gedehnte Wegstrecke zum „Berghof“ unmöglich noch aus eigener Kraft werde überwinden können, und da es keine Trambahn gab und kein Mietsfuhrwerk sich zeigte, so bat er einen Fuhrmann, der einen Stellwagen mit leeren Kisten gegen „Dorf“ hin lenkte, ihn aufsitzen zu lassen. Rücken an Rücken mit dem Kutscher, die Beine vom Wagen hängend, von den Passanten mit verwunderter Teilnahme betrachtet, schwankend und nickend im Halbschlaf und unter den Stößen des Gefährtes, zog er dahin, stieg ab beim Bahnübergange, gab Geld hin, ohne zu sehen, wie viel und wie wenig, und hastete kopfüber die Wegschleife hinan.
„Dépêchez-vous, monsieur!“ sagte der französische Türhüter. „La conférence de M. Krokowski vient de commencer.“ Und Hans Castorp warf Hut und Stock in die Garderobe und zwängte sich hastig-behutsam, die Zunge zwischen den Zähnen, durch die kaum geöffnete Glastür in den Speisesaal, wo die Kurgesellschaft reihenweise auf Stühlen saß, während an der rechten Schmalseite Dr. Krokowski im Gehrock hinter einem gedeckten und mit einer Wasserkaraffe geschmückten Tische stand und sprach ...
Ein freier Eckplatz winkte glücklicherweise in der Nähe der Tür. Er stahl sich seitlich darauf und nahm eine Miene an, als hätte er hier schon immer gesessen. Das Publikum, mit erster Aufmerksamkeit an Dr. Krokowskis Lippen hängend, beachtete ihn kaum; und das war gut, denn er sah schrecklich aus. Sein Gesicht war bleich wie Leinen und sein Anzug mit Blut befleckt, so daß er einem von frischer Tat kommenden Mörder glich. Die Dame vor ihm freilich wandte den Kopf, als er sich setzte, und musterte ihn mit schmalen Augen. Es war Madame Chauchat, er erkannte sie mit einer Art von Erbitterung. Aber das war doch des Teufels! Sollte er denn nicht zur Ruhe kommen? Er hatte gedacht, hier still am Ziele sitzen und sich ein wenig erholen zu können, und da mußte er sie nun gerade vor der Nase haben, – ein Zufall, über den er sich unter anderen Umständen ja möglicherweise gefreut hätte, aber müde und abgehetzt, wie er war, was sollte es ihm da? Es stellte nur neue Anforderungen an sein Herz und würde ihn während des ganzen Vortrags in Atem halten. Genau mit Pribislavs Augen hatte sie ihn angesehen, in sein Gesicht und auf die Blutflecke seines Anzugs geblickt, – ziemlich rücksichtslos und zudringlich übrigens, wie es zu den Manieren einer Frau paßte, die mit den Türen warf. Wie schlecht sie sich hielt! Nicht wie die Frauen in Hans Castorps heimischer Sphäre, die aufrechten Rückens den Kopf ihrem Tischherrn zuwandten, indes sie mit den Spitzen der Lippen sprachen. Frau Chauchat saß zusammengesunken und schlaff, ihr Rücken war rund, sie ließ die Schultern nach vorne hängen, und außerdem hielt sie auch noch den Kopf vorgeschoben, so daß der Wirbelknochen im Nackenausschnitt ihrer weißen Bluse hervortrat. Auch Pribislav hatte den Kopf so ähnlich gehalten; er jedoch war ein Musterschüler gewesen, der in Ehren gelebt hatte (obgleich nicht dies der Grund gewesen war, weshalb Hans Castorp sich den Bleistift von ihm geliehen hatte), – während es klar und deutlich war, daß Frau Chauchats nachlässige Haltung, ihr Türenwerfen, die Rücksichtslosigkeit ihres Blickes mit ihrem Kranksein zusammenhingen, ja, es drückten sich darin die Ungebundenheit, jene nicht ehrenvollen, aber geradezu grenzenlosen Vorteile aus, deren der junge Herr Albin sich gerühmt hatte ...
Hans Castorps Gedanken verwirrten sich, während er auf Frau Chauchats schlaffen Rücken blickte, sie hörten auf, Gedanken zu sein, und wurden zur Träumerei, in welche Dr. Krokowskis schleppender Bariton, sein weich anschlagendes r wie aus weiter Ferne hereintönte. Aber die Stille im Saal, die tiefe Aufmerksamkeit, die ringsumher alles in Bann hielt, wirkte auf ihn, sie weckte ihn förmlich aus seinem Dämmern. Er blickte um sich ... Neben ihm saß der dünnhaarige Pianist, den Kopf im Nacken und lauschte mit offenem Munde und gekreuzten Armen. Die Lehrerin, Fräulein Engelhart, weiter drüben, hatte gierige Augen und rotflaumige Flecke auf beiden Wangen, – eine Hitze, die sich auf den Gesichtern anderer Damen wiederfand, die Hans Castorp ins Auge faßte, auch auf dem der Frau Salomon dort, neben Herrn Albin, und der Bierbrauersgattin Frau Magnus, derselben, die Eiweiß verlor. Auf Frau Stöhrs Gesicht, etwas weiter zurück, malte sich eine so ungebildete Schwärmerei, daß es ein Jammer war, während die elfenbeinfarbene Levi, mit halbgeschlossenen Augen und die flachen Hände im Schoß an der Stuhllehne ruhend, vollständig einer Toten geglichen hätte, wenn nicht ihre Brust sich so stark und taktmäßig gehoben und gesenkt hätte, wodurch sie Hans Castorp vielmehr an eine weibliche Wachsfigur erinnerte, die er einst im Panoptikum gesehen und die ein mechanisches Triebwerk im Busen gehabt hatte. Mehrere Gäste hielten die hohle Hand an die Ohrmuschel, oder deuteten dies wenigstens an, indem sie die Hand bis halbwegs zum Ohre erhoben hielten, als seien sie mitten in der Bewegung vor Aufmerksamkeit erstarrt. Staatsanwalt Paravant, ein brauner, scheinbar urkräftiger Mann, schüttelte sogar sein eines Ohr mit dem Zeigefinger, um es hellhöriger zu machen, und hielt es dann wieder Dr. Krokowskis Redeflusse hin.
Was redete denn Dr. Krokowski? In welchem Gedankengange bewegte er sich? Hans Castorp nahm seinen Verstand zusammen, um aufs laufende zu kommen, was ihm nicht gleich gelang, da er den Anfang nicht gehört und beim Nachdenken über Frau Chauchats schlaffen Rücken Weiteres versäumt hatte. Es handelte sich um eine Macht ... jene Macht ... kurzum, es war die Macht der Liebe, um die es sich handelte. Selbstverständlich! Das Thema lag ja im Generaltitel des Vortragszyklus, und wovon sollte Dr. Krokowski denn auch sonst wohl sprechen, da dies nun einmal sein Gebiet war. Etwas wunderlich war es ja, auf einmal ein Kolleg über die Liebe zu hören, während sonst immer nur von Dingen wie dem Übersetzungsgetriebe im Schiffbau die Rede gewesen war. Wie fing man es an, einen Gegenstand von so spröder und verschwiegener Beschaffenheit am hellen Vormittag vor Damen und Herren zu erörtern? Dr. Krokowski erörterte ihn in einer gemischten Ausdrucksweise, in zugleich poetischem und gelehrtem Stile, rücksichtslos wissenschaftlich, dabei aber gesanghaft schwingenden Tones, was den jungen Hans Castorp etwas unordentlich anmutete, obgleich gerade dies der Grund sein mochte, weshalb die Damen so hitzige Wangen hatten und die Herren ihre Ohren schüttelten. Insonderheit gebrauchte der Redner das Wort „Liebe“ beständig in einem leise schwankenden Sinn, so daß man niemals recht wußte, woran man damit war, und ob es Frommes oder Leidenschaftlich-Fleischliches bedeute, – was ein leichtes Gefühl von Seekrankheit erzeugte. Nie in seinem Leben hatte Hans Castorp dieses Wort so oft hintereinander aussprechen hören, wie hier und heute, ja, wenn er nachdachte, so schien ihm, daß er selbst es noch niemals ausgesprochen oder aus fremdem Munde vernommen habe. Das mochte ein Irrtum sein, – jedenfalls fand er nicht, daß so häufige Wiederholung dem Worte zustatten käme. Im Gegenteil, diese schlüpfrigen anderthalb Silben mit dem Zungen-, dem Lippenlaut und dem dünnen Vokal in der Mitte wurden ihm auf die Dauer recht widerwärtig, eine Vorstellung verband sich für ihn damit wie von gewässerter Milch, – etwas Weißbläulichem, Labberigem, zumal im Vergleich mit all dem Kräftigen, was Dr. Krokowski genau genommen darüber zum besten gab. Denn so viel ward deutlich, daß man starke Stücke sagen konnte, ohne die Leute aus dem Saale zu treiben, wenn man es anfing wie er. Keineswegs begnügte er sich damit, allgemein bekannte, doch gemeinhin in Schweigen gehüllte Dinge mit einer Art von berauschendem Takt zur Sprache zu bringen; er zerstörte Illusionen, er gab unerbittlich der Erkenntnis die Ehre, er ließ keinen Raum für empfindsamen Glauben an die Würde des Silberhaares und die Engelsreinheit des zarten Kindes. Übrigens trug er auch zum Gehrock seinen weichen Fallkragen und seine Sandalen über den grauen Socken, was einen grundsätzlichen und idealistischen Eindruck machte, wenn auch Hans Castorp etwas darüber erschrak. Indem er an der Hand von Büchern und losen Blättern, die vor ihm auf dem Tische lagen, seine Aufstellungen durch allerlei Beispiele und Anekdoten stützte und mehrmals sogar Verse rezitierte, handelte Dr. Krokowski von erschreckenden Formen der Liebe, wunderlichen, leidvollen und unheimlichen Abwandlungen ihrer Erscheinung und Allgewalt. Unter allen Naturtrieben, sagte er, sei sie der schwankendste und gefährdetste, von Grund aus zur Verirrung und heillosen Verkehrtheit geneigt, und das dürfe nicht wundernehmen. Denn dieser mächtige Impuls sei nichts Einfaches, er sei seiner Natur nach vielfach zusammengesetzt, und zwar, so rechtmäßig wie er als Ganzes auch immer sei, – zusammengesetzt sei er aus lauter Verkehrtheiten. Da man nun aber, und zwar mit Recht, so fuhr Dr. Krokowski fort, da man es nun aber richtigerweise ablehne, aus der Verkehrtheit der Bestandteile auf die Verkehrtheit des Ganzen zu schließen, so sei man unweigerlich genötigt, einen Teil der Rechtmäßigkeit des Ganzen, wenn nicht seine ganze Rechtmäßigkeit, auch für die einzelne Verkehrtheit in Anspruch zu nehmen. Das sei eine Forderung der Logik, und daran bitte er seine Zuhörer festzuhalten. Seelische Widerstände und Korrektive seien es, anständige und ordnende Instinkte von – fast hätte er sagen mögen bürgerlicher Art, unter deren ausgleichender und einschränkender Wirkung die verkehrten Bestandteile zum regelrechten und nützlichen Ganzen verschmölzen, – ein immerhin häufiger und begrüßenswerter Prozeß, dessen Ergebnis jedoch (wie Dr. Krokowski etwas wegwerfend hinzufügte) den Arzt und Denker weiter nichts angehe. In einem anderen Falle dagegen gelinge er nicht, dieser Prozeß, wolle und solle er nicht gelingen, und wer, so fragte Dr. Krokowski, vermöge zu sagen, ob dies nicht vielleicht den edleren, seelisch kostbareren Fall bedeute? In diesem Falle nämlich eigne beiden Kräftegruppen, dem Liebesdrange sowohl wie jenen gegnerischen Impulsen, unter denen Scham und Ekel besonders zu nennen seien, eine außerordentliche, das bürgerlich-übliche Maß überschreitende Anspannung und Leidenschaft, und, in den Untergründen der Seele geführt, verhindere der Kampf zwischen ihnen jene Einfriedung, Sicherung und Sittigung der irrenden Triebe, die zur üblichen Harmonie, zum vorschriftsmäßigen Liebesleben führe. Dieser Widerstreit zwischen den Mächten der Keuschheit und der Liebe – denn um einen solchen handle es sich –, wie gehe er aus? Er endige scheinbar mit dem Siege der Keuschheit. Furcht, Wohlanstand, züchtiger Abscheu, zitterndes Reinheitsbedürfnis, sie unterdrückten die Liebe, hielten sie in Dunkelheiten gefesselt, ließen ihre wirren Forderungen höchstens teilweise, aber bei weitem nicht nach ihrer ganzen Vielfalt und Kraft ins Bewußtsein und zur Betätigung zu. Allein dieser Sieg der Keuschheit sei nur ein Schein- und Pyrrhussieg, denn der Liebesbefehl lasse sich nicht knebeln, nicht vergewaltigen, die unterdrückte Liebe sei nicht tot, sie lebe, sie trachte im Dunklen und Tiefgeheimen auch ferner sich zu erfüllen, sie durchbreche den Keuschheitsbann und erscheine wieder, wenn auch in verwandelter, unkenntlicher Gestalt ... Und welches sei denn nun die Gestalt und Maske, worin die nicht zugelassene und unterdrückte Liebe wiedererscheine? So fragte Dr. Krokowski und blickte die Reihen entlang, als erwarte er die Antwort ernstlich von seinen Zuhörern. Ja, das mußte er nun auch noch selber sagen, nachdem er schon so manches gesagt hatte. Niemand außer ihm wußte es, aber er würde bestimmt auch dies noch wissen, das sah man ihm an. Mit seinen glühenden Augen, seiner Wachsblässe und seinem schwarzen Bart, dazu den Mönchssandalen über grauwollenen Socken, schien er selbst in seiner Person den Kampf zwischen Keuschheit und Leidenschaft zu versinnbildlichen, von dem er gesprochen hatte. Wenigstens war dies Hans Castorps Eindruck, während er wie alle Welt mit größter Spannung die Antwort darauf erwartete, in welcher Gestalt die unzugelassene Liebe wiederkehre. Die Frauen atmeten kaum. Staatsanwalt Paravant schüttelte rasch noch einmal sein Ohr, damit es im entscheidenden Augenblick offen und aufnahmefähig wäre. Da sagte Dr. Krokowski: In Gestalt der Krankheit! Das Krankheitssymptom sei verkappte Liebesbetätigung und alle Krankheit verwandelte Liebe.
Nun wußte man es, wenn auch wohl nicht alle es ganz zu würdigen vermochten. Ein Seufzer ging durch den Saal, und Staatsanwalt Paravant nickte bedeutsamen Beifall, während Dr. Krokowski fortfuhr, seine These zu entwickeln. Hans Castorp seinerseits senkte den Kopf, um zu bedenken, was er gehört hatte, und sich zu erforschen, ob er es verstünde. Aber ungeübt, wie er war in solchen Gedankengängen, und außerdem wenig geisteskräftig infolge seines unbekömmlichen Spazierganges, war er leicht abzulenken und wurde dann auch sogleich abgelenkt durch den Rücken vor ihm und den zugehörigen Arm, der sich hob und rückwärts bog, um mit der Hand, dicht vor Hans Castorps Augen, von unten das geflochtene Haar zu stützen.
Es war beklemmend, die Hand so nahe vor Augen zu haben, – man mußte sie betrachten, ob man wollte oder nicht, sie studieren in allen Makeln und Menschlichkeiten, die ihr anhafteten, als habe man sie unter dem Vergrößerungsglas. Nein, sie hatte durchaus nichts Aristokratisches, diese zu gedrungene Schulmädchenhand mit den schlecht und recht beschnittenen Nägeln, – man war nicht einmal sicher, ob sie an den äußeren Fingergelenken ganz sauber war, und die Haut neben den Nägeln war zerbissen, das konnte gar keinem Zweifel unterliegen. Hans Castorps Mund verzog sich, aber seine Augen blieben haften an Madame Chauchats Hand, und eine halbe und unbestimmte Erinnerung ging ihm durch den Sinn an das, was Dr. Krokowski über die bürgerlichen Widerstände, die sich der Liebe entgegenstellten, gesagt hatte ... Der Arm war schöner, dieser weich hinter den Kopf gebogene Arm, der kaum bekleidet war, denn der Stoff der Ärmel war dünner als der der Bluse, – die leichteste Gaze, so daß der Arm nur eine gewisse duftige Verklärung dadurch erfuhr und ganz ohne Umhüllung wahrscheinlich weniger anmutig gewesen wäre. Er war zugleich zart und voll – und kühl, aller Mutmaßung nach. Es konnte hinsichtlich seiner von keinerlei bürgerlichen Widerständen die Rede sein.
Hans Castorp träumte, den Blick auf Frau Chauchats Arm gerichtet. Wie die Frauen sich kleideten! Sie zeigten dies und jenes von ihrem Nacken und ihrer Brust, sie verklärten ihre Arme mit durchsichtiger Gaze ... Das taten sie in der ganzen Welt, um unser sehnsüchtiges Verlangen zu erregen. Mein Gott, das Leben war schön! Es war schön gerade durch solche Selbstverständlichkeit, wie daß die Frauen sich verlockend kleideten, – denn selbstverständlich war es ja und so allgemein üblich und anerkannt, daß man kaum daran dachte und es sich unbewußt und ohne Aufhebens gefallen ließ. Man sollte aber daran denken, meinte Hans Castorp innerlich, um sich des Lebens recht zu freuen, und sich vergegenwärtigen, daß es eine beglückende und im Grunde fast märchenhafte Einrichtung war. Versteht sich, es war um eines gewissen Zweckes willen, daß die Frauen sich märchenhaft und beglückend kleiden durften, ohne dadurch gegen die Schicklichkeit zu verstoßen; es handelte sich um die nächste Generation, um die Fortpflanzung des Menschengeschlechts, jawohl. Aber wie, wenn die Frau nun innerlich krank war, so daß sie gar nicht zur Mutterschaft taugte, – was dann? Hatte es dann einen Sinn, daß sie Gazeärmel trug, um die Männer neugierig auf ihren Körper zu machen, – ihren innerlich kranken Körper? Das hatte offenbar keinen Sinn und hätte eigentlich für unschicklich gelten und untersagt werden müssen. Denn daß ein Mann sich für eine kranke Frau interessierte, dabei war doch entschieden nicht mehr Vernunft, als ... nun, als seinerzeit bei Hans Castorps stillem Interesse für Pribislav Hippe gewesen war. Ein dummer Vergleich, eine etwas peinliche Erinnerung. Aber sie hatte sich ungerufen und ohne sein Zutun eingestellt. Übrigens brach seine träumerische Betrachtung an diesem Punkte ab, hauptsächlich weil seine Aufmerksamkeit wieder auf Dr. Krokowski hingelenkt wurde, dessen Stimme sich auffallend erhoben hatte. Wahrhaftig, er stand da mit ausgebreiteten Armen und schräg geneigtem Kopf hinter seinem Tischchen und sah trotz seines Gehrockes beinahe aus wie der Herr Jesus am Kreuz!
Es stellte sich heraus, daß Dr. Krokowski am Schlusse seines Vortrages große Propaganda für die Seelenzergliederung machte und mit offenen Armen alle aufforderte, zu ihm zu kommen. Kommet her zu mir, sagte er mit anderen Worten, die ihr mühselig und beladen seid! Und er ließ keinen Zweifel an seiner Überzeugung, daß alle ohne Ausnahme mühselig und beladen waren. Er sprach von verborgenem Leide, von Scham und Gram, von der erlösenden Wirkung der Analyse; er pries die Durchleuchtung des Unbewußten, lehrte die Wiederverwandlung der Krankheit in den bewußt gemachten Affekt, mahnte zum Vertrauen, verhieß Genesung. Dann ließ er die Arme sinken, stellte seinen Kopf wieder gerade, raffte die Druckschriften zusammen, die ihm bei seinem Vortrage gedient hatten, und indem er das Päckchen, ganz wie ein Lehrer, mit der linken Hand gegen die Schulter lehnte, entfernte er sich erhobenen Hauptes durch den Wandelgang.
Alle standen auf, rückten die Stühle und begannen, sich langsam gegen denselben Ausgang zu bewegen, durch den der Doktor den Saal verlassen hatte. Es sah aus, als drängten sie ihm konzentrisch nach, von allen Seiten, zögernd, doch willenlos und in benommener Einhelligkeit, wie das Gewimmel hinter dem Rattenfänger. Hans Castorp blieb stehen im Strom, seine Stuhllehne in der Hand. Ich bin nur zu Besuch hier, dachte er; ich bin gesund und komme gottlob überhaupt nicht in Betracht, und den nächsten Vortrag erlebe ich gar nicht mehr hier. Er sah Frau Chauchat hinausgehen, schleichend, mit vorgeschobenem Kopfe. Ob auch sie sich zergliedern läßt? dachte er, und sein Herz begann zu pochen ... Dabei bemerkte er nicht, daß Joachim zwischen den Stühlen auf ihn zu kam, und zuckte nervös zusammen, als der Vetter das Wort an ihn richtete.
„Du kamst aber im letzten Augenblick“, sagte Joachim. „Bist du weit gewesen? Wie war es denn?“
„Oh, nett“, erwiderte Hans Castorp. „Doch, ich war ziemlich weit. Aber ich muß gestehen, es hat mir weniger gut getan, als ich erwartete. Es war wohl verfrüht oder überhaupt verfehlt. Ich werde es vorläufig nicht wieder tun.“
Ob ihm der Vortrag gefallen, fragte Joachim nicht, und Hans Castorp äußerte sich nicht dazu. Wie nach schweigender Übereinkunft erwähnten sie des Vortrages auch nachher mit keinem Worte.
Am Dienstag war unser Held nun also seit einer Woche bei denen hier oben, und so fand er denn, als er vom Morgenspaziergang zurückkehrte, in seinem Zimmer die Rechnung vor, seine erste Wochenrechnung, ein reinlich ausgeführtes kaufmännisches Dokument, in einen grünlichen Umschlag verschlossen, mit illustriertem Kopf (das Berghofgebäude war bestechend abgebildet dort oben) und links seitwärts geschmückt mit einem in schmaler Kolonne angeordneten Auszuge aus dem Prospekt, worin auch der „psychischen Behandlung nach modernsten Prinzipien“ in Sperrdruck Erwähnung geschah. Die kalligraphischen Aufstellungen selbst betrugen ziemlich genau 180 Franken, und zwar entfielen auf die Verpflegung nebst ärztlicher Behandlung 12 und auf das Zimmer 8 Franken für den Tag, ferner auf den Posten „Eintrittsgeld“ 20 Franken und auf die Desinfektion des Zimmers 10 Franken, während kleinere Sporteln für Wäsche, Bier und den zum ersten Abendessen genossenen Wein die Summe abrundeten.
Hans Castorp fand nichts zu beanstanden, als er mit Joachim die Addition überprüfte. „Ja, von der ärztlichen Behandlung mache ich keinen Gebrauch,“ sagte er, „aber das ist meine Sache; sie ist einbegriffen in den Pensionspreis, und ich kann nicht verlangen, daß sie in Abzug gebracht wird, wie sollte das auch geschehen? Bei der Desinfektion machen sie einen Schnitt, denn für 10 Franken H₂CO können sie unmöglich verpulvert haben, um die Amerikanerin auszuräuchern. Aber im ganzen muß ich sagen, ich finde es eher billig als teuer, in Anbetracht dessen, was geboten wird.“ Und so gingen sie denn vor dem zweiten Frühstück auf die „Verwaltung“, um die Schuld zu bereinigen.
Die „Verwaltung“ befand sich zu ebener Erde: wenn man, jenseits der Halle, an der Garderobe und den Küchen- und Anrichteräumen vorüber den Flurgang verfolgte, konnte man die Tür nicht verfehlen, zumal sie durch ein Porzellanschild ausgezeichnet war. Hans Castorp gewann dort mit Interesse einen gewissen Einblick in das kaufmännische Zentrum des Anstaltsbetriebes. Es war ein richtiges kleines Kontor: ein Schreibmaschinenfräulein war tätig, und drei männliche Angestellte saßen über Pulte gebückt, während im anstoßenden Raum ein Herr von dem höheren Ansehen eines Chefs oder Direktors an einem frei stehenden Zylinderbureau arbeitete und nur über sein Augenglas hinweg einen kalten und sachlich musternden Blick auf die Klienten warf. Während man sie am Schalter abfertigte, einen Schein wechselte, kassierte, quittierte, bewahrten sie eine ernst-bescheidene, schweigsame, ja botmäßige Haltung, wie junge Deutsche, die die Achtung vor der Behörde, der Amtsstube auf jedes Schreib- und Dienstlokal übertragen; aber draußen, auf dem Wege zum Frühstück und später im Laufe des Tages plauderten sie einiges über die Verfassung des Berghof-Instituts, wobei Joachim als der Eingesessene und Kundige die Fragen seines Vetters beantwortete.
Hofrat Behrens war keineswegs Inhaber und Besitzer der Anstalt, – obgleich man wohl diesen Eindruck gewinnen konnte. Über und hinter ihm standen unsichtbare Mächte, die sich eben nur in Gestalt des Bureaus bis zu einem gewissen Grade manifestierten: ein Aufsichtsrat, eine Aktiengesellschaft, der anzugehören nicht übel sein mochte, da sie nach Joachims glaubwürdiger Versicherung trotz hoher Ärztegehälter und liberalster Wirtschaftsprinzipien alljährlich eine saftige Dividende unter ihre Mitglieder verteilen konnte. Der Hofrat also war kein selbständiger Mann, er war nichts als ein Agent, ein Funktionär, ein Verwandter höherer Gewalten, der erste und oberste freilich, die Seele des Ganzen, von bestimmendem Einfluß auf die gesamte Organisation, die Intendantur nicht ausgeschlossen, obgleich er als dirigierender Arzt über jede Beschäftigung mit dem kaufmännischen Teil des Betriebes natürlich erhaben war. Aus dem Nordwesten Deutschlands gebürtig, war er, wie man wußte, wider Absicht und Lebensplan vor Jahren in diese Stellung gelangt: heraufgeführt durch seine Frau, deren Reste schon längst der Friedhof von „Dorf“ umfing, – der malerische Friedhof von Dorf Davos dort oben am rechtsseitigen Hange, weiter zurück gegen den Eingang des Tales. Sie war eine sehr liebliche, wenn auch überäugige und asthenische Erscheinung gewesen, den Photographien nach zu urteilen, die überall in des Hofrats Dienstwohnung standen, sowie auch den Ölbildnissen zufolge, die, von seiner eigenen Liebhaberhand stammend, dort an den Wänden hingen. Nachdem sie ihm zwei Kinder geschenkt, einen Sohn und eine Tochter, war ihr leichter, von Hitze ergriffener Körper in diese Gegenden heraufgezogen worden, und in wenigen Monaten hatte seine Aus- und Aufzehrung sich vollendet. Man sagte, Behrens, der sie vergöttert habe, sei durch den Schlag so schwer getroffen worden, daß er vorübergehend in Tiefsinn und Wunderlichkeit verfallen sei und sich auf der Straße durch Kichern, Gestenspiel und Selbstgespräch auffällig gemacht habe. Er war dann nicht mehr in seinen ursprünglichen Lebenskreis zurückgekehrt, sondern an Ort und Stelle geblieben: gewiß auch darum, weil er sich von dem Grabe nicht trennen mochte; den Ausschlag aber hatte wohl der weniger sentimentale Grund gegeben, daß er selbst etwas abbekommen hatte und seiner eigenen wissenschaftlichen Einsicht nach einfach hierher gehörte. So hatte er sich eingebürgert als einer der Ärzte, die Leidensgenossen derjenigen sind, deren Aufenthalt sie überwachen; die nicht, von der Krankheit unabhängig, sie aus dem freien Stande persönlicher Intaktheit bekämpfen, sondern selber ihr Zeichen tragen, – ein eigentümlicher, aber durchaus nicht vereinzelter Fall, der ohne Zweifel seine Vorzüge wie sein Bedenkliches hat. Kameradschaft des Arztes mit dem Patienten ist gewiß zu begrüßen, und es läßt sich hören, daß nur der Leidende des Leidenden Führer und Heiland zu sein vermag. Aber ist rechte geistige Herrschaft über eine Macht denn möglich bei dem, der selber zu ihren Sklaven zählt? Kann befreien, wer selbst unterworfen ist? Der kranke Arzt bleibt ein Paradoxon für das einfache Gefühl, eine problematische Erscheinung. Wird nicht vielleicht sein geistiges Wissen um die Krankheit durch das erfahrungsmäßige nicht so sehr bereichert und sittlich gestärkt als getrübt und verwirrt? Er blickt der Krankheit nicht in klarer Gegnerschaft ins Auge, er ist befangen, ist nicht eindeutig als Partei; und mit aller gebotenen Vorsicht muß man fragen, ob ein der Krankheitswelt Zugehöriger an der Heilung oder auch nur Bewahrung anderer eigentlich in dem Sinne interessiert sein kann, wie ein Mann der Gesundheit ...
Von diesen Zweifeln und Erwägungen sprach Hans Castorp auf seine Weise einiges aus, als er mit Joachim vom „Berghof“ und seinem ärztlichen Leiter schwatzte, aber Joachim bemerkte dagegen, man wisse ja gar nicht, ob Hofrat Behrens heute noch selber Patient sei, – wahrscheinlich sei er schon längst genesen. Daß er hier zu praktizieren begonnen hatte, war lange her, – er hatte es eine Weile auf eigene Hand getrieben und sich als feinhöriger Auskultator wie auch als sicherer Pneumotom rasch einen Namen gemacht. Dann hatte der „Berghof“ sich seiner Person versichert, das Institut, mit dem er nun bald seit einem Jahrzehnt so eng verwachsen war ... Dort hinten, am Ende des nordwestlichen Flügels, lag seine Wohnung (Dr. Krokowski hauste nicht weit davon), und jene altadelige Dame, die Schwester-Oberin, von der Settembrini so höhnisch gesprochen und die Hans Castorp bisher nur flüchtig gesehen hatte, stand dem kleinen Witwerhaushalte vor. Im übrigen war der Hofrat allein, denn sein Sohn studierte an reichsdeutschen Universitäten, und seine Tochter war schon vermählt: nämlich an einen Advokaten im französischen Teile der Schweiz. Der junge Behrens kam in den Ferien zuweilen zu Besuch, was sich während Joachims Aufenthalt schon einmal ereignet hatte, und er sagte, die Damen der Anstalt seien dann sehr bewegt, die Temperaturen stiegen, Eifersüchteleien führten zu Zank und Streit auf den Liegehallen, und erhöhter Zudrang herrsche zu Dr. Krokowskis besonderer Sprechstunde ...
Dem Assistenten war für seine Privatordinationen ein eigenes Zimmer eingeräumt, das, wie der große Untersuchungsraum, das Laboratorium, der Operationssaal und das Durchstrahlungsatelier, in dem gut belichteten Kellergeschoß des Anstaltsgebäudes gelegen war. Wir sprechen von einem Kellergeschoß, weil die steinerne Treppe, die vom Erdgeschoß dorthin führte, in der Tat die Vorstellung erweckte, daß man sich in einen Keller begebe, – was aber beinahe ganz auf Täuschung beruhte. Denn erstens war das Erdgeschoß ziemlich hoch gelegen, das Berghofgebäude aber zweitens, im ganzen, auf abschüssigem Grunde, am Berge errichtet, und jene „Keller“-Räumlichkeiten schauten nach vorn, gegen den Garten und das Tal: Umstände, durch die Wirkung und Sinn der Treppe gewissermaßen durchkreuzt und aufgehoben wurden. Denn man glaubte wohl über ihre Stufen von ebener Erde hinabzusteigen, befand sich aber drunten immer noch und wiederum zu ebener Erde oder doch nur ein paar Schuh darunter, – ein belustigender Eindruck für Hans Castorp, als er seinen Vetter, der sich vom Bademeister wiegen lassen sollte, nachmittags einmal in diese Sphäre „hinunter“-begleitete. Es herrschte klinische Helligkeit und Sauberkeit dort; alles war weiß in weiß gehalten, und in weißem Lack schimmerten die Türen, auch die zu Dr. Krokowskis Empfangszimmer, an der die Visitenkarte des Gelehrten mit einem Reißnagel befestigt war, und zu der noch eigens zwei Stufen von der Höhe des Flurganges hinabführten, so daß der dahinter liegende Raum einen gelaßartigen Charakter erhielt. Sie lag rechts von der Treppe, diese Tür, am Ende des Ganges, und Hans Castorp hatte ein besonderes Auge auf sie, während er, auf Joachim wartend, den Korridor auf und nieder ging. Er sah auch jemanden herauskommen, eine Dame, die kürzlich eingetroffen war und deren Namen er noch nicht kannte, eine Kleine, Zierliche mit Stirnlöckchen und goldenen Ohrringen. Sie bückte sich tief, die Stufen ersteigend, und raffte ihren Rock, indes sie mit der anderen kleinen, beringten Hand ihr Tüchlein an den Mund preßte und darüberhin aus ihrer gebückten Haltung mit großen blassen, verstörten Augen ins Leere blickte. So eilte sie mit engen Trittchen, bei denen ihr Unterrock rauschte, zur Treppe, blieb plötzlich stehen, als besänne sie sich auf etwas, setzte sich trippelnd wieder in Lauf und verschwand im Stiegenhause, immer gebückt und ohne das Tüchlein von den Lippen zu nehmen.
Hinter ihr, als die Tür sich geöffnet hatte, war es viel dunkler gewesen als auf dem weißen Korridor: die klinische Helligkeit dieser unteren Räume reichte offenbar nicht bis dorthinein; verhülltes Halblicht, tiefe Dämmerung herrschte, wie Hans Castorp bemerkte, in Dr. Krokowskis analytischem Kabinett.
Bei den Mahlzeiten im bunten Speisesaal bereitete es dem jungen Hans Castorp einige Verlegenheit, daß ihm von jenem auf eigene Hand unternommenen Spaziergang das großväterliche Kopfzittern zurückgeblieben war, – gerade bei Tisch stellte es sich fast regelmäßig wieder ein und war dann nicht zu verhindern und schwer zu verbergen. Außer der würdigen Kinnstütze, die nicht dauernd festzuhalten war, machte er verschiedene Mittel ausfindig, die Schwäche zu maskieren, – zum Beispiel hielt er tunlichst den Kopf in Bewegung, indem er nach rechts und links konversierte, oder er drückte, etwa wenn er den Suppenlöffel zum Munde führte, den linken Unterarm fest auf den Tisch, um sich Haltung zu geben, stellte auch wohl den Ellenbogen auf in den Pausen und stützte den Kopf mit der Hand, obgleich dies eine Flegelei war in seinen eigenen Augen und nur in ungebundener Krankengesellschaft allenfalls durchgehen mochte. Aber das alles war lästig und es fehlte nicht viel, daß es ihm die Mahlzeiten vollständig verleidet hätte, die er doch sonst, um der Spannungen und Sehenswürdigkeiten willen, die sie mit sich brachten, so wohl zu schätzen wußte.
Es lag aber so – und Hans Castorp wußte das auch genau –, daß die blamable Erscheinung, mit der er kämpfte, nicht nur körperlicher Herkunft, nicht nur auf die hiesige Luft und die Anstrengung der Akklimatisation zurückzuführen war, sondern eine innere Erregung ausdrückte und mit jenen Spannungen und Sehenswürdigkeiten selbst unmittelbar zusammenhing.
Madame Chauchat kam fast immer zu spät zu Tische, und bis sie kam, saß Hans Castorp und konnte die Füße nicht ruhig halten, denn er wartete auf das Schmettern der Glastür, von dem ihr Eintritt unweigerlich begleitet war, und wußte, daß er dabei zusammenfahren und sein Gesicht würde kalt werden fühlen, was denn auch regelmäßig geschah. Anfangs hatte er jedesmal ergrimmt den Kopf herumgeworfen und die fahrlässige Nachzüglerin mit zornigen Augen zu ihrem Platze am „Guten“ Russentisch begleitet, auch wohl ihr halblaut und zwischen den Zähnen ein Scheltwort, einen Ruf empörter Mißbilligung nachgesandt. Das unterließ er jetzt, beugte den Kopf tiefer über den Teller, wobei er sich wohl gar auf die Lippe biß, oder wandte ihn absichtlich und künstlich nach der anderen Seite; denn ihm war, als komme der Zorn ihm nicht mehr zu, als sei er zum Tadel nicht so recht frei, sondern mitschuldig an dem Ärgernis und mitverantwortlich dafür vor den anderen, – kurzum, er schämte sich, und zwar wäre es ungenau gewesen, zu sagen, daß er sich für Frau Chauchat schämte, sondern ganz persönlich schämte er sich vor den Leuten, – was er sich übrigens hätte sparen können, da niemand im Saale sich um Frau Chauchats Laster noch um Hans Castorps Scham darüber kümmerte, ausgenommen etwa die Lehrerin, Fräulein Engelhart, zu seiner Rechten.
Das kümmerliche Wesen hatte begriffen, daß dank Hans Castorps Empfindlichkeit gegen das Türenwerfen eine gewisse affekthafte Beziehung des jungen Tischnachbarn zu der Russin entstanden war, ferner, daß es wenig auf den Charakter einer solchen Beziehung ankomme, wenn sie nur überhaupt vorhanden war, und endlich, daß seine geheuchelte – und zwar aus Mangel an schauspielerischer Übung und Begabung sehr schlecht geheuchelte – Gleichgültigkeit keine Abschwächung, sondern eine Verstärkung, eine höhere Phase des Verhältnisses bedeutete. Ohne Anspruch und Hoffnung für ihre eigene Person, erging Fräulein Engelhart sich beständig in selbstlos entzückten Reden über Frau Chauchat, – wobei das Merkwürdige war, daß Hans Castorp ihr hetzerisches Betreiben, wenn nicht sofort, so doch auf die Dauer, vollkommen klar erkannte und durchschaute, ja, daß es ihn sogar anwiderte, ohne daß er sich darum weniger willig hätte davon beeinflussen und betören lassen.
„Pardauz!“ sagte das alte Mädchen. „Das ist sie. Man braucht nicht aufzusehen, um sich zu überzeugen, wer da hereingekommen ist. Natürlich, da geht sie, – und wie reizend sie geht, – ganz wie ein Kätzchen zur Milchschüssel schleicht! Ich wollte, wir könnten die Plätze tauschen, damit Sie sie so ungezwungen und bequem betrachten könnten, wie ich es kann. Ich verstehe es ja, daß Sie nicht immer den Kopf nach ihr drehen mögen, – Gott weiß, was sie sich schließlich einbilden würde, wenn sie es merkte ... Jetzt sagt sie ihren Leuten Guten Tag ... Sie sollten doch einmal hinsehen, es ist so erquickend, sie zu beobachten. Wenn sie so lächelt und spricht wie jetzt, bekommt sie ein Grübchen in die eine Wange, aber nicht immer, nur wenn sie will. Ja, das ist ein Goldkind von einer Frau, ein verzogenes Geschöpf, daher ist sie so lässig. Solche Menschen muß man lieben, ob man will oder nicht, denn wenn sie einen ärgern durch ihre Lässigkeit, so ist auch der Ärger nur ein Anreiz mehr, ihnen zugetan zu sein, es ist so beglückend, sich zu ärgern und dennoch lieben zu müssen ...“
So raunte die Lehrerin hinter der Hand und ungehört von den anderen, während die flaumige Röte auf ihren Altjungferwangen an ihre übernormale Körpertemperatur erinnerte; und ihre wollüstigen Redereien gingen dem armen Hans Castorp in Mark und Blut. Eine gewisse Unselbständigkeit schuf ihm das Bedürfnis, von dritter Seite bestätigt zu erhalten, daß Madame Chauchat eine entzückende Frau sei, und außerdem wünschte der junge Mann, sich von außen zur Hingabe an Empfindungen ermutigen zu lassen, denen seine Vernunft und sein Gewissen störende Widerstände entgegensetzten.
Übrigens erwiesen sich diese Unterhaltungen in sachlicher Beziehung nur wenig fruchtbar, denn Fräulein Engelhart wußte beim besten Willen nichts Näheres über Frau Chauchat auszusagen, nicht mehr als jedermann im Sanatorium; sie kannte sie nicht, konnte sich nicht einmal einer Bekanntschaft rühmen, die sie mit ihr gemeinsam gehabt hätte, und das einzige, womit sie sich vor Hans Castorp ein Ansehen geben konnte, war, daß sie in Königsberg – also nicht gar so sehr weit von der russischen Grenze – zu Hause war und einige Brocken Russisch kannte, – dürftige Eigenschaften, in denen Hans Castorp aber etwas wie weitläufige persönliche Beziehungen zu Frau Chauchat zu sehen bereit war.
„Sie trägt keinen Ring,“ sagte er, „keinen Ehering, wie ich sehe. Wie ist denn das? Sie ist doch eine verheiratete Frau, haben Sie mir gesagt?“
Die Lehrerin geriet in Verlegenheit, als sei sie in die Enge getrieben und müsse sich herausreden, so sehr verantwortlich fühlte sie sich für Frau Chauchat Hans Castorp gegenüber.
„Das dürfen Sie nicht so genau nehmen“, sagte sie. „Zuverlässig ist sie verheiratet. Daran ist kein Zweifel möglich. Daß sie sich Madame nennt, geschieht nicht nur der größeren Ansehnlichkeit wegen, wie ausländische Fräulein es machen, wenn sie ein wenig reifer sind, sondern wir alle wissen es, daß sie wirklich einen Mann hat irgendwo in Rußland, das ist im ganzen Orte bekannt. Von Hause aus hat sie einen anderen Namen, einen russischen und keinen französischen, einen auf -anow oder -ukow, ich habe ihn schon gewußt und nur wieder vergessen; wenn Sie wollen, erkundige ich mich danach; es gibt sicher mehrere Personen hier, die den Namen kennen. Einen Ring? Nein, sie trägt keinen, es ist mir auch schon aufgefallen. Lieber Himmel, vielleicht kleidet er sie nicht, vielleicht macht er ihr eine breite Hand. Oder sie findet es spießbürgerlich, einen Ehering zu tragen, so einen glatten Reif ... es fehlt nur der Schlüsselkorb ... nein, dazu ist sie gewiß zu großzügig ... Ich kenne das, die russischen Frauen haben alle so etwas Freies und Großzügiges in ihrem Wesen. Außerdem hat so ein Ring etwas geradezu Abweisendes und Ernüchterndes, er ist doch ein Symbol der Hörigkeit, möchte ich sagen, er gibt einer Frau direkt etwas Nonnenhaftes, das reine Blümchen Rührmichnichtan macht er aus ihr. Ich wundere mich gar nicht, wenn das nicht nach Frau Chauchats Sinne ist ... Eine so reizende Frau, in der Blüte der Jahre ... Wahrscheinlich hat sie weder Grund noch Lust, jeden Herrn, dem sie die Hand gibt, gleich ihre eheliche Gebundenheit fühlen zu lassen ...“
Großer Gott, wie die Lehrerin sich ins Zeug legte! Hans Castorp sah ihr ganz erschreckt ins Gesicht, aber sie trotzte seinem Blick mit einer Art von wilder Verlegenheit. Dann schwiegen beide eine Weile, um sich zu erholen. Hans Castorp aß und unterdrückte das Zittern seines Kopfes. Endlich sagte er:
„Und der Mann? Er kümmert sich gar nicht um sie? Er besucht sie niemals hier oben? Was ist er denn eigentlich?“
„Beamter. Russischer Administrationsbeamter, in einem ganz entlegenen Gouvernement, Daghestan, wissen Sie, das liegt ganz östlich über den Kaukasus hinaus, dahin ist er kommandiert. Nein, ich sagte Ihnen ja, daß noch nie ihn jemand hier oben gesehen hat. Und dabei ist sie schon wieder im dritten Monat hier.“
„Sie ist also nicht zum erstenmal hier?“
„O nein, schon das drittemal. Und zwischendurch ist sie wieder wo anders, an ähnlichen Orten. – Umgekehrt, sie besucht ihn zuweilen, nicht oft, einmal im Jahre auf einige Zeit. Sie leben getrennt, kann man sagen, und sie besucht ihn zuweilen.“
„Nun ja, da sie krank ist ...“
„Gewiß, krank ist sie. Aber doch nicht so. Doch nicht so ernstlich krank, daß sie geradezu immer in Sanatorien und von ihrem Manne getrennt leben müßte. Das muß schon weitere und andere Gründe haben. Hier nimmt man allgemein an, daß es noch andere hat. Vielleicht gefällt es ihr nicht in Daghestan hinter dem Kaukasus, einer so wilden, entfernten Gegend, das wäre am Ende nicht zu verwundern. Aber ein wenig muß es doch auch an dem Manne liegen, wenn es ihr so gar nicht bei ihm gefällt. Er hat ja einen französischen Namen, aber darum ist er doch ein russischer Beamter, und das ist ein roher Menschenschlag, wie Sie mir glauben können. Ich habe einmal einen davon gesehen, er hatte so einen eisenfarbenen Backenbart und so ein rotes Gesicht ... Im höchsten Grade bestechlich sind sie, und dann haben sie es alle mit dem Wutki, dem Branntwein, wissen Sie ... Anstandshalber lassen sie sich eine Kleinigkeit zu essen geben, ein paar marinierte Pilze oder ein Stückchen Stör, und dazu trinken sie – einfach im Übermaß. Das nennen sie dann einen Imbiß ...“
„Sie schieben alles auf ihn“, sagte Hans Castorp. „Wir wissen aber doch nicht, ob es nicht vielleicht an ihr liegt, wenn sie nicht gut miteinander leben. Man muß gerecht sein. Wenn ich sie mir so ansehe und diese Unmanier mit dem Türenwerfen ... ich halte sie für keinen Engel, das nehmen Sie mir, bitte, nicht übel, ich traue ihr nicht über den Weg. Aber Sie sind nicht unparteiisch, Sie sitzen ja bis über die Ohren in Vorurteilen zu ihren Gunsten ...“
So machte er es zuweilen. Mit einer Schlauheit, die seiner Natur eigentlich fremd war, stellte er es so hin, als bedeute Fräulein Engelharts Schwärmerei für Frau Chauchat nicht das, was sie, wie er sehr wohl wußte, in Wirklichkeit bedeutete, sondern als sei diese Schwärmerei eine selbständige, drollige Tatsache, mit welcher er, der unabhängige Hans Castorp, die alte Jungfer aus kühlem und humoristischem Abstande necken konnte. Und da er sicher war, daß seine Helfershelferin diese dreiste Verdrehung gelten und sich gefallen lassen werde, so war nichts damit gewagt.
„Guten Morgen!“ sagte er. „Haben Sie wohl geruht? Ich hoffe, Sie haben von Ihrer schönen Minka geträumt? ... Nein, wie Sie gleich rot werden, wenn man sie nur erwähnt! Ganz vernarrt sind Sie in sie, das leugnen Sie nur lieber nicht!“
Und die Lehrerin, die wirklich errötet war und sich tief über ihre Tasse beugte, raunte aus ihrem linken Mundwinkel:
„Aber nein, pfui, Herr Castorp! Das ist nicht schön von Ihnen, daß Sie mich so in Verlegenheit bringen mit Ihren Anspielungen. Alle merken es ja, daß wir es auf sie abgesehen haben, und daß Sie mir Dinge sagen, über die ich rot werden muß ...“
Es war sonderbar, was die beiden Tischnachbarn da trieben. Beide wußten, daß sie doppelt und dreifach logen, daß Hans Castorp nur, um von Frau Chauchat sprechen zu können, die Lehrerin mit ihr neckte, dabei aber ein ungesundes und übertragenes Vergnügen darin fand, mit dem alten Mädchen zu schäkern, – welches ihrerseits darauf einging: erstens aus kupplerischen Gründen, dann auch, weil sie sich dem jungen Manne zu Gefallen wohl wirklich etwas in Frau Chauchat vergafft hatte, und endlich, weil sie es kümmerlich genoß, sich irgendwie von ihm necken und rot machen zu lassen. Dies wußten sie beide von sich und vom anderen und wußten auch, daß jeder es von sich und vom anderen wisse, und das alles war verwickelt und unsauber. Aber obgleich Hans Castorp von verwickelten und unsauberen Dingen im ganzen angewidert wurde und sich auch in diesem Falle davon angewidert fühlte, so fuhr er doch fort, in dem trüben Elemente zu plätschern, indem er sich zur Beruhigung sagte, daß er ja nur zu Besuch hier oben sei und demnächst wieder abreisen werde. Mit erkünstelter Sachlichkeit beurteilte er kennerhaft das Äußere der „lässigen“ Frau, stellte fest, daß sie von vorn gesehen entschieden jünger und hübscher wirke als im Profil, daß ihre Augen zu weit auseinander lägen und ihre Haltung viel zu wünschen übriglasse, wofür allerdings ihre Arme schön und „weich geformt“ seien. Und indem er dies sagte, suchte er das Zittern seines Kopfes zu verbergen, wobei er aber nicht nur erkennen mußte, daß die Lehrerin seine vergebliche Anstrengung bemerkte, sondern auch mit dem größten Widerwillen die Wahrnehmung machte, daß sie selber ebenfalls mit dem Kopfe zitterte. Auch war es nichts als Politik und unnatürliche Schlauheit gewesen, daß er Frau Chauchat als „schöne Minka“ bezeichnet hatte; denn so konnte er weiter fragen:
„Ich sage ‚Minka‘, aber wie heißt sie denn eigentlich in Wirklichkeit. Ich meine mit Vornamen. So vernarrt, wie Sie unstreitig in sie sind, müssen Sie doch unbedingt ihren Vornamen wissen.“
Die Lehrerin dachte nach.
„Warten Sie, ich weiß ihn“, sagte sie. „Ich habe ihn gewußt. Heißt sie nicht Tatjana? Nein, das war es nicht, und auch nicht Natascha. Natascha Chauchat? Nein, so habe ichs nicht gehört. Halt, ich habe es! Awdotja heißt sie. Oder es war doch etwas in diesem Charakter. Denn Katjenka oder Ninotschka heißt sie nun einmal bestimmt nicht. Es ist mir wahrhaftig entfallen. Aber ich kann es mit Leichtigkeit in Erfahrung bringen, wenn Ihnen daran gelegen ist.“
Wirklich wußte sie am nächsten Tage den Namen. Sie sprach ihn beim Mittagessen aus, als die Glastür ins Schloß schmetterte. Frau Chauchat hieß Clawdia.
Hans Castorp verstand nicht gleich. Er ließ sich den Namen wiederholen und buchstabieren, bevor er ihn auffaßte. Dann sprach er ihn mehrmals nach, indem er dabei mit rot geäderten Augen zu Frau Chauchat hinüberblickte und ihn ihr gewissermaßen anprobierte.
„Clawdia,“ sagte er, „ja, so mag sie wohl heißen, es stimmt ganz gut.“ Er machte kein Hehl aus seiner Freude über die intime Kenntnis und sprach jetzt nur noch von „Clawdia“, wenn er Frau Chauchat meinte. „Ihre Clawdia dreht ja Brotkugeln, habe ich eben gesehen. Fein ist das nicht.“ „Es kommt darauf an, wer es tut“, antwortete die Lehrerin. „Clawdia steht es.“
Ja, die Mahlzeiten im Saal mit den sieben Tischen hatten den allergrößten Reiz für Hans Castorp. Er bedauerte es, wenn eine davon zu Ende ging, aber sein Trost war, daß er sehr bald, in zwei oder zweieinhalb Stunden, wieder hier sitzen werde, und wenn er wieder hier saß, so war es, als sei er nie aufgestanden. Was lag dazwischen? Nichts. Ein kurzer Spaziergang zum Wasserlauf oder ins Englische Viertel, ein wenig Ruhe im Stuhl. Das war keine ernste Unterbrechung, kein schwer zu nehmendes Hindernis. Etwas anderes, wenn Arbeit, irgendwelche Sorgen und Mühen sich vorgelagert hätten, die im Geiste nicht leicht zu übersehen, zu übergehen gewesen wären. Dies war jedoch nicht der Fall im klug und glücklich geregelten Leben des „Berghofs“. Hans Castorp konnte sich, wenn er von einer gemeinsamen Mahlzeit aufstand, ganz unmittelbar auf die nächste freuen, – sofern nämlich „sich freuen“ das richtige Wort war für die Art von Erwartung, mit der er dem neuen Zusammensein mit der kranken Frau Clawdia Chauchat entgegensah, und nicht ein zu leichtes, vergnügtes, einfältiges und gewöhnliches. Möglicherweise ist der Leser geneigt, nur solche Ausdrücke, nämlich vergnügte und gewöhnliche, in bezug auf Hans Castorps Person und sein Innenleben als passend und zulässig zu erachten; aber wir erinnern daran, daß er sich als ein junger Mann von Vernunft und Gewissen auf den Anblick und die Nähe Frau Chauchats nicht einfach „freuen“ konnte und, da wir es wissen müssen, stellen wir fest, daß er dies Wort, wenn man es ihm angeboten hätte, achselzuckend verworfen haben würde.
Ja, er wurde hochnäsig gegen gewisse Ausdrucksmittel, – das ist eine Einzelheit, die angemerkt zu werden verdient. Er ging umher, indes seine Wangen in trockener Hitze standen, und sang vor sich hin, sang in sich hinein, denn sein Befinden war musikalisch und sensitiv. Er summte ein Liedchen, das er, wer weiß wo und wann, in einer Gesellschaft oder bei einem Wohltätigkeitskonzert einmal von einer kleinen Sopranstimme gehört und jetzt in sich vorgefunden hatte, – einen sanften Unsinn, der anfing:
„Wie berührt mich wundersam
Oft ein Wort von dir“,
und er war im Begriffe, hinzuzusetzen:
„Das von deiner Lippe kam
Und zum Herzen mir!“ –
als er plötzlich die Achseln zuckte, „lächerlich“ sagte und das zarte Liedchen als abgeschmackt und läppisch empfindsam verwarf und von sich wies, – es mit einer gewissen Melancholie und Strenge von sich wies. An solchem innigen Liedchen mochte irgendein junger Mann Genüge und Gefallen finden, der „sein Herz“, wie man zu sagen pflegt, erlaubter-, friedlicher- und aussichtsreicherweise irgendeinem gesunden Gänschen dort unten im Flachlande „geschenkt“ hatte und sich nun seinen erlaubten, aussichtsreichen, vernünftigen und im Grunde vergnügten Empfindungen überließ. Für ihn und sein Verhältnis zu Madame Chauchat – das Wort „Verhältnis“ kommt auf seine Rechnung, wir lehnen die Verantwortung dafür ab – schickte sich ein solches Gedichtchen entschieden nicht; in seinem Liegestuhl fand er sich bewogen, das ästhetische Urteil „albern!“ darüber zu fällen und brach in der Mitte ab, indem er die Nase rümpfte, obgleich er nichts Geeigneteres dafür einzusetzen wußte.
Eins aber bereitete ihm Genugtuung, wenn er lag und auf sein Herz, sein körperliches Herz achtete, das rasch und vernehmlich in der Stille pochte, – der vorschriftsmäßigen Hausordnungsstille, die während der Haupt- und Schlafliegekur über dem ganzen „Berghof“ waltete. Es pochte hartnäckig und vordringlich, sein Herz, wie es das fast beständig tat, seitdem er hier oben war; doch nahm Hans Castorp neuerdings weniger Anstoß daran als in den ersten Tagen. Man konnte jetzt nicht mehr sagen, daß es auf eigene Hand, grundlos und ohne Zusammenhang mit der Seele klopfte. Ein solcher Zusammenhang war vorhanden oder doch unschwer herzustellen; eine rechtfertigende Gemütsbewegung ließ sich der exaltierten Körpertätigkeit zwanglos unterlegen. Hans Castorp brauchte nur an Frau Chauchat zu denken – und er dachte an sie –, so besaß er zum Herzklopfen das zugehörige Gefühl.
Das Wetter war spottschlecht, – in dieser Beziehung hatte Hans Castorp kein Glück mit seinem flüchtigen Aufenthalt in diesen Gegenden. Es schneite nicht gerade, aber es regnete tagelang schwer und häßlich, dicke Nebel erfüllten das Tal, und Gewitter von lächerlicher Überflüssigkeit – denn es war ohnehin so kalt, daß man im Speisesaal sogar geheizt hatte – entluden sich mit umständlich ausrollendem Widerhall.
„Schade“, sagte Joachim. „Ich hatte gedacht, wir wollten mal mit dem Frühstück auf die Schatzalp oder sonst etwas unternehmen. Aber es scheint, es soll nicht sein. Hoffentlich wird deine letzte Woche besser.“
Aber Hans Castorp antwortete:
„Laß nur. Ich brenne gar nicht auf Unternehmungen. Meine erste ist mir nicht sonderlich bekommen. Ich erhole mich am besten, wenn ich so in den Tag hineinlebe, ohne viel Abwechslung. Abwechslung ist für die Langjährigen. Aber ich mit meinen drei Wochen, was brauche ich Abwechslung.“
So war es, er fühlte sich ausgefüllt und beschäftigt an Ort und Stelle. Wenn er Hoffnungen hegte, so blühten Erfüllung wie Enttäuschung ihm hier, und nicht auf irgendeiner Schatzalp. Langeweile war es nicht, was ihn plagte; im Gegenteil begann er zu fürchten, das Ende seines Aufenthalts möchte allzu beschwingt erscheinen. Die zweite Woche schritt vor, zwei Drittel seiner Zeit würden bald abgelebt sein, und brach erst das dritte an, so dachte man schon an den Koffer. Die erste Auffrischung von Hans Castorps Zeitsinn war längst vorbei; schon begannen die Tage dahinzufliegen, und das taten sie, obgleich jeder einzelne von ihnen sich in immer erneuter Erwartung dehnte und von stillen, verschwiegenen Erlebnissen schwoll ... Ja, die Zeit ist ein rätselhaftes Ding, es hat eine schwer klarzustellende Bewandtnis mit ihr!
Wird es nötig sein, jene verschwiegenen Erlebnisse, die Hans Castorps Tage zugleich beschwerten und beschwingten, näher zu kennzeichnen? Aber jedermann kennt sie, es waren durchaus die gewöhnlichen in ihrer sensiblen Nichtigkeit, und in einem vernünftiger und aussichtsreicher gelagerten Fall, auf den das abgeschmackte Liedchen „Wie berührt mich wundersam“ anwendbar gewesen wäre, hätten sie sich auch nicht anders abspielen können.
Unmöglich, daß Madame Chauchat von den Fäden, die sich von einem gewissen Tische zu ihrem spannen, nicht irgend etwas hätte bemerken sollen; und daß sie etwas, ja möglichst viel davon bemerke, lag zügelloserweise durchaus in Hans Castorps Absichten. Wir nennen das zügellos, weil er sich über die Vernunftwidrigkeit seines Falles völlig im klaren war. Aber um wen es steht, wie es um ihn stand oder zu stehen begann, der will, daß man drüben von seinem Zustande Kenntnis habe, auch wenn kein Sinn und Verstand bei der Sache ist. So ist der Mensch.
Nachdem also Frau Chauchat sich zwei- oder dreimal zufällig oder unter magnetischer Einwirkung beim Essen nach jenem Tisch umgewandt hatte und jedesmal den Augen Hans Castorps begegnet war, blickte sie zum viertenmal mit Vorbedacht hinüber und begegnete seinen Augen auch diesmal. In einem fünften Fall ertappte sie ihn zwar nicht unmittelbar; er war gerade nicht auf dem Posten. Doch fühlte er es sofort, daß sie ihn ansah, und blickte ihr so eifrig entgegen, daß sie sich lächelnd abwandte. Mißtrauen und Entzücken erfüllten ihn angesichts dieses Lächelns. Wenn sie ihn für kindlich hielt, so täuschte sie sich. Sein Bedürfnis nach Verfeinerung war bedeutend. Bei sechster Gelegenheit, als er ahnte, spürte, die innere Kunde gewann, daß sie herüberblickte, tat er, als betrachte er mit eindringlichem Mißfallen eine finnige Dame, die an seinen Tisch getreten war, um mit der Großtante zu plaudern, hielt eisern durch, wohl zwei oder drei Minuten lang, und gab nicht nach, bis er sicher war, daß die Kirgisenaugen dort drüben von ihm abgelassen hatten, – eine wunderliche Schauspielerei, die Frau Chauchat nicht nur durchschauen mochte, sondern ausdrücklich durchschauen sollte, damit Hans Castorps große Feinheit und Selbstbeherrschung sie nachdenklich stimme ... Es kam zu folgendem. In einer Eßpause wandte Frau Chauchat sich nachlässig um und musterte den Saal. Hans Castorp war auf dem Posten gewesen: ihre Blicke trafen sich. Indes sie einander ansehen – die Kranke unbestimmt spähend und spöttisch, Hans Castorp mit erregter Festigkeit (er biß sogar die Zähne zusammen, während er ihren Augen standhielt) – will ihr die Serviette entfallen, ist im Begriffe, ihr vom Schoße zu Boden zu gleiten. Nervös zusammenzuckend greift sie danach, aber auch ihm fährt es in die Glieder, es reißt ihn halbwegs vom Stuhle empor, und blindlings will er über acht Meter Raum hinweg und um einen zwischenstehenden Tisch herum ihr zu Hilfe stürzen, als würde es eine Katastrophe bedeuten, wenn die Serviette den Boden erreichte ... Knapp über dem Estrich wird sie ihrer noch habhaft. Aber aus ihrer gebückten Haltung, überquer zu Boden geneigt, die Serviette am Zipfel und mit verfinsterter Miene, offenbar ärgerlich über die unvernünftige kleine Panik, der sie unterlegen und an der sie ihm, wie es scheint, die Schuld gibt, – blickt sie noch einmal nach ihm zurück, bemerkt seine Sprungstellung, seine emporgerissenen Brauen und wendet sich lächelnd ab.
Über dies Vorkommnis triumphierte Hans Castorp bis zur Ausgelassenheit. Jedoch blieb der Rückschlag nicht aus, denn Madame Chauchat wandte sich nun volle zwei Tage lang, also während der Dauer von zehn Mahlzeiten, überhaupt nicht mehr nach dem Saale um, ja, unterließ es sogar, sich bei ihrem Eintritt, wie es sonst ihre Gepflogenheiten gewesen, dem Publikum zu „präsentieren“. Das war hart. Aber da diese Unterlassungen sich ganz ohne Zweifel auf ihn bezogen, so war eine Beziehung eben doch deutlich vorhanden, wenn auch in negativer Gestalt; und das mochte genügen.
Er sah wohl, daß Joachim vollständig recht gehabt hatte mit seiner Bemerkung, es sei gar nicht leicht, hier Bekanntschaft zu machen, außer mit Tischgenossen. Denn während der einzigen knappen Stunde nach dem Diner, in der eine gewisse Geselligkeit regelmäßig statthatte, die aber oft auf zwanzig Minuten zusammenschrumpfte, saß Madame Chauchat ohne Ausnahme mit ihrer Umgebung, dem hohlbrüstigen Herrn, der humoristischen Wollhaarigen, dem stillen Dr. Blumenkohl und den hängeschultrigen Jünglingen, im Hintergrunde des kleinen Salons, der dem „Guten Russentisch“ vorbehalten schien. Auch drängte Joachim stets bald zum Aufbruch, um die Abendliegekur nicht zu verkürzen, wie er sagte, und vielleicht noch aus anderen diätetischen Gründen, die er nicht anführte, die aber Hans Castorp ahnte und achtete. Wir erhoben den Vorwurf der Zügellosigkeit gegen ihn, aber wohin seine Wünsche nun immer gehen mochten, die gesellschaftliche Bekanntschaft mit Frau Chauchat war es nicht, was er anstrebte, und mit den Umständen, die dagegen wirkten, war er im Grunde einverstanden. Die unbestimmt gespannten Beziehungen, die sein Schauen und Betreiben zwischen ihm und der Russin hergestellt hatte, waren außergesellschaftlicher Natur, sie verpflichteten zu nichts und durften zu nichts verpflichten. Denn ein beträchtliches Maß von gesellschaftlicher Ablehnung vertrug sich wohl mit ihnen, auf seiner Seite, und die Tatsache, daß er den Gedanken an „Clawdia“ dem Klopfen seines Herzens unterlegte, genügte bei weitem nicht, den Enkel Hans Lorenz Castorps in der Überzeugung wankend zu machen, daß er mit dieser Fremden, die ihr Leben getrennt von ihrem Mann und ohne Trauring am Finger an allen möglichen Kurorten verbrachte, sich mangelhaft hielt, die Tür hinter sich zufallen ließ, Brotkugeln drehte und zweifellos an den Fingern kaute, – daß er, sagen wir, in Wirklichkeit, das heißt: über jene geheimen Beziehungen hinaus, nichts mit ihr zu schaffen haben könne, daß tiefe Klüfte ihre Existenz von der seinen trennten, und daß er vor keiner Kritik, die er anerkannte, mit ihr bestehen würde. Einsichtigerweise war Hans Castorp ganz ohne persönlichen Hochmut; aber ein Hochmut allgemeiner und weiter hergeleiteter Art stand ihm ja auf der Stirn und um die etwas schläfrig blickenden Augen geschrieben, und aus ihm entsprang das Überlegenheitsgefühl, dessen er sich beim Anblick von Frau Chauchats Sein und Wesen nicht entschlagen konnte noch wollte. Es war sonderbar, daß er sich dieses weitläufigen Überlegenheitsgefühls besonders lebhaft und vielleicht überhaupt zum erstenmal bewußt wurde, als er Frau Chauchat eines Tages Deutsch sprechen hörte, – sie stand, beide Hände in den Taschen ihres Sweaters, nach Schluß einer Mahlzeit im Saale, und mühte sich, wie Hans Castorp im Vorübergehen wahrnahm, im Gespräch mit einer anderen Patientin, einer Liegehallengenossin wahrscheinlich, auf übrigens reizende Art um die deutsche Sprache, Hans Castorps Muttersprache, wie er mit plötzlichem und nie gekanntem Stolze empfand, – wenn auch nicht ohne gleichzeitige Neigung, diesen Stolz dem Entzücken aufzuopfern, womit ihr anmutiges Stümpern und Radebrechen ihn erfüllte.
Mit einem Worte: Hans Castorp sah in seinem stillen Verhältnis zu dem nachlässigen Mitgliede Derer hier oben ein Ferienabenteuer, das vor dem Tribunal der Vernunft – seines eigenen vernünftigen Gewissens – keinerlei Anspruch auf Billigung erheben konnte: hauptsächlich deshalb nicht, weil Frau Chauchat ja krank war, schlaff, fiebrig und innerlich wurmstichig, ein Umstand, der mit der Zweifelhaftigkeit ihrer Gesamtexistenz nahe zusammenhing und auch an Hans Castorps Vorsichts- und Abstandsgefühlen stark beteiligt war ... Nein, ihre wirkliche Bekanntschaft zu suchen, kam ihm nicht in den Sinn, und was das andere betraf, so würde es ja in anderthalb Wochen, wenn er bei Tunder & Wilms in die Praxis trat, wohl oder übel folgenlos beendet sein.
Vorderhand allerdings stand es so mit ihm, daß er angefangen hatte, die Gemütsbewegungen, Spannungen, Erfüllungen und Enttäuschungen, die ihm aus seinen zarten Beziehungen zu der Patientin erwuchsen, als den eigentlichen Sinn und Inhalt seines Ferienaufenthaltes zu betrachten, ganz ihnen zu leben und seine Laune von ihrem Gedeihen abhängig zu machen. Die Umstände leisteten ihrer Pflege den wohlwollendsten Vorschub, denn man lebte bei feststehender und jedermann bindender Tagesordnung auf beschränktem Raum beieinander, und wenn auch Frau Chauchat in einem anderen Stockwerk – im ersten – zu Hause war (sie hielt übrigens ihre Liegekur, wie Hans Castorp von der Lehrerin hörte, in einer gemeinsamen Liegehalle, nämlich der, die sich auf dem Dache befand, derselben, in der Hauptmann Miklosich neulich das Licht abgedreht hatte), so war doch allein schon durch die fünf Mahlzeiten, aber auch sonst auf Schritt und Tritt, vom Morgen bis zum Abend die Möglichkeit, ja Unumgänglichkeit der Begegnung gegeben. Und auch dies, ebenso wie das andere, daß keine Sorgen und Mühen die Aussicht versperrten, fand Hans Castorp famos, wenn auch solches Eingesperrtsein mit dem günstigen Ungefähr zugleich etwas Beklemmendes hatte.
Doch half er sogar noch ein bißchen nach, rechnete und stellte seinen Kopf in den Dienst der Sache, um das Glück zu verbessern. Da Frau Chauchat gewohnheitsmäßig verspätet zu Tische kam, so legte er es darauf an, ebenfalls zu spät zu kommen, um ihr unterwegs zu begegnen. Er versäumte sich bei der Toilette, war nicht fertig, wenn Joachim eintrat, um ihn abzuholen, ließ den Vetter vorangehen und sagte, er käme gleich nach. Beraten von dem Instinkt seines Zustandes, wartete er einen gewissen Augenblick ab, der ihm der richtige schien, und eilte ins erste Stockwerk hinab, wo er nicht die Treppe benutzte, die die Fortsetzung derjenigen bildete, die ihn herabgeführt hatte, sondern den Korridor fast bis ans Ende, bis zur anderen Treppe verfolgte, die einer längst bekannten Zimmertür – es war die von Nr. 7 – nahegelegen war. Auf diesem Wege, den Korridor entlang, von einer Treppe zur anderen, bot sozusagen jeder Schritt eine Chance, denn jeden Augenblick konnte die bewußte Tür sich öffnen, – und das tat sie wiederholt: krachend fiel sie hinter Frau Chauchat zu, die für ihre Person lautlos hervorgetreten war und lautlos zur Treppe glitt ... Dann ging sie vor ihm her und stützte das Haar mit der Hand, oder Hans Castorp ging vor ihr her und fühlte ihren Blick in seinem Rücken, wobei er ein Reißen in den Gliedern sowie ein Ameisenlaufen den Rücken hinunter verspürte, in dem Wunsche aber, sich vor ihr aufzuspielen, so tat, als wisse er nichts von ihr und führe sein Einzelleben in kräftiger Unabhängigkeit, – die Hände in die Rocktaschen grub und ganz unnötigerweise die Schultern rollte oder sich heftig räusperte und sich dabei mit der Faust vor die Brust schlug, – alles, um seine Unbefangenheit zu bekunden.
Zweimal trieb er die Abgefeimtheit noch weiter. Nachdem er am Eßtisch schon Platz genommen, sagte er bestürzt und ärgerlich, indem er sich mit beiden Händen betastete: „Da, ich habe mein Taschentuch vergessen! Jetzt heißt es, sich noch einmal hinaufbequemen.“ Und er ging zurück, damit er und „Clawdia“ einander begegneten, was denn doch noch etwas anderes, gefährlicher und von schärferen Reizen war, als wenn sie vor oder hinter ihm ging. Das erstemal, als er dies Manöver ausgeführt, maß sie ihn zwar aus einiger Entfernung mit den Augen, und zwar recht rücksichtslos und ohne Verschämtheit, von oben bis unten, wandte aber, herangekommen, gleichgültig das Gesicht ab und ging so vorüber, so daß das Ergebnis dieses Zusammentreffens nicht hoch zu veranschlagen war. Beim zweitenmal aber sah sie ihn an, und nicht nur von weitem, – die ganze Zeit sah sie ihn an, während des ganzen Vorganges, blickte ihm fest und sogar etwas finster in das Gesicht und drehte im Vorübergehen sogar noch den Kopf nach ihm, – es ging dem armen Hans Castorp durch Mark und Bein. Übrigens sollte man ihn nicht bedauern, da er es nicht anders gewollt und alles selbst in die Wege geleitet hatte. Aber die Begegnung ergriff ihn gewaltig, sowohl während sie sich abspielte wie namentlich noch nachträglich; denn erst als alles vorüber war, sah er recht deutlich, wie es gewesen. Noch niemals hatte er Frau Chauchats Gesicht so nahe, so in allen Einzelheiten klar erkennbar vor sich gehabt: er hatte die kurzen Härchen unterscheiden können, die sich aus dem Geflecht ihres blonden, ein wenig ins Metallisch-Rötliche spielenden und einfach um den Kopf geschlungenen Zopfes lösten, und nur ein paar Handbreit Raum war gewesen zwischen seinem Gesicht und dem ihren in seiner wundersamen, ihm aber von langer Hand her vertrauten Bildung, die ihm zusagte wie nichts in der Welt: einer Bildung, fremdartig und charaktervoll (denn nur das Fremde scheint uns Charakter zu haben), von nördlicher Exotik und geheimnisreich, zur Ergründung auffordernd, insofern ihre Merkmale und Verhältnisse nicht leicht zu bestimmen waren. Das Entscheidende war wohl die Betontheit der hochsitzenden Wangenknochenpartie: sie bedrängte die ungewohnt flach, ungewohnt weit voneinander liegenden Augen und trieb sie ein wenig ins Schiefe, während sie zugleich die Ursache abgab für das weiche Konkav der Wangen, das wiederum, von seiner Seite und mittelbar, die leicht aufgeworfene Üppigkeit der Lippen bewirkte. Dann aber waren da namentlich die Augen selbst gewesen, diese schmal und (so fand Hans Castorp) schlechthin zauberhaft geschnittenen Kirgisenaugen, deren Farbe das Graublau oder Blaugrau ferner Berge war, und die sich zuweilen, bei einem gewissen Seitenblick, der nicht zum Sehen diente, auf eine schmelzende Weise völlig ins Schleierig-Nächtige verdunkeln konnten, – Clawdias Augen, die ihn rücksichtslos und etwas finster aus nächster Nähe betrachtet hatten und nach Stellung, Farbe, Ausdruck denen Pribislav Hippes so auffallend und erschreckend ähnlich waren! „Ähnlich“ war gar nicht das richtige Wort, – es waren dieselben Augen; und auch die Breite der oberen Gesichtshälfte, die eingedrückte Nase, alles, bis auf die gerötete Weiße der Haut, die gesunde Farbe der Wangen, die bei Frau Chauchat ja aber Gesundheit nur vortäuschte und, wie bei allen hier oben, nichts als ein oberflächliches Erzeugnis der Liegekur im Freien war, – alles war ganz wie bei Pribislav, und nicht anders hatte dieser ihn angesehen, wenn sie auf dem Schulhof aneinander vorübergingen.
Das war erschütternd in jedem Sinn; Hans Castorp war begeistert von der Begegnung, und zugleich spürte er etwas wie aufsteigende Angst, eine Beklemmung derselben Art, wie das Eingesperrtsein mit dem günstigen Ungefähr auf engem Raum ihm verursachte: auch dies, daß der längst vergessene Pribislav ihm hier oben als Frau Chauchat wieder begegnete und ihn mit Kirgisenaugen ansah, war wie ein Eingesperrtsein mit Unumgänglichem oder Unentrinnbarem, – in beglückendem und ängstlichem Sinn Unentrinnbarem. Es war hoffnungsreich und zugleich auch unheimlich, ja bedrohlich, und ein Gefühl der Hilfsbedürftigkeit kam den jungen Hans Castorp an, – in seinem Inneren vollzogen sich unbestimmte und instinktmäßige Bewegungen, die man als ein Sichumsehen, als ein Tasten und Suchen nach Hilfe, nach Rat und Stütze hätte ansprechen mögen; er dachte nacheinander an verschiedene Personen, an die zu denken etwa zuträglich sein mochte.
Da war Joachim, der gute, ehrenfeste Joachim an seiner Seite, dessen Augen in diesen Monaten einen so traurigen Ausdruck angenommen, und der zuweilen so wegwerfend-heftig mit den Achseln zuckte, wie er es früher nie und nimmer getan, – Joachim mit dem „Blauen Heinrich“ in der Tasche, wie Frau Stöhr dies Gerät zu bezeichnen pflegte: mit einem so störrisch schamlosen Gesicht, daß es Hans Castorp jedesmal in der Seele entsetzte ... Der redliche Joachim also war da, der Hofrat Behrens tirrte und plagte, um fortzukommen und in der „Ebene“ oder im „Flachlande“, wie man hier die Welt der Gesunden mit einem leisen, aber deutlichen Akzent von Geringschätzung nannte, seinen ersehnten Dienst tun zu können. Damit er schneller dazu gelange und Zeit spare, mit der man hier so verschwenderisch umging, hielt er denn vorerst einmal mit aller Gewissenhaftigkeit den Kurdienst ein, – tat es um seiner baldigen Genesung willen, ohne Frage, aber, wie Hans Castorp manchmal zu spüren glaubte, ein wenig doch auch um des Kurdienstes willen, der am Ende ein Dienst war wie ein anderer, und Pflichterfüllung war Pflichterfüllung. So drängte denn Joachim abends schon nach einer Viertelstunde aus der Geselligkeit fort in die Liegekur, und das war gut, denn seine militärische Genauigkeit kam dem zivilen Sinn Hans Castorps gewissermaßen zu Hilfe, der sich sonst wohl, sinn- und aussichtsloserweise, gern noch des längeren an der Geselligkeit beteiligt hätte, mit Aussicht auf den kleinen Russensalon. Daß aber Joachim so dringlich darauf bedacht war, die Abendgeselligkeit abzukürzen, das hatte noch einen anderen, verschwiegenen Grund, auf den sich Hans Castorp genau verstand, seit er Joachims fleckiges Erblassen und jene eigentümlich klägliche Art, in der sein Mund sich in gewissen Augenblicken verzerrte, so genau verstehen gelernt hatte. Denn auch Marusja, die ewig lachlustige Marusja mit dem kleinen Rubin an ihrem schönen Finger, dem Apfelsinenparfüm und der hohen, wurmstichigen Brust war ja bei der Geselligkeit meistens zugegen, und Hans Castorp begriff, daß dieser Umstand Joachim forttrieb, weil er ihn allzusehr, auf eine schreckliche Weise anzog. War auch Joachim „eingesperrt“, – noch enger und beklemmender sogar als er selbst, da ja Marusja mit ihrem Apfelsinentüchlein zu allem Überfluß auch noch fünfmal am Tage mit ihnen zusammen an demselben Eßtisch saß? Jedenfalls hatte Joachim viel zu viel mit sich selbst zu tun, als daß sein Dasein eigentlich innerlich hilfreich für Hans Castorp hätte sein können. Seine tägliche Flucht aus der Geselligkeit wirkte zwar ehrenhaft, aber nichts weniger als beruhigend auf diesen, und dann kam es ihm augenblicksweise auch vor, als ob Joachims gutes Beispiel in bezug auf die Pflichttreue im Kurdienst, die kundige Anleitung dazu, die er ihm zuteil werden ließ, ihr Bedenkliches hätten.
Hans Castorp war noch nicht zwei Wochen an Ort und Stelle, aber es schien ihm länger, und die Tagesordnung Derer hier oben, die Joachim an seiner Seite so dienstfromm beobachtete, hatte angefangen, in seinen Augen das Gepräge einer heilig-selbstverständlichen Unverbrüchlichkeit anzunehmen, so daß ihm das Leben im Flachlande drunten, von hier gesehen, fast sonderbar und verkehrt erschien. Schon hatte er in der Handhabung der beiden Decken, mit denen man bei kalter Witterung in der Liegekur ein ebenmäßig Paket, eine richtige Mumie aus sich machte, schöne Gewandtheit gewonnen; es fehlte nicht viel, so tat er es Joachim gleich in der sicheren Fertigkeit und Kunst, sie vorschriftsmäßig um sich zu schlagen, und fast mußte er sich wundern bei dem Gedanken, daß in der Ebene drunten niemand etwas von dieser Kunst und Vorschrift wußte. Ja, das war wunderlich; – aber zugleich wunderte sich Hans Castorp darüber, daß er es wunderlich fand, und jene Unruhe, die ihn innerlich nach Rat und Stütze sich umsehen ließ, stieg neuerdings in ihm auf.
Er mußte an Hofrat Behrens denken und an seinen sine pecunia erteilten Rat, ganz so zu leben wie die Patientenschaft und sich sogar auch zu messen, – und an Settembrini, der über diesen Rat so laut in die Luft hinein gelacht und dann etwas aus der „Zauberflöte“ zitiert hatte. Ja, auch an diese beiden dachte er probeweise, um zu sehen, ob es ihm gut täte. Hofrat Behrens war ja ein weißhaariger Mann, er hätte Hans Castorps Vater sein können. Dazu war er Vorsteher der Anstalt, die höchste Autorität, – und väterliche Autorität war es, wonach der junge Hans Castorp ein unruhiges Herzensbedürfnis empfand. Und doch wollte es ihm nicht gelingen, wenn er es versuchte, des Hofrats mit kindlichem Vertrauen zu gedenken. Er hatte hier seine Frau begraben, ein Kummer, von dem er vorübergehend etwas wunderlich geworden war, und dann war er am Orte geblieben, weil das Grab ihn band, und außerdem weil er selbst etwas abbekommen hatte. War es nun vorbei damit? War er gesund und unzweideutig gesonnen, die Leute gesund zu machen, damit sie recht bald ins Flachland zurückkehren und Dienst tun könnten? Seine Backen waren beständig blau, und eigentlich sah er aus, als hätte er Übertemperatur. Aber das mochte auf Täuschung beruhen und nur die Luft schuld sein an dieser Gesichtsfarbe: Hans Castorp selber spürte hier ja tagein, tagaus eine trockene Hitze, ohne Fieber zu haben, soweit er es ohne Thermometer beurteilen konnte. Zwar, wenn man den Hofrat reden hörte, konnte man wieder zuweilen an Übertemperatur glauben; es war nicht ganz richtig mit seiner Redeweise: sie klang so forsch und fidel und gemütlich, aber es war etwas Sonderbares darin, etwas Exaltiertes, besonders wenn man die blauen Backen mit in Betracht zog, sowie die tränenden Augen, die aussahen, als weine er immer noch über seine Frau. Hans Castorp erinnerte sich dessen, was Settembrini über des Hofrats „Schwermut“ und „Lasterhaftigkeit“ ausgesagt, und daß er ihn eine „verworrene Seele“ genannt hatte. Das mochte Bosheit sein und Windbeutelei; aber er fand trotzdem, daß es nicht sonderlich stärkend sei, an Hofrat Behrens zu denken.
Aber da war denn freilich noch dieser Settembrini selbst, der Oppositionsmann, Windbeutel und „homo humanus“, wie er sich selber nannte, der es ihm mit vielen prallen Worten verwiesen hatte, Krankheit und Dummheit zusammen einen Widerspruch und ein Dilemma für das menschliche Gefühl zu nennen. Wie stand es mit ihm? Und war es zuträglich, an ihn zu denken? Hans Castorp erinnerte sich wohl, wie er in mehreren der übermäßig lebhaften Träume, die hier oben seine Nächte erfüllten, Ärgernis genommen an dem feinen, trockenen Lächeln des Italieners, das sich unter der schönen Rundung seines Schnurrbartes kräuselte, wie er ihn einen Drehorgelmann gescholten und ihn wegzudrängen versucht hatte, weil er hier störe. Aber das war im Traum gewesen, und der wachende Hans Castorp war ein anderer, weniger ungehemmt als der des Traumes. Im Wachen mochte es etwas anderes sein, – vielleicht tat er gut daran, es innerlich mit Settembrinis neuartigem Wesen zu versuchen, – mit seiner Aufsässigkeit und Kritik, obgleich sie larmoyant und geschwätzig war. Er selbst hatte sich ja einen Pädagogen genannt; offenbar wünschte er Einfluß zu nehmen; und den jungen Hans Castorp verlangte es herzlich, beeinflußt zu werden, – was ja freilich so weit nicht zu gehen brauchte, daß er sich von Settembrini bestimmen ließ, seinen Koffer zu packen und vor der Zeit abzureisen, wie jener es neulich allen Ernstes in Vorschlag gebracht hatte.
Placet experiri, dachte er bei sich lächelnd, denn so viel Latein verstand er auch noch, ohne sich einen homo humanus nennen zu dürfen. Und so hatte er denn ein Auge auf Settembrini und hörte bereitwillig und nicht ohne prüfende Aufmerksamkeit auf das, was er alles zum besten gab bei Begegnungen, wie sie bei den gemessenen Kurpromenaden zur Bank an der Bergwand oder nach „Platz“ hinab sich beiläufig ereigneten, oder bei anderer Gelegenheit, zum Beispiel wenn Settembrini nach beendeter Mahlzeit sich als erster erhob und in seinen karierten Beinkleidern, einen Zahnstocher zwischen den Lippen, durch den Saal mit den sieben Tischen schlenderte, um gegen alle Vorschrift und Übung ein wenig am Tische der Vettern zu hospitieren. Er tat es, indem er in anmutiger Haltung, mit gekreuzten Füßen, Aufstellung nahm und mit dem Zahnstocher gestikulierend plauderte. Oder er zog auch einen Stuhl heran, nahm Platz an einer Ecke zwischen Hans Castorp und der Lehrerin einerseits oder zwischen Hans Castorp und Miß Robinson andererseits und sah zu, wie die neun Tischgenossen ihren Nachtisch verzehrten, auf den er verzichtet zu haben schien.
„Ich bitte um Zutritt in diesen edlen Kreis“, sagte er, indem er den Vettern die Hand schüttelte und die übrigen Personen mit einer Verbeugung umfaßte. „Dieser Bierbrauer dort drüben ... von dem verzweiflungsvollen Anblick der Bierbrauerin zu schweigen. Aber dieser Herr Magnus, – soeben hat er einen völkerpsychologischen Vortrag gehalten. Wollen Sie hören? ‚Unser liebes Deutschland ist eine große Kaserne, gewiß. Aber es steckt viel Tüchtigkeit dahinter, und ich tausche unsere Gediegenheit für die Höflichkeit der andern nicht ein. Was hilft mir alle Höflichkeit, wenn ich vorn und hinten betrogen werde?‘ In diesem Stile. Ich bin am Rand meiner Kräfte. Dann sitzt da mir gegenüber ein armes Wesen mit Friedhofsrosen auf den Backen, eine alte Jungfer aus Siebenbürgen, die ohne Unterbrechung von ihrem ‚Schwager‘ spricht, einem Menschen, von dem niemand etwas weiß, noch wissen will. Kurzum, ich kann nicht mehr, ich habe mich aus dem Staub gemacht.“
„Fluchtartig haben Sie das Panier ergriffen,“ sagte Frau Stöhr; „das kann ich mir denken.“
„Exakt!“ rief Settembrini. „Das Panier! Ich sehe, hier weht ein anderer Wind, – kein Zweifel, ich bin vor die rechte Schmiede gekommen. Fluchtartig also ergriff ich es ... Wer so seine Worte zu setzen wüßte! – Darf ich mich nach den Fortschritten Ihrer Gesundheit erkundigen, Frau Stöhr?“
Es war entsetzlich, wie Frau Stöhr sich zierte. „Großer Gott,“ sagte sie, „es ist immer dasselbe, der Herr wissen ja selbst. Man tut zwei Schritte vorwärts und drei zurück, – hat man fünf Monate abgesessen, so kommt der Alte und legt einem ein halbes Jahr zu. Ach, es sind Tantalusqualen. Man schiebt und schiebt, und glaubt man, oben zu sein ...“
„Oh, das ist schön von Ihnen! Sie gönnen dem armen Tantalus endlich einige Abwechslung! Sie lassen ihn austauschweise einmal den berühmten Marmor wälzen! Das nenne ich wahre Herzensgüte. Aber wie ist es, Madame, es gehen geheimnisvolle Dinge mit Ihnen vor. Man hat Geschichten von Doppelgängerei, Astralleibern ... Ich habe daran nicht geglaubt bisher, aber was sich mit Ihnen zuträgt, macht mich irre ...“
„Es scheint, der Herr will seine Ergötzlichkeit mit mir treiben.“
„Durchaus nicht! Ich denke nicht daran! Beruhigen Sie mich zuerst über gewisse dunkle Seiten Ihrer Existenz, und wir werden von Ergötzlichkeit reden können! Ich mache mir gestern abend zwischen halb zehn und zehn Uhr ein wenig Bewegung im Garten – ich blicke dabei die Balkons entlang – das elektrische Lämpchen auf dem Ihren glüht durch das Dunkel. Sie befanden sich folglich in der Liegekur, nach Pflicht, Vernunft und Vorschrift. ‚Da liegt unsere schöne Kranke‘, sage ich zu mir selbst, ‚und beobachtet treulich die Verordnung, um baldigst heimkehren zu können in die Arme des Herrn Stöhr.‘ Und vor wenigen Minuten, was höre ich? Daß Sie zu derselben Stunde im cinematógrafo (Herr Settembrini sprach das Wort italienisch aus, mit dem Akzent auf der vierten Silbe) – im cinematógrafo der Kurhausarkaden gesehen worden sind und hernach noch in der Konditorei bei Süßwein und irgendwelchen Baisers, und zwar ...“
Die Stöhr wand sich in den Schultern, kicherte in ihre Serviette, stieß Joachim Ziemßen und den stillen Dr. Blumenkohl mit den Ellenbogen in die Seiten, zwinkerte listig-vertraulich und gab auf alle Weise eine stockdumme Selbstgefälligkeit zu erkennen. Sie pflegte abends zur Täuschung der Aufsicht ihr brennendes Tischlämpchen auf den Balkon hinauszustellen, sich heimlich davonzumachen und drunten im Englischen Viertel ihrer Zerstreuung nachzugehen. Ihr Mann wartete in Cannstatt auf sie. Übrigens war sie nicht der einzige Patient, der diese Praktik übte.
„... und zwar,“ fuhr Settembrini fort, „hätten Sie diese Baisers – in wessen Gesellschaft gekostet? In der Gesellschaft des Hauptmanns Miklosich aus Bukarest! Man versichert mir, er trage ein Korsett, aber mein Gott, wie wenig fällt das hier ins Gewicht! Ich beschwöre Sie, Madame, wo waren Sie? Sie sind doppelt! Jedenfalls waren Sie eingeschlafen, und während der irdische Teil Ihres Wesens einsam Liegekur machte, erlustierte sich der spirituelle in der Gesellschaft des Hauptmanns Miklosich und an seinen Baisers ...“
Frau Stöhr wand und sträubte sich, wie jemand, den man kitzelt.
„Man weiß nicht, ob man das Umgekehrte wünschen soll“, sagte Settembrini. „Daß Sie die Baisers allein genossen und die Liegekur mit dem Hauptmann Miklosich ausgeübt hätten ...“
„Hi, hi, hi ...“
„Kennen die Herrschaften die vorgestrige Geschichte?“ fragte der Italiener unvermittelt. „Jemand ist abgeholt worden, – vom Teufel geholt, oder eigentlich von seiner Frau Mutter, einer tatkräftigen Dame, sie hat mir gefallen. Es ist der junge Schneermann, Anton Schneermann, der dort vorn am Tische von Mademoiselle Kleefeld saß, – Sie sehen, sein Platz ist leer. Er wird bald genug wieder besetzt sein, ich mache mir keine Sorge, aber Anton ist fort auf Sturmesschwingen, im Hui und eh ers gedacht. Anderthalb Jahre war er hier – mit seinen sechzehn; es waren ihm eben noch sechs Monate zugelegt worden. Und was geschieht? Ich weiß nicht, wer Madame Schneermann ein Wort hatte zufließen lassen, auf jeden Fall hatte sie Wind bekommen von dem Wandel ihres Söhnchens in Baccho et ceteris. Unangemeldet erscheint sie auf dem Plan, eine Matrone – drei Köpfe größer als ich, weißhaarig und zornmütig, zieht Herrn Anton, ohne zu reden, ein paar Ohrfeigen herunter, nimmt ihn beim Kragen und setzt ihn auf die Bahn. ‚Soll er zu Grund gehen,‘ sagt sie, ‚so kann ers auch unten.‘ Und fort gehts nach Hause.“
Man lachte, soweit man in Hörweite saß, denn Herr Settembrini erzählte drollig. Er zeigte sich auf dem Laufenden über die letzten Neuigkeiten, obgleich er sich doch gegen das Gemeinschaftsleben Derer hier oben so kritisch-spöttisch verhielt. Er wußte alles. Er kannte die Namen und ungefähr auch die Lebensumstände Neuangekommener; er berichtete, daß gestern bei dem und dem oder der und der eine Rippenresektion vorgenommen worden und hatte es aus bester Quelle, daß vom Herbst an Kranke über 38,5 Grad nicht mehr aufgenommen werden würden. In der letzten Nacht hatte sich, seiner Erzählung nach, das Hündchen der Madame Capatsoulias aus Mytilene auf den Knopf des elektrischen Lichtsignals auf dem Nachttisch seiner Herrin gesetzt, woraus viel Rennerei und Tumult entstanden war, besonders, da man Madame Capatsoulias nicht allein, sondern in Gesellschaft des Assessors Düstmund aus Friedrichshagen gefunden habe. Selbst Dr. Blumenkohl mußte lächeln über diese Geschichte, die hübsche Marusja wollte in ihrem Orangentüchlein fast ersticken, und Frau Stöhr schrie gellend, indem sie die linke Brust mit beiden Händen preßte.
Aber mit den Vettern sprach Lodovico Settembrini auch von sich selbst und seiner Herkunft, sei es auf den Spaziergängen, gelegentlich der Abendgeselligkeit oder nach beendetem Mittagstisch, wenn die große Mehrzahl der Patienten den Saal schon verlassen hatte und die drei Herren noch eine Weile an ihrem Tafelende sitzenblieben, während die Saaltöchter abräumten und Hans Castorp seine Maria Mancini rauchte, deren Würze er in der dritten Woche wieder ein wenig zu schmecken begann. Aufmerksam prüfend, befremdet, aber willig sich beeinflussen zu lassen, hörte er den Erzählungen des Italieners zu, die ihm eine sonderbare, durchaus neuartige Welt eröffneten.
Settembrini sprach von seinem Großvater, der zu Mailand Advokat, hauptsächlich aber ein großer Patriot gewesen und etwas wie einen politischen Agitator, Redner und Zeitschriften-Mitarbeiter vorgestellt hatte, – auch er ein Oppositionsmann, gleich dem Enkel, doch hatte er das Ding in größerem, kühnerem Stile betrieben. Denn während Lodovico, wie er selber mit Bitterkeit bemerkte, sich darauf angewiesen fand, das Leben und Treiben im Internationalen Sanatorium Berghof zu hecheln, höhnische Kritik daran zu üben und im Namen einer schönen und tatfrohen Menschlichkeit Verwahrung dagegen einzulegen, hatte jener den Regierungen zu schaffen gemacht, gegen Österreich und die Heilige Allianz konspiriert, die damals sein zerstückeltes Vaterland im Banne dumpfer Knechtschaft gehalten hatten, und war eifriges Mitglied gewisser, über Italien verbreiteter geheimer Gesellschaften gewesen, – ein Carbonaro, wie Settembrini mit plötzlich gesenkter Stimme erklärte, als sei es auch jetzt noch gefährlich, davon zu sprechen. Kurz, dieser Giuseppe Settembrini stellte sich, nach den Erzählungen des Enkels, den beiden Zuhörern als eine dunkle, leidenschaftliche und wühlerische Existenz, als ein Rädelsführer und Verschwörer dar, und bei aller Achtung, deren sie sich höflicherweise befleißigten, gelang es ihnen nicht ganz, einen Ausdruck mißtrauischer Abneigung, ja des Widerwillens aus ihren Zügen zu verbannen. Freilich lagen die Dinge besonders: was sie hörten, war lange her, fast hundert Jahre, es war Geschichte, und aus der Geschichte, namentlich der alten, war ihnen das Wesen, von dem sie hier vernahmen, die Erscheinung verzweifelten Freiheitsmutes und unbeugsamen Tyrannenhasses theoretisch vertraut, obwohl sie nie gedacht hatten, so menschlich unmittelbar mit ihm in Berührung zu kommen. Auch hatte sich mit dem Aufrührer- und Konspirantentum dieses Großvaters, wie sie hörten, eine große Liebe zu seinem Vaterlande verbunden, das er einig und frei wissen wollte, – ja, sein umstürzlerisches Betreiben war Frucht und Ausfluß dieser achtbaren Verbundenheit gewesen, und wie sonderbar die Mischung von Aufrührerei und Patriotismus die Vettern, einen wie den andern, auch anmutete – denn sie waren gewohnt, vaterländische Gesinnung mit einem erhaltenden Ordnungssinn gleichzusetzen –, so mußten sie bei sich selber doch zugeben, daß, wie dort und damals alles sich verhalten hatte, Rebellion mit Bürgertugend und loyale Gesetztheit mit träger Gleichgültigkeit gegen das öffentliche Wesen mochte gleichbedeutend gewesen sein.
Aber nicht nur ein italienischer Patriot war Großvater Settembrini gewesen, sondern Mitbürger und Mitstreiter aller nach Freiheit dürstenden Völker. Denn nach dem Scheitern eines gewissen Hand- und Staatsstreichversuches, den man in Turin unternommen, und an dem er mit Wort und Tat beteiligt gewesen, nur mit genauer Not den Häschern des Fürsten Metternich entkommen, hatte er die Zeit seiner Verbannung dazu benutzt, in Spanien für die Konstitution und in Griechenland für die Unabhängigkeit des hellenischen Volkes zu kämpfen und zu bluten. Hier war Settembrinis Vater zur Welt gekommen, – weshalb er denn wohl auch ein so großer Humanist und Liebhaber des klassischen Altertums geworden war, – geboren übrigens von einer Mutter deutschen Blutes, denn Giuseppe hatte das Mädchen in der Schweiz geheiratet und bei seinen weiteren Abenteuern mit sich geführt. Später, nach zehnjähriger Landflüchtigkeit, hatte er in die Heimat zurückkehren können und zu Mailand als Advokat gewirkt, keineswegs aber darauf verzichtet, die Nation durch das gesprochene und geschriebene Wort, in Vers und Prosa zur Freiheit und zur Herstellung der einheitlichen Republik aufzurufen, staatsumwälzende Programme mit leidenschaftlich diktatorischem Schwung zu entwerfen und klaren Stiles die Vereinigung der befreiten Völker zur Errichtung des allgemeinen Glückes zu verkünden. Eine Einzelheit, deren Settembrini, der Enkel, erwähnte, machte besonderen Eindruck auf den jungen Hans Castorp: daß nämlich Großvater Giuseppe sich zeit seines Lebens ausschließlich in schwarzer Trauerkleidung unter seinen Mitbürgern gezeigt habe, denn er sei ein Leidtragender, habe er gesagt, um Italien, sein Vaterland, das in Elend und Knechtschaft dahinschmachte. Bei dieser Nachricht mußte Hans Castorp, wie er es übrigens schon vorher ein paarmal vergleichend getan hatte, an seinen eigenen Großvater denken, der ebenfalls, solange der Enkel ihn kannte, sich allezeit schwarz getragen hatte, aber in gründlich anderem Sinne, als dieser Großvater hier: an die altmodische Tracht dachte er, mit der Hans Lorenz Castorps eigentliches, einer vergangenen Zeit angehöriges Wesen sich behelfsweise und unter Andeutung seiner Unzugehörigkeit der Gegenwart angepaßt hatte, bis es im Tode zu seiner wahren und angemessenen Gestalt (mit der Tellerkrause) feierlich eingegangen war. Zwei auffallend verschiedenartige Großväter waren das wahrhaftig gewesen! Hans Castorp dachte darüber nach, indes seine Augen sich festsahen und er vorsichtig den Kopf schüttelte, so, daß es ebensogut als ein Zeichen der Bewunderung für Giuseppe Settembrini, wie auch als Befremdung und Verneinung gedeutet werden konnte. Auch hütete er sich redlich, das Fremdartige zu verurteilen, sondern hielt sich an, es bei Vergleich und Feststellung bewenden zu lassen. Er sah den schmalen Kopf des alten Hans Lorenz im Saale sich sinnend über das schwachgoldene Rund der Taufschale, des stehend-wandernden Erbstückes neigen, – gerundeten Mundes, denn seine Lippen bildeten die Vorsilbe „Ur“, diesen dumpfen und frommen Laut, der an Orte erinnerte, an denen man in eine ehrerbietig vorwärts wiegende Gangart verfiel. Und er sah Giuseppe Settembrini, die Trikolore im Arm, mit geschwungenem Säbel und den schwarzen Blick gelobend gen Himmel gewandt, einer Schar von Freiheitskämpfern voran gegen die Phalanx des Despotismus stürmen. Beides hatte wohl seine Schönheit und Ehre, dachte er, um Billigkeit desto mehr bemüht, als er sich persönlich oder halb persönlich ein wenig Partei fühlte. Denn Großvater Settembrini hatte ja um politische Rechte gestritten, seinem eigenen Großvater aber oder doch dessen Vorvätern hatten ursprünglich alle Rechte gehört, und die Krapüle hatte sie ihnen im Laufe von vier Jahrhunderten mit Gewalt und Redensarten entrissen ... Da waren sie nun beide immer in Schwarz gegangen, der Großvater im Norden und der im Süden, und beide zu dem Zweck, einen strengen Abstand zwischen sich und die schlechte Gegenwart zu legen. Aber der eine hatte es aus Frömmigkeit getan, der Vergangenheit und dem Tode zu Ehren, denen sein Wesen angehörte; der andere dagegen aus Rebellion und zu Ehren eines frömmigkeitsfeindlichen Fortschritts. Ja, das waren zwei Welten oder Himmelsgegenden, dachte Hans Castorp, und wie er gleichsam zwischen ihnen stand, während Herr Settembrini erzählte, und prüfend bald in die eine, bald in die andere blickte, so, meinte er, habe er es schon einmal erfahren. Er erinnerte sich einer einsamen Kahnfahrt im Abendzwielicht auf einem holsteinischen See, im Spätsommer, vor einigen Jahren. Um sieben Uhr war es gewesen, die Sonne war schon hinab, der annähernd volle Mond im Osten über den buschigen Ufern schon aufgegangen. Da hatte zehn Minuten lang, während Hans Castorp sich über die stillen Wasser dahinruderte, eine verwirrende und träumerische Konstellation geherrscht. Im Westen war heller Tag gewesen, ein glasig nüchternes, entschiedenes Tageslicht; aber wandte er den Kopf, so hatte er in eine ebenso ausgemachte, höchst zauberhafte, von feuchten Nebeln durchsponnene Mondnacht geblickt. Das sonderbare Verhältnis hatte wohl eine knappe Viertelstunde bestanden, bevor es sich zugunsten der Nacht und des Mondes ausgeglichen, und mit heiterem Staunen waren Hans Castorps geblendete und vexierte Augen von einer Beleuchtung und Landschaft zur anderen, vom Tage in die Nacht und aus der Nacht wieder in den Tag gegangen. Daran also mußte er denken.
Ein großer Rechtsgelehrter, dachte er ferner, konnte Advokat Settembrini bei seiner Lebensführung und seinem ausgedehnten Betreiben nicht gut geworden sein. Aber der allgemeine Grundsatz des Rechtes hatte ihn, wie der Enkel glaubhaft machte, von Kindesbeinen bis an sein Lebensende beseelt, und Hans Castorp, obgleich zur Zeit nicht eben scharf im Kopfe und von einer sechsgängigen Berghof-Mahlzeit organisch stark in Anspruch genommen, bemühte sich, zu verstehen, wie Settembrini es meinte, wenn er diesen Grundsatz „die Quelle der Freiheit und des Fortschritts“ nannte. Unter dem letzteren hatte Hans Castorp bisher so etwas verstanden, wie die Entwicklung des Hebezeug-Wesens im neunzehnten Jahrhundert; und er fand denn auch, daß Herr Settembrini solche Dinge nicht niedrig einschätzte, was offenbar auch sein Großvater nicht getan. Der Italiener erzeigte dem Vaterlande seiner beiden Zuhörer hohe Ehre in Hinsicht darauf, daß dort das Schießpulver erfunden worden sei, welches den Harnisch des Feudalismus zum Gerümpel gemacht habe, sowie die Druckerpresse: denn diese habe die demokratische Verbreitung der Ideen – das heiße: die Verbreitung der demokratischen Ideen ermöglicht. Er lobte also Deutschland in diesem Betracht und, soweit die Vergangenheit in Frage kam, wenn er auch seinem eigenen Lande billig die Palme glaubte reichen zu sollen, da es, während die anderen Völker noch in Aberglauben und Knechtschaft dämmerten, als erstes die Fahne der Aufklärung, Bildung und Freiheit entrollt habe. Wenn er aber der Technik und dem Verkehr, Hans Castorps persönlichem Arbeitsgebiet, viel Reverenz erwies, wie er es schon bei seiner ersten Begegnung mit den Vettern bei der Bank am Abhange getan, so schien es doch nicht um dieser Mächte selbst willen zu geschehen, sondern in Anbetracht ihrer Bedeutung für die moralische Vervollkommnung der Menschen, – denn eine solche Bedeutung erklärte er freudig ihnen beizumessen. Indem die Technik, sagte er, mehr und mehr die Natur sich unterwerfe, durch die Verbindungen, welche sie schaffe, den Ausbau der Straßennetze und Telegraphen, die klimatischen Unterschiede besiege, erweise sie sich als das verlässigste Mittel, die Völker einander nahe zu bringen, ihre gegenseitige Bekanntschaft zu fördern, menschlichen Ausgleich zwischen ihnen anzubahnen, ihre Vorurteile zu zerstören und endlich ihre allgemeine Vereinigung herbeizuführen. Das Menschengeschlecht komme aus Dunkel, Furcht und Haß, jedoch auf glänzendem Wege bewege es sich vorwärts und aufwärts einem Endzustande der Sympathie, der inneren Helligkeit, der Güte und des Glückes entgegen, und auf diesem Wege sei die Technik das förderlichste Vehikel, sagte er. Aber indem er so sprach, faßte er in einer Auslassung des Atems Kategorien zusammen, die Hans Castorp bisher nur weit voneinander getrennt zu denken gewohnt gewesen war. Technik und Sittlichkeit! sagte er. Und dann sprach er wahrhaftig vom Heilande des Christentums, der das Prinzip der Gleichheit und der Vereinigung zuerst offenbart, worauf die Druckerpresse die Verbreitung dieses Prinzipes mächtig gefördert und endlich die große französische Staatsumwälzung es zum Gesetz erhoben habe. Das mutete den jungen Hans Castorp, wenn auch aus unbestimmten Gründen, so doch in der Tat auf das allerbestimmteste konfus an, obwohl Herr Settembrini es in so klare und pralle Worte faßte. Einmal, erzählte dieser, einmal in seinem Leben, und zwar zu Beginn seines besten Mannesalters, habe sein Großvater sich recht von Herzen glücklich gefühlt, und das sei zur Zeit der Pariser Juli-Revolution gewesen. Laut und öffentlich habe er damals das Wort gesprochen, daß alle Menschen dereinst jene drei Tage von Paris neben die sechs Tage der Weltschöpfung stellen würden. Hier konnte Hans Castorp nicht umhin, mit der Hand auf den Tisch zu schlagen und sich bis in den Grund seiner Seele zu wundern. Daß man drei Sommertage des Jahres 1830, an welchen die Pariser sich eine neue Verfassung gegeben, neben die sechs stellen solle, in denen Gott der Herr die Feste von den Wassern geschieden und die ewigen Himmelslichter sowie Blumen, Bäume, Vögel, Fische und alles Leben geschaffen hatte, schien ihm stark, und noch nachher, allein mit seinem Vetter Joachim, ausdrücklich und gesprächsweise, fand er es überaus stark, ja geradezu anstößig.
Aber er war guten Willens, sich beeinflussen zu lassen, im Sinne des Wortes, daß es angenehm sei, Versuche anzustellen, und so legte er dem Proteste, den seine Pietät und sein Geschmack gegen die Settembrinische Anordnung der Dinge erhoben, Zügel an, in der Erwägung, daß, was ihm lästerlich vorkam, Kühnheit genannt werden könne und, was ihn abgeschmackt anmutete, Hochherzigkeit und edelmütiger Überschwang wenigstens dort und damals gewesen sein mochte: so zum Beispiel, wenn Großvater Settembrini die Barrikaden den „Volksthron“ genannt und erklärt hatte, es gelte, „die Pike des Bürgers am Altar der Menschheit zu weihen“.
Hans Castorp wußte, warum er Herrn Settembrini zuhörte, nicht ausdrücklich, aber er wußte es. Etwas wie Pflichtgefühl war dabei, außer jener Ferien-Verantwortungslosigkeit des Reisenden und Hospitanten, der sich gegen keinen Eindruck verhärtet und die Dinge an sich herankommen läßt, in dem Bewußtsein, daß er morgen oder übermorgen wieder die Flügel lüften und in die gewohnte Ordnung zurückkehren wird: – etwas wie eine Gewissensvorschrift also, und zwar, um genau zu sein, die Vorschrift und Mahnung eines irgendwie schlechten Gewissens, bestimmte ihn, dem Italiener zuzuhören, ein Bein über das andere geschlagen und an seiner Maria Mancini ziehend, oder wenn sie zu dritt vom Englischen Viertel gegen den Berghof emporstiegen.
Nach Settembrinis Anordnung und Darstellung lagen zwei Prinzipien im Kampf um die Welt: die Macht und das Recht, die Tyrannei und die Freiheit, der Aberglaube und das Wissen, das Prinzip des Beharrens und dasjenige der gärenden Bewegung, des Fortschritts. Man konnte das eine das asiatische Prinzip, das andere aber das europäische nennen, denn Europa war das Land der Rebellion, der Kritik und der umgestaltenden Tätigkeit, während der östliche Erdteil die Unbeweglichkeit, die untätige Ruhe verkörperte. Gar kein Zweifel, welcher der beiden Mächte endlich der Sieg zufallen würde, – es war die der Aufklärung, der vernunftgemäßen Vervollkommnung. Denn immer neue Völker raffte die Menschlichkeit auf ihrem glänzenden Wege mit fort, immer mehr Erde eroberte sie in Europa selbst und begann, nach Asien vorzudringen. Doch fehlte noch viel an ihrem vollen Siege, und noch große und edelmütige Anstrengungen waren von den Wohlgesinnten, von denen, welche das Licht erhalten hatten, zu machen, bis nur erst der Tag kam, wo auch in den Ländern unseres Erdteils, die in Wahrheit weder ein achtzehntes Jahrhundert noch ein 1789 erlebt hatten, die Monarchien und Religionen zusammenstürzen würden. Aber dieser Tag werde kommen, sagte Settembrini und lächelte fein unter seinem Schnurrbart, – er werde, wenn nicht auf Taubenfüßen, so auf Adlersschwingen kommen und anbrechen als die Morgenröte der allgemeinen Völkerverbrüderung im Zeichen der Vernunft, der Wissenschaft und des Rechtes; die heilige Allianz der bürgerlichen Demokratie werde er bringen, das leuchtende Gegenstück zu jener dreimal infamen Allianz der Fürsten und Kabinette, deren persönlicher Todfeind Großvater Giuseppe gewesen, – mit einem Worte die Weltrepublik. Zu diesem Endziele aber war vor allem erforderlich, das asiatische, das knechtische Prinzip der Beharrung im Mittelpunkte und Lebensnerv seines Widerstandes zu treffen, nämlich in Wien. Österreich gelte es aufs Haupt zu schlagen und zu zerstören, einmal um Rache zu nehmen für Vergangenes und dann, um die Herrschaft des Rechtes und Glückes auf Erden in die Wege zu leiten.
Diese letzte Wendung und Schlußfolgerung von Settembrinis wohllautenden Ergießungen interessierte Hans Castorp nun gar nicht mehr, sie mißfiel ihm, ja berührte ihn peinlich wie eine persönliche oder nationale Verbissenheit, sooft sie wiederkehrte, – von Joachim Ziemßen zu schweigen, der, wenn der Italiener in dieses Fahrwasser geriet, mit verfinsterten Brauen den Kopf abwandte und nicht mehr zuhörte, auch wohl zum Kurdienste mahnte oder das Gespräch abzulenken suchte. Auch Hans Castorp fühlte sich nicht gehalten, solchen Abwegigkeiten Aufmerksamkeit zu schenken, – offenbar lagen sie außer der Grenze dessen, wovon versuchsweise sich beeinflussen zu lassen eine Gewissensvorschrift ihn mahnte, und zwar so vernehmbar mahnte, daß er selbst, wenn Herr Settembrini sich zu ihnen setzte oder im Freien sich ihnen anschloß, ihn aufforderte, sich über seine Ideen zu äußern.
Diese Ideen, Ideale und Willensstrebungen, bemerkte Settembrini, seien Familienüberlieferung in seinem Hause. Denn alle drei hätten sie ihnen ihr Leben und ihre Geisteskräfte gewidmet, der Großvater, Vater und Enkel, ein jeder nach seiner Art: der Vater nicht weniger als der Großvater Giuseppe, obgleich er nicht, wie dieser, ein politischer Agitator und Freiheitskämpfer, sondern ein stiller und zarter Gelehrter, ein Humanist an seinem Pulte gewesen sei. Was aber sei denn der Humanismus? Liebe zum Menschen sei er, nichts weiter, und damit sei er auch Politik, sei er auch Rebellion gegen alles, was die Idee des Menschen besudele und entwürdige. Man habe ihm eine übertriebene Schätzung der Form zum Vorwurf gemacht; aber auch die schöne Form pflege er lediglich um der Würde des Menschen willen, im glänzenden Gegensatze zum Mittelalter, das nicht allein in Menschenfeindschaft und Aberglauben, sondern auch in schimpfliche Formlosigkeit versunken gewesen sei, und von allem Anbeginn habe er die Sache des Menschen, die irdischen Interessen, habe er Gedankenfreiheit und Lebensfreude verfochten und dafür gehalten, daß der Himmel billig den Spatzen zu überlassen sei. Prometheus! Er sei der erste Humanist gewesen, und er sei identisch mit jenem Satanas, auf den Carducci seine Hymne gedichtet ... Ach, mein Gott, die Vettern hätten den alten Kirchenfeind zu Bologna gegen die christliche Empfindsamkeit der Romantiker sollen sticheln und wettern hören! Gegen Manzonis heilige Gesänge! Gegen die Schatten- und Mondscheinpoesie des Romanticismo, den er der „bleichen Himmelsnonne Luna“ verglichen habe! Per Bacco, es sei ein Hochgenuß gewesen! Und hören sollen hätten sie auch, wie er, Carducci, Dante ausgelegt habe, – als Bürger einer Großstadt habe er ihn gefeiert, der gegen Askese und Weltverneinung die Tatkraft, die umwälzende und weltverbessernde, verteidigt habe. Denn nicht den kränklichen und mystagogischen Schatten der Beatrice habe der Dichter mit dem Namen der „Donna gentile e pietosa“ geehrt; so heiße vielmehr seine Gattin, die im Gedicht das Prinzip der diesseitigen Erkenntnis, der praktischen Lebensarbeit verkörpere ...
Da hatte Hans Castorp nun auch dies und das über Dante gehört, und zwar aus bester Quelle. Ganz fest verließ er sich nicht darauf, in Anbetracht der Windbeutelei des Vermittlers; aber hörenswert war es immerhin, daß Dante ein geweckter Großstädter gewesen sei. Und dann hörte er weiter zu, wie Settembrini von sich selber sprach und erklärte, in seiner, des Enkels Lodovico, Person nun aber hätten die Tendenzen seiner unmittelbaren Vorfahren, die staatsbürgerliche des Großvaters und die humanistische des Vaters, sich vereinigt, indem er nämlich ein Literat, ein freier Schriftsteller geworden sei. Denn die Literatur sei nichts anderes als eben dies: sie sei die Vereinigung von Humanismus und Politik, welche sich um so zwangloser vollziehe, als ja Humanismus selber schon Politik und Politik Humanismus sei ... Hier horchte Hans Castorp auf und gab sich Mühe, es recht zu verstehen; denn er durfte nun hoffen, Bierbrauer Magnussens ganze Unbelehrtheit einzusehen und zu erfahren, inwiefern die Literatur denn doch noch etwas anderes sei als „schöne Charaktere“. Ob, fragte Settembrini, seine Zuhörer je von Herrn Brunetto gehört hätten, Brunetto Latini, Stadtschreiber von Florenz um 1250, der ein Buch über die Tugenden und die Laster geschrieben? Dieser Meister zuerst habe den Florentinern Schliff gegeben und sie das Sprechen gelehrt sowie die Kunst, ihre Republik nach den Regeln der Politik zu lenken. „Da haben Sie es, meine Herren!“ rief Settembrini. „Da haben Sie es!“ Und er sprach vom „Worte“, vom Kultus des Wortes, der Eloquenz, die er den Triumph der Menschlichkeit nannte. Denn das Wort sei die Ehre des Menschen, und nur dieses mache das Leben menschenwürdig. Nicht nur der Humanismus, – Humanität überhaupt, alle Menschenwürde, Menschenachtung und menschliche Selbstachtung sei untrennbar mit dem Worte, mit Literatur verbunden – („Siehst du wohl,“ sagte Hans Castorp später zu seinem Vetter, „siehst du wohl, daß es in der Literatur auf die schönen Worte ankommt? Ich habe es gleich gemerkt.“), – und so sei auch die Politik mit ihr verbunden, oder vielmehr: sie gehe hervor aus dem Bündnis, der Einheit von Humanität und Literatur, denn das schöne Wort erzeuge die schöne Tat. „Sie hatten in Ihrem Lande,“ sagte Settembrini, „vor zweihundert Jahren einen Dichter, einen prächtigen alten Plauderer, der großes Gewicht auf eine schöne Handschrift legte, weil er meinte, daß eine solche zum schönen Stile führe. Er hätte ein wenig weiter gehen sollen und sagen, daß ein schöner Stil zu schönen Handlungen führe.“ Schön schreiben, das heiße beinahe auch schon schön denken, und von da sei nicht weit mehr zum schönen Handeln. Alle Sittigung und sittliche Vervollkommnung entstamme dem Geiste der Literatur, diesem Geiste der Menschenehre, welcher zugleich auch der Geist der Humanität und der Politik sei. Ja, dies alles sei eins, sei ein und dieselbe Macht und Idee, und in einen Namen könne man es zusammenfassen. Wie dieser Name laute? Nun, dieser Name setze sich aus vertrauten Silben zusammen, deren Sinn und Majestät die Vettern aber gewiß so recht noch niemals begriffen hätten, – er laute: Zivilisation! Und indem Settembrini dies Wort von den Lippen ließ, warf er seine kleine, gelbe Rechte empor, wie jemand, der einen Toast ausbringt.
Dies alles fand der junge Hans Castorp hörenswert, zwar unverbindlicherweise und mehr zum Versuch, doch hörenswert auf alle Fälle fand er, daß es sei, und sprach sich in diesem Sinne auch gegen Joachim Ziemßen darüber aus, der aber gerade das Thermometer im Munde hatte und also nur undeutlich antworten konnte, danach auch allzu beschäftigt war, die Ziffer abzulesen und in die Tabelle einzutragen, um sich zu Settembrinis Aspekten äußern zu können. Hans Castorp, wie wir sagten, nahm gutwillig Kenntnis davon und öffnete ihnen zur Prüfung sein Inneres: woraus vor allem erhellt, wie vorteilhaft der wachende Mensch sich von dem blöde träumenden unterscheidet, – als welcher Hans Castorp Herrn Settembrini schon mehrmals ins Gesicht hinein einen Drehorgelmann geschimpft und ihn aus allen Kräften von der Stelle zu drängen versucht hatte, weil er „hier störe“; als Wachender aber hörte er ihm höflich und aufmerksam zu und suchte rechtlich gesinnt die Widerstände auszugleichen und niederzuhalten, die sich gegen des Mentors Anordnungen und Darstellungen in ihm erheben wollten. Denn daß gewisse Widerstände in seiner Seele sich regten, soll nicht geleugnet werden: es waren solche, die von früher her, ursprünglich und immer schon darin vorhanden gewesen, wie auch solche, die sich aus der gegenwärtigen Sachlage besonders ergaben, aus seinen teils mittelbaren, teils verschwiegenen Erlebnissen bei Denen hier oben.
Was ist der Mensch, wie leicht betrügt sich doch sein Gewissen! Wie versteht er es, noch aus der Stimme der Pflicht die Erlaubnis zur Leidenschaft herauszuhören! Aus Pflichtgefühl, um der Billigkeit, des Gleichgewichts willen hörte Hans Castorp Herrn Settembrini zu und prüfte wohlmeinend seine Aspekten über die Vernunft, die Republik und den schönen Stil, bereit, sich davon beeinflussen zu lassen. Desto statthafter aber fand er es hinterdrein, seinen Gedanken und Träumen wieder in anderer, in entgegengesetzter Richtung freien Lauf zu lassen, – ja, um unseren ganzen Verdacht oder unsere ganze Einsicht auszusprechen, so hatte er wohl gar Herrn Settembrini nur zu dem Zwecke gelauscht, von seinem Gewissen einen Freibrief zu erlangen, den es ihm ursprünglich nicht hatte ausfertigen wollen. Was oder wer aber befand sich auf dieser anderen, dem Patriotismus, der Menschenwürde und der schönen Literatur entgegengesetzten Seite, wohin Hans Castorp sein Sinnen und Betreiben nun wieder lenken zu dürfen glaubte? Dort befand sich ... Clawdia Chauchat, – schlaff, wurmstichig und kirgisenäugig; und indem Hans Castorp ihrer gedachte (übrigens ist „gedenken“ ein allzu gezügelter Ausdruck für seine Art, sich ihr innerlich zuzuwenden), war es ihm wieder, als säße er im Kahn auf jenem holsteinischen See und blicke aus der glasigen Tageshelle des westlichen Ufers vexierten und geblendeten Auges hinüber in die nebeldurchsponnene Mondnacht der östlichen Himmel.
Hans Castorps Woche lief hier von Dienstag bis Dienstag, denn an einem Dienstag war er ja angekommen. Daß er im Bureau seine zweite Wochenrechnung beglichen hatte, lag schon ein paar Tage zurück, – die bescheidene Wochenrechnung von rund 160 Franken, bescheiden und billig nach seinem Urteil, selbst wenn man die Unbezahlbarkeiten des hiesigen Aufenthalts, eben ihrer Unbezahlbarkeit wegen, überhaupt nicht in Anschlag brachte, auch nicht gewisse Darbietungen, die wohl berechenbar gewesen wären, wenn man gewollt hätte, wie zum Exempel die vierzehntägige Kurmusik und die Vorträge Dr. Krokowskis, sondern allein und ausschließlich die eigentliche Bewirtung und gasthausmäßige Leistung, das bequeme Logis, die fünf übergewaltigen Mahlzeiten.
„Es ist nicht viel, es ist eher billig, du kannst nicht klagen, daß man dich überfordert hier oben“, sagte der Hospitant zu dem Eingesessenen. „Du brauchst also rund 650 Franken den Monat für Wohnung und Essen, und dabei ist ja die ärztliche Behandlung schon einbegriffen. Gut. Nimm an, du wirfst im Monat noch dreißig Franken für Trinkgelder aus, wenn du anständig bist und Wert legst auf freundliche Gesichter. Das sind 680 Franken. Gut. Du wirst mir sagen, daß es noch Spesen und Sporteln gibt. Man hat Auslagen für Getränke, für Kosmetik, für Zigarren, man macht mal einen Ausflug, eine Wagenfahrt, wenn du willst, und dann und wann gibt es eine Schuster- oder Schneiderrechnung. Gut, aber bei alldem bringst du mit dem besten Willen noch keine tausend Franken im Monat unter! Noch keine achthundert Mark! Das sind noch keine 10000 Mark im Jahr. Mehr ist es auf keinen Fall. Davon lebst du.“
„Kopfrechnen lobenswert“, sagte Joachim. „Ich wußte gar nicht, daß du so gewandt darin bist. Und daß du gleich die Jahreskalkulation aufstellst, das finde ich großzügig von dir, entschieden hast du schon etwas gelernt hier oben. Übrigens rechnest du zu hoch. Ich rauche ja keine Zigarren, und Anzüge hoffe ich mir hier auch nicht machen lassen zu müssen, ich danke!“
„Also sogar noch zu hoch“, sagte Hans Castorp etwas verwirrt. Aber wie es nun gekommen sein mochte, daß er seinem Vetter Zigarren und neue Anzüge in Rechnung gestellt hatte, – was sein behendes Kopfrechnen betraf, so war das nichts weiter als Blendwerk und Irreführung über seine natürlichen Gaben. Denn wie in allen Stücken, war er auch hierin eher langsam und bar des Feuers, und seine rasche Übersicht in diesem Falle war keine Stegreifleistung, sondern beruhte auf Vorbereitung, und zwar auf schriftlicher Vorbereitung, indem nämlich Hans Castorp eines Abends während der Liegekur (denn er legte sich abends nun doch hinaus, da alle es taten) eigens von seinem vorzüglichen Liegestuhl aufgestanden war, um sich, einem plötzlichen Einfall folgend, aus dem Zimmer Papier und Bleistift zum Rechnen zu holen. Damit hatte er denn festgestellt, daß sein Vetter, oder vielmehr, daß man überhaupt hier alles in allem 12000 Franken pro Jahr benötige und sich zum Spaße innerlich klargemacht, daß er für seine Person dem Leben hier oben wirtschaftlich mehr als gewachsen sei, da er sich als einen Mann von 18-19000 Franken jährlich betrachten durfte.
Seine zweite Wochenrechnung also war vor drei Tagen gegen Dank und Quittung geregelt worden, was so viel heißen will, wie daß er sich mitten in der dritten und plangemäß letzten Woche seines Aufenthaltes hier oben befand. Am kommenden Sonntag würde er noch eines der vierzehntägig wiederkehrenden Kurkonzerte hier miterleben und am Montag noch einem der ebenfalls vierzehntägig sich wiederholenden Vorträge Dr. Krokowskis beiwohnen, – sagte er zu sich selbst und zu seinem Vetter; am Dienstag oder Mittwoch aber würde er reisen und Joachim wieder allein hier zurücklassen, den armen Joachim, dem Radamanth noch wer weiß wie viele Monate zudiktiert hatte, und dessen sanfte, schwarze Augen sich jedesmal wehmütig verschleierten, wenn von Hans Castorps rapid heranrückender Abreise die Rede war. Ja, großer Gott, wo war diese Ferienzeit geblieben! Verronnen, verflogen, enteilt, – man wußte wahrhaftig nicht recht zu sagen, wie. Es waren doch schließlich einundzwanzig Tage gewesen, die sie hatten miteinander verleben sollen, eine lange Reihe, nicht leicht zu übersehen am Anfang. Und nun waren auf einmal nur noch drei, vier geringfügige Tage davon übrig, ein wenig beträchtlicher Restbestand, etwas beschwert allerdings durch die beiden periodischen Abwandlungen des Normaltages, aber schon erfüllt von Pack- und Abschiedsgedanken. Drei Wochen waren eben so gut wie nichts hier oben, – sie hatten es ihm ja alle gleich gesagt. Die kleinste Zeiteinheit war hier der Monat, hatte Settembrini gesagt, und da Hans Castorps Aufenthalt sich unter dieser Größe hielt, so war er eben ein Nichts von einem Aufenthalt und eine Stippvisite, wie Hofrat Behrens sich ausgedrückt hatte. Ob es vielleicht an der erhöhten Allgemeinverbrennung lag, daß die Zeit hier so im Handumdrehen verging? Solche Raschlebigkeit war ja ein Trost für Joachim in Hinsicht auf die fünf Monate, die ihm noch bevorstanden, falls es bei fünfen sein Bewenden haben würde. Aber während dieser drei Wochen hätten sie der Zeit etwas besser aufpassen sollen, so, wie es während des Messens geschah, wo dann die vorgeschriebenen sieben Minuten zu einer so bedeutenden Zeitspanne wurden ... Hans Castorp fühlte herzliches Mitleid mit seinem Vetter, dem die Trauer über den nahe bevorstehenden Verlust des menschlichen Gesellschafters in den Augen zu lesen war, – fühlte in der Tat das stärkste Mitleid mit ihm, wenn er bedachte, daß der Arme nun immerfort ohne ihn hierbleiben sollte, während er selbst wieder im Flachland lebte und im Dienste der völkerverbindenden Verkehrstechnik tätig war: ein geradezu brennendes Mitleid, schmerzhaft für die Brust in gewissen Augenblicken und, kurz, so lebhaft, daß er zuweilen ernstlich daran zweifelte, ob er es über sich gewinnen und Joachim allein würde hier oben lassen können. So sehr also brannte ihn manchmal das Mitleid, und dies war denn auch wohl der Grund, weshalb er selbst, von sich aus, weniger und weniger von seiner Abreise sprach: Joachim war es, der hin und wieder das Gespräch darauf brachte; Hans Castorp, wie wir sagten, schien aus natürlichem Takt und Feingefühl bis zum letzten Augenblick nicht daran denken zu wollen.
„Nun wollen wir wenigstens hoffen,“ sagte Joachim, „daß du dich erholt hast bei uns und die Erfrischung spürst, wenn du hinunterkommst.“
„Ja, ich werde also allerseits grüßen,“ erwiderte Hans Castorp, „und sagen, daß du spätestens in fünf Monaten nachkommst. Erholt? Du meinst, ob ich mich erholt habe in diesen paar Tagen? Das will ich doch annehmen. Eine gewisse Erholung muß selbst in so kurzer Zeit doch am Ende wohl stattgefunden haben. Allerdings waren es ja so neuartige Eindrücke hier oben, neuartig in jeder Beziehung, sehr anregend, aber auch anstrengend für den Geist und den Körper, ich habe nicht das Gefühl, mit ihnen schon fertig geworden zu sein und mich akklimatisiert zu haben, was doch wohl die Vorbedingung aller Erholung wäre. Maria ist gottlob die alte, seit einigen Tagen bin ich ihr wieder auf den Geschmack gekommen. Aber von Zeit zu Zeit wird immer noch mein Taschentuch rot, wenn ich es benutze, und die verdammte Hitze im Gesicht mitsamt dem sinnlosen Herzklopfen werde ich auch, wie es scheint, bis zum Schluß nicht mehr loswerden. Nein, nein, von Akklimatisation kann man bei mir nicht gut reden, wie sollte man auch nach so kurzer Zeit. Da brauchte es länger, um sich hier zu akklimatisieren und mit den Eindrücken fertig zu werden, und dann könnte die Erholung beginnen und das Ansetzen von Eiweiß. Schade. Ich sage ‚schade‘, weil es entschieden fehlerhaft war, daß ich mir nicht mehr Zeit für diesen Aufenthalt vorbehielt, – zur Verfügung wär sie ja schließlich gewesen. So ist mir zumute, als ob ich mich zu Hause im Flachland vor allem einmal von der Erholung werde erholen müssen und drei Wochen schlafen, so abgearbeitet komme ich mir manchmal vor. Und nun kommt ja ärgerlicherweise dieser Katarrh hinzu ...“
Es hatte nämlich den Anschein gewonnen, als ob Hans Castorp mit einem Schnupfen erster Klasse im Flachlande wieder eintreffen sollte. Er hatte sich erkältet, wahrscheinlich in der Liegekur, und zwar, um nochmals zu mutmaßen, in der Abendliegekur, an der er sich seit etwa einer Woche beteiligte, trotz des naßkalten Wetters, das sich vor seiner Abreise nicht mehr bessern zu wollen schien. Er hatte aber erfahren, daß es als schlecht nicht anerkannt wurde; der Begriff des schlechten Wetters bestand überhaupt nicht zu Recht hier oben, man fürchtete kein Wetter, man nahm kaum Rücksicht darauf, und mit der weichen Gelehrigkeit der Jugend, ihrer ganzen Anpassungswilligkeit an die Gedanken und Gebräuche der Umgebung, in die sie sich eben versetzt findet, hatte Hans Castorp angefangen, sich diese Gleichgültigkeit zu eigen zu machen. Wenn es wie aus Kannen goß, so durfte man nicht glauben, daß deshalb die Luft weniger trocken sei. Das war sie wohl wirklich nicht, denn nach wie vor hatte man einen so heißen Kopf davon, wie von der einer überheizten Stube, oder als ob man viel Wein getrunken. Was aber die Kälte anging, die erheblich war, so hätte es wenig Vernunft gehabt, sich vor ihr ins Zimmer zu flüchten; denn da es nicht schneite, wurde nicht geheizt, und im Zimmer zu sitzen war keineswegs behaglicher, als, im Winterpaletot und nach der Kunst in seine zwei guten Kamelhaardecken verpackt, in der Balkonloge zu liegen. Im Gegenteile und umgekehrt: dies letztere war das ganz unvergleichlich Behaglichere, es war, schlechthin geurteilt, die ansprechendste Lebenslage, die Hans Castorp je erprobt zu haben sich erinnerte, – ein Urteil, in dem er sich dadurch nicht beirren ließ, daß irgendein Schriftsteller und Carbonaro sie mit einem boshaften Unter- und Nebensinn die „horizontale“ Lebenslage nannte. Namentlich am Abend fand er sie ansprechend, wenn neben einem auf dem Tischchen das Lämpchen glühte und man, warm in den Decken, die wieder schmeckende Maria zwischen den Lippen und im Genuß aller schwer bestimmbaren Vorzüge des hiesigen Liegestuhltypus, mit freilich eisiger Nasenspitze und ein Buch – es war immer noch „Ocean steamships“ – in den freilich arg verklammten, rot angelaufenen Händen, durch die Bogen der Loggia über das dunkelnde, mit hier zerstreuten, dort dicht zusammentretenden Lichtern geschmückte Tal hinblickte, aus welchem fast jeden Abend und wenigstens eine Stunde lang, Musik herauftönte, angenehm abgedämpfte, vertraut melodische Klänge: Opernfragmente waren es, Stücke aus „Carmen“, aus dem „Troubadour“ oder dem „Freischütz“, wohlgebaute, zügige Walzer sodann, Märsche, bei denen man hochgemut den Kopf hin und her wandte, und muntere Mazurken. Mazurka? Marusja hieß sie eigentlich, die mit dem kleinen Rubin, und in der Nachbarloge, hinter der dicken Milchglaswand, lag Joachim, – dann und wann wechselte Hans Castorp ein vorsichtiges Wort mit ihm, unter voller Rücksichtnahme auf die anderen Horizontalen. Joachim hatte es in seiner Loge ebensogut wie Hans Castorp, wenn er auch unmusikalisch war und sich an den Abendkonzerten nicht so zu freuen verstand. Schade für ihn; er las wohl statt dessen in seiner russischen Grammatik. Hans Castorp aber ließ „Ocean steamships“ auf der Decke liegen und lauschte mit herzlicher Teilnahme auf die Musik, blickte wohlgefällig in die durchsichtige Tiefe ihrer Faktur und empfand so inniges Vergnügen an einer charakter- und stimmungsvollen melodischen Eingebung, daß er sich zwischendurch nur mit Feindseligkeit an Settembrinis Äußerungen über die Musik erinnerte, Äußerungen, so ärgerlich wie die, daß die Musik politisch verdächtig sei, – was in der Tat nicht viel besser war, als Großvater Giuseppes Redensart von der Julirevolution und den sechs Tagen der Weltschöpfung ...
Joachim also war des musikalischen Genusses nicht so teilhaftig, und auch die würzige Unterhaltung des Rauchens war ihm fremd; sonst aber lag er ebenso wohlgeborgen in seiner Loge, geborgen und befriedet. Der Tag war zu Ende, für diesmal war alles zu Ende, man war sicher, daß heute nichts mehr geschehen, keine Erschütterungen sich mehr ereignen, keine Zumutungen an die Herzmuskulatur mehr gestellt werden würden. Zugleich aber war man sicher, daß morgen dies alles mit all der Wahrscheinlichkeit, die sich aus der Enge, Gunst und Regelmäßigkeit der Umstände ergab, wieder der Fall sein und von vorn beginnen werde; und diese doppelte Sicherheit und Geborgenheit war überaus behaglich, sie gestaltete zusammen mit der Musik und der wiedergefundenen Würze Marias die Abendliegekur für Hans Castorp zu einer wahrhaft glücklichen Lebenslage.
Das alles nun aber hatte also nicht gehindert, daß der Hospitant und weiche Neuling sich in der Liegekur (oder wie und wo nun immer) tüchtig erkältet hatte. Ein schwerer Schnupfen schien im Anzuge, er saß ihm in der Stirnhöhle und drückte, das Zäpfchen im Halse war weh und wund, die Luft ging ihm nicht wie sonst durch den von der Natur hierzu vorgesehenen Kanal, sondern strich kalt, behindert und Hustenkrampf unaufhörlich erregend hindurch; seine Stimme hatte über Nacht die Klangfarbe eines dumpfen und wie von starken Getränken verbrannten Basses angenommen, und seiner Aussage nach hatte er in eben dieser Nacht kein Auge zugetan, da eine erstickende Trockenheit des Schlundes ihn je und je hatte vom Kissen auffahren lassen.
„Höchst ärgerlich,“ sagte Joachim, „ist das und beinahe peinlich. Erkältungen, mußt du wissen, sind hier nicht reçus, man leugnet sie, sie kommen offiziell bei der großen Lufttrockenheit nicht vor, und als Patient würde man übel anlaufen bei Behrens, wenn man sich erkältet melden wollte. Aber bei dir ist es ja etwas anderes, du hast am Ende das Recht dazu. Es wäre doch gut, wenn wir den Katarrh noch abschneiden könnten, im Flachlande kennt man ja Praktiken, hier aber – ich zweifle, ob man sich hier genügend dafür interessieren wird. Krank soll man hier lieber nicht werden, es kümmert sich niemand darum. Das ist eine alte Lehre, du erfährst es nun auch noch zu guter Letzt. Als ich ankam, war hier eine Dame, die hielt sich die ganze Woche ihr Ohr und jammerte über Schmerzen, und schließlich sah Behrens es an. ‚Sie können ganz beruhigt sein,‘ sagt’ er, ‚tuberkulös ist es nicht.‘ Dabei hatte es sein Bewenden. Ja, wir müssen sehn, was sich tun läßt. Ich werde es morgen früh dem Bademeister sagen, wenn er zu mir kommt. Das ist der Dienstweg, und er wird es schon weitergeben, so daß dann doch vielleicht etwas für dich geschieht.“
So Joachim; und der Dienstweg bewährte sich. Schon als Hans Castorp am Freitag von der Morgenmotion in sein Zimmer zurückkehrte, klopfte es bei ihm, und es ergab sich für ihn die persönliche Bekanntschaft mit dem Fräulein von Mylendonk oder der „Frau Oberin“, wie sie genannt wurde, – bisher hatte er die offenbar Vielbeschäftigte immer nur von weitem erblickt, wie sie, aus einem Krankenzimmer kommend, den Korridor überquerte, um in ein gegenüberliegendes einzutreten, oder sie flüchtig im Speisesaal auftauchen sehen und ihre quäkende Stimme vernommen. Nun also galt ihm selbst ihr Besuch; durch seinen Katarrh herbeigezogen, klopfte sie knöchern hart und kurz an seine Stubentür und trat ein, fast bevor er Herein gesagt, indem sie sich auf der Schwelle noch einmal zurückbeugte, um sich der Zimmernummer gewiß zu machen.
„Dreiundvierzig“, quäkte sie ungedämpft. „Es stimmt. Menschenskind, on me dit, que vous avez pris froid, I hear, you have caught a cold, Wy, kaschetsja, prostudilisj, ich höre, Sie sind erkältet? Wie soll ich reden mit Ihnen? Deutsch, ich sehe schon. Ach, der Besuch vom jungen Ziemßen, ich sehe schon. Ich muß in den Operationssaal. Da ist einer, der wird chloroformiert und hat Bohnensalat gegessen. Wenn man seine Augen nicht überall hat ... Und Sie, Menschenskind, wollen sich hier erkältet haben?“
Hans Castorp war verblüfft über diese Redeweise einer altadligen Dame. Während sie sprach, ging sie über ihre eigenen Worte hinweg, indem sie unruhig, in rollender, schleifenförmiger Bewegung den Kopf mit suchend erhobener Nase hin und her wandte, wie Raubtiere im Käfig tun, und ihre sommersprossige Rechte, leicht geschlossen und den Daumen nach oben, vor sich im Handgelenk schlenkerte, als wollte sie sagen: „Rasch, rasch, rasch! Hören Sie nicht auf das, was ich sage, sondern reden Sie selbst, daß ich fortkomme!“ Sie war eine Vierzigerin, kümmerlichen Wuchses, ohne Formen, angetan mit einem weißen, gegürteten, klinischen Schürzenkleid, auf dessen Brust ein Granatkreuz lag. Unter ihrer Schwesternhaube kam spärliches rötliches Haar hervor, ihre wasserblauen, entzündeten Augen, an deren einem zum Überfluß ein in der Entwicklung sehr weit vorgeschrittenes Gerstenkorn saß, waren unsteten Blicks, die Nase aufgeworfen, der Mund froschmäßig, außerdem mit schief vorstehender Unterlippe, die sie beim Sprechen schaufelnd bewegte. Indessen Hans Castorp betrachtete sie mit all der bescheiden duldsamen und vertrauensvollen Menschenfreundlichkeit, die ihm angeboren war.
„Was ist denn das für eine Erkältung, he?“ fragte die Oberin wieder, indem sie ihre Augen durchdringend zu machen suchte, was aber nicht gelang, da sie abschweiften. „Wir lieben solche Erkältungen nicht. Sind Sie öfter erkältet? War Ihr Vetter nicht auch so oft erkältet? Wie alt sind Sie denn? Vierundzwanzig? Das Alter hat’s in sich. Und nun kommen Sie hier herauf und sind erkältet? Wir sollten hier nicht von ‚Erkältung‘ reden, geehrtes Menschenskind, das ist so ein Schnickschnack von unten. (Das Wort „Schnickschnack“ nahm sich ganz abscheulich und abenteuerlich aus in ihrem Munde, wie sie es mit der Unterlippe schaufelnd hervorbrachte.) Sie haben den wunderschönsten Katarrh der Luftwege, das gebe ich zu, das sieht man Ihnen an den Augen an – (Und wieder machte sie den sonderbaren Versuch, ihm durchdringend in die Augen zu blicken, ohne daß es ihr recht gelingen wollte.) Aber Katarrhe kommen nicht von der Kälte, sondern sie kommen von einer Infektion, für die man aufnahmelustig war, und es fragt sich nur, ob eine unschuldige Infektion vorliegt oder eine weniger unschuldige, alles andere ist Schnickschnack. (Schon wieder das schauderhafte „Schnickschnack“!) Ist ja möglich, daß Ihre Aufnahmelustigkeit mehr zum Harmlosen neigt“, sagte sie und sah ihn an mit ihrem vorgeschrittenen Gerstenkorn, er wußte nicht, wie. „Hier haben Sie ein harmloses Antiseptikum. Wird Ihnen möglicherweise gut tun.“ Und sie holte aus der schwarzen Ledertasche, die ihr am Gürtel hing, ein Päckchen hervor, das sie auf den Tisch stellte. Es war Formamint. „Übrigens sehen Sie angeregt aus; als ob Sie Hitze hätten.“ Und sie ließ nicht ab, ihm in das Gesicht zu blicken, aber immer mit etwas beiseite gehenden Augen. „Haben Sie sich gemessen?“
Er verneinte.
„Warum nicht?“ fragte sie und ließ ihre schräg vorgeschobene Unterlippe in der Luft stehen ...
Er verstummte. Der Gute war noch so jung, er hatte sich noch das Verstummen des Schuljungen bewahrt, der in der Bank steht, nichts weiß und schweigt.
„Messen Sie sich etwa überhaupt nie?“
„Doch, Frau Oberin. Wenn ich Fieber habe.“
„Menschenskind, man mißt sich in erster Linie, um zu sehen, ob man Fieber hat. Und jetzt haben Sie Ihrer Meinung nach keins?“
„Ich weiß nicht recht, Frau Oberin; ich kann es nicht recht unterscheiden. Ein bißchen heiß und frostig bin ich schon seit meiner Ankunft hier oben.“
„Aha. Und wo haben Sie Ihr Thermometer?“
„Ich habe keins bei mir, Frau Oberin. Wozu, ich bin ja nur zu Besuch hier, ich bin gesund.“
„Schnickschnack! Haben Sie mich gerufen, weil Sie gesund sind?“
„Nein,“ lachte er höflich, „sondern weil ich mich etwas –“
„– Erkältet habe. Solche Erkältungen sind uns schon öfter vorgekommen. Hier!“ sagte sie und kramte wieder in ihrer Tasche, um zwei längliche Lederetuis zum Vorschein zu bringen, ein schwarzes und ein rotes, die sie ebenfalls auf den Tisch legte. „Dieser hier kostet drei Franken fünfzig und der hier fünf Franken. Besser fahren Sie natürlich mit dem zu fünf. Das ist etwas fürs Leben, wenn Sie ordentlich damit umgehen.“
Er nahm lächelnd das rote Etui vom Tisch und öffnete es. Schmuck wie ein Geschmeide lag das gläserne Gerät in die genau nach seiner Figur ausgesparte Vertiefung der roten Samtpolsterung gebettet. Die ganzen Grade waren mit roten, die Zehntelgrade mit schwarzen Strichen markiert. Die Bezifferung war rot, der untere, verjüngte Teil mit spiegelig glänzendem Quecksilber gefüllt. Die Säule stand tief und kühl, weit unter dem Normalgrade tierischer Wärme.
Hans Castorp wußte, was er sich und seinem Ansehen schuldig war.
„Ich nehme diesen“, sagte er, ohne dem anderen nur Beachtung zu schenken. „Den hier zu fünf. Darf ich Ihnen sofort ...“
„Abgemacht!“ quäkte die Oberin. „Nur nicht knausern bei wichtigen Anschaffungen! Eilt nicht, es kommt auf die Rechnung. Geben Sie her, wir wollen ihn erst noch recht klein machen, ganz hinunterjagen – so.“ Und sie nahm ihm das Thermometer aus der Hand, stieß es wiederholt in die Luft und trieb so das Quecksilber noch tiefer, bis unter 35 hinab. „Wird schon steigen, wird schon emporwandern, der Merkurius!“ sagte sie. „Hier haben Sie Ihre Erwerbung! Sie wissen doch wohl, wie es gemacht wird bei uns? Unter die werte Zunge damit, auf sieben Minuten, viermal am Tag, und gut die geschätzten Lippen drum schließen. Adieu, Menschenskind! Wünsche gute Ergebnisse!“ Und sie war aus dem Zimmer.
Hans Castorp, der sich verbeugt hatte, stand am Tische und sah auf die Tür, durch die sie verschwunden war, und auf das Instrument, das sie zurückgelassen. „Das war nun die Oberin von Mylendonk“, dachte er. „Settembrini mag sie nicht, und wahr ist es, sie hat ihre Unannehmlichkeiten. Das Gerstenkorn ist nicht schön, übrigens hat sie es ja wohl nicht immer. Aber warum nennt sie mich immer ‚Menschenskind‘, noch dazu mit einem s in der Mitte? Es ist burschikos und sonderbar. Und da hat sie mir nun ein Thermometer verkauft, sie hat immer ein paar in der Tasche. Es soll ja hier überall welche geben, in allen Läden, auch da, wo man es gar nicht erwarten sollte, Joachim sagte es. Aber ich habe mich nicht zu bemühen brauchen, es ist mir von selbst in den Schoß gefallen.“ Er nahm das zierliche Gerät aus dem Futteral, betrachtete es und ging dann mehrmals in Unruhe damit durch das Zimmer. Sein Herz klopfte rasch und stark. Er sah sich nach der offenen Balkontür um und machte eine Bewegung gegen die Zimmertür, aus dem Antriebe, Joachim aufzusuchen, unterließ es aber dann und blieb wieder am Tische stehen, indem er sich räusperte, um die Dumpfheit seiner Stimme zu prüfen. Hierauf hustete er. „Ja, ich muß nun sehn, ob ich Schnupfenfieber habe“, sagte er und führte rasch das Thermometer in den Mund, die Quecksilberspitze unter die Zunge, so daß das Instrument ihm schräg aufwärts zwischen den Lippen hervorragte, die er fest darum schloß, um keine Außenluft zuzulassen. Dann sah er nach seiner Armbanduhr: es war sechs Minuten nach halb zehn. Und er begann, auf den Ablauf von sieben Minuten zu warten.
„Keine überflüssige Sekunde,“ dachte er, „und keine zu wenig. Auf mich ist Verlaß, nach oben wie nach unten. Man braucht ihn mir nicht mit einer Stummen Schwester zu vertauschen, wie der Person, von der Settembrini erzählte, Ottilie Kneifer.“ Und er ging im Zimmer umher, das Instrument mit der Zunge niederdrückend.
Die Zeit schlich, die Frist schien endlos. Erst zweiundeinehalbe Minute waren verstrichen, als er nach den Zeigern sah, schon besorgt, er könnte den Augenblick verpassen. Er tat tausend Dinge, nahm Gegenstände auf und setzte sie nieder, trat auf den Balkon hinaus, ohne sich seinem Vetter bemerklich zu machen, überblickte die Landschaft, dies Hochtal, seinem Sinn schon urvertraut in allen Gestaltungen: mit seinen Hörnern, Kammlinien und Wänden, mit der links vorgelagerten Kulisse des „Brembühl“, dessen Rücken schräg gegen den Ort hin abfiel und dessen Flanke der rauhe Mattenwald bedeckte, mit den Bergformationen zur Rechten, deren Namen ihm ebenfalls geläufig geworden waren, und der Alteinwand, die das Tal, von hier aus gesehen, im Süden zu schließen schien, – sah hinab auf die Wege und Beete der Gartenplattform, die Felsengrotte, die Edeltanne, lauschte auf ein Flüstern, das aus der Liegehalle drang, wo Kur gemacht wurde, und wandte sich ins Zimmer zurück, wobei er die Lage des Instrumentes im Munde zu verbessern suchte, um dann wieder durch Vorrecken des Armes den Ärmel vom Handgelenk zu ziehen und den Unterarm vor das Gesicht zu biegen. Mit Mühe und Anstrengung, unter Schieben, Stoßen und Fußtritten gleichsam, waren sechs Minuten vertrieben. Da er nun aber, mitten im Zimmer stehend, ins Träumen verfiel und seine Gedanken wandern ließ, so verhuschte die letzte noch übrige ihm unvermerkt auf Katzenpfötchen, eine neue Armbewegung offenbarte ihm ihr heimliches Entkommen, und es war ein wenig zu spät, die achte lag schon zu einem Dritteile im Vergangenen, als er mit dem Gedanken, daß das nichts schade, für das Ergebnis nichts ausmache und zu bedeuten habe, das Thermometer aus dem Munde riß und mit verwirrten Augen darauf niederstarrte.
Er ward nicht unmittelbar klug aus seiner Angabe, der Glanz des Quecksilbers fiel mit dem Lichtreflex des flachrunden Glasmantels zusammen, die Säule schien bald ganz hoch oben zu stehen, bald überhaupt nicht vorhanden zu sein, er führte das Instrument nahe vor die Augen, drehte es hin und her und erkannte nichts. Endlich, nach einer glücklichen Wendung, wurde das Bild ihm deutlich, er hielt es fest und bearbeitete es hastig mit dem Verstande. In der Tat, Merkurius hatte sich ausgedehnt, er hatte sich stark ausgedehnt, die Säule war ziemlich hoch gestiegen, sie stand mehrere Zehntelstriche über der Grenze normaler Blutwärme, Hans Castorp hatte 37,6.
Am hellen Vormittag zwischen zehn und halb elf Uhr 37,6, – das war zuviel, es war „Temperatur“, Fieber als Folge einer Infektion, für die er aufnahmelustig gewesen, und es fragte sich nur, was für eine Art Infektion das war. 37,6, – mehr hatte auch Joachim nicht, mehr hatte hier niemand, der nicht als schwerkrank oder moribund das Bett hütete, weder die Kleefeld mit dem Pneumothorax noch ... noch auch Madame Chauchat. Es war natürlich in seinem Falle wohl nicht ganz das Rechte, – bloßes Schnupfenfieber, wie man es unten nannte. Aber genau zu unterscheiden und auseinanderzuhalten war das nicht, Hans Castorp bezweifelte, daß er diese Temperatur erst bekommen, seit er sich erkältet hatte, und er mußte bedauern, Merkurius nicht schon früher befragt zu haben, gleich anfangs, wie der Hofrat es ihm nahegelegt hatte. Ganz vernünftig war dieser Ratschlag gewesen, das zeigte sich nun, und Settembrini hatte völlig unrecht getan, so höhnisch darüber in die Lüfte zu lachen, – Settembrini mit der Republik und dem schönen Stil. Hans Castorp verachtete die Republik und den schönen Stil, während er immer wieder die Aussage des Thermometers prüfte, die ihm mehrmals durch die Blendung verloren ging und die er dann durch eifriges Drehen und Wenden des Instruments wieder herstellte: sie lautete auf 37,6, und das am frühesten Vormittag!
Seine Bewegung war mächtig. Er ging ein paarmal durch das Zimmer, das Thermometer in der Hand, wobei er es jedoch wagerecht hielt, um nicht durch senkrechte Erschütterung eine Störung hervorzurufen, legte es dann mit aller Bewahrsamkeit auf die Waschtischplatte nieder und ging vorerst einmal mit Paletot und Decken in die Liegekur. Sitzend warf er die Decken um sich, wie er es gelernt hatte, von den Seiten und von unten, eine nach der anderen, mit schon geübter Hand, und lag dann still, die Stunde des zweiten Frühstücks und Joachims Eintritt erwartend. Zuweilen lächelte er, und es war, als lächle er jemandem zu. Zuweilen hob sich seine Brust mit einem beklommenen Beben, und dann mußte er husten aus seiner katarrhalischen Brust.
Joachim fand ihn noch liegend, als er um elf Uhr, nach dem Tönen des Gongs, zu ihm herüberkam, um ihn zum Frühstück abzuholen.
„Nun?“ fragte er verwundert, indem er neben den Stuhl trat ...
Hans Castorp schwieg noch eine Weile und sah vor sich hin. Dann gab er zur Antwort:
„Ja, das Neueste ist also, daß ich etwas Temperatur habe.“
„Was soll das heißen?“ fragte Joachim. „Fühlst du dich fiebrig?“
Hans Castorp ließ wieder ein wenig auf die Antwort warten und gab hierauf mit einer gewissen Trägheit die folgende:
„Fiebrig, mein Lieber, fühle ich mich schon längst, schon die ganze Zeit. Aber jetzt handelt es sich nicht um subjektive Empfindungen, sondern um eine exakte Feststellung. Ich habe mich gemessen.“
„Du hast dich gemessen?! Womit?!“ rief Joachim erschrocken.
„Selbstverständlich mit einem Thermometer“, antwortete Hans Castorp nicht ohne Spott und Strenge. „Die Oberin hat mir eines verkauft. Warum sie einen immer ‚Menschenskind‘ anredet, das weiß ich nicht; korrekt ist es nicht. Aber ein sehr gutes Thermometer hat sie mir in aller Eile verkauft, und wenn du dich überzeugen willst, wieviel es zeigt, so liegt es da drinnen auf dem Waschtisch. Es ist eine minimale Erhöhung.“
Joachim machte kurz kehrt und ging ins Zimmer. Als er zurückkehrte, sagte er zögernd:
„Ja, das sind 37 Komma 5½.“
„Dann ist es etwas zurückgegangen!“ versetzte Hans Castorp rasch. „Es waren sechs.“
„Keinesfalls kann man das minimal nennen für den Vormittag“, sagte Joachim. „Eine schöne Bescherung“, sagte er und stand an seines Vetters Lager, wie man eben vor einer „schönen Bescherung“ steht, die Arme in die Seiten gestemmt und mit gesenktem Kopfe. „Du wirst ins Bett müssen.“
Hans Castorp hatte darauf seine Antwort bereit.
„Ich sehe nicht ein,“ sagte er, „warum ich mich mit 37,6 ins Bett legen soll, wo doch du und so viele andere, die auch nicht weniger haben, – wo ihr alle hier frei herumlauft.“
„Das ist aber doch etwas anderes“, sagte Joachim. „Bei dir ist es akut und harmlos. Du hast Schnupfenfieber.“
„Erstens,“ erwiderte Hans Castorp und teilte seine Rede nun sogar in erstens und zweitens ein, „verstehe ich nicht, warum man mit harmlosem Fieber – ich will einmal annehmen, daß es so etwas gibt – mit harmlosem Fieber das Bett hüten muß, mit anderem aber nicht. Und zweitens sage ich dir ja, daß der Schnupfen mich nicht heißer gemacht hat, als ich schon vorher war. Ich stehe auf dem Standpunkt,“ schloß er, „daß 37,6 gleich 37,6 ist. Könnt ihr damit herumlaufen, kann ich es auch.“
„Ich habe aber vier Wochen liegen müssen, als ich ankam,“ wandte Joachim ein; „und erst als sich zeigte, daß die Temperatur durch Bettruhe nicht verschwand, durfte ich aufstehen.“
Hans Castorp lächelte.
„Nun und?“ fragte er. „Ich denke, bei dir war es etwas anderes? Mir scheint, du verwickelst dich in Widersprüche. Erst unterscheidest du, und dann stellst du gleich. Das ist doch Schnickschnack ...“
Joachim drehte sich auf dem Absatz um, und als er sich seinem Vetter wieder zukehrte, sah man, daß sein gebräuntes Gesicht noch eine Schattierung dunkler geworden war.
„Nein,“ sagte er, „ich stelle nicht gleich, du bist ein Konfusionsrat. Ich meine nur, du bist elend erkältet, man hört es ja an deiner Stimme, und du solltest dich legen, um den Prozeß abzukürzen, da du nächste Woche nach Hause willst. Wenn du aber nicht willst, – ich meine: wenn du dich nicht legen willst, so kannst du es ja lassen. Ich mache dir keine Vorschriften. Jedenfalls müssen wir jetzt zum Frühstück. Mach, es ist über die Zeit!“
„Richtig. Los!“ sagte Hans Castorp und warf die Decken von sich. Er ging ins Zimmer, um sich mit der Bürste übers Haar zu fahren, und während er es tat, sah Joachim noch einmal nach dem Thermometer auf dem Waschtisch, wobei Hans Castorp ihn von weitem beobachtete. Dann gingen sie, schweigend, und saßen wieder einmal an ihren Plätzen im Speisesaal, wo es, wie immer um diese Stunde, weiß schimmerte vor lauter Milch.
Als die Zwergin das Kulmbacher Bier für Hans Castorp brachte, lehnte er es mit ernstem Verzichte ab. Er trinke heute lieber kein Bier, trinke überhaupt nichts, nein, danke sehr, höchstens einen Schluck Wasser. Das erregte Aufsehen. Wieso? Was für Neuerungen! Warum kein Bier? – Er habe ein bißchen Temperatur, warf Hans Castorp hin. 37,6. Minimal.
Da drohten sie ihm mit den Zeigefingern, – es war sehr sonderbar. Sie wurden schelmisch, legten den Kopf auf die Seite, kniffen ein Auge zu und rührten die Zeigefinger in Höhe des Ohres, als kämen kecke, pikante Dinge an den Tag von einem, der den Unschuldigen gespielt hatte. „Na, na, Sie“, sagte die Lehrerin, und der Flaum ihrer Wangen rötete sich, indes sie lächelnd drohte. „Saubere Geschichten hört man, ausgelassene. Wart, wart, wart.“ – „Ei, ei, ei“, machte auch Frau Stöhr und drohte mit ihrem kurzen und roten Stummel, indem sie ihn neben die Nase hielt. „Tempus hat er, der Herr Besuch. Sie sind mir einer, – der Rechte sind Sie mir, ein Bruder Lustig!“ – Selbst die Großtante am oberen Tischende drohte ihm scherzhaft und verschlagen zu, als die Nachricht zu ihr drang; die hübsche Marusja, die ihm bisher kaum je Beachtung geschenkt, beugte sich gegen ihn vor und sah ihn, das Apfelsinentüchlein gegen die Lippen gepreßt, mit ihren kugelrunden braunen Augen an, indes sie drohte; auch Dr. Blumenkohl, dem Frau Stöhr die Sache erzählte, konnte nicht umhin, sich der allgemeinen Gebärde anzuschließen, ohne freilich Hans Castorp dabei anzusehen, und nur Miß Robinson zeigte sich teilnahmslos und verschlossenen Sinnes wie immer. Joachim hielt mit anständiger Miene die Augen gesenkt.
Hans Castorp, geschmeichelt von so viel Neckerei, glaubte bescheiden ablehnen zu müssen. „Nein, nein,“ sagte er, „Sie irren sich, mein Fall ist der denkbar harmloseste, ich habe Schnupfen, Sie sehen: die Augen gehen mir über, meine Brust ist verstockt, ich huste die halbe Nacht, es ist unangenehm genug ...“ Aber sie nahmen seine Entschuldigungen nicht an, sie lachten und winkten ihm mit den Händen ab, rufend: „Ja, ja, ja, Flausen, Ausreden, Schnupfenfieber, kennen wir, kennen wir!“ Und dann forderten sie alle auf einmal, daß Hans Castorp sich unverzüglich zur Untersuchung melde. Sie waren belebt von der Nachricht; unter den sieben Tischen war an diesem während des Frühstücks die Unterhaltung am muntersten. Frau Stöhr insbesondere, hochroten, störrischen Gesichts über ihrer Halsrüsche und kleine Sprünge in der Wangenhaut, legte eine fast wilde Gesprächigkeit an den Tag und erging sich über die Vergnüglichkeit des Hustens, – ja, es habe unbedingt eine unterhaltliche und genußreiche Bewandtnis damit, wenn in den Gründen der Brust der Kitzel sich mehre und wachse und man mit Krampf und Pressung so recht tief hinunterlange, um dem Reiz zu genügen: ein ähnlicher Spaß sei das wie das Niesen, wenn die Lust dazu gewaltig anschwelle und unwiderstehlich werde und man mit berauschter Miene ein paarmal stürmisch aus- und einatme, sich wonnig ergäbe und über dem gesegneten Ausbruch die ganze Welt vergäße. Und manchmal komme es zwei-, dreimal hintereinander. Das seien kostenfreie Genüsse des Lebens, wie beispielsweise auch noch, sich im Frühling die Frostbeulen zu kratzen, wenn sie so süßlich juckten, – sich so recht innig und grausam zu kratzen bis aufs Blut in Wut und Vergnügen, und wenn man zufällig in den Spiegel sähe dabei, dann sähe man eine Teufelsfratze.
So schauderhaft eingehend redete die ungebildete Stöhr, bis die kurze, wenn auch reichhaltige Zwischenmahlzeit beendigt war und die Vettern ihren zweiten Vormittagsgang antraten, den Gang hinunter nach Platz Davos. Joachim war in sich gekehrt unterwegs, und Hans Castorp ächzte vor Schnupfen und räusperte sich aus rostiger Brust. Auf dem Heimwege sagte Joachim:
„Ich mache dir einen Vorschlag. Heute ist Freitag, – morgen nach Tische habe ich Monatsuntersuchung. Es ist keine Generaluntersuchung, aber Behrens klopft mich ein bißchen ab und läßt Krokowski ein paar Notizen machen. Da könntest du mitkommen und bitten, dich auch bei der Gelegenheit rasch zu behorchen. Es ist ja lächerlich, – wenn du zu Hause wärst, du ließest Heidekind kommen. Und hier, wo zwei Spezialisten im Hause sind, läufst du herum und weißt nicht, woran du bist, und wie tief es sitzt bei dir, und ob du nicht besser tätest, dich hinzulegen.“
„Schön“, sagte Hans Castorp. „Wie du meinst. Natürlich, so kann ich es machen. Und es ist ja auch interessant für mich, mal einer Untersuchung beizuwohnen.“
So kamen sie überein; und als sie hinauf vor das Sanatorium gelangten, wollte es der Zufall, daß sie mit Hofrat Behrens persönlich zusammentrafen und günstige Gelegenheit fanden, stehenden Fußes ihr Anliegen vorzubringen.
Behrens kam aus dem Vorbau, lang und hochnackig, einen steifen Hut auf dem Hinterkopf und eine Zigarre im Munde, blaubackig und quelläugig, so recht im Zuge der Tätigkeit, im Begriffe, seiner Privatpraxis nachzugehen, Besuche im Ort zu machen, nachdem er soeben im Operationssaal am Werke gewesen, wie er erklärte.
„Mahlzeit, die Herren!“ sagte er. „Immer auf der Walze? War wohl fein in der großen Welt? Ich komme gerade von einem ungleichen Zweikampf auf Messer und Knochensäge, – große Sache, wissen Sie, Rippenresektion. Früher blieben fünfzig Prozent dabei auf dem Tisch des Hauses. Jetzt haben wirs besser raus, aber öfters muß man doch mortis causa vorzeitig einpacken. Na, der von heute konnte ja Spaß verstehen, blieb für den Augenblick ganz stramm bei der Stange ... Doll, so ein Menschenthorax, der keiner mehr ist. Weichteil, wissen Sie, unkleidsam, leichte Trübung der Idee, sozusagen. Na, und Sie? Was macht die werte Befindität? Ist wohl ein fidelerer Lebenswandel zu zweien, was, Ziemßen, alter Schlauberger? Warum weinen Sie denn, Sie Vergnügungsreisender?“ wandte er sich auf einmal an Hans Castorp. „Öffentliches Weinen ist hier nicht erlaubt. Hausordnungsverbot. Da könnte jeder kommen.“
„Das ist mein Schnupfen, Herr Hofrat“, antwortete Hans Castorp. „Ich weiß nicht, wie es möglich war, aber ich habe mir einen enormen Katarrh geholt. Husten habe ich auch, und ordentlich auf der Brust liegt es mir.“
„So?“ sagte Behrens. „Dann sollten Sie mal einen verständigen Arzt zu Rate ziehen.“
Die beiden lachten, und Joachim antwortete, indem er die Absätze zusammenzog:
„Wir sind im Begriffe, Herr Hofrat. Ich habe ja morgen Untersuchung, und da wollten wir fragen, ob Sie die Güte hätten, auch meinen Vetter gleich einmal dranzunehmen. Es handelt sich darum, ob er Dienstag wird reisen können ...“
„M. w.!“ sagte Behrens. „M. w. m. F.! Machen wir mit Vergnügen! Hätten wir längst mal machen sollen. Wenn man schon hier ist, soll man das immer mitnehmen. Aber man mag sich ja natürlich nicht aufdrängen. Also morgen um zwei, gleich wenn Sie von der Krippe kommen!“
„Denn ich habe nämlich auch etwas Fieber“, merkte Hans Castorp noch an.
„Was Sie sagen!“ rief Behrens. „Sie wollen mir wohl Neuigkeiten erzählen? Glauben Sie, ich habe keine Augen im Kopf?“ Und er deutete mit dem gewaltigen Zeigefinger auf seine beiden blutunterlaufenen, blau quellenden, tränenden Augäpfel. „Wieviel ist es denn übrigens?“
Hans Castorp nannte bescheiden die Ziffer.
„Vormittags? Hm, nicht übel. Für den Anfang gar nicht so unbegabt. Na, also paarweise angetreten morgen um zwei! Soll mir eine Auszeichnung sein. Gesegnete Nahrungsaufnahme!“ Und mit krummen Knien und rudernden Händen begann er den abschüssigen Weg hinabzustapfen, indes eine Rauchfahne von seiner Zigarre rückwärts wehte.
„Das wäre also nach deinem Wunsche verabredet“, sagte Hans Castorp. „Glücklicher konnte es sich ja gar nicht treffen, und nun bin ich gemeldet. Er wird ja weiter auch nicht viel tun können in der Sache, als mir vielleicht einen Lakritzensaft oder Brusttee verschreiben, aber angenehm ist es doch, ein bißchen ärztlichen Zuspruch zu haben, wenn man sich fühlt wie ich. Aber warum er nur immer so unmäßig forsch daherredet!“ sagte er. „Anfangs machte es mir Spaß, aber auf die Länge ist es mir unlieb. ‚Gesegnete Nahrungsaufnahme‘! Was für ein Kauderwelsch. Man kann sagen: ‚Gesegnete Mahlzeit‘! denn ‚Mahlzeit‘ ist ein poetisches Wort sozusagen, wie ‚tägliches Brot‘, und verträgt sich ganz gut mit ‚gesegnet‘. Aber ‚Nahrungsaufnahme‘ ist ja die reine Physiologie, und dazu Segen zu wünschen, das ist doch ein höhnisches Gerede. Ich sehe es auch nicht gern, wenn er raucht, es hat etwas Beängstigendes für mich, weil ich weiß, daß es ihm nicht bekommt und ihn melancholisch macht. Settembrini sagte von ihm, seine Lustigkeit sei gezwungen, und Settembrini ist ein Kritiker, ein Mann des Urteils, das muß man ihm lassen. Ich sollte vielleicht auch mehr urteilen und nicht alles nehmen, wie es ist, er hat ganz recht. Aber manchmal fängt man mit Urteil und Tadel und gerechtem Ärgernis an, und dann kommt ganz anderes dazwischen, was mit Urteilen gar nichts zu tun hat, und dann ist es aus mit der Sittenstrenge, und die Republik und der schöne Stil kommen einem auch nur noch abgeschmackt vor ...“
Er murmelte Undeutliches, schien selbst nicht ganz klar über das, was er meinte. Auch sah ihn sein Vetter denn nur von der Seite an und sagte „Auf Wiedersehn“, worauf ein jeder auf sein Zimmer und in seine Balkonloge ging.
„Wieviel?“ fragte Joachim nach einer Weile gedämpft, obgleich er nicht gesehen, daß Hans Castorp sein Thermometer wieder zu Rate gezogen hatte ... Und Hans Castorp antwortete gleichgültigen Tones:
„Nichts Neues.“
Wirklich hatte er gleich bei seinem Eintritt seinen zierlichen Erwerb von heute morgen vom Waschtisch genommen, hatte die 37,6, die nun ihre Rolle ausgespielt hatten, durch senkrechte Stöße zerstört und sich ganz wie ein Alter, die gläserne Zigarre im Munde, in die Liegekur verfügt. Aber allzu hochfliegenden Erwartungen entgegen und obgleich er das Instrument volle acht Minuten unter der Zunge behalten, hatte Merkurius sich nicht weiter ausgedehnt, als wieder nur bis 37,6, – was ja übrigens Fieber war, wenn auch kein höheres, als schon am früheren Vormittage vorhanden gewesen. Nach Tische stieg das schimmernde Säulchen auf 37,7, verharrte abends, als der Patient nach den Erregungen und Neuigkeiten des Tages sehr müde war, auf 37,5, und zeigte in der nächsten Morgenfrühe gar nur auf 37, um gegen Mittag die gestrige Höhe wieder zu erreichen. Unter diesen Ergebnissen kam die Hauptmahlzeit des folgenden Tages und mit ihrer Beendigung die Stunde des Rendezvous heran.
Hans Castorp erinnerte sich später, daß Madame Chauchat während dieser Mahlzeit einen goldgelben Sweater mit großen Knöpfen und bordierten Taschen getragen hatte, der neu, jedenfalls neu für Hans Castorp gewesen war, und worin sie bei ihrem wie immer verspäteten Eintritt, in der Art, die Hans Castorp so wohl an ihr kannte, einen Augenblick Front gegen den Saal gemacht hatte. Dann war sie, wie täglich fünfmal, zu ihrem Tische geglitten, hatte sich mit weichen Bewegungen niedergelassen und plaudernd zu essen begonnen: Hans Castorp hatte, wie jeden Tag, aber doch mit besonderer Aufmerksamkeit, ihren Kopf sich beim Sprechen bewegen sehen und aufs neue die Rundung ihres Nackens, die schlaffe Haltung ihres Rückens bemerkt, wenn er hinter dem Settembrinis vorbei, der am Ende des schräg zwischenstehenden Tisches saß, zum Guten Russentisch hinübergeblickt hatte. Frau Chauchat ihrerseits hatte sich während des Mittagessens kein einziges Mal nach dem Saale umgeblickt. Als aber der Nachtisch eingenommen gewesen war und die große Ketten- und Pendeluhr an der rechten Schmalseite des Saals, dort, wo der Schlechte Russentisch stand, zwei geschlagen hatte, da war es zu Hans Castorps rätselhafter Erschütterung dennoch geschehen: während die Uhr zwei schlug – eins und zwei – hatte die anmutige Kranke langsam den Kopf und ein wenig auch den Oberkörper gewandt und über die Schulter deutlich und unverhohlen zu Hans Castorps Tische – und nicht nur im allgemeinen zu seinem Tische, nein, unmißverständlich und streng persönlich zu ihm herübergeblickt, ein Lächeln um die geschlossenen Lippen und in ihren schmalgeschnittenen Pribislav-Augen, als wollte sie sagen: „Nun? Es ist Zeit. Wirst du gehen?“ (denn wenn nur die Augen sprechen, geht ja die Rede per Du, auch wenn der Mund noch nicht einmal „Sie“ gesagt hat) – und das war ein Zwischenfall gewesen, der Hans Castorp in tiefster Seele verwirrt und entsetzt hatte, – kaum hatte er seinen Sinnen getraut und entgeistert zuerst in Frau Chauchats Angesicht und dann, die Augen hebend, über ihre Stirn und ihr Haar hin ins Leere geblickt. Wußte sie denn, daß er sich auf zwei Uhr zur Untersuchung hatte bestellen lassen? Genau so hatte es ausgesehen. Und doch war es fast ebenso unwahrscheinlich, wie daß sie hätte wissen sollen, daß er soeben noch, in der jüngstvergangenen Minute, sich gefragt hatte, ob er nicht dem Hofrat durch Joachim sagen lassen sollte, seine Erkältung habe sich schon gebessert und er betrachte die Untersuchung als überflüssig: ein Gedanke, dessen Vorzüge unter jenem fragenden Lächeln freilich dahingewelkt waren und sich in lauter abstoßende Langweiligkeit verwandelt hatten. In der nächsten Sekunde hatte denn Joachim auch schon seine gerollte Serviette auf den Tisch gelegt, hatte ihm mit erhobenen Brauen zugewinkt, sich gegen die Umsitzenden verneigt und den Tisch verlassen, – worauf Hans Castorp innerlich taumelnd, wenn auch äußerlich festen Schrittes, und mit dem Gefühl, daß jenes Blicken und Lächeln immer noch auf ihm läge, dem Vetter zum Saal hinaus folgte.
Sie hatten seit gestern vormittag nicht mehr über ihr heutiges Vorhaben gesprochen, und auch jetzt gingen sie in schweigendem Einverständnis. Joachim beeilte sich: es war schon über die vereinbarte Stunde, und Hofrat Behrens bestand auf Pünktlichkeit. Es ging vom Speisesaal den ebenerdigen Korridor entlang, an der „Verwaltung“ vorbei und die reinliche, mit gebohntem Linoleum belegte Treppe zum Kellergeschoß „hinab“. Joachim klopfte an die Tür, die sich, der Treppe gleich gegenüber, durch ein Porzellanschild als Eingang zum Ordinationszimmer zu erkennen gab.
„Herein!“ rief Behrens, indem er die erste Silbe stark betonte. Er stand inmitten des Raumes, im Kittel, in der Rechten das schwarze Hörrohr, mit dem er sich gegen den Schenkel klopfte.
„Tempo, Tempo“, sagte er und richtete seine quellenden Augen auf die Wanduhr. „Un poco più presto, Signori! Wir sind nicht ganz ausschließlich für Eure Hochwohlgeboren vorhanden.“
Am doppelten Schreibtisch vorm Fenster saß Dr. Krokowski, bleich gegen sein schwarzes Lüsterhemd, die Ellenbogen auf der Platte, in der einen Hand die Feder, die andere im Bart, vor sich Papiere, wahrscheinlich den Krankenakt, und blickte den Eintretenden mit dem stumpfen Ausdruck einer Persönlichkeit, die nur assistierenderweise anwesend ist, entgegen.
„Na, her mit der Konduite!“ antwortete der Hofrat auf Joachims Entschuldigungen und nahm ihm die Fieberkurve aus der Hand, um sie durchzusehen, während der Patient sich beeilte, seinen Oberkörper freizumachen und die abgelegten Kleidungsstücke an den neben der Tür stehenden Garderobeständer zu hängen. Um Hans Castorp kümmerte man sich nicht. Er stand eine Weile zuschauend und ließ sich später auf einem altmodischen kleinen Fauteuil mit Troddeln an den Armlehnen zur Seite eines Tischchens mit Wasserkaraffe nieder. Bücherschränke mit breitrückigen medizinischen Werken und Aktenfaszikeln standen an den Wänden. An Möbeln war sonst nur noch eine mit weißem Wachstuch überzogene, höher und niedriger zu kurbelnde Chaiselongue vorhanden, über deren Kopfpolster eine Papierserviette gebreitet war.
„Komma 7, Komma 9, Komma 8“, sagte Behrens, die Wochenkarten durchblätternd, in die Joachim die Ergebnisse seiner täglich fünfmaligen Messungen treulich eingetragen. „Immer noch ein bißchen illuminiert, lieber Ziemßen, können nicht gerade behaupten, daß Sie seit neulich solider geworden sind. („Neulich“, das war vor vier Wochen gewesen.) Nicht entgiftet, nicht entgiftet“, sagte er. „Na, das geht natürlich nicht so von heute auf morgen, hexen können wir auch nicht.“
Joachim nickte und zuckte mit seinen bloßen Schultern, obgleich er hätte einwenden können, daß er ja keineswegs erst seit gestern hier oben sei.
„Wie steht es denn mit den Stichen am rechten Hilus, wo es immer verschärft klang? Besser? Na, kommen Sie her! Wollen mal höflich bei Ihnen anklopfen.“ Und die Auskultation begann.
Hofrat Behrens, breitbeinig und rückwärts geneigt, den Hörer unter dem Arme, klopfte zuerst ganz oben an Joachims rechter Schulter, klopfte aus dem Handgelenk, indem er sich des gewaltigen Mittelfingers seiner Rechten als Hammer bediente und die Linke zur Stütze gebrauchte. Dann ging er unter das Schulterblatt hinab und klopfte seitlich am mittleren und unteren Rücken, worauf Joachim, der wohlabgerichtet war, den Arm hob, um auch unter der Achsel klopfen zu lassen. Hierauf wiederholte das Ganze sich linkerseits, und damit fertig, kommandierte der Hofrat „Kehrt!“ zur Beklopfung der Brustseite. Er klopfte gleich unter dem Halse beim Schlüsselbein, klopfte über und unter der Brust, zuerst rechts und dann links. Als er aber sattsam geklopft hatte, ging er zum Horchen über, indem er sein Hörrohr, das Ohr an der Muschel, auf Joachims Brust und Rücken setzte, überallhin, wo er vorhin geklopft hatte. Dabei mußte Joachim abwechselnd stark atmen und künstlich husten, was ihn sehr anzustrengen schien, denn er geriet außer Atem, und in die Augen traten ihm Tränen. Hofrat Behrens aber meldete alles, was er dort innen hörte, dem Assistenten in kurzen, feststehenden Worten zum Schreibtisch hinüber, derart, daß Hans Castorp nicht umhin konnte, an den Vorgang beim Schneider zu denken, wenn der wohlgekleidete Herr einem zu einem Anzuge das Maß nimmt, in herkömmlicher Reihenfolge dem Besteller das Meterband da und dort um den Rumpf und an die Glieder legt und dem gebückt sitzenden Gehilfen die gewonnenen Ziffern in die Feder diktiert. „Kurz“, „verkürzt“, diktierte Hofrat Behrens. „Vesikulär“, sagte er, und abermals: „Vesikulär“ (das war gut, offenbar). „Rauh“, sagte er und schnitt ein Gesicht. „Sehr rauh.“ „Geräusch.“ Und Dr. Krokowski trug alles ein, wie der Angestellte die Ziffern des Zuschneiders.
Hans Castorp folgte den Vorgängen seitwärts geneigten Kopfes, nachdenklich versunken in die Betrachtung von Joachims Oberkörper, dessen Rippen (gottlob war er im Besitz seiner Rippen) sich beim Schnaufen unter der gespannten Haut hoch über den zurückfallenden Magen hoben, – diesem schlanken, gelblich-brünetten Jünglingsoberkörper mit den schwarzen Haaren am Brustknochen und an den übrigens kräftigen Armen, deren einer ein goldenes Kettenarmband um das Handgelenk trug. Turnerarme sind das, dachte Hans Castorp; er hat immer gern geturnt, während ich mir nichts daraus machte, und das hing mit seiner Lust zum Soldatenstande zusammen. Immer war er gut körperlich gesinnt, viel mehr als ich, oder doch auf andere Weise; denn ich war immer ein Zivilist, und es war mir mehr um warm baden und gut essen und trinken zu tun, ihm aber um männliche Anforderungen und Leistungen. Und nun ist auf so ganz andere Weise sein Körper in den Vordergrund getreten und hat sich selbständig und wichtig gemacht, nämlich durch Krankheit. Illuminiert ist er und will sich nicht entgiften und solide werden, so gern der arme Joachim auch Soldat sein möchte im Flachland. Sieh an, er ist gewachsen, wie es im Buche steht, der reine Apollo von Belvedere, bis auf die Haare. Aber innerlich ist er krank und außen zu warm vor Krankheit; denn Krankheit macht den Menschen viel körperlicher, sie macht ihn gänzlich zum Körper ... Und wie er dies dachte, erschrak er und blickte rasch und forschend von Joachims bloßem Oberleib zu seinen Augen hinauf, seinen großen, schwarzen und sanften Augen, die vom künstlichen Atmen und Husten in Tränen standen und bei der Untersuchung mit traurigem Ausdruck über den Zuschauer hin ins Leere sahen.
Unterdessen aber war Hofrat Behrens zu Ende gekommen.
„Na, is gut, Ziemßen“, sagte er. „Alles in Ordnung, so weit es möglich ist. Nächstes Mal“ (das war in vier Wochen), „wird es gewiß überall wieder ein bißchen besser sein.“
„Wie lange meinen Herr Hofrat, daß –“
„Wollen Sie schon wieder drängeln? Sie können Ihre Kerls doch nicht in angeheitertem Zustand kujonieren! Ein halbes Jährchen habe ich neulich gesagt, – rechnen Sie meinetwegen von neulich an, aber betrachten Sie es als Minimum. Schließlich läßt sich ja leben hier, Sie müssen auch höflich sein. Wir sind ja doch kein Bagno und kein ... sibirisches Bergwerk! Oder wollen Sie sagen, daß wir mit so was Ähnlichkeit haben? Is gut, Ziemßen! Wegtreten! Weiter, wer da noch Lust hat!“ rief er und sah in die Luft. Mit ausgestrecktem Arme reichte er dabei sein Hörrohr zu Dr. Krokowski hinüber, der aufstand und es ergriff, um eine kleine Assistenten-Nachprüfung bei Joachim vorzunehmen.
Auch Hans Castorp war aufgesprungen, und die Augen an die Person des Hofrats gefesselt, der, breitbeinig dastehend, offenen Mundes in Gedanken versunken schien, begann er, sich eilig in Bereitschaft zu setzen. Er überhastete sich, fand nicht gleich aus seinem punktierten Manschettenhemd heraus, als er es sich über den Kopf zog. Und dann stand er, weiß, blond und schmal, vor Hofrat Behrens, – von zivilerer Bildung schien er als Joachim Ziemßen.
Aber der Hofrat ließ ihn stehen, in Gedanken noch immer. Dr. Krokowski hatte schon wieder Platz genommen und Joachim sich ans Ankleiden gemacht, als Behrens sich endlich entschloß, von dem, der da auch noch Lust hatte, Notiz zu nehmen.
„Ach so, das wären nun Sie!“ sagte er, faßte Hans Castorp mit seiner riesigen Hand am Oberarm, rückte ihn von sich und betrachtete ihn scharf. Nicht ins Gesicht blickte er ihm, wie man einen Menschen ansieht, sondern auf den Körper; drehte ihn um, wie man einen Körper umdreht, und betrachtete auch seinen Rücken. „Hm“, sagte er. „Na, wollen mal sehen, wie Sie sich anspielen.“ Und wie vorhin begann er sein Klopfen.
Er klopfte überall, wo er es bei Joachim Ziemßen getan, und kehrte zu verschiedenen Stellen mehrmals zurück. Längere Zeit klopfte er abwechselnd und zu Vergleichszwecken links oben beim Schlüsselbein und etwas weiter unten.
„Hören Sie?“ fragte er dabei zu Dr. Krokowski hinüber ... Und Dr. Krokowski, fünf Schritte entfernt am Schreibtisch sitzend, bekundete durch eine Kopfneigung, daß er höre: ernst senkte er das Kinn auf die Brust, so daß sein Bart eingedrückt wurde und die Spitzen sich aufwärts bogen.
„Tief atmen! Husten!“ kommandierte der Hofrat, der nun das Hörrohr wieder zur Hand genommen; und Hans Castorp arbeitete schwer, wohl acht oder zehn Minuten lang, während der Hofrat ihn abhorchte. Er sprach kein Wort dabei, setzte das Hörrohr nur dahin und dorthin und horchte namentlich und wiederholt an den Punkten, wo er vorhin schon mit Klopfen verweilt hatte. Dann schob er das Instrument unter den Arm, legte die Hände auf den Rücken und blickte zwischen sich und Hans Castorp auf den Fußboden nieder.
„Ja, Castorp,“ sagte er – und es geschah zum erstenmal, daß er den jungen Mann einfach mit Nachnamen nannte –, „die Sache verhält sich so praeter-propter, wie ich sie mir schon immer gedacht hatte. Ich habe Sie auf dem Strich gehabt, Castorp, nun kann ichs Ihnen ja sagen, – von vornherein, schon seit ich zuerst die unverdiente Auszeichnung hatte, Sie kennenzulernen, – und ziemlich sicher vermutet, daß Sie im stillen ein Hiesiger wären und das auch noch einsehen würden, wie schon so mancher, der zum Spaß hier heraufkam und sich mit erhobener Nase umsah und eines Tages erfuhr, daß er gut täte – und nicht bloß ‚gut täte‘, bitte mich wohl zu verstehen – hier ganz ohne unbeteiligte Neugiersallüre eine etwas ausgiebigere Station zu machen.“
Hans Castorp hatte sich verfärbt, und Joachim, im Begriffe, sich die Hosenträger zu knöpfen, hielt inne, wie er da eben stand, und lauschte ...
„Sie haben da einen so netten, sympathischen Vetter,“ fuhr der Hofrat fort, indem er mit dem Kopfe nach Joachims Seite deutete und sich dabei auf Fußballen und Absätzen schaukelte, „– der nun ja hoffentlich bald wird sagen können, daß er einmal krank gewesen ist, aber wenn wir so weit sind, so wird er doch eben immer noch früher einmal krank gewesen sein, Ihr Herr rechter Vetter, und das wirft a priori, wie der Denker sagt, so ein gewisses Licht auch auf Sie, lieber Castorp ...“
„Er ist aber nur ein Stiefvetter von mir, Herr Hofrat.“
„Nanu, nanu. Sie werden doch Ihren Cousin nicht verleugnen wollen. Stief oder nicht, er bleibt doch immer ein Blutsverwandter. Von welcher Seite denn?“
„Von mütterlicher, Herr Hofrat. Er ist der Sohn einer Stief–“
„Und Ihre Frau Mama ist vergnügt?“
„Nein, sie ist tot. Sie starb, als ich noch klein war.“
„Oh, warum denn?“
„An einem Blutpfropf, Herr Hofrat.“
„Blutpfropf? Na, es ist ja schon lange her. Und Ihr Herr Vater?“
„Der ist an der Lungenentzündung gestorben –,“ sagte Hans Castorp, „und mein Großvater auch –“, setzte er hinzu.
„So, der auch? Na, soviel von Ihren Vorfahren. Was nun Sie betrifft, so waren Sie ja wohl immer ziemlich bleichsüchtig, nicht? Aber müde wurden Sie gar nicht leicht bei körperlicher und geistiger Arbeit? Doch? Und haben viel Herzklopfen? Neuerdings erst? Schön, und außerdem liegt ja offenbar eine lebhafte Neigung zu Katarrhen der Luftwege vor. Wissen Sie, daß Sie früher schon krank waren?“
„Ich?“
„Ja, ich habe Sie persönlich im Auge. Hören Sie den Unterschied?“ Und der Hofrat klopfte abwechselnd links oben an der Brust und etwas weiter unten.
„Da klingt es etwas dumpfer als hier“, sagte Hans Castorp.
„Sehr gut. Sie sollten Spezialist werden. Das ist also eine Dämpfung, und Dämpfungen beruhen auf veralteten Stellen, wo schon Verkalkung eingetreten ist, Vernarbung, wenn Sie wollen. Sie sind ein alter Patient, Castorp, aber wir wollen es niemandem übelnehmen, daß Sie es nicht erfuhren. Die Frühdiagnose ist schwierig, – zumal für die Herren Kollegen im Flachland. Ich will nicht mal sagen, daß wir feinere Ohren haben, obgleich ja die Spezialübung einiges ausmacht. Aber die Luft hilft uns hören, verstehen Sie, die dünne, trockene Luft hier oben.“
„Gewiß, natürlich“, sagte Hans Castorp.
„Schön, Castorp. Und nun hören Sie mal zu, mein Junge, ich will nun mal mehrere goldene Worte sprechen. Wenn es weiter nichts wäre mit Ihnen, verstehen Sie, und es bei den Dämpfungen und Narben an Ihrem Äolusschlauch da drinnen und mit den kalkigen Fremdkörpern darin sein Bewenden hätte, so würde ich Sie zu Ihren Laren und Penaten schicken und mich auch keinen Deut mehr um Sie kümmern, verstehen Sie wohl? Wie aber die Dinge liegen und weiterhin noch der Befund ist, und wo Sie nun einmal hier bei uns sind, – so lohnt es die Heimreise nicht, Hans Castorp, – in kurzem müßten Sie doch wieder antreten.“
Hans Castorp fühlte aufs neue sein Blut zum Herzen strömen, so daß es hämmerte, und Joachim stand immer noch, die Hände an hinteren Knöpfen, und hatte die Augen niedergeschlagen.
„Denn außer den Dämpfungen,“ sagte der Hofrat, „haben Sie da links oben auch eine Rauhigkeit, die beinahe schon ein Geräusch ist und zweifellos von einer frischen Stelle kommt, – ich will noch nicht von einem Erweichungsherd reden, aber es ist bestimmt eine feuchte Stelle, und wenn Sie’s da unten so weiter treiben, mein Lieber, so geht Ihnen, was hast du was kannst du, der ganze Lungenlappen zum Teufel.“
Hans Castorp stand ohne Regung, um seinen Mund zuckte es sonderbar, und deutlich konnte man sein Herz gegen die Rippen pulsieren sehen. Er blickte zu Joachim hinüber, dessen Augen er nicht fand, und dann wieder in des Hofrats Gesicht mit den blauen Backen, den ebenfalls blauen Quellaugen und dem einseitig geschürzten Schnurrbärtchen.
„Als objektive Bestätigung,“ fuhr Behrens fort, „haben wir da noch Ihre Temperatur: 37,6 zehn Uhr früh, das entspricht so ziemlich den akustischen Wahrnehmungen.“
„Ich dachte nur,“ sagte Hans Castorp, „das Fieber käme von meinem Katarrh.“
„Und der Katarrh?“ versetzte der Hofrat ... „Wovon kommt der? Lassen Sie sich mal was erzählen, Castorp, und passen Sie auf, Sie verfügen ja über hinlänglich zahlreiche Hirnwindungen, soviel ich weiß. Also die Luft hier bei uns, die ist gut gegen die Krankheit, meinen Sie, nicht wahr? Und das ist auch so. Aber sie ist auch gut für die Krankheit, verstehen Sie mich, sie fördert sie erst einmal, sie revolutioniert den Körper, sie bringt die latente Krankheit zum Ausbruch, und so ein Ausbruch, nichts für ungut, ist Ihr Katarrh. Ich weiß nicht, ob Sie schon unten im Tieflande febril gewesen sind, aber hier oben sind Sie es jedenfalls gleich am ersten Tage geworden und nicht erst durch Ihren Katarrh, – um meine Meinung zu sagen.“
„Ja,“ sagte Hans Castorp, „ja, das glaube ich wirklich auch.“
„Sofort waren Sie wahrscheinlich beschwipst“, bekräftigte der Hofrat. „Das sind die löslichen Gifte, die von den Bakterien erzeugt werden; die wirken berauschend auf das Zentralnervensystem, verstehen Sie, und dann kriegt man heitere Bäckchen. Sie gehen nun erst einmal in die Klappe, Castorp; wir müssen sehen, ob wir Sie durch ein paar Wochen Bettruhe nüchtern kriegen. Das Weitere kann nachher kommen. Wir nehmen eine schöne Innenansicht von Ihnen auf – es wird Ihnen Spaß machen, so Einblick zu gewinnen in Ihre eigne Person. Das sage ich Ihnen aber gleich: ein Fall wie Ihrer heilt nicht von heute bis übermorgen, Reklameerfolge und Wunderkuren sind dabei nicht aufzuweisen. Es kam mir doch gleich so vor, als ob Sie ein besserer Patient sein würden, mit mehr Talent zum Kranksein, als der Brigadegeneral da, der immer gleich weg will, wenn er mal ein paar Striche weniger hat. Als ob Stillgelegen nicht ein ebenso gutes Kommando wäre wie Stillgestanden! Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, und Ungeduld schadet bloß. Daß Sie mich also nicht enttäuschen, Castorp, und meine Menschenkenntnis nicht Lügen strafen, bitt’ ich mir aus! Und nun marsch, in die Remise mit Ihnen!“
Damit schloß Hofrat Behrens die Unterredung und setzte sich an den Schreibtisch, um als Mann von vielen Geschäften die Pause bis zur nächsten Untersuchung mit schriftlicher Arbeit auszufüllen. Dr. Krokowski aber erhob sich von seinem Platze, schritt auf Hans Castorp zu, und, den Kopf schräg zurückgelegt, eine Hand auf der Schulter des jungen Mannes und kernig lächelnd, so daß in seinem Barte die gelblichen Zähne sichtbar wurden, schüttelte er ihm herzhaft die Rechte.
Hier steht eine Erscheinung bevor, über die der Erzähler sich selbst zu wundern gut tut, damit nicht der Leser auf eigene Hand sich allzusehr darüber wundere. Während nämlich unser Rechenschaftsbericht über die ersten drei Wochen von Hans Castorps Aufenthalt bei denen hier oben (einundzwanzig Hochsommertage, auf die sich menschlicher Voraussicht nach dieser Aufenthalt überhaupt hatte beschränken sollen) Räume und Zeitmengen verschlungen hat, deren Ausdehnung unseren eigenen halb eingestandenen Erwartungen nur zu sehr entspricht, – wird die Bewältigung der nächsten drei Wochen seines Besuches an diesem Orte kaum so viele Zeilen, ja Worte und Augenblicke erfordern, als jener Seiten, Bogen, Stunden und Tagewerke gekostet hat: im Nu, das sehen wir kommen, werden diese drei Wochen hinter uns gebracht und beigesetzt sein.
Dies also könnte wundernehmen; und doch ist es in der Ordnung und entspricht den Gesetzen des Erzählens und Zuhörens. Denn in der Ordnung ist es und diesen Gesetzen entspricht es, daß uns die Zeit genau so lang oder kurz wird, für unser Erlebnis sich genau ebenso breit macht oder zusammenschrumpft, wie dem auf so unerwartete Art vom Schicksal mit Beschlag belegten Helden unserer Geschichte, dem jungen Hans Castorp; und es mag nützlich sein, den Leser in Ansehung des Zeitgeheimnisses auf noch ganz andere Wunder und Phänomene, als das hier auffallende, vorzubereiten, die uns in seiner Gesellschaft zustoßen werden. Für jetzt genügt es, daß jedermann sich erinnert, wie rasch eine Reihe, ja eine „lange“ Reihe von Tagen vergeht, die man als Kranker im Bette verbringt: es ist immer derselbe Tag, der sich wiederholt; aber da es immer derselbe ist, so ist es im Grunde wenig korrekt, von „Wiederholung“ zu sprechen; es sollte von Einerleiheit, von einem stehenden Jetzt oder von der Ewigkeit die Rede sein. Man bringt dir die Mittagssuppe, wie man sie dir gestern brachte und sie dir morgen bringen wird. Und in demselben Augenblick weht es dich an – du weißt nicht, wie und woher; dir schwindelt, indes du die Suppe kommen siehst, die Zeitformen verschwimmen dir, rinnen ineinander, und was sich als wahre Form des Seins dir enthüllt, ist eine ausdehnungslose Gegenwart, in welcher man dir ewig die Suppe bringt. Mit Bezug auf die Ewigkeit aber von Langerweile zu sprechen, wäre sehr paradox; und Paradoxe wollen wir meiden, besonders im Zusammenleben mit diesem Helden.
Hans Castorp also war bettlägrig seit Sonnabendnachmittag, da Hofrat Behrens, die oberste Autorität in der Welt, die uns einschließt, es so angeordnet hatte. Da lag er, sein Monogramm auf der Brusttasche seines Nachthemds, die Hände hinter dem Kopf gefaltet, in seinem reinlichen, weißen Bett, dem Totenbett der Amerikanerin und wahrscheinlich noch mancher anderen Person, und blickte mit einfachen, vom Schnupfen getrübten blauen Augen zur Zimmerdecke empor, die Sonderbarkeit seiner Lebenslage betrachtend. Dabei ist nicht anzunehmen, daß seine Augen ohne Schnupfen klar, hell und unzweideutig geblickt hätten, denn so sah es in seinem Inneren, wie einfach dieses auch sein mochte, nicht aus, sondern in der Tat sehr trübe, verworren, undeutlich-halbaufrichtig und zweifelhaft. Bald erschütterte, wie er so dalag, ein tolles, tief aufsteigendes Triumphgelächter von innen her seine Brust, und sein Herz stockte und schmerzte von einer nie gekannten, ausschweifenden Freude und Hoffnung; bald wieder erblaßte er vor Schrecken und Bangen, und es waren die Schläge des Gewissens selbst, mit denen sein Herz in raschem, fliegendem Takt gegen die Rippen pochte.
Joachim ließ ihn am ersten Tage ganz in Ruhe und vermied jede Erörterung. Schonend trat er ein paarmal ins Krankenzimmer, nickte dem Liegenden zu und fragte der guten Form wegen, ob ihm was abgehe. Übrigens fiel es ihm um so leichter, Hans Castorps Scheu vor einer Auseinandersetzung zu erkennen und zu achten, als er sie teilte und sich nach seiner Auffassung sogar in einer peinlicheren Lage befand als dieser.
Aber am Sonntagvormittag, nach seiner Rückkehr von dem wie früher allein zurückgelegten Morgenspaziergang, verschob er es trotzdem nicht länger, das nun unmittelbar Notwendigste mit seinem Vetter zu beraten. Er stellte sich an dessen Bett und sagte aufseufzend:
„Ja, es hilft alles nichts, es müssen nun Schritte geschehen. Sie erwarten dich ja zu Hause.“
„Noch nicht“, antwortete Hans Castorp.
„Nein, aber in den nächsten Tagen, Mittwoch oder Donnerstag.“
„Ach,“ sagte Hans Castorp, „sie erwarten mich überhaupt nicht so genau auf den Tag. Die haben anderes zu tun, als auf mich zu warten und die Tage zu zählen, bis ich wiederkomme. Wenn ich komme, so bin ich da, und Onkel Tienappel sagt: ‚Da bist du ja auch wieder!‘ und Onkel James sagt: ‚Na, war’s schön.‘ Und wenn ich nicht komme, so dauert es lange, bis es ihnen auffällt, da kannst du sicher sein. Selbstverständlich müßte man sie mit der Zeit benachrichtigen ...“
„Du kannst dir denken,“ sagte Joachim und seufzte wieder, „wie unangenehm mir die Sache ist! Was soll denn jetzt werden? Natürlich fühle ich mich doch sozusagen verantwortlich. Du kommst hier herauf, um mich zu besuchen, und ich führe dich ein hier oben, und nun sitzst du fest, und niemand weiß, wann du wieder loskommst und deine Stelle antreten kannst. Du mußt einsehen, daß mir das im höchsten Grade peinlich ist.“
„Erlaube mir!“ sagte Hans Castorp, immer die Hände unter dem Kopf. „Was machst denn du dir für Kopfzerbrechen? Das ist doch Unsinn. Bin ich heraufgekommen, um dich zu besuchen? Auch; aber in erster Linie doch schließlich, um mich zu erholen, auf Vorschrift von Heidekind. Na, und nun zeigt sich eben, daß ich erholungsbedürftiger bin, als er und wir alle uns haben träumen lassen. Ich bin ja wohl nicht der erste, der glaubte, hier eine Stippvisite zu machen, und für den es dann anders kam. Denke doch nur zum Beispiel an Tous les deux’ zweiten Sohn, und wie es den hier denn doch noch ganz anders getroffen hat, – ich weiß nicht, ob er noch lebt, vielleicht haben sie ihn abgeholt während einer Mahlzeit. Daß ich etwas krank bin, ist mir ja eine Überraschung, ich muß mich erst darein finden, mich hier als Patient und richtig als einer von euch zu fühlen, statt, wie bisher, nur als Gast. Und dann überrascht es mich doch auch wieder fast gar nicht, denn so recht prachtvoll instand habe ich mich eigentlich niemals gefühlt, und wenn ich denke, wie früh meine beiden Eltern gestorben sind, – woher sollte die Pracht denn schließlich auch kommen! Daß du einen kleinen Knacks hast, nicht wahr, wenn er nun auch so gut wie kuriert ist, darüber machen wir uns ja alle nichts vor, und also kann es ja sein, daß es ein bißchen in unsrer Familie liegt, Behrens wenigstens machte so eine Bemerkung. Jedenfalls liege ich hier schon seit gestern und überlege mir, wie mir doch eigentlich immer zumute war und wie ich mich zu dem Ganzen verhielt, zum Leben, weißt du, und seinen Anforderungen. Ein gewisser Ernst und eine gewisse Abneigung gegen robustes und lautes Wesen lag immer in meiner Natur, – wir sprachen noch neulich davon, und daß ich manchmal fast Lust gehabt hätte, geistlich zu werden, aus Interesse für traurige und erbauliche Dinge, – so ein schwarzes Tuch, weißt du, mit einem silbernen Kreuz darauf oder R. I. P. ... Requiescat in pace ... das ist eigentlich das schönste Wort und mir viel sympathischer als ‚Hoch soll er leben‘, was doch mehr ein Radau ist. Das alles, denke ich mir, kommt wohl daher, daß ich selbst einen Knacks habe und mich von Anfang an auf die Krankheit verstehe, – es zeigt sich bei dieser Gelegenheit. Aber wenn es sich nun doch so verhält, so kann ich ja von Glück sagen, daß ich heraufgekommen bin und mich habe untersuchen lassen; du brauchst dir nicht die geringsten Vorwürfe deswegen zu machen. Denn du hast ja gehört: wenn ich es im Flachland noch eine Weile so weiter getrieben hätte, so wäre womöglich mir nichts dir nichts mein ganzer Lungenlappen zum Teufel gegangen.“
„Das kann man nicht wissen!“ sagte Joachim. „Das ist es ja eben, daß man das gar nicht wissen kann! Du sollst ja früher schon Stellen gehabt haben, um die sich niemand gekümmert hat und die ganz von selbst verheilt sind, so daß du jetzt nur noch ein paar gleichgültige Dämpfungen davon hast. So wäre es möglicherweise auch mit der feuchten Stelle gegangen, die du jetzt haben sollst, wenn du nicht zufällig zu mir heraufgekommen wärst, – man kann es nicht wissen!“
„Nein, wissen kann man gar nichts“, antwortete Hans Castorp. „Und darum hat man kein Recht, das Ärgerlichste in Ansatz zu bringen, zum Beispiel auch was die Dauer meines Kuraufenthaltes betrifft. Du sagst, niemand weiß, wann ich loskomme und auf der Werft eintreten kann, aber du sagst es im pessimistischen Sinn, und das finde ich voreilig, da man es ja eben nicht wissen kann. Behrens hat keinen Termin genannt, er ist ein besonnener Mann und spielt nicht den Wahrsager. Es hat ja auch die Durchleuchtung und photographische Aufnahme noch gar nicht stattgefunden, die erst den Sachverhalt objektiv klarstellen wird, und wer weiß, ob da etwas Nennenswertes zutage kommt und ob ich nicht vorher schon fieberfrei bin und euch Adieu sagen kann. Ich bin dafür, daß wir uns nicht vor der Zeit aufspielen und denen zu Hause nicht gleich die größten Räubergeschichten erzählen. Es genügt, wenn wir nächstens mal schreiben – ich kann selbst schreiben, mit der Füllfeder hier, wenn ich mich etwas aufsetze –, daß ich stark erkältet und febril und bettlägrig bin und vorderhand noch nicht reisen kann. Das Weitere findet sich.“
„Gut,“ sagte Joachim, „so können wir’s vorläufig machen. Und dann können wir ja auch mit dem anderen noch etwas zuwarten.“
„Mit welchem anderen?“
„Sei nicht so gedankenlos! Du bist doch nur auf drei Wochen eingerichtet mit deinem Kajütenkoffer. Du brauchst Wäsche, Unter- und Oberwäsche und Winterkleider, und brauchst mehr Schuhzeug. Schließlich, auch Geld mußt du dir kommen lassen.“
„Wenn,“ sagte Hans Castorp, „wenn ich das alles brauche.“
„Gut, warten wir’s ab. Aber wir sollten ... nein,“ sagte Joachim und ging in Bewegung durchs Zimmer, „wir sollten uns keine Illusionen machen! Ich bin zu lange hier, um nicht Bescheid zu wissen. Wenn Behrens sagt, daß da eine rauhe Stelle ist, beinah ein Geräusch ... Aber selbstverständlich, wir können ja zusehen!“ –
Dabei blieb es für diesmal, und vorderhand traten die acht- und vierzehntägigen Abwandlungen des Normaltages in ihre Rechte, – auch in seiner gegenwärtigen Lage hatte Hans Castorp teil daran, wo nicht durch unmittelbaren Mitgenuß, so durch Berichte, die Joachim abstattete, wenn er ihn besuchte und sich für eine Viertelstunde auf seine Bettkante setzte.
Das Teebrett, worauf man ihm am Sonntagmorgen sein Frühstück brachte, war mit einem Blumenväschen geschmückt, und man hatte nicht versäumt, ihm von dem Feingebäck zu schicken, das heute im Saale gereicht wurde. Später wurde es drunten im Garten und auf der Terrasse lebendig, und mit Trara und Klarinettengenäsel setzte das vierzehntägige Sonntagskonzert ein, zu dem Joachim sich bei seinem Vetter einfand: er nahm die Darbietung bei offener Balkontür draußen in der Loge entgegen, während Hans Castorp von seinem Bette aus, halb sitzend, den Kopf auf die Seite gelegt und liebevoll-andächtig verschwimmenden Blickes den heraufdrängenden Harmonien lauschte, nicht ohne innerlich achselzuckend der Redereien Settembrinis von der „politischen Verdächtigkeit“ der Musik zu gedenken.
Im übrigen, wie wir sagten, ließ er sich von Joachim über die Erscheinungen und Veranstaltungen dieser Tage Bericht erstatten, fragte ihn aus, ob der Sonntag festliche Toiletten gebracht habe, Spitzenmatinees oder dergleichen (für Spitzenmatinees war es jedoch zu kalt gewesen); auch ob nachmittags Wagenfahrten stattgefunden hätten (wirklich waren welche unternommen worden: der Verein „Halbe Lunge“ war in corpore nach Clavadell ausgeflogen); und am Montag verlangte er, von Dr. Krokowskis Conférence zu hören, als Joachim davon zurückkehrte und, bevor er in die Mittagsliegekur ging, bei ihm vorsprach. Joachim zeigte sich mundfaul und abgeneigt, über den Vortrag zu berichten, – wie ja auch von dem vorigen weiter nicht zwischen den beiden die Rede gewesen war. Aber Hans Castorp bestand darauf, Einzelheiten zu hören. „Ich liege hier und zahle den vollen Preis“, sagte er. „Ich will auch etwas haben von dem, was geboten wird.“ Er erinnerte sich an den Montag vor vierzehn Tagen, an seinen selbständigen Spaziergang, der ihm so wenig gut getan, und gab der bestimmten Vermutung Ausdruck, daß er es eigentlich gewesen sei, der revolutionierend auf seinen Körper gewirkt und die still vorhandene Krankheit zum Ausbruch gebracht habe. „Aber wie die Leute hier reden,“ rief er; „das niedere Volk, – so würdig und feierlich: es klingt zuweilen wie Poesie. ‚Nun, so leb’ wohl und hab’ Dank!‘“ wiederholte er, indem er die Sprechweise des Holzknechtes nachahmte. „So habe ich es im Walde gehört, und ich vergesse es meiner Lebtage nicht. Dergleichen verbindet sich dann mit anderen Eindrücken oder Erinnerungen, weißt du, und man behält es bis an sein Lebensende im Ohr. – Und Krokowski hat also wieder von ‚Liebe‘ gesprochen?“ fragte er und schnitt ein Gesicht bei dem Wort.
„Selbstredend“, sagte Joachim. „Wovon denn sonst. Es ist ja nun einmal sein Thema.“
„Was sagte er denn heute davon?“
„Ach, nichts Besonderes. Du weißt ja selbst, vom vorigen Mal, wie er sich ausdrückt.“
„Aber was gab er denn Neues zum besten?“
„Nichts weiter Neues ... Ja, es war die reine Chemie, was er heute verzapfte“, ließ Joachim sich widerstrebend herbei, zu berichten. Es handele sich „dabei“ um eine Art von Vergiftung, von Selbstvergiftung des Organismus, habe Dr. Krokowski gesagt, die so entstehe, daß ein noch unbekannter, im Körper verbreiteter Stoff Zersetzung erfahre; und die Produkte dieser Zersetzung wirkten berauschend auf gewisse Rückenmarkszentren ein, nicht anders, als wie es sich bei der gewohnheitsmäßigen Einführung von fremden Giftstoffen, Morphin oder Kokain, verhalte.
„Und dann kriegt man heitere Bäckchen!“ sagte Hans Castorp. „Sieh an, das ist ja hörenswert. Was der nicht alles weiß –. Er hat es mit Löffeln gegessen. Warte nur, eines Tages entdeckt er dir noch den unbekannten Stoff, der im ganzen Körper verbreitet ist, und stellt die löslichen Gifte her, die berauschend aufs Zentrum wirken, dann kann er die Leute auf eine besondere Weise beschwipsen. Vielleicht war man früher schon einmal so weit. Wenn man ihn hört, so könnte man denken, daß etwas Wahres ist an den Geschichten von Liebestränken und solchem Zeug, wovon in den Sagenbüchern die Rede ist ... Gehst du schon?“
„Ja,“ sagte Joachim, „ich muß unbedingt noch etwas liegen. Ich habe ansteigende Kurve seit gestern. Die Sache mit dir hat mir doch etwas zugesetzt.“ –
Das war der Sonntag, der Montag. Aus Abend und Morgen wurde der dritte Tag von Hans Castorps Aufenthalt in der „Remise“, ein Wochentag ohne Auszeichnung, der Dienstag. Es war aber der Tag seiner Ankunft hier oben, er war nun rund drei Wochen an diesem Ort, und so trieb es ihn doch, den Brief nach Hause zu schreiben und seine Onkel wenigstens obenhin und für den Augenblick über den Stand der Dinge zu unterrichten. Sein Plumeau im Rücken, schrieb er auf einem Briefbogen der Anstalt, daß seine Abreise von hier sich planwidrig verzögere. Er liege mit einer fieberigen Erkältung, die von Hofrat Behrens, übergewissenhaft, wie er wohl sei, offenbar nicht ganz auf die leichte Achsel genommen werde, da er sie mit seiner, des Schreibers, Konstitution überhaupt in Zusammenhang bringe. Denn gleich bei der ersten Bekanntschaft habe der dirigierende Arzt ihn stark anämisch gefunden, und alles in allem scheine es, als ob maßgeblicherseits die von ihm, Hans Castorp, zu seiner Erholung angesetzte Frist nicht für recht ausreichend erachtet werde. Weiteres ehetunlichst. – So ist es gut, dachte Hans Castorp. Da ist kein Wort zu viel und doch hält es auf jeden Fall eine Weile vor. – Der Brief wurde dem Hausdiener übergeben, der ihn unter Vermeidung des Umweges über den Kasten unmittelbar zum nächsten fahrplanmäßigen Zug beförderte.
Hiernach schien unserem Abenteurer vieles geordnet, und mit beschwichtigtem Gemüt, wenn auch geplagt von Husten und Schnupfendumpfheit, lebte er abwartend in den Tag hinein, den vielfach in kurze Stückchen geteilten und in seiner feststehenden Einförmigkeit weder kurz- noch langweiligen Normaltag, der immer derselbe war. Morgens trat nach mächtigem Anklopfen der Bademeister herein, ein nerviges Individuum namens Turnherr, mit aufgerollten Hemdärmeln, hochgeäderten Unterarmen und einer gurgelnden, schwer behinderten Sprechart, der Hans Castorp, wie alle Patienten, mit seiner Zimmernummer anredete und ihn mit Alkohol abrieb. Nicht lange nach seinem Abgang erschien Joachim, fertig angezogen, um Guten Morgen zu sagen, nach seines Vetters Sieben-Uhr-früh-Temperatur zu fragen und seine eigene mitzuteilen. Während er drunten frühstückte, tat Hans Castorp, sein Plumeau im Rücken, mit dem Appetit, den eine neue Lebenslage erzeugt, dasselbe –, kaum gestört durch den geschäftig-geschäftsmäßigen Einbruch der Ärzte, die um diese Zeit den Speisesaal passiert hatten und ihren Rundgang durch die Zimmer der Bettlägrigen und Moribunden im Geschwindschritt zurücklegten. Den Mund voll Eingemachtem, bekundete er, „schön“ geschlafen zu haben, sah über den Rand seiner Tasse hin zu, wie der Hofrat, der seine Fäuste auf die Platte des Mitteltisches stemmte, rasch die dort aufliegende Fiebertabelle prüfte, und erwiderte gleichmütig gedehnten Tones den Morgengruß der Abziehenden. Dann zündete er sich eine Zigarette an und sah Joachim schon von seinem morgendlichen Dienstgang wieder zurückkehren, wenn er kaum gedacht hatte, daß er fortgegangen sei. Wieder plauderten sie dies und das, und der Zeit-Zwischenraum bis zum zweiten Frühstück – Joachim hielt Liegekur unterdessen – war so kurz, daß selbst ein ausgemachter Hohlkopf und Geistesarmer es nicht zur Langenweile gebracht haben würde, – während doch Hans Castorp an den Eindrücken seiner ersten drei Wochen hier oben reichlich zu zehren, auch seine gegenwärtige Lebenslage und was etwa daraus werden mochte, innerlich zu bearbeiten hatte und der beiden dicken Bände einer illustrierten Zeitschrift kaum bedurft hätte, die, der Anstaltsbibliothek entstammend, auf seinem Nachttisch lagen.
Nichts anderes gilt für die Zeitspanne, während der Joachim seinen zweiten Gang nach Platz Davos absolvierte, ein leichtes Stündchen. Er sprach dann wieder vor bei Hans Castorp und erzählte von dem und jenem, was ihm im Spazieren auffällig geworden, stand oder saß einen Augenblick am Krankenbette, bevor er in die Mittagsliegekur ging, – und wie lange dauerte die? Nur wieder ein Stündchen! Man hatte kaum, die Hände hinter dem Kopf gefaltet, ein wenig zur Decke geblickt und einem Gedanken nachgehangen, so dröhnte das Gong, das die nicht Bettlägrigen und Moribunden aufforderte, sich zur großen Mahlzeit instandzusetzen.
Joachim ging, und es kam die „Mittagssuppe“: ein einfältig symbolischer Name für das, was kam! Denn Hans Castorp war nicht auf Krankenkost gesetzt, – warum auch hätte man ihn darauf setzen sollen? Krankenkost, schmale Kost war auf keine Art indiziert bei seinem Zustande. Er lag hier und zahlte den vollen Preis, und was man ihm bringt in der stehenden Ewigkeit dieser Stunde, das ist keine „Mittagssuppe“, es ist das sechsgängige Berghof-Diner ohne Abzug und in aller Ausführlichkeit, – am Alltage üppig, am Sonntage ein Gala-, Lust- und Parademahl, von einem europäisch erzogenen Chef in der Luxushotelküche der Anstalt bereitet. Die Saaltochter, deren Amt es war, die Bettlägrigen zu versorgen, brachte es ihm unter vernickelten Hohldeckeln und in leckeren Tiegeln; sie schob den Krankentisch, der sich eingefunden, dies einbeinige Wunder von Gleichgewichtskonstruktion, quer über sein Bett vor ihn hin, und Hans Castorp tafelte daran wie der Sohn des Schneiders am Tischlein deck dich.
Kaum hatte er abgespeist, so kehrte auch Joachim zurück, und bis dieser in seine Loggia ging und die Stille der großen Liegekur sich über Haus „Berghof“ senkte, war es soviel wie halb drei geworden. Nicht ganz, vielleicht; genau genommen wohl erst ein Viertel über zwei. Aber solche überzähligen Viertelstunden außerhalb runder Einheiten werden nicht mitgerechnet, sondern nebenbei verschlungen, wo großzügige Zeitwirtschaft herrscht, wie etwa auf Reisen, bei vielstündiger Bahnfahrt oder sonst in leerem, wartendem Zustande, wenn alles Streben und Leben aufs Hinbringen und Zurücklegen von Zeit zurückgeführt ist. Ein Viertel über zwei Uhr – das gilt für halb drei; es gilt in Gottes Namen auch gleich für drei Uhr, da schon die Drei im Spiele ist. Die dreißig Minuten werden als Auftakt zur runden Stunde von drei bis vier Uhr verstanden und innerlich beseitigt: so macht man es unter solchen Umständen. Und so beschränkte sich denn die Dauer der großen Liegekur schließlich und eigentlich wieder auf eine Stunde, – die übrigens an ihrem Ende vermindert, weggestutzt und gleichsam apostrophiert wurde. Der Apostroph war Dr. Krokowski.
Ja, Dr. Krokowski beschrieb auf seinem selbständigen Nachmittagsrundgang keinen Bogen mehr um Hans Castorp. Dieser zählte nun mit, er war nicht länger ein Intervall und Hiatus, er war Patient, er wurde gefragt und nicht links liegengelassen, wie es zu seinem geheimen und leichten, aber täglich wieder empfundenen Ärger so lange geschehen war. Es war am Montag gewesen, daß Dr. Krokowski zum erstenmal im Zimmer erschienen war, – wir sagen „erschienen“, denn das ist das rechte Wort für den sonderbaren und sogar etwas entsetzlichen Eindruck, dessen Hans Castorp sich damals nicht hatte erwehren können. Er hatte im Halb- oder Viertelschlummer gelegen, als er aufschreckend gewahrte, daß der Assistent im Zimmer war, ohne durch die Tür hereingelangt zu sein, und von der Außenseite her auf ihn zuschritt. Denn sein Weg war nicht über den Korridor, sondern durch die äußeren Loggien gewesen, und durch die offene Balkontür war er eingetreten, so daß sich die Vorstellung aufdrängte, als sei er durch die Lüfte gekommen. Da hatte er nun jedenfalls an Hans Castorps Lager gestanden, schwarzbleich, breitschultrig und stämmig, der Apostroph der Stunde, und in seinem geteilten Bart waren gelblich und mannhaft lächelnd die Zähne zu sehen gewesen.
„Sie scheinen überrascht, mich zu sehen, Herr Castorp,“ hatte er mit baritonaler Milde, schleppend, unbedingt etwas geziert und mit einem exotischen Gaumen-r gesprochen, das er jedoch nicht rollte, sondern durch ein nur einmaliges Anschlagen der Zunge gleich hinter den oberen Vorderzähnen erzeugte; „ich erfülle aber lediglich eine angenehme Pflicht, wenn ich bei Ihnen nun auch nach dem Rechten sehe. Ihr Verhältnis zu uns ist in eine neue Phase getreten, über Nacht ist aus dem Gaste ein Kamerad geworden ...“ (Das Wort „Kamerad“ hatte Hans Castorp etwas geängstigt.) „Wer hätte es gedacht!“ hatte Dr. Krokowski kameradschaftlich gescherzt ... „Wer hätte es gedacht an dem Abend, als ich Sie zuerst begrüßen durfte und Sie meiner irrigen Auffassung – damals war sie irrig – mit der Erklärung begegneten, Sie seien vollkommen gesund. Ich glaube, ich drückte damals etwas wie einen Zweifel aus, aber, ich versichere Sie, ich meinte es nicht so! Ich will mich nicht scharfsichtiger hinstellen, als ich bin, ich dachte damals an keine feuchte Stelle, ich meinte es anders, allgemeiner, philosophischer, ich verlautbarte meinen Zweifel daran, daß ‚Mensch‘ und ‚vollkommene Gesundheit‘ überhaupt Reimworte seien. Und auch heute noch, auch nach dem Verlauf Ihrer Untersuchung, kann ich, wie ich nun einmal bin, und im Unterschiede von meinem verehrten Chef, diese feuchte Stelle da“ – und er hatte mit der Fingerspitze leicht Hans Castorps Schulter berührt – „nicht als im Vordergrunde des Interesses stehend erachten. Sie ist für mich eine sekundäre Erscheinung ... Das Organische ist immer sekundär ...“
Hans Castorp war zusammengezuckt.
„... Und also ist Ihr Katarrh in meinen Augen eine Erscheinung dritter Ordnung“, hatte Dr. Krokowski sehr leicht hinzugefügt. „Wie steht es damit? Die Bettruhe wird in dieser Hinsicht gewiß rasch das ihre tun. Was haben Sie heute gemessen?“ Und von da an hatte der Besuch des Assistenten den Charakter einer harmlosen Kontrollvisite getragen, wie er ihn denn auch in den folgenden Tagen und Wochen beständig trug: Dr. Krokowski kam ¾4 Uhr oder auch schon etwas früher über den Balkon herein, begrüßte den Liegenden auf mannhaft heitere Art, stellte die einfachsten ärztlichen Fragen, leitete auch wohl ein kurzes, persönlicher bestimmtes Geplauder ein, scherzte kameradschaftlich, – und wenn alles dies eines Anfluges von Bedenklichkeit nicht entbehrte, so gewöhnt man sich endlich auch an das Bedenkliche, falls es in seinen Grenzen bleibt, und Hans Castorp fand bald nichts mehr gegen das regelmäßige Erscheinen Dr. Krokowskis zu erinnern, das nun einmal zum stehenden Normaltage gehörte und die Stunde der großen Liegekur apostrophierte.
Es war also 4 Uhr, wenn der Assistent wieder auf den Balkon zurücktrat, – das heißt tiefer Nachmittag! Plötzlich und eh mans gedacht, war es tiefer Nachmittag, – der sich übrigens ungesäumt ins annähernd Abendliche vertiefte: denn bis der Tee getrunken war, drunten im Saal und auf Nummer 34, ging es stärkstens auf 5 Uhr und, bis Joachim von seinem dritten Dienstgange zurückkehrte und bei seinem Vetter wieder vorsprach, immerhin so stark auf 6, daß sich die Liegekur bis zum Abendessen, wenn man nur ein wenig rund rechnete, wieder auf eine Stunde beschränkte, – eine spielend aus dem Felde zu schlagende Zeitgegnerschaft, wenn man Gedanken im Kopf und außerdem einen ganzen orbis pictus auf dem Nachttische hat.
Joachim verabschiedete sich zur Mahlzeit. Das Essen wurde gebracht. Das Tal hatte sich längst mit Schatten gefüllt, und während Hans Castorp aß, dunkelte es zusehens im weißen Zimmer. Er saß, wenn er fertig war, in sein Plumeau gelehnt, vor dem abgegessenen Tischleindeckdich und blickte in die rasch zunehmende Dämmerung, die Dämmerung von heute, die von der gestrigen, vorgestrigen oder der vor acht Tagen nur schwer zu unterscheiden war. Es war Abend, – nachdem es eben noch Morgen gewesen. Der zerkleinerte und künstlich kurzweilig gemachte Tag war ihm buchstäblich unter den Händen zerbröckelt und zunichte geworden, wie er mit heiterer Verwunderung oder allenfalls nachdenklich bemerkte; denn Grauen hiervor war seinen Jahren noch fremd. Ihm war nur, als blicke er „immer noch“.
Eines Tages, es mochten zehn oder zwölf vergangen sein, seit Hans Castorp bettlägrig geworden war, pochte es um diese Stunde, das heißt: bevor Joachim vom Abendessen und von der Geselligkeit zurückgekehrt war, an die Stubentür, und auf Hans Castorps fragendes Herein erschien Lodovico Settembrini auf der Schwelle, – wobei es mit einem Schlage blendend hell im Zimmer wurde. Denn des Besuchers erste Bewegung, bei noch offener Tür, war gewesen, daß er das Deckenlicht eingeschaltet hatte, welches, von dem Weiß der Decke, der Möbel zurückgeworfen, den Raum im Nu mit zitternder Klarheit überfüllte.
Der Italiener war die einzige Persönlichkeit unter den Kurgästen, nach der Hans Castorp sich in diesen Tagen ausdrücklich und namentlich bei Joachim erkundigt hatte. Joachim berichtete ihm ja ohnedies, sooft er für zehn Minuten auf seines Vetters Bettrand saß oder neben ihm stand – und das geschah zehnmal am Tage – von den kleinen Vorkommnissen und Schwankungen im Alltagsleben der Anstalt, und soweit Hans Castorp Fragen gestellt hatte, waren sie allgemeiner und unpersönlicher Art gewesen. Die Neugier des Isolierten ging dahin, zu wissen, ob etwa neue Gäste angekommen oder von den vertrauten Physiognomien jemand abgereist sei; und es schien ihn zu befriedigen, daß nur jenes der Fall war. Ein „Neuer“ war eingetroffen, ein junger Mann, grünlich und hohl von Gesicht, und hatte seinen Platz am Tische der elfenbeinernen Levi und der Frau Iltis, gleich rechts von dem der Vettern erhalten. Nun, Hans Castorp konnte es erwarten, ihn in Augenschein zu nehmen. Abgereist war also niemand? Joachim verneinte kurz, indem er die Augen niederschlug. Aber er mußte die Frage mehrmals beantworten, eigentlich jeden zweiten Tag, obgleich er schließlich, eine gewisse Ungeduld in der Stimme, ein für allemal Bescheid zu geben versucht und gesagt hatte, seines Wissens stehe niemand vor der Abreise, so schlankerhand werde hier überhaupt ja nicht abgereist.
Was Settembrini betraf, so hatte also Hans Castorp persönlich nach ihm gefragt und zu hören verlangt, was jener „dazu gesagt“ habe. Wozu? „Nun, daß ich hier liege und krank sein soll.“ Wirklich hatte Settembrini sich geäußert, wenn auch sehr knapp. Gleich am Tage von Hans Castorps Verschwinden war er an Joachim mit der Frage nach dem Verbleib des Gastes herangetreten, wobei er sichtlich zu erfahren bereit gewesen war, daß Hans Castorp abgereist sei. Auf Joachims Erklärungen hatte er nur mit zwei italienischen Wörtern erwidert: zuerst hatte er „Ecco“ und dann „Poveretto“ gesagt, zu deutsch: „da haben wir’s“ und „armer Kleiner“, – man brauchte nicht mehr Italienisch zu verstehen als die beiden jungen Leute, um den Sinn dieser beiden Äußerungen zu erfassen. „Wieso ‚poveretto‘?“ hatte Hans Castorp gesagt. „Er sitzt doch auch hier oben mit seiner Literatur, die aus Humanismus und Politik besteht, und kann die irdischen Lebensinteressen wenig fördern. Er sollte mich nur nicht so von oben herab bemitleiden, ich komme immer noch früher ins Flachland als er.“
Nun also stand Herr Settembrini im jäh erleuchteten Zimmer, – Hans Castorp, der sich auf den Ellbogen gestützt und zur Tür gewandt hatte, erkannte ihn blinzelnd und errötete, als er ihn erkannte. Wie immer trug Settembrini seinen dicken Rock mit den großen Aufschlägen, einen etwas schadhaften Umlegekragen dazu und die karierten Hosen. Da er vom Essen kam, hielt er nach seiner Gewohnheit einen hölzernen Zahnstocher zwischen den Lippen. Sein Mundwinkel unter der schönen Schnurrbartbiegung war zu dem bekannten feinen, nüchternen und kritischen Lächeln gespannt.
„Guten Abend, Ingenieur! Ist es erlaubt, sich nach Ihnen umzusehen? Wenn ja, so bedarf es dazu des Lichtes, – verzeihen Sie meine Eigenmächtigkeit!“ sagte er, indem er die kleine Hand schwunghaft zur Deckenlampe emporwarf. „Sie kontemplierten, – ich möchte beileibe nicht stören. Neigung zur Nachdenklichkeit wäre mir ganz begreiflich in Ihrem Fall, und zum Plaudern haben Sie schließlich Ihren Vetter. Sie sehen, meine Überflüssigkeit ist mir vollkommen deutlich. Trotzdem, man lebt auf so engem Raum beieinander, man faßt Teilnahme von Mensch zu Mensch, geistige Teilnahme, Herzensteilnahme ... Es ist eine gute Woche, daß man Sie nicht sieht. Ich fing wahrhaftig an, mir einzubilden, Sie seien abgereist, als ich Ihren Platz drunten im Refektorium leer sah. Der Leutnant belehrte mich eines Besseren, hm, eines weniger Guten, wenn das nicht unhöflich klingt ... Kurz, wie geht es? Was treiben Sie? Wie fühlen Sie sich? Doch nicht allzu niedergeschlagen?“
„Sie sind es, Herr Settembrini! Das ist ja freundlich. Ha, ha, ‚Refektorium‘? Da haben Sie gleich wieder einen Witz gemacht. Nehmen Sie den Stuhl, bitte. Sie stören mich keine Spur. Ich lag da und sinnierte, – sinnieren ist schon viel zu viel gesagt. Ich war einfach zu faul, das Licht anzudrehen. Danke vielmals, es geht mir subjektiv so gut wie normal. Mein Schnupfen ist beinahe behoben durch die Bettruhe, aber er soll ja eine sekundäre Erscheinung sein, wie ich allgemein höre. Die Temperatur ist eben immer noch nicht, wie sie sein sollte, mal 37,5, mal 37,7, das hat sich in diesen Tagen noch nicht geändert.“
„Sie nehmen regelmäßig Messungen vor?“
„Ja, sechsmal am Tage, ganz wie sie alle hier oben. Haha, entschuldigen Sie, ich muß noch lachen darüber, daß Sie unsern Speisesaal ‚Refektorium‘ nannten. So sagt man doch im Kloster, nicht? Davon hat es hier wirklich etwas, – ich war ja noch nie in einem Kloster, aber so ähnlich stelle ich es mir vor. Und die ‚Regeln‘ habe ich auch schon am Schnürchen und beobachte sie ganz genau.“
„Wie ein frommer Bruder. Man kann sagen, Ihr Noviziat ist beendet, Sie haben Profeß getan. Meine feierliche Gratulation. Sie sagen ja auch schon ‚unser Speisesaal‘. Übrigens – ohne Ihrer Manneswürde zu nahe treten zu wollen – erinnern Sie mich fast mehr an ein junges Nönnlein als an einen Mönch, – an so ein eben geschorenes, unschuldiges Bräutchen Christi mit großen Opferaugen. Ich habe früher hie und da solche Lämmer gesehen nie ohne ... nie ohne eine gewisse Sentimentalität. Ah, ja, ja, Ihr Herr Vetter hat mir alles erzählt. Sie haben sich also im letzten Moment noch untersuchen lassen.“
„Da ich febril war –. Ich bitte Sie, Herr Settembrini, bei einem solchen Katarrh hätte ich mich in der Ebene an unseren Arzt gewandt. Und hier, wo man sozusagen an der Quelle sitzt, wo zwei Spezialisten im Hause sind, – es wäre doch komisch gewesen ...“
„Versteht sich, versteht sich. Und gemessen hatten Sie sich also schon, bevor man es Ihnen aufgetragen. Man hatte es Ihnen übrigens sofort empfohlen. Das Thermometer hat Ihnen die Mylendonk zugesteckt?“
„Zugesteckt? Da der Bedarfsfall vorlag, habe ich ihr eines abgekauft.“
„Ich verstehe. Ein einwandfreies Handelsgeschäft. Und wieviel Monate hat der Chef Ihnen aufgebrummt? ... Großer Gott, so habe ich Sie schon einmal gefragt! Erinnern Sie sich? Sie waren frisch angekommen. Sie antworteten so keck damals ...“
„Natürlich weiß ich das noch, Herr Settembrini. Viel Neues habe ich seitdem erlebt, aber das weiß ich doch noch wie heute. Gleich damals waren Sie so amüsant und machten Hofrat Behrens zum Höllenrichter ... Rhadames ... Nein, warten Sie, das ist was anderes ...“
„Rhadamanthys? Mag sein, daß ich ihn beiläufig so nannte. Ich behalte nicht alles, was mein Kopf gelegentlich hervorsprudelt.“
„Rhadamanthys, natürlich! Minos und Rhadamanthys! Auch von Carducci erzählten Sie uns damals gleich ...“
„Erlauben Sie, lieber Freund, den wollen wir beiseite lassen. Der Name nimmt sich in diesem Augenblick gar zu fremdartig aus in Ihrem Munde!“
„Auch gut“, lachte Hans Castorp. „Ich habe durch Sie aber doch viel über ihn gelernt. Ja, damals hatte ich keine Ahnung und antwortete Ihnen, ich sei auf drei Wochen gekommen, anders wußte ich’s nicht. Gerade hatte die Kleefeld mich zur Begrüßung mit dem Pneumothorax angepfiffen, davon war ich etwas außer mir. Aber auch febril fühlte ich mich damals gleich, denn die Luft hier ist ja nicht nur gut gegen die Krankheit, sie ist auch gut für die Krankheit, manchmal bringt sie sie erst zum Ausbruch, und das ist am Ende wohl nötig, wenn Heilung eintreten soll.“
„Eine bestechende Hypothese. Hat Hofrat Behrens Ihnen auch von der Deutschrussin erzählt, die wir voriges Jahr, – nein: vorvoriges Jahr fünf Monate hier hatten? Nicht? Das hätte er tun sollen. Eine liebenswürdige Dame, deutschrussisch ihrer Abstammung nach, verheiratet, junge Mutter. Sie kam aus dem Osten hierher, lymphatisch, blutarm, es lag auch wohl etwas Ernsthafteres vor. Nun, sie lebt einen Monat hier und klagt, sie fühle sich schlecht. Nur Geduld! Es vergeht ein zweiter Monat, und sie behauptet fortgesetzt, daß es ihr nicht besser, sondern schlechter geht. Ihr wird bedeutet, wie es ihr gehe, könne einzig und allein der Arzt beurteilen; sie könne nur angeben, wie sie sich fühle, – und daran sei wenig gelegen. Mit ihrer Lunge sei man zufrieden. Gut, sie schweigt, sie macht Kur und verliert allwöchentlich an Gewicht. Im vierten Monat wird sie bei Untersuchungen ohnmächtig. Das schade nichts, erklärt Behrens; mit ihrer Lunge sei er recht wohl zufrieden. Als sie aber im fünften Monat nicht mehr gehen kann, schreibt sie dies ihrem Manne nach Osten, und Behrens bekommt einen Brief von ihm, – es stand ‚Persönlich‘ und ‚Dringlich‘ darauf in markiger Schrift, ich habe ihn selbst gesehen. Ja, sagt Behrens nun und zuckt die Achseln, es scheine sich ja herauszustellen, daß sie offenbar das Klima hier nicht vertrage. Die Frau war außer sich. Das hätte er ihr doch früher sagen müssen, rief sie, sie habe es immer gefühlt, ganz und gar verdorben habe sie sich! ... Wir wollen hoffen, daß sie bei ihrem Mann im Osten wieder zu Kräften gekommen ist.“
„Ausgezeichnet! Sie erzählen so hübsch, Herr Settembrini, geradezu plastisch ist jedes Ihrer Worte. Auch über die Geschichte mit dem Fräulein, das im See badete, und der man die Stumme Schwester gab, habe ich noch oft im stillen lachen müssen. Ja, was alles vorkommt. Man lernt gewiß nicht aus. Mein eigener Fall liegt übrigens noch ganz im Ungewissen. Der Hofrat will ja eine Kleinigkeit bei mir gefunden haben, – die alten Stellen, wo ich früher schon krank war, ohne es zu wissen, habe ich selbst beim Klopfen gehört, und nun soll auch eine frische hier irgendwo zu hören sein – ha, ‚frisch‘ ist übrigens eigentümlich gesagt in diesem Zusammenhang. Aber bis jetzt handelt es sich ja nur um akustische Wahrnehmungen, und die rechte diagnostische Sicherheit werden wir erst haben, wenn ich wieder auf bin und die Durchleuchtung und photographische Aufnahme stattgefunden hat. Dann werden wir positiv Bescheid wissen.“
„Meinen Sie? – Wissen Sie, daß die photographische Platte oft Flecken zeigt, die man für Kavernen hält, während sie bloß Schatten sind, und daß sie da, wo etwas ist, zuweilen keine Flecken zeigt? Madonna, die photographische Platte! Hier war ein junger Numismatiker, der fieberte; und da er fieberte, sah man deutlich Kavernen auf der photographischen Platte. Man wollte sie sogar gehört haben! Er wurde auf Phthisis behandelt, und darüber starb er. Die Obduktion lehrte, daß seiner Lunge nichts fehlte, und daß er an irgendwelchen Kokken gestorben war.“
„Nun, hören Sie, Herr Settembrini, gleich von Obduktion reden Sie! Soweit ist es mit mir denn doch wohl noch nicht.“
„Ingenieur, Sie sind ein Schalk.“
„Und Sie sind durch und durch ein Kritiker und Zweifler, das muß man sagen! Nicht einmal an die exakte Wissenschaft glauben Sie. Zeigt denn bei Ihnen die Platte Flecken?“
„Ja, sie zeigt welche.“
„Und sind Sie wirklich etwas krank?“
„Ja, ich bin leider ziemlich krank“, erwiderte Herr Settembrini und ließ das Haupt sinken. Es trat eine Pause ein, in der er hüstelte. Hans Castorp blickte aus seiner Ruhelage auf den zum Schweigen gebrachten Gast. Ihm war, als hätte er mit seinen beiden sehr einfachen Fragen alles mögliche widerlegt und zum Verstummen gebracht, sogar die Republik und den schönen Stil. Von seiner Seite tat er nichts, um das Gespräch wieder in Gang zu bringen.
Nach einer Weile richtete Herr Settembrini sich lächelnd wieder auf.
„Erzählen Sie mir nun, Ingenieur,“ sagte er, „wie haben die Ihren die Nachricht aufgenommen?“
„Das heißt, welche Nachricht? Von der Verzögerung meiner Abreise? Ach, die Meinen, wissen Sie, die Meinen zu Hause bestehen aus drei Onkels, einem Großonkel und zwei Söhnen von ihm, zu denen ich mehr in Vetternverhältnis stehe. Weiter habe ich keine Meinen, ich bin ja sehr früh Doppelwaise geworden. Aufgenommen? Sie wissen ja noch nicht viel, nicht mehr, als ich selbst. Zu Anfang, als ich mich legen mußte, habe ich ihnen geschrieben, ich sei stark erkältet und könne nicht reisen. Und gestern, da es nun doch ein bißchen lange dauerte, habe ich noch einmal geschrieben und gesagt, Hofrat Behrens sei durch den Katarrh auf den Zustand meiner Brust aufmerksam geworden und dringe darauf, daß ich meinen Aufenthalt verlängere, bis Klarheit darüber geschaffen ist. Davon werden sie sehr ruhigen Blutes Kenntnis genommen haben.“
„Und Ihr Posten? Sie sprachen von einem praktischen Wirkungskreis, in den Sie eben einzutreten gedachten.“
„Ja, als Volontär. Ich habe gebeten, mich vorläufig auf der Werft zu entschuldigen. Sie müssen nicht denken, daß deswegen da Verzweiflung herrscht. Die können sich beliebig lange auch ohne Volontär behelfen.“
„Sehr gut! Von dieser Seite betrachtet, ist also alles in Ordnung. Phlegma auf der ganzen Linie. Man ist überhaupt phlegmatisch bei Ihnen zu Lande, nicht wahr? Aber auch energisch!“
„O ja, energisch auch, doch, sehr energisch“, sagte Hans Castorp. Er prüfte die heimatliche Lebensstimmung aus der Entfernung und fand, daß sein Unterredner sie richtig kennzeichne. „Phlegmatisch und energisch, so sind sie wohl.“
„Nun,“ fuhr Herr Settembrini fort, „sollten Sie länger bleiben, so wird es ja nicht fehlen, daß wir hier oben die Bekanntschaft Ihres Herrn Onkels – ich meine den Großonkel – machen. Zweifellos wird er heraufkommen, sich nach Ihnen umzusehen.“
„Ausgeschlossen!“ rief Hans Castorp. „Unter gar keinen Umständen! Keine zehn Pferde bringen ihn hier herauf! Mein Onkel ist stark apoplektisch, wissen Sie, er hat fast keinen Hals. Nein, der braucht einen vernünftigen Luftdruck, es würde ihm hier noch schlimmer ergehen als Ihrer Dame aus dem Osten, alle Zustände würde er kriegen.“
„Das enttäuscht mich. Apoplektisch also? Was nützen mir da Phlegma und Energie. – Ihr Herr Onkel ist wohl reich? Auch Sie sind reich? Man ist reich bei Ihnen zu Hause.“
Hans Castorp lächelte über Herrn Settembrinis schriftstellerische Verallgemeinerung, und dann blickte er wieder aus seiner Ruhelage ins Weite, in die heimatliche Sphäre, der er entrückt war. Er erinnerte sich, er versuchte, unpersönlich zu urteilen, die Distanz ermunterte und befähigte ihn dazu. Er antwortete:
„Man ist reich, ja, – oder man ist es nicht. Und wenn nicht, – desto schlimmer. Ich? Ich bin kein Millionär, aber das meine ist mir sichergestellt, ich bin unabhängig, ich habe zu leben. Sehen wir von mir mal ab. Wenn Sie gesagt hätten: Man muß reich sein da hinten, – dann hätte ich Ihnen zugestimmt. Denn angenommen, man ist nicht reich, oder hört auf, es zu sein, – dann wehe. ‚Der? Hat der denn noch Geld?‘ fragen sie ... Wörtlich so und mit genau solchem Gesicht; ich habe es oft gehört, und ich merke, daß es sich mir eingeprägt hat. Also muß es mir doch wohl sonderbar vorgekommen sein, obgleich ich gewöhnt war, es zu hören, – sonst hätte es sich mir nicht eingeprägt. Oder wie meinen Sie. Nein, ich glaube nicht, daß es zum Beispiel Ihnen, als homo humanus, zusagen würde bei uns; selbst mir, der ich doch dort zu Hause bin, ist es öfters kraß vorgekommen, wie ich nachträglich merke, obgleich ich persönlich ja nicht darunter zu leiden gehabt habe. Wer nicht die besten, teuersten Weine servieren läßt bei seinen Diners, zu dem geht man überhaupt nicht, und seine Töchter bleiben sitzen. So sind die Leute. Wie ich hier so liege und es von weitem sehe, kommt es mir kraß vor. Was brauchten Sie für Ausdrücke, – phlegmatisch und? Und energisch! Gut, aber was heißt das? Das heißt hart, kalt. Und was heißt hart und kalt? Das heißt grausam. Es ist eine grausame Luft da unten, unerbittlich. Wenn man so liegt und es von weitem sieht, kann es einem davor grauen.“
Settembrini hörte ihm zu und nickte. Er tat dies noch, als Hans Castorp vorläufig mit seiner Kritik zu Rande gekommen war und nicht mehr sprach. Dann atmete er auf und sagte:
„Ich will die besonderen Erscheinungsformen, die die natürliche Grausamkeit des Lebens innerhalb Ihrer Gesellschaft annimmt, nicht beschönigen. Einerlei, der Vorwurf der Grausamkeit bleibt ein ziemlich sentimentaler Vorwurf. Sie würden ihn an Ort und Stelle kaum erhoben haben, aus Furcht, vor sich selber lächerlich zu werden. Sie haben ihn mit Recht den Drückebergern des Lebens überlassen. Daß Sie ihn jetzt erheben, zeugt von einer gewissen Entfremdung, die ich ungern anwachsen sehen würde, denn wer sich gewöhnt, ihn zu erheben, kann ganz leicht dem Leben, der Lebensform, für die er geboren ist, verloren gehen. Wissen Sie, Ingenieur, was das heißt: ‚Dem Leben verloren gehen‘? Ich, ich weiß es, ich sehe es hier alle Tage. Spätestens nach einem halben Jahr hat der junge Mensch, der heraufkommt (und es sind fast lauter junge Menschen, die heraufkommen), keinen anderen Gedanken mehr im Kopf als Flirt und Temperatur. Und spätestens nach einem Jahr wird er auch nie wieder einen anderen fassen können, sondern jeden anderen als ‚grausam‘ oder, besser gesagt, als fehlerhaft und unwissend empfinden. Sie lieben Geschichten, – ich könnte Ihnen aufwarten. Ich könnte Ihnen von dem Sohn und Ehemann erzählen, der elf Monate hier war, und den ich kannte. Er war ein wenig älter als Sie, glaube ich, – sogar schon etwas älter. Man entließ ihn probeweise als gebessert, er kehrte nach Hause zurück in die Arme seiner Lieben; es waren keine Onkel, es waren Mutter und Gattin. Den ganzen Tag lag er mit dem Thermometer im Munde und wußte von nichts anderem. ‚Das versteht ihr nicht‘, sagte er. ‚Dazu muß man oben gelebt haben, um zu wissen, wie es sein muß. Hier unten fehlen die Grundbegriffe.‘ Es endete damit, daß seine Mutter entschied: ‚Geh nur wieder hinauf. Mit dir ist nichts mehr anzufangen.‘ Und er ging wieder hinauf. Er kehrte in die ‚Heimat‘ zurück, – Sie wissen doch, man nennt dies ‚Heimat‘, wenn man einmal hier gelebt hat. Seiner jungen Frau war er völlig entfremdet, es fehlten ihr die ‚Grundbegriffe‘, und sie verzichtete. Sie sah ein, daß er in der Heimat eine Genossin mit übereinstimmenden ‚Grundbegriffen‘ finden und dableiben werde.“
Hans Castorp schien nur mit halbem Ohre zugehört zu haben. Noch immer schaute er in die Glühlichtklarheit des weißen Zimmers hinein wie in eine Weite. Er lachte verspätet und sagte:
„Die Heimat nannte er es? Das ist wohl wirklich etwas sentimental, wie Sie sagen. Ja, Geschichten wissen Sie ohne Zahl. Ich dachte eben noch weiter nach über das, was wir von Härte und Grausamkeit sprachen, ich habe es mir in diesen Tagen schon verschiedentlich durch den Kopf gehen lassen. Sehen Sie, man muß wohl eine ziemlich dicke Haut haben, um von Natur so ganz einverstanden zu sein mit der Denkungsart der Leute da unten im Tieflande und mit solchen Fragen, wie ‚Hat der denn noch Geld?‘ und dem Gesicht, das sie dazu machen. Mir war es eigentlich nie ganz natürlich, obgleich ich nicht einmal ein homo humanus bin, – ich merke nachträglich, daß es mir immer auffallend vorgekommen ist. Vielleicht hing es mit meiner unbewußten Neigung zur Krankheit zusammen, daß es mir nicht natürlich war, – ich habe die alten Stellen ja selbst gehört, und nun hat Behrens angeblich eine frische Kleinigkeit bei mir gefunden. Es kam mir wohl überraschend, und doch habe ich mich im Grunde nicht sehr darüber gewundert. Geradezu felsenfest habe ich mich eigentlich nie gefühlt; und dann sind meine beiden Eltern so früh gestorben, – ich bin von Kind auf Doppelwaise, wissen Sie ...“
Herr Settembrini beschrieb mit Kopf, Schultern und Händen eine einheitliche Gebärde, die die Frage „Nun, und? Was weiter?“ heiter und artig anschaulich machte.
„Sie sind doch Schriftsteller,“ sagte Hans Castorp, „– Literat; Sie müssen sich auf so etwas doch verstehen und einsehen, daß man unter diesen Umständen nicht so recht derb gesinnt sein und die Grausamkeit der Leute ganz natürlich finden kann, – der gewöhnlichen Leute, wissen Sie, die herumgehen und lachen und Geld verdienen und sich den Bauch vollschlagen ... Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ...“
Settembrini verbeugte sich. „Sie wollen sagen,“ erläuterte er, „daß die frühe und wiederholte Berührung mit dem Tode eine Grundstimmung des Gemütes zeitigt, die gegen die Härten und Kruditäten des unbedachten Weltlebens, sagen wir: gegen seinen Zynismus reizbar und empfindlich macht.“
„Genau so!“ rief Hans Castorp in aufrichtiger Begeisterung. „Tadellos ausgedrückt bis aufs i-Tüpfelchen, Herr Settembrini! Mit dem Tode –! Ich wußte es ja, daß Sie als Literat ...“
Settembrini streckte die Hand gegen ihn aus, indem er den Kopf auf die Seite legte und die Augen schloß, – eine sehr schöne und sanfte Gebärde des Einhalttuns und der Bitte um weiteres Gehör. Er verharrte mehrere Sekunden in dieser Stellung, auch als Hans Castorp schon lange schwieg und in einiger Verlegenheit der Dinge wartete, die da kommen sollten. Endlich schlug er seine schwarzen Augen – die Augen der Drehorgelmänner – wieder auf und sprach:
„Gestatten Sie. Gestatten Sie mir, Ingenieur, Ihnen zu sagen und Ihnen ans Herz zu legen, daß die einzig gesunde und edle, übrigens auch – ich will das ausdrücklich hinzufügen – auch die einzig religiöse Art, den Tod zu betrachten, die ist, ihn als Bestandteil und Zubehör, als heilige Bedingung des Lebens zu begreifen und zu empfinden, nicht aber – was das Gegenteil von gesund, edel, vernünftig und religiös wäre – ihn geistig irgendwie davon zu scheiden, ihn in Gegensatz dazu zu bringen und ihn etwa gar widerwärtigerweise dagegen auszuspielen. Die Alten schmückten ihre Sarkophage mit Sinnbildern des Lebens und der Zeugung, sogar mit obszönen Symbolen, – das Heilige war der antiken Religiosität ja sehr häufig eins mit dem Obszönen. Diese Menschen wußten den Tod zu ehren. Der Tod ist ehrwürdig als Wiege des Lebens, als Mutterschoß der Erneuerung. Vom Leben getrennt gesehen, wird er zum Gespenst, zur Fratze – und zu etwas noch Schlimmerem. Denn der Tod als selbständige geistige Macht ist eine höchst liederliche Macht, deren lasterhafte Anziehungskraft zweifellos sehr stark ist, aber mit der zu sympathisieren ebenso unzweifelhaft die gräulichste Verirrung des Menschengeistes bedeutet.“
Hier schwieg Herr Settembrini. Er blieb bei dieser Allgemeinheit stehen und endete auf das bestimmteste. Es war ihm Ernst; nicht unterhaltungsweise hatte er geredet, hatte es verschmäht, seinem Partner Gelegenheit zur Anknüpfung und Gegenrede zu bieten, sondern am Ende seiner Aufstellungen die Stimme sinken lassen und einen Punkt gemacht. Er saß geschlossenen Mundes, die gekreuzten Hände im Schoß, ein Bein in der karierten Hose über das andere geschlagen, und wippte nur leicht mit dem in der Luft schwebenden Fuß, den er streng betrachtete.
Auch Hans Castorp schwieg denn also. In seinem Plumeau sitzend, wandte er den Kopf zur Wand und trommelte leicht mit den Fingerspitzen auf der Steppdecke. Er kam sich belehrt, zurechtgewiesen, ja gescholten vor, und in seinem Schweigen lag viel kindliche Verstocktheit. Die Gesprächspause dauerte ziemlich lange.
Endlich hob Herr Settembrini wieder das Haupt und sagte lächelnd:
„Erinnern Sie sich wohl, Ingenieur, daß wir einen ähnlichen Disput schon einmal geführt haben – man kann sagen: denselben? Wir plauderten damals – ich glaube, es war auf einem Spaziergang – über Krankheit und Dummheit, deren Vereinigung Sie für eine Paradoxie erklärten, und zwar aus Hochachtung vor der Krankheit. Ich nannte diese Hochachtung eine düstere Grille, mit der man den Gedanken des Menschen entehre, und Sie schienen zu meinem Vergnügen denn doch nicht ganz abgeneigt, meinen Einwand in Erwägung zu ziehen. Wir sprachen auch von der Neutralität und geistigen Unschlüssigkeit der Jugend, von ihrer Wahlfreiheit, ihrer Neigung, mit den möglichen Standpunkten Versuche anzustellen, und davon, daß man solche Versuche noch nicht als endgültige und lebensernste Optionen betrachten dürfe, – zu betrachten brauche. Wollen Sie mir –,“ und Herr Settembrini beugte sich lächelnd auf seinem Stuhle vor, die Füße nebeneinander am Boden, die zusammengelegten Hände zwischen den Knien, den Kopf gleichfalls etwas schräg vorgeschoben – „wollen Sie mir auch fernerhin,“ sagte er, und es war eine leichte Bewegung in seiner Stimme, „erlauben, Ihnen bei Ihren Übungen und Experimenten ein wenig zur Hand zu gehen und berichtigend auf Sie einzuwirken, wenn die Gefahr verderblicher Fixierungen droht?“
„Aber gewiß, Herr Settembrini!“ Hans Castorp beeilte sich, seine befangene und halb trotzige Abkehr aufzugeben, das Trommeln auf der Bettdecke zu unterlassen und sich seinem Gaste mit bestürzter Freundlichkeit zuzuwenden. „Es ist sogar außerordentlich liebenswürdig von Ihnen ... Ich frage mich wirklich, ob ich ... Das heißt, ob es sich bei mir ...“
„Ganz sine pecunia“, zitierte Herr Settembrini, indem er aufstand. „Wer will sich denn lumpen lassen.“ Sie lachten. Man hörte die äußere Doppeltür gehen, und im nächsten Augenblick wurde auch die innere geklinkt. Es war Joachim, der aus der Abendgeselligkeit zurückkehrte. Beim Anblick des Italieners errötete auch er, wie Hans Castorp für sein Teil es vorhin getan: die verbrannte Dunkelheit seines Gesichtes vertiefte sich um eine Schattierung.
„Oh, du hast Besuch“, sagte er. „Wie angenehm für dich. Ich bin aufgehalten worden. Sie haben mich zu einer Partie Bridge gepreßt, – Bridge nennen sie das nach außen hin,“ sagte er kopfschüttelnd, „und dabei war es schließlich ganz was anderes. Ich habe fünf Mark gewonnen ...“
„Daß das nur keine lasterhafte Anziehungskraft für dich bekommt“, sagte Hans Castorp. „Hm, hm. Herr Settembrini hat mir unterdessen so schön die Zeit vertrieben ... was übrigens gar kein Ausdruck ist. Es gilt allenfalls von euerem falschen Bridge, aber Herr Settembrini hat mir die Zeit so bedeutend ausgefüllt ... Als anständiger Mensch müßte man ja mit Händen und Füßen trachten, hier fortzukommen, – wo es nun schon mit falschem Bridge losgeht in euerer Mitte. Aber um Herrn Settembrini noch recht oft zu hören und mir von ihm gesprächsweise zur Hand gehen zu lassen, könnte ich beinahe wünschen, unabsehbar lange febril zu bleiben und hier bei euch festzusitzen ... Am Ende muß man mir noch eine Stumme Schwester geben, damit ich nicht mogle.“
„Ich wiederhole, Ingenieur, daß Sie ein Schalk sind“, sagte der Italiener. Er empfahl sich in den angenehmsten Formen. Mit seinem Vetter allein geblieben, seufzte Hans Castorp auf.
„Ist das ein Pädagog!“ sagte er ... „Ein humanistischer Pädagog, das muß man gestehen. Immerfort wirkt er berichtigend auf dich ein, abwechselnd in Form von Geschichten und in abstrakter Form. Und auf Dinge kommt man mit ihm zu sprechen, – nie hätte man gedacht, daß man darüber reden oder sie auch nur verstehen könnte. Und wenn ich unten im Flachlande mit ihm zusammengetroffen wäre, so würde ich sie auch nicht verstanden haben“, fügte er hinzu.
Joachim blieb um diese Zeit eine Weile bei ihm; er opferte zwei, drei Viertelstunden von seiner Abendliegekur. Manchmal spielten sie Schach auf Hans Castorps Eßtischplatte, – Joachim hatte ein Spiel von unten heraufgebracht. Später begab er sich mit Sack und Pack, das Thermometer im Munde, auf seinen Balkon, und auch Hans Castorp maß sich ein letztes Mal, während leichte Musik von näher oder fernher aus dem nächtlichen Tale heraufklang. Um zehn Uhr wurde die Liegekur beendigt; man hörte Joachim; man hörte das Ehepaar vom Schlechten Russentisch ... Und Hans Castorp nahm Seitenlage ein, in Erwartung des Schlafes.
Die Nacht war die schwierigere Hälfte des Tages, denn Hans Castorp erwachte oft und lag nicht selten stundenlang wach, sei es, weil seine nicht ganz korrekte Blutwärme ihn munter hielt, oder weil Lust und Kraft zum Schlafe durch seine derzeit völlig horizontale Lebensweise Einbuße erlitten. Dafür waren die Stunden des Schlummers von abwechslungsreichen und sehr lebensvollen Träumen belebt, denen er nachhängen konnte, während er wach lag. Und wenn die vielfache Gliederung und Einteilung des Tages diesen kurzweilig machte, so war es bei Nacht die verschwimmende Einförmigkeit der schreitenden Stunden, was in der gleichen Richtung wirkte. Nahte sich aber erst einmal der Morgen, so war es unterhaltend, das allmähliche Ergrauen und Erscheinen des Zimmers, das Hervortreten und Entschleiertwerden der Dinge zu beobachten, den Tag draußen in trüb schwelender oder heiterer Glut sich entzünden zu sehen; und eh mans gedacht, war wieder der Augenblick da, wo das handfeste Klopfen des Bademeisters das Inkrafttreten der Tagesordnung verkündete.
Hans Castorp hatte keinen Kalender auf seinen Ausflug mitgenommen, und so fand er sich in betreff des Datums nicht immer ganz genau auf dem laufenden. Dann und wann forderte er Auskunft von seinem Vetter, der aber in diesem Punkte auch nicht jederzeit seiner Sache eben sicher war. Immerhin boten die Sonntage, besonders der zweite, vierzehntägige mit Konzert, den Hans Castorp auf diese Weise verbrachte, einigen Anhalt, und so viel war gewiß, daß der September nachgerade ziemlich weit, bis gegen seine Mitte hin, vorgeschritten war. Draußen im Tale war, seitdem Hans Castorp Bettlage eingenommen, das trübe und kalte Wetter, das damals geherrscht hatte, herrlichen Hochsommertagen gewichen, ungezählten solcher Tage, einer ganzen Serie davon, so daß Joachim allmorgendlich in weißen Hosen bei seinem Vetter eingetreten war und dieser ein redliches Bedauern, ein Bedauern der Seele und seiner jungen Muskeln, über den Verlust solcher Prachtzeit nicht hatte unterdrücken können. Sogar eine „Schande“ hatte er es einmal mit leiser Stimme genannt, daß er sie solcherart versäume, – dann aber zu seiner Beschwichtigung hinzugefügt, daß er ja auf freiem Fuße auch nicht viel mehr als jetzt damit anzufangen gewußt hätte, da sich ihm ausgiebige Bewegung hier erfahrungsgemäß verbiete. Und einigen Anteil an dem warmen Schimmer dort draußen gewährte die breite, weit offene Balkontür ihm immerhin.
Aber gegen das Ende der ihm auferlegten Zurückgezogenheit schlug wieder das Wetter um. Über Nacht war es neblig und kalt geworden, das Tal hüllte sich in nasses Schneegestöber, und der trockene Hauch der Dampfheizung erfüllte das Zimmer. So war es auch an dem Tage, als Hans Castorp bei der Morgenvisite der Ärzte den Hofrat erinnerte, daß er heute drei Wochen liege, und um die Erlaubnis bat, aufzustehen.
„Was Kuckuck, sind Sie schon fertig?“ sagte Behrens. „Lassen Sie mal sehen; wahrhaftig, es stimmt. Gott, wie man alt wird. Geändert hat sich mit Ihnen ja nicht gerade viel unterdessen. Was, gestern war es normal? Ja, bis auf die 6-Uhr-Nachmittagsmessung. Na, Castorp, dann will ich ja auch nicht so sein und will Sie der menschlichen Sozietät zurückerstatten. Stehen Sie auf und wandeln Sie, Mann! In den gegebenen Grenzen und Maßen natürlich. Wir machen nächstens Ihr Innenkonterfei. Vormerken!“ sagte er im Hinausgehen zu Dr. Krokowski, indem er mit seinem riesigen Daumen über die Schulter auf Hans Castorp deutete und den bleichen Assistenten mit seinen blutigen, tränenden blauen Augen ansah ... Hans Castorp verließ die „Remise“.
Mit hochgeschlagenem Mantelkragen und in Gummischuhen begleitete er seinen Vetter zum ersten Male wieder zur Bank am Wasserlauf und zurück, nicht ohne unterwegs die Frage aufzuwerfen, wie lange der Hofrat ihn wohl hätte liegen lassen, wenn er die Frist nicht als abgelaufen gemeldet hätte. Und Joachim, gebrochenen Blickes, den Mund wie zu einem hoffnungslosen „Ach“ geöffnet, machte in die Luft hinein die Gebärde des Unabsehbaren.
Es dauerte eine Woche, bis Hans Castorp durch die Oberin von Mylendonk ins Durchleuchtungslaboratorium bestellt wurde. Er mochte nicht drängen. Man war beschäftigt im Hause „Berghof“, offenbar hatten Ärzte und Personal alle Hände voll zu tun. Neue Gäste waren in den letzten Tagen angelangt: zwei russische Studenten mit dickem Haar und geschlossenen schwarzen Blusen, die keinen Schimmer von Wäsche sehen ließen; ein holländisches Ehepaar, dem an Settembrinis Tische Plätze angewiesen wurden; ein buckliger Mexikaner, der die Tischgesellschaft durch furchtbare Anfälle von Atemnot in Schrecken setzte: er klammerte sich dabei mit ehernem Griff seiner langen Hände an seine Nachbarn, ob Herr oder Dame, hielt fest wie ein Schraubstock und zog die entsetzt Widerstrebenden, um Hilfe Rufenden so in seine Ängste hinein. Kurzum, der Speisesaal war beinahe voll besetzt, obgleich die Wintersaison erst mit dem Oktober begann. Und die Schwere von Hans Castorps Fall, sein Krankheitsgrad, gab ihm kaum ein Recht, besonderen Anspruch auf Beachtung zu erheben. Frau Stöhr etwa war in all ihrer Dummheit und Unbildung ohne Zweifel viel kränker als er, von Dr. Blumenkohl ganz zu schweigen. Man hätte jedes Sinnes für Rangordnung und Abstand entbehren müssen, um in Hans Castorps Fall nicht bescheidene Zurückhaltung zu üben, – besonders da eine solche Gesinnung zum Geiste des Hauses gehörte. Leichtkranke galten nicht viel, er hatte es öfters aus den Gesprächen herausgehört. Man sprach mit Geringschätzung von ihnen, nach dem hierorts geltenden Maßstab, sie wurden über die Achsel angesehen, und zwar nicht allein von den Höher- und Hochgradigen, sondern auch von solchen, die selbst nur „leicht“ waren: womit diese freilich Geringschätzung auch ihrerselbst an den Tag legten, aber eine höhere Selbstachtung retteten, indem sie dem Maßstab sich unterwarfen. So ist es menschlich. „Ach, der!“ konnten sie wohl voneinander sagen, „dem fehlt eigentlich nichts, kaum daß er das Recht hat, hier zu sein. Nicht mal eine Kaverne hat er ...“ Dies war der Geist; er war aristokratisch in seinem besonderen Sinn, und Hans Castorp salutierte ihn aus angeborener Achtung vor Gesetz und Ordnung jeder Art. Ländlich, sittlich, heißt es. Reisende zeigen sich wenig gebildet, wenn sie über die Sitten und Werte ihrer Wirtsvölker sich lustig machen, und der Eigenschaften, die Ehre schaffen, gibt es diese und jene. Sogar gegen Joachim selbst beobachtete Hans Castorp eine gewisse Ehrerbietung und Rücksicht, – nicht sowohl, weil dieser der länger Eingesessene war und sein Anleiter und Cicerone in dieser Welt –, sondern namentlich, weil er der zweifellos „Schwerere“ war. Da aber alles so lag, war es begreiflich, daß man dazu neigte, aus seinem Falle das Mögliche zu machen und in Hinsicht auf ihn auch wohl zu übertreiben, um zur Aristokratie zu gehören oder ihr näher zu kommen. Auch Hans Castorp, wenn er bei Tische gefragt wurde, nannte wohl ein paar Striche mehr, als er in Wahrheit gemessen, und konnte unmöglich umhin, sich geschmeichelt zu fühlen, wenn man ihm mit dem Finger drohte, wie einem, der es faustdick hinter den Ohren hat. Aber auch, wenn er ein wenig auftrug, blieb er immer noch, eigentlich gesprochen, eine Person von geringen Graden, und so waren Geduld und Zurückhaltung denn sicherlich das ihm zukommende Betragen.
Er hatte die Lebensweise seiner ersten drei Wochen, dies schon vertraute, gleichmäßige und genau geregelte Leben an Joachims Seite wieder aufgenommen, und es ging wie am Schnürchen vom ersten Tage an, als sei es nie unterbrochen worden. In der Tat war diese Unterbrechung nichtig gewesen; er bekam es gleich gelegentlich seines ersten Wiedererscheinens bei Tische deutlich zu spüren. Zwar hatte Joachim, der auf solche Markierungen ein ganz bestimmtes und geflissentliches Gewicht legte, Sorge getragen, daß ein paar Blumen den Platz des Erstandenen schmückten. Aber die Begrüßung durch die Tischgenossen war wenig festlich, unterschied sich von früheren, denen eine Trennung nicht von drei Wochen, sondern von drei Stunden vorangegangen war, nur unwesentlich: weniger aus Gleichgültigkeit gegen seine einfache und sympathische Person und weil diese Leute allzusehr mit sich selbst, das heißt: mit ihrem interessanten Körper beschäftigt waren, als darum, weil ihnen die Zwischenzeit nicht bewußt geworden war. Und Hans Castorp konnte ihnen darin ohne Schwierigkeit folgen, denn er selbst saß an seinem Platz am Tischende, zwischen der Lehrerin und Miß Robinson, nicht anders, als habe er spätestens gestern zuletzt hier gesessen.
Wenn man aber am Tische selbst von der Beendigung seiner Zurückgezogenheit nicht viel Aufhebens gemacht hatte, – wie hätte man im weiteren Saal welches davon machen sollen? Dort hatte buchstäblich niemand auch nur Notiz davon genommen, – mit alleiniger Ausnahme Settembrinis, der nach Schluß der Mahlzeit zu spaßhaft-freundschaftlicher Begrüßung herangekommen war. Hans Castorp hätte freilich noch eine weitere Einschränkung gemacht, deren Berechtigung wir dahinstellen müssen. Er behauptete bei sich, daß Clawdia Chauchat sein Wiedererscheinen bemerkt –, gleich bei ihrem, wie immer, verspäteten Eintreten, nach dem Zufallen der Glastür, ihren schmalen Blick habe auf ihm ruhen lassen, dem er mit seinem begegnet war, und kaum, daß sie sich niedergesetzt, noch einmal über die Schulter sich lächelnd nach ihm umgesehen habe: lächelnd, wie vor drei Wochen, bevor er zur Untersuchung gegangen. Und eine so unverhohlene und rücksichtslose Bewegung war das gewesen – rücksichtslos in betreff seinerselbst wie auch der übrigen Gästeschaft –, daß er nicht gewußt hatte, ob er sich darüber entzücken oder es als ein Zeichen von Geringschätzung verstehen und sich darüber ärgern sollte. Auf jeden Fall hatte sein Herz sich zusammengekrampft unter diesen Blicken, welche die zwischen der Kranken und ihm obwaltende gesellschaftliche Unbekanntschaft auf eine in seinen Augen ungeheuerliche und berauschende Weise verleugnet und Lügen gestraft hatte, – sich fast schmerzhaft zusammengekrampft schon, als die Glastür klirrte, denn auf diesen Augenblick hatte er mit kurz gehendem Atem gewartet.
Es will nachgetragen sein, daß Hans Castorps innere Beziehungen zu der Patientin vom Guten Russentisch, die Teilnahme seiner Sinne und seines bescheidenen Geistes an ihrer mittelgroßen, weich schleichenden, kirgisenäugigen Person, kurzum seine Verliebtheit (das Wort habe Statt, obgleich es ein Wort von „unten“, ein Wort der Ebene ist und die Vorstellung erwecken könnte, als sei das Liedchen „Wie berührt mich wundersam“ hier irgendwie anwendbar gewesen) – während seiner Zurückgezogenheit sehr starke Fortschritte gemacht hatte. Ihr Bild hatte ihm vorgeschwebt, wenn er, frühwach, in das sich zögernd entschleiernde Zimmer, oder, am Abend, in die dichter werdende Dämmerung geblickt hatte (auch zu jener Stunde, als Settembrini unter plötzlichem Aufflammen des Lichtes bei ihm eingetreten war, hatte es ihm überaus deutlich vorgeschwebt, und dies war der Grund gewesen, weshalb er bei dem Anblick des Humanisten errötet war); an ihren Mund, ihre Wangenknochen, ihre Augen, deren Farbe, Form, Stellung ihm in die Seele schnitt, ihren schlaffen Rücken, ihre Kopfhaltung, den Halswirbel im Nackenausschnitt ihrer Bluse, ihre von dünnster Gaze verklärten Arme hatte er gedacht während der einzelnen Stunden des zerkleinerten Tages, – und wenn wir verschwiegen, daß dies das Mittel gewesen, wodurch ihm die Stunden so mühelos vergingen, so geschah es, weil wir sympathisch teilnehmen an der Gewissensunruhe, die sich in das erschreckende Glück dieser Bilder und Gesichte mischte. Ja, es war Schreck, Erschütterung damit verbunden, eine ins Unbestimmte, Unbegrenzte und vollständig Abenteuerliche ausschweifende Hoffnung, Freude und Angst, die namenlos war, aber des jungen Mannes Herz – sein Herz im eigentlichen und körperlichen Sinn – zuweilen so jäh zusammenpreßte, daß er die eine Hand in die Gegend dieses Organs, die andere aber zur Stirn führte (sie wie einen Schirm über die Augen legte) und flüsterte:
„Mein Gott!“
Denn hinter der Stirn waren Gedanken oder Halbgedanken, die den Bildern und Gesichten ihre zu weit gehende Süßigkeit eigentlich erst verliehen, und die sich auf Madame Chauchats Nachlässigkeit und Rücksichtslosigkeit bezogen, auf ihr Kranksein, die Steigerung und Betonung ihres Körpers durch die Krankheit, die Verkörperlichung ihres Wesens durch die Krankheit, an der er, Hans Castorp, laut ärztlichen Spruches nun teilhaben sollte. Er begriff hinter seiner Stirn die abenteuerliche Freiheit, mit der Frau Chauchat durch ihr Umblicken und Lächeln die zwischen ihnen bestehende gesellschaftliche Unbekanntschaft außer acht ließ, so, als seien sie überhaupt keine gesellschaftlichen Wesen und als sei es nicht einmal nötig, daß sie miteinander sprächen ... und ebendies war es, worüber er erschrak: in demselben Sinne erschrak wie damals im Untersuchungszimmer, als er von Joachims Oberkörper eilig suchend zu seinen Augen emporgeblickt hatte, – mit dem Unterschiede, daß damals Mitleid und Sorge die Gründe seines Erschreckens gewesen, hier aber ganz anderes im Spiele war.
Nun also ging das Berghof-Leben, dies gunstreiche und wohlgeregelte Leben auf engem Schauplatz wieder seinen gleichmäßigen Gang, – Hans Castorp, in Erwartung der Innenaufnahme, fuhr fort, es mit dem guten Joachim zu teilen, indem er es Stunde für Stunde genau so trieb wie dieser; und diese Nachbarschaft war wohl gut für den jungen Mann. Denn obgleich es nur eine Krankennachbarschaft war, so war viel militärische Ehrbarkeit darin: eine Ehrbarkeit, die freilich, ohne es gewahr zu werden, schon im Begriffe stand, im Kurdienste Genüge zu finden, so daß dieser gleichsam zum Ersatzmittel tiefländischer Pflichterfüllung und zum untergeschobenen Berufe wurde, – Hans Castorp war nicht so dumm, es nicht ganz genau zu bemerken. Doch aber fühlte er wohl ihre zügelnde, zurückhaltende Wirkung auf sein zivilistisches Gemüt, – sogar mochte es diese Nachbarschaft sein, ihr Beispiel und die Beaufsichtigung durch sie, was ihn von äußeren Schritten und blinden Unternehmungen zurückhielt. Denn er sah wohl, was der brave Joachim von einer gewissen, täglich auf ihn eindringenden Apfelsinenatmosphäre, worin es runde braune Augen, einen kleinen Rubin, viel schwach gerechtfertigte Lachlust und eine äußerlich wohlgebildete Brust gab, auszustehen hatte, und die Vernunft und Ehrliebe, mit der Joachim den Einfluß dieser Atmosphäre scheute und floh, ergriff Hans Castorp, hielt ihn selbst in einiger Zucht und Ordnung und hinderte ihn, sich von der Schmaläugigen sozusagen „einen Bleistift zu leihen“, – wozu er ohne die disziplinierende Nachbarschaft aller Erfahrung nach sehr bereitgewesen wäre.
Joachim sprach niemals von der lachlustigen Marusja, und so verbot es sich auch für Hans Castorp, mit ihm von Clawdia Chauchat zu sprechen. Er hielt sich schadlos durch verstohlenen Austausch mit der Lehrerin zu seiner Rechten bei Tische, wobei er das alte Mädchen durch Neckereien mit ihrer Schwäche für die schmiegsame Kranke zum Erröten brachte und unterdessen die Kinn- und Würdenstütze des alten Castorp nachahmte. Auch drang er in sie, über Madame Chauchats persönliche Verhältnisse, über ihre Herkunft, ihren Mann, ihr Alter, die Art ihres Krankheitsfalles Neues und Wissenswertes in Erfahrung zu bringen. Ob sie denn Kinder habe, wollte er wissen. – Aber nein doch, sie hatte keine. Was sollte eine Frau wie sie wohl mit Kindern beginnen? Wahrscheinlich war es ihr streng untersagt, welche zu haben – und andererseits: was würden denn das auch wohl für Kinder sein? Hans Castorp mußte dem beipflichten. Nachgerade sei es auch wohl zu spät dafür, vermutete er mit gewaltsamer Sachlichkeit. Zuweilen, im Profil, scheine Madame Chauchats Gesicht ihm fast schon ein wenig scharf. Ob sie wohl über dreißig sei? – Fräulein Engelhart widersprach heftig. Clawdia dreißig? Allerschlimmstenfalls sei sie achtundzwanzig. Und was das Profil betraf, so verbot sie ihrem Tischnachbar, so etwas zu sagen. Clawdias Profil sei von der weichsten Jugendlichkeit und Süße, wenn es natürlich auch ein interessantes Profil sei und nicht das irgendeiner gesunden Gans. Und zur Strafe fügte Fräulein Engelhart ohne Pause hinzu, sie wisse, daß Frau Chauchat öfters Herrenbesuch empfange, den Besuch eines in „Platz“ wohnenden Landsmannes: sie empfange ihn nachmittags auf ihrem Zimmer.
Das war gut gezielt. Hans Castorps Gesicht verzerrte sich gegen alle Bemühung, und auch die auf „Was nicht gar“ und „Sehe einer an“ gestimmten Redensarten, mit denen er die Eröffnung zu behandeln versuchte, waren verzerrt. Unfähig, das Vorhandensein dieses Landsmannes auf die leichte Achsel zu nehmen, wie er sich anfangs den Anschein hatte geben wollen, kam er mit zuckenden Lippen beständig auf ihn zurück. Ein jüngerer Mann? – Jung und ansehnlich, nach allem, was sie höre, erwiderte die Lehrerin; denn nach eigenem Augenschein konnte sie nicht urteilen. – Krank? – Höchstens leichtkrank! – Er wolle hoffen, sagte Hans Castorp höhnisch, daß mehr Wäsche an ihm zu sehen sei als bei den Landsleuten am Schlechten Russentisch, – wofür die Engelhart, noch immer zur Strafe, einstehen zu wollen erklärte. Da gab er zu, es sei eine Angelegenheit, um die man sich kümmern müsse, und beauftragte sie ernstlich, in Erfahrung zu bringen, was es mit diesem aus und ein gehenden Landsmann auf sich habe. Statt ihm aber Nachrichten hierüber zu bringen, wußte sie einige Tage später etwas völlig Neues.
Sie wußte, daß Clawdia Chauchat gemalt werde, porträtiert – und fragte Hans Castorp, ob er es auch wisse. Wenn nicht, so könne er trotzdem überzeugt davon sein, sie habe es aus sicherster Quelle. Seit längerem sitze sie hier im Hause jemandem Modell zu ihrem Bildnis – und zwar wem? Dem Hofrat! Herrn Hofrat Behrens, der sie zu diesem Zweck beinahe täglich in seiner Privatwohnung bei sich sehe.
Diese Kunde ergriff Hans Castorp noch mehr als die vorige. Er machte fortan viele verzerrte Späße darüber. Nun, gewiß, es sei ja bekannt, daß der Hofrat in Öl male, – was die Lehrerin denn wolle, das sei nicht verboten, und so stehe es jedermann frei. In des Hofrats Witwerheim also? Hoffentlich sei wenigstens Fräulein von Mylendonk bei den Sitzungen anwesend. – Die habe wohl keine Zeit. – „Mehr Zeit als die Oberin sollte auch Behrens nicht haben“, sagte Hans Castorp streng. Aber obgleich damit etwas Endgültiges über die Sache gesagt schien, war er weit entfernt, sie fallen zu lassen, sondern erschöpfte sich in Fragen nach Näherem und Weiterem: über das Bild, sein Format und ob es ein Kopf- oder Kniestück sei; auch über die Stunde der Sitzungen, – während doch Fräulein Engelhart mit Einzelheiten auch hier nicht dienen konnte und ihn auf die Ergebnisse weiterer Nachforschungen vertrösten mußte.
Hans Castorp maß 37,7 nach dem Empfang dieser Nachricht. Weit mehr noch, als die Besuche, die Frau Chauchat empfing, schmerzten und beunruhigten ihn diejenigen, die sie machte. Frau Chauchats Privat- und Eigenleben als solches an und für sich und schon unabhängig von seinem Inhalt hatte angefangen, ihm Schmerz und Unruhe zu bereiten, und wie sehr mußte sich beides erst verschärfen, da ihm Mehrdeutigkeiten über diesen Inhalt zu Ohren kamen! Zwar schien es allgemein möglich, daß die Beziehungen des russischen Besuchers zu seiner Landsmännin nüchterner und harmloser Natur waren; aber Hans Castorp war seit einiger Zeit geneigt, Nüchternheit und Harmlosigkeit für Schnickschnack zu halten, – wie er sich denn auch nicht überwinden oder bereden konnte, die Ölmalerei als Beziehung zwischen einem forsch redenden Witwer und einer schmaläugig-leisetreterischen jungen Frau für etwas anderes anzusehen. Der Geschmack, den der Hofrat mit der Wahl seines Modells bekundete, entsprach zu sehr seinem eigenen, als daß er hier an Nüchternheit hätte glauben können, worin ihn die Vorstellung von des Hofrats blauen Backen und seinen rot geäderten Quellaugen denn auch nur wenig unterstützte.
Eine Wahrnehmung, die er in diesen Tagen auf eigene Hand und zufällig machte, wirkte in anderer Weise auf ihn ein, obgleich es sich abermals um eine Bestätigung seines Geschmackes handelte. Es war da am querstehenden Tische der Frau Salomon und des gefräßigen Schülers mit der Brille, links von dem der Vettern, nächst der seitlichen Glastür, ein Kranker, Mannheimer seiner Herkunft nach, wie Hans Castorp gehört hatte, etwa dreißigjährig, mit gelichtetem Haupthaar, kariösen Zähnen und einer zaghaften Redeweise, – derselbe, der zuweilen während der Abendgeselligkeit auf dem Piano spielte, und zwar meistens den Hochzeitsmarsch aus dem „Sommernachtstraum“. Er sollte sehr fromm sein, wie es begreiflicherweise nicht selten unter Denen hier oben der Fall sei, so hatte Hans Castorp sagen hören. Allsonntäglich sollte er den Gottesdienst drunten in „Platz“ besuchen und in der Liegekur andächtige Bücher lesen, Bücher mit einem Kelch oder Palmzweigen auf dem Vorderdeckel. Dieser nun, so bemerkte Hans Castorp eines Tages, hatte seine Blicke ebendort, wo er selbst sie hatte, – hing mit ihnen an Madame Chauchats schmiegsamer Person, und zwar auf eine Art, die scheu und zudringlich bis zum Hündischen war. Nachdem Hans Castorp es einmal beobachtet, konnte er nicht umhin, es wieder und wieder festzustellen. Er sah ihn abends im Spielzimmer inmitten der Gäste stehen, trübe verloren in den Anblick der lieblichen, wenn auch schadhaften Frau, die drüben im kleinen Salon auf dem Sofa saß und mit der wollhaarigen Tamara (so hieß das humoristische Mädchen), mit Dr. Blumenkohl und den konkaven und hängeschultrigen Herren ihres Tisches plauderte; sah ihn sich abwenden, sich herumdrücken und wieder langsam, mit seitlich gedrehten Augäpfeln und kläglich geschürzter Oberlippe den Kopf über die Schulter dorthin wenden. Er sah ihn sich verfärben und nicht aufblicken, dann aber dennoch aufblicken und gierig schauen, wenn die Glastür fiel und Frau Chauchat zu ihrem Platze glitt. Und mehrmals sah er, wie der Arme sich nach Tische zwischen Ausgang und Gutem Russentisch aufstellte, um Frau Chauchat an sich vorübergehen zu lassen und sie, die seiner nicht achtete, aus unmittelbarer Nähe mit Augen zu verschlingen, die bis zum Grunde mit Traurigkeit angefüllt waren.
Auch diese Entdeckung also setzte dem jungen Hans Castorp nicht wenig zu, obgleich die klägliche Schaubegier des Mannheimers ihn nicht in dem Sinne beunruhigen konnte, wie der Privatverkehr Clawdia Chauchats mit Hofrat Behrens, einem ihm an Alter, Person und Lebensstellung so übergeordneten Mann. Clawdia kümmerte sich gar nicht um den Mannheimer, – es wäre Hans Castorps innerer Geschärftheit nicht entgangen, wenn es der Fall gewesen wäre, und nicht der widrige Stachel der Eifersucht war es also in diesem Falle, den er in der Seele spürte. Aber er erprobte alle Empfindungen, die Rausch und Leidenschaft eben erproben, wenn sie in der Außenwelt ihrer selbst ansichtig werden, und die das sonderbarste Gemisch aus Ekel- und Gemeinschaftsgefühlen bilden. Unmöglich, alles zu ergründen und auseinanderzulegen, wenn wir von der Stelle kommen wollen. Auf jeden Fall war es viel auf einmal für seine Verhältnisse, was auch die Beobachtung des Mannheimers dem armen Hans Castorp zu durchkosten gab.
So vergingen die acht Tage bis zu Hans Castorps Durchleuchtung. Er hatte nicht gewußt, daß sie bis dahin vergehen würden, aber als er eines Morgens beim ersten Frühstück durch die Oberin (sie hatte schon wieder ein Gerstenkorn, es konnte nicht mehr dasselbe sein, offenbar war dies harmlose, aber entstellende Leiden in ihrer Verfassung gelegen) den Befehl erhielt, sich nachmittags im Laboratorium einzufinden, da waren sie eben vergangen. Zusammen mit seinem Vetter sollte Hans Castorp sich stellen, eine halbe Stunde vor dem Tee; denn auch von Joachim sollte bei dieser Gelegenheit wieder eine Innenansicht aufgenommen werden, – die letzte mußte schon für veraltet gelten.
So hatten sie heute die große Nachmittagsliegekur um dreißig Minuten abgekürzt, waren mit dem Schlage halb vier die steinerne Treppe in das falsche Kellergeschoß „hinab“gestiegen und saßen zusammen in dem kleinen Warteraum, der das Ordinationszimmer vom Durchleuchtungslaboratorium trennte, – Joachim, dem nichts Neues bevorstand, in guter Ruhe, Hans Castorp etwas fiebrig erwartungsvoll, da man bisher noch niemals Einblick in sein organisches Innenleben genommen. Sie waren nicht allein: mehrere Gäste hatten, zerrissene illustrierte Zeitschriften auf den Knien, schon im Zimmer gesessen, als sie eingetreten waren, und warteten mit ihnen: ein reckenhafter junger Schwede, der im Speisesaal an Settembrinis Tische saß, und von dem man sagte, er sei bei seiner Ankunft im April so krank gewesen, daß man ihn kaum habe aufnehmen wollen; nun aber habe er achtzig Pfund zugenommen und sei im Begriffe, als völlig geheilt entlassen zu werden; ferner eine Frau vom Schlechten Russentisch, eine Mutter, selbst kümmerlich, mit ihrem noch kümmerlicheren, langnäsigen und häßlichen Knaben namens Sascha. Diese Personen also warteten schon länger als die Vettern; offenbar hatten sie in der Reihenfolge der Bestellungen den Vorrang vor ihnen, Verspätung schien eingerissen nebenan im Durchleuchtungsraum, und so stand kalter Tee in Aussicht.
Im Laboratorium war man beschäftigt. Die Stimme des Hofrats war zu hören, der Anweisungen gab. Es war halb vier Uhr oder etwas darüber, als die Tür sich öffnete, – ein technischer Assistent, der hier unten tätig war, öffnete sie – und nur erst der schwedische Recke und Glückspilz eingelassen wurde: offenbar hatte man seinen Vorgänger durch einen anderen Ausgang entlassen. Die Geschäfte wickelten sich nun schneller ab. Nach zehn Minuten schon hörte man den völlig genesenen Skandinavier, diese wandelnde Empfehlung des Ortes und der Heilanstalt, sich starken Schrittes über den Korridor entfernen, und die russische Mutter nebst Sascha wurden empfangen. Wiederum, wie schon beim Eintritt des Schweden, bemerkte Hans Castorp, daß im Durchleuchtungsraum Halbdunkel, das heißt künstliches Halblicht herrschte, – gerade wie andererseits in Dr. Krokowskis analytischem Kabinett. Die Fenster waren verhüllt, das Tageslicht abgesperrt, und ein paar elektrische Lampen brannten. Während man aber Sascha und seine Mutter einließ und Hans Castorp ihnen nachblickte, – gleichzeitig also hiermit ging die Korridortür auf, und der nächstbestellte Patient betrat den Warteraum, verfrüht, da Verspätung obwaltete, es war Madame Chauchat.
Es war Clawdia Chauchat, die sich plötzlich im Zimmerchen befand; Hans Castorp erkannte sie mit aufgerissenen Augen, indem er deutlich fühlte, wie das Blut ihm aus dem Gesichte wich und sein Unterkiefer erschlaffte, so daß sein Mund im Begriffe war, sich zu öffnen. Clawdias Eintritt hatte sich so nebenbei, so unversehens vollzogen, – auf einmal teilte sie den engen Aufenthalt mit den Vettern, nachdem sie eben noch keineswegs dagewesen. Joachim blickte rasch auf Hans Castorp und schlug dann nicht nur die Augen nieder, sondern nahm das illustrierte Blatt, das er schon fortgelegt hatte, wieder vom Tisch und verbarg sein Gesicht dahinter. Hans Castorp fand nicht die Entschlußkraft, ein gleiches zu tun. Nach dem Erblassen war er sehr rot geworden, und sein Herz hämmerte.
Frau Chauchat nahm bei der Tür zum Laboratorium in einem rundlichen kleinen Sessel mit stummelhaften, gleichsam rudimentären Armlehnen Platz, schlug, zurückgelehnt, leicht ein Bein über das andere und blickte ins Leere, wobei ihre Pribislav-Augen, die durch das Bewußtsein, daß man sie beobachtete, aus ihrer Blickrichtung nervös abgelenkt wurden, etwas schielten. Sie trug einen weißen Sweater und einen blauen Rock und hielt ein Buch auf dem Schoß, einen Leihbibliotheksband, wie es schien, während sie mit der Sohle des am Boden stehenden Fußes leise aufpochte.
Schon nach anderthalb Minuten änderte sie ihre Haltung, blickte um sich, stand auf mit einer Miene, als wisse sie nicht, woran sie sei und wohin sie sich zu wenden habe – und begann zu sprechen. Sie fragte etwas, richtete eine Frage an Joachim, obgleich dieser in seine illustrierte Zeitung vertieft schien, während Hans Castorp unbeschäftigt dasaß, – bildete Worte mit ihrem Munde und gab Stimme dazu aus ihrer weißen Kehle: es war die nicht tiefe, aber eine kleine Schärfe enthaltende, angenehm belegte Stimme, die Hans Castorp kannte – von langer Hand her kannte und einmal sogar aus unmittelbarer Nähe vernommen hatte: damals, als mit dieser Stimme für ihn selbst gesagt worden war: „Gern. Du mußt ihn mir nach der Stunde aber bestimmt zurückgeben.“ Das war jedoch fließender und bestimmter hingesprochen worden; jetzt kamen die Worte etwas schleppend und gebrochen, die Sprechende hatte kein natürliches Anrecht darauf, sie lieh sie nur, wie Hans Castorp sie schon ein paarmal hatte tun hören, mit einer Art von Überlegenheitsgefühl, das aber von demütigem Entzücken umwogt war. Eine Hand in der Tasche ihrer Wolljacke und die andere am Hinterkopf, fragte Frau Chauchat:
„Ich bitte, auf wieviel Uhr sind Sie bestellt?“
Und Joachim, der einen schnellen Blick auf seinen Vetter geworfen hatte, antwortete, indem er sitzend die Absätze zusammenzog:
„Auf halb vier Uhr.“
Sie sprach wieder:
„Ich auf drei Viertel. Was gibt es denn? Es ist gleich vier. Es sind Personen eben noch eingetreten, nicht wahr?“
„Ja, zwei Personen“, antwortete Joachim. „Sie waren vor uns an der Reihe. Der Dienst hat Verspätung. Es scheint, das Ganze hat sich um eine halbe Stunde verschoben.“
„Das ist unangenehm!“ sagte sie und betastete nervös ihr Haar.
„Eher“, erwiderte Joachim. „Wir warten auch schon fast eine halbe Stunde.“
So sprachen sie miteinander, und wie im Traum hörte Hans Castorp zu. Daß Joachim mit Frau Chauchat sprach, war beinahe dasselbe, wie wenn er selbst mit ihr gesprochen hätte, – wenn freilich auch wieder etwas ganz und gar anderes. Das „Eher“ hatte Hans Castorp beleidigt, es kam ihm frech und mindestens befremdend gleichmütig vor in Anbetracht der Umstände. Aber Joachim konnte am Ende so sprechen, – er konnte überhaupt mit ihr sprechen und tat sich vielleicht vor ihm noch etwas zugute darauf mit seinem kecken „Eher“, – ungefähr wie er selbst vor Joachim und Settembrini sich aufgespielt hatte, als man ihn gefragt, wie lange er zu bleiben gedenke und er „drei Wochen“ geantwortet hatte. An Joachim, obgleich er die Zeitung vor das Gesicht gehalten, hatte sie sich gewandt mit ihrer Anrede, – gewiß weil er der älter Eingesessene, ihr länger von Ansehen Bekannte war; aber doch auch aus jenem anderen Grunde, weil ein Verkehr auf gesittetem Fuße, ein artikulierter Austausch in ihrem Falle am Platze war und nichts Wildes, Tiefes, Schreckliches und Geheimnisvolles zwischen ihnen waltete. Hätte jemand Braunäugiges mit Rubinring und Orangenparfüm hier mit ihnen gewartet, so wäre es an ihm, Hans Castorp, gewesen, das Wort zu führen und „Eher“ zu sagen, – unabhängig und rein, wie er ihr gegenüberstand. „Gewiß, eher unangenehm, wertes Fräulein!“ hätte er gesagt und vielleicht sein Taschentuch mit einem Schwung aus der Brusttasche gezogen, um sich zu schneuzen. „Bitte, Geduld zu üben. Wir sind in keiner besseren Lage.“ Und Joachim hätte gestaunt über seine Leichtlebigkeit, – wahrscheinlich aber, ohne sich ernstlich an seine Stelle zu wünschen. Nein, auch Hans Castorp war nicht eifersüchtig auf Joachim, wie die Dinge lagen, obgleich dieser es war, der mit Frau Chauchat sprechen durfte. Er war einverstanden damit, daß sie sich an ihn gewandt hatte; sie hatte den Umständen Rechnung getragen, indem sie es tat, und so zu erkennen gegeben, daß sie sich dieser Umstände bewußt war ... Sein Herz hämmerte.
Nach der gelassenen Behandlung, die Frau Chauchat durch Joachim erfahren, und in der Hans Castorp sogar etwas wie eine leise Feindseligkeit auf seiten des guten Joachim gegen die Mitpatientin gespürt hatte, eine Feindseligkeit, über die er bei aller Erschütterung lächeln mußte, – versuchte „Clawdia“ einen Gang durch das Zimmer zu tun; doch fehlte es an Raum dazu, und so nahm auch sie ein illustriertes Heft vom Tische und kehrte damit in den Sessel mit den rudimentären Armlehnen zurück. Hans Castorp saß und sah sie an, indem er die Kinnstütze seines Großvaters nachahmte und so dem Alten wirklich lächerlich ähnlich sah. Da Frau Chauchat wieder ein Bein über das andere gelegt hatte, zeichnete sich ihr Knie, ja, die ganze schlanke Linie ihres Beines unter dem blauen Tuchrock ab. Sie war nur von mittlerer Größe, einer in Hans Castorps Augen höchst angenehmen und richtigen Größe, aber verhältnismäßig hochbeinig und nicht breit in den Hüften. Sie saß nicht zurückgelehnt, sondern vorgebeugt, die gekreuzten Unterarme auf den Oberschenkel des übergeschlagenen Beines gestützt, mit gerundetem Rücken und vorfallenden Schultern, so daß die Nackenwirbel hervortraten, ja, unter dem anliegenden Sweater beinahe das Rückgrat zu erkennen war und ihre Brust, die nicht so hoch und üppig entwickelt wie bei Marusja, sondern klein und mädchenhaft war, von beiden Seiten zusammengepreßt wurde. Plötzlich erinnerte sich Hans Castorp, daß auch sie hier in der Erwartung saß, durchleuchtet zu werden. Der Hofrat malte sie; er gab ihre äußere Erscheinung mit Öl und Farbstoffen auf der Leinwand wieder. Jetzt aber würde er im Halbdunkel Lichtstrahlen auf sie lenken, die ihm das Innere ihres Körpers bloßlegten. Und indem Hans Castorp dies dachte, wandte er mit einer ehrbaren Verfinsterung seiner Miene den Kopf beiseite, einem Ausdruck von Diskretion und Sittsamkeit, den vor sich selber anzunehmen ihm bei dieser Vorstellung angemessen schien.
Das Beisammensein zu dritt in dem Wartezimmerchen währte nicht lange. Man hatte drinnen mit Sascha und seiner Mutter wohl nicht viel Federlesens gemacht, man sputete sich, die Verspätung wieder einzuholen. Neuerdings öffnete der Techniker im weißen Kittel die Tür, Joachim warf aufstehend sein Zeitungsblatt auf den Tisch zurück, und Hans Castorp folgte ihm, wenn auch nicht ohne inneres Zögern, zur Tür. Ritterliche Bedenken regten sich in ihm zusammen mit der Versuchung, dennoch auf gesittete Art zu Frau Chauchat zu sprechen und ihr den Vortritt anzubieten; vielleicht sogar auf Französisch, wenn es sich machen ließ; und hastig suchte er bei sich nach den Vokabeln, der Satzbildung. Aber er wußte nicht, ob solche Höflichkeiten hier ortsüblich waren, ob nicht die angesetzte Reihenfolge hoch über Ritterlichkeiten erhaben war. Joachim mußte es wissen, und da er nicht Miene machte, vor der anwesenden Dame zurückzustehen, obgleich Hans Castorp ihn bewegt und dringlich anblickte, so folgte dieser ihm denn an Frau Chauchat vorbei, die nur flüchtig aus ihrer gebückten Haltung aufschaute, und durch die Tür ins Laboratorium.
Er war zu benommen von dem, was er hinter sich ließ, von den Abenteuern der letzten zehn Minuten, als daß mit dem Übertritt in den Durchleuchtungsraum auch seine innere Gegenwart sich sogleich hätte umstellen können. Er sah nichts oder nur sehr Allgemeines im künstlichen Halblicht. Er hörte Frau Chauchats angenehm verschleierte Stimme, mit der sie gesagt hatte: „Was gibt es denn ... Es sind Personen eben noch eingetreten ... Das ist unangenehm ...“, und dieser Stimmklang schauerte ihm als ein süßer Reiz den Rücken hinunter. Er sah ihr Knie unter dem Tuchrock sich abbilden, sah an ihrem gebeugten Nacken, unter dem kurzen rötlichblonden Haar, das dort lose hing, ohne in die Zopffrisur aufgenommen worden zu sein, die Halswirbel hervortreten, und abermals überlief ihn der Schauder. Er sah Hofrat Behrens, abgewandt von den Eintretenden, vor einem Schrank oder regalförmigen Einbau stehen und eine schwärzliche Platte betrachten, die er mit ausgestrecktem Arm gegen das matte Deckenlicht hielt. An ihm vorbei gingen sie tiefer in den Raum hinein, überholt von dem Gehilfen, der Vorbereitungen zu ihrer Behandlung und Abfertigung traf. Es roch eigentümlich hier. Eine Art von abgestandenem Ozon erfüllte die Atmosphäre. Zwischen den schwarzverhängten Fenstern vorspringend, teilte der Einbau das Laboratorium in zwei ungleiche Hälften. Man unterschied physikalische Apparate, Hohlgläser, Schaltbretter, aufrecht ragende Meßinstrumente, aber auch einen kameraartigen Kasten auf rollbarem Gestell, gläserne Diapositive, die reihenweise in die Wand eingelassen waren, – man wußte nicht, war man in dem Atelier eines Photographen, einer Dunkelkammer oder einer Erfinderwerkstatt und technischen Hexenoffizin.
Joachim hatte ohne weiteres begonnen, seinen Oberkörper freizumachen. Der Gehilfe, ein jüngerer, gedrungener und rotbäckiger Eingeborener in weißem Kittel, wies Hans Castorp an, ein gleiches zu tun. Es gehe schnell, er sei sofort an der Reihe ... Während Hans Castorp die Weste auszog, kam Behrens aus dem kleinen Abteil, wo er gestanden, in den geräumigeren herüber.
„Hallo!“ sagte er. „Das sind ja unsere Dioskuren! Castorp und Pollux ... Bitte, Wehelaute zu unterdrücken! Warten Sie nur, gleich werden wir Sie alle beide durchschaut haben. Ich glaube, Sie haben Angst, Castorp, uns Ihr Inneres zu eröffnen? Seien Sie ruhig, es geht ganz ästhetisch zu. Hier, haben Sie meine Privatgalerie schon gesehen?“ Und er zog Hans Castorp am Arm vor die Reihen der dunklen Gläser, hinter denen er knipsend Licht einschaltete. Da erhellten sie sich, zeigten ihre Bilder. Hans Castorp sah Gliedmaßen: Hände, Füße, Kniescheiben, Ober- und Unterschenkel, Arme und Beckenteile. Aber die rundliche Lebensform dieser Bruchstücke des Menschenleibes war schemenhaft und dunstig von Kontur; wie ein Nebel und bleicher Schein umgab sie ungewiß ihren klar, minutiös und entschieden hervortretenden Kern, das Skelett.
„Sehr interessant“, sagte Hans Castorp.
„Das ist allerdings interessant!“ erwiderte der Hofrat. „Nützlicher Anschauungsunterricht für junge Leute. Lichtanatomie, verstehen Sie, Triumph der Neuzeit. Das ist ein Frauenarm, Sie ersehen es aus seiner Niedlichkeit. Damit umfangen sie einen beim Schäferstündchen, verstehen Sie.“ Und er lachte, wobei seine Oberlippe mit dem gestutzten Schnurrbärtchen sich einseitig höher schürzte. Die Bilder erloschen. Hans Castorp wandte sich zur Seite, dorthin, wo Joachims Innenaufnahme sich vorbereitete.
Es geschah vor jenem Einbau, an dessen anderer Seite der Hofrat anfangs gestanden. Joachim hatte auf einer Art von Schustersessel vor einem Brett Platz genommen, gegen das er die Brust preßte, wobei er es außerdem mit den Armen umschlang; und mit knetenden Bewegungen verbesserte der Gehilfe seine Stellung, indem er Joachims Schultern weiter nach vorn drückte, seinen Rücken massierte. Hierauf begab er sich hinter die Kamera, um, wie irgend ein Photograph, gebückt, breitbeinig, die Ansicht zu prüfen, drückte seine Zufriedenheit aus und mahnte Joachim, beiseite gehend, tief einzuatmen und, bis alles vorüber, die Luft anzuhalten. Joachims gerundeter Rücken dehnte sich und blieb stehen. In diesem Augenblick hatte der Gehilfe am Schaltbrett den nötigen Handgriff getan. Zwei Sekunden lang spielten fürchterliche Kräfte, deren Aufwand erforderlich war, um die Materie zu durchdringen, Ströme von Tausenden von Volt, von hunderttausend, Hans Castorp glaubte sich zu erinnern. Kaum zum Zwecke gebändigt, suchten die Gewalten auf Nebenwegen sich Luft zu machen. Entladungen knallten wie Schüsse. Es knatterte blau am Meßapparat. Lange Blitze fuhren knisternd die Wand entlang. Irgendwo blickte ein rotes Licht, einem Auge gleich, still und drohend in den Raum, und eine Phiole in Joachims Rücken füllte sich grün. Dann beruhigte sich alles; die Lichterscheinungen verschwanden, und Joachim ließ seufzend den Atem aus. Es war geschehen.
„Nächster Delinquent!“ sagte Behrens und stieß Hans Castorp mit dem Ellenbogen. „Nur keine Müdigkeit vorschützen! Sie kriegen ein Freiexemplar, Castorp. Dann können Sie noch Kindern und Enkeln die Geheimnisse Ihres Busens an die Wand projizieren!“
Joachim war abgetreten; der Techniker wechselte die Platte. Hofrat Behrens unterwies den Neuling persönlich, wie er sich zu setzen, zu halten habe. „Umarmen!“ sagte er. „Das Brett umarmen! Stellen Sie sich meinetwegen was anderes darunter vor! Und gut die Brust andrücken, als ob Glücksempfindungen damit verbunden wären! Recht so. Einatmen! Stillgehalten!“ kommandierte er. „Bitte, recht freundlich!“ Hans Castorp wartete blinzelnd, die Lunge voller Luft. Hinter ihm brach das Gewitter los, knisterte, knatterte, knallte und beruhigte sich. Das Objektiv hatte in sein Inneres geblickt.
Er stieg ab, verwirrt und betäubt von dem, was mit ihm geschehen, obgleich ja die Durchdringung ihm nicht im geringsten empfindlich geworden war. „Brav“, sagte der Hofrat. „Nun werden wir selber sehen.“ Und schon hatte Joachim, bewandert wie er war, sich weiter hinbegeben, näher der Ausgangstür an einem Stativ Aufstellung genommen, im Rücken den weitläufig sich aufbauenden Apparat, auf dessen Rückenhöhe man eine halb mit Wasser gefüllte Glasblase mit Verdunstungsröhre gewahrte, vor sich, in Brusthöhe, einen gerahmten Schirm, der an Rollzügen schwebte. Zu seiner Linken, inmitten eines Schaltbretts und Instrumentariums, erhob sich eine rote Lampenglocke. Der Hofrat, vor dem hängenden Schirm auf einem Schemel reitend, entzündete sie. Das Deckenlicht erlosch, nur das Rubinlicht noch erhellte die Szene. Dann hob der Meister auch dieses mit kurzem Handgriff auf, und dichteste Finsternis hüllte die Laboranten ein.
„Erst müssen die Augen sich gewöhnen“, hörte man den Hofrat im Dunkel sagen. „Ganz große Pupillen müssen wir erst kriegen, wie die Katzen, um zu sehen, was wir sehen wollen. Das verstehen Sie ja wohl, daß wir es so ohne weiteres mit unseren gewöhnlichen Tagaugen nicht ordentlich sehen könnten. Den hellen Tag mit seinen fidelen Bildern müssen wir uns erst mal aus dem Sinn schlagen zu dem Behuf.“
„Selbstredend“, sagte Hans Castorp, der hinter des Hofrats Schulter stand, und schloß die Augen, da es ganz gleichgültig war, ob man sie offen hielt, oder nicht, so schwarz war die Nacht. „Erst müssen wir uns mal die Augen mit Finsternis waschen, um so was zu sehen, das ist doch klar. Ich finde es sogar gut und richtig, daß wir uns vorher ein bißchen sammeln, sozusagen in stillem Gebet. Ich stehe hier und habe die Augen geschlossen, es ist mir angenehm schläfrig zu Sinn. Aber wonach riecht es hier nur?“
„Sauerstoff“, sagte der Hofrat. „Das ist Oxygen, was Sie in den Lüften spüren. Atmosphärisches Produkt des Stubengewitters, verstehen Sie mich ... Augen auf!“ sagte er. „Jetzt fängt die Beschwörung an.“ Hans Castorp gehorchte eilig.
Man hörte das Umlegen eines Hebels. Ein Motor sprang auf und sang wütend in die Höhe, wurde aber durch einen neuen Handgriff zur Stetigkeit gebändigt. Der Fußboden bebte gleichmäßig. Das rote Lichtlein, länglich und senkrecht, blickte mit stillem Drohen herüber. Irgendwo knisterte ein Blitz. Und langsam, mit milchigem Schein, ein sich erhellendes Fenster, trat aus dem Dunkel das bleiche Viereck des Leuchtschirms hervor, vor welchem Hofrat Behrens auf seinem Schusterschemel ritt, die Schenkel gespreizt, die Fäuste daraufgestemmt, die Stumpfnase dicht an der Scheibe, die Einblick in eines Menschen organisches Inneres gewährte.
„Sehen Sie, Jüngling?“ fragte er ... Hans Castorp beugte sich über seine Schulter, hob aber noch einmal den Kopf, dorthin, wo im Dunkel Joachims Augen zu vermuten waren, die sanft und traurig blicken mochten, wie damals bei der Untersuchung, und fragte:
„Du erlaubst doch?“
„Bitte, bitte“, antwortete Joachim liberal aus seiner Finsternis. Und beim Schüttern des Erdbodens, im Knistern und Rumoren der spielenden Kräfte spähte Hans Castorp gebückt durch das bleiche Fenster, spähte durch Joachim Ziemßens leeres Gebein. Der Brustknochen fiel mit dem Rückgrat zur dunklen, knorpeligen Säule zusammen. Das vordere Rippengerüst wurde von dem des Rückens überschnitten, das blasser erschien. Geschwungen zweigten oben die Schlüsselbeine nach beiden Seiten ab, und in der weichen Lichthülle der Fleischesform zeigten sich dürr und scharf das Schulterskelett, der Ansatz von Joachims Oberarmknochen. Es war hell im Brustraum, aber man unterschied ein Geäder, dunkle Flecke, ein schwärzliches Gekräusel.
„Klares Bild“, sagte der Hofrat. „Das ist die anständige Magerkeit, die militärische Jugend. Ich habe hier Wänste gehabt, – undurchdringlich, beinahe nichts zu erkennen. Die Strahlen müßte man erst mal entdecken, die durch so eine Fettschicht gehen ... Dies hier ist saubere Arbeit. Sehen Sie das Zwerchfell?“ sagte er und wies mit dem Finger auf den dunklen Bogen, der sich unten im Fenster hob und senkte ... „Sehen Sie die Buckel hier linkerseits, die Erhöhungen? Das ist die Rippenfellentzündung, die er mit fünfzehn Jahren hatte. Tief atmen!“ kommandierte er. „Tiefer! Ich sage tief!“ Und Joachims Zwerchfell hob sich zitternd, so hoch es konnte, Aufhellung war in den oberen Lungenteilen zu bemerken, aber der Hofrat war nicht befriedigt. „Ungenügend!“ sagte er. „Sehen Sie die Hilusdrüsen? Sehen Sie die Verwachsungen? Sehen Sie die Kavernen hier? Da kommen die Gifte her, die ihn beschwipsen.“ Aber Hans Castorps Aufmerksamkeit war in Anspruch genommen von etwas Sackartigem, ungestalt Tierischem, dunkel hinter dem Mittelstamme Sichtbarem, und zwar größerenteils zur Rechten, vom Beschauer aus gesehen, – das sich gleichmäßig ausdehnte und wieder zusammenzog, ein wenig nach Art einer rudernden Qualle.
„Sehen Sie sein Herz?“ fragte der Hofrat, indem er abermals die riesige Hand vom Schenkel löste und mit dem Zeigefinger auf das pulsierende Gehänge wies ... Großer Gott, es war das Herz, Joachims ehrliebendes Herz, was Hans Castorp sah!
„Ich sehe dein Herz!“ sagte er mit gepreßter Stimme.
„Bitte, bitte“, antwortete Joachim wieder, und wahrscheinlich lächelte er ergeben dort oben im Dunklen. Aber der Hofrat gebot ihnen, zu schweigen und keine Empfindsamkeiten zu tauschen. Er studierte die Flecke und Linien, das schwarze Gekräusel im inneren Brustraum, während auch sein Mitspäher nicht müde wurde, Joachims Grabesgestalt und Totenbein zu betrachten, dies kahle Gerüst und spindeldürre Memento. Andacht und Schrecken erfüllten ihn. „Jawohl, jawohl, ich sehe“, sagte er mehrmals. „Mein Gott, ich sehe!“ Er hatte von einer Frau gehört, einer längst verstorbenen Verwandten von Tienappelscher Seite, – sie sollte mit einer schweren Gabe ausgestattet oder geschlagen gewesen sein, die sie in Demut getragen, und die darin bestanden hatte, daß Leute, die baldigst sterben sollten, ihren Augen als Gerippe erschienen waren. So sah nun Hans Castorp den guten Joachim, wenn auch mit Hilfe und auf Veranstaltung der physikalisch-optischen Wissenschaft, so daß es nichts zu bedeuten hatte und alles mit rechten Dingen zuging, zumal er Joachims Zustimmung ausdrücklich eingezogen. Dennoch wandelte Verständnis ihn an für die Melancholie im Schicksal jener seherischen Tante. Heftig bewegt von dem, was er sah, oder eigentlich davon, daß er es sah, fühlte er sein Gemüt von geheimen Zweifeln gestachelt, ob es rechte Dinge seien, mit denen dies zugehe, Zweifeln an der Erlaubtheit seines Schauens im schütternden, knisternden Dunkel; und die zerrende Lust der Indiskretion mischte sich in seiner Brust mit Gefühlen der Rührung und Frömmigkeit.
Aber wenige Minuten später stand er selbst im Gewitter am Pranger, während Joachim, wieder geschlossenen Leibes, sich ankleidete. Abermals spähte der Hofrat durch die milchige Scheibe, diesmal in Hans Castorps Inneres, und aus seinen halblauten Äußerungen, abgerissenen Schimpfereien und Redensarten schien hervorzugehen, daß der Befund seinen Erwartungen entsprach. Er war dann noch so freundlich, zu erlauben, daß der Patient seine eigene Hand durch den Leuchtschirm betrachte, da er dringend darum gebeten hatte. Und Hans Castorp sah, was zu sehen er hatte erwarten müssen, was aber eigentlich dem Menschen zu sehen nicht bestimmt ist, und wovon auch er niemals gedacht hatte, daß ihm bestimmt sein könne, es zu sehen: er sah in sein eigenes Grab. Das spätere Geschäft der Verwesung sah er vorweggenommen durch die Kraft des Lichtes, das Fleisch, worin er wandelte, zersetzt, vertilgt, zu nichtigem Nebel gelöst, und darin das kleinlich gedrechselte Skelett seiner rechten Hand, um deren oberes Ringfingerglied sein Siegelring, vom Großvater her ihm vermacht, schwarz und lose schwebte: ein hartes Ding dieser Erde, womit der Mensch seinen Leib schmückt, der bestimmt ist, darunter wegzuschmelzen, so daß es frei wird und weiter geht an ein Fleisch, das es eine Weile wieder tragen kann. Mit den Augen jener Tienappelschen Vorfahrin erblickte er einen vertrauten Teil seines Körpers, durchschauenden, voraussehenden Augen, und zum erstenmal in seinem Leben verstand er, daß er sterben werde. Dazu machte er ein Gesicht, wie er es zu machen pflegte, wenn er Musik hörte, – ziemlich dumm, schläfrig und fromm, den Kopf halb offenen Mundes gegen die Schulter geneigt. Der Hofrat sagte:
„Spukhaft, was? Ja, ein Einschlag von Spukhaftigkeit ist nicht zu verkennen.“
Und dann tat er den Kräften Einhalt. Der Fußboden kam zur Ruhe, die Lichterscheinungen schwanden, das magische Fenster hüllte sich wieder in Dunkel. Das Deckenlicht ging an. Und während auch Hans Castorp sich in die Kleider warf, gab Behrens den jungen Leuten einige Auskunft über seine Beobachtungen, unter Berücksichtigung ihrer laienhaften Auffassungsfähigkeit. Was im besonderen Hans Castorp betraf, so hatte der optische Befund den akustischen so genau bestätigt, wie die Ehre der Wissenschaft es nur irgend verlangte. Es seien die alten Stellen sowohl wie die frische zu sehen gewesen, und „Stränge“ zögen sich von den Bronchien aus ziemlich weit in das Organ hinein, – „Stränge mit Knötchen“. Hans Castorp werde es selbst auf dem Diapositivbildchen nachprüfen können, das ihm, wie gesagt, demnächst werde eingehändigt werden. Also Ruhe, Geduld, Mannszucht, messen, essen, liegen, abwarten und Tee trinken. Er wandte ihnen den Rücken. Sie gingen. Hans Castorp, hinter Joachim, blickte im Hinausgehen über die Schulter. Vom Techniker eingelassen, betrat Frau Chauchat das Laboratorium.
Wie kam es dem jungen Hans Castorp eigentlich vor? Etwa so, als ob die sieben Wochen, die er nun nachweislich und ohne allen Zweifel schon bei Denen hier oben verbracht hatte, nur sieben Tage gewesen wären? Oder schien ihm im Gegenteil, daß er schon viel, viel länger, als wirklich zutraf, an diesem Orte lebe? Er fragte sich selbst danach, sowohl innerlich, wie auch in der Form, daß er Joachim danach fragte, konnte aber zu keiner Entscheidung kommen. Es war wohl beides der Fall: zugleich unnatürlich kurz und unnatürlich lang erschien ihm im Rückblick die hier verbrachte Zeit, nur eben wie es wirklich damit war, so wollte es ihm nicht scheinen, – wobei vorausgesetzt wird, daß Zeit überhaupt Natur, und daß es statthaft ist, den Begriff der Wirklichkeit mit ihr in Verbindung zu bringen.
Auf jeden Fall stand der Oktober vor der Tür, jeden Tag konnte er eintreten. Es war ein leichtes für Hans Castorp, sich das auszurechnen, und außerdem wurde er durch Gespräche seiner Mitpatienten darauf hingewiesen, denen er zuhörte. „Wissen Sie, daß in fünf Tagen wieder einmal der Erste ist?“ hörte er Hermine Kleefeld zu zwei jungen Herren ihrer Gesellschaft sagen, dem Studenten Rasmussen und jenem Wulstlippigen, dessen Name Gänser war. Man stand nach der Hauptmahlzeit im Speisedunst zwischen den Tischen herum und zögerte plaudernd, in die Liegekur zu gehen. „Der erste Oktober, ich habe es in der Verwaltung auf dem Kalender gesehen. Das ist der zweite seiner Art, den ich an diesem Lustort verlebe. Schön, der Sommer ist hin, soweit er vorhanden war, man ist um ihn betrogen, wie man um das Leben betrogen ist, im ganzen und überhaupt.“ Und sie seufzte aus ihrer halben Lunge, indem sie kopfschüttelnd ihre von Dummheit umschleierten Augen zur Decke richtete. „Lustig, Rasmussen!“ sagte sie hierauf und schlug ihrem Kameraden auf die abfallende Schulter. „Machen Sie Witze!“ „Ich weiß nur wenige“, erwiderte Rasmussen und ließ die Hände wie Flossen in Brusthöhe hängen; „die aber wollen mir nicht vonstatten gehn, ich bin immer so müde.“ „Es möchte kein Hund,“ sagte Gänser hinter den Zähnen, „so oder ähnlich noch viel länger leben.“ Und sie lachten achselzuckend.
Aber auch Settembrini, seinen Zahnstocher zwischen den Lippen, hatte in der Nähe gestanden, und im Hinausgehen sagte er zu Hans Castorp:
„Glauben Sie ihnen nicht, Ingenieur, glauben Sie ihnen niemals, wenn sie schimpfen! Das tun sie alle ohne Ausnahme, obgleich sie sich nur zu sehr zu Hause fühlen. Führen ein Lotterleben und erheben auch noch Anspruch auf Mitleid, dünken sich zur Bitterkeit berechtigt, zur Ironie, zum Zynismus! ‚An diesem Lustort!‘ Ist es vielleicht kein Lustort? Ich will meinen, daß es einer ist, und zwar in des Wortes zweifelhaftester Bedeutung! ‚Betrogen‘, sagt dies Frauenzimmer; ‚an diesem Lustort um das Leben betrogen.‘ Aber entlassen Sie sie in die Ebene, und ihr Lebenswandel dort unten wird keinen Zweifel darüber lassen, daß sie es darauf anlegt, baldmöglichst wieder heraufzukommen. Ach ja, die Ironie! Hüten Sie sich vor der hier gedeihenden Ironie, Ingenieur! Hüten Sie sich überhaupt vor dieser geistigen Haltung! Wo sie nicht ein gerades und klassisches Mittel der Redekunst ist, dem gesunden Sinn keinen Augenblick mißverständlich, da wird sie zur Liederlichkeit, zum Hindernis der Zivilisation, zur unsauberen Liebelei mit dem Stillstand, dem Ungeist, dem Laster. Da die Atmosphäre, in der wir leben, dem Gedeihen dieses Sumpfgewächses offenbar sehr günstig ist, darf ich hoffen oder muß fürchten, daß Sie mich verstehen.“
Wirklich waren des Italieners Worte von der Art derer, die noch vor sieben Wochen im Tieflande für Hans Castorp nur Schall gewesen wären, für deren Bedeutung aber der Aufenthalt hier oben seinen Geist empfänglich gemacht hatte: empfänglich im Sinne intellektuellen Verständnisses, nicht ohne weiteres auch in dem der Sympathie, was vielleicht noch mehr besagen will. Denn obgleich er im Grunde seiner Seele froh war, daß Settembrini auch jetzt noch, trotz allem, was geschehen, fortfuhr, zu ihm zu sprechen, wie er es tat, ihn weiter belehrte, warnte und Einfluß auf ihn zu nehmen suchte, ging seine Auffassungsfähigkeit sogar so weit, daß er seine Worte beurteilte und ihnen seine Zustimmung, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, vorenthielt. „Sieh an,“ dachte er, „er spricht von der Ironie ganz ähnlich wie von der Musik, es fehlt nur, daß er sie ‚politisch verdächtig‘ nennt, nämlich von dem Moment an, wo sie aufhört, ein ‚gerades und klassisches Lehrmittel‘ zu sein. Aber eine Ironie, die ‚keinen Augenblick mißverständlich‘ ist, – was wäre denn das für eine Ironie, frage ich in Gottes Namen, wenn ich schon mitreden soll? Eine Trockenheit und Schulmeisterei wäre sie!“ – So undankbar ist Jugend, die sich bildet. Sie läßt sich beschenken, um dann das Geschenk zu bemäkeln.
Seine Widersetzlichkeit in Worte zu fassen, wäre ihm immerhin zu abenteuerlich erschienen. Er beschränkte seine Einwände auf Herrn Settembrinis Urteil über Hermine Kleefeld, das ihm ungerecht erschien oder das er aus bestimmten Gründen sich so erscheinen lassen wollte.
„Aber das Fräulein ist krank!“ sagte er. „Sie ist ja wahr- und wahrhaftig schwer krank und hat allen Grund, verzweifelt zu sein! Was wollen Sie eigentlich von ihr?“
„Krankheit und Verzweiflung,“ sagte Settembrini, „sind auch oft nur Formen der Liederlichkeit.“
„Und Leopardi,“ dachte Hans Castorp, „der ausdrücklich sogar an Wissenschaft und Fortschritt verzweifelte? Und er selbst, der Herr Schulmeister? Er ist doch auch krank und kommt immer wieder herauf, und Carducci hätte wenig Freude an ihm.“ Laut sagte er:
„Sie sind gut. Das Fräulein kann jeden Tag ins Gras beißen, und das nennen Sie Liederlichkeit! Da müssen Sie sich schon näher erklären. Wenn Sie mir sagten: Krankheit ist bisweilen eine Folge der Liederlichkeit, so wäre das plausibel ...“
„Sehr plausibel“, schaltete Settembrini ein. „Meiner Treu, es wäre Ihnen recht, wenn ich dabei stehen bliebe?“
„Oder wenn Sie sagten: Krankheit muß der Liederlichkeit manchmal zum Vorwand dienen, – auch das ließe ich mir gefallen.“
„Grazie tanto!“
„Aber Krankheit eine Form der Liederlichkeit? Das heißt: nicht aus der Liederlichkeit entstanden, sondern selbst Liederlichkeit? Das ist doch paradox!“
„Oh, ich bitte, Ingenieur, keine Unterstellungen! Ich verachte die Paradoxe, ich hasse sie! Lassen Sie sich alles, was ich Ihnen über die Ironie bemerkte, auch vom Paradoxon gesagt sein, und noch einiges mehr! Das Paradoxon ist die Giftblüte des Quietismus, das Schillern des faulig gewordenen Geistes, die größte Liederlichkeit von allen! Im übrigen stelle ich fest, daß Sie wieder einmal die Krankheit in Schutz nehmen ...“
„Nein, was Sie sagen, interessiert mich. Es erinnert geradezu an manches, was Dr. Krokowski an seinen Montagen vorbringt. Auch er erklärt die organische Krankheit für eine sekundäre Erscheinung.“
„Kein ganz reinlicher Idealist.“
„Was haben Sie gegen ihn?“
„Eben dies.“
„Sind Sie schlecht auf die Analyse zu sprechen?“
„Nicht jeden Tag. – Sehr schlecht und sehr gut, beides abwechselnd, Ingenieur.“
„Wie soll ich das verstehen?“
„Die Analyse ist gut als Werkzeug der Aufklärung und der Zivilisation, gut, insofern sie dumme Überzeugungen erschüttert, natürliche Vorurteile auflöst und die Autorität unterwühlt, gut, mit anderen Worten, indem sie befreit, verfeinert, vermenschlicht und Knechte reif macht zur Freiheit. Sie ist schlecht, sehr schlecht, insofern sie die Tat verhindert, das Leben an den Wurzeln schädigt, unfähig, es zu gestalten. Die Analyse kann eine sehr unappetitliche Sache sein, unappetitlich wie der Tod, zu dem sie denn doch wohl eigentlich gehören mag, – verwandt dem Grabe und seiner anrüchigen Anatomie ...“
„Gut gebrüllt, Löwe“, konnte Hans Castorp nicht umhin zu denken, wie gewöhnlich, wenn Herr Settembrini etwas Pädagogisches geäußert. Er sagte aber nur:
„Lichtanatomie haben wir neulich getrieben in unserem Parterrekeller. Behrens nannte es so, als er uns durchleuchtete.“
„Ah, auch diese Station haben Sie schon erstiegen. Nun, und?“
„Ich habe das Skelett meiner Hand gesehen“, sagte Hans Castorp, indem er sich die Empfindungen zurückzurufen suchte, die bei diesem Anblick in ihm aufgestiegen waren. „Haben Sie sich Ihres auch einmal zeigen lassen?“
„Nein, ich interessiere mich nicht im geringsten für mein Skelett. Und das ärztliche Ergebnis?“
„Er hat Stränge gesehen, Stränge mit Knötchen.“
„Teufelsknecht.“
„So haben Sie Hofrat Behrens schon einmal genannt. Was meinen Sie damit?“
„Seien Sie überzeugt, daß es eine gewählte Bezeichnung ist!“
„Nein, Sie sind ungerecht, Herr Settembrini! Ich gebe zu, daß der Mann seine Schwächen hat. Seine Redeweise ist mir selbst auf die Dauer nicht angenehm; sie hat zuweilen was Gewaltsames, besonders wenn man sich erinnert, daß er den großen Kummer gehabt hat, seine Frau hier oben einzubüßen. Aber was für ein verdienter und achtbarer Mann ist er doch alles in allem, ein Wohltäter der leidenden Menschheit! Neulich begegnete ich ihm, als er eben von einer Operation kam, einer Rippenresektion, einer Sache, bei der es auf Biegen oder Brechen gegangen war. Es machte großen Eindruck auf mich, wie ich ihn so von seiner schwierigen, nützlichen Arbeit kommen sah, auf die er sich so gut versteht. Noch ganz erhitzt war er und hatte sich zur Belohnung eine Zigarre angezündet. Ich war neidisch auf ihn.“
„Das war schön von Ihnen. Aber Ihr Strafmaß?“
„Er hat mir keine bestimmte Frist gesetzt.“
„Auch nicht übel. Legen wir uns also, Ingenieur. Beziehen wir unsere Stellungen.“
Sie verabschiedeten sich vor Nummer 34.
„Nun gehen Sie auf Ihr Dach hinauf, Herr Settembrini. Es muß lustiger sein, so in Gesellschaft zu liegen, als allein. Unterhalten Sie sich? Sind es interessante Leute, mit denen Sie Kur machen?“
„Ach, das sind lauter Parther und Skythen!“
„Sie meinen Russen?“
„Und Russinnen“, sagte Herr Settembrini, und sein Mundwinkel spannte sich. „Adieu, Ingenieur!“
Das war mit Bedeutung gesagt, unzweifelhaft. Hans Castorp betrat in Verwirrung sein Zimmer. Wußte Settembrini, wie es um ihn stand? Wahrscheinlich hatte er ihm erzieherisch nachgespürt und die Wege verfolgt, die seine Augen gingen. Hans Castorp war zornig auf den Italiener und auch auf sich selbst, weil er unbeherrschterweise den Stich herausgefordert hatte. Während er sein Schreibzeug zusammensuchte, um es mit in die Liegekur zu nehmen – denn nun galt kein Zögern mehr, der Brief nach Hause, der dritte, wollte geschrieben sein –, fuhr er fort, sich zu ärgern, murmelte dies und das vor sich hin gegen diesen Windbeutel und Räsonneur, der sich in Dinge mischte, die ihn nichts angingen, während er selbst die Mädchen auf der Straße anträllerte, – und fühlte sich zu der schriftlichen Arbeit gar nicht mehr aufgelegt, – dieser Drehorgelmann hatte ihm mit seinen Anspielungen förmlich die Stimmung dazu verdorben. Aber so oder so, er mußte Winterzeug haben, Geld, Wäsche, Schuhwerk, kurz alles, was er mitgenommen haben würde, wenn er gewußt hätte, daß er nicht für drei Hochsommerwochen, sondern ... sondern für eine noch unbestimmte Frist kam, die aber jedenfalls ein Stück in den Winter hineinreichen, ja, wie bei Uns hier oben die Begriffe und Zeitverhältnisse nun einmal waren, ihn wohl gar einschließen würde. Dies eben wollte, wenigstens als Möglichkeit, nach Hause mitgeteilt sein. Es galt diesmal ganze Arbeit zu tun, Denen dort unten reinen Wein einzuschenken und weder sich noch ihnen länger etwas vorzumachen ...
In diesem Geiste schrieb er denn, unter Beobachtung der Technik, die er Joachim mehrmals hatte üben sehen: im Liegestuhl, mit dem Füllfederhalter, die Reisemappe auf den hochgezogenen Knien. Er schrieb auf einem Briefbogen der Anstalt, von denen ein Vorrat in der Tischschublade bereit lag, an James Tienappel, der ihm unter den drei Onkels am nächsten stand, und bat ihn, den Konsul zu unterrichten. Er sprach von einem leidigen Zwischenfall, von Befürchtungen, die sich bewahrheitet hätten, von der ärztlicherseits erklärten Notwendigkeit, einen Teil des Winters, vielleicht den ganzen hier oben zu verbringen, denn Fälle wie der seinige seien oft hartnäckiger als solche, die sich pompöser anließen, und es gelte doch, nachdrücklich einzugreifen und beizeiten ein für allemal vorzubauen. Unter diesem Gesichtspunkt, meinte er, sei es ja ein Glück und eine günstige Fügung, daß er zufällig jetzt heraufgekommen und veranlaßt worden sei, sich untersuchen zu lassen; denn sonst wäre er wohl noch lange über seinen Zustand im unklaren geblieben und später vielleicht auf viel empfindlichere Art darüber belehrt worden. Was die voraussichtliche Dauer der Kur betreffe, so möge man sich nicht wundern, daß er sich wahrscheinlich den Winter werde um die Ohren schlagen müssen und kaum früher als Joachim in die Ebene werde zurückkehren können. Die Zeitbegriffe seien hier andere, als die sonst wohl für Badereisen und Kuraufenthalte gültigen; der Monat sei sozusagen die kleinste Zeiteinheit, und einzeln spiele er gar keine Rolle ...
Es war kühl, er schrieb im Paletot, in eine Decke gehüllt, mit geröteten Händen. Manchmal blickte er auf von seinem Papier, das sich mit vernünftigen und überzeugenden Sätzen bedeckte, und blickte in die vertraute Landschaft, die er kaum noch sah, dieses gestreckte Tal mit dem heute glasig-bleichen Gipfelgeschiebe am Ausgang, dem hell besiedelten Grunde, der manchmal sonnig aufglänzte, und den teils waldrauhen, teils wiesigen Lehnen, von denen Kuhgeläut kam. Er schrieb mit wachsender Leichtigkeit und verstand nicht mehr, wie er sich vor dem Brief hatte fürchten können. Im Schreiben begriff er selbst, daß nichts einleuchtender sein konnte, als seine Darlegungen, und daß sie zu Hause selbstverständlich das vollkommenste Einverständnis finden würden. Ein junger Mann seiner Klasse und in seinen Verhältnissen tat etwas für sich, wenn es sich als ratsam erwies, er machte Gebrauch von den eigens für seinesgleichen bereitgestellten Bequemlichkeiten. So gehörte es sich. Wäre er heimgereist, – man hätte ihn auf seinen Bericht hin wieder heraufgeschickt. Er bat, ihm zukommen zu lassen, was er brauchte. Auch um regelmäßige Anweisung der nötigen Geldmittel bat er zum Schluß; mit 800 Mark monatlich sei alles zu decken.
Er unterschrieb. Das war getan. Dieser dritte Brief nach Hause war ausgiebig, er hielt vor, – nicht nach den Zeitbegriffen von unten, sondern nach den hier oben herrschenden; er befestigte Hans Castorps Freiheit. Dies war das Wort, das er anwandte, nicht ausdrücklich, nicht, indem er auch nur innerlich seine Silben gebildet hätte, aber er empfand seinen weitläufigsten Sinn, wie er es während seines hiesigen Aufenthaltes zu tun gelernt hatte, – einen Sinn, der mit demjenigen, den Settembrini diesem Worte beilegte, nur wenig zu schaffen hatte, – und eine ihm schon bekannte Welle des Schreckens und der Erregung ging über ihn hin, die seine Brust beim Aufseufzen erzittern ließ.
Er hatte den Kopf voller Blut vom Schreiben, seine Backen brannten. Er nahm Merkurius vom Lampentischchen und maß sich, als gelte es, eine Gelegenheit zu benutzen. Merkurius stieg auf 37,8.
„Seht ihr?“ dachte Hans Castorp. Und er fügte das Postskriptum hinzu: „Der Brief hat mich doch angestrengt. Ich messe 37,8. Ich sehe, daß ich mich vorläufig sehr ruhig verhalten muß. Ihr müßt entschuldigen, wenn ich selten schreibe.“ Dann lag er und hob seine Hand gegen den Himmel, das Innere nach außen, so, wie er sie hinter den Leuchtschirm gehalten. Aber das Himmelslicht ließ ihre Lebensform unberührt, sogar noch dunkler und undurchsichtiger wurde ihr Stoff vor seiner Helle, und nur ihre äußersten Umrisse zeigten sich rötlich durchleuchtet. Es war die Lebenshand, die er zu sehen, zu säubern, zu benutzen gewohnt war – nicht jenes fremde Gerüst, das er im Schirme erblickt –, die analytische Grube, die er damals offen gesehen, hatte sich wieder geschlossen.
Der Oktober brach an, wie neue Monate anzubrechen pflegen, – es ist an und für sich ein vollkommen bescheidenes und geräuschloses Anbrechen, ohne Zeichen und Feuermale, ein stilles Sicheinschleichen also eigentlich, das der Aufmerksamkeit, wenn sie nicht strenge Ordnung hält, leicht entgeht. Die Zeit hat in Wirklichkeit keine Einschnitte, es gibt kein Gewitter oder Drommetengetön beim Beginn eines neuen Monats oder Jahres, und selbst bei dem eines neuen Säkulums sind es nur wir Menschen, die schießen und läuten.
In Hans Castorps Fall glich der erste Oktobertag auf ein Haar dem letzten Septembertage; er war ebenso kalt und unfreundlich wie dieser, und die nächstfolgenden waren es auch. Man brauchte den Winterpaletot und beide Kamelhaardecken in der Liegekur, nicht nur abends, sondern auch am Tage; die Finger, mit denen man sein Buch hielt, waren feucht und steif, wenn auch die Backen in trockener Hitze standen, und Joachim war sehr versucht, seinen Pelzsack in Gebrauch zu nehmen; er unterließ es nur, um sich nicht vorzeitig zu verwöhnen.
Aber einige Tage später, man hielt schon zwischen Anfang und Mitte des Monats, änderte sich alles, und ein nachträglicher Sommer fiel ein von solcher Pracht, daß es zum Verwundern war. Nicht umsonst hatte Hans Castorp den Oktober dieser Gegenden rühmen hören; wohl zweieinhalb Wochen lang herrschte Himmelsherrlichkeit über Berg und Tal, ein Tag überbot den anderen an blauender Reinheit, und mit so unvermittelter Kraft brannte die Sonne darein, daß jedermann sich veranlaßt fand, das leichteste Sommerzeug, Musselinkleider und Leinwandhosen, die schon verworfen gewesen, wieder hervorzusuchen und selbst der große Segeltuchschirm ohne Krücke, den man vermittelst einer sinnreichen Vorrichtung, einem mehrfach gelochten Pflock, an der Armlehne des Liegestuhles befestigte, in den mittleren Tagesstunden nur ungenügenden Schutz gegen die Glut des Gestirnes bot.
„Schön, daß ich das hier noch mitmache“, sagte Hans Castorp zu seinem Vetter. „Wir haben es manchmal so elend gehabt, – es ist ja ganz, als hätten wir den Winter schon hinter uns und nun käme die gute Zeit.“ Er hatte recht. Wenige Merkmale deuteten auf den wahren Sachverhalt, und auch diese waren unscheinbar. Nahm man ein paar gepflanzte Ahorne beiseite, die unten in „Platz“ nur eben ihr Leben fristeten und längst mutlos ihre Blätter hatten fallen lassen, so gab es keine Laubbäume hier, deren Zustand der Landschaft das Gepräge der Jahreszeit aufgedrückt hätte, und nur die zwittrige Alpenerle, die weiche Nadeln trägt und diese wie Blätter wechselt, zeigte sich herbstlich kahl. Der übrige Baumschmuck der Gegend, ob ragend oder geduckt, war immergrünes Nadelholz, fest gegen den Winter, der, undeutlich eingeschränkt, seine Schneestürme hier über das ganze Jahr verteilen darf; und nur ein mehrfach gestufter, roströtlicher Ton über dem Forst ließ trotz dem Sommerbrande des Himmels das sinkende Jahr erkennen. Freilich waren da, näher zugesehen, noch die Wiesenblumen, die gleichfalls leise zur Sache redeten. Es gab das orchideenähnliche Knabenkraut, die staudenförmige Akelei nicht mehr, die bei des Besuchers Ankunft noch das Gehänge geschmückt hatten, und auch die wilde Nelke war nicht mehr da. Nur noch der Enzian, die kurzaufsitzende Herbstzeitlose waren zu sehen und gaben Bescheid über eine gewisse innere Frische der oberflächlich erhitzten Atmosphäre, eine Kühle, die dem Ruhenden, äußerlich fast Versengten plötzlich ans Gebein treten konnte, wie ein Frostschauer dem Fieberglühenden.
Hans Castorp also hielt innerlich nicht jene Ordnung, womit der die Zeit bewirtschaftende Mensch ihren Ablauf beaufsichtigt, ihre Einheiten abteilt, zählt und benennt. Er hatte auf den stillen Anbruch des zehnten Monats nicht achtgehabt; nur das Sinnliche berührte ihn, die Sonnenglut mit der geheimen Frostfrische darin und darunter, – eine Empfindung, die ihm in dieser Stärke neu war und ihn zu einem kulinarischen Vergleich anregte: sie erinnerte ihn, einer Äußerung zufolge, die er gegen Joachim tat, an eine „Omelette en surprise“ mit Gefrorenem unter dem heißen Eierschaum. Er sagte öfter solche Dinge, sagte sie rasch, geläufig und mit bewegter Stimme, wie ein Mensch spricht, den es fröstelt bei heißer Haut. Dazwischen freilich war er auch schweigsam, um nicht zu sagen: in sich gekehrt; denn seine Aufmerksamkeit war wohl nach außen gerichtet, aber auf einen Punkt; das übrige, Menschen wie Dinge, verschwamm im Nebel, einem in Hans Castorps Hirn erzeugten Nebel, den Hofrat Behrens und Dr. Krokowski zweifellos als das Produkt löslicher Gifte angesprochen haben würden, wie der Benebelte sich selber sagte, ohne daß diese Einsicht das Vermögen oder auch nur im entferntesten den Wunsch in ihm gezeitigt hätte, des Rausches ledig zu werden.
Denn das ist ein Rausch, dem es um sich selber zu tun ist, und dem nichts unerwünschter und verabscheuenswürdiger scheint, als die Ernüchterung. Er behauptet sich auch gegen dämpfende Eindrücke, er läßt sie nicht zu, um sich zu bewahren. Hans Castorp wußte und hatte es früher selbst zur Sprache gebracht, daß Frau Chauchat im Profil nicht günstig aussah, etwas scharf, nicht mehr ganz jung. Die Folge? Er vermied es, sie im Profil zu betrachten, schloß buchstäblich die Augen, wenn sie ihm zufällig von fern oder nah diese Ansicht bot, es tat ihm weh. Warum? Seine Vernunft hätte freudig die Gelegenheit wahrnehmen sollen, sich zur Geltung zu bringen! Aber was verlangt man ... Er wurde blaß vor Entzücken, als Clawdia in diesen glänzenden Tagen zum zweiten Frühstück wieder einmal in der weißen Spitzenmatinee erschien, die sie bei warmem Wetter trug, und die sie so außerordentlich reizvoll machte, – verspätet und türschmetternd darin erschien und lächelnd, die Arme leicht zu ungleicher Höhe erhoben, gegen den Saal Front machte, um sich zu präsentieren. Aber er war entzückt nicht sowohl dadurch, daß sie so günstig aussah, sondern darüber, daß es so war, weil das den süßen Nebel in seinem Kopf verstärkte, den Rausch, der sich selber wollte, und dem es darum zu tun war, gerechtfertigt und genährt zu werden.
Ein Gutachter von der Denkungsart Lodovico Settembrinis hätte angesichts eines solchen Mangels an gutem Willen geradezu von Liederlichkeit, von „einer Form der Liederlichkeit“ sprechen mögen. Hans Castorp gedachte zuweilen der schriftstellerischen Dinge, die jener über „Krankheit und Verzweiflung“ geäußert, und die er unbegreiflich gefunden oder so zu finden sich den Anschein gegeben hatte. Er sah Clawdia Chauchat an, die Schlaffheit ihres Rückens, die vorgeschobene Haltung ihres Kopfes; er sah sie beständig mit großer Verspätung zu Tisch kommen, ohne Grund und Entschuldigung, einzig aus Mangel an Ordnung und gesitteter Energie; sah sie aus eben diesem grundlegenden Mangel jede Tür hinter sich zufallen lassen, durch die sie aus oder ein ging, Brotkugeln drehen und gelegentlich an den seitlichen Fingerspitzen kauen, – und eine wortlose Ahnung stieg in ihm auf, daß, wenn sie krank war, und das war sie wohl, fast hoffnungslos krank, da sie ja schon so lange und oft hier oben hatte leben müssen, – ihre Krankheit, wenn nicht gänzlich, so doch zu einem guten Teile moralischer Natur, und zwar wirklich, wie Settembrini gesagt hatte, nicht Ursache oder Folge ihrer „Lässigkeit“, sondern mit ihr ein und dasselbe war. Er erinnerte sich auch der wegwerfenden Gebärde, womit der Humanist von den „Parthern und Skythen“ gesprochen hatte, mit denen er Liegekur halten müsse, einer Gebärde natürlicher und unmittelbarer, nicht erst zu begründender Geringschätzung und Ablehnung, auf die Hans Castorp sich von früher her wohl verstand, – von damals her, als er, der sich bei Tische sehr gerade hielt, das Türenwerfen aus Herzensgrund haßte und nicht einmal in Versuchung kam, an den Fingern zu kauen (schon darum nicht, weil ihm statt dessen Maria Mancini gegeben war), an den Ungezogenheiten Frau Chauchats schweren Anstoß genommen und sich eines Gefühls der Überlegenheit nicht hatte entschlagen können, als er die schmaläugige Fremde in seiner Muttersprache sich hatte versuchen hören.
Solcher Empfindungen hatte Hans Castorp sich nun, auf Grund der inneren Sachlage, fast ganz begeben, und der Italiener war es viel mehr, an dem er sich ärgerte, weil dieser in seinem Dünkel von „Parthern und Skythen“ gesprochen, – während er doch nicht einmal Personen vom „Schlechten“ Russentisch im Auge gehabt hatte, demjenigen, an dem die Studenten mit dem allzu dicken Haar und der unsichtbaren Wäsche saßen und unaufhörlich in ihrer wildfremden Sprache disputierten, außer der sie sich offenbar in keiner auszudrücken wußten, und deren knochenloser Charakter an einen Thorax ohne Rippen erinnerte, wie Hofrat Behrens es neulich beschrieben hatte. Es war richtig, daß die Sitten dieser Leute einem Humanisten wohl lebhafte Abstandsgefühle erregen konnten. Sie aßen mit dem Messer und besudelten auf nicht wiederzugebende Weise die Toilette. Settembrini behauptete, daß einer von ihrer Gesellschaft, ein Mediziner in höheren Semestern, sich des Lateinischen vollkommen unkundig erwiesen, beispielsweise nicht gewußt habe, was ein vacuum sei, und nach Hans Castorps eigenen täglichen Erfahrungen log Frau Stöhr wahrscheinlich nicht, wenn sie bei Tische erzählte, das Ehepaar auf Nr. 32 empfange den Bademeister morgens, wenn er zur Abreibung komme, zusammen im Bette liegend.
Mochte dies alles zutreffen, so bestand doch die augenfällige Scheidung von „gut“ und „schlecht“ nicht umsonst, und Hans Castorp versicherte sich selbst, er habe nur ein Achselzucken für irgendeinen Propagandisten der Republik und des schönen Stils, der, hochnäsig und nüchtern – namentlich nüchtern, obgleich auch er febril und beschwipst war –, die beiden Tischgesellschaften unter dem Namen von Parthern und Skythen zusammenfaßte. Wie es gemeint war, verstand der junge Hans Castorp sehr weitgehend, er hatte ja auch angefangen, sich auf die Zusammenhänge von Frau Chauchats Krankheit mit ihrer „Lässigkeit“ zu verstehen. Aber es verhielt sich, wie er selbst eines Tages zu Joachim gesagt hatte: man beginnt mit Ärgernis und Abstandsgefühlen, auf einmal aber „kommt ganz anderes dazwischen“, was „mit Urteilen gar nichts zu tun hat“, und die Sittenstrenge hat ausgespielt, – man ist pädagogischen Einflüssen republikanischer und eloquenter Art kaum noch zugänglich. Was ist aber das, fragen wir, wahrscheinlich auch in Lodovico Settembrinis Sinn, was ist das für ein fragwürdiges Zwischenkommnis, das des Menschen Urteil lahmlegt und ausschaltet, ihn des Rechtes darauf beraubt oder vielmehr ihn bestimmt, sich dieses Rechtes mit unsinnigem Entzücken zu begeben? Wir fragen nicht nach seinem Namen, denn diesen kennt jeder. Wir erkundigen uns nach seiner moralischen Beschaffenheit, – und erwarten, offen gestanden, keine sehr hochgemute Antwort darauf. In Hans Castorps Fall bewährte sich diese Beschaffenheit in dem Grade, daß er nicht allein aufhörte, zu urteilen, sondern auch begann, mit der Lebensform, die es ihm angetan, seinerseits Versuche anzustellen. Er versuchte, wie es sei, wenn man bei Tische zusammengesunken, mit schlaffem Rücken dasäße, und fand, daß es eine große Erleichterung für die Beckenmuskeln bedeute. Ferner probierte er es, eine Tür, durch die er schritt, nicht umständlich hinter sich zu schließen, sondern sie zufallen zu lassen; und auch dies erwies sich sowohl als bequem wie als angemessen: es entsprach im Ausdruck jenem Achselzucken, mit dem Joachim ihn seinerzeit gleich am Bahnhof begrüßt, und das er seitdem so oft bei Denen hier oben gefunden hatte.
Schlicht gesagt, war unser Reisender nun also über beide Ohren in Clawdia Chauchat verliebt, – wir gebrauchen nochmals dies Wort, da wir dem Mißverständnis, das es erregen könnte, hinlänglich vorgebeugt zu haben meinen. Freundlich gemütvolle Wehmut im Geist jenes Liedchens war es also nicht, was das Wesen seiner Verliebtheit ausmachte. Vielmehr war das eine ziemlich riskierte und unbehauste Abart dieser Betörung, aus Frost und Hitze gemischt wie das Befinden eines Febrilen oder wie ein Oktobertag in oberen Sphären; und was fehlte, war eben ein gemüthaftes Mittel, das ihre extremen Bestandteile verbunden hätte. Sie bezog sich einerseits mit einer Unmittelbarkeit, die den jungen Mann erblassen ließ und seine Gesichtszüge verzerrte, auf Frau Chauchats Knie und die Linie ihres Beines, auf ihren Rücken, ihre Nackenwirbel und ihre Oberarme, von denen die kleine Brust zusammengepreßt wurde, – mit einem Worte auf ihren Körper, ihren lässigen und gesteigerten, durch die Krankheit ungeheuer betonten und noch einmal zum Körper gemachten Körper. Und sie war andererseits etwas äußerst Flüchtiges und Ausgedehntes, ein Gedanke, nein, ein Traum, der schreckhafte und grenzenlos verlockende Traum eines jungen Mannes, dem auf bestimmte, wenn auch unbewußt gestellte Fragen nur ein hohles Schweigen geantwortet hatte. Wie jedermann, nehmen wir das Recht in Anspruch, uns bei der hier laufenden Erzählung unsere privaten Gedanken zu machen, und wir äußern die Mutmaßung, daß Hans Castorp die für seinen Aufenthalt bei Denen hier oben ursprünglich angesetzte Frist nicht einmal bis zu dem gegenwärtig erreichten Punkt überschritten hätte, wenn seiner schlichten Seele aus den Tiefen der Zeit über Sinn und Zweck des Lebensdienstes eine irgendwie befriedigende Auskunft zuteil geworden wäre.
Im übrigen fügte seine Verliebtheit ihm all die Schmerzen zu und gewährte ihm all die Freuden, die dieser Zustand überall und unter allen Umständen mit sich bringt. Der Schmerz ist durchdringend; er enthält ein entehrendes Element, wie jeder Schmerz, und bedeutet eine solche Erschütterung des Nervensystems, daß er den Atem verschlägt und einem erwachsenen Manne bittere Tränen entpressen kann. Um auch den Freuden gerecht zu werden, so waren sie zahlreich und, obgleich aus unscheinbaren Anlässen entstehend, nicht weniger eindringlich als die Leiden. Fast jeder Augenblick des Berghof-Tages war fähig, sie zu zeitigen. Zum Beispiel: im Begriff, den Speisesaal zu betreten, bemerkt Hans Castorp den Gegenstand seiner Träume hinter sich. Das Ergebnis ist im voraus klar und von größter Simplizität, aber innerlich entzückend bis zu ebenfalls tränentreibender Wirkung. Ihre Augen begegnen sich nahe, die seinen und ihre graugrünen, deren leicht asiatischer Sitz und Schnitt ihm das Mark bezaubern. Er ist besinnungslos, aber auch ohne Besinnung tritt er seitlich zurück, um ihr zuerst den Weg durch die Tür freizugeben. Mit halbem Lächeln und einem halblauten „Merci“ macht sie Gebrauch von seinem nicht mehr als gesitteten Anerbieten, geht vorbei und hindurch. Im Hauch ihrer vorüberstreichenden Person steht er, närrisch vor Glück über das Zusammentreffen und darüber, daß ein Wort ihres Mundes, nämlich das Merci, ihm direkt und persönlich gegolten. Er folgt ihr, er schwankt rechtshin zu seinem Tische, und indem er auf seinen Stuhl sinkt, darf er wahrnehmen, daß „Clawdia“ drüben, ebenfalls Platz nehmend, sich nach ihm umblickt, – mit einem Ausdruck des Nachdenkens über die Begegnung an der Tür, wie ihm scheint. O unglaubwürdiges Abenteuer! O Jubel, Triumph und grenzenloses Frohlocken! Nein, diesen Rausch phantastischer Genugtuung hätte Hans Castorp nicht erprobt bei dem Blick irgendeines gesunden Gänschens, dem er drunten im Flachlande erlaubter-, friedlicher- und aussichtsreicherweise, im Sinne jenes Liedchens, „sein Herz geschenkt“ hätte. Mit fiebriger Aufgeräumtheit begrüßt er die Lehrerin, die alles gesehen hat und flaumig errötet ist, – worauf er Miß Robinson mit englischer Konversation von solcher Sinnlosigkeit berennt, daß das Fräulein, im Ekstatischen nicht bewandert, sogar zurückprallt und ihn mit Blicken voller Befürchtungen mißt.
Ein andermal fallen beim Abendessen die Strahlen der klar untergehenden Sonne auf den Guten Russentisch. Man hat die Vorhänge vor die Verandatüren und Fenster gezogen, aber irgendwo klafft da ein Spalt, und durch ihn findet der rote Schein kühl, aber blendend seinen Weg und trifft genau Frau Chauchats Kopf, so daß sie, im Gespräch mit dem konkaven Landsmann zu ihrer Rechten, sich mit der Hand dagegen schützen muß. Das ist eine Belästigung, aber keine schwere; niemand kümmert sich darum, die Betroffene selbst ist sich der Unbequemlichkeit wohl nicht einmal bewußt. Aber Hans Castorp sieht es über den Saal hinweg, – auch er sieht es eine Weile mit an. Er überprüft die Sachlage, verfolgt den Weg des Strahles, stellt den Ort seines Einfalles fest. Es ist das Bogenfenster dort hinten rechts, in der Ecke zwischen der einen Verandatür und dem Schlechten Russentisch, weit von Frau Chauchats Platze entfernt und fast genau ebensoweit von dem Hans Castorps. Und er faßt seine Entschlüsse. Ohne ein Wort steht er auf, geht, seine Serviette in der Hand, schräg zwischen den Tischen hin durch den Saal, schlägt da hinten die cremefarbenen Vorhänge gut übereinander, überzeugt sich durch einen Blick über die Schulter, daß der Abendschein ausgesperrt und Frau Chauchat befreit ist – und begibt sich unter Aufbietung vielen Gleichmutes auf den Rückweg. Ein aufmerksamer junger Mann, der das Notwendige tut, da sonst niemand darauf verfällt, es zu tun. Die wenigsten hatten auf sein Eingreifen geachtet, aber Frau Chauchat hatte die Erleichterung sofort gespürt und sich umgeblickt, – sie blieb in dieser Haltung, bis Hans Castorp seinen Platz wieder erreicht hatte und, sich setzend, zu ihr hinübersah, worauf sie mit freundlich erstauntem Lächeln dankte, das heißt: ihren Kopf mehr vorschob als neigte. Er quittierte mit einer Verbeugung. Sein Herz war unbeweglich, es schien überhaupt nicht zu schlagen. Erst später, als alles vorüber war, begann es zu hämmern, und da bemerkte er erst, daß Joachim die Augen still auf seinen Teller gerichtet hielt, – wie ihm auch nachträglich deutlich wurde, daß Frau Stöhr Dr. Blumenkohl in die Seite gestoßen hatte und überall am eigenen Tische und an den anderen mit geducktem Lachen nach mitwissenden Blicken suchte ...
Wir schildern Alltägliches; aber das Alltägliche wird sonderbar, wenn es auf sonderbarer Grundlage gedeiht. Es gab Spannungen und wohltätige Lösungen zwischen ihnen, – oder wenn nicht zwischen ihnen (denn wie weit Madame Chauchat davon berührt wurde, wollen wir dahingestellt sein lassen), so doch für Hans Castorps Phantasie und Gefühl. Nach dem Mittagessen pflegte in diesen schönen Tagen ein größerer Teil der Kurgesellschaft sich auf die dem Speisesaal vorgelagerte Veranda hinaus zu begeben, um eine Viertelstunde gruppenweise in der Sonne zu verweilen. Es ging da zu, und ein Bild entwickelte sich, ähnlich wie bei der vierzehntägigen Sonntagsblechmusik. Die jungen Leute, absolut müßig, übermäßig gesättigt mit Fleischspeisen und Süßigkeiten, und alle leicht fiebernd, plauderten, schäkerten, äugten. Frau Salomon aus Amsterdam mochte wohl an der Balustrade sitzen, – hart mit den Knien bedrängt von dem wulstlippigen Gänser auf der einen und dem schwedischen Recken auf der anderen Seite, der, obgleich völlig genesen, seinen Aufenthalt zu einer kleinen Nachkur noch etwas verlängerte. Frau Iltis schien Witwe zu sein, denn sie erfreute sich seit kurzem der Gesellschaft eines „Bräutigams“, von übrigens zugleich melancholischer und untergeordneter Erscheinung, dessen Vorhandensein sie denn auch nicht hinderte, gleichzeitig die Huldigungen des Hauptmanns Miklosich, eines Mannes mit Hakennase, gewichstem Schnurrbart, erhabener Brust und drohenden Augen, entgegenzunehmen. Es waren da Liegehallendamen verschiedener Nationalität, neue Figuren darunter, erst seit dem 1. Oktober sichtbar geworden, die Hans Castorp kaum schon bei Namen zu nennen gewußt hätte, untermischt mit Kavalieren vom Schlage des Herrn Albin; monokeltragenden Siebzehnjährigen; einem bebrillten jungen Holländer mit rosigem Gesicht und monomanischer Leidenschaft für den Briefmarkentausch; verschiedenen Griechen, pomadisiert und mandeläugig, bei Tische zu Übergriffen geneigt; zwei eng zusammengehörigen Stutzerchen, die „Max und Moritz“ genannt wurden und für große Ausbrecher galten ... Der bucklige Mexikaner, dem Nichtkenntnis der hier vertretenen Sprachen den Gesichtsausdruck eines Tauben verlieh, nahm unaufhörlich photographische Aufnahmen vor, indem er sein Stativ mit schnurriger Behendigkeit von einem Punkt der Terrasse zum andern schleppte. Auch der Hofrat mochte sich wohl einfinden, um das Kunststück mit den Stiefelbändern aufzuführen. Irgendwo aber drückte sich einsam der mannheimische Religiöse in die Menge, und seine bis in den Grund hinein traurigen Augen gingen zu Hans Castorps Ekel heimlich gewisse Wege.
Um denn mit einem oder dem anderen Beispiel auf jene „Spannungen und Lösungen“ zurückzukommen, so mochte bei einer solchen Gelegenheit Hans Castorp auf einem lackierten Gartenstuhl und in gesprächiger Unterhaltung mit Joachim, den er trotz seines Widerstrebens gezwungen hatte, mit herauszukommen, an der Hauswand sitzen, während vor ihm Frau Chauchat mit ihren Tischgenossen eine Zigarette rauchend an der Brüstung stand. Er sprach für sie, damit sie ihn höre. Sie wandte ihm den Rücken zu ... Man sieht, wir haben jetzt einen bestimmten Fall im Auge. Des Vetters Gespräch hatte ihm nicht genügt für seine affektierte Redseligkeit, er hatte absichtlich eine Bekanntschaft gemacht, – welche? Die Bekanntschaft Hermine Kleefelds – hatte wie von ungefähr das Wort an die junge Dame gerichtet, sich selbst und Joachim ihr namentlich vorgestellt und auch ihr einen lackierten Stuhl herangezogen, um sich zu dritt besser aufspielen zu können. Ob sie noch wisse, fragte er, wie teufelsmäßig sie ihn damals erschreckt habe, bei ihrer ersten Begegnung seinerzeit auf der Morgenpromenade. Ja, das sei er gewesen, den sie damals so herzerfrischend zum Willkomm angepfiffen! Und ihren Zweck habe sie erreicht, das wolle er freiwillig gestehen, er sei wie mit einer Keule vor den Kopf geschlagen gewesen, sie solle nur seinen Vetter fragen. Ha, ha, mit dem Pneumothorax zu pfeifen und harmlose Wanderer damit zu erschrecken! Ein frevles Spiel nenne er das, als sündhaften Mißbrauch bezeichne er es freierdings und in gerechtem Zorne ... Und während Joachim im Bewußtsein seiner werkzeughaften Rolle mit niedergeschlagenen Augen saß und auch die Kleefeld aus Hans Castorps blinden und abschweifenden Blicken allmählich für ihre Person das kränkende Gefühl gewann, nur als Mittel zum Zwecke zu dienen, schmollte Hans Castorp und zierte sich und drechselte Redensarten und gab sich eine wohllautende Stimme, bis er es wirklich erreichte, daß Frau Chauchat sich nach dem auffällig Redenden umwandte und ihm ins Gesicht blickte, – aber nur einen Augenblick. Denn so gestaltete es sich, daß ihre Pribislav-Augen an seiner mit übergeschlagenem Beine sitzenden Figur rasch hinunterglitten und mit einem Ausdruck von so geflissentlicher Gleichgültigkeit, daß er wie Verachtung aussah, genau wie Verachtung, eine Weile auf seinem gelben Stiefel haften blieben, – worauf sie sich phlegmatisch und vielleicht mit einem Lächeln in ihrer Tiefe wieder zurückzogen.
Ein schwerer, schwerer Unglücksfall! Hans Castorp redete noch eine Weile fieberhaft weiter; dann, als er dieses Blickes auf seinen Stiefel innerlich recht ansichtig geworden, verstummte er beinahe mitten im Wort und sank in Gram. Die Kleefeld, gelangweilt und beleidigt, ging ihrer Wege. Nicht ohne Gereiztheit in der Stimme meinte Joachim, nun könnten sie ja wohl Liegekur machen. Und ein Gebrochener antwortete ihm bleichen Mundes, das könnten sie.
Hans Castorp litt grausam unter diesem Vorfall zwei Tage lang; denn nichts geschah unterdessen, was Balsam für seine brennende Wunde gewesen wäre. Warum dieser Blick? Warum ihm ihre Verachtung in des dreifaltigen Gottes Namen? Sah sie ihn an wie einen gesunden Gimpel von unten, dessen Aufnahmelustigkeit nur zum Harmlosen neigte? Wie eine Unschuld aus dem Flachlande, sozusagen, einen gewöhnlichen Kerl, der herumging und lachte und sich den Bauch vollschlug und Geld verdiente, – einen Musterschüler des Lebens, der sich auf nichts als auf die langweiligen Vorteile der Ehre verstand? War er ein windiger Hospitant auf drei Wochen, unteilhaft ihrer Sphäre, oder hatte er nicht Profeß getan auf Grund einer feuchten Stelle, – war er nicht eingereiht und zugehörig, einer von Uns hier oben, mit guten zwei Monaten auf dem Buckel, und war nicht Merkurius noch gestern abend wieder auf 37,8 gestiegen? ... Aber das eben war es, das machte sein Leiden vollständig! Merkurius stieg nicht mehr! Die furchtbare Niedergeschlagenheit dieser Tage bewirkte eine Erkältung, Ernüchterung und Abspannung von Hans Castorps Natur, die sich zu seiner bitteren Beschämung in sehr niedrigen, kaum übernormalen Meßergebnissen äußerte, und grausam war es für ihn, zu gewahren, wie sein Kummer und Gram nichts weiter vermochte, als ihn von Clawdias Sein und Wesen immer nur weiter noch zu entfernen.
Der dritte Tag brachte die zarte Erlösung, brachte sie gleich in der Frühe. Es war ein herrlicher Herbstmorgen, sonnig und frisch, mit grausilbrig übersponnenen Wiesen. Sonne und abnehmender Mond standen gleichzeitig ziemlich gleich hoch am reinen Himmel. Die Vettern waren früher als gewöhnlich aufgestanden, um dem schönen Tag zu Ehren ihren Morgenspaziergang ein wenig über die Vorschrift auszudehnen, auf dem Waldwege, an dem die Bank neben der Wasserrinne stand, etwas weiter vorzudringen. Joachim, dessen Kurve gerade ebenfalls einen erfreulichen Abstieg aufwies, hatte die erfrischende Unregelmäßigkeit befürwortet und Hans Castorp nicht nein gesagt. „Wir sind ja genesene Leute,“ hatte er gesagt, „abgefiebert und entgiftet, so gut wie reif für das Flachland. Warum sollten wir nicht ausschlagen wie die Füllen.“ So wanderten sie barhaupt – denn seit er Profeß getan, hatte Hans Castorp sich in Gottes Namen der herrschenden Sitte anbequemt, ohne Hut zu gehen, so sicher er sich anfangs, diesem Brauch gegenüber, seiner Lebensform und Gesittung gefühlt hatte – und setzten ihre Stöcke. Sie hatten aber den ansteigenden Teil des rötlichen Weges noch nicht zurückgelegt, waren erst ungefähr bis zu dem Punkte gelangt, wo damals der pneumatische Trupp dem Neuling begegnet war, als sie vor sich in einiger Entfernung, langsam steigend, Frau Chauchat gewahrten, Frau Chauchat in Weiß, in weißem Sweater, weißem Flanellrock, und sogar in weißen Schuhen, das rötliche Haar von der Morgensonne erleuchtet. Genauer gesagt: Hans Castorp hatte sie erkannt; Joachim fand sich erst durch ein unangenehmes Gefühl des Ziehens und Zerrens an seiner Seite auf die Umstände hingewiesen, – ein Gefühl, hervorgebracht durch die antreibend beschwingtere Gangart, die sein Begleiter plötzlich angeschlagen, nachdem er zuvor seine Schritte jäh gehemmt hatte und beinahe stehengeblieben war. Solches Gehetztwerden empfand Joachim als äußerst unzuträglich und ärgerlich; sein Atem verkürzte sich rasch, und er hüstelte. Aber den zielbewußten Hans Castorp, dessen Organe prachtvoll zu arbeiten schienen, kümmerte das wenig; und da sein Vetter der Sachlage innegeworden, zog er nur schweigend die Brauen zusammen und hielt Schritt, denn unmöglich konnte er jenen allein voranlaufen lassen.
Den jungen Hans Castorp belebte der schöne Morgen. Auch hatten in der Depression seine Seelenkräfte sich heimlich ausgeruht, und klar leuchtete vor seinem Geist die Gewißheit, daß der Augenblick gekommen war, da der Bann, der auf ihm gelegen, gebrochen werden sollte. So griff er aus, den keuchenden, auch sonst widerstrebenden Joachim mit sich ziehend, und vor der Biegung des Weges, wo er eben ward und rechtshin den bewaldeten Hügel entlang führte, hatten sie Frau Chauchat so gut wie erreicht. Da verlangsamte Hans Castorp das Tempo wieder, um nicht in einem von Anstrengung verwilderten Zustand sein Vorhaben auszuführen. Und jenseits des Wegknies, zwischen Abhang und Bergwand, zwischen den rostig gefärbten Fichten, durch deren Zweige Sonnenlichter fielen, trug es sich zu und begab sich wunderbar, daß Hans Castorp, links von Joachim, die liebliche Kranke überholte, daß er mit männlichen Tritten an ihr vorüber ging, und in dem Augenblick, da er sich rechts neben ihr befand, mit einer hutlosen Verneigung und einem mit halber Stimme gesprochenen „Guten Morgen“ sie ehrerbietig (wieso eigentlich: ehrerbietig) begrüßte und Antwort von ihr empfing: mit freundlicher, nicht weiter erstaunter Kopfneigung dankte sie, sagte auch ihrerseits guten Morgen in seiner Sprache, wobei ihre Augen lächelten, – und das alles war etwas anderes, etwas gründlich und beseligend anderes als der Blick auf seinen Stiefel, es war ein Glücksfall und eine Wendung der Dinge zum Guten und Allerbesten, ganz beispielloser Art und fast die Fassungskraft überschreitend; es war die Erlösung.
Auf Flügelsohlen, geblendet von vernunftloser Freude, im Besitz des Grußes, des Wortes, des Lächelns, eilte Hans Castorp an des mißbrauchten Joachim Seite vorwärts, der schweigend von jenem fort den Abhang hinunter blickte. Ein Streich war es gewesen, ein ziemlich ausgelassener, und wohl sogar etwas wie Verrat und Tücke in Joachims Augen, das wußte Hans Castorp sehr gut. Es war nicht geradeso, wie wenn er jemand Wildfremdes um einen Bleistift ersucht hätte, – vielmehr wäre es beinahe ungehobelt gewesen, an einer Dame, mit der man seit Monaten unter demselben Dache lebte, steif und ohne Ehrenbezeigung vorüberzugehen; und war nicht neulich im Wartezimmer Clawdia sogar ins Gespräch mit ihnen gekommen? Darum mußte Joachim schweigen. Aber Hans Castorp verstand wohl, weshalb der ehrliebende Joachim sonst noch schwieg und abgewendeten Kopfes ging, während er selbst über seinen gelungenen Streich so ausbündig und durchgängerisch glücklich war. Glücklicher konnte nicht sein, wer etwa im Flachlande erlaubter-, aussichtsreicher- und im Grunde vergnügterweise einem gesunden Gänschen „sein Herz geschenkt“ und großen Erfolg dabei gehabt hatte, – nein, so glücklich, wie er nun über das wenige, das er sich in guter Stunde geraubt und gesichert, konnte ein solcher nicht sein ... Darum schlug er nach einer Weile seinen Vetter mit Macht auf die Schulter und sagte:
„Hallo, du, was ist mit dir? Es ist so schönes Wetter! Nachher wollen wir zum Kurhaus hinunter, da machen sie wahrscheinlich Musik, bedenke mal! Vielleicht spielen sie ‚Hier an dem Herzen treu geborgen, die Blume, sieh, von jenem Morgen‘ aus ‚Carmen‘. Was ist dir über die Leber gelaufen?“
„Nichts“, sagte Joachim. „Aber du siehst so heiß aus, ich fürchte, mit deiner Senkung ist es zu Ende.“
Es war zu Ende damit. Die beschämende Herabstimmung von Hans Castorps Natur war überwunden durch den Gruß, den er mit Clawdia Chauchat getauscht hatte, und ganz genau genommen, war es dies Bewußtsein, dem eigentlich seine Genugtuung galt. Ja, Joachim hatte recht gehabt: Merkurius stieg wieder! Er stieg, als Hans Castorp ihn nach dem Spaziergang zu Rate zog, auf rund 38 Grad.
Wenn gewisse Anspielungen Herrn Settembrinis Hans Castorp geärgert hatten, – verwundern durfte er sich nicht darüber und hatte kein Recht, den Humanisten erzieherischer Spürsucht zu zeihen. Ein Blinder hätte bemerken müssen, wie es um ihn stand: er selbst tat nichts, um es geheimzuhalten, eine gewisse Hochherzigkeit und noble Einfalt hinderte ihn einfach, aus seinem Herzen eine Mördergrube zu machen, worin er sich immerhin – und vorteilhaft, wenn man will, – von dem dünnhaarigen Verliebten aus Mannheim und seinem schleichenden Wesen unterschied. Wir erinnern und wiederholen, daß dem Zustande, in dem er sich befand, in der Regel ein Drang und Zwang, sich zu offenbaren, eingeboren ist, ein Trieb zum Bekenntnis und Geständnis, eine blinde Eingenommenheit von sich selbst und eine Sucht, die Welt mit sich zu erfüllen, – desto befremdlicher für uns Nüchterne, je weniger Sinn, Vernunft und Hoffnung offenbar bei der Sache ist. Wie solche Leute es eigentlich anfangen, sich zu verraten, ist schwer zu sagen; sie können, scheint es, nichts tun und lassen, was sie nicht verriete, – besonders nun gar in einer Gesellschaft, von der ein urteilender Kopf bemerkt hatte, sie habe im ganzen nur zwei Dinge im Sinn, nämlich erstens Temperatur und dann – nochmals Temperatur, das heißt zum Beispiel die Frage, mit wem Frau Generalkonsul Wurmbrandt aus Wien sich für die Flatterhaftigkeit des Hauptmanns Miklosich schadlos halte: ob mit dem völlig genesenen schwedischen Recken oder mit dem Staatsanwalt Paravant aus Dortmund oder drittens mit beiden zugleich. Denn daß die Bande, die den Staatsanwalt und Frau Salomon aus Amsterdam mehrere Monate lang verknüpft hatten, nach gütlicher Übereinkunft gelöst worden waren und Frau Salomon, dem Zuge ihrer Jahre folgend, sich den zarteren Semestern zugewandt und den wulstlippigen Gänser vom Tische der Kleefeld unter ihre Fittiche genommen oder, wie Frau Stöhr es in einer Art von Kanzleistil, dabei aber nicht ohne Anschaulichkeit ausdrückte, ihn „sich beigebogen“ hatte, – das war sicher und bekannt, so daß folglich der Staatsanwalt freie Hand hatte, sich der Generalkonsulin wegen mit dem Schweden zu schlagen oder zu vertragen.
Diese Prozesse also, die in der Berghofgesellschaft und besonders unter der febrilen Jugend anhängig waren, und bei denen die Balkondurchgänge (an den Glaswänden vorbei und das Geländer entlang) offenbar eine bedeutende Rolle spielten: diese Vorgänge hatte man im Sinn, sie bildeten einen Hauptbestandteil der hiesigen Lebensluft, – und auch damit ist das, was hier vorschwebt, nicht eigentlich ausgedrückt. Hans Castorp hatte nämlich den eigentümlichen Eindruck, daß auf einer Grundangelegenheit, welcher überall in der Welt eine hinlängliche, in Ernst und Scherz sich äußernde Wichtigkeit zugebilligt wird, hierorts denn doch ein Ton-, Wert- und Bedeutungszeichen lag, so schwer und vor Schwere so neu, daß es die Sache selbst in einem völlig neuen und, wenn nicht schrecklichen, so doch in seiner Neuheit erschreckenden Lichte erscheinen ließ. Indem wir dies aussagen, verändern wir unsere Mienen und bemerken, daß, wenn wir von den fraglichen Beziehungen bisher in einem leichten und spaßhaften Ton gesprochen haben sollten, es aus denselben geheimen Gründen geschehen wäre, aus denen es so oft geschieht, ohne daß für die Leichtigkeit oder Spaßhaftigkeit der Sache damit irgendetwas bewiesen wäre; und in der Sphäre, wo wir uns befinden, wäre das in der Tat noch weniger der Fall als anderwärts. Hans Castorp hatte geglaubt, sich auf jene gern bewitzelte Grundangelegenheit im üblichen Maße zu verstehen, und mochte mit Recht so geglaubt haben. Nun erkannte er, daß er sich im Flachlande nur sehr unzulänglich darauf verstanden, eigentlich sich in einfältiger Unwissenheit darüber befunden hatte, – während hier persönliche Erfahrungen, deren Natur wir mehrfach anzudeuten versuchten, und die ihm in gewissen Augenblicken den Ausruf „Mein Gott!“ abpreßten, ihn allerdings von innen her befähigten, den steigernden Akzent des Unerhörten, Abenteuerlich-Namenlosen wahrzunehmen und zu begreifen, den unter Denen hier oben die Sache allgemein und für jeden trug. Nicht daß man nicht auch hier darüber gewitzelt hätte. Aber weit mehr noch als unten trug hier diese Manier das Gepräge des Unsachgemäßen, sie hatte etwas Zähneklapperndes und Kurzatmiges, was sie als durchsichtigen Deckmantel für die darunter verborgene oder vielmehr nicht zu verbergende Not allzu deutlich kennzeichnete. Hans Castorp erinnerte sich des fleckigen Erblassens, das Joachim gezeigt hatte, als jener zum ersten und einzigen Mal in der unschuldig neckenden Art des Tieflandes die Rede auf Marusjas Körperlichkeit gebracht hatte. Er erinnerte sich auch der kalten Blässe, die, als er Frau Chauchat vom einfallenden Abendlichte befreit, sein eigenes Gesicht überzogen hatte, – und daran, daß er sie vorher und nachher bei verschiedenen Gelegenheiten auf manchem fremden Gesicht gewahr geworden war: auf zweien zugleich in der Regel, zum Beispiel auf den Gesichtern der Frau Salomon und des jungen Gänser in jenen Tagen, da das, was Frau Stöhr so redensartlich bezeichnet, sich zwischen ihnen angebahnt hatte. Er erinnerte sich, sagen wir, daran und verstand, daß es unter solchen Umständen nicht nur sehr schwer gewesen wäre, sich nicht zu „verraten“, sondern daß auch die Bemühung darum nur wenig gelohnt haben würde. Mit anderen Worten: es mochte denn doch wohl nicht allein Hoch- und Treuherzigkeit, sondern auch eine gewisse Ermutigung durch die Atmosphäre im Spiele sein, wenn Hans Castorp sich wenig bemüßigt fand, seinen Empfindungen Zwang anzutun und aus seinem Zustande ein Hehl zu machen.
Wäre nicht die von Joachim sofort hervorgehobene Schwierigkeit gewesen, hier Bekanntschaften zu machen, diese Schwierigkeit, die man hauptsächlich darauf zurückführen muß, daß die Vettern in der Kurgesellschaft sozusagen eine Partie und Miniaturgruppe für sich bildeten, und daß der militärische Joachim, auf nichts als rasche Genesung bedacht, der näheren Berührung und Gemeinschaft mit den Leidensgenossen grundsätzlich abhold war: so hätte Hans Castorp noch weit mehr Gelegenheit gehabt und genommen, seine Gefühle hochherzig-zügellos unter die Leute zu bringen. Immerhin konnte Joachim ihn eines Abends während der Salongeselligkeit betreffen, wie er mit Hermine Kleefeld, ihren beiden Tischherren Gänser und Rasmussen und viertens dem Jungen mit dem Einglas und dem Fingernagel zusammenstand und mit Augen, die ihren übernormalen Glanz nicht verleugneten, mit bewegter Stimme eine Stegreifrede über Frau Chauchats eigen- und fremdartige Gesichtsbildung hielt, während seine Zuhörer Blicke tauschten, sich anstießen und kicherten.
Das war peinigend für Joachim; aber der Urheber solcher Lustbarkeit war unempfindlich gegen die Enthüllung seines Zustandes, er mochte meinen, daß derselbe, unbeachtet und verborgen, nicht zu seinem Rechte gekommen wäre. Des allgemeinen Verständnisses dafür durfte er sicher sein. Die Schadenfreude, die sich darein mischte, nahm er in den Kauf. Nicht nur von seinem eigenen Tisch, sondern nachgerade auch von anderen, benachbarten blickte man auf ihn, um sich an seinem Erbleichen und Erröten zu weiden, wenn nach Beginn einer Mahlzeit die Glastür ins Schloß schmetterte, und auch hiermit war er wohl gar noch zufrieden, da es ihm schien, daß seinem Rausch, indem er Aufmerksamkeit erregte, eine gewisse Anerkennung und Bestätigung von außen zuteil werde, geeignet, seine Sache zu fördern, seine unbestimmten und unvernünftigen Hoffnungen zu ermutigen, – und das beglückte ihn sogar. Es kam dahin, daß man sich buchstäblich versammelte, um dem Verblendeten zuzusehen. Das war etwa nach Tische auf der Terrasse oder am Sonntag nachmittag vor der Conciergeloge, wenn die Kurgäste dort ihre Post in Empfang nahmen, die an diesem Tage nicht auf die Zimmer verteilt wurde. Vielfach wußte man, daß da ein kolossal Beschwipster und Hochilluminierter sei, der sich alles anmerken ließ, und so standen etwa Frau Stöhr, Fräulein Engelhart, die Kleefeld nebst ihrer Freundin mit dem Tapirgesicht, der unheilbare Herr Albin, der junge Mann mit dem Fingernagel und noch dieses oder jenes Mitglied der Patientenschaft, – standen mit hinuntergezogenen Mündern und durch die Nase pruschend und sahen ihm zu, der, verloren und leidenschaftlich lächelnd, jene Hitze auf den Wangen, die ihn sofort am ersten Abend seines Hierseins ergriffen, jenen Glanz in den Augen, den schon der Husten des Herrenreiters darin entzündet, in einer bestimmten Richtung blickte ...
Eigentlich war es schön von Herrn Settembrini, daß er unter solchen Umständen auf Hans Castorp zutrat, um ihn in ein Gespräch zu ziehen und nach seinem Ergehen zu fragen; aber es ist zweifelhaft, ob dieser die menschenfreundliche Vorurteilslosigkeit, die darin lag, dankbar zu würdigen wußte. Es mochte im Vestibül sein, am Sonntag nachmittag. Beim Concierge drängten sich die Gäste und streckten die Hände nach ihrer Post. Auch Joachim war dort vorn. Sein Vetter war zurückgeblieben und trachtete in der beschriebenen Verfassung, einen Blick Clawdia Chauchats zu gewinnen, die mit ihrer Tischgesellschaft in der Nähe stand, wartend, daß das Gedräng an der Loge sich lichten möge. Es war eine Stunde, die die Kurgäste durcheinandermischte, eine Stunde der Gelegenheiten, geliebt und ersehnt aus diesem Grunde von dem jungen Hans Castorp. Vor acht Tagen war er am Schalter in sehr nahe Berührung mit Madame Chauchat gekommen, so daß sie ihn sogar etwas gestoßen und mit flüchtiger Kopfwendung „Pardon“ zu ihm gesagt hatte, – worauf er kraft einer febrilen Geistesgegenwart, die er segnete, zu antworten vermocht hatte:
„Pas de quoi, madame!“
Welche Lebensgunst, dachte er, daß jeden Sonntag nachmittag mit Sicherheit in der Vorhalle Postverteilung stattfand! Man kann sagen, daß er die Woche konsumiert hatte, indem er auf die Wiederkehr derselben Stunde in sieben Tagen wartete, und Warten heißt: Voraneilen, heißt: Zeit und Gegenwart nicht als Geschenk, sondern nur als Hindernis empfinden, ihren Eigenwert verneinen und vernichten und sie im Geist überspringen. Warten, sagt man, sei langweilig. Es ist jedoch ebensowohl oder sogar eigentlich kurzweilig, indem es Zeitmengen verschlingt, ohne sie um ihrer selbst willen zu leben und auszunutzen. Man könnte sagen, der Nichts-als-Wartende gleiche einem Fresser, dessen Verdauungsapparat die Speisen, ohne ihre Nähr- und Nutzwerte zu verarbeiten, massenhaft durchtriebe. Man könnte weitergehen und sagen: wie unverdaute Speise ihren Mann nicht stärker mache, so mache verwartete Zeit nicht älter. Freilich kommt reines und unvermischtes Warten praktisch nicht vor.
Es war also die Woche verschlungen und die Sonntagnachmittagspoststunde wieder in Kraft getreten, nicht anders, als wäre es immer noch die von vor sieben Tagen. Aufs erregendste fuhr sie fort, Gelegenheit zu machen, barg und bot in jeder Minute die Möglichkeit, mit Frau Chauchat in gesellschaftliche Beziehungen zu treten: Möglichkeiten, von denen Hans Castorp sich das Herz pressen und jagen ließ, ohne sie ins Wirkliche übertreten zu lassen. Dem standen Hemmungen entgegen, die teils militärischer, teils zivilistischer Natur waren: – teils nämlich mit der Gegenwart des ehrenhaften Joachim und mit Hans Castorps eigener Ehre und Pflicht zusammenhingen, teils aber auch in dem Gefühl ihren Grund hatten, daß gesellschaftliche Beziehungen zu Clawdia Chauchat, gesittete Beziehungen, bei denen man „Sie“ sagte und Verbeugungen machte und womöglich Französisch sprach, – nicht nötig, nicht wünschenswert, nicht das Richtige seien ... Er stand und sah sie lachend sprechen, genau wie Pribislav Hippe dereinst auf dem Schulhof sprechend gelacht hatte: ihr Mund öffnete sich ziemlich weit dabei, und ihre schiefstehenden graugrünen Augen über den Backenknochen zogen sich zu schmalen Ritzen zusammen. Das war durchaus nicht „schön“; aber es war, wie es war, und bei der Verliebtheit kommt das ästhetische Vernunfturteil so wenig zu seinem Recht, wie das moralische. –
„Sie erwarten ebenfalls Briefschaften, Ingenieur?“
So redete nur einer, ein Störender. Hans Castorp fuhr zusammen und wandte sich Herrn Settembrini zu, der lächelnd vor ihm stand. Es war das feine und humanistische Lächeln, mit dem er dereinst bei der Bank am Wasserlauf den Ankömmling zuerst begrüßt hatte, und wie damals schämte Hans Castorp sich, als er es sah. Aber wie oft er auch im Traume den „Drehorgelmann“ von der Stelle zu drängen gesucht hatte, weil er „hier störe“, – der wachende Mensch ist besser als der träumende, und nicht nur zu seiner Beschämung und Ernüchterung wurde Hans Castorp dieses Lächelns wieder ansichtig, sondern auch mit Gefühlen dankbarer Bedürftigkeit. Er sagte:
„Gott, Briefschaften, Herr Settembrini. Ich bin doch kein Ambassadeur! Vielleicht ist eine Postkarte da für einen von uns. Mein Vetter sieht eben mal nach.“
„Mir hat der hinkende Teufel da vorn meine kleinen Korrespondenzen schon ausgehändigt“, sagte Settembrini und führte die Hand zur Seitentasche seines unvermeidlichen Flausrockes. „Interessante Dinge, Dinge von literarischer und sozialer Tragweite, ich leugne es nicht. Es handelt sich um ein enzyklopädisches Werk, an dem mitzuarbeiten ein humanitäres Institut mich würdigt ... Kurz, um schöne Arbeit.“ Herr Settembrini brach ab. „Aber Ihre Angelegenheiten?“ fragte er. „Wie steht es damit? Wie weit ist beispielsweise der Akklimatisierungsprozeß gediehen? Sie weilen alles in allem so lange noch nicht in unserer Mitte, daß die Frage nicht mehr an der Tagesordnung wäre.“
„Danke, Herr Settembrini; es hat nach wie vor seine Schwierigkeiten damit. Ich halte für möglich, daß es das bis zum letzten Tage haben wird. Manche gewöhnen sich nie, sagte mein Vetter mir gleich, als ich ankam. Aber man gewöhnt sich daran, daß man sich nicht gewöhnt.“
„Ein verwickelter Vorgang“, lachte der Italiener. „Eine sonderbare Art der Einbürgerung. Natürlich, die Jugend ist zu allem fähig. Sie gewöhnt sich nicht, aber sie schlägt Wurzeln.“
„Und schließlich ist das ja kein sibirisches Bergwerk hier.“
„Nein. Oh, Sie bevorzugen östliche Vergleiche. Sehr begreiflich. Asien verschlingt uns. Wohin man blickt: tatarische Gesichter.“ Und Herr Settembrini wandte diskret den Kopf über die Schulter. „Dschingis-Khan,“ sagte er, „Steppenwolfslichter, Schnee und Schnaps, Knute, Schlüsselburg und Christentum. Man sollte der Pallas Athene hier in der Vorhalle einen Altar errichten, – im Sinne der Abwehr. Sehen Sie, da vorn ist so ein Iwan Iwanowitsch ohne Weißzeug mit dem Staatsanwalt Paravant in Streit geraten. Jeder will vor dem anderen an der Reihe sein, seine Post zu empfangen. Ich weiß nicht, wer recht hat, aber für mein Gefühl steht der Staatsanwalt im Schutze der Göttin. Er ist zwar ein Esel, aber er versteht wenigstens Latein.“
Hans Castorp lachte, – was Herr Settembrini niemals tat. Man konnte ihn sich herzlich lachend gar nicht vorstellen; über die feine und trockene Spannung seines Mundwinkels brachte er es nicht hinaus. Er sah dem jungen Manne beim Lachen zu und fragte dann:
„Ihr Diapositiv – haben Sie bekommen?“
„Das habe ich bekommen!“ bestätigte Hans Castorp wichtig. „Schon neulich. Hier ist es.“ Und er griff in die innere Brusttasche.
„Ah, Sie tragen es im Portefeuille. Wie einen Ausweis sozusagen, einen Paß oder eine Mitgliedskarte. Sehr gut. Lassen Sie sehen!“ Und Herr Settembrini hob die kleine, mit schwarzen Papierstreifen gerahmte Glasplatte gegen das Licht, indem er sie zwischen Daumen und Zeigefinger seiner Linken hielt, – eine oft gesehene, sehr übliche Bewegung hier oben. Sein Gesicht mit den schwarzen Mandelaugen grimassierte ein wenig, während er das funebre Lichtbild prüfte, – ohne ganz deutlich werden zu lassen, ob es nur des genaueren Sehens wegen oder aus anderen Gründen geschah.
„Ja, ja“, sagte er dann. „Hier haben Sie Ihre Legitimation, ich danke bestens.“ Und er reichte das Glas seinem Besitzer zurück, reichte es ihm von der Seite, gewissermaßen über den eigenen Arm hinüber und abgewandten Gesichtes.
„Haben Sie die Stränge gesehen?“ fragte Hans Castorp. „Und die Knötchen?“
„Sie wissen,“ antwortete Herr Settembrini schleppend, „wie ich über den Wert dieser Produkte denke. Sie wissen auch, daß die Flecke und Dunkelheiten da im Inneren zum allergrößten Teil physiologisch sind. Ich habe hundert Bilder gesehen, die ungefähr aussahen wie Ihres, und die die Entscheidung, ob sie wirklich einen ‚Ausweis‘ bildeten oder nicht, einigermaßen in das Belieben des Beurteilers stellten. Ich rede als Laie, aber immerhin als ein langjähriger Laie.“
„Sieht Ihr eigener Ausweis schlimmer aus?“
„Ja, etwas schlimmer. – Übrigens ist mir bekannt, daß auch unsere Herren und Meister auf dieses Spielzeug allein keine Diagnose gründen. – Und Sie beabsichtigen nun also, bei uns zu überwintern?“
„Ja, lieber Gott ... Ich fange an, mich an den Gedanken zu gewöhnen, daß ich erst mit meinem Vetter zusammen wieder hinunterfahren werde.“
„Das heißt, Sie gewöhnen sich daran, daß Sie sich nicht ... Sie formulierten das sehr witzig. Ich hoffe, Sie haben Ihre Sachen erhalten, – warme Kleider, solides Schuhwerk?“
„Alles. Alles in schönster Ordnung, Herr Settembrini. Ich habe meine Verwandten informiert, und unsere Haushälterin hat mir alles als Eilgut geschickt. Ich kann es nun aushalten.“
„Das beruhigt mich. Aber halt, Sie brauchen einen Sack, einen Pelzsack, – wo haben wir unsere Gedanken! Dieser Nachsommer ist trügerisch; in einer Stunde kann es tiefer Winter sein. Sie werden hier die kältesten Monate verbringen ...“
„Ja, der Liegesack,“ sagte Hans Castorp, „der ist wohl ein Zubehör. Ich habe auch schon flüchtig daran gedacht, daß wir in den nächsten Tagen mal, mein Vetter und ich, in den Ort gehen müssen und einen kaufen. Man braucht das Ding später nie wieder, aber schließlich für vier bis sechs Monate lohnt es.“
„Es lohnt, es lohnt. – Ingenieur!“ sagte Herr Settembrini leise, indem er näher an den jungen Mann herantrat. „Wissen Sie nicht, daß es grauenhaft ist, wie Sie mit den Monaten herumwerfen? Grauenhaft, weil unnatürlich und Ihrem Wesen fremd, nur auf der Gelehrigkeit Ihrer Jahre beruhend. Ach, diese übergroße Gelehrigkeit der Jugend! – sie ist die Verzweiflung der Erzieher, denn vor allem ist sie bereit, sich im Schlimmen zu bewähren. Reden Sie nicht, wie es in der Luft liegt, junger Mensch, sondern wie es Ihrer europäischen Lebensform angemessen ist! Hier liegt vor allem viel Asien in der Luft, – nicht umsonst wimmelt es von Typen aus der moskowitischen Mongolei! Diese Leute“ – und Herr Settembrini deutete mit dem Kinn über die Schulter hinter sich – „richten Sie sich innerlich nicht nach ihnen, lassen Sie sich von ihren Begriffen nicht infizieren, setzen Sie vielmehr Ihr Wesen, Ihr höheres Wesen gegen das ihre, und halten Sie heilig, was Ihnen, dem Sohn des Westens, des göttlichen Westens, – dem Sohn der Zivilisation, nach Natur und Herkunft heilig ist, zum Beispiel die Zeit! Diese Freigebigkeit, diese barbarische Großartigkeit im Zeitverbrauch ist asiatischer Stil, – das mag ein Grund sein, weshalb es den Kindern des Ostens an diesem Orte behagt. Haben Sie nie bemerkt, daß, wenn ein Russe ‚vier Stunden‘ sagt, es nicht mehr ist, als wenn unsereins ‚eine‘ sagt? Leicht zu denken, daß die Nonchalance dieser Menschen im Verhältnis zur Zeit mit der wilden Weiträumigkeit ihres Landes zusammenhängt. Wo viel Raum ist, da ist viel Zeit, – man sagt ja, daß sie das Volk sind, das Zeit hat und warten kann. Wir Europäer, wir können es nicht. Wir haben so wenig Zeit, wie unser edler und zierlich gegliederter Erdteil Raum hat, wir sind auf genaue Bewirtschaftung des einen wie des anderen angewiesen, auf Nutzung, Nutzung, Ingenieur! Nehmen Sie unsere großen Städte als Sinnbild, diese Zentren und Brennpunkte der Zivilisation, diese Mischkessel des Gedankens! In demselben Maße, wie der Boden sich dort verteuert, Raumverschwendung zur Unmöglichkeit wird, in demselben Maße, bemerken Sie das, wird dort auch die Zeit immer kostbarer. Carpe diem! Das sang ein Großstädter. Die Zeit ist eine Göttergabe, dem Menschen verliehen, damit er sie nutze – sie nutze, Ingenieur, im Dienste des Menschheitsfortschritts.“
Selbst dieses letzte Wort, so viele Hindernisse es seiner mediterranen Zunge bieten mochte, hatte Herr Settembrini auf erfreuliche Art, klar, wohllautend und – man kann wohl sagen – plastisch zu Gehör gebracht. Hans Castorp antwortete nicht anders, als mit der kurzen, steifen und befangenen Verbeugung eines Schülers, der eine verweisartige Belehrung entgegennimmt. Was hätte er erwidern sollen? Dies Privatissimum, das Herr Settembrini ihm insgeheim, mit dem Rücken gegen die ganze übrige Gästeschaft und beinahe flüsternd, gehalten, hatte zu sachlichen, zu ungesellschaftlichen, zu wenig gesprächsmäßigen Charakter getragen, als daß der Takt erlaubt hätte, auch nur Beifall zu äußern. Man antwortet einem Lehrer nicht: „Das haben Sie schön gesagt.“ Hans Castorp hatte es wohl früher manchmal getan, gewissermaßen um das gesellschaftliche Gleichheitsverhältnis zu wahren; allein so dringlich erzieherisch hatte der Humanist noch niemals gesprochen; es blieb nichts übrig, als die Vermahnung einzustecken, – benommen wie ein Schuljunge von soviel Moral.
Man sah übrigens Herrn Settembrini an, daß seine Gedankentätigkeit auch im Schweigen noch ihren Fortgang nahm. Noch immer stand er dicht vor Hans Castorp, so daß dieser sich sogar ein wenig zurückbeugte, und seine schwarzen Augen waren in fixer und sinnend blinder Einstellung auf des jungen Mannes Gesicht gerichtet.
„Sie leiden, Ingenieur!“ fuhr er fort. „Sie leiden wie ein Verirrter, – wer sähe es Ihnen nicht an? Aber auch Ihr Verhalten zum Leiden sollte ein europäisches Verhalten sein, – nicht das des Ostens, der, weil er weich und zur Krankheit geneigt ist, diesen Ort so ausgiebig beschickt ... Mitleid und unermeßliche Geduld, das ist seine Art, dem Leiden zu begegnen. Es kann, es darf die unsrige, die Ihre nicht sein! ... Wir sprachen von meiner Post ... Sehen Sie, hier ... Oder besser noch, – kommen Sie! Es ist unmöglich, hier ... Wir ziehen uns zurück, wir treten dort drüben ein. Ich mache Ihnen Eröffnungen, welche ... Kommen Sie!“ Und sich umwendend, zog er Hans Castorp fort aus dem Vestibül, in das erste, dem Portal am nächsten gelegene der Gesellschaftszimmer, das als Schreib- und Leseraum eingerichtet und jetzt leer von Gästen war. Es zeigte eichene Wandtäfelungen unter seinem hellen Gewölbe, Bücherschränke, einen von Stühlen umgebenen, mit gerahmten Zeitungen belegten Tisch in der Mitte und Schreibgelegenheiten unter den Bögen der Fensternischen. Herr Settembrini schritt bis in die Nähe eines der Fenster vor, Hans Castorp folgte ihm. Die Tür blieb offen.
„Diese Papiere,“ sagte der Italiener, indem er aus der beutelartigen Seitentasche seines Flauses mit fliegender Hand ein Konvolut, ein umfangreiches, schon geöffnetes Briefkuvert zog und seinen Inhalt, verschiedene Drucksachen nebst einem Schreiben, vor Hans Castorps Augen durch die Finger gleiten ließ, „diese Papiere tragen in französischer Sprache den Aufdruck: ‚Internationaler Bund für Organisierung des Fortschritts.‘ Man sendet sie mir aus Lugano, wo sich ein Filialbureau des Bundes befindet. Sie fragen mich nach seinen Grundsätzen, seinen Zielen? Ich gebe sie Ihnen in zwei Worten. Die Liga für Organisierung des Fortschritts leitet aus der Entwicklungslehre Darwins die philosophische Anschauung ab, daß der innerste Naturberuf der Menschheit ihre Selbstvervollkommnung ist. Sie folgert daraus weiter, daß es Pflicht eines jeden ist, der seinem Naturberuf genügen will, am Menschheitsfortschritt tätig mitzuarbeiten. Viele sind ihrem Rufe gefolgt; die Zahl ihrer Mitglieder in Frankreich, Italien, Spanien, der Türkei und selbst in Deutschland ist bedeutend. Auch ich habe die Ehre, in den Bundesregistern geführt zu werden. Ein wissenschaftlich ausgearbeitetes Reformprogramm großen Stils ist entworfen, das alle augenblicklichen Vervollkommnungsmöglichkeiten des menschlichen Organismus umfaßt. Das Problem der Gesundheit unserer Rasse wird studiert, man prüft alle Methoden zur Bekämpfung der Degeneration, die ohne Zweifel eine beklagenswerte Begleiterscheinung der zunehmenden Industrialisierung ist. Ferner betreibt der Bund die Gründung von Volksuniversitäten, die Überwindung der Klassenkämpfe durch alle die sozialen Verbesserungen, die sich zu diesem Zwecke empfehlen, endlich die Beseitigung der Völkerkämpfe, des Krieges durch die Entwicklung des internationalen Rechts. Sie sehen, die Anstrengungen der Liga sind hochherzig und umfassend. Mehrere internationale Zeitschriften zeugen von ihrer Tätigkeit, – Monatsrevuen, die in drei oder vier Weltsprachen höchst anregend über die fortschrittliche Entwicklung der Kulturmenschheit berichten. Zahlreiche Ortsgruppen sind in den verschiedenen Ländern gegründet worden, die durch Diskussionsabende und Sonntagsfeiern im Sinne des menschlichen Fortschrittsideals aufklärend und erbaulich wirken sollen. Vor allem beeifert sich der Bund, den politischen Fortschrittsparteien aller Länder mit seinem Material zur Hand zu gehen ... Sie folgen meinen Worten, Ingenieur?“
„Absolut!“ antwortete Hans Castorp heftig und überstürzt. Er hatte bei diesem Wort das Gefühl eines Menschen, der ausgleitet und sich eben noch glücklich auf den Füßen hält.
Herr Settembrini schien befriedigt.
„Ich nehme an, es sind neue, überraschende Einblicke, die Sie da tun?“
„Ja, ich muß gestehen, es ist das erste, was ich über diese ... diese Anstrengungen höre.“
„Hätten Sie nur,“ rief Settembrini leise, „hätten Sie nur früher davon gehört! Aber vielleicht hören Sie noch nicht zu spät davon. Nun, diese Druckschriften ... Sie wollen wissen, was sie behandeln ... Hören Sie weiter! Im Frühjahr war eine feierliche Hauptversammlung des Bundes nach Barcelona einberufen, – Sie wissen, daß diese Stadt sich besonderer Beziehungen zur politischen Fortschrittsidee rühmen kann. Der Kongreß tagte eine Woche lang unter Banketten und Festlichkeiten. Guter Gott, ich wollte hinreisen, es verlangte mich sehnlichst, an den Beratungen teilzunehmen. Aber dieser Schuft von Hofrat verbot es mir unter Todesdrohungen, – und, was wollen Sie, ich fürchtete den Tod und reiste nicht. Ich war verzweifelt, wie Sie sich denken können, über den Streich, den meine unzulängliche Gesundheit mir spielte. Nichts ist schmerzhafter, als wenn unser organisches, unser tierisches Teil uns hindert, der Vernunft zu dienen. Desto lebhafter ist meine Befriedigung über diese Zuschrift des Bureaus von Lugano ... Sie sind neugierig auf ihren Inhalt? Das glaube ich gern! Ein paar flüchtige Informationen ... Der ‚Bund zur Organisierung des Fortschritts‘, eingedenk der Wahrheit, daß seine Aufgabe darin besteht, das Glück der Menschheit herbeizuführen, mit anderen Worten: das menschliche Leiden durch zweckvolle soziale Arbeit zu bekämpfen und am Ende völlig auszumerzen, – eingedenk ferner der Wahrheit, daß diese höchste Aufgabe nur mit Hilfe der soziologischen Wissenschaft gelöst werden kann, deren Endziel der vollkommene Staat ist, – der Bund also hat in Barcelona die Herstellung eines vielbändigen Buchwerkes beschlossen, das den Titel ‚Soziologie der Leiden‘ führen wird, und worin die menschlichen Leiden nach allen ihren Klassen und Gattungen in genauer und erschöpfender Systematik bearbeitet werden sollen. Sie werden mir einwenden: was nützen Klassen, Gattungen, Systeme! Ich antworte Ihnen: Ordnung und Sichtung sind der Anfang der Beherrschung, und der eigentlich furchtbare Feind ist der unbekannte. Man muß das Menschengeschlecht aus den primitiven Stadien der Furcht und der duldenden Dumpfheit herausführen und sie zur Phase zielbewußter Tätigkeit leiten. Man muß sie darüber aufklären, daß Wirkungen hinfällig werden, deren Ursachen man zuerst erkennt und dann aufhebt, und daß fast alle Leiden des Individuums Krankheiten des sozialen Organismus sind. Gut! Dies ist die Absicht der ‚Soziologischen Pathologie‘. Sie wird also in etwa zwanzig Bänden von Lexikonformat alle menschlichen Leidensfälle aufführen und behandeln, die sich überhaupt erdenken lassen, von den persönlichsten und intimsten bis zu den großen Gruppenkonflikten, den Leiden, die aus Klassenfeindschaften und internationalen Zusammenstößen erwachsen, sie wird, kurz gesagt, die chemischen Elemente aufzeigen, aus deren vielfältiger Mischung und Verbindung sich alles menschliche Leiden zusammensetzt, und indem sie die Würde und das Glück der Menschheit zur Richtschnur nimmt, wird sie ihr in jedem Falle die Mittel und Maßnahmen an die Hand geben, die ihr zur Beseitigung der Leidensursachen angezeigt scheinen. Berufene Fachmänner der europäischen Gelehrtenwelt, Ärzte, Volkswirte und Psychologen, werden sich in die Ausarbeitung dieser Enzyklopädie der Leiden teilen, und das General-Redaktionsbureau zu Lugano wird das Sammelbecken sein, in dem die Artikel zusammenfließen. Sie fragen mich mit den Augen, welche Rolle nun mir bei all dem zufallen soll? Lassen Sie mich zu Ende reden! Auch den schönen Geist will dieses große Werk nicht vernachlässigen, soweit er eben menschliches Leiden zum Gegenstande hat. Darum ist ein eigener Band vorgesehen, der, den Leidenden zu Trost und Belehrung, eine Zusammenstellung und kurzgefaßte Analyse aller für jeden einzelnen Konflikt in Betracht kommenden Meisterwerke der Weltliteratur enthalten soll; und – dies ist die Aufgabe, mit der man in dem Schreiben, das Sie hier sehen, Ihren ergebensten Diener betraut.“
„Was Sie sagen, Herr Settembrini! Da erlauben Sie mir aber, Sie herzlich zu beglückwünschen! Das ist ja ein großartiger Auftrag und ganz wie für Sie gemacht, wie mir scheint. Es wundert mich keinen Augenblick, daß die Liga an Sie gedacht hat. Und wie muß es Sie freuen, daß Sie da nun behilflich sein können, die menschlichen Leiden auszumerzen!“
„Es ist eine weitläufige Arbeit,“ sagte Herr Settembrini sinnend, „zu der viel Umsicht und Lektüre erforderlich ist. Zumal,“ fügte er hinzu, während sein Blick sich in der Vielfältigkeit seiner Aufgabe zu verlieren schien, „zumal in der Tat der schöne Geist sich fast regelmäßig das Leiden zum Gegenstande gesetzt hat und selbst Meisterwerke zweiten und dritten Ranges sich irgendwie damit beschäftigen. Gleichviel oder desto besser! So umfassend die Aufgabe immer sein möge, auf jeden Fall ist sie von der Art, daß ich mich ihrer zur Not auch an diesem verfluchten Aufenthalt entledigen kann, obgleich ich nicht hoffen will, daß ich gezwungen sein werde, sie hier zu beenden. Man kann dasselbe,“ fuhr er fort, indem er wieder näher an Hans Castorp herantrat und die Stimme beinahe zum Flüstern dämpfte, „man kann dasselbe von den Pflichten nicht sagen, die Ihnen die Natur auferlegt, Ingenieur! Das ist es, worauf ich hinauswollte, woran ich Sie mahnen wollte. Sie wissen, wie sehr ich Ihren Beruf bewundere, aber da er ein praktischer, kein geistiger Beruf ist, so können Sie ihm, anders als ich, nur in der Welt drunten nachkommen. Nur im Tiefland können Sie Europäer sein, das Leiden auf Ihre Art aktiv bekämpfen, den Fortschritt fördern, die Zeit nutzen. Ich habe Ihnen von der mir zugefallenen Aufgabe nur erzählt, um Sie zu erinnern, um Sie zu sich zu bringen, um Ihre Begriffe richtigzustellen, die sich offenbar unter atmosphärischen Einflüssen zu verwirren beginnen. Ich dringe in Sie: Halten Sie auf sich! Seien Sie stolz und verlieren Sie sich nicht an das Fremde! Meiden Sie diesen Sumpf, dies Eiland der Kirke, auf dem ungestraft zu hausen Sie nicht Odysseus genug sind. Sie werden auf allen Vieren gehen, Sie neigen sich schon auf Ihre vorderen Extremitäten, bald werden Sie zu grunzen beginnen, – hüten Sie sich!“
Der Humanist hatte bei seinen leisen Ermahnungen den Kopf eindringlich geschüttelt. Er schwieg mit niedergeschlagenen Augen und zusammengezogenen Brauen. Es war unmöglich, ihm scherzhaft und ausweichend zu antworten, wie Hans Castorp es zu tun gewohnt war und wie er es auch jetzt einen Augenblick als Möglichkeit erwog. Auch er stand mit gesenkten Lidern. Dann hob er die Schultern und sagte ebenso leise:
„Was soll ich tun?“
„Was ich Ihnen sagte.“
„Das heißt: abreisen?“
Herr Settembrini schwieg.
„Wollen Sie sagen, daß ich nach Hause reisen soll?“
„Das habe ich Ihnen gleich am ersten Abend geraten, Ingenieur.“
„Ja, und damals war ich frei, es zu tun, obgleich ich es unvernünftig fand, die Flinte ins Korn zu werfen, nur weil die hiesige Luft mir ein bißchen zusetzte. Seitdem hat sich die Sachlage aber doch geändert. Seitdem hat sich diese Untersuchung ergeben, nach der Hofrat Behrens mir klipp und klar gesagt hat, es lohnte die Heimreise nicht, in kurzem müßte ich doch wieder antreten, und wenn ich’s da unten so weitertriebe, so ginge mir, was hast du, was kannst du, der ganze Lungenlappen zum Teufel.“
„Ich weiß, jetzt haben Sie Ihren Ausweis in der Tasche.“
„Ja, das sagen Sie so ironisch ... mit der richtigen Ironie natürlich, die keinen Augenblick mißverständlich ist, sondern ein gerades und klassisches Mittel der Redekunst, – Sie sehen, ich merke mir Ihre Worte. Aber können Sie es denn verantworten, mir auf diese Photographie hin und nach dem Ergebnis der Durchleuchtung und nach der Diagnose des Hofrats die Heimreise anzuraten?“
Herr Settembrini zögerte einen Augenblick. Dann richtete er sich auf, schlug auch die Augen auf, die er fest und schwarz auf Hans Castorp richtete, und erwiderte mit einer Betonung, die des theatralischen und effekthaften Einschlages nicht entbehrte:
„Ja, Ingenieur. Ich will es verantworten.“
Aber auch Hans Castorps Haltung hatte sich nun gestrafft. Er hielt die Absätze geschlossen und sah Herrn Settembrini ebenfalls gerade an. Diesmal war es ein Gefecht. Hans Castorp stand seinen Mann. Einflüsse aus der Nähe „stärkten“ ihn. Da war ein Pädagog, und dort draußen war eine schmaläugige Frau. Er entschuldigte sich nicht einmal für das, was er sagte; er fügte nicht hinzu: „Nehmen Sie es mir nicht übel.“ Er antwortete:
„Dann sind Sie vorsichtiger für sich als für andere Leute! Sie sind nicht gegen ärztliches Verbot nach Barcelona zum Fortschrittskongreß gereist. Sie fürchteten den Tod und blieben hier.“
Bis zu einem gewissen Grade war dadurch Herrn Settembrinis Pose unzweifelhaft zerstört. Er lächelte nicht ganz mühelos und sagte:
„Ich weiß eine schlagfertige Antwort zu schätzen, selbst wenn Ihre Logik der Sophisterei nicht fern ist. Es ekelt mich, in einem hier üblichen abscheulichen Wettstreit zu konkurrieren, sonst würde ich Ihnen erwidern, daß ich bedeutend kränker bin als Sie, – leider in der Tat so krank, daß ich die Hoffnung, diesen Ort je wieder verlassen und in die untere Welt zurückkehren zu können, nur künstlicher- und ein wenig selbstbetrügerischerweise hinfriste. In dem Augenblick, wo es sich als völlig unanständig erweisen wird, sie aufrechtzuhalten, werde ich dieser Anstalt den Rücken kehren und für den Rest meiner Tage irgendwo im Tal ein Privatlogis beziehen. Das wird traurig sein, aber da meine Arbeitssphäre die freieste und geistigste ist, wird es mich nicht hindern, bis zu meinem letzten Atemzuge der Sache der Menschheit zu dienen und dem Geist der Krankheit die Stirn zu bieten. Ich habe Sie auf den Unterschied, der in dieser Beziehung zwischen uns besteht, bereits aufmerksam gemacht. Ingenieur, Sie sind nicht der Mann, Ihr besseres Wesen hier zu behaupten, das sah ich bei unserer ersten Begegnung. Sie halten mir vor, ich sei nicht nach Barcelona gereist. Ich habe mich dem Verbot unterworfen, um mich nicht vorzeitig zu zerstören. Aber ich tat es unter dem stärksten Vorbehalt, unter dem stolzesten und schmerzlichsten Protest meines Geistes gegen das Diktat meines armseligen Körpers. Ob dieser Protest auch in Ihnen lebendig ist, indem Sie den Vorschriften der hiesigen Mächte Folge leisten, – ob es nicht vielmehr der Körper ist und sein böser Hang, dem Sie nur zu bereitwillig gehorchen ...“
„Was haben Sie gegen den Körper?“ unterbrach Hans Castorp ihn rasch und blickte ihn groß an mit seinen blauen Augen, deren Weißes von roten Adern durchzogen war. Ihm schwindelte vor seiner Tollkühnheit, und man sah es ihm an. „Wovon spreche ich?“ dachte er. „Es wird ungeheuerlich. Aber ich habe mich einmal auf Kriegsfuß mit ihm gestellt und werde ihm, so lange es irgend geht, das letzte Wort nicht lassen. Natürlich wird er es haben, aber das macht nichts, ich werde immerhin dabei profitieren. Ich werde ihn reizen.“ Er ergänzte seinen Einwand:
„Sie sind doch Humanist? Wie können Sie schlecht auf den Körper zu sprechen sein?“
Settembrini lächelte, diesmal ungezwungen und selbstgewiß.
„‚Was haben Sie gegen die Analyse?‘“ zitierte er, den Kopf auf der Schulter. „‚Sind Sie schlecht auf die Analyse zu sprechen?‘ – Sie werden mich immer bereit finden, Ihnen Rede zu stehen, Ingenieur,“ sagte er mit Verbeugung und einer salutierenden Handbewegung gegen den Fußboden, „besonders wenn Ihre Einwendungen Geist haben. Sie parieren nicht ohne Eleganz. Humanist, – gewiß, ich bin es. Asketischer Neigungen werden Sie mich niemals überführen. Ich bejahe, ich ehre und liebe den Körper, wie ich die Form, die Schönheit, die Freiheit, die Heiterkeit und den Genuß bejahe, ehre und liebe, – wie ich die ‚Welt‘, die Interessen des Lebens vertrete gegen sentimentale Weltflucht, – den Classicismo gegen die Romantik. Ich denke, meine Stellungnahme ist eindeutig. Eine Macht, ein Prinzip aber gibt es, dem meine höchste Bejahung, meine höchste und letzte Ehrerbietung und Liebe gilt, und diese Macht, dieses Prinzip ist der Geist. Wie sehr ich es verabscheue, irgendein verdächtiges Mondscheingespinst und -gespenst, das man ‚die Seele‘ nennt, gegen den Leib ausgespielt zu sehen, – innerhalb der Antithese von Körper und Geist bedeutet der Körper das böse, das teuflische Prinzip, denn der Körper ist Natur, und die Natur – innerhalb ihres Gegensatzes zum Geiste, zur Vernunft, ich wiederhole das! – ist böse, – mystisch und böse. ‚Sie sind Humanist!‘ Allerdings bin ich es, denn ich bin ein Freund des Menschen, wie Prometheus es war, ein Liebhaber der Menschheit und ihres Adels. Dieser Adel aber ist beschlossen im Geiste, in der Vernunft, und darum werden Sie ganz vergebens den Vorwurf des christlichen Obskurantismus erheben ...“
Hans Castorp wehrte ab.
„... Sie werden,“ beharrte Settembrini, „diesen Vorwurf ganz vergebens erheben, wenn humanistischer Adelsstolz die Gebundenheit des Geistes an das Körperliche, an die Natur eines Tages als Erniedrigung, als Schimpf empfinden lernt. Wissen Sie, daß von dem großen Plotinus die Äußerung überliefert ist, er schäme sich, einen Körper zu haben?“ fragte Settembrini und verlangte so ernstlich eine Antwort, daß Hans Castorp genötigt war, zu gestehen, das sei das erste, was er höre.
„Porphyrius überliefert es. Eine absurde Äußerung, wenn Sie wollen. Aber das Absurde, das ist das geistig Ehrenhafte, und nichts kann im Grunde ärmlicher sein, als der Einwand der Absurdität, dort, wo der Geist gegen die Natur seine Würde behaupten will, sich weigert, vor ihr abzudanken ... Haben Sie von dem Erdbeben zu Lissabon gehört?“
„Nein, – ein Erdbeben? Ich sehe hier keine Zeitungen ...“
„Sie mißverstehen mich. Nebenbei bemerkt, ist es bedauerlich – und kennzeichnend für diesen Ort, – daß Sie es hier versäumen, die Presse zu lesen. Aber Sie mißverstehen mich, das Naturereignis, von dem ich spreche, ist nicht aktuell, es fand vor beiläufig hundertundfünfzig Jahren statt ...“
„Ja so! Oh, warten Sie, – richtig! Ich habe gelesen, daß Goethe damals nachts in Weimar in seinem Schlafzimmer zu seinem Diener sagte ...“
„Ah, – nicht davon wollte ich reden“, unterbrach ihn Settembrini, indem er die Augen schloß und seine kleine braune Hand in der Luft schüttelte. „Übrigens vermengen Sie die Katastrophen. Sie haben das Erdbeben von Messina im Sinn. Ich meine die Erschütterung, die Lissabon heimsuchte, im Jahre 1755.“
„Entschuldigen Sie.“
„Nun, Voltaire empörte sich dagegen.“
„Das heißt ... wie? Er empörte sich?“
„Er revoltierte, ja. Er nahm das brutale Fatum und Faktum nicht hin, er weigerte sich, davor abzudanken. Er protestierte im Namen des Geistes und der Vernunft gegen diesen skandalösen Unfug der Natur, dem drei Viertel einer blühenden Stadt und Tausende von Menschenleben zum Opfer fielen ... Sie staunen? Sie lächeln? Mögen Sie immerhin staunen, was das Lächeln betrifft, so nehme ich mir die Freiheit, es Ihnen zu verweisen! Voltaires Haltung war die eines echten Nachkömmlings jener alten Gallier, die ihre Pfeile gegen den Himmel schleuderten ... Sehen Sie, Ingenieur, da haben Sie die Feindschaft des Geistes gegen die Natur, sein stolzes Mißtrauen gegen sie, sein hochherziges Bestehen auf dem Rechte zur Kritik an ihr und ihrer bösen, vernunftwidrigen Macht. Denn sie ist die Macht, und es ist knechtisch, die Macht hinzunehmen, sich mit ihr abzufinden ... wohlgemerkt, sich innerlich mit ihr abzufinden. Da haben Sie aber auch jene Humanität, die sich schlechterdings in keinen Widerspruch verstrickt, sich keines Rückfalls in christliche Duckmäuserei schuldig macht, wenn sie im Körper das böse, das widersacherische Prinzip zu erblicken sich entschließt. Der Widerspruch, den Sie zu sehen meinen, ist im Grunde immer derselbe. ‚Was haben Sie gegen die Analyse?‘ Nichts ... wenn sie Sache der Belehrung, der Befreiung und des Fortschritts ist. Alles ... wenn ihr der scheußliche haut-goût des Grabes anhaftet. Es ist mit dem Körper nicht anders. Man muß ihn ehren und verteidigen, wenn es sich um seine Emanzipation und Schönheit handelt, um die Freiheit der Sinne, um Glück, um Lust. Man muß ihn verachten, sofern er als Prinzip der Schwere und der Trägheit sich der Bewegung zum Lichte entgegensetzt, ihn verabscheuen, sofern er gar das Prinzip der Krankheit und des Todes vertritt, sofern sein spezifischer Geist der Geist der Verkehrtheit ist, der Geist der Verwesung, der Wollust und der Schande ...“
Settembrini hatte die letzten Worte, dicht vor Hans Castorp stehend, fast ohne Ton und sehr rasch gesprochen, um fertig zu werden. Entsatz näherte sich für Hans Castorp: Joachim betrat, zwei Postkarten in der Hand, das Lesezimmer, die Rede des Literaten brach ab, und die Gewandtheit, mit der sein Ausdruck ins gesellschaftlich Leichte hinüberwechselte, verfehlte nicht ihren Eindruck auf seinen Schüler, – wenn man Hans Castorp so nennen konnte.
„Da sind Sie, Leutnant! Sie werden Ihren Vetter gesucht haben, – verzeihen Sie! Wir waren da in ein Gespräch geraten, – wenn mir recht ist, hatten wir sogar einen kleinen Zwist. Er ist kein übler Räsonneur, Ihr Vetter, ein durchaus nicht ungefährlicher Gegner im Wortstreit, wenn es ihm darauf ankommt.“
Hans Castorp und Joachim Ziemßen saßen in weißen Hosen und blauen Jacken nach dem Diner im Garten. Es war noch einer dieser gepriesenen Oktobertage, ein Tag, heiß und leicht, festlich und herb zugleich, mit südlich dunkler Himmelsbläue über dem Tal, dessen von Wegen durchzogene und besiedelte Triften im Grunde noch heiter grünten, und von dessen rauh bewaldeten Lehnen Kuhgeläut kam, – dieser blechern-friedliche, einfältig-musikalische Laut, der klar und ungestört durch die stillen, dünnen, leeren Lüfte schwebte, die Feierstimmung vertiefend, die über hohen Gegenden waltet.
Die Vettern saßen auf einer Bank am Ende des Gartens vor einem Rondell junger Tannen. – Der Platz lag am nordwestlichen Rande der eingezäunten, um fünfzig Meter über das Tal erhöhten Plattform, die das Postament des Berghofgeländes bildete. Sie schwiegen. Hans Castorp rauchte. Er haderte innerlich mit Joachim, weil dieser nach Tische nicht an der Geselligkeit auf der Veranda hatte teilnehmen wollen, sondern ihn gegen Wunsch und Willen in die Stille des Gartens genötigt hatte, bevor sie den Liegedienst aufnehmen würden. Das war tyrannisch von Joachim. Genau genommen, waren sie nicht die siamesischen Zwillinge. Sie konnten sich trennen, wenn ihre Neigungen auseinandergingen. Hans Castorp war ja nicht hier, um Joachim Gesellschaft zu leisten, sondern er war selbst Patient. Er schmollte in diesem Sinne, und er konnte es aushalten, zu schmollen, da er Maria Mancini hatte. Die Hände in den Seitentaschen seiner Jacke, die braunbeschuhten Füße von sich gestreckt, hielt er die lange, mattgraue Zigarre, die sich noch im ersten Stadium der Konsumtion befand, das heißt: von deren stumpfer Spitze er die Asche noch nicht abgestreift hatte, in der Mitte der Lippen, so daß sie etwas abwärts hing, und genoß nach der starken Mahlzeit ihr Aroma, dessen er nun völlig wieder habhaft geworden war. Mochte sonst seine Eingewöhnung hier oben nur in der Gewöhnung daran bestehen, daß er sich nicht gewöhnte, – was den Chemismus seines Magens, die Nerven seiner trockenen und zu Blutungen neigenden Schleimhäute betraf, so hatte offenbar die Anpassung sich endlich doch vollzogen: unmerklich und ohne daß er den Fortschritt hatte verfolgen können, hatte sich im Wandel der Tage, dieser fünfundsechzig oder siebzig Tage, sein ganzes organisches Behagen an dem wohlfabrizierten pflanzlichen Reiz- oder Betäubungsmittel wieder hergestellt. Er freute sich des wiedergekehrten Vermögens. Die moralische Genugtuung verstärkte den physischen Genuß. Während seiner Bettlägrigkeit hatte er an dem mitgebrachten Vorrat von zweihundert Stück gespart; Restbestände davon waren noch vorhanden. Aber zugleich mit der Wäsche, den Winterkleidern hatte er sich von Schalleen auch weitere fünfhundert Stück der Bremer Ware kommen lassen, um eingedeckt zu sein. Es waren schöne lackierte Kistchen mit einem Globus, vielen Medaillen und einem von Fahnen umflatterten Ausstellungsgebäude in Gold geschmückt.
Wie sie saßen, siehe, so kam Hofrat Behrens durch den Garten. Er hatte heute am Mittagessen im Saale teilgenommen; am Tische der Frau Salomon hatte man ihn die riesigen Hände vor seinem Teller falten sehen. Dann hatte er sich wohl auf der Terrasse verweilt, persönliche Töne angeschlagen, wahrscheinlich das Stiefelbandkunststück ausgeführt, für jemanden, der es noch nicht gesehen. Nun kam er auf dem Kieswege schlendernd heran, ohne Ärztekittel, in kleinkariertem Schwalbenschwanz, den steifen Hut im Nacken, eine Zigarre auch seinerseits im Munde, die sehr schwarz war, und aus der er große, weißliche Rauchwolken sog. Sein Kopf, sein Gesicht mit den bläulich erhitzten Backen, der Stumpfnase, den feuchten, blauen Augen und dem geschürzten Bärtchen waren klein im Verhältnis zu der langen, leicht gebückten und geknickten Gestalt und zu dem Umfange seiner Hände und Füße. Er war nervös, sichtlich schrak er zusammen, als er die Vettern bemerkte, und blieb sogar etwas verlegen, da er gerade auf sie zugehen mußte. Er begrüßte sie in der gewohnten Weise, aufgeräumt und redensartlich, mit „Sieh da, sieh da, Timotheus!“ und Segenswünschen für ihren Stoffwechsel, indem er sie nötigte, sitzenzubleiben, da sie sich zu seinen Ehren erheben wollten.
„Geschenkt, geschenkt. Keine Umstände weiter mit mir schlichtem Manne. Kommt mir gar nicht zu, sintemalen Sie Patienten sind, einer wie der andere. Sie haben so was nicht nötig. Nichts zu sagen gegen die Situation, wie sie ist.“
Und er blieb vor ihnen stehen, die Zigarre zwischen Zeige- und Mittelfinger seiner riesigen Rechten.
„Wie schmeckt der Krautwickel, Castorp? Lassen Sie mal sehen, ich bin Kenner und Liebhaber. Die Asche ist gut: was ist denn das für eine bräunliche Schöne?“
„Maria Mancini, Postre de Banquett aus Bremen, Herr Hofrat. Kostet wenig oder nichts, neunzehn Pfennig in reinen Farben, hat aber ein Bukett, wie es sonst in dieser Preislage nicht vorkommt. Sumatra-Havanna, Sandblattdecker, wie Sie sehen. Ich habe mich sehr an sie gewöhnt. Es ist eine mittelvolle Mischung und sehr würzig, aber leicht auf der Zunge. Sie hat es gern, wenn man ihr lange die Asche läßt, ich streife nur höchstens zweimal ab. Natürlich hat sie ihre kleinen Launen, aber die Kontrolle bei der Herstellung muß besonders genau sein, denn Maria ist sehr zuverlässig in ihren Eigenschaften und luftet vollkommen gleichmäßig. Darf ich Ihnen eine anbieten?“
„Danke, wir können ja mal tauschen.“ Und sie zogen ihre Etuis.
„Die hat Rasse“, sagte der Hofrat, indem er seine Marke hinreichte. „Temperament, wissen Sie, Saft und Kraft. St. Felix-Brasil, ich habe es immer mit diesem Charakter gehalten. Ein rechter Sorgenbrecher, brennt ein wie Schnaps, und namentlich gegen das Ende hat sie was Fulminantes. Einige Zurückhaltung im Verkehr wird empfohlen, man kann nicht eine an der anderen anzünden, das geht über Manneskraft. Aber lieber mal einen ordentlichen Happen, als den ganzen Tag Wasserdampf ...“
Sie drehten die gewechselten Geschenke zwischen den Fingern, prüften mit sachlicher Kennerschaft diese schlanken Körper, die mit den schräg gleichlaufenden Rippen ihrer erhöhten, hie und da etwas gelüfteten Wickelränder, ihrem aufliegenden Geäder, das zu pulsen schien, den kleinen Unebenheiten ihrer Haut, dem Spiel des Lichtes auf ihren Flächen und Kanten etwas organisch Lebendiges hatten. Hans Castorp sprach es aus:
„So eine Zigarre hat Leben. Sie atmet regelrecht. Zu Hause ließ ich es mir mal einfallen, Maria in einer luftdichten Blechkiste aufzubewahren, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Wollen Sie glauben, daß sie starb? Sie kam um und war tot binnen Wochenfrist, – lauter ledrige Leichen.“
Und sie tauschten ihre Erfahrungen aus über die beste Art, Zigarren aufzubewahren, namentlich Importen. Der Hofrat liebte Importen, er hätte am liebsten immer nur schwere Havannas geraucht. Nur leider vertrug er sie nicht, und zwei kleine Henry Clays, die er einmal in einer Gesellschaft ans Herz genommen, hätten ihn, wie er erzählte, um ein Haar unter den Rasen gebracht. „Ich rauche sie zum Kaffee,“ sagte er, „eine nach der anderen, und denke mir wenig dabei. Aber wie ich fertig bin, da steigt mir die Frage auf, wie mir eigentlich zu Sinne wird. Ganz anders jedenfalls, total fremdartig, wie noch nie im Leben. Nach Hause zu kommen, war keine Kleinigkeit, und wie ich da bin, da denke ich erst recht, mich laust der Affe. Eisbeine, wissen Sie, kalter Schweiß, wo Sie wollen, linnenweiß das Gesicht, das Herz in allen Zuständen, ein Puls, – mal fadenförmig und kaum zu fühlen, mal holterdipolter, über Stock und Stein, verstehen Sie, und das Gehirn in einer Aufregung ... Ich war überzeugt, daß ich abtanzen sollte. Ich sage: abtanzen, weil das das Wort ist, das mir damals einfiel, und das ich brauchte zur Kennzeichnung meines Befindens. Denn eigentlich war es höchst fidel und eine rechte Festivität, obgleich ich kolossale Angst hatte oder, richtiger gesagt, ganz und gar aus Angst bestand. Aber Angst und Festivität schließen sich ja nicht aus, das weiß jeder. Der Bengel, der zum erstenmal ein Mädchen haben soll, hat auch Angst, und sie auch, und dabei schmelzen sie nur so vor Vergnüglichkeit. Na, ich wäre ebenfalls beinahe geschmolzen, mit wogendem Busen wollte ich abtanzen. Aber die Mylendonk brachte mich mit ihren Anwendungen aus der Stimmung. Eiskompressen, Bürstenfrottage, einer Kampferinjektion, und so blieb ich der Menschheit erhalten.“
Hans Castorp, sitzend in seiner Eigenschaft als Patient, blickte mit einer Miene, die von Gedankentätigkeit zeugte, zu Behrens auf, dessen blaue, quellende Augen sich beim Erzählen mit Tränen gefüllt hatten.
„Sie malen doch manchmal, Herr Hofrat“, sagte er plötzlich.
Der Hofrat tat, als pralle er zurück.
„Nanu? Jüngling, wie kommen Sie mir vor?“
„Verzeihung. Ich habe es gelegentlich erwähnen hören. Es fiel mir eben ein.“
„Na, dann will ich mich mal nicht aufs Leugnen verlegen. Wir sind allzumal schwächliche Menschen. Ja, so was ist vorgekommen. Anch’ io sono pittore, wie jener Spanier zu sagen pflegte.“
„Landschaften?“ fragte Hans Castorp kurz und gönnerhaft. Die Umstände verleiteten ihn zu diesem Tone.
„Soviel Sie wollen!“ antwortete der Hofrat mit verlegener Prahlerei. „Landschaften, Stilleben, Tiere, – was ein Kerl ist, schreckt überhaupt vor gar nichts zurück.“
„Aber keine Porträts?“
„Auch ein Porträt ist wohl mal mit untergelaufen. Wollen Sie mir Ihres in Auftrag geben?“
„Ha, ha, nein. Aber es wäre sehr freundlich, wenn Herr Hofrat uns Ihre Bilder bei Gelegenheit mal zeigen würden.“
Auch Joachim, nachdem er den Vetter erstaunt betrachtet, beeilte sich zu versichern, daß das sehr freundlich sein würde.
Behrens war entzückt, geschmeichelt bis zur Begeisterung. Er wurde sogar rot vor Vergnügen, und seine Augen schienen ihre Tränen diesmal vergießen zu wollen.
„Aber gern!“ rief er. „Aber mit dem allergrößten Pläsier! Aber gleich auf der Stelle, wenns Ihnen Spaß macht! Kommen Sie her, kommen Sie mit, ich braue uns einen türkischen Kaffee auf meiner Bude!“ Und er nahm die jungen Leute am Arm, zog sie von der Bank und führte sie, eingehängt zwischen ihnen, den Kiesweg entlang gegen seine Wohnung, die, wie sie wußten, in dem nahen nordwestlichen Flügel des Berghofgebäudes gelegen war.
„Ich habe mich ja selbst,“ erklärte Hans Castorp, „früher hie und da in dieser Richtung versucht.“
„Was Sie sagen. Ganz solide in Öl?“
„Nein, nein, über das eine oder andere Aquarell hab ichs nicht hinausgebracht. Mal ein Schiff, ein Seestück, Kindereien. Aber ich sehe Bilder sehr gern, und darum war ich so frei ...“
Namentlich Joachim fand sich einigermaßen beruhigt und aufgeklärt über seines Vetters befremdende Neugier durch diese Erläuterung, – und mehr für ihn, als für den Hofrat, hatte Hans Castorp sich denn auch auf seine eigenen künstlerischen Versuche berufen. Sie langten an: es gab kein so prächtiges, von Laternen flankiertes Portal an dieser Seite, wie drüben an der Auffahrt. Ein paar gerundete Stufen führten zu der eichenen Haustür empor, die der Hofrat mit einem Drücker seines reichhaltigen Schlüsselbundes öffnete. Seine Hand zitterte dabei; entschieden war er nervös. Ein Vorraum, als Garderobe ausgestattet, nahm sie auf, wo Behrens seinen steifen Hut an den Nagel hing. Drinnen, auf dem kurzen, vom allgemeinen Teil des Gebäudes durch eine Glastür abgetrennten Korridor, an dessen beiden Seiten die Räumlichkeiten der kleinen Privatwohnung lagen, rief er nach dem Dienstmädchen und machte seine Bestellung. Dann ließ er seine Gäste unter jovialen und ermutigenden Redensarten eintreten, – durch eine der Türen zur Rechten.
Ein paar banal-bürgerlich möblierte Räume, nach vorn, gegen das Tal blickend, gingen ineinander, ohne Verbindungstüren, nur durch Portieren getrennt: ein „altdeutsches“ Eßzimmer, ein Wohn- und Arbeitszimmer mit Schreibtisch, über dem eine Studentenmütze und gekreuzte Schläger hingen, wolligen Teppichen, Bibliothek und Sofaarrangement und noch ein Rauchkabinett, das „türkisch“ eingerichtet war. Überall hingen Bilder, die Bilder des Hofrats, – höflich und zur Bewunderung bereit gingen die Augen der Eintretenden sogleich darüberhin. Des Hofrats entschwebte Gattin war mehrmals zu sehen: in Öl und auch als Photographie auf dem Schreibtisch. Es war eine dünn und fließend gekleidete, etwas rätselhafte Blondine, welche, die Hände an der linken Schulter gefaltet – und zwar nicht fest gefaltet, sondern nur so, daß die oberen Fingerglieder schwach ineinander lagen –, ihre Augen entweder gen Himmel gerichtet oder tief niedergeschlagen und unter den langen, schräg von den Lidern abstehenden Wimpern versteckt hielt: nur geradeaus und dem Beschauer entgegen blickte die Selige niemals. Sonst gab es hauptsächlich gebirgige Landschaftsmotive, Berge im Schnee und im Tannengrün, Berge, von Höhenqualm umwogt, und Berge, deren trockene und scharfe Umrisse unter dem Einflusse Segantinis in einen tiefblauen Himmel schnitten. Ferner waren da Sennhütten, wammige Kühe auf besonnter Weide stehend und lagernd, ein gerupftes Huhn, das seinen verdrehten Hals zwischen Gemüsen von einer Tischplatte hängen ließ, Blumenstücke, Gebirglertypen und anderes mehr, – gemalt dies alles mit einem gewissen flotten Dilettantismus, in keck aufgeklecksten Farben, die öfters aussahen, als seien sie unmittelbar aus der Tube auf die Leinwand gedrückt, und die lange gebraucht haben mußten, bis sie getrocknet waren – bei groben Fehlern war es zuweilen wirksam.
Anschauend wie in einer Ausstellung gingen sie die Wände entlang, begleitet vom Hausherrn, der dann und wann ein Motiv bei Namen nannte, meistens aber schweigend, in der stolzen Beklommenheit des Künstlers, es genoß, seine Augen zusammen mit denen Fremder auf seinen Werken ruhen zu lassen. Das Porträt Clawdia Chauchats hing im Wohnzimmer an der Fensterwand, – Hans Castorp hatte es schon beim Eintreten mit raschem Blicke erspäht, obgleich es nur eine entfernte Ähnlichkeit aufwies. Absichtlich mied er die Stelle, hielt seine Begleiter im Eßzimmer fest, wo er einen grünen Blick ins Sergital mit bläulichen Gletschern im Hintergrunde zu bewundern vorgab, steuerte dann aus eigener Machtvollkommenheit zuerst ins türkische Kabinett hinüber, das er, Lob auf den Lippen, ebenfalls gründlich durchmusterte, und besichtigte dann die Eingangswand des Wohnzimmers, auch Joachim manchmal zur Beifallsäußerung auffordernd. Endlich wandte er sich um und fragte mit Maßen stutzend:
„Da ist doch ein bekanntes Gesicht?“
„Erkennen Sie sie?“ wollte Behrens hören.
„Doch, da ist wohl eine Täuschung nicht möglich. Das ist die Dame vom Guten Russentisch, mit dem französischen Namen ...“
„Stimmt, die Chauchat. Freut mich, daß Sie sie ähnlich finden.“
„Sprechend!“ log Hans Castorp, weniger aus Falschheit, als in dem Bewußtsein, daß er, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, das Modell gar nicht hätte erkennen dürfen, – so wenig, wie Joachim es aus eigenen Kräften jemals erkannt hätte, der gute, überlistete Joachim, dem nun freilich ein Licht aufging, das wahre Licht nach dem falschen, das Hans Castorp ihm vorher angezündet. „Ja so“, sagte er leise und schickte sich darein, das Bild betrachten zu helfen. Sein Vetter hatte sich für ihr Fernbleiben von der Verandageselligkeit schadlos zu halten gewußt.
Es war ein Bruststück in Halbprofil, etwas unter Lebensgröße, dekolletiert, mit einer Schleierdraperie um Schultern und Busen, in einen breiten, schwarzen, nach innen abfallenden und am Rande der Leinwand mit einer Goldleiste verzierten Rahmen gefaßt. Frau Chauchat erschien da zehn Jahre älter, als sie war, wie das bei Dilettantenporträts, die charakteristisch sein wollen, zu gehen pflegt. Im ganzen Gesicht war zuviel Rot, die Nase war arg verzeichnet, die Haarfarbe nicht getroffen, zu strohig, der Mund verzerrt, der besondere Reiz der Physiognomie nicht gesehen oder nicht herausgebracht, durch Vergröberung seiner Ursachen verfehlt, das Ganze ein ziemlich pfuscherhaftes Produkt, als Bildnis seinem Gegenstande nur weitläufig verwandt. Aber Hans Castorp nahm es mit der Ähnlichkeit nicht weiter genau, die Beziehungen dieser Leinwand zu Frau Chauchats Person waren ihm eng genug, das Bild sollte Frau Chauchat darstellen, sie selbst hatte in diesen Räumen dazu Modell gesessen, das genügte ihm, bewegt wiederholte er:
„Wie sie leibt und lebt!“
„Sagen Sie das nicht“, wehrte der Hofrat ab. „Es war ein klotziges Stück Arbeit, ich bilde mir nicht ein, so recht damit fertig geworden zu sein, obgleich wir wohl zwanzig Sitzungen gehabt haben, – wie wollen Sie denn fertig werden mit einer so vertrackten Visage. Man denkt, sie muß leicht zu erwischen sein, mit ihren hyperboreischen Jochbeinen und den Augen, wie aufgesprungene Schnitte in Hefegebäck. Ja, hat sich was. Macht man die Einzelheit richtig, verpatzt man das Ganze. Das reine Vexierrätsel. Kennen Sie sie? Möglicherweise sollte man sie nicht abmalen, sondern nach dem Gedächtnis arbeiten. Kennen Sie sie denn?“
„Ja, nein, oberflächlich, wie man hier die Leute so kennt ...“
„Na, ich kenne sie ja mehr inwendig, subkutan, verstehen Sie, über arteriellen Blutdruck, Gewebsspannung und Lymphbewegung, da weiß ich bei ihr so ziemlich Bescheid – aus bestimmten Gründen. Das Oberflächliche bietet größere Schwierigkeiten. Haben Sie sie schon manchmal gehen sehen? Wie sie geht, so ist ihr Gesicht. Eine Schleicherin. Nehmen Sie zum Exempel die Augen, – ich rede nicht von der Farbe, die auch ihre Tücken hat; ich meine den Sitz, den Schnitt. Die Lidspalte, sagen Sie, ist geschlitzt, schief. Das scheint Ihnen aber nur so. Was Sie täuscht, ist der Epikanthus, das heißt eine Varietät, die bei gewissen Rassen vorkommt und darin besteht, daß ein Hautüberschuß, der von dem flachen Nasensattel dieser Leute herrührt, von der Deckfalte des Lides über den inneren Augenwinkel hinabreicht. Ziehen Sie die Haut über der Nasenwurzel straff an, und Sie haben ein Auge ganz wie von unsereinem. Eine pikante Mystifikation also, übrigens nicht weiter ehrenvoll; denn bei Lichte besehen, läuft der Epikanthus auf eine atavistische Hemmungsbildung hinaus.“
„So verhält sich das also“, sagte Hans Castorp. „Ich wußte es nicht, aber es interessiert mich schon längst, was es mit solchen Augen auf sich hat.“
„Vexation, Täuschung“, bekräftigte der Hofrat. „Zeichnen Sie sie einfach schief und geschlitzt, so sind Sie verloren. Sie müssen die Schiefheit und Geschlitztheit zuwege bringen, wie die Natur sie zuwege bringt, Illusion in der Illusion treiben, sozusagen, und dazu ist natürlich nötig, daß Sie über den Epikanthus Bescheid wissen. Wissen kann überhaupt nicht schaden. Sehen Sie sich die Haut an, die Körperhaut hier. Ist das anschaulich, oder ist es nicht so besonders anschaulich Ihrer Meinung nach?“
„Enorm,“ sagte Hans Castorp, „enorm anschaulich ist sie gemalt, die Haut. Ich glaube, ähnlich gut gemalte ist mir nie vorgekommen. Man meint die Poren zu sehen.“ Und er fuhr leicht mit dem Handrande über das Dekolleté des Bildes, das sehr weiß gegen die übertriebene Rötung des Gesichtes abstach, wie ein Körperteil, der gewöhnlich dem Lichte nicht ausgesetzt ist, und so, absichtlich oder nicht, die Vorstellung des Entblößtseins aufdringlich hervorrief, – ein jedenfalls ziemlich plumper Effekt.
Trotzdem war Hans Castorps Lob berechtigt. Die matt schimmernde Weiße dieser zarten, aber nicht mageren Büste, die sich in der bläulichen Schleierdraperie verlor, hatte viel Natur; sichtlich war sie mit Gefühl gemalt, aber unbeschadet einer gewissen Süßigkeit, die davon ausging, hatte der Künstler ihr eine Art von wissenschaftlicher Realität und lebendiger Genauigkeit zu verleihen gewußt. Er hatte sich des körnigen Charakters der Leinwand bedient, um ihn, namentlich in der Gegend der zart hervortretenden Schlüsselbeine, durch die Ölfarbe hindurch als natürliche Unebenheit der Hautoberfläche wirken zu lassen. Ein Leberfleckchen links, wo die Brust sich zu teilen begann, war nicht außer acht gelassen, und zwischen den Erhebungen glaubte man schwach-bläuliches Geäder durchscheinen zu sehen. Es war, als ginge unter dem Blick des Betrachters ein kaum merklicher Schauer von Sensitivität über diese Nacktheit, – gewagt zu sagen: man mochte sich einbilden, die Perspiration, den unsichtbaren Lebensdunst dieses Fleisches wahrzunehmen, so, als würde man, wenn man etwa die Lippen darauf drückte, nicht den Geruch von Farbe und Firnis, sondern den des menschlichen Körpers verspüren. Wir geben mit alldem die Eindrücke Hans Castorps wieder: aber wenn er besonders bereit war, solche Eindrücke zu empfangen, so ist doch sachlich festzustellen, daß Frau Chauchats Dekolleté das bei weitem bemerkenswerteste Stück Malerei in diesen Zimmern war.
Hofrat Behrens schaukelte sich, die Hände in den Hosentaschen, auf Absätzen und Fußballen, während er seine Arbeit zugleich mit den Besuchern betrachtete.
„Freut mich, Herr Kollege,“ sagte er, „freut mich, daß es Ihnen einleuchtet. Es ist eben gut und kann gar nicht schaden, wenn man auch unter der Epidermis ein bißchen Bescheid weiß und mitmalen kann, was nicht zu sehen ist, – mit anderen Worten: wenn man zur Natur noch in einem andern Verhältnis steht als bloß dem lyrischen, wollen wir mal sagen; wenn man zum Beispiel im Nebenamt Arzt ist, Physiolog, Anatom und von den Dessous auch noch so seine stillen Kenntnisse hat, – das kann von Vorteil sein, sagen Sie, was Sie wollen, es gibt entschieden ein Prä. Die Körperpelle da hat Wissenschaft, die können Sie mit dem Mikroskop auf ihre organische Richtigkeit untersuchen. Da sehen Sie nicht bloß die Schleim- und Hornschichten der Oberhaut, sondern darunter ist das Lederhautgewebe gedacht mit seinen Salbendrüsen und Schweißdrüsen und Blutgefäßen und Wärzchen, – und darunter wieder die Fetthaut, die Polsterung, wissen Sie, die Unterlage, die mit ihren vielen Fettzellen die holdseligen weiblichen Formen zustande bringt. Was aber mitgewußt und mitgedacht ist, das spricht auch mit. Es fließt Ihnen in die Hand und tut seine Wirkung, ist nicht da und irgendwie doch da, und das gibt Anschaulichkeit.“
Hans Castorp war Feuer und Flamme für dies Gespräch, seine Stirn war gerötet, seine Augen eiferten, er wußte nicht, was er zuerst erwidern sollte, denn er hatte vieles zu sagen. Erstens beabsichtigte er, das Bild von der beschatteten Fensterwand fort an einen günstigeren Platz zu schaffen, zweitens wollte er unbedingt an des Hofrats Äußerungen über die Natur der Haut anknüpfen, die ihn dringlich interessierten, drittens aber einen eigenen allgemeinen und philosophischen Gedanken auszudrücken versuchen, der ihm ebenfalls höchlichst am Herzen lag. Während er schon die Hände an das Porträt legte, um es abzuhängen, fing er hastig an:
„Jawohl, jawohl! Sehr gut, das ist wichtig. Ich möchte sagen ... Das heißt, Herr Hofrat sagten: ‚Noch in einem anderen Verhältnis.‘ Es wäre gut, wenn außer dem lyrischen – so, glaube ich, sagten Sie –, dem künstlerischen Verhältnis noch ein anderes vorhanden wäre, wenn man die Dinge, kurz gesagt, noch unter einem anderen Gesichtswinkel auffaßte, zum Beispiel dem medizinischen. Das ist kolossal zutreffend – entschuldigen Herr Hofrat –, ich meine, es ist darum so hervorragend richtig, weil es sich da eigentlich gar nicht um grundverschiedene Verhältnisse und Gesichtswinkel handelt, sondern genau genommen immer um ein und denselben – bloß um Spielarten davon, ich meine: Schattierungen, ich meine also: Variationen von ein und demselben allgemeinen Interesse, von dem auch die künstlerische Beschäftigung bloß ein Teil und ein Ausdruck ist, wenn ich so sagen darf. Ja, entschuldigen Sie, ich hänge das Bild ab, es hat ja hier absolut kein Licht, Sie werden sehen, ich trage es mal eben zum Sofa hinüber, ob es denn da nicht doch ganz anders ... Ich wollte sagen: Womit beschäftigt sich die medizinische Wissenschaft? Ich verstehe ja natürlich nichts davon, aber sie beschäftigt sich doch mit dem Menschen. Und die Juristerei, die Gesetzgebung und Rechtsprechung? Auch mit dem Menschen. Und die Sprachforschung, mit der ja meistenteils die Ausübung des pädagogischen Berufs verbunden ist? Und die Theologie, die Seelsorge, das geistliche Hirtenamt? Alle mit dem Menschen, es sind alles bloß Abschattierungen von ein und demselben wichtigen und ... hauptsächlichen Interesse, nämlich dem Interesse am Menschen, es sind die humanistischen Berufe, mit einem Wort, und wenn man sie studieren will, so lernt man als Grundlage vor allem einmal die alten Sprachen, nicht wahr, der formalen Bildung halber, wie man sagt. Sie wundern sich vielleicht, daß ich so davon rede, ich bin ja bloß Realist, Techniker. Aber ich habe noch neulich im Liegen darüber nachgedacht: es ist doch ausgezeichnet, eine ausgezeichnete Einrichtung in der Welt, daß man jeder Art von humanistischem Beruf das Formale, die Idee der Form, der schönen Form, wissen Sie, zugrunde legt, – das bringt so etwas Nobles und Überflüssiges in die Sache und außerdem so etwas von Gefühl und ... Höflichkeit, – das Interesse wird dadurch beinahe schon zu etwas wie einem galanten Anliegen ... Das heißt, ich drücke mich höchstwahrscheinlich unpassend aus, aber man sieht da, wie das Geistige und das Schöne sich vermischen und eigentlich immer schon eines waren, mit anderen Worten: die Wissenschaft und die Kunst, und daß also die künstlerische Beschäftigung unbedingt auch dazu gehört, als fünfte Fakultät gewissermaßen, daß sie auch gar nichts anderes ist, als ein humanistischer Beruf, eine Abschattierung des humanistischen Interesses, insofern ihr wichtigstes Thema oder Anliegen doch auch wieder der Mensch ist, das werden Sie mir zugeben. Ich habe ja bloß Schiffe und Wasser gemalt, wenn ich mich in meiner Jugend mal in dieser Richtung versuchte, aber das Anziehendste in der Malerei ist und bleibt in meinen Augen doch das Porträt, weil es unmittelbar den Menschen zum Gegenstand hat, darum fragte ich gleich, ob Herr Hofrat sich auch auf diesem Gebiet betätigten ... Würde es hier nun nicht doch ganz erheblich günstiger hängen?“
Beide, Behrens sowohl wie Joachim, sahen ihn an, ob er sich dessen nicht schäme, was er da aus dem Stegreif zusammengeredet. Aber Hans Castorp war viel zu sehr bei der Sache, um verlegen zu werden. Er hielt das Bild an die Sofawand und verlangte Antwort, ob es da nicht bedeutend besser belichtet sei. Gleichzeitig brachte das Dienstmädchen auf einem Brett heißes Wasser, einen Spirituskocher und Kaffeetäßchen. Der Hofrat wies sie ins Kabinett und sagte:
„Dann müßten Sie sich aber eigentlich nicht so sehr für Malerei interessieren, als in erster Linie für Skulptur ... Doch, da hat es natürlich mehr Licht. Wenn Sie meinen, daß es soviel davon verträgt ... Für Plastik, meine ich, weil die es doch am reinsten und ausschließlichsten mit dem Menschen im allgemeinen zu tun hat. Daß uns aber das Wasser nicht wegkocht.“
„Sehr wahr, die Plastik“, sagte Hans Castorp, während sie hinübergingen, und vergaß, das Bild wieder aufzuhängen oder abzustellen: er nahm es mit, trug es bei Fuß ins anstoßende Zimmer. „Sicher, so eine griechische Venus oder so ein Athlet, da zeigt sich das Humanistische zweifellos am deutlichsten, es ist wohl im Grunde das Wahre, die eigentlich humanistische Art von Kunst, wenn man es sich überlegt.“
„Na, was die kleine Chauchat betrifft,“ bemerkte der Hofrat, „so ist das wohl jedenfalls mehr ein Gegenstand für die Malerei, ich glaube, Phidias oder der andere mit der mosaischen Namensendung, die hätten die Nase gerümpft über ihre Art von Physiognomie ... Was machen Sie denn, was schleppen Sie sich denn mit dem Schinken?“
„Danke, ich stelle es erst mal hier an mein Stuhlbein, da steht es ja für den Augenblick ganz gut. Die griechischen Plastiker kümmerten sich aber nicht viel um den Kopf, es kam ihnen auf den Körper an, das war vielleicht gerade das Humanistische ... Und die weibliche Plastik, das ist also Fett?“
„Das ist Fett!“ sagte endgültig der Hofrat, der einen Wandschrank aufgeschlossen und ihm das Zubehör zur Kaffeebereitung entnommen hatte, eine röhrenförmige türkische Mühle, den langgestielten Kochbecher, das Doppelgefäß für Zucker und gemahlenen Kaffee, alles aus Messing. „Palmitin, Stearin, Oleïn“, sagte er und schüttete Kaffeebohnen aus einer Blechbüchse in die Mühle, deren Kurbel er zu drehen begann. „Die Herren sehen, ich mache alles selbst, von Anfang an, es schmeckt noch mal so gut. – Was dachten Sie denn? Daß es Ambrosia wäre?“
„Nein, ich wußte es schon selber. Es ist nur merkwürdig, es so zu hören“, sagte Hans Castorp.
Sie saßen im Winkel zwischen Tür und Fenster, an einem Bambustaburett mit orientalisch ornamentierter Messingplatte, auf der das Kaffeegerät zwischen Rauchutensilien Platz gefunden hatte: Joachim neben Behrens auf der reichlich mit seidenen Kissen ausgestatteten Ottomane, Hans Castorp in einem Klubsessel auf Rollen, gegen den er Frau Chauchats Porträt gelehnt hatte. Ein bunter Teppich lag unter ihnen. Der Hofrat löffelte Kaffee und Zucker in den gestielten Becher, goß Wasser nach und ließ das Getränk über der Spiritusflamme aufkochen. Es schäumte braun in den Zwiebeltäßchen und erwies sich beim Nippen als ebenso stark wie süß.
„Ihre übrigens auch“, sagte Behrens. „Ihre Plastik, soweit davon die Rede sein kann, ist natürlich auch Fett, wenn auch nicht in dem Grade wie bei den Weibern. Bei unsereinem macht das Fett gewöhnlich bloß den zwanzigsten Teil vom Körpergewicht aus, bei den Weibern den sechzehnten. Ohne das Unterhautzellgewebe, da wären wir alle bloß Morcheln. Mit den Jahren schwindet es ja, und dann gibt es den bekannten unästhetischen Faltenwurf. Am dicksten und fettesten ist es an der weiblichen Brust und am Bauch, an den Oberschenkeln, kurz, überall, wo ein bißchen was los ist für Herz und Hand. Auch an den Fußsohlen ist es fett und kitzlich.“
Hans Castorp drehte die röhrenförmige Kaffeemühle zwischen den Händen. Sie war, wie die ganze Garnitur, wohl eher indischer oder persischer, als türkischer Herkunft: der Stil der in das Messing gearbeiteten Gravierungen, deren Flächen blank aus dem matt gehaltenen Grunde traten, deutete darauf hin. Hans Castorp betrachtete die Ornamentik, ohne gleich klug daraus werden zu können. Als er klug daraus geworden war, errötete er unversehens.
„Ja, das ist so ein Gerät für alleinstehende Herren“, sagte Behrens. „Darum halte ich es unter Verschluß, wissen Sie. Meine Küchenfee könnte sich die Augen daran verderben. Sie werden ja wohl weiter keinen Schaden davontragen. Ich habe es mal von einer Patientin geschenkt bekommen, einer ägyptischen Prinzessin, die uns ein Jährchen die Ehre schenkte. Sie sehen, das Muster wiederholt sich an jedem Stück. Ulkig, was?“
„Ja, das ist merkwürdig“, erwiderte Hans Castorp. „Ha nein, mir macht es natürlich nichts. Man kann es ja sogar ernst und feierlich nehmen, wenn man will, – obgleich es dann am Ende auf einer Kaffeegarnitur nicht ganz am Platz ist. Die Alten sollen ja so etwas gelegentlich auf ihren Särgen angebracht haben. Das Obszöne und das Heilige war ihnen gewissermaßen ein und dasselbe.“
„Na, was die Prinzessin betrifft,“ sagte Behrens, „die war nun, glaub ich, mehr für das erstere. Sehr schöne Zigaretten habe ich übrigens auch noch von ihr, das ist was Extrafeines, wird nur bei erstklassigen Gelegenheiten aufgefahren.“ Und er holte die grellbunte Schachtel aus dem Wandschrank, um sie anzubieten. Joachim enthielt sich, indem er die Absätze zusammenzog. Hans Castorp griff zu und rauchte die ungewöhnlich große und breite, mit einer Sphinx in Golddruck geschmückte Zigarette an, die in der Tat wundervoll war.
„Erzählen Sie uns doch noch etwas von der Haut,“ bat er, „wenn Sie so freundlich sein wollen, Herr Hofrat!“ Er hatte Frau Chauchats Porträt wieder an sich genommen, hatte es auf sein Knie gestellt und betrachtete es, in den Stuhl zurückgelehnt, die Zigarette zwischen den Lippen. „Nicht gerade von der Fetthaut, das wissen wir ja nun, was es damit auf sich hat. Aber von der menschlichen Haut im allgemeinen, die Sie so gut zu malen verstehn.“
„Von der Haut? Interessieren Sie sich für Physiologie?“
„Sehr! Ja, dafür habe ich mich schon immer im höchsten Grade interessiert. Der menschliche Körper, für den habe ich immer hervorragend viel Sinn gehabt. Manchmal habe ich mich schon gefragt, ob ich nicht Arzt hätte werden sollen, – in gewisser Weise hätte das, glaube ich, nicht schlecht für mich gepaßt. Denn wer sich für den Körper interessiert, der interessiert sich ja auch für die Krankheit, – namentlich sogar für die, – tut er das nicht? Übrigens hat es nicht viel zu sagen, ich hätte Verschiedenes werden können. Ich hätte zum Beispiel auch Geistlicher werden können.“
„Ja, vorübergehend ist es mir schon manchmal so vorgekommen, als ob ich dabei eigentlich ganz in meinem Element gewesen wäre.“
„Warum sind Sie denn Ingenieur geworden?“
„Aus Zufall. Das waren wohl mehr oder weniger die äußeren Umstände, die darin den Ausschlag gaben.“
„Na, von der Haut? Was soll ich Ihnen denn von Ihrem Sinnesblatt erzählen. Das ist Ihr Außenhirn, verstehen Sie, – ontogenetisch ganz desselben Ursprungs wie der Apparat für die sogenannten höheren Sinnesorgane da oben in Ihrem Schädel: das zentrale Nervensystem, müssen Sie wissen, ist bloß eine leichte Umbildung der äußeren Hautschicht, und bei den niederen Tieren, da gibts den Unterschied zwischen zentral und peripher überhaupt noch nicht, die riechen und schmecken mit der Haut, müssen Sie sich vorstellen, die haben überhaupt bloß Hautsinnlichkeit, – muß ganz behaglich sein, wenn man sich so hineinversetzt. Dagegen bei so hoch differenzierten Lebewesen, wie Sie und ich, da beschränkt sich der Ehrgeiz der Haut auf die Kitzlichkeit, da ist sie bloß noch Schutz- und Meldeorgan, aber höllisch auf dem Posten gegen alles, was dem Körper zu nahe treten will, – sie streckt ja sogar noch Tastapparate über sich hinaus, die Haare nämlich, die Körperhärchen, die bloß aus verhornten Hautzellen bestehen und eine Annäherung schon spüren lassen, bevor die Haut selbst noch berührt ist. Unter uns gesagt, es ist sogar möglich, daß sich der Schutz- und Abwehrberuf der Haut nicht bloß aufs Körperliche erstreckt ... Wissen Sie, wie Sie rot und blaß werden?“
„Ungenau.“
„Ja, ganz genau wissen wir es, offen gestanden, auch nicht, wenigstens was das Schamrotwerden betrifft. Die Sache ist nicht ganz aufgehellt, denn erweiternde Muskeln, die durch die vasomotorischen Nerven in Bewegung gesetzt werden könnten, haben sich bis dato an den Gefäßen nicht nachweisen lassen. Wieso dem Hahn eigentlich der Kamm schwillt – oder was sich sonst für renommistische Beispiele anführen ließen –, das ist sozusagen mysteriös, besonders da es sich um psychische Einwirkung handelt. Wir nehmen an, daß Verbindungen zwischen der Großhirnrinde und dem Gefäßzentrum im Kopfmark bestehen. Und bei gewissen Reizen also, zum Exempel: Sie schämen sich mächtig, da spielt diese Verbindung, und die Gefäßnerven nach dem Gesichte spielen, und dann dehnen und füllen die dortigen Blutgefäße sich, daß Sie einen Kopf kriegen wie ein Puter, ganz hochgeschwollen von Blut sind Sie da und können nicht aus den Augen sehen. Dagegen in anderen Fällen, Gott weiß, was Ihnen bevorsteht, was ganz gefährlich Schönes möglicherweise, – da ziehen die Blutgefäße der Haut sich zusammen, und die Haut wird blaß und kalt und fällt ein, und dann sehen Sie aus wie ’ne Leiche vor lauter Emotion, mit bleifarbenen Augenhöhlen und einer weißen, spitzen Nase. Aber das Herz läßt der Sympathikus ordentlich trommeln.“
„So kommt das also“, sagte Hans Castorp.
„So ungefähr. Das sind Reaktionen, wissen Sie. Da aber alle Reaktionen und Reflexe von Hause aus einen Zweck haben, so vermuten wir Physiologen beinah, daß auch diese Begleiterscheinungen psychischer Affekte eigentlich zweckmäßige Schutzmittel sind, Abwehrreflexe des Körpers, wie die Gänsehaut. Wissen Sie, wie Sie eine Gänsehaut kriegen?“
„Das ist nämlich eine Veranstaltung der Hauttalgdrüsen, die die Hautschmiere absondern, so ein eiweißhaltiges, fettiges Sekret, wissen Sie, nicht gerade appetitlich, aber es hält die Haut geschmeidig, damit sie vor Dürre nicht reißt und springt und angenehm anzufassen ist, – es ist ja nicht auszudenken, wie die menschliche Haut anzufassen wäre ohne die Cholesterinschmiere. Diese Hautsalbendrüsen haben kleine organische Muskeln, die die Drüsen aufrichten können, und wenn sie das tun, dann wird Ihnen wie dem Jungen, dem die Prinzessin den Eimer mit den Gründlingen über den Leib goß, wie ein Reibeisen wird Ihre Haut, und wenn der Reiz stark ist, so richten auch die Haarbälge sich auf, – die Haare sträuben sich Ihnen auf dem Kopf und die Härchen am Leibe, wie einem Stachelschwein, das sich wehrt, und Sie können sagen, Sie haben das Gruseln gelernt.“
„Oh, ich“, sagte Hans Castorp, „ich habe das schon manchmal gelernt. Mir gruselt es sogar ziemlich leicht, bei den verschiedensten Gelegenheiten. Was mich wundert, ist nur, daß die Drüsen bei so verschiedenen Gelegenheiten sich aufrichten. Wenn einer mit einem Griffel über Glas fährt, so kriegt man eine Gänsehaut, und bei besonders schöner Musik kriegt man auch plötzlich eine, und als ich bei meiner Konfirmation das Abendmahl nahm, da kriegte ich eine über die andere, das Graupeln und Prickeln wollte gar nicht mehr aufhören. Es ist doch sonderbar, wodurch nicht alles die kleinen Muskeln in Bewegung gesetzt werden.“
„Ja,“ sagte Behrens, „Reiz ist Reiz. Der Inhalt des Reizes kümmert den Körper den Teufel was. Ob Gründlinge oder Abendmahl, die Talgdrüsen richten sich eben auf.“
„Herr Hofrat,“ sagte Hans Castorp und betrachtete das Bild auf seinen Knien; „worauf ich noch zurückkommen wollte. Sie sprachen vorhin von inneren Vorgängen, Lymphbewegung und dergleichen ... Was ist es damit? Ich würde gern mehr davon hören, von der Lymphbewegung zum Beispiel, wenn Sie die Liebenswürdigkeit hätten, es interessiert mich sehr.“
„Das will ich glauben“, erwiderte Behrens. „Die Lymphe, das ist das Allerfeinste, Intimste und Zarteste in dem ganzen Körperbetrieb, – es schwebt Ihnen wohl vermutungsweise so vor, wenn Sie fragen. Man spricht immer vom Blut und seinen Mysterien und nennt es einen besonderen Saft. Aber die Lymphe, die ist ja erst der Saft des Saftes, die Essenz, wissen Sie, Blutmilch, eine ganz deliziöse Tropfbarkeit, – nach Fettnahrung sieht sie übrigens wirklich wie Milch aus.“ Und aufgeräumt und redensartlich begann er zu schildern, wie das Blut, diese theatermantelrote, durch Atmung und Verdauung bereitete, mit Gasen gesättigte, mit Mauserschlacke beladene Fett-, Eiweiß-, Eisen-, Zucker- und Salzbrühe, die achtunddreißig Grad heiß von der Herzpumpe durch die Gefäße gedrückt werde und überall im Körper den Stoffwechsel, die tierische Wärme, mit einem Worte das liebe Leben in Gang halte, – wie also das Blut nicht unmittelbar an die Zellen herankomme, sondern wie der Druck, unter dem es stehe, einen Extrakt und Milchsaft davon durch die Gefäßwände schwitzen lasse und ihn in die Gewebe presse, so daß er überall hindringe, als Gewebsflüssigkeit jedes Spältchen fülle und das elastische Zellgewebe dehne und spanne. Das sei die Gewebsspannung, der Turgor, und wieder der Turgor seinerseits mache, daß die Lymphe, wenn sie die Zellen lieblich bespült und Stoff mit ihnen getauscht habe, in die Lymphgefäße getrieben werde, die vasa lymphatica, und zurück in das Blut fließe, es seien täglich anderthalb Liter. Er beschrieb das Röhren- und Saugadersystem der Lymphgefäße, redete von dem Brustmilchgang, der die Lymphe der Beine, des Bauches und der Brust, eines Armes und einer Kopfseite sammle, von zarten Filterorganen sodann, welche vielerorts in den Lymphgefäßen ausgebildet seien, Lymphdrüsen genannt und gelegen am Halse, in der Achselhöhle, den Ellbogengelenken, der Kniekehle und an ähnlich intimen und zärtlichen Körperstellen. „Da können nun Schwellungen vorkommen,“ erklärte Behrens, „und davon gingen wir ja wohl aus, – Verdickungen der Lymphdrüsen, sagen wir mal: in den Kniekehlen und den Armgelenken, wassersuchtähnliche Geschwülste da und dort, und das hat immer einen Grund, wenn auch nicht gerade einen schönen. Unter Umständen wird einem der Verdacht der tuberkulösen Lymphgefäßverstopfung näher als nahgelegt.“
Hans Castorp schwieg. „Ja,“ sagte er leise nach einer Pause, „es ist so, ich hätte gut Arzt werden können. Der Brustmilchgang ... Die Lymphe der Beine ... Das interessiert mich sehr. – Was ist der Körper!“ rief er auf einmal stürmisch ausbrechend. „Was ist das Fleisch! Was ist der Leib des Menschen! Woraus besteht er! Sagen Sie uns das heute nachmittag, Herr Hofrat! Sagen Sie es uns ein für allemal und genau, damit wir es wissen!“
„Aus Wasser“, antwortete Behrens. „Für organische Chemie interessieren Sie sich also auch? Das ist allergrößtenteils Wasser, woraus der humanistische Menschenleib besteht, nichts Besseres und nichts Schlechteres, es ist keine Ursache, heftig zu werden. Die Trockensubstanz beträgt bloß fünfundzwanzig Prozent, und davon sind zwanzig Prozent gewöhnliches Hühnereiweiß, Proteinstoffe, wenn Sie es ein bißchen nobler ausdrücken wollen, denen eigentlich nur noch ein bißchen Fett und Salz zugesetzt ist, das ist so gut wie alles.“
„Aber das Hühnereiweiß. Was ist das?“
„Allerlei Elementares. Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel. Manchmal auch Phosphor. Sie entwickeln ja eine ausschweifende Wißbegier. Manche Eiweiße sind auch mit Kohlehydraten verbunden, das heißt mit Traubenzucker und Stärke. Im Alter wird das Fleisch zäh, das kommt, weil das Kollagen im Bindegewebe zunimmt, der Leim, wissen Sie, wichtigster Bestandteil der Knochen und Knorpel. Was soll ich Ihnen denn noch erzählen? Da haben wir im Muskelplasma ein Eiweiß, das Myosinogen, das im Tode zu Muskelfibrin gerinnt und die Totenstarre erzeugt.“
„Ja so, die Totenstarre“, sagte Hans Castorp munter. „Sehr gut, sehr gut. Und dann kommt die Generalanalyse, die Anatomie des Grabes.“
„Na, selbstredend. Das haben Sie übrigens schön gesagt. Dann wird die Sache weitläufig. Man fließt auseinander, sozusagen. Bedenken Sie all das Wasser! Und die anderen Ingredienzien sind ohne Leben ja wenig haltbar, sie werden durch die Fäulnis in simplere Verbindungen zerlegt, in anorganische.“
„Fäulnis, Verwesung,“ sagte Hans Castorp, „das ist doch Verbrennung, Verbindung mit Sauerstoff, soviel ich weiß.“
„Auffallend richtig. Oxydation.“
„Und Leben?“
„Auch. Auch, Jüngling. Auch Oxydation. Leben ist hauptsächlich auch bloß Sauerstoffbrand des Zelleneiweiß, da kommt die schöne tierische Wärme her, von der man manchmal zu viel hat. Tja, Leben ist Sterben, da gibt es nicht viel zu beschönigen, – une destruction organique, wie irgendein Franzos es in seiner angeborenen Leichtfertigkeit mal genannt hat. Es riecht auch danach, das Leben. Wenn es uns anders vorkommt, so ist unser Urteil bestochen.“
„Und wenn man sich für das Leben interessiert,“ sagte Hans Castorp, „so interessiert man sich namentlich für den Tod. Tut man das nicht?“
„Na, so eine Art von Unterschied bleibt da ja immerhin. Leben ist, daß im Wechsel der Materie die Form erhalten bleibt.“
„Wozu die Form erhalten“, sagte Hans Castorp.
„Wozu? Hören Sie mal, das ist aber kein bißchen humanistisch, was Sie da sagen.“
„Form ist ete-pe-tete.“
„Sie haben entschieden was Unternehmendes heute. Förmlich was Durchgängerisches. Aber ich falle nun ab“, sagte der Hofrat. „Ich werde nun melancholisch“, sagte er und legte seine riesige Hand über die Augen. „Sehen Sie, das kommt so über mich. Da habe ich nun Kaffee mit Ihnen getrunken, und es hat mir geschmeckt, und auf einmal kommt es über mich, daß ich melancholisch werde. Die Herren müssen mich nun schon entschuldigen. Es war mir was Besonderes und hat mir allen möglichen Spaß gemacht ...“
Die Vettern waren aufgesprungen. Sie machten sich Vorwürfe, sagten sie, den Herrn Hofrat so lange ... Er gab beruhigende Gegenversicherungen. Hans Castorp beeilte sich, Frau Chauchats Porträt ins Nebenzimmer zu tragen und wieder an seinen Platz zu hängen. Sie betraten den Garten nicht mehr, um in ihr Quartier zu gelangen. Behrens wies ihnen den Weg durch das Gebäude, indem er sie bis zur Verbindungsglastür geleitete. Sein Nacken schien stärker als sonst herauszutreten in dem Gemütszustand, der plötzlich über ihn gekommen war, er blinzelte mit seinen Quellaugen, und sein infolge der einseitigen Lippenschürzung schiefes Schnurrbärtchen hatte einen kläglichen Ausdruck gewonnen.
Während sie über Korridore und Treppen gingen, sagte Hans Castorp:
„Gib zu, daß das eine gute Idee von mir war.“
„Jedenfalls war es eine Abwechslung“, erwiderte Joachim. „Und ausgesprochen habt ihr euch ja über mancherlei Dinge bei dieser Gelegenheit, das muß man sagen. Mir ging es sogar ein bißchen zu sehr drüber und drunter. Es ist nun hohe Zeit, daß wir vorm Tee doch wenigstens noch auf zwanzig Minuten in den Liegedienst kommen. Du findest es vielleicht ete-pe-tete von mir, daß ich so darauf halte, – durchgängerisch, wie du neuerdings bist. Aber du hast es ja schließlich auch nicht so nötig wie ich.“
So kam, was kommen mußte, und was hier zu erleben Hans Castorp noch vor kurzem sich nicht hätte träumen lassen: der Winter fiel ein, der hiesige Winter, den Joachim schon kannte, da der vorige noch in voller Herrschaft gewesen, als er hier eingetroffen war, vor dem aber Hans Castorp sich etwas fürchtete, obgleich er sich ja bestens dafür gerüstet wußte. Sein Vetter suchte ihn zu beruhigen.
„Du mußt es dir nicht allzu grimmig vorstellen,“ sagte er, „nicht gerade arktisch. Man spürt die Kälte wenig wegen der Lufttrockenheit und der Windstille. Wenn man sich gut verpackt, kann man bis tief in die Nacht auf dem Balkon bleiben, ohne zu frieren. Es ist die Geschichte mit der Temperaturumkehr oberhalb der Nebelgrenze, es wird wärmer in höheren Lagen, man hat das früher nicht so gewußt. Eher ist es schon kalt, wenn es regnet. Aber du hast ja nun deinen Liegesack, und geheizt wird auch ein bißchen, wenn Not an den Mann kommt.“
Übrigens konnte von Überrumpelung und Gewalttätigkeit nicht die Rede sein, der Winter kam gelinde, er sah vorderhand nicht sehr anders aus, als mancher Tag, den auch der Hochsommer schon mit sich geführt hatte. Ein paar Tage lang hatte Südwind geweht, die Sonne drückte, das Tal schien verkürzt und verengt, nahe und nüchtern lagen die Alpenkulissen des Ausgangs. Dann zogen Wolken auf, drangen vom Piz Michel und Tinzenhorn gegen Nordosten vor, und das Tal verdunkelte sich. Dann regnete es schwer. Dann wurde der Regen unrein, weißlichgrau, Schnee hatte sich dareingemischt, es war schließlich nur noch Schnee, das Tal war angefüllt mit Gestöber, und da das reichlich lange so ging, auch die Temperatur unterdessen beträchtlich gefallen war, so konnte der Schnee nicht ganz wegschmelzen, er war naß, aber er blieb liegen, das Tal lag in dünnem, feuchtem, schadhaftem weißen Gewand, gegen welches das Nadelrauh der Lehnen schwarz abstach; im Speisesaal erwärmten die Röhren sich laulich. Das war Anfang November, um Allerseelen, und es war nicht neu. Auch im August war es schon so gewesen, und längst hatte man sich entwöhnt, den Schnee als ein Vorrecht des Winters zu betrachten. Stets und bei jeder Witterung, wenn auch nur von ferne, hatte man welchen vor Augen gehabt, denn immer schimmerten Reste und Spuren davon in den Spalten und Schründen der felsigen Rätikonkette, die dem Taleingang vorzuliegen schien, und immer hatten die fernsten Bergmajestäten des Südens im Schnee herübergegrüßt. Aber beides hielt an, der Schneefall und der Wärmerückgang. Der Himmel hing blaßgrau und niedrig über dem Tal, löste sich in Flocken hin, die lautlos und unaufhörlich fielen, in übertriebener und leicht beunruhigender Ausgiebigkeit, und stündlich wurde es kälter. Es kam der Morgen, da Hans Castorp in seinem Zimmer sieben Grad hatte, und am folgenden waren es nur noch fünf. Das war der Frost, und er hielt sich in Grenzen, aber er hielt sich. Es hatte bei Nacht gefroren, nun fror es auch am Tage, und zwar von morgens bis abends, wobei es weiterschneite, mit kurzen Unterbrechungen den vierten und fünften, den siebenten Tag. Der Schnee sammelte sich nun mächtig an, nachgerade wurde er zur Verlegenheit. Man hatte auf dem Dienstwege zur Bank am Wasserlauf, sowie auf dem Fahrweg hinab ins Tal, Gehbahnen geschaufelt; aber sie waren schmal, es gab kein Ausweichen darauf, bei Begegnungen mußte man in den Schneedamm zur Seite treten und versank bis zum Knie. Eine Schneewalze aus Stein, von einem Pferde gezogen, das ein Mann am Halfter führte, rollte den ganzen Tag über die Straßen des Kurortes drunten, und eine Schlittentram, gelb und von altfränkisch postkutschenhafter Gestalt, mit einem Schneepfluge vorn, der die weißen Massen schaufelnd beiseite warf, verkehrte zwischen dem Kurhausviertel und dem „Dorf“ genannten nördlichen Teil der Siedelung. Die Welt, die enge, hohe und abgeschiedene Welt Derer hier oben, erschien nun dick bepelzt und gepolstert, es war kein Pfeiler und Pfahl, der nicht eine weiße Haube trug, die Treppenstufen zum Berghofportal verschwanden, verwandelten sich in eine schiefe Ebene, schwere, humoristisch geformte Kissen lasteten überall auf den Zweigen der Kiefern, da und dort rutschte die Masse ab, zerstäubte und zog als Wolke und weißer Nebel zwischen den Stämmen dahin. Verschneit lag rings das Gebirge, rauh in den unteren Bezirken, weich zugedeckt die über die Baumgrenze hinausragenden, verschieden gestalteten Gipfel. Es war dunkel, die Sonne stand nur als ein bleicher Schein hinter dem Geschleier. Aber der Schnee gab ein indirektes und mildes Licht, eine milchige Helligkeit, die Welt und Menschen gut kleidete, wenn auch die Nasen unter den weißen oder farbigen Wollmützen rot waren.
Im Speisesaal, an den sieben Tischen, beherrschte der Anbruch des Winters, der großen Jahreszeit dieser Gegenden, das Gespräch. Viele Touristen und Sportsleute, hieß es, seien eingetroffen und bevölkerten die Hotels von „Dorf“ und „Platz“. Man schätzte die Höhe des geworfenen Schnees auf sechzig Zentimeter, und seine Beschaffenheit sei ideal im Sinne des Skiläufers. An der Bobbahn, die drüben am nordwestlichen Hange von der Schatzalp zu Tal führte, werde eifrig gearbeitet, schon in den nächsten Tagen könne sie eröffnet werden, vorausgesetzt, daß nicht der Föhn einen Strich durch die Rechnung mache. Man freute sich auf das Treiben der Gesunden, der Gäste von unten, das nun sich hier wieder entwickeln werde, auf die Sportsfeste und Rennen, denen man auch gegen Verbot beizuwohnen gedachte, indem man die Liegekur schwänzte und entwischte. Es gab etwas Neues, hörte Hans Castorp, eine Erfindung aus Norden, das Skikjöring, ein Rennen, wobei sich die Teilnehmer auf Skiern stehend von Pferden ziehen lassen würden. Dazu wollte man entwischen. – Auch von Weihnachten war die Rede.
Von Weihnachten! Nein, daran hatte Hans Castorp noch nicht gedacht. Er hatte leicht sagen und schreiben können, daß er kraft ärztlichen Befundes mit Joachim den Winter hier werde zubringen müssen. Aber das schloß ein, wie sich nun zeigte, daß er hier Weihnachten verleben sollte, und das hatte ohne Zweifel etwas Erschreckendes für das Gemüt, schon deshalb, aber nicht ganz allein deshalb, weil er diese Zeit überhaupt noch niemals anderswo als in der Heimat, im Schoß der Familie, verlebt hatte. In Gottes Namen denn, das wollte nun in den Kauf genommen sein. Er war kein Kind mehr, Joachim schien auch weiter keinen Anstoß daran zu nehmen, sondern sich ohne Weinerlichkeit damit abzufinden, und wo nicht überall und unter welchen Umständen war in der Welt schon Weihnachten begangen worden!
Bei alldem schien es ihm etwas übereilt, vor dem ersten Advent von Weihnachten zu reden; es waren ja noch reichlich sechs Wochen bis dahin. Diese aber übersprang und verschlang man im Speisesaal, – ein inneres Verfahren, auf das Hans Castorp ja schon auf eigene Hand sich verstehen gelernt hatte, wenn er es auch noch nicht in so kühnem Stile zu üben gewöhnt war wie die älter eingesessenen Lebensgenossen. Solche Etappen im Jahreslauf, wie das Weihnachtsfest, schienen ihnen eben recht als Anhaltspunkte und Turngeräte, woran sich über leere Zwischenzeiten behende hinwegvoltigieren ließ. Sie hatten alle Fieber, ihr Stoffumsatz war erhöht, ihr Körperleben verstärkt und beschleunigt, – es mochte am Ende wohl damit zusammenhängen, daß sie die Zeit so rasch und massenhaft durchtrieben. Er hätte sich nicht gewundert, wenn sie Weihnachten schon als zurückgelegt betrachtet und gleich von Neujahr und Fastnacht gesprochen hätten. Aber so leichtlebig und ungesetzt war man mitnichten im Berghofspeisesaal. Bei Weihnachten machte man halt, es gab Anlaß zu Sorgen und Kopfzerbrechen. Man beriet über das gemeinsame Geschenk, das nach bestehender Anstaltsübung dem Chef, Hofrat Behrens, am heiligen Abend überreicht werden sollte, und für das eine allgemeine Sammlung eingeleitet war. Voriges Jahr hatte man einen Reisekoffer geschenkt, wie diejenigen überlieferten, die seit mehr als Jahresfrist hier waren. Man sprach für diesmal von einem neuen Operationstisch, einer Malstaffelei, einem Gehpelz, einem Schaukelstuhl, einem elfenbeinernen und irgendwie „eingelegten“ Hörrohr, und Settembrini empfahl auf Befragen die Schenkung eines angeblich im Entstehen begriffenen lexikographischen Werkes, genannt „Soziologie der Leiden“; doch fiel ihm einzig ein Buchhändler bei, der seit kurzem am Tische der Kleefeld saß. Einigung hatte sich noch nicht ergeben wollen. Die Verständigung mit den russischen Gästen bot Schwierigkeiten. Die Sammlung spaltete sich. Die Moskowiter erklärten, Behrens auf eigene Hand beschenken zu wollen. Frau Stöhr zeigte sich tagelang in größter Unruhe wegen eines Geldbetrages, zehn Franken, die sie bei der Sammlung leichtsinnigerweise für Frau Iltis ausgelegt hatte, und die diese ihr zurückzuerstatten „vergaß“. Sie „vergaß“ es, – die Betonungen, mit denen Frau Stöhr dies Wort versah, waren vielfach abgestuft und sämtlich darauf berechnet, den tiefsten Unglauben an eine Vergeßlichkeit zu bekunden, die allen Anspielungen und feinen Gedächtnisstachelungen, an denen es Frau Stöhr, wie sie versicherte, nicht fehlen ließ, Trotz bieten zu wollen schien. Mehrfach verzichtete Frau Stöhr und erklärte, der Iltis die schuldige Summe zu schenken. „Ich zahle also für mich und für sie,“ sagte sie; „gut, nicht mein ist die Schande!“ Endlich aber war sie auf einen Ausweg verfallen, von dem sie der Tischgesellschaft zu allgemeiner Heiterkeit Mitteilung machte: sie hatte sich die zehn Franken auf der „Verwaltung“ auszahlen und der Iltis in Rechnung stellen lassen, – womit die träge Schuldnerin denn überlistet und wenigstens diese Sache ins gleiche gebracht war.
Es hatte zu schneien aufgehört. Teilweise öffnete der Himmel sich; graublaue Wolken, die sich geschieden, ließen Sonnenblicke einfallen, die die Landschaft bläulich färbten. Dann wurde es völlig heiter. Klarer Frost herrschte, reine, gesicherte Winterspracht um Mitte November, und das Panorama hinter den Bogen der Balkonloge, die bepuderten Wälder, die weichgefüllten Schlüfte, das weiße, sonnige Tal unter dem blaustrahlenden Himmel war herrlich. Abends gar, wenn der fast gerundete Mond erschien, verzauberte sich die Welt und ward wunderbar. Kristallisches Geflimmer, diamantnes Glitzern herrschte weit und breit. Sehr weiß und schwarz standen die Wälder. Die dem Monde fernen Himmelsgegenden lagen dunkel, mit Sternen bestickt. Scharfe, genaue und intensive Schatten, die wirklicher und bedeutender schienen als die Dinge selbst, fielen von den Häusern, den Bäumen, den Telegraphenstangen auf die blitzende Fläche. Es hatte sieben oder acht Grad Frost ein paar Stunden nach Sonnenuntergang. In eisige Reinheit schien die Welt gebannt, ihre natürliche Unsauberkeit zugedeckt und erstarrt im Traum eines phantastischen Todeszaubers.
Hans Castorp hielt sich bis spät in die Nacht in seiner Balkonloge über dem verwunschenen Wintertal, weit länger als Joachim, der sich um zehn, oder doch nicht viel später, zurückzog. Sein vorzüglicher Liegestuhl mit dem dreiteiligen Polster und der Nackenrolle war nahe an das Holzgeländer gerückt, auf dem ein Kissen von Schnee sich hinzog; auf dem weißen Tischchen daneben brannte die elektrische Lampe und stand neben einem Stapel Bücher ein Glas fetter Milch, die Abendmilch, die allen Bewohnern des „Berghofs“ noch um neun Uhr aufs Zimmer gebracht wurde, und in die Hans Castorp sich einen Schuß Kognak goß, um sie sich mundgerechter zu machen. Schon hatte er alle verfügbaren Schutzmittel gegen die Kälte aufgeboten, den ganzen Apparat. Bis über die Brust stak er in dem knöpfbaren Pelzsack, den er in einem einschlägigen Geschäft des Kurorts rechtzeitig erstanden, und hatte um diesen die beiden Kamelhaardecken nach dem Ritus geschlagen. Dazu trug er über dem Winteranzug seine kurze Pelzjacke, auf dem Kopf eine wollene Mütze, Filzstiefel an den Füßen und an den Händen dickgefütterte Handschuhe, die aber freilich das Erstarren der Finger nicht hindern konnten.
Was ihn so lange draußen hielt, bis gegen und über Mitternacht (wenn das schlechte Russenpaar die Nachbarloge längst verlassen hatte), war wohl auch der Zauber der Winternacht, zumal sich bis elf Uhr Musik darein wob, die von näher und ferner her aus dem Tale heraufdrang, – hauptsächlich aber Trägheit und Angeregtheit, beides zugleich und im Verein: nämlich die Trägheit und bewegungsfeindliche Müdigkeit seines Körpers und die beschäftigte Angeregtheit seines Geistes, der über gewissen neuen und fesselnden Studien, auf die der junge Mann sich eingelassen, nicht zur Ruhe kommen wollte. Die Witterung setzte ihm zu, der Frost wirkte anstrengend und konsumierend auf seinen Organismus. Er aß viel, nutzte die gewaltigen Berghofmahlzeiten, bei denen auf garniertes Roastbeef gebratene Gänse folgten, mit jenem übergewöhnlichen Appetit, der hier durchaus und im Winter, wie sich zeigte, noch mehr als im Sommer, an der Tagesordnung war. Gleichzeitig beherrschte ihn Schlafsucht, so daß er bei Tage wie an den mondlichten Abenden über den Büchern, die er wälzte, und die wir kennzeichnen werden, oftmals einschlief, um nach einigen Minuten der Bewußtlosigkeit seine Forschungen fortzusetzen. Lebhaftes Sprechen – und er neigte hier mehr als ehemals im Tiefland zu schnellem, rückhaltlosem und selbst gewagtem Plaudern – lebhaftes Sprechen also mit Joachim während ihrer Dienstgänge im Schnee erschöpfte ihn sehr; Schwindel und Zittern, ein Gefühl von Betäubung und Trunkenheit kam ihn an, und sein Kopf stand in Hitze. Seine Kurve war angestiegen seit Einfall des Winters, und Hofrat Behrens hatte etwas von Injektionen fallen lassen, die er bei hartnäckiger Übertemperatur anzuwenden pflegte, und denen zwei Drittel der Gäste, auch Joachim, sich regelmäßig zu unterziehen hatten. Mit der gesteigerten Wärmeerzeugung seines Körpers aber, dachte Hans Castorp, hatte gewiß die geistige Erregung und Rührigkeit zu tun, die ihn an ihrem Teil bis tief in die glitzernde Frostnacht auf seinem Liegestuhl festhielt. Die Lektüre, die ihn fesselte, legte ihm solche Erklärungen nah.
Es wurde nicht wenig gelesen auf den Liegehallen und Privatbalkons des internationalen Sanatoriums „Berghof“, – namentlich von Anfängern und Kurzfristigen; denn die Vielmonatigen oder gar Mehrjährigen hatten längst gelernt, auch ohne Zerstreuung und Beschäftigung des Kopfes die Zeit zu vernichten und kraft inneren Virtuosentums hinter sich zu bringen, ja, sie erklärten es für das Ungeschick von Stümpern, sich dabei an ein Buch zu klammern. Allenfalls möge man eines auf dem Schoß oder dem Beitischchen liegen haben, das genüge vollauf, sich versorgt zu fühlen. Die Anstaltsbücherei, polyglott und an Bilderwerken reich, der erweiterte Unterhaltungsbestand eines zahnärztlichen Wartezimmers, bot sich der freien Benutzung an. Romanbände aus der Leihbibliothek von „Platz“ wurden ausgetauscht. Dann und wann trat ein Buch, eine Schrift auf, um die man sich riß, nach der auch die nicht mehr Lesenden mit nur erheucheltem Phlegma die Hände streckten. Zu dem Zeitpunkt, wo wir halten, ging ein schlecht gedrucktes Heft von Hand zu Hand, das Herr Albin eingeführt hatte und das „Die Kunst, zu verführen“ betitelt war. Es war sehr wörtlich aus dem Französischen übersetzt, ja selbst die Syntax dieser Sprache war in der Übertragung beibehalten, wodurch der Vortrag viel Haltung und prickelnde Eleganz gewann, und entwickelte die Philosophie der Leibesliebe und Wollust im Geist eines weltmännisch-lebensfreundlichen Heidentums. Frau Stöhr hatte es bald gelesen und fand es „berauschend“. Frau Magnus, dieselbe, die Eiweiß verlor, pflichtete ihr rückhaltlos bei. Ihr Gatte, der Bierbrauer, wollte für seine Person bei der Lektüre manches profitiert haben, bedauerte aber, daß Frau Magnus die Schrift in sich aufgenommen, denn dergleichen „verhätschele“ die Frauen und bringe ihnen unbescheidene Begriffe bei. Diese Äußerung verstärkte die Begierde nach dem Buchwerk nicht wenig. Zwischen zwei im Oktober zugereisten Damen der unteren Liegehalle, Frau Redisch, der Gattin eines polnischen Industriellen und einer gewissen Witwe Hessenfeld aus Berlin, von denen jede behauptete, sie habe sich vor der anderen zur Lektüre gemeldet, kam es nach dem Diner zu einer mehr als unerquicklichen, eigentlich gewalttätigen Szene, der Hans Castorp in seiner Balkonloge zuzuhören hatte, und die mit einem hysterischen Schreikrampf einer der beiden Damen – es konnte die Redisch, konnte aber auch die Hessenfeld sein – und der Verbringung der Wuterkrankten auf ihr Zimmer endigte. Die Jugend hatte sich des Traktates früher bemächtigt als die reiferen Jahrgänge. Sie studierte es teilweise gemeinsam nach dem Souper auf verschiedenen Zimmern. Hans Castorp sah, wie der Junge mit dem Fingernagel es im Speisesaal einer jungen, frisch eingetroffenen Leichtkranken, Fränzchen Oberdank, einhändigte, einem blond gescheitelten Haustöchterchen, das erst kürzlich von seiner Mutter heraufgebracht worden war.
Vielleicht gab es Ausnahmen, vielleicht solche, die die Stunden des Liegedienstes mit irgendeiner ernsten geistigen Beschäftigung, einem irgendwie förderlichen Studium erfüllten, sei es auch nur, um dadurch eine Verbindung mit dem Leben der Ebene zu bewahren oder der Zeit ein wenig Schwere und Tiefgang, damit sie nicht reine Zeit und sonst überhaupt nichts sei, zu verleihen. Vielleicht war außer Herrn Settembrini, mit seinen Bestrebungen, die Leiden auszumerzen, und dem ehrliebenden Joachim mit seinen russischen Übungsbüchern, noch dieser und jener, der es so hielt, wenn nicht unter den Insassen des Speisesaals, was wirklich unwahrscheinlich war, so möglicherweise gerade unter den Bettlägrigen und Moribunden – Hans Castorp war geneigt, es zu glauben. Ihn selbst angehend, so hatte er sich seinerzeit, da Ocean steamships ihm nichts mehr zu sagen hatte, zusammen mit seinem Winterbedarf, auch einige in seinen Lebensberuf einschlagende Bücher, Ingenieur-Wissenschaftliches, Schiffsbautechnisches, von zuhause heraufkommen lassen. Diese Bände lagen aber vernachlässigt zugunsten anderer, einer ganz verschiedenen Sparte und Fakultät angehöriger Lehrwerke, zu deren Materie der junge Hans Castorp Lust gefaßt. Es waren solche der Anatomie, Physiologie und Lebenskunde, abgefaßt in verschiedenen Sprachen, auf deutsch, französisch und englisch, und sie wurden ihm eines Tages vom Buchhändler des Ortes heraufgeschickt, offenbar, weil er sie bestellt hatte, und zwar auf eigene Hand, stillschweigend, gelegentlich eines Spazierganges, den er ohne Joachim (da dieser gerade zur Injektion oder zum Wiegen bestellt gewesen) nach „Platz“ hinunter gemacht hatte. Joachim sah die Bücher mit Überraschung in seines Vetters Händen. Sie waren teuer gewesen, wie wissenschaftliche Werke sind; die Preise standen noch an den Innenseiten der Deckel und auf den Umschlägen vermerkt. Er fragte, warum Hans Castorp sie sich nicht, wenn er dergleichen schon lesen wolle, vom Hofrat geliehen habe, der diese Literatur doch sicher in guter Auswahl besitze. Aber Hans Castorp erwiderte, er wolle sie selber besitzen, es sei ein ganz anderes Lesen, wenn das Buch einem gehöre; auch liebe er es, mit dem Bleistift dareinzufahren und anzustreichen. Stundenlang hörte Joachim in seines Vetters Loge das Geräusch, mit dem das Papiermesser die Blätter broschierter Bogen trennt.
Die Bände waren schwer, unhandlich; Hans Castorp stützte sie im Liegen mit dem unteren Rande gegen die Brust, den Magen. Es drückte, aber er nahm das in Kauf; halboffenen Mundes ließ er seine Augen über die gelehrten Seiten hinuntersteigen, die fast unnötigerweise vom rötlichen Schein des beschirmten Lämpchens erhellt waren, da sie notfalls im starken Mondlicht lesbar gewesen wären, – folgte mit dem Kopf, bis sein Kinn auf der Brust lag, eine Haltung, worin der Lesende, bevor er das Gesicht zur nächsten Seite hob, wohl nachdenkend, schlummernd oder im Halbschlummer nachdenkend etwas verweilte. Er forschte tief, er las, während der Mond über das kristallisch glitzernde Hochgebirgstal seinen gemessenen Weg ging, von der organisierten Materie, den Eigenschaften des Protoplasmas, der zwischen Aufbau und Zersetzung in sonderbarer Seinsschwebe sich erhaltenden empfindlichen Substanz und ihrer Gestaltbildung aus anfänglichen, doch immer gegenwärtigen Grundformen, las mit dringlichem Anteil vom Leben und seinem heilig-unreinen Geheimnis.
Was war das Leben? Man wußte es nicht. Es war sich seiner bewußt, unzweifelhaft, sobald es Leben war, aber es wußte nicht, was es sei. Bewußtsein als Reizempfindlichkeit, unzweifelhaft, erwachte bis zu einem gewissen Grade schon auf den niedrigsten, ungebildetsten Stufen seines Vorkommens, es war unmöglich, das erste Auftreten bewußter Vorgänge an irgendeinen Punkt seiner allgemeinen oder individuellen Geschichte zu binden, Bewußtsein etwa durch das Vorhandensein eines Nervensystems zu bedingen. Die niedersten Tierformen hatten kein Nervensystem, geschweige daß sie ein Großhirn gehabt hätten, doch wagte es niemand, ihnen die Fähigkeit der Empfindung von Reizen abzusprechen. Auch konnte man das Leben betäuben, dieses selbst, nicht nur besondere Organe der Reizempfänglichkeit, die es etwa ausbildete, nicht nur die Nerven. Man konnte die Reizbarkeit jedes mit Leben begabten Stoffes im Pflanzen- wie im Tierreich vorübergehend aufheben, konnte Eier und Samenfäden mit Chloroform, Chloralhydrat oder Morphium narkotisieren. Bewußtsein seinerselbst war also schlechthin eine Funktion der zum Leben geordneten Materie, und bei höherer Verstärkung wandte die Funktion sich gegen ihren eigenen Träger, ward zum Trachten nach Ergründung und Erklärung des Phänomens, das sie zeitigte, einem hoffnungsvoll-hoffnungslosen Trachten des Lebens nach Selbsterkenntnis, einem Sich-in-sich-Wühlen der Natur, vergeblich am Ende, da Natur in Erkenntnis nicht aufgehen, Leben im Letzten sich nicht belauschen kann.
Was war das Leben? Niemand wußte es. Niemand kannte den natürlichen Punkt, an dem es entsprang und sich entzündete. Nichts war unvermittelt oder nur schlecht vermittelt im Bereiche des Lebens von jenem Punkte an; aber das Leben selbst erschien unvermittelt. Wenn sich etwas darüber aussagen ließ, so war es dies: es müsse von so hoch entwickelter Bauart sein, daß in der unbelebten Welt auch nicht entfernt seinesgleichen vorkomme. Zwischen der scheinfüßigen Amöbe und dem Wirbeltier war der Abstand geringfügig, unwesentlich, im Vergleiche mit dem zwischen der einfachsten Erscheinung des Lebens und jener Natur, die nicht einmal verdiente, tot genannt zu werden, weil sie unorganisch war. Denn der Tod war nur die logische Verneinung des Lebens; zwischen Leben und unbelebter Natur aber klaffte ein Abgrund, den die Forschung vergebens zu überbrücken strebte. Man mühte sich, ihn mit Theorien zu schließen, die er verschlang, ohne an Tiefe und Breite im geringsten dadurch einzubüßen. Man hatte sich, um ein Bindeglied zu finden, zu dem Widersinn der Annahme strukturloser Lebensmaterie, unorganisierter Organismen herbeigelassen, die in der Eiweißlösung von selbst zusammenschössen, wie der Kristall in der Mutterlauge, – während doch organische Differenziertheit zugleich Vorbedingung und Äußerung alles Lebens blieb, und während kein Lebewesen aufzuweisen war, das nicht einer Elternzeugung sein Dasein verdankt hätte. Das Ende des Jubels, mit dem man den Urschleim aus den äußersten Tiefen des Meeres gefischt hatte, war Beschämung gewesen. Es zeigte sich, daß man Gipsniederschläge für Protoplasma gehalten. Um aber nicht vor einem Wunder haltmachen zu müssen – denn das Leben, das aus denselben Stoffen sich aufbaute und in dieselben Stoffe zerfiel wie die unorganische Natur, wäre, unvermittelt, ein Wunder gewesen –, war man trotzdem genötigt, an Urzeugung, das hieß an die Entstehung des Organischen aus dem Unorganischen, zu glauben, die übrigens ebenfalls ein Wunder war. So fuhr man fort, Zwischenstufen und Übergänge zu ersinnen, das Dasein von Organismen anzunehmen, die niedriger standen, als alle bekannten, ihrerseits aber noch ursprünglichere Lebensversuche der Natur zu Vorläufern hatten, Probien, die niemand je sehen würde, da sie sich unter aller mikroskopischen Größe hielten, und vor deren gedachter Entstehung die Synthese von Eiweißverbindungen sich vollzogen haben mußte ...
Was war also das Leben? Es war Wärme, das Wärmeprodukt formerhaltender Bestandlosigkeit, ein Fieber der Materie, von welchem der Prozeß unaufhörlicher Zersetzung und Wiederherstellung unhaltbar verwickelt, unhaltbar kunstreich aufgebauter Eiweißmolekel begleitet war. Es war das Sein des eigentlich Nicht-sein-Könnenden, des nur in diesem verschränkten und fiebrigen Prozeß von Zerfall und Erneuerung mit süß-schmerzlich-genauer Not auf dem Punkte des Seins Balancierenden. Es war nicht materiell, und es war nicht Geist. Es war etwas zwischen beidem, ein Phänomen, getragen von Materie, gleich dem Regenbogen auf dem Wasserfall und gleich der Flamme. Aber wiewohl nicht materiell, war es sinnlich bis zur Lust und zum Ekel, die Schamlosigkeit der selbstempfindlich-reizbar gewordenen Materie, die unzüchtige Form des Seins. Es war ein heimlich-fühlsames Sichregen in der keuschen Kälte des Alls, eine wollüstig-verstohlene Unsauberkeit von Nährsaugung und Ausscheidung, ein exkretorischer Atemhauch von Kohlensäure und üblen Stoffen verborgener Herkunft und Beschaffenheit. Es war das durch Überausgleich seiner Unbeständigkeit ermöglichte und in eingeborene Bildungsgesetze gebannte Wuchern, Sichentfalten und Gestaltbilden von etwas Gedunsenem aus Wasser, Eiweiß, Salz und Fetten, welches man Fleisch nannte, und das zur Form, zum hohen Bilde, zur Schönheit wurde, dabei jedoch der Inbegriff der Sinnlichkeit und der Begierde war. Denn diese Form und Schönheit war nicht geistgetragen, wie in den Werken der Dichtung und Musik, auch nicht getragen von einem neutralen und geistverzehrten, den Geist auf eine unschuldige Art versinnlichenden Stoff, wie die Form und Schönheit der Bildwerke. Vielmehr war sie getragen und ausgebildet von der auf unbekannte Art zur Wollust erwachten Substanz, der organischen, verwesend-wesenden Materie selbst, dem riechenden Fleische ...
Dem jungen Hans Castorp, der über dem glitzernden Tal in seiner von Pelz und Wolle gesparten Körperwärme ruhte, zeigte sich in der vom Scheine des toten Gestirnes erhellten Frostnacht das Bild des Lebens. Es schwebte ihm vor, irgendwo im Raume, entrückt und doch sinnennah, der Leib, der Körper, matt weißlich, ausduftend, dampfend, klebrig, die Haut, in aller Unreinigkeit und Makelhaftigkeit ihrer Natur, mit Flecken, Papillen, Gilbungen, Rissen und körnig-schuppigen Gegenden, überzogen von den zarten Strömen und Wirbeln des rudimentären Lanugoflaums. Es lehnte, abgesondert von der Kälte des Unbelebten, in seiner Dunstsphäre, lässig, das Haupt gekränzt mit etwas Kühlem, Hornigem, Pigmentiertem, das ein Produkt seiner Haut war, die Hände im Nacken verschränkt, und blickte unter gesenkten Lidern hervor, aus Augen, die eine Varietät der Lidhautbildung schief erscheinen ließ, mit halb geöffneten, ein wenig aufgeworfenen Lippen dem Anschauenden entgegen, gestützt auf das eine Bein, so daß der tragende Hüftknochen in seinem Fleische stark hervortrat, während das Knie des schlaffen Beins, leicht abgebogen, bei auf die Zehen gestelltem Fuß sich gegen die Innenseite des belasteten schmiegte. Es stand so, lächelnd gedreht, in seiner Anmut lehnend, die schimmernden Ellbogen vorwärts gespreizt, in der paarigen Symmetrie seines Gliederbaus, seiner Leibesmale. Dem scharf dünstenden Dunkel der Achselhöhlen entsprach in mystischem Dreieck die Nacht des Schoßes, wie den Augen die rot-epithelische Mundöffnung, den roten Blüten der Brust der senkrecht in die Länge gedehnte Nabel entsprach. Unter dem Antriebe eines Zentralorgans und im Rückenmark entspringender motorischer Nerven regten sich Bauch und Brustkorb, die Pleuroperitonealhöhle blähte sich und zog sich zusammen, der Atemhauch, erwärmt und befeuchtet von den Schleimhäuten des Atmungskanals, mit Ausscheidungsstoffen gesättigt, strömte zwischen den Lippen aus, nachdem er in den Luftzellen der Lunge seinen Sauerstoff an das Hämoglobin des Blutes zur inneren Atmung gebunden. Denn Hans Castorp verstand, daß dieser Lebenskörper in dem geheimnisvollen Gleichmaß seines blutgenährten, von Nerven, Venen, Arterien, Haarfiltern durchzweigten, von Lymphe durchsickerten Gliederbaus, mit seinem inneren Gerüst von fettmarkgefüllten Röhrenknochen, von Blatt-, Wirbel- und Wurzelknochen, die aus der ursprünglichen Stützsubstanz, dem Gallertgewebe, mit Hilfe von Kalksalzen und Leim sich befestigt hatten, um ihn zu tragen; mit den Kapseln und schlüpfrig geschmierten Höhlen, Bändern und Knorpeln seiner Gelenke, seinen mehr als zweihundert Muskeln, seinen zentralen, der Ernährung, Atmung, Reizmeldung und Reizentsendung dienenden Organbildungen, seinen Schutzhäuten, serösen Höhlen, absonderungsreichen Drüsen, dem Röhren- und Spaltenwerk seiner verwickelten, durch Leibesöffnungen in die äußere Natur mündenden Innenfläche: daß dieses Ich eine Lebenseinheit von hoher Ordnung war, bei weitem nicht mehr von der Art jener einfachsten Wesen, die mit ihrer ganzen Körperoberfläche atmeten, sich ernährten und sogar dachten, sondern aufgebaut aus Myriaden solcher Kleinorganisationen, die von einer einzigen her ihren Ursprung genommen, sich durch immer wiederkehrende Teilung vervielfältigt, sich zu verschiedenen Dienststellungen und Verbänden geordnet, gesondert, eigens ausgebildet und Formen hervorgetrieben hatten, die Bedingung und Wirkung ihres Wachstums waren.
Der Leib, der ihm vorschwebte, dies Einzelwesen und Lebens-Ich war also eine ungeheuere Vielheit atmender und sich ernährender Individuen, welche, durch organische Einordnung und Sonderzweckgestaltung, des ichhaften Seins, der Freiheit und Lebensunmittelbarkeit in so hohem Grade verlustig gegangen, so sehr zu anatomischen Elementen geworden waren, daß die Verrichtung einiger sich einzig auf Reizempfindlichkeit gegen Licht, Schall, Berührung, Wärme beschränkte, andere es nur noch verstanden, ihre Form durch Zusammenziehung zu verändern oder Verdauungssekrete zu erzeugen, wieder andere zum Schutz, zur Stütze, zur Beförderung der Säfte oder zur Fortpflanzung einseitig ausgebildet und tüchtig waren. Es gab Lockerungen dieser zum hohen Ich vereinigten organischen Pluralität, Fälle, in denen die Vielzahl der Unterindividuen nur auf leichte und zweifelhafte Art zur höheren Lebenseinheit zusammengefaßt war. Der Studierende grübelte über der Erscheinung der Zellkolonien, er vernahm von Halborganismen, Algen, deren einzelne Zellen, nur in einen Mantel von Gallerte eingehüllt, oft weit voneinander lagen, mehrzellige Bildungen immerhin, die aber, zur Rede gestellt, nicht zu sagen gewußt hätten, ob sie als Siedelung einzelliger Individuen oder als Einheitswesen gewürdigt werden wollten und in ihrer Selbstaussage zwischen dem Ich und dem Wir wunderlich geschwankt haben würden. Hier wies die Natur einen Mittelstand auf zwischen der hochsozialen Vereinigung zahlloser Elementarindividuen zu Geweben und Organen einer übergeordneten Ichheit – und der freien Einzelexistenz dieser Einfachheiten: der vielzellige Organismus war nur eine Erscheinungsform des zyklischen Prozesses, in dem das Leben sich abspielte, und der ein Kreislauf von Zeugung zu Zeugung war. Der Befruchtungsakt, das geschlechtliche Verschmelzen zweier Zellenleiber, stand am Anfange des Aufbaues jedes pluralischen Individuums, wie er am Anfange jeder Generationenreihe einzeln lebender Elementargeschöpfe stand und zu sich selbst zurückführte. Denn dieser Akt war nachhaltig durch viele Geschlechter, die seiner nicht bedurften, um sich in immer wiederholter Teilung zu vermehren, bis ein Augenblick kam, wo die ungeschlechtlich entstandenen Nachkommen zur Erneuerung des Kopulationsgeschäftes sich wieder angehalten fanden, und der Kreis sich schloß. So war der vielfache Lebensstaat, entsprungen aus der Kernverschmelzung zweier elterlicher Zellen, das Zusammenleben vieler ungeschlechtlich entstandener Generationen von Zellindividuen; sein Wachstum war ihre Vermehrung, und der Zeugungskreis schloß sich, wenn Geschlechtszellen, zum Sonderzwecke der Fortpflanzung ausgebildete Elemente, sich in ihm hergestellt hatten und den Weg zu einer das Leben neu antreibenden Vermischung fanden.
Ein embryologisches Volumen in die Herzgrube gestützt, verfolgte der junge Abenteurer die Entwicklung des Organismus von dem Augenblick an, wo der Samenfaden, einer von vielen und dieser zuerst, sich antreibend durch die peitschenden Bewegungen seines Hinterleibes, mit seiner Kopfspitze an die Gallerthülle des Eies stieß und sich in den Empfängnishügel einbohrte, den das Protoplasma der Eirinde seiner Annäherung entgegenwölbte. Keine Fratze und Farce war auszudenken, in der die Natur bei der Abwandlung dieses stehenden Herganges sich nicht ernstlich gefallen hätte. Es gab Tiere, bei denen das Männchen im Darm des Weibchens schmarotzte. Es gab andere, bei denen der Arm des Erzeugers der Erzeugerin durch den Rachenschlund in das Innere griff, um seine Sämereien dort niederzulegen, worauf er, abgebissen und ausgespien, allein auf seinen Fingern davonlief, zur Betörung der Wissenschaft, die ihn lange auf Griechisch-Latein als selbständiges Lebewesen ansprechen zu müssen geglaubt hatte. Hans Castorp hörte die Gelehrtenschulen der Ovisten und Animalculisten sich zanken, von denen die einen behauptet hatten, das Ei sei ein in sich vollendeter kleiner Frosch, Hund oder Mensch und der Samen nur der Erreger seines Wachstums, während die anderen im Samenfaden, der Kopf, Arme und Beine besaß, ein vorgebildetes Lebewesen sahen, dem das Ei nur als Nährboden diente, – bis man übereingekommen war, der Ei- und der Samenzelle, die aus ursprünglich ununterscheidbaren Fortpflanzungszellen entstanden waren, gleiche Verdienstlichkeit einzuräumen. Er sah den einzelligen Organismus des befruchteten Eies auf dem Wege, sich in einen vielzelligen umzuwandeln, indem es sich furchte und teilte, sah die Zellenleiber zur Schleimhautlamelle sich zusammenschmiegen, die Keimblase sich einstülpen und einen Becher und Hohlraum bilden, der das Geschäft der Nahrungsaufnahme und Verdauung begann. Das war die Darmlarve, das Urtier, die Gastrula, Grundform alles tierischen Lebens, Grundform der fleischgetragenen Schönheit. Ihre beiden Epithellagen, die äußere und die innere, das Hautsinnesblatt und das Darmdrüsenblatt, erwiesen sich als Primitivorgane, aus denen durch Ein- und Ausstülpungen die Drüsen, die Gewebe, die Sinneswerkzeuge, die Körperfortsätze sich bildeten. Ein Streifen des äußeren Keimblattes verdickte sich, faltete sich zur Rinne, schloß sich zum Nervenrohr und wurde zur Wirbelsäule, zum Gehirn. Und wie der fötale Schleim sich zu faserigem Bindegewebe, zu Knorpel befestigte, indem die Gallertzellen statt Mucin Leimsubstanz zu erzeugen begannen, sah er an gewissen Orten die Bindegewebszellen Kalksalze und Fette aus den umspülenden Säften an sich ziehen und verknöchern. Der Embryo des Menschen kauerte in sich gebückt, geschwänzt, von dem des Schweines durch nichts zu unterscheiden, mit ungeheurem Bauchstiel und stummelhaft formlosen Extremitäten, die Gesichtslarve auf den geblähten Wanst gebeugt, und sein Werden erschien einer Wissenschaft, deren Wahrheitsvorstellung unschmeichelhaft und düster war, als die flüchtige Wiederholung einer zoologischen Stammesgeschichte. Vorübergehend hatte er Kiementaschen wie ein Roche. Es schien erlaubt oder notwendig, aus den Entwicklungsstadien, die er durchlief, auf den wenig humanistischen Anblick zu schließen, den der vollendete Mensch in Urzeiten geboten hatte. Seine Haut war mit zuckenden Muskeln zur Abwehr der Insekten ausgestattet und dicht behaart, die Ausdehnung seiner Riechschleimhaut gewaltig, seine abstehenden, beweglichen, am Mienenspiel lebhaft beteiligten Ohren zum Schallfang geschickter gewesen als gegenwärtig. Damals hatten seine Augen, von einem dritten, nickenden Lide geschützt, seitlich am Kopfe gestanden, mit Ausnahme des dritten, dessen Rudiment die Zirbeldrüse war, und das die oberen Lüfte zu überwachen vermocht hatte. Dieser Mensch hatte außerdem ein sehr langes Darmrohr, viele Mahlzähne und Schallsäcke am Kehlkopf zum Brüllen besessen und auch die männlichen Geschlechtsdrüsen im Innern des Bauchraumes getragen.
Die Anatomie enthäutete und präparierte unserem Forscher die Gliedmaßen des Menschenleibes, sie zeigte ihm ihre oberflächlichen und ihre tiefen, hinteren Muskeln, Sehnen und Bänder: diejenigen der Schenkel, des Fußes und namentlich der Arme, des Ober- und Unterarms, lehrte ihn die lateinischen Namen, mit denen die Medizin, diese Abschattung des humanistischen Geistes, sie nobler- und galanterweise benannt und unterschieden hatte, und ließ ihn vordringen bis zum Skelett, dessen Ausbildung ihm neue Gesichtspunkte lieferte, unter denen die Einheit alles Menschlichen, die Beschlossenheit aller Disziplinen darin sich betrachten ließ. Denn hier fand er sich aufs merkwürdigste an seinen eigentlichen – oder muß man sagen: früheren – Beruf, die wissenschaftliche Charge erinnert, als deren Zugehöriger er bei seiner Ankunft hier oben sich den Begegnenden (Herrn Dr. Krokowski, Herrn Settembrini) vorgestellt hatte. Um irgendetwas zu lernen – es war recht gleichgültig gewesen, was –, hatte er auf Hochschulen dies und das von Statik, von biegungsfähigen Stützen, von Belastung und von der Konstruktion als einer vorteilhaften Bewirtschaftung des mechanischen Materials gelernt. Es wäre wohl kindlich gewesen, zu meinen, daß die Ingenieurwissenschaften, die Regeln der Mechanik auf die organische Natur Anwendung gefunden hätten, aber ebensowenig konnte man sagen, daß sie davon abgeleitet worden seien. Sie fanden sich einfach darin wiederholt und bekräftigt. Das Prinzip des Hohlzylinders herrschte im Bau der langen Röhrenknochen dergestalt, daß mit dem genauen Minimum von solider Substanz den statischen Ansprüchen Genüge geschah. Ein Körper, hatte Hans Castorp gelernt, der den Anforderungen gemäß, die durch Zug und Druck an ihn gestellt werden sollen, nur aus Stäben und Bändern eines mechanisch brauchbaren Materials zusammengesetzt wird, kann dieselbe Belastung ertragen wie ein massiver Körper des gleichen Stoffes. So auch ließ bei der Entstehung der Röhrenknochen sich verfolgen, wie, schritthaltend mit der Bildung kompakter Substanz an ihrer Oberfläche, die inneren Teile, da sie mechanisch unnötig wurden, sich in Fettgewebe, das gelbe Mark, verwandelten. Der Oberschenkelknochen war ein Kran, bei dessen Konstruktion die organische Natur durch die Richtung, die sie den Knochenbälkchen gegeben, auf ein Haar die gleichen Zug- und Druckkurven ausgeführt hatte, die Hans Castorp bei der graphischen Darstellung eines so in Anspruch genommenen Gerätes korrekterweise einzutragen gehabt hätte. Er sah es mit Wohlgefallen, denn er fand sich zum Femur, oder zur organischen Natur überhaupt, nun schon in dreierlei Verhältnis stehen: dem lyrischen, dem medizinischen und dem technischen, – so groß war seine Angeregtheit; und diese drei Verhältnisse, fand er, waren eines im Menschlichen, sie waren Abwandlungen eines und desselben dringlichen Anliegens, humanistische Fakultäten ...
Bei alldem blieben die Leistungen des Protoplasmas ganz unerklärlich, dem Leben schien es verwehrt, sich selbst zu begreifen. Die Mehrzahl der biochemischen Vorgänge war nicht nur unbekannt, sondern es lag in ihrer Natur, sich der Einsicht zu entziehen. Man wußte von dem Aufbau, der Zusammensetzung der Lebenseinheit, die man die „Zelle“ nannte, fast nichts. Was half es, die Bestandteile des toten Muskels aufzuweisen? Der lebende ließ sich chemisch nicht untersuchen; schon jene Veränderungen, die die Totenstarre hervorrief, genügten, um alles Experimentieren nichtssagend zu machen. Niemand verstand den Stoffwechsel, niemand das Wesen der Nervenfunktion. Welchen Eigenschaften verdankten die schmeckenden Körper ihren Geschmack? Worin bestand die verschiedenartige Erregung gewisser Sinnesnerven durch die Riechstoffe? Worin die Riechbarkeit überhaupt? Der spezifische Geruch der Tiere und Menschen beruhte auf der Verdunstung von Substanzen, die niemand zu nennen gewußt hätte. Die Zusammensetzung des Sekrets, das man Schweiß nannte, war wenig geklärt. Die Drüsen, die es absonderten, erzeugten Aromata, die unter Säugetieren zweifellos eine wichtige Rolle spielten, und über deren Bedeutung beim Menschen man nicht unterrichtet zu sein erklärte. Die physiologische Bedeutung offenbar wichtiger Teile des Körpers war in Dunkel gehüllt. Man konnte den Blinddarm beiseite lassen, der ein Mysterium war, und den man beim Kaninchen regelmäßig mit einem breiigen Inhalt angefüllt fand, von dem nicht zu sagen war, wie er wieder hinausgelangen oder sich erneuern mochte. Aber was hatte es auf sich mit der weißen und grauen Substanz des Kopfmarks, was mit dem Sehhügel, der mit dem Optikus kommunizierte, und mit den grauen Einlagerungen der „Brücke“? Die Hirn- und Rückenmarksubstanz war dermaßen zersetzlich, daß keine Hoffnung bestand, je ihren Aufbau zu ergründen. Was enthob beim Einschlafen die Großhirnrinde ihrer Tätigkeit? Was hinderte die Selbstverdauung des Magens, die sich bei Leichen in der Tat zuweilen ereignete? Man antwortete: das Leben; eine besondere Widerstandskraft des lebenden Protoplasmas, – und tat, als bemerke man nicht, daß das eine mystische Erklärung war. Die Theorie einer so alltäglichen Erscheinung wie des Fiebers war widerspruchsvoll. Der gesteigerte Stoffumsatz hatte erhöhte Wärmeproduktion zur Folge. Aber warum steigerte sich nicht, wie sonst, kompensatorisch die Wärmeausgabe? Beruhte die Lähmung der Schweißsekretion auf Kontraktionszuständen der Haut? Aber nur bei Fieberfrost waren solche nachweisbar, denn sonst war die Haut vielmehr heiß. Der „Wärmestich“ kennzeichnete das Zentralnervensystem als Sitz der Ursachen für den erhöhten Umsatz wie für eine Hautbeschaffenheit, die man abnorm zu nennen sich begnügte, da man sie nicht zu bestimmen wußte.
Aber was bedeutete all dieses Unwissen im Vergleich mit der Ratlosigkeit, in der man vor Erscheinungen wie der des Gedächtnisses oder jenes weiteren und erstaunlicheren Gedächtnisses stand, das die Vererbung erworbener Eigenschaften hieß? Die Unmöglichkeit, auch nur die Ahnung einer mechanischen Erklärbarkeit solcher Leistungen der Zellsubstanz zu fassen, war vollkommen. Der Samenfaden, der zahllose und verwickelte Art- und Individualeigenschaften des Vaters auf das Ei übertrug, war nur mikroskopisch sichtbar, und auch die stärkste Vergrößerung reichte nicht hin, ihn anders denn als homogenen Körper erscheinen zu lassen und die Bestimmung seiner Abkunft zu ermöglichen; denn bei einem Tier sah er aus wie beim anderen. Das waren Organisationsverhältnisse, die zu der Annahme zwangen, daß es sich mit der Zelle nicht anders verhielt als mit dem höheren Leib, den sie aufbaute; daß also auch sie schon ein übergeordneter Organismus war, der seinerseits und wiederum sich aus lebenden Teilungskörpern, individuellen Lebenseinheiten zusammensetzte. Man schritt also vom angeblich Kleinsten zum abermals Kleineren vor, man löste notgedrungen das Elementare in Unterelemente auf. Kein Zweifel, wie das Tierreich aus verschiedenen Spezies von Tieren, wie der tierisch-menschliche Organismus aus einem ganzen Tierreich von Zellenspezies, so bestand derjenige der Zelle aus einem neuen und vielfältigen Tierreich elementarer Lebenseinheiten, deren Größe tief unter der Grenze des mikroskopisch Sichtbaren lag, die selbsttätig wuchsen, selbsttätig, nach dem Gesetz, daß jede nur ihresgleichen hervorbringen konnte, sich vermehrten und nach dem Grundsatz der Arbeitsteilung gemeinsam der nächsthöheren Lebensordnung dienten.
Das waren die Genen, die Bioblasten, die Biophoren, – Hans Castorp war erfreut, in der Frostnacht ihre namentliche Bekanntschaft zu machen. Nur fragte er sich in seiner Angeregtheit, wie es bei abermals verbesserter Beleuchtung um ihre Elementarnatur bestellt sein mochte. Da sie Leben trugen, mußten sie organisiert sein, denn Leben beruhte auf Organisation; wenn sie aber organisiert waren, so konnten sie nicht elementar sein, denn ein Organismus ist nicht elementar, er ist vielfach. Sie waren Lebenseinheiten unterhalb der Lebenseinheit der Zelle, die sie organisch aufbauten. Wenn dem aber so war, so mußten sie, obgleich über alle Begriffe klein, selber „aufgebaut“, und zwar organisch, als Lebensordnung, „aufgebaut“ sein; denn der Begriff der Lebenseinheit war identisch mit dem des Aufbaues aus kleineren, untergeordneten, das hieß: zu höherem Leben geordneten Lebenseinheiten. Solange die Teilung organische Einheiten ergab, die die Eigenschaften des Lebens, nämlich die Fähigkeiten der Assimilation, des Wachstums und der Vermehrung besaßen, waren ihr keine Grenzen gesetzt. Solange von Lebenseinheiten die Rede war, konnte nur fälschlich von Elementareinheiten die Rede sein, denn der Begriff der Einheit umschloß ad infinitum den Mitbegriff der untergeordnet-aufbauenden Einheit, und elementares Leben, also etwas, was schon Leben, aber noch elementar war, gab es nicht.
Aber obschon ohne logische Existenz, mußte zuletzt dergleichen irgendwie wirklich sein, denn die Idee der Urzeugung, das hieß: der Entstehung des Lebens aus dem Nichtlebenden, war ja nicht von der Hand zu weisen, und jene Kluft, die man in der äußeren Natur vergebens zu schließen suchte, die nämlich zwischen Leben und Leblosigkeit, mußte sich im organischen Inneren der Natur auf irgendeine Weise ausfüllen oder überbrücken. Irgendwann mußte die Teilung zu „Einheiten“ führen, die, zwar zusammengesetzt, aber noch nicht organisiert, zwischen Leben und Nichtleben vermittelten, Molekülgruppen, den Übergang bildend zwischen Lebensordnung und bloßer Chemie. Allein beim chemischen Molekül angekommen, fand man sich bereits in der Nähe eines Abgrundes, der weit mysteriöser gähnte als der zwischen organischer und unorganischer Natur: nahe dem Abgrund zwischen dem Materiellen und dem Nichtmateriellen. Denn das Molekül setzte sich ja aus Atomen zusammen, und das Atom war bei weitem nicht mehr groß genug, um auch nur als außerordentlich klein bezeichnet werden zu können. Es war dermaßen klein, eine derart winzige, frühe und übergängliche Ballung des Unstofflichen, des noch nicht Stofflichen, aber schon Stoffähnlichen, der Energie, daß es kaum schon oder kaum noch als materiell, vielmehr als Mittel und Grenzpunkt zwischen dem Materiellen und dem Immateriellen gedacht werden mußte. Das Problem einer anderen Urzeugung, weit rätselhafter und abenteuerlicher noch als die organische, warf sich auf: der Urzeugung des Stoffes aus dem Unstofflichen. In der Tat verlangte die Kluft zwischen Materie und Nichtmaterie ebenso dringlich, ja noch dringlicher nach Ausfüllung als die zwischen organischer und anorganischer Natur. Notwendig mußte es eine Chemie des Immateriellen geben, unstoffliche Verbindungen, aus denen das Stoffliche entsprang, wie die Organismen aus unorganischen Verbindungen entsprangen, und die Atome mochten die Probien und Moneren der Materie darstellen, – stofflich ihrer Natur nach und auch wieder noch nicht. Aber angelangt beim „nicht einmal mehr klein“, entglitt der Maßstab; „nicht einmal mehr klein“, das galt bereits soviel wie „ungeheuer groß“; und der Schritt zum Atom erwies sich ohne Übertreibung als im höchsten Grade verhängnisvoll. Denn im Augenblick letzter Zerteilung und Verwinzigung des Materiellen tat sich plötzlich der astronomische Kosmos auf!
Das Atom war ein energiegeladenes kosmisches System, worin Weltkörper rotierend um ein sonnenhaftes Zentrum rasten, und durch dessen Ätherraum mit Lichtjahrgeschwindigkeit Kometen fuhren, welche die Kraft des Zentralkörpers in ihre exzentrischen Bahnen zwang. Das war so wenig nur ein Vergleich, wie es nur ein solcher war, wenn man den Leib der vielzelligen Wesen einen „Zellenstaat“ nannte. Die Stadt, der Staat, die nach dem Prinzip der Arbeitsteilung geordnete soziale Gemeinschaft war dem organischen Leben nicht nur zu vergleichen, sie wiederholte es. So wiederholte sich im Innersten der Natur, in weitester Spiegelung, die makrokosmische Sternenwelt, deren Schwärme, Haufen, Gruppen, Figuren, bleich vom Monde, zu Häupten des vermummten Adepten über dem frostglitzernden Tale schwebten. War es unerlaubt, zu denken, daß gewisse Planeten des atomischen Sonnensystems – dieser Heere und Milchstraßen von Sonnensystemen, die die Materie aufbauten, – daß also einer oder der andere dieser innerweltlichen Weltkörper sich in einem Zustande befand, der demjenigen entsprach, der die Erde zu einer Wohnstätte des Lebens machte? Für einen im Zentrum etwas beschwipsten jungen Adepten von „abnormer“ Hautbeschaffenheit, der im Gebiete des Unerlaubten ja nicht mehr all und jeder Erfahrung entbehrte, war das eine nicht nur nicht ungereimte, sondern sogar bis zur Aufdringlichkeit sich nahelegende, höchst einleuchtende Spekulation von logischem Wahrheitsgepräge. Die „Kleinheit“ der innerweltlichen Sternkörper wäre ein sehr unsachgemäßer Einwand gewesen, denn der Maßstab von Groß und Klein war spätestens damals abhanden gekommen, als der kosmische Charakter der „kleinsten“ Stoffteile sich offenbart hatte, und die Begriffe des Außen und Innen hatten nachgerade gleichfalls in ihrer Standfestigkeit gelitten. Die Welt des Atoms war ein Außen, wie höchstwahrscheinlich der Erdenstern, den wir bewohnten, organisch betrachtet, ein tiefes Innen war. Hatte nicht die träumerische Kühnheit eines Forschers von „Milchstraßentieren“ gesprochen, – kosmischen Ungeheuern, deren Fleisch, Bein und Gehirn sich aus Sonnensystemen aufbaute? War dem aber so, wie Hans Castorp dachte, dann fing in dem Augenblick, da man geglaubt hatte, zu Rande gekommen zu sein, das Ganze von vorn an! Dann lag vielleicht im Innersten und Aberinnersten seiner Natur er selbst, der junge Hans Castorp, noch einmal, noch hundertmal, warm eingehüllt, in einer Balkonloge mit Aussicht in die mondhelle Hochgebirgsfrostnacht und studierte mit erstarrten Fingern und heißem Gesicht aus humanistisch-medizinischer Anteilnahme das Körperleben?
Die pathologische Anatomie, von der er einen Band seitlich in den roten Schein seines Tischlämpchens hielt, belehrte ihn durch einen Text, der mit Abbildungen durchsetzt war, über das Wesen der parasitischen Zellvereinigung und der Infektionsgeschwülste. Diese waren Gewebsformen – und zwar besonders üppige Gewebsformen –, hervorgerufen durch das Eindringen fremdartiger Zellen in einen Organismus, der sich für sie aufnahmelustig erwiesen hatte und ihrem Gedeihen auf irgendeine Weise – aber man mußte wohl sagen: auf eine irgendwie liederliche Weise – günstige Bedingungen bot. Weniger, daß der Parasit dem umgebenden Gewebe Nahrung entzogen hätte; aber er erzeugte, indem er, wie jede Zelle, Stoff wechselte, organische Verbindungen, die sich für die Zellen des Wirtsorganismus als erstaunlich giftig, als unweigerlich verderbenbringend erwiesen. Man hatte von einigen Mikroorganismen die Toxine zu isolieren und in konzentriertem Zustande darzustellen verstanden, und es verwunderlich gefunden, in welchen geringen Dosen diese Stoffe, die einfach in die Reihe der Eiweißverbindungen gehörten, in den Kreislauf eines Tieres gebracht, die allergefährlichsten Vergiftungserscheinungen, reißende Verderbnis bewirkten. Das äußere Wesen dieser Korruption war Gewebswucherung, die pathologische Geschwulst, nämlich als Reaktionswirkung der Zellen auf den Reiz, den die zwischen ihnen angesiedelten Bazillen auf sie ausübten. Hirsekorngroße Knötchen bildeten sich, zusammengesetzt aus schleimhautgewebartigen Zellen, zwischen denen oder in denen die Bazillen nisteten, und von welchen einige außerordentlich reich an Protoplasma, riesengroß und von vielen Kernen erfüllt waren. Diese Lustbarkeit aber führte gar bald zum Ruin, denn nun begannen die Kerne der Monstrezellen zu schrumpfen und zu zerfallen, ihr Protoplasma an Gerinnung zugrunde zu gehen; weitere Gewebsteile der Umgebung wurden von der fremden Reizwirkung ergriffen; entzündliche Vorgänge griffen um sich und zogen die angrenzenden Gefäße in Mitleidenschaft; weiße Blutkörperchen wanderten, angelockt von der Unheilsstätte, herzu; das Gerinnungssterben schritt fort; und unterdessen hatten längst die löslichen Bakteriengifte die Nervenzentren berauscht, der Organismus stand in Hochtemperatur, mit wogendem Busen, sozusagen, taumelte er seiner Auflösung entgegen.
So weit die Pathologie, die Lehre von der Krankheit, der Schmerzbetonung des Körpers, die aber, als Betonung des Körperlichen, zugleich eine Lustbetonung war, – Krankheit war die unzüchtige Form des Lebens. Und das Leben für sein Teil? War es vielleicht nur eine infektiöse Erkrankung der Materie, – wie das, was man die Urzeugung der Materie nennen durfte, vielleicht nur Krankheit, eine Reizwucherung des Immateriellen war? Der anfänglichste Schritt zum Bösen, zur Lust und zum Tode war zweifellos da anzusetzen, wo, hervorgerufen durch den Kitzel einer unbekannten Infiltration, jene erste Dichtigkeitszunahme des Geistigen, jene pathologisch üppige Wucherung seines Gewebes sich vollzog, die, halb Vergnügen, halb Abwehr, die früheste Vorstufe des Substanziellen, den Übergang des Unstofflichen zum Stofflichen bildete. Das war der Sündenfall. Die zweite Urzeugung, die Geburt des Organischen aus dem Unorganischen, war nur noch eine schlimme Steigerung der Körperlichkeit zum Bewußtsein, wie die Krankheit des Organismus eine rauschhafte Steigerung und ungesittete Überbetonung seiner Körperlichkeit war –: nur noch ein Folgeschritt war das Leben auf dem Abenteuerpfade des unehrbar gewordenen Geistes, Schamwärmereflex der zur Fühlsamkeit geweckten Materie, die für den Erwecker aufnahmelustig gewesen war ...
Die Bücher lagen zuhauf auf dem Lampentischchen, eins lag am Boden, neben dem Liegestuhl, auf der Matte der Loggia, und dasjenige, worin Hans Castorp zuletzt geforscht, lag ihm auf dem Magen und drückte, beschwerte ihm sehr den Atem, doch ohne daß von seiner Hirnrinde an die zuständigen Muskeln Order ergangen wäre, es zu entfernen. Er hatte die Seite hinunter gelesen, sein Kinn hatte die Brust erreicht, die Lider waren ihm über die einfachen blauen Augen gefallen. Er sah das Bild des Lebens, seinen blühenden Gliederbau, die fleischgetragene Schönheit. Sie hatte die Hände aus dem Nacken gelöst, und ihre Arme, die sie öffnete, und an deren Innenseite, namentlich unter der zarten Haut des Ellbogengelenks, die Gefäße, die beiden Äste der großen Venen, sich bläulich abzeichneten, – diese Arme waren von unaussprechlicher Süßigkeit. Sie neigte sich ihm, neigte sich zu ihm, über ihn, er spürte ihren organischen Duft, spürte den Spitzenstoß ihres Herzens. Heiße Zartheit umschlang seinen Hals, und während er, vergehend vor Lust und Grauen, seine Hände an ihre äußeren Oberarme legte, dorthin, wo die den triceps überspannende, körnige Haut von wonniger Kühle war, fühlte er auf seinen Lippen die feuchte Ansaugung ihres Kusses.
Kurz nach Weihnachten starb der Herrenreiter ... Aber vorher spielte eben noch Weihnachten sich ab, diese beiden Festtage, oder, wenn man den Tag des heiligen Abends mitzählte, diese drei, denen Hans Castorp mit einigem Schrecken und der kopfschüttelnden Erwartung entgegengesehen hatte, wie sie sich hier wohl ausnehmen würden, und die dann, als natürliche Tage mit Morgen, Mittag, Abend und mittlerer Zufallswitterung (es taute etwas), auch nicht anders, als andere ihrer Gattung, heraufgekommen und verblichen waren: – äußerlich ein wenig geschmückt und ausgezeichnet, hatten sie während der ihnen zugemessenen Frist ihre Bewußtseinsherrschaft in den Köpfen und Herzen der Menschen geübt und waren unter Zurücklassung eines Niederschlages unalltäglicher Eindrücke zu naher und fernerer Vergangenheit geworden ...
Der Sohn des Hofrates, Knut mit Namen, kam auf Ferienbesuch und wohnte bei seinem Vater im Seitenflügel, – ein hübscher, junger Mann, dem aber ebenfalls schon der Nacken etwas zu sehr heraustrat. Man spürte die Anwesenheit des jungen Behrens in der Atmosphäre; die Damen legten Lachlust, Putzsucht und Reizbarkeit an den Tag, und in ihren Gesprächen handelte es sich um Begegnungen mit Knut im Garten, im Walde oder im Kurhausviertel. Übrigens erhielt er selbst Besuch: eine Anzahl seiner Universitätskameraden kam in das Tal herauf, sechs oder sieben Studenten, die im Orte wohnten, aber beim Hofrat die Mahlzeiten nahmen und, zum Trupp verbunden, mit ihrem Kommilitonen die Gegend durchstreiften. Hans Castorp mied sie. Er mied diese jungen Leute und wich ihnen mit Joachim aus, wenn es nötig war, unlustig, ihnen zu begegnen. Den Zugehörigen Derer hier oben trennte eine Welt von diesen Sängern, Wanderern und Stöckeschwingern, er wollte von ihnen nichts hören und wissen. Außerdem schienen die meisten von ihnen aus dem Norden zu stammen, womöglich waren Landsleute darunter, und Hans Castorp fühlte die größte Scheu vor Landsleuten, oft erwog er mit Widerwillen die Möglichkeit, daß irgendwelche Hamburger im „Berghof“ eintreffen könnten, zumal Behrens gesagt hatte, diese Stadt stelle der Anstalt immer ein stattliches Kontingent. Vielleicht befanden sich welche unter den Schweren und Moribunden, die man nicht sah. Zu sehen war nur ein hohlwangiger Kaufmann, der seit ein paar Wochen am Tische der Iltis saß, und der aus Cuxhaven sein sollte. Hans Castorp freute sich im Hinblick auf ihn, daß man mit Nicht-Tischgenossen hierorts so schwer in Berührung kam, und ferner darüber, daß sein Heimatsgebiet groß und sphärenreich war. Die gleichgültige Anwesenheit dieses Kaufmanns entkräftete in hohem Grade die Besorgnisse, die er an das Vorkommen von Hamburgern hier oben geknüpft hatte.
Der heilige Abend also näherte sich, stand eines Tages vor der Tür und hatte am nächsten Tage Gegenwart gewonnen ... Es waren noch reichlich sechs Wochen bis zu ihm gewesen, damals, als Hans Castorp sich gewundert hatte, daß man hier schon von Weihnachten sprach: so viel Zeit also noch, rechnerisch genommen, wie die ganze Dauer seines Aufenthalts nach ihrer ursprünglichen Veranschlagung, zusammen mit der Dauer seiner Bettlägrigkeit betragen hatte. Trotzdem war das damals eine große Menge Zeit gewesen, namentlich die erste Hälfte, wie es Hans Castorp nachträglich schien, – während die rechnerisch gleiche Menge jetzt sehr wenig bedeutete, beinahe nichts: die im Speisesaal, so fand er nun, hatten recht gehabt, sie so gering zu achten. Sechs Wochen, nicht einmal so viele also, wie die Woche Tage hatte: was war auch das in Anbetracht der weiteren Frage, was denn so eine Woche, so ein kleiner Rundlauf vom Montag zum Sonntag und wieder Montag war. Man brauchte nur immer nach Wert und Bedeutung der nächstkleineren Einheit zu fragen, um zu verstehen, daß bei der Summierung nicht viel herauskommen konnte, deren Wirkung überdies und zugleich ja auch eine sehr starke Verkürzung, Verwischung, Schrumpfung und Zernichtung war. Was war ein Tag, gerechnet etwa von dem Augenblick an, wo man sich zum Mittagessen setzte, bis zu dem Wiedereintritt dieses Augenblicks in vierundzwanzig Stunden? Nichts, – obgleich es doch vierundzwanzig Stunden waren. Was war denn aber auch eine Stunde, verbracht etwa in der Liegekur, auf einem Spaziergang oder beim Essen, – womit die Möglichkeiten, diese Einheit zu verbringen, so gut wie erschöpft waren? Wiederum nichts. Aber die Summierung des Nichts war wenig ernst ihrer Natur nach. Am ernstesten wurde die Sache, wenn man ins Kleinste stieg: jene sieben mal sechzig Sekunden, während derer man das Thermometer zwischen den Lippen hielt, um die Kurve fortführen zu können, waren überaus zählebig und gewichtig; sie weiteten sich zu einer kleinen Ewigkeit, bildeten Einlagerungen von höchster Solidität in dem schattenhaften Huschen der großen Zeit ...
Das Fest vermochte die Lebensordnung der Berghofbewohner kaum zu stören. Eine wohlgewachsene Tanne war schon einige Tage zuvor an der rechten Schmalseite des Speisesaals, beim Schlechten Russentisch, aufgerichtet worden, und ihr Duft, der durch den Brodem der reichen Gänge hindurch die Speisenden zuweilen berührte, rief etwas wie Nachdenklichkeit in den Augen einzelner Personen an den sieben Tischen hervor. Beim Abendessen des 24. Dezembers zeigte der Baum sich bunt geschmückt mit Lametta, Glaskugeln, vergoldeten Tannenzapfen, kleinen Äpfeln, die in Netzen hingen, und vielerlei Konfekt, und seine farbigen Wachskerzen brannten während der Mahlzeit und nachher. Auch in den Zimmern der Bettlägrigen, hieß es, brannten Bäumchen; jedes hatte das seine. Und die Paketpost war reich gewesen schon in den letzten Tagen. Auch Joachim Ziemßen und Hans Castorp hatten Sendungen aus der fernen und tiefen Heimat bekommen, sorglich verpackte Bescherungen, die sie in ihren Zimmern ausgebreitet hatten: sinnreiche Kleidungsstücke, Krawatten, Luxusgegenstände in Leder und Nickel, sowie viel Festgebäck, Nüsse, Äpfel und Marzipan, – Vorräte, die die Vettern mit zweifelnden Blicken betrachteten, indem sie sich fragten, wann hier je der Augenblick kommen werde, davon zu genießen. Schalleen hatte Hans Castorps Paket hergestellt, wie er wußte, und auch, nach sachlicher Besprechung mit den Onkeln, die Geschenke besorgt. Ein Brief von James Tienappel lag bei, auf dickem Privatpapier, doch in Maschinenschrift. Der Onkel übermittelte darin des Großonkels und seine eigenen Fest- und Genesungswünsche und fügte aus praktischen Gründen gleich die nächstens fälligen Neujahrsgratulationen hinzu, wie übrigens auch Hans Castorp verfahren war, als er rechtzeitig seinen Weihnachtsbrief nebst klinischem Rapport an Konsul Tienappel liegend aufgesetzt hatte.
Der Baum im Speisesaal brannte, knisterte, duftete und hielt in den Köpfen und Herzen das Bewußtsein der Stunde wach. Man hatte Toilette gemacht, die Herren trugen Gesellschaftsanzug, man sah an den Frauen Schmuckstücke, die ihnen von liebender Gattenhand aus den Ländern der Ebene gekommen sein mochten. Auch Clawdia Chauchat hatte den ortsüblichen Wollsweater gegen ein Salonkleid vertauscht, das aber einen Stich ins Willkürliche oder vielmehr ins Nationale hatte: es war ein helles, gesticktes Gürtelkostüm von bäuerlich-russischem, oder doch balkanischem, vielleicht bulgarischem Grundcharakter, mit kleinen Goldflittern besetzt, dessen Faltigkeit ihrer Erscheinung eine ungewohnt weiche Fülle verlieh und ausgezeichnet mit dem zusammenstimmte, was Settembrini ihre „tatarische Physiognomie“, insbesondere ihre „Steppenwolfslichter“ zu nennen beliebte. Man war sehr heiter am Guten Russentisch; dort zuerst knallte der Champagner, der dann fast an allen Tischen getrunken wurde. An dem der Vettern war es die Großtante, die ihn für ihre Nichte und für Marusja bestellte, und sie traktierte alle damit. Das Menü war gewählt, es endete mit Käsegebäck und Bonbons; man schloß Kaffee an und Liköre, und dann und wann rief ein aufflammender Tannenzweig, der Löscharbeit forderte, eine schrille, übermäßige Panik hervor. Settembrini, gekleidet wie immer, saß gegen Ende des Festessens eine Weile mit seinem Zahnstocher am Tische der Vettern, hänselte Frau Stöhr und sprach dann einiges über den Tischlerssohn und Menschheits-Rabbi, dessen Geburtstag man heute fingiere. Ob jener wirklich gelebt habe, sei ungewiß. Was aber damals geboren worden sei und seinen bis heute ununterbrochenen Siegeslauf begonnen habe, das sei die Idee des Wertes der Einzelseele, zusammen mit der der Gleichheit gewesen, – mit einem Worte die individualistische Demokratie. In diesem Sinne leere er das Glas, das man ihm zugeschoben. Frau Stöhr fand seine Ausdrucksweise „equivok und gemütlos“. Sie erhob sich unter Protest, und da man ohnedies die Gesellschaftsräume aufzusuchen begonnen hatte, so folgten die Tischgenossen ihrem Beispiel.
Die Geselligkeit dieses Abends erhielt Gewicht und Leben durch die Überreichung der Geschenke an den Hofrat, der mit Knut und der Mylendonk auf eine halbe Stunde herüberkam. Die Handlung vollzog sich in dem Salon mit den optischen Scherzapparaten. Die Sondergabe der Russen bestand in etwas Silbernem, einem sehr großen, runden Teller, in dessen Mitte das Monogramm des Empfängers eingraviert war, und dessen vollkommene Unverwendbarkeit in die Augen sprang. Auf der Chaiselongue, die die übrigen Gäste gestiftet hatten, konnte man wenigstens liegen, obgleich sie noch ohne Decke und Kissen war, nur eben mit Tuch überzogen. Doch war ihr Kopfende verstellbar, und Behrens probierte ihre Bequemlichkeit, indem er sich, seinen nutzlosen Teller unter dem Arm, der Länge nach darauf ausstreckte, die Augen schloß und zu schnarchen begann wie ein Sägewerk, unter der Angabe, er sei Fafnir mit dem Hort. Der Jubel war allgemein. Auch Frau Chauchat lachte sehr über diese Aufführung, wobei ihre Augen sich zusammenzogen und ihr Mund offen stand, beides genau auf dieselbe Weise, so fand Hans Castorp, wie es bei Pribislav Hippe, wenn er lachte, der Fall gewesen war.
Gleich nach dem Abgange des Chefs setzte man sich an die Spieltische. Die russische Gesellschaft bezog, wie immer, den kleinen Salon. Einige Gäste umstanden im Saale den Weihnachtsbaum, sahen dem Erlöschen der Lichtstümpfchen in ihren kleinen Metallhülsen zu und naschten von dem Aufgehängten. An den Tischen, die schon für das erste Frühstück gedeckt waren, saßen vereinzelte Personen, weit voneinander entfernt, verschiedentlich aufgestützt, in getrenntem Schweigen.
Der erste Weihnachtstag war feucht und neblig. Es seien Wolken, sagte Behrens, in denen man sitze; Nebel gäbe es nicht hier oben. Aber Wolken oder Nebel, auf jeden Fall war die Nässe empfindlich. Der liegende Schnee taute oberflächlich an, wurde porös und klebrig. Gesicht und Hände erstarrten im Kurdienst weit peinlicher als bei sonnigem Frost.
Der Tag war ausgezeichnet durch eine musikalische Veranstaltung am Abend, ein richtiges Konzert mit Stuhlreihen und gedruckten Programmen, das Denen hier oben vom Hause „Berghof“ geboten wurde. Es war ein Liederabend, gegeben von einer am Orte ansässigen und Unterricht erteilenden Berufssängerin mit zwei Medaillen seitlich unter dem Ausschnitt ihres Ballkleides, Armen, die Stöcken glichen, und einer Stimme, deren eigentümliche Tonlosigkeit über die Gründe ihrer Ansiedelung hier oben betrübende Auskunft gab. Sie sang:
Der Pianist, der sie begleitete, war ebenfalls ortsansässig ... Frau Chauchat saß in der ersten Reihe, benutzte jedoch die Pause, um sich zurückzuziehen, so daß Hans Castorp von da an der Musik (es war Musik unter allen Umständen) mit ruhigem Herzen lauschen konnte, indem er während des Gesanges den Text der Lieder mitlas, der auf dem Programm gedruckt stand. Eine Weile saß Settembrini an seiner Seite, verschwand aber ebenfalls, nachdem er über den dumpfen bel canto der Ansässigen einiges Pralle, Plastische angemerkt und sein satirisches Behagen darüber ausgedrückt, daß man auch heute abend so treu und traulich unter sich sei. Die Wahrheit zu sagen, spürte Hans Castorp Erleichterung, als sie beide fort waren, die Schmaläugige und der Pädagog, und er in Freiheit den Liedern seine Aufmerksamkeit widmen konnte. Er fand es gut, daß in der ganzen Welt und noch unter den besondersten Umständen Musik gemacht wurde, wahrscheinlich sogar auf Polarexpeditionen.
Der zweite Weihnachtstag unterschied sich durch nichts mehr, als durch das leichte Bewußtsein seiner Gegenwart, von einem gewöhnlichen Sonn- oder auch nur Wochentag, und als er vorüber war, da lag das Weihnachtsfest im Vergangenen, – oder, ebenso richtig, es lag wieder in ferner Zukunft, in jahresferner: zwölf Monate waren nun wieder bis dahin, wo es sich im Kreislauf erneuern würde, – schließlich nur sieben Monate mehr, als Hans Castorp hier schon verbracht hatte.
Aber gleich nach dem diesjährigen Weihnachten, noch vor Neujahr, starb denn also der Herrenreiter. Die Vettern erfuhren es von Alfreda Schildknecht, genannt Schwester Berta, der Pflegerin des armen Fritz Rotbein, die ihnen das diskrete Vorkommnis auf dem Gange erzählte. Hans Castorp nahm eindringlich Anteil daran, teils weil die Lebensäußerungen des Herrenreiters zu den ersten Eindrücken gehört hatten, die er hier oben empfangen, – zu denen, die zuerst, wie ihm schien, den Wärmereflex in seiner Gesichtshaut hervorgerufen hatten, der seitdem nicht mehr daraus hatte weichen wollen, – teils aus moralischen, man möchte sagen: geistlichen Gründen. Er hielt Joachim lange im Gespräch mit der Diakonissin fest, die Ansprache und Austausch mit klammernder Dankbarkeit genoß. Es sei ein Wunder, sagte sie, daß der Herrenreiter das Fest noch erlebt habe. Längst habe er sich als zäher Kavalier erwiesen gehabt, allein womit er zuletzt noch geatmet, sei keinem begreiflich gewesen. Seit Tagen schon habe er sich freilich nur mit Hilfe gewaltiger Mengen Sauerstoffes gehalten: gestern allein habe er vierzig Ballons konsumiert, das Stück zu sechs Franken. Das müsse ins Geld gelaufen sein, wie die Herren sich ausrechnen könnten, und dabei sei zu bedenken, daß seine Gemahlin, in deren Armen er danach verschieden, völlig mittellos hinterbleibe. Joachim mißbilligte diesen Aufwand. Wozu die Quälerei und kostspielig künstliche Hinfristung in einem ganz aussichtslosen Fall? Dem Mann sei es nicht zu verargen, daß er das teure Lebensgas blindlings verzehrt, da man es ihm aufgenötigt hatte. Dagegen die Behandelnden hätten vernünftiger denken und ihn in Gottes Namen seines unvermeidlichen Weges ziehen lassen sollen, ganz abgesehen von den Verhältnissen und gar nun mit Rücksicht auf diese. Die Lebenden hätten doch auch ein Recht und so weiter. Dem widersprach Hans Castorp mit Nachdruck. Sein Vetter rede ja fast schon wie Settembrini, ohne Achtung und Scheu vor dem Leiden. Der Herrenreiter sei doch am Ende gestorben, da höre der Spaß auf, man könne nichts weiter tun, um seinen Ernst zu erweisen, und einem Sterbenden gebühre jeder Respekt und Ehrenaufwand, darauf bestehe Hans Castorp. Er wolle nur hoffen, daß Behrens den Herrenreiter zuletzt nicht angeschrien und pietätloserweise gescholten habe? Kein Anlaß, erklärte die Schildknecht. Einen kleinen, unbesonnenen Versuch zu entwischen habe der Herrenreiter zwar zuletzt noch gemacht und aus dem Bett springen wollen; aber ein leichter Hinweis auf die Zwecklosigkeit solchen Beginnens habe genügt, ihn ein für allemal davon abstehen zu lassen.
Hans Castorp nahm den Verblichenen in Augenschein. Er tat es aus Trotz gegen das herrschende System der Verheimlichung, weil er das egoistische Nichts-wissen-, Nichts-sehen-und-hören-wollen der andern verachtete und ihm durch die Tat zu widersprechen wünschte. Bei Tische hatte er den Todesfall zur Sprache zu bringen versucht, war aber auf einmütige und so verstockte Ablehnung dieses Themas gestoßen, daß es ihn beschämt und empört hatte. Frau Stöhr war geradezu grob geworden. Was ihm einfalle, von so etwas anzufangen, hatte sie gefragt, und was er denn eigentlich für eine Kinderstube genossen. Die Ordnung des Hauses schütze sie, die Patientenschaft, sorgfältig davor, von solchen Geschichten berührt zu werden, und da komme nun so ein Grünschnabel und rede ganz laut davon, noch dazu beim Braten und dazu wieder in Gegenwart des Dr. Blumenkohl, den es täglich ereilen könne. (Dies hinter der Hand.) Wiederhole sich das, so werde sie klagbar werden. Da war es, daß der Gescholtene den Entschluß gefaßt und ihm auch Ausdruck verliehen hatte, für seine Person dem abgeschiedenen Hausgenossen durch einen Besuch und stille Andachtsverrichtung an seinem Lager die letzte Ehre zu erweisen, und auch Joachim hatte er bestimmt, das zu tun.
Durch Vermittlung Schwester Alfredas erlangten sie Eintritt in das Sterbezimmer, das im ersten Stock unter ihren eigenen Zimmern gelegen war. Die Witwe empfing sie, eine kleine, zerzauste, von Nachtwachen mitgenommene Blonde, das Taschentuch vor dem Munde, mit roter Nase und in dickem Plaidmantel, dessen Kragen sie aufgestellt hatte, denn es war sehr kalt im Zimmer. Die Heizung war abgestellt, die Balkontür offen. Gedämpft sagten die jungen Leute das Erforderliche und gingen dann, durch eine Handbewegung schmerzlich eingeladen, durch das Zimmer zum Bett, – mit ehrerbietig vorwärts wiegenden Schritten gingen sie, ohne Benutzung der Stiefelabsätze, und standen in Betrachtung am Lager des Toten, ein jeder nach seiner Art: Joachim dienstlich geschlossen, in salutierender Halbverbeugung, Hans Castorp gelöst und versunken, die Hände vor sich gekreuzt, den Kopf auf der Schulter, mit einer Miene, ähnlich derjenigen, mit der er Musik zu hören pflegte. Des Herrenreiters Kopf lag hoch gebettet, so daß der Körper, dieser lange Aufbau und vielfache Zeugungskreis des Lebens, mit der Erhöhung der Füße am Ende unter der Decke, desto flacher, fast brettartig flach erschien. Ein Blumengewinde lag in der Gegend der Knie, und der daraus hervorragende Palmzweig berührte die großen, gelben, knöchernen Hände, die auf der eingefallenen Brust gefaltet waren. Gelb und knöchern war auch das Gesicht mit dem kahlen Schädel, der gehöckerten Nase, den scharfen Backenknochen und dem buschigen, rotblonden Schnurrbart, dessen Dicke die grauen, stoppligen Höhlen der Wangen noch stärker vertiefte. Die Augen waren auf eine gewisse unnatürlich feste Weise geschlossen, – zugedrückt, mußte Hans Castorp denken, nicht zugemacht: den letzten Liebesdienst nannte man das, obgleich es im Sinne der Überlebenden mehr, als um des Toten willen geschah. Auch mußte es beizeiten, gleich nach dem Tode geschehen; denn wenn erst die Myosinbildung in den Muskeln vorgeschritten war, so ging es nicht mehr, und er lag und starrte, und um die sinnige Vorstellung des „Schlummers“ war es getan.
Sachkundig und in mehr als einer Beziehung in seinem Elemente stand Hans Castorp am Lager, bewandert, aber fromm. „Er scheint zu schlafen“, sagte er aus Menschlichkeit, obgleich große Unterschiede vorhanden waren. Und dann begann er mit schicklich gedämpfter Stimme ein Gespräch mit der Witwe des Herrenreiters, zog über die Leidensgeschichte ihres Gatten, seine letzten Tage und Augenblicke, den zu bewerkstelligenden Transport des Körpers nach Kärnten Erkundigungen ein, die von einer teils medizinischen, teils geistlich-sittlichen Teilnahme und Eingeweihtheit zeugten. Die Witwe, in ihrer österreichisch schleppenden und näselnden Sprechweise und zuweilen aufschluchzend, fand es bemerkenswert, daß junge Leute zur Beschäftigung mit fremdem Kummer sich so aufgelegt zeigten; worauf Hans Castorp erwiderte, sein Vetter und er, sie seien ja selber krank, überdies habe er, für seine Person, frühe an den Sterbebetten naher Angehöriger gestanden, er sei Doppelwaise, von langer Hand her sei ihm der Tod vertraut, sozusagen. Welchen Beruf er gewählt habe, fragte sie. Er antwortete, er sei Techniker „gewesen“. – Gewesen? – Gewesen insofern, als nun ja die Krankheit und ein noch recht unbestimmt begrenzter Aufenthalt hier oben dazwischengekommen sei, was doch einen bedeutenden Einschnitt und möglicherweise etwas wie einen Lebenswendepunkt darstelle, was könne man wissen. (Joachim sah ihn mit forschendem Schrecken an.) Und sein Herr Vetter? – Der wolle Soldat sein im Tieflande, er sei Offiziersaspirant. – Oh, sagte sie, das Kriegerhandwerk sei freilich auch ein Beruf, der zum Ernst anhalte, ein Soldat müsse damit rechnen, unter Umständen mit dem Tode in nahe Berührung zu kommen und tue wohl gut, sich frühzeitig an seinen Anblick zu gewöhnen. Sie beurlaubte die jungen Leute mit Dank und freundlicher Fassung, die Achtung erwecken mußte in Anbetracht ihrer beklommenen Lage und besonders der hohen Oxygenrechnung, die der Gatte zurückgelassen. Die Vettern kehrten in ihr Stockwerk zurück. Hans Castorp zeigte sich befriedigt von dem Besuch und geistlich angeregt durch die empfangenen Eindrücke.
„Requiescat in pace“, sagte er. „Sit tibi terra levis. Requiem aeternam dona ei, Domine. Siehst du, wenn es sich um den Tod handelt und man zu Toten spricht oder von Toten, so tritt auch wieder das Latein in Kraft, das ist die offizielle Sprache in solchen Fällen, da merkt man, was für eine besondere Sache es mit dem Tode ist. Aber es ist nicht aus humanistischer Courtoisie, daß man Lateinisch redet zu seinen Ehren, die Totensprache ist kein Bildungslatein, verstehst du, sondern von einem ganz anderen Geist, einem ganz entgegengesetzten, kann man wohl sagen. Das ist Sakrallatein, Mönchsdialekt, Mittelalter, so ein dumpfer, eintöniger, unterirdischer Gesang gewissermaßen, – Settembrini fände kein Gefallen daran, es ist nichts für Humanisten und Republikaner und solche Pädagogen, es ist von einer anderen Geistesrichtung, der anderen, die es gibt. Ich finde, man muß sich klar sein über die verschiedenen Geistesrichtungen oder Geistesstimmungen, wie man wohl richtiger sagen sollte, es gibt die fromme und die freie. Sie haben beide ihre Vorzüge, aber was ich gegen die freie, die Settembrinische meine ich, auf dem Herzen habe, ist nur, daß sie die Menschenwürde so ganz in Pacht zu haben glaubt, das ist übertrieben. Die andere enthält auch viel menschliche Würde in ihrer Art und gibt Veranlassung zu einer Menge Wohlanstand und properer Haltung und nobler Förmlichkeit, mehr sogar als die ‚freie‘, obgleich sie die menschliche Schwäche und Hinfälligkeit ja besonders im Auge hat und der Gedanke an Tod und Verwesung eine so wichtige Rolle darin spielt. Hast du mal im Theater den ‚Don Carlos‘ gesehen und wie es zuging am spanischen Hof, wenn König Philipp hereinkommt, ganz in Schwarz, mit dem Hosenbandorden und dem Goldenen Vließ, und langsam den Hut zieht, der beinahe schon aussieht wie unsere Melonen, – so nach oben hin zieht er ihn und sagt: ‚Bedeckt euch, meine Granden‘ oder so ähnlich, – im höchsten Grade gemessen ist das, darf man wohl sagen, von Gehenlassen und schlottrigen Sitten kann da nicht die Rede sein, im Gegenteil, und die Königin sagt denn ja auch: ‚In meinem Frankreich wars doch anders‘, natürlich, der ist es zu akkurat und umständlich, die möchte es fideler haben, menschlicher. Aber was heißt menschlich? Menschlich ist alles. Das spanisch Gottesfürchtige und Demütig-Feierliche und streng Abgezirkelte ist eine sehr würdige Fasson der Menschlichkeit, sollte ich meinen, und andererseits kann man mit dem Worte ‚menschlich‘ jede Schlamperei und Schlappheit zudecken, da wirst du mir recht geben.“
„Da gebe ich dir recht,“ sagte Joachim, „Schlappheit und Gehenlassen kann ich natürlich auch nicht leiden, Disziplin muß sein.“
„Ja, das sagst du als Militär, und ich gebe zu, beim Militär versteht man sich auf diese Dinge. Die Witwe hatte ganz recht, von eurem Handwerk zu sagen, es habe eine ernsthafte Bewandtnis damit, denn immer müßtet ihr mit dem äußersten Ernstfalle rechnen und damit, es mit dem Tod zu tun zu bekommen. Ihr habt die Uniform, die ist knapp und propper und hat einen steifen Kragen, das gibt euch bienséance. Und dann habt ihr die Rangordnung und den Gehorsam und erweist euch umständlich Ehre untereinander, das geschieht in spanischem Geiste, aus Frömmigkeit, ich mag es im Grunde wohl leiden. Bei uns Zivilisten sollte von diesem Geiste auch mehr herrschen, in unseren Sitten und unserm Gehaben, das wäre mir lieber, ich fände es passend. Ich finde, die Welt und das Leben ist danach angetan, daß man sich allgemein schwarz tragen sollte, mit einer gestärkten Halskrause statt eures Kragens, und ernst, gedämpft und förmlich miteinander verkehren im Gedanken an den Tod, – so wär es mir recht, es wäre moralisch. Siehst du, das ist auch so ein Irrtum und Eigendünkel von Settembrini, noch einer, es ist ganz gut, daß ich gesprächsweise mal darauf komme. Nicht bloß die Menschenwürde meint er in Pacht zu haben, sondern auch die Moral, – mit seiner ‚praktischen Lebensarbeit‘ und seinen Fortschritts-Sonntagsfeiern (als ob man nicht gerade Sonntags an was anderes zu denken hätte als an den Fortschritt) und mit seiner systematischen Ausmerzung der Leiden, wovon du übrigens nichts weißt, aber mir hat er zu meiner Belehrung davon erzählt, – systematisch will er sie ausmerzen, vermittelst eines Lexikons. Und wenn mir nun das gerade unmoralisch vorkommt, – was dann? Ihm sage ich es natürlich nicht, er redet mich ja in Grund und Boden mit seiner plastischen Mundart und sagt: ‚Ich warne Sie, Ingenieur!‘ Aber denken dürfen wird man sich ja sein Teil, – Sire, geben Sie Gedankenfreiheit. Ich will dir was sagen“, schloß er. (Sie waren in Joachims Zimmer hinaufgelangt, und Joachim machte sich zum Liegen bereit.) „Ich werde dir sagen, was ich mir vorgenommen habe. Man lebt hier so Tür an Tür mit sterbenden Leuten und mit dem schwersten Kreuz und Jammer, aber nicht allein, daß man so tut, als ob es einen nichts anginge, sondern man wird auch geschont und geschützt, daß man nur ja nicht damit in Berührung kommt und nichts davon sieht, und den Herrenreiter, den werden sie nun auch wieder heimlich auf die Seite bringen, während wir vespern oder frühstücken. Das finde ich unmoralisch. Die Stöhr wurde ja schon wütend, weil ich den Todesfall nur erwähnte, das ist mir zu albern, und wenn sie schon ungebildet ist und glaubt, daß ‚Leise, leise, fromme Weise‘ im ‚Tannhäuser‘ vorkommt, wie es ihr neulich bei Tische passierte, so könnte sie dabei doch etwas moralischer empfinden, und die anderen auch. Ich habe mir nun vorgenommen, mich in Zukunft etwas mehr um die Schweren und Moribunden im Hause zu kümmern, das wird mir wohltun, – schon unser Besuch eben hat mir gewissermaßen gut getan. Der arme Reuter damals, auf Nr. 25, den ich in meinen ersten Tagen durch die Tür einmal sah, ist gewiß schon längst ad penates gegangen und heimlich auf die Seite gebracht worden, – er hatte schon damals so übertrieben große Augen. Aber dafür sind andere da, das Haus ist voll, es fehlt nie an Zuzug, und Schwester Alfreda oder auch die Oberin oder sogar Behrens selbst werden uns gewiß behilflich sein, eine oder die andere Beziehung herzustellen, das wird sich ja unschwer machen lassen. Nimm an, jemand Moribundes hat Geburtstag, und wir erfahren es, – das läßt sich ja in Erfahrung bringen. Gut, wir schicken dem Betreffenden – oder ihr – ihm oder ihr, je nachdem – einen Blumentopf aufs Zimmer, eine Aufmerksamkeit von zwei ungenannten Kollegen, – beste Genesungswünsche, – das Wort Genesung bleibt höflicherweise immer am Platz. Dann werden wir dem Betreffenden natürlich doch genannt, und er oder sie läßt uns in ihrer Schwäche einen freundlichen Gruß durch die Tür sagen, und vielleicht lädt sie uns auf einen Augenblick ins Zimmer ein, und wir wechseln noch ein paar menschliche Worte mit ihm, bevor er sich auflöst. So denke ich es mir. Bist du nicht einverstanden? Für mein Teil hab ichs mir jedenfalls vorgenommen.“
Joachim hatte gegen diese Absichten denn auch nicht viel zu erinnern. „Es ist gegen die Hausordnung,“ sagte er; „du durchbrichst sie gewissermaßen damit. Aber ausnahmsweise, und wenn du nun einmal den Wunsch hast, wird Behrens dir wohl Permeß geben, denke ich. Du kannst dich ja auf dein medizinisches Interesse berufen.“
„Ja, unter anderem darauf“, sagte Hans Castorp; denn wirklich waren es verschlungene Motive, aus denen sein Wunsch erwuchs. Der Protest gegen den obwaltenden Egoismus war nur eines davon. Was mitsprach, war namentlich auch das Bedürfnis seines Geistes, Leiden und Tod ernst nehmen und achten zu dürfen, – ein Bedürfnis, für das er sich von der Annäherung an die Schweren und Sterbenden Genugtuung und Stärkung erhoffte, als Gegengewicht gegen vielfache Beleidigungen, denen er es sonst auf Schritt und Tritt, alltäglich und stündlich ausgesetzt fand, und durch die gewisse Urteile Settembrinis eine ihn kränkende Bekräftigung erfuhren. Beispiele bieten sich nur zu zahlreich an; hätte man Hans Castorp gefragt, er wäre vielleicht zuerst auf solche Personen im Hause „Berghof“ zu sprechen gekommen, die eingestandenermaßen überhaupt nicht krank waren und vollkommen freiwillig, unter dem offiziellen Vorwande leichter Angegriffenheit, in Wirklichkeit aber nur zu ihrem Vergnügen und weil die Lebensform der Kranken ihnen zusagte, hier lebten, wie die schon beiläufig erwähnte Witwe Hessenfeld, eine lebhafte Frau, deren Leidenschaft das Wetten war: sie wettete mit den Herren, wettete auf alles und um alles, wettete auf das Wetter, das eintreten, die Gerichte, die es geben würde, auf das Ergebnis von Generaluntersuchungen und darauf, wieviel Monate jemandem zugelegt werden würden, auf gewisse Bobs, Eisschlitten, Schlittschuh- oder Ski-Champions bei sportlichen Konkurrenzen, auf den Verlauf sich anspinnender Liebesgeschichten unter den Gästen und auf hundert andere, oft gänzlich unerhebliche und gleichgültige Dinge, wettete um Schokolade, um Champagner und Kaviar, die dann im Restaurant festlicherweise verzehrt wurden, um Geld, um Kinobilletts und selbst um Küsse, zu gebende und zu nehmende, – kurzum, sie brachte mit dieser ihrer Passion viel Spannung und Leben in den Speisesaal, nur daß ihr Treiben den jungen Hans Castorp natürlich sehr ernst nicht dünken wollte, ja, daß ihr bloßes Vorhandensein ihm als Beeinträchtigung der Würde eines Leidensortes erschien.
Denn diese Würde zu schützen und vor sich selber aufrecht zu halten, war er im Innern treulich bestrebt, so schwer es ihm fallen mochte nach einem nun fast halbjährigen Aufenthalt unter Denen hier oben. Die Einblicke, die er nach und nach in ihr Leben und Treiben, ihre Sitten und Anschauungen getan, waren seinem guten Willen wenig behilflich. Da waren jene beiden mageren Stutzerchen, siebzehn- und achtzehnjährig und „Max und Moritz“ genannt, deren abendliches Aussteigen zum Zwecke des Pokerns und der Zechereien in Damengesellschaft dem Gerede viel Stoff bot. Kürzlich, das heißt etwa acht Tage nach Neujahr (denn man muß festhalten, daß, während wir erzählen, die Zeit in ihrer still strömenden Art rastlos fortschreitet), hatte sich beim Frühstück die Nachricht verbreitet, der Bademeister habe die beiden morgens in zerknitterten Gesellschaftsanzügen auf ihren Betten betroffen. Auch Hans Castorp lachte; aber wenn es beschämend für seinen guten Willen war, so war es noch gar nicht viel im Vergleich mit den Geschichten des Rechtsanwalts Einhuf aus Jüterbog, eines spitzbärtigen Vierzigers mit schwarzbehaarten Händen, der seit einiger Zeit an Stelle des genesenen Schweden am Tisch Settembrinis saß und nicht nur jede Nacht betrunken nach Hause kam, sondern dies neulich überhaupt nicht getan hatte, vielmehr auf der Wiese gefunden worden war. Er galt für einen gefährlichen Liederjahn, und Frau Stöhr konnte auf die – im Tiefland übrigens verlobte – junge Dame mit ihrem Finger weisen, die man zu einer bestimmten Stunde aus Einhufs Zimmer hatte treten sehen, bekleidet nur mit einem Pelz, unter dem sie nichts weiter als eine Reformhose getragen haben sollte. Das war skandalös, – nicht nur in allgemein moralischem Sinn, sondern skandalös und beleidigend für Hans Castorp persönlich, im Sinn seiner geistigen Bemühungen. Es kam aber hinzu, daß er an die Person des Rechtsanwalts nicht denken konnte, ohne auch Fränzchen Oberdank mit einzubeziehen, jenes glattgescheitelte Haustöchterchen, das vor wenigen Wochen von ihrer Mutter, einer würdigen Provinzdame, heraufgeleitet worden war. Fränzchen Oberdank hatte bei ihrer Ankunft und nach der ersten Untersuchung für leichtkrank gegolten; aber mochte sie Fehler begangen haben, mochte ein Fall vorliegen, in dem die Luft zunächst nicht sowohl gegen, als vor allen Dingen einmal für die Krankheit gut gewesen war, oder mochte die Kleine in irgendwelche Intrigen und Aufregungen verstrickt worden sein, die ihr geschadet hatten: vier Wochen nach ihrem Eintritt geschah es, daß sie, von einer neuen Untersuchung kommend, beim Betreten des Speisesaals ihr Handtäschchen in die Luft warf und mit heller Stimme ausrief: „Hurra, ein Jahr muß ich bleiben!!“ – worüber im ganzen Saal ein homerisches Gelächter sich verbreitet hatte. Aber vierzehn Tage später war die Nachricht in Umlauf gekommen, daß Rechtsanwalt Einhuf an Fränzchen Oberdank wie ein Schurke gehandelt habe. Übrigens kommt dieser Ausdruck auf unsere Rechnung oder allenfalls auf die Hans Castorps; denn den Trägern der Nachricht schien diese ihrem Wesen nach wohl nicht neu genug, um zu so starken Worten anzuregen. Auch gaben sie achselzuckend zu verstehen, daß zu solchen Geschichten ja zweie gehörten, und daß vermutlich nichts gegen Wunsch und Willen eines Beteiligten geschehen sei. Wenigstens war dies Frau Stöhrs Verhalten und sittliche Stimmung in fraglicher Angelegenheit.
Karoline Stöhr war entsetzlich. Wenn irgend etwas den jungen Hans Castorp in seinen redlich gemeinten geistigen Bemühungen störte, so war es das Sein und Wesen dieser Frau. Ihre beständigen Bildungsschnitzer hätten genügt. Sie sagte „Agonje“ statt „Todeskampf“; „insolvent“, wenn sie jemandem Frechheit zum Vorwurf machte, und gab über die astronomischen Vorgänge, die eine Sonnenfinsternis zeitigen, den greulichsten Unsinn zum besten. Mit den liegenden Schneemassen, sagte sie, sei es „eine wahre Kapazität“; und eines Tages setzte sie Herrn Settembrini in lang andauerndes Erstaunen durch die Mitteilung, sie lese zur Zeit ein der Anstaltsbibliothek entnommenes Buch, das ihn angehe, nämlich „Benedetto Cenelli in der Übersetzung von Schiller“! Sie liebte Redensarten, die dem jungen Hans Castorp, ihrer Abgeschmacktheit und modisch ordinären Verbrauchtheit wegen, auf die Nerven gingen, wie zum Beispiel: „Das ist die Höhe!“ oder: „Du ahnst es nicht!“ Und da die Bezeichnung „blendend“, die das Modemaul lange Zeit für „glänzend“ oder „vorzüglich“ gebraucht hatte, sich als gänzlich ausgelaugt, entkräftet, prostituiert und sohin veraltet erwies, so warf sie sich auf das Neueste, nämlich das Wort „verheerend“, und fand nun, im Ernst oder höhnischerweise, alles „verheerend“, die Schlittenbahn, die Mehlspeise und ihre eigene Leibeswärme, was ebenfalls ekelhaft anmutete. Hinzu kam ihre Klatschsucht, die unmäßig war. Mochte sie immerhin erzählen, Frau Salomon trage heute die kostbarste Spitzenwäsche, denn sie sei zur Untersuchung bestellt und ziere sich dabei vor den Ärzten mit feinem Unterzeug: – es hatte seine Richtigkeit damit, Hans Castorp selbst hatte den Eindruck gewonnen, daß die Prozedur der Untersuchung, unabhängig von ihrem Ergebnis, den Damen Vergnügen bereite, und daß sie sich kokett dafür schmückten. Aber was sollte man zu Frau Stöhrs Versicherung sagen, Frau Redisch aus Posen, die im Verdacht tuberkulösen Rückenmarks stehe, müsse wöchentlich einmal zehn Minuten lang vollständig nackt vor Hofrat Behrens im Zimmer hin und her marschieren? Die Unwahrscheinlichkeit dieser Behauptung kam fast ihrer Anstößigkeit gleich, aber Frau Stöhr verfocht und beschwor sie aufs äußerste, – obgleich schwer begreiflich erschien, wie die Arme auf Dinge, wie diese, so viel Eifer, Nachdruck und Rechthaberei verwenden mochte, da ihre eigensten Angelegenheiten ihr schwer zu schaffen machten. Denn zwischendurch suchten Anfälle von feiger und weinerlicher Besorgnis sie heim, deren Anlaß ihre angeblich zunehmende „Schlaffheit“ oder das Ansteigen ihrer Kurve war. Sie kam schluchzend zu Tisch, die spröden roten Backen von Tränen überströmt und heulte in ihr Taschentuch, daß Behrens sie in ihr Bett schicken wolle, sie aber wolle wissen, was er hinter ihrem Rücken gesagt habe, was ihr fehle, wie es um sie stehe, sie wolle der Wahrheit ins Auge sehen! Zu ihrem Entsetzen hatte sie eines Tages bemerkt, daß ihr Bett mit dem Fußende in der Richtung der Haustür stehe und erlitt fast Krämpfe dieser Entdeckung wegen. Man verstand ihre Wut, ihr Grauen nicht ohne weiteres, Hans Castorp im besonderen verstand sich nicht gleich darauf. Nun und? Wieso? Warum das Bett nicht stehen solle, wie es stehe? – Aber ob er, um Gottes willen, denn nicht begreife! „Die Füße voran ...!“ Sie schlug verzweifelten Lärm, und sofort mußte das Bett umgestellt werden, obgleich sie fortan vom Kissen ins Licht sah, was ihren Schlaf beeinträchtigte.
Das alles war unernst; es kam Hans Castorps geistigen Bedürfnissen sehr wenig entgegen. Ein schreckhafter Zwischenfall, der sich um diese Zeit während einer Mahlzeit ereignete, machte besonderen Eindruck auf den jungen Mann. Ein noch neuer Patient, der Lehrer Popów, ein magerer und stiller Mensch, der mit seiner ebenfalls mageren und stillen Braut am Guten Russentisch Platz gefunden hatte, erwies sich, da eben das Essen in vollem Gange war, als epileptisch, indem er einen krassen Anfall dieser Art erlitt, mit jenem Schrei, dessen dämonischer und außermenschlicher Charakter oft geschildert worden ist, zu Boden stürzte und neben seinem Stuhle unter den scheußlichsten Verrenkungen mit Armen und Beinen um sich schlug. Erschwerend wirkte, daß es ein Fischgericht war, das eben gereicht worden, so daß zu befürchten stand, Popów möchte in seiner Krampfverzückung an einer Gräte Schaden nehmen. Der Aufruhr war unbeschreiblich. Die Damen, Frau Stöhr voran, aber ohne daß etwa die Frauen Salomon, Redisch, Hessenfeld, Magnus, Iltis, Levi und wie sie nun heißen mochten, ihr etwas nachgegeben hätten, wurden von den verschiedensten Zuständen betreten, so daß einige es Herrn Popów fast gleichtaten. Ihre Schreie gellten. Man sah nichts als zugekrampfte Augen, offene Münder und verdrehte Oberkörper. Eine einzelne gab stiller Ohnmacht den Vorzug. Erstickungsanfälle, da jedermann von dem wilden Ereignis im Kauen und Schlucken überrascht worden war, spielten sich ab. Ein Teil der Tischgesellschaft suchte durch die verfügbaren Ausgänge das Weite, auch durch die Verandatüren, obgleich es draußen sehr naßkalt war. Es trug aber der ganze Vorfall ein eigentümliches und außer seiner Entsetzlichkeit auch anstößiges Tonzeichen, und zwar vermöge einer allgemein sich aufdrängenden Ideenverbindung, die an den jüngsten Vortrag Dr. Krokowskis anknüpfte. Der Analytiker war nämlich bei seinen Ausführungen über die Liebe als krankheitbildende Macht gerade am letzten Montag auf die Fallsucht zu reden gekommen und hatte dies Leiden, worin die Menschheit in voranalytischen Zeiten abwechselnd eine heilige, ja prophetische Heimsuchung und eine Teufelsbesessenheit gesehen, mit halb poetischen, halb unerbittlich wissenschaftlichen Worten als Äquivalent der Liebe und Orgasmus des Gehirns angesprochen, kurz, es in einem solchen Sinne verdächtigt, daß seine Zuhörer die Aufführung des Lehrers Popów, diese Illustration des Vortrags, als wüste Offenbarung und mysteriösen Skandal verstehen mußten, so daß denn auch in dem verhüllten Entfliehen der Damen eine gewisse Schamhaftigkeit sich ausdrückte. Der Hofrat selbst war bei der Mahlzeit zugegen, und er war es, der, zusammen mit der Mylendonk und einigen jungen, handfesten Tafelgenossen, den Ekstatiker, blau, schäumend, steif und verzerrt, wie er war, aus dem Saal in die Halle schaffte, wo man die Ärzte, die Oberin und anderes Personal noch längere Zeit an dem Sinnlosen hantieren sah, der dann auf einer Bahre davongetragen wurde. Ganz kurze Zeit danach aber sah man Herrn Popów stillvergnügt, in Gesellschaft seiner ebenfalls stillvergnügten Braut, wieder am Guten Russentisch sitzen und, als sei nichts geschehen, sein Mittagessen beenden!
Hans Castorp hatte dem Ereignis mit den äußeren Zeichen respektvollen Schreckens beigewohnt, im Grunde aber mutete auch dies ihn nicht ernst an, Gott mochte ihm helfen. Popów hätte an seinem Fischbissen freilich ersticken können, aber in Wirklichkeit war er ja nicht erstickt, sondern hatte, bei aller bewußtlosen Wut und Lustbarkeit, im Stillsten wohl dennoch ein wenig achtgegeben. Nun saß er heiter, aß fertig und tat, als habe er sich nie wie ein Berserker und rasender Trunkenbold benommen, erinnerte sich gewiß auch nicht daran. Auch seine Erscheinung aber war nicht danach angetan, Hans Castorps Ehrfurcht vor dem Leiden zu stärken; auch sie, in ihrer Art, vermehrte die Eindrücke unernster Liederlichkeit, denen er sich widerstrebend hier oben ausgesetzt fand, und denen er durch eine den herrschenden Sitten widersprechende nähere Beschäftigung mit den Schweren und Moribunden entgegenzuwirken wünschte.
Auf der Etage der Vettern, nicht weit von ihren Zimmern, lag ein ganz junges Mädchen, Leila Gerngroß mit Namen, die den Mitteilungen Schwester Alfredas zufolge im Begriffe war, zu sterben. Sie hatte binnen zehn Tagen vier heftige Blutungen erlitten, und ihre Eltern waren heraufgekommen, um sie vielleicht noch lebend heimzubringen; doch schien das nicht angängig: der Hofrat verneinte die Transportfähigkeit der armen kleinen Gerngroß. Sie war sechzehn-, siebzehnjährig. Hans Castorp sah hier die rechte Gelegenheit, seinen Plan mit dem Blumentopf und den Genesungswünschen zu verwirklichen. Zwar hatte Leila jetzt nicht Geburtstag, würde diesen auch, menschlicher Voraussicht nach, nicht mehr erleben, da er, wie Hans Castorp ausgekundschaftet, erst in das Frühjahr fiel; doch brauchte das seiner Entscheidung nach kein Hindernis für eine solche barmherzige Huldigung zu sein. Auf einem Mittagsgange in die Gegend des Kurhauses trat er mit seinem Vetter in einen Blumenladen, dessen erdig-feuchte und duftüberladene Atmosphäre er mit bewegter Brust einatmete, und erstand einen hübschen Hortensienstock, den er ohne Namensnennung, mit einer Karte, auf der nur „Von zwei Hausgenossen, mit besten Genesungswünschen“ geschrieben stand, der kleinen Moribunden aufs Zimmer zu schicken Weisung gab. Er handelte freudig, angenehm benommen vom Pflanzenbrodem, der lauen Wärme des Ortes, die nach der Außenkälte seine Augen tränen ließ, mit klopfendem Herzen und einem Gefühl der Abenteuerlichkeit, Kühnheit, Förderlichkeit seines unscheinbaren Unternehmens, dem er insgeheim eine symbolische Tragweite beimaß.
Leila Gerngroß genoß keine Privatpflege, sondern unterstand unmittelbar der Fürsorge Fräulein von Mylendonks und der Ärzte; aber Schwester Alfreda ging bei ihr aus und ein, und sie erstattete den jungen Leuten Bericht über die Wirkung ihrer Aufmerksamkeit. Die Kleine, in der aussichtslosen Beschränktheit ihres Zustandes, hatte sich kindisch gefreut über den fremden Gruß. Die Pflanze stand an ihrem Bett, sie liebkoste sie mit Blicken und Händen, sorgte, daß man sie begoß, und hing selbst noch bei den schlimmsten Hustenanfällen, die sie heimsuchten, mit ihren gequälten Augen an ihr. Ihre Eltern, Major außer Diensten Gerngroß und Frau, waren ebenfalls gerührt und erfreut gewesen, und da sie, ohne jede Bekanntschaft im Hause, die Geber zu erraten nicht einmal versuchen konnten, so hatte die Schildknecht, wie sie gestand, sich nicht enthalten können, die Anonymität zu lüften und die Vettern als Spender namhaft zu machen. Sie überbrachte ihnen die Bitte der drei Gerngroß um Vorstellung und Dankesentgegennahme, und so traten die beiden denn übernächsten Tages, von der Diakonissin geführt, auf Zehenspitzen in Leilas Leidenskammer ein.
Die Sterbende war ein überaus liebreizendes blondes Geschöpf mit genau vergißmeinnichtblauen Augen, das trotz furchtbarer Blutverluste und einer Atmung, die nur vermittelst eines ganz unzulänglichen Restbestandes von tauglichem Lungengewebe geschah, einen zwar zarten, aber eigentlich nicht elenden Anblick bot. Sie dankte und plauderte mit etwas tonarmer, aber angenehmer Stimme. Ein rosiger Schein erstand auf ihren Wangen und verharrte dort. Hans Castorp, der gegen die anwesenden Eltern und sie seine Handlungsweise so erläutert, wie man es erwartete, und sich gewissermaßen entschuldigt hatte, sprach gedämpft und bewegt, mit zärtlicher Ehrerbietung. Es fehlte nicht viel – der innere Antrieb dazu war jedenfalls vorhanden –, daß er sich vor dem Bett auf ein Knie niedergelassen hätte, und lange hielt er Leilas Hand in der seinen fest, obgleich dies heiße Händchen nicht nur feucht, sondern geradezu naß war, denn des Kindes Schweißsekretion war übermäßig; beständig verausgabte sie so viel Wasser, daß ihr Fleisch schon längst hätte eingeschnurrt und vertrocknet sein müssen, wenn nicht der gierigste Konsum von Limonade, von der auch eine Karaffe voll auf ihrem Nachttische stand, der Transsudation ungefähr die Wage gehalten hätte. Die Eltern, gramvoll, wie sie waren, hielten mit Erkundigungen über die persönlichen Umstände der Vettern und anderen konversationellen Mitteln die kurze Unterhaltung nach menschlicher Gesittung aufrecht. Der Major war ein breitschultriger Mann mit niedriger Stirn und gesträubtem Schnurrbart, – ein Hüne, dessen organische Unschuld an der Disposition und Aufnahmelustigkeit des Töchterchens in die Augen stach. Schuld daran war offensichtlich vielmehr seine Frau, eine kleine Person von entschieden phthisischem Typus, deren Gewissen denn auch dieser Mitgift wegen belastet schien. Als nämlich Leila nach zehn Minuten Ermüdungs- oder vielmehr Überreizungszeichen gab (das Rosenrot ihrer Wangen erhöhte sich, während ihre Vergißmeinnichtaugen beunruhigend glänzten), und die Vettern, von Schwester Alfreda mit den Blicken dazu gemahnt, sich verabschiedeten, geleitete Frau Gerngroß sie bis vor die Tür und erging sich dabei in Selbstanklagen, die Hans Castorp sonderbar ergriffen. Von ihr, von ihr allein komme es, versicherte sie zerknirscht; von ihr nur könne das arme Kind es haben, ihr Mann sei völlig unbeteiligt daran, habe nicht das geringste damit zu tun. Aber auch sie, könne sie versichern, habe nur ganz vorübergehend damit zu tun gehabt, nur ein bißchen und obenhin, ganz kurze Zeit, als junges Mädchen. Dann habe sie es überwunden, ganz und gar, wie ihr bezeugt worden sei, denn sie habe heiraten wollen, so gern heiraten und leben, und es sei ihr gelungen, ganz ausgeheilt und genesen sei sie in die Ehe getreten mit ihrem lieben, baumstarken Mann, der seinerseits nie auch nur entfernt an solche Geschichten gedacht habe. Aber so rein und stark er sei, – er habe das Unglück doch nicht verhindern können mit seinem Einfluß. Denn bei dem Kinde, da sei das Schreckliche, das Begrabene und Vergessene wieder zum Vorschein gekommen, und es werde nicht fertig damit, es gehe zugrunde daran, während sie, die Mutter, darüber hinweggekommen und in ein gefestetes Alter getreten sei, – es sterbe, das arme, liebe Ding, die Ärzte gäben keine Hoffnung mehr, und sie allein sei schuld daran mit ihrem Vorleben.
Die jungen Leute suchten sie zu trösten, machten Worte über die Möglichkeit einer glücklichen Wendung. Aber die Majorin schluchzte nur auf und dankte ihnen jedenfalls nochmals für alles, für die Hortensie und dafür, daß sie das Kind durch ihren Besuch noch ein wenig zerstreut und beglückt. Da läge die Ärmste in ihrer Qual und Einsamkeit, während andere junge Dinger sich ihres Lebens freuten und mit hübschen jungen Herren tanzten, wozu die Krankheit doch keineswegs die Lust ertöte. Sie hätten ihr ein wenig Sonnenschein gebracht, mein Gott, wohl den letzten. Die Hortensie sei wie ein Ballerfolg und das Geplauder mit den beiden stattlichen Kavalieren wie ein netter kleiner Flirt für sie gewesen, das habe sie, Mutter Gerngroß, wohl gesehen.
Hiervon war Hans Castorp nun peinlich berührt, besonders da die Majorin das Wort „Flirt“ obendrein nicht richtig, das heißt nicht englisch, sondern mit deutschem i ausgesprochen hatte, was ihn maßlos irritierte. Auch war er kein stattlicher Kavalier, sondern hatte die kleine Leila aus Protest gegen den herrschenden Egoismus und in medizinisch-geistlicher Meinung besucht. Kurz, er war etwas verstimmt über den letzten Ausgang der Sache, soweit die Auffassung der Majorin in Frage kam, sonst aber sehr belebt und angetan von der Durchführung des Unternehmens. Namentlich zwei Eindrücke: die erdigen Düfte des Blumenladens und die Nässe von Leilas Händchen waren ihm davon in Seele und Sinn zurückgeblieben. Und da ein Anfang gemacht war, verabredete er noch gleichen Tages mit Schwester Alfreda einen Besuch bei ihrem Pflegling Fritz Rotbein, der sich nebst seiner Pflegerin so schrecklich langweilte, obgleich ihm, wenn nicht alle Zeichen trogen, nur noch eine ganz kurze Weile beschieden war.
Es half dem guten Joachim nichts, er mußte mithalten. Hans Castorps Antrieb und charitativer Unternehmungsgeist war stärker als seines Vetters Abneigung, welche dieser höchstens durch Schweigen und Niederschlagen der Augen geltend machen konnte, da er sie, ohne Mangel an Christentum zu bekunden, nicht zu begründen gewußt hätte. Hans Castorp sah das sehr wohl und zog seinen Nutzen daraus. Er verstand auch genau den militärischen Sinn dieser Unlust. Aber wenn er selbst sich nun doch belebt und beglückt fühlte durch solche Unternehmungen, und wenn sie ihm förderlich schienen? Dann mußte er über Joachims stillen Widerstand eben hinwegschreiten. Er erwog mit ihm, ob man auch dem jungen Fritz Rotbein Blumen schicken oder bringen könne, obgleich dieser Moribundus männlichen Geschlechtes war. Er wünschte sehr, es zu tun; Blumen, fand er, gehörten dazu; der Streich mit der Hortensie, die violett und wohlgeformt gewesen war, hatte ihm ausnehmend gefallen; und so entschied er denn, daß Rotbeins Geschlecht durch seinen finalen Zustand ausgeglichen werde, und daß er, um Blumenspenden entgegenzunehmen, auch nicht Geburtstag zu haben brauche, da Sterbende ohne weiteres und in Permanenz wie Geburtstagskinder zu behandeln seien. So gesonnen, suchte er mit dem Vetter denn wieder die erdig-warme Duftatmosphäre des Blumengeschäftes auf und trat bei Herrn Rotbein mit einem frisch besprengten und duftenden Rosen-, Nelken- und Levkoiengebinde ein, geführt von Alfreda Schildknecht, die die jungen Leute gemeldet hatte.
Der Schwerkranke, kaum zwanzigjährig und dabei schon etwas kahl und grau auf dem Kopf, wächsern und abgezehrt, mit großen Händen, großer Nase und großen Ohren, zeigte sich zu Tränen dankbar für Zuspruch und Zerstreuung, – wirklich weinte er aus Schwäche etwas, als er die beiden begrüßte und das Bukett entgegennahm, kam dann aber, im Anschluß an dieses, sofort, wenn auch nur mit fast flüsternder Stimme, auf den europäischen Blumenhandel und seine immer noch zunehmende Schwunghaftigkeit zu sprechen, auf den gewaltigen Export der Gärtnereien von Nizza und Cannes, die Waggonladungen und Postsendungen, die von diesen Orten täglich nach allen Seiten ausgingen, auf die Engrosmärkte von Paris und Berlin und die Versorgung Rußlands. Denn er war Kaufmann, und in dieser Richtung lagen seine Interessen, solange er eben am Leben war. Sein Vater, der Koburger Puppenfabrikant, hatte ihn zu seiner Ausbildung nach England geschickt, so flüsterte er, und dort war er erkrankt. Man hatte aber sein fiebriges Leiden als typhös betrachtet und dementsprechend behandelt, das hieß: ihn auf Wassersuppendiät gesetzt, wodurch er so sehr heruntergekommen sei. Hier oben habe er essen dürfen, und er habe es getan: im Schweiße seines Angesichts habe er im Bette gesessen und sich zu nähren gesucht. Allein es sei zu spät gewesen, sein Darm sei leider in Mitleidenschaft gezogen, vergebens schicke man ihm von zu Hause Zunge und Spickaal, er vertrage nichts mehr. Nun sei sein Vater im Anreisen von Koburg, von Behrens telegraphisch berufen. Denn es solle ja nun ein entscheidender Eingriff, die Rippenresektion, bei ihm vorgenommen werden, man wolle es jedenfalls damit versuchen, obgleich die Chancen verschwindend seien. Rotbein flüsterte sehr sachlich hierüber und nahm auch die Frage der Operation durchaus von der geschäftlichen Seite, – solange er eben lebte, würde er die Dinge unter diesem Gesichtswinkel betrachten. Der Kostenpunkt, flüsterte er, sei, die Rückenmarksanästhesie mit eingerechnet, auf tausend Franken fixiert, denn so gut wie der ganze Brustkorb käme in Betracht, sechs bis acht Rippen, und es frage sich nun, ob das eine irgendwie lohnende Anlage sein werde. Behrens rede ihm zu, aber sein Interesse sei eindeutig, während das seine zweifelhaft scheine und man nicht wissen könne, ob er nicht klüger täte, ruhig mit seinen Rippen zu sterben.
Es war schwer, ihm zu raten. Die Vettern meinten, man müsse die hervorragende chirurgische Geschicklichkeit des Hofrats bei der Kalkulation in Anschlag bringen. Man kam überein, die Meinung des im Anrollen begriffenen alten Rotbein den Ausschlag geben zu lassen. Bei der Verabschiedung weinte der junge Fritz wieder etwas, und obgleich es nur aus Schwäche geschah, standen die Tränen, die er vergoß, in sonderbarem Gegensatz zu der trockenen Sachlichkeit seiner Denk- und Sprechweise. Er bat, die Herren möchten den Besuch wiederholen, und sie versprachen es bereitwillig, kamen aber nicht mehr dazu. Denn da abends der Puppenfabrikant eingetroffen, war man am nächsten Vormittag zur Operation geschritten, nach welcher der junge Fritz nicht mehr empfangsfähig gewesen war. Und zwei Tage später sah Hans Castorp im Vorbeigehen mit Joachim, daß in dem Rotbeinschen Zimmer gestöbert wurde. Schwester Alfreda hatte mit ihrem Köfferchen Haus Berghof schon verlassen, da sie eilig zu einem anderen Moribundus in einer anderen Anstalt bestellt worden war, und seufzend, ihr Kneiferband hinter dem Ohr, hatte sie sich zu ihm begeben, da dies eben die Perspektive war, die sich ihr einzig eröffnete.
Ein „verlassenes“, ein freigewordenes Zimmer, worin bei aufeinander getürmten Möbeln und offener Doppeltür gestöbert wurde, wie man bemerkte, wenn man auf dem Weg in den Speisesaal oder ins Freie daran vorüberkam, – war ein vielsagender, dabei aber so gewohnter Anblick, daß er einem kaum noch viel sagte, besonders wenn man selbst, seinerzeit, von einem soeben auf solche Art „freigewordenen“ und gestöberten Zimmer Besitz ergriffen hatte und darin heimisch geworden war. Zuweilen wußte man, wer auf der betreffenden Nummer gewohnt hatte, was dann immerhin zu denken gab: so diesmal und so auch acht Tage später, als Hans Castorp im Vorbeigehen das Zimmer der kleinen Gerngroß in demselben Zustand erblickte. In diesem Fall sträubte sein Verständnis sich beim ersten Augenschein gegen den Sinn der dort drinnen herrschenden Geschäftigkeit. Er stand und schaute, versonnen und betroffen, als eben der Hofrat des Weges kam.
„Ich stehe hier und sehe stöbern“, sagte Hans Castorp. „Guten Tag, Herr Hofrat. Die kleine Leila ...“
„Tja –“, antwortete Behrens und zuckte die Achseln. Nach einem Silentium, währenddessen diese Gebärde sich auswirkte, setzte er hinzu:
„Sie haben ihr ja schnell vor Torschluß noch ganz regulär den Hof gemacht? Gefällt mir von Ihnen, daß Sie sich meiner Lungenpfeiferchen in ihren Käfigen ein bißchen annehmen, relativ rüstig wie Sie persönlich sind. Hübscher Zug Ihrerseits, nee, nee, lassen wir das mal seine Richtigkeit haben, daß es ein ganz hübscher Zug ist in Ihrem Charakterbild. Soll ich Sie gelegentlich ein bißchen einführen dann und wann? Ich habe da noch allerlei Zeisige sitzen, – wenn es Sie interessiert. Jetzt gehe ich zum Beispiel auf einen Sprung zu meiner ‚Überfüllten‘. Kommen Sie mit? Ich stelle Sie einfach als teilnehmenden Leidensgenossen vor.“
Hans Castorp sagte, der Hofrat habe ihm das Wort vom Munde genommen und ihm genau das angeboten, um was er ihn eben habe bitten wollen. Dankbar mache er Gebrauch von der Erlaubnis und schließe sich an. Aber wer das denn sei, die „Überfüllte“, und wie er den Namen verstehen solle.
„Wörtlich“, sagte der Hofrat. „Ganz präzise und unmetaphorisch. Lassen Sie sichs von ihr selber erzählen.“ Mit wenigen Schritten waren sie am Zimmer der „Überfüllten“. Der Hofrat drang durch die Doppeltür, indem er seinem Begleiter zu warten befahl. Kurzatmig bedrängtes, aber helles und lustiges Lachen und Sprechen klang bei Behrens’ Eintritt aus dem Zimmer und ward dann abgesperrt. Aber auch dem teilnehmenden Besucher klang es wieder entgegen, als ihm einige Minuten später Einlaß gewährt wurde und Behrens ihn der im Bette liegenden blonden Dame vorstellte, die ihn aus blauen Augen neugierig betrachtete, – Kissen im Rücken, lag sie halb sitzend, in Unruhe, und lachte beständig perlend, ganz hoch und silberhell, indem sie nach Atem rang, erregt und gekitzelt, wie es schien, von ihrer Beklemmung. Auch über des Hofrats Redensarten lachte sie wohl, womit er ihr den Besucher präsentierte, rief dem Abgehenden vielmals Adieu und Schönen Dank und Auf Wiedersehn nach, indem sie mit der Hand hinter ihm drein winkte, seufzte klingend, lachte silberne Läufe, stemmte die Hände gegen die unter dem Batisthemd wogende Brust und konnte die Beine nicht ruhig halten. Sie hieß Frau Zimmermann.
Hans Castorp kannte sie flüchtig von Ansehen. Sie hatte einige Wochen lang am Tisch der Salomon und des gefräßigen Schülers gesessen und immer viel gelacht. Dann war sie verschwunden, ohne daß der junge Mann sich weiter darum gekümmert hätte. Sie mochte abgereist sein, hatte er gemeint, soweit er sich eine Meinung über ihr Unsichtbarwerden gebildet hatte. Nun fand er sie hier, unter dem Namen der „Überfüllten“, auf dessen Erklärung er wartete.
„Hahahaha“, perlte sie gekitzelt, mit fliegender Brust. „Furchtbar komischer Mann, dieser Behrens, fabelhaft komischer und amüsanter Mann, zum Schief- und Kranklachen. Setzen Sie sich doch, Herr Kasten, Herr Carsten, oder wie Sie heißen, Sie heißen so komisch, ha, ha, hi, hi, entschuldigen Sie! Setzen Sie sich auf den Stuhl da zu meinen Füßen, aber erlauben Sie, daß ich strample, ich kann es – ha...a“, seufzte sie offenen Mundes und perlte dann wieder, „ich kann es unmöglich lassen.“
Sie war nahezu hübsch, hatte klare, etwas zu ausgeprägte, aber angenehme Züge und ein kleines Doppelkinn. Aber ihre Lippen waren bläulich, und auch die Nasenspitze wies diese Tönung auf, zweifellos infolge Luftmangels. Ihre Hände, die von sympathischer Magerkeit waren, und die die Spitzenmanschetten des Nachthemdes gut kleideten, vermochten sich ebensowenig ruhig zu halten wie die Füße. Ihr Hals war mädchenhaft, mit „Salzfässern“ über den zarten Schlüsselbeinen, und auch die Brust, unter dem Linnen von Gelächter und Atemnot in unruhig knapper und ringender Bewegung gehalten, schien zart und jung. Hans Castorp beschloß, auch ihr schöne Blumen zu schicken oder zu bringen, aus den Exportgärtnereien von Nizza und Cannes, besprengte und duftende. Mit einiger Besorgnis stimmte er in Frau Zimmermanns fliegende und bedrängte Heiterkeit ein.
„Und Sie besuchen hier also die Hochgradigen?“ fragte sie. „Wie amüsant und freundlich von Ihnen, ha, ha, ha, ha! Denken Sie aber, ich bin gar nicht hochgradig, das heißt, ich war es eigentlich gar nicht, noch bis vor kurzem, nicht im geringsten ... Bis mir neulich diese Geschichte ... Hören Sie nur, ob es nicht das Komischste ist, was Ihnen in Ihrem ganzen Leben ...“ Und nach Luft ringend, unter Tirili und Trillern, erzählte sie ihm, was ihr zugestoßen war.
Ein wenig krank war sie heraufgekommen, – krank immerhin, denn sonst wäre sie nicht gekommen, nicht ganz leicht vielleicht sogar, aber eher leicht als schwer. Der Pneumothorax, diese noch junge und rasch zu großer Beliebtheit gelangte Errungenschaft der chirurgischen Technik, hatte sich auch in ihrem Falle glänzend bewährt. Der Eingriff war vollkommen gelungen, Frau Zimmermanns Zustand und Befinden machte die erfreulichsten Fortschritte, ihr Mann – denn sie war verheiratet, wenn auch kinderlos – durfte sie in drei bis vier Monaten zurückerwarten. Da machte sie, um sich zu amüsieren, einen Ausflug nach Zürich, – es lag kein anderer Grund vor für diese Reise als der des Amüsements. Sie hatte sich auch amüsiert nach Herzenslust, war aber dabei der Notwendigkeit innegeworden, sich auffüllen zu lassen und hatte mit diesem Geschäft einen dortigen Arzt betraut. Ein netter, komischer junger Mensch, hahaha, hahaha, aber was war geschehen? Er hatte sie überfüllt! Es gab keine andere Bezeichnung dafür, das Wort sagte alles. Er hatte es zu gut mit ihr gemeint, hatte die Sache wohl nicht so recht verstanden, und kurz und gut: in überfülltem Zustande, das heißt unter Herzbeklemmungen und Atemnot – ha! hihihi – war sie hier oben wieder eingetroffen und von Behrens, der mordsmäßig gewettert hatte, sofort ins Bett gesteckt worden. Denn nun sei sie schwerkrank, – nicht hochgradig eigentlich, aber verpfuscht, verpatzt, – hahaha, sein Gesicht, was er denn für ein komisches Gesicht mache? Und sie lachte, indem sie mit dem Finger hineindeutete, so sehr über dies Gesicht, daß nun auch ihre Stirn sich blau zu färben begann. Aber am allerkomischsten, sagte sie, sei Behrens mit seinem Gewetter und seiner Grobheit, – schon im voraus habe sie darüber lachen müssen, als sie gemerkt habe, daß sie überfüllt sei. „Sie schweben in absoluter Lebensgefahr“, habe er sie angeschrien ohne Umschweife und Einkleidung, so ein Bär, hahaha, hihihi, entschuldigen Sie.
Es blieb zweifelhaft, in welchem Sinn sie über des Hofrats Erklärung so perlend lachte, – ob nur ihrer „Grobheit“ wegen und weil sie nicht daran glaubte, oder obgleich sie daran glaubte – denn das mußte sie doch wohl tun –, aber die Sache selbst, das heißt die Lebensgefahr, in der sie schwebte, eben nur furchtbar komisch fand. Hans Castorp hatte den Eindruck, daß dies letztere zutreffe, und daß sie wirklich nur aus kindischem Leichtsinn und dem Unverstand ihres Vogelhirns perle, trillere und tiriliere, was er mißbilligte. Trotzdem schickte er ihr Blumen, sah aber auch die lachlustige Frau Zimmermann nicht wieder. Denn nachdem sie noch einige Tage lang unter Sauerstoff gehalten worden, war sie im Arm ihres telegraphisch herbeigerufenen Gatten denn richtig gestorben, – eine Gans in Folio, wie der Hofrat, von dem Hans Castorp es hörte, von sich aus hinzufügte.
Aber schon vorher hatte Hans Castorps teilnehmender Unternehmungsgeist mit Hilfe des Hofrats und des Pflegepersonals weitere Beziehungen zu den Schwerkranken des Hauses angeknüpft, und Joachim mußte mit. Er mußte mit zu dem Sohne von „Tous les deux“, dem zweiten, der noch übrig war, nachdem bei dem anderen nebenan schon längst gestöbert und mit H₂CO geräuchert worden. Ferner zu dem Knaben Teddy, der kürzlich aus dem „Fridericianum“ genannten Erziehungsinstitut, für das sein Fall zu schwer gewesen, heraufgekommen war. Ferner zu dem deutsch-russischen Versicherungsbeamten Anton Karlowitsch Ferge, einem gutmütigen Dulder. Ferner zu der unglückseligen und dabei so gefallsüchtigen Frau von Mallinckrodt, die ebenfalls Blumen bekam wie die Vorgenannten, und die von Hans Castorp in Joachims Gegenwart sogar mehrmals mit Brei gefüttert wurde ... Nachgerade gelangten sie in den Ruf von Samaritern und barmherzigen Brüdern. Auch redete Settembrini Hans Castorp eines Tages in diesem Sinne an.
„Sapperlot, Ingenieur, ich höre Auffälliges von Ihrem Wandel. Sie haben sich auf die Mildtätigkeit geworfen? Sie suchen Rechtfertigung durch gute Werke?“
„Nicht der Rede wert, Herr Settembrini. Gar nichts dabei, wovon es lohnte, Aufhebens zu machen. Mein Vetter und ich ...“
„Aber lassen Sie doch Ihren Vetter aus dem Spiel! Man hat es mit Ihnen zu tun, wenn Sie beide von sich reden machen, das ist gewiß. Der Leutnant ist eine respektable, aber einfache und geistig unbedrohte Natur, die dem Erzieher wenig Unruhe verursacht. Sie werden mich an seine Führerschaft nicht glauben machen. Der Bedeutendere, aber auch der Gefährdetere sind Sie. Sie sind, wenn ich mich so ausdrücken darf, ein Sorgenkind des Lebens, – man muß sich um Sie kümmern. Übrigens haben Sie mir erlaubt, mich um Sie zu kümmern.“
„Gewiß, Herr Settembrini. Ein für allemal. Sehr freundlich von Ihnen. Und ‚Sorgenkind des Lebens‘ ist hübsch. Worauf so ein Schriftsteller nicht gleich verfällt! Ich weiß nicht recht, ob ich mir etwas einbilden soll auf diesen Titel, aber hübsch klingt er, das muß ich sagen. Ja, und ich gebe mich nun also ein bißchen mit den ‚Kindern des Todes‘ ab, das ist es ja wohl, was Sie meinen. Ich sehe mich hie und da, wenn ich Zeit habe, ganz nebenbei, der Kurdienst leidet so gut wie gar nicht darunter, nach den Schweren und Ernsten um, verstehen Sie, die nicht zu ihrem Amüsement hier sind und es liederlich treiben, sondern die sterben.“
„Es steht jedoch geschrieben: Laßt die Toten ihre Toten begraben“, sagte der Italiener.
Hans Castorp hob die Arme und drückte mit seiner Miene aus, daß gar so manches geschrieben stehe, dies und auch wieder jenes, so daß es schwer sei, das Rechte herauszufinden und es zu befolgen. Selbstverständlich hatte der Drehorgelmann einen störenden Gesichtspunkt geltend gemacht, das war zu erwarten gewesen. Aber wenn auch Hans Castorp nach wie vor bereit war, ihm ein Ohr zu leihen, seine Lehren unverbindlicherweise hörenswert zu finden und sich zum Versuche pädagogisch beeinflussen zu lassen, so war er doch weit entfernt, um irgendwelcher erzieherischer Gesichtspunkte willen auf Unternehmungen zu verzichten, die ihm, trotz Mutter Gerngroß und ihrer Redensart vom „netten kleinen Flirt“, trotz auch dem nüchternen Wesen des armen Rotbein und dem törichten Tirili der Überfüllten, noch immer auf unbestimmte Art förderlich und von bedeutender Tragweite erschienen.
Der Sohn Tous-les-deux’ hieß Lauro. Er hatte Blumen erhalten, erdig duftende Nizzaveilchen, „von zwei teilnehmenden Hausgenossen, mit besten Genesungswünschen“, und da die Anonymität zur reinen Formsache geworden war und jedermann wußte, von wem diese Spenden ausgingen, so redete Tous-les-deux selbst, die schwarzbleiche Mutter aus Mexiko, bei einer Begegnung auf dem Korridor die Vettern dankend an, indem sie sie mit rasselnden Worten, hauptsächlich aber durch ein gramvoll einladendes Gebärdenspiel aufforderte, den Dank ihres Sohnes – de son seul et dernier fils qui allait mourir aussi – persönlich entgegenzunehmen. Das geschah auf der Stelle. Lauro erwies sich als ein erstaunlich schöner junger Mann mit Glutaugen, einer Adlernase, deren Nüstern flogen, und prachtvollen Lippen, über denen ein schwarzes Schnurrbärtchen sproßte, – zeigte dabei aber ein so prahlerisch-dramatisches Gebaren, daß die Besucher, Hans Castorp wirklich nicht weniger als Joachim Ziemßen, froh waren, als sich die Tür des Krankenzimmers wieder hinter ihnen schloß. Denn während Tous-les-deux in ihrem schwarzen Kaschmirtuch, den schwarzen Schleier unter dem Kinn geknotet, Querfalten auf ihrer engen Stirn und ungeheure Hautsäcke unter ihren jettschwarzen Augen, mit krummen Knien wandernd den Raum durchmaß, den einen Winkel ihres großen Mundes harmvoll tief hinabhängen ließ und dann und wann sich den am Bette Sitzenden näherte, um ihren tragischen Papageienspruch zu wiederholen: „Tous les dé, vous comprenez, messiés ... Premièrement l’un et maintenant l’autre“ – erging sich der schöne Lauro, ebenfalls auf französisch, in rollenden, rasselnden und unerträglich hochtrabenden Redereien, des Inhalts, daß er wie ein Held zu sterben gedenke, comme héros, à l’espagnol, gleich seinem Bruder, de même que son fier jeune frère Fernando, der ebenfalls wie ein spanischer Held gestorben sei, – gestikulierte, riß sich das Hemd auf, um den Streichen des Todes die gelbe Brust zu bieten, und betrug sich so fort, bis ein Hustenanfall, der ihm dünnen, rosafarbenen Schaum auf die Lippen trieb, seine Rodomontaden erstickte und die Vettern veranlaßte, auf den Zehenspitzen hinauszugehen.
Sie sprachen nicht weiter über den Besuch bei Lauro, und auch im stillen, jeder für sich, enthielten sie sich des Urteils über sein Gehaben. Besser aber gefiel es allen beiden bei Anton Karlowitsch Ferge aus Petersburg, der mit seinem großen gutmütigen Schnurrbart und seinem ebenfalls mit gutmütigem Ausdruck vorragenden Kehlkopf im Bette lag und sich nur langsam und schwer von dem Versuch erholte, den Pneumothorax bei sich herstellen zu lassen, was ihm, Herrn Ferge, um ein Haar auf der Stelle das Leben gekostet hätte. Er hatte einen heftigen Chok dabei erlitten, den Pleurachok, als Zwischenfall bekannt bei diesem modischen Eingriff. Bei ihm aber war der Pleurachok in ausnehmend gefährlicher Form, als vollständiger Kollaps und bedenklichste Ohnmacht, mit einem Worte so schwer aufgetreten, daß man die Operation hatte unterbrechen und vorläufig vertagen müssen.
Herrn Ferges gutmütige graue Augen erweiterten sich, und sein Gesicht wurde fahl, sooft er auf den Vorgang zu sprechen kam, der für ihn grauenhaft gewesen sein mußte. „Ohne Narkose, meine Herren. Gut, unsereiner verträgt das nicht, es verbietet sich in diesem Fall, man begreift und findet sich als vernünftiger Mensch in die Sache. Aber das Örtliche reicht nicht tief, meine Herren, nur das äußere Fleisch macht es stumpf, man spürt, wenn man aufgemacht wird, allerdings nur ein Drücken und Quetschen. Ich liege mit zugedecktem Gesicht, damit ich nichts sehe, und der Assistent hält mich rechts und die Oberin links. Es ist so, als ob ich gedrückt und gequetscht würde, das ist das Fleisch, das geöffnet und mit Klammern zurückgezwängt wird. Aber da höre ich den Herrn Hofrat sagen: ‚So!‘ und in dem Augenblick, meine Herren, fängt er an, mit einem stumpfen Instrument – es muß stumpf sein, damit es nicht vorzeitig durchsticht – das Rippenfell abzutasten: er tastet es ab, um die rechte Stelle zu finden, wo er durchstechen und das Gas einlassen kann, und wie er das tut, wie er mit dem Instrument auf meinem Rippenfell herumfährt, – meine Herren, meine Herren! da war es um mich geschehen, es war aus mit mir, es erging mir ganz unbeschreiblich. Das Rippenfell, meine Herren, das soll nicht berührt werden, das darf und will nicht berührt werden, das ist tabu, das ist mit Fleisch zugedeckt, isoliert und unnahbar, ein für allemal. Und nun hatte er es bloßgelegt und tastete es ab. Meine Herren, da wurde mir übel. Entsetzlich, entsetzlich, meine Herren, – nie hätte ich gedacht, daß so ein siebenmal scheußliches und hundsföttisch gemeines Gefühl auf Erden und abgesehen von der Hölle überhaupt vorkomme! Ich fiel in Ohnmacht, – in drei Ohnmachten auf einmal, eine grüne, eine braune und eine violette. Außerdem stank es in dieser Ohnmacht, der Pleurachok warf sich mir auf den Geruchsinn, meine Herren, es roch über alle Maßen nach Schwefelwasserstoff, wie es in der Hölle riechen muß, und bei alldem hörte ich mich lachen, während ich abschnappte, aber nicht wie ein Mensch lacht, sondern das war die unanständigste und ekelhafteste Lache, die ich in meinem Leben je gehört habe, denn das Abgetastetwerden des Rippenfells, meine Herren, das ist ja, als ob man auf die allerinfamste, übertriebenste und unmenschlichste Weise gekitzelt würde, so und nicht anders ist es mit dieser verdammten Schande und Qual, und das ist der Pleurachok, den der liebe Gott Ihnen erspare.“
Oft und nicht anders als mit fahlem Grauen kam Anton Karlowitsch Ferge auf dies „hundsföttische“ Erlebnis zurück und ängstigte sich nicht wenig vor seiner Wiederholung. Übrigens hatte er sich von vornherein als einen einfachen Menschen bekannt, dem alles „Hohe“ vollständig fernliege und an den man besondere Ansprüche geistiger und gemütlicher Art nicht stellen dürfe, wie auch er solche Ansprüche an niemanden stelle. Dies vereinbart, erzählte er gar nicht uninteressant von seinem früheren Leben, aus dem die Krankheit ihn dann geworfen, dem Leben eines Reisenden im Dienst einer Feuerversicherungsgesellschaft: von Petersburg aus hatte er in weitläufigen Kreuz- und Querfahrten durch ganz Rußland die assekurierten Fabriken besucht und die wirtschaftlich zweifelhaften auszukundschaften gehabt; denn es sei statistisch, daß in den gerade schlecht gehenden Industrien die meisten Fabrikbrände vorkämen. Darum sei er denn ausgesandt worden, um unter diesem und jenem Vorwande einen Betrieb zu sondieren und seiner Bank Bericht zu erstatten, damit zu rechter Zeit durch verstärkte Rückversicherung oder Prämienteilung empfindlichem Verlust habe vorgebeugt werden können. Von winterlichen Reisen durch das weite Reich erzählte er, von Fahrten die Nächte hindurch bei ungeheuerem Frost, im Liegeschlitten, unter Schaffelldecken, und wie er erwachend die Augen der Wölfe gleich Sternen über dem Schnee habe glühen sehen. Gefrorenen Proviant, so Kohlsuppe wie Weißbrot, hatte er im Kasten mit sich geführt, die an den Stationen, beim Pferdewechsel, zum Genusse aufgetaut worden waren, wobei sich das Brot als frisch wie am ersten Tage erwiesen hatte. Und schlimm nur, wenn unterwegs plötzlich Tauwetter eingefallen war: dann war ihm die in Stücken mitgenommene Kohlsuppe ausgelaufen.
In dieser Weise erzählte Herr Ferge, indem er sich hin und wieder seufzend mit der Bemerkung unterbrach, das sei alles recht schön, aber wenn nur nicht noch einmal der Versuch mit dem Pneumothorax bei ihm gemacht werden müsse. Es war nichts Höheres, was er vorbrachte, aber faktischer Natur und ganz gut zu hören, besonders für Hans Castorp, dem es förderlich schien, vom russischen Reich und seinem Lebensstil zu vernehmen, von Samowaren, Piroggen, Kosaken und hölzernen Kirchen mit so vielen Zwiebelturmköpfen, daß sie Pilzkolonien glichen. Auch von der dortigen Menschenart, ihrer nördlichen und darum in seinen Augen desto abenteuerlicheren Exotik, ließ er Herrn Ferge erzählen, von dem asiatischen Einschuß ihres Geblütes, den vortretenden Backenknochen, dem finnisch-mongolischen Augensitz, und lauschte mit anthropologischem Anteil, ließ sich auch Russisch vorsprechen, – rasch, verwaschen, wildfremd und knochenlos ging das östliche Idiom unter Herrn Ferges gutmütigem Schnurrbart, aus seinem gutmütig vorstehenden Kehlkopf hervor –, und desto besser (wie einmal die Jugend ist) fand sich Hans Castorp von alldem unterhalten, als es pädagogisch verbotenes Gebiet war, auf dem er sich tummelte.
Sie sprachen öfters auf eine Viertelstunde bei Anton Karlowitsch Ferge vor. Dazwischen besuchten sie den Knaben Teddy aus dem „Fridericianum“, einen eleganten Vierzehnjährigen, blond und fein, mit Privatpflegerin und in weißseidenem, verschnürtem Pyjama. Er war Waise und reich, wie er selbst erzählte. In Erwartung eines tieferen operativen Eingriffs, der Entfernung wurmstichiger Teile, womit man es probieren wollte, verließ er, wenn er sich besser fühlte, zuweilen auf eine Stunde sein Bett, um sich in seinem hübschen Sportanzug an der unteren Geselligkeit zu beteiligen. Die Damen schäkerten gern mit ihm, und er hörte ihren Gesprächen zu, zum Beispiel denen, die sich mit Rechtsanwalt Einhuf, dem Fräulein in der Reformhose und Fränzchen Oberdank beschäftigten. Dann legte er sich wieder. So lebte der Knabe Teddy elegant in den Tag hinein, indem er durchblicken ließ, daß er vom Leben nichts anderes mehr, als eben immer nur dies, erwarte.
Aber auf Nummer fünfzig lag Frau von Mallinckrodt, Natalie mit Vornamen, mit schwarzen Augen und goldenen Ringen in den Ohren, kokett, putzsüchtig und dabei ein weiblicher Lazarus und Hiob, von Gott mit jederlei Bresthaftigkeit geschlagen. Ihr Organismus schien mit Giftstoffen überschwemmt, so daß alle möglichen Krankheiten sie abwechselnd und gleichzeitig heimsuchten. Sehr in Mitleidenschaft gezogen war ihr Hautorgan, das zu großen Teilen von einem qualvoll juckenden, da und dort wunden Ekzem überzogen war, auch am Munde, woraus der Einführung des Löffels Schwierigkeiten erwuchsen. Innere Entzündungen, solche des Rippenfells, der Nieren, der Lungen, der Knochenhäute und selbst des Hirns, so daß Bewußtlosigkeit einfiel, lösten einander ab bei Frau von Mallinckrodt, und Herzschwäche, hervorgerufen durch Fieber und Schmerzen, schuf ihr große Ängste, bewirkte zum Beispiel, daß sie beim Schlucken das Essen nicht ordentlich hinunterbrachte: gleich oben in der Speiseröhre blieb es ihr stecken. Kurzum, die Frau war gräßlich daran und außerdem ganz allein in der Welt; denn nachdem sie Mann und Kinder um eines anderen Mannes, das heißt eines halben Knaben, willen verlassen, war sie ihrerseits von ihrem Geliebten verlassen worden, wie die Vettern von ihr selbst erfuhren, und war nun heimatlos, wenn auch nicht ohne Mittel, da der Ehemann sie mit solchen versah. Sie machte ohne unangebrachten Stolz von seiner Anständigkeit oder seiner fortdauernden Verliebtheit Gebrauch, da sie sich selber nicht ernst nahm, sondern einsah, daß sie nur ein ehrloses, sündhaftes Weibchen war, und trug denn auf dieser Basis alle ihre Hiobsplagen mit erstaunlicher Geduld und Zähigkeit, der elementaren Widerstandskraft ihrer Rasse-Weiblichkeit, die über das Elend ihres bräunlichen Körpers triumphierte und noch aus dem weißen Gazeverband, den sie aus irgendeinem schlimmen Grunde um den Kopf tragen mußte, ein kleidsames Kostümstück machte. Beständig wechselte sie den Schmuck, begann in der Frühe mit Korallen und endete abends mit Perlen. Erfreut durch Hans Castorps Blumensendung, der sie offensichtlich eine mehr galante als charitative Bedeutung beilegte, ließ sie die jungen Herren zum Tee an ihr Lager bitten, den sie aus einer Schnabeltasse trank, die Finger ohne Ausnahme der Daumen und bis zu den Gelenken mit Opalen, Amethysten und Smaragden bedeckt. Bald, während die goldenen Ringe an ihren Ohren schaukelten, hatte sie den Vettern erzählt, wie alles sich mit ihr zugetragen: von ihrem anständigen, aber langweiligen Mann, ihren ebenfalls anständigen und langweiligen Kindern, die ganz dem Vater nacharteten und für die sie sich niemals sonderlich hatte erwärmen können, und von dem halben Knaben, mit dem sie das Weite gesucht und dessen poetische Zärtlichkeit sie sehr zu rühmen wußte. Aber seine Verwandten hätten ihn mit List und Gewalt von ihr losgemacht, und dann habe sich der Kleine auch wohl vor ihrer Krankheit geekelt, die damals vielfältig und stürmisch zum Ausbruch gekommen. Ob die Herren sich etwa auch ekelten, fragte sie kokettierend; und ihre Rasse-Weiblichkeit triumphierte über das Ekzem, das ihr das halbe Gesicht überzog.
Hans Castorp dachte geringschätzig über den Kleinen, der sich geekelt hatte, und gab dieser Empfindung auch durch ein Achselzucken Ausdruck. Was ihn betraf, so ließ er sich den Weichmut des poetischen Halbknaben zum Ansporn in entgegengesetzter Richtung dienen, und nahm Gelegenheit, der unglückseligen Frau von Mallinckrodt bei wiederholten Besuchen kleine Pflegerdienste zu leisten, zu denen keine Vorkenntnisse gehörten, das heißt: ihr behutsam den Mittagsbrei einzuführen, wenn er eben serviert wurde, ihr aus der Schnabeltasse zu trinken zu geben, wenn der Bissen ihr steckenblieb, oder ihr beim Umlagern im Bette behilflich zu sein; denn zu allem übrigen erschwerte eine Operationswunde ihr auch das Liegen. In diesen Handreichungen übte er sich, wenn er auf dem Wege zum Speisesaal oder von einem Spaziergange heimkehrend bei ihr einsprach, indem er Joachim aufforderte, immer voranzugehen, er wolle nur rasch den Fall auf Nummer fünfzig ein bißchen kontrollieren, – und empfand eine beglückende Ausdehnung seines Wesens dabei, eine Freude, die auf dem Gefühl von der Förderlichkeit und heimlichen Tragweite seines Tuns beruhte, sich übrigens auch mit einem gewissen diebischen Vergnügen an dem untadelig christlichen Gepräge dieses Tuns und Treibens mischte, einem so frommen, milden und lobenswerten Gepräge in der Tat, daß weder vom militärischen noch vom humanistisch-pädagogischen Standpunkte irgend etwas Ernstliches dagegen erinnert werden konnte.
Von Karen Karstedt war noch nicht die Rede, und doch nahmen Hans Castorp und Joachim sich ihrer sogar besonders an. Sie war eine auswärtige Privatpatientin des Hofrats, von ihm der Charität der Vettern empfohlen. Seit vier Jahren hier oben, war die Mittellose von harten Verwandten abhängig, die sie schon einmal, da sie doch sterben müsse, von hier fortgenommen und nur auf Einspruch des Hofrats wieder heraufgeschickt hatten. Sie domizilierte im „Dorf“, in einer billigen Pension, – neunzehnjährig und schmächtig, mit glattem, geöltem Haar, Augen, die zaghaft einen Glanz zu verbergen suchten, der mit der hektischen Erhöhung ihrer Wangen übereinstimmte, und einer charakteristisch belegten, dabei aber sympathisch lautenden Stimme. Sie hustete fast ohne Unterbrechung, und ihre sämtlichen Fingerspitzen waren verpflastert, da sie infolge der Vergiftung offen waren.
Ihr also widmeten die beiden auf Fürbitte des Hofrats, da sie nun einmal so gutherzige Kerle seien, sich ganz besonders. Mit einer Blumensendung begann es, dann folgte ein Besuch bei der armen Karen auf ihrem kleinen Balkon in „Dorf“ und hierauf diese und jene außerordentliche Unternehmung zu dritt: die Besichtigung einer Eislaufkonkurrenz, eines Bobsleighrennens. Denn es war nun die Wintersport-Jahreszeit unseres Hochtales auf voller Höhe, eine Festwoche wurde begangen, die Veranstaltungen häuften sich, diese Lustbarkeiten und Schauspiele, denen die Vettern bisher keine andere als nur eine gelegentlich-flüchtige Aufmerksamkeit geschenkt hatten. Joachim war ja allen Zerstreuungen hier oben abhold. Nicht um solcher willen war er hier, – war überhaupt nicht hier, um zu leben und sich mit dem Aufenthalt abzufinden, indem er ihn angenehm und abwechslungsreich gestaltete, sondern einzig und ganz allein, um sich möglichst rasch zu entgiften, damit er in der Ebene Dienst machen könne, wirklichen Dienst statt des Kurdienstes, der ein Ersatzmittel war, aber an dem er einen Raub nur widerwillig duldete. Sich tätig an der Winterlust zu beteiligen, war ihm verboten, und den Gaffer zu spielen, hatte ihm mißfallen. Was aber Hans Castorp betraf, so fühlte er sich zu sehr, in einem zu strengen und intimen Verstande, als Mitglied Derer hier oben, um Sinn und Blick zu haben für das Treiben von Leuten, die in diesem Tale ein Sportgelände sahen.
Die charitative Teilnahme nun aber für das arme Fräulein Karstedt brachte hierin einige Änderung hervor, – ohne unchristlich zu erscheinen, konnte Joachim keine Einwände dagegen erheben. Sie holten die Kranke aus ihrer dürftigen Wohnung in „Dorf“ und führten sie bei prächtig heiß durchsonntem Frostwetter durch das nach dem Hotel d’Angleterre genannte Englische Viertel, zwischen den Luxusläden der Hauptstraße hin, auf der Schlitten läuteten, reiche Genießer und Tagediebe aus aller Welt, Bewohner des Kurhauses und der anderen großen Hotels, barhaupt in modischem Sportdreß aus edlen und teueren Stoffen, mit Gesichtern, bronziert von Wintersonnenbrand und Schneestrahlung, sich ergingen, und hinab auf den nicht weit vom Kurhause in der Tiefe des Tales gelegenen Eisplatz, der im Sommer eine zum Fußballspiel benutzte Wiese gewesen. Musik erscholl; die Kurkapelle konzertierte auf der Empore des hölzernen Pavillongebäudes zu Häupten der viereckig gestreckten Bahn, hinter welchem die verschneiten Berge im Dunkelblauen standen. Sie nahmen Einlaß, drängten sich durch das Publikum, das von drei Seiten, auf ansteigenden Sitzen, die Bahn umgab, fanden Plätze und schauten. Die Kunstläufer, in knapper Tracht, schwarzen Trikots, Pelzwerk an den Tressenjacken, wiegten sich, schwebten, zogen Figuren, sprangen und kreiselten. Ein virtuoses Paar, Herr und Dame, Professionals und außer Konkurrenz, vollführte etwas in der ganzen Welt nur von ihm Vermochtes, entfesselte Tusch und Händeklatschen. Im Kampf um den Schnelligkeitspreis arbeiteten sich sechs junge Männer verschiedener Nationalität, gebückt, die Hände auf dem Rücken, zuweilen das Taschentuch vor dem Munde, sechsmal um das weite Viereck. Man läutete mit einer Glocke in die Musik hinein. Zuweilen brandete die Menge in anfeuernden Zurufen und Beifall auf.
Es war eine bunte Versammlung, in der die drei Kranken, die Vettern und ihr Schützling sich umsahen. Engländer mit schottischen Mützen und weißen Zähnen sprachen Französisch mit penetrant duftenden Damen, die von oben bis unten in bunte Wolle gekleidet waren, und von denen einige in Hosen gingen. Kleinköpfige Amerikaner, das Haar glatt angeklebt, die Shagpfeife im Munde, trugen Pelze, deren Rauhseite nach außen gekehrt war. Russen, bärtig und elegant, barbarisch reichen Ansehens, und Holländer von malaischem Kreuzungstyp saßen zwischen deutschem und schweizerischem Publikum, während allerlei Unbestimmtes, französisch Redendes, vom Balkan oder der Levante, abenteuerliche Welt, für die Hans Castorp eine gewisse Schwäche an den Tag legte, und die von Joachim als zweideutig und charakterlos abgelehnt wurde, überall eingesprengt war. Kinder konkurrierten zwischendurch in scherzhaften Aufgaben, stolperten über die Bahn, am einen Fuß einen Schnee-, am anderen einen Schlittschuh, oder indem die Knaben ihre Dämchen auf Schaufeln vor sich her schoben. Sie liefen mit brennenden Kerzen, wobei Sieger war, wer sein Licht, noch brennend, zum Ziele trug, mußten im Laufe Hindernisse überklettern oder Kartoffeln mit Zinnlöffeln in aufgestellte Gießkannen lesen. Die große Welt jubelte. Man zeigte sich die reichsten, berühmtesten und anmutigsten unter den Kindern, das Töchterchen eines holländischen Multimillionärs, den Sohn eines preußischen Prinzen und einen Zwölfjährigen, der den Namen einer weltbekannten Champagnerfirma trug. Die arme Karen jubelte ebenfalls und hustete dabei. Sie klatschte vor Freude in ihre Hände mit den offenen Fingerspitzen. Sie war so dankbar.
Auch zum Bobsleighrennen führten die Vettern sie: es war nicht weit zum Ziel, weder vom „Berghof“ noch auch von Karen Karstedts Wohnung, denn die Bahn, von der Schatzalp herunterkommend, endete in „Dorf“ zwischen den Siedelungen des westlichen Hanges. Ein Kontrollhäuschen war dort errichtet, wohin die Abfahrt eines jeden Gefährts vom Start telephonisch gemeldet wurde. Zwischen den vereisten Schneebarrieren, auf den metallisch glänzenden Kurven der Bahn steuerten die flachen Gerüste, bemannt mit Männern und Frauen in weißer Wolle, Schärpen in allerlei Landesfarben um die Brust, einzeln, in größeren Abständen, aus der Höhe daher. Man sah rote, angestrengte Gesichter, in die es hineinschneite. Stürze, Schlitten, die aneckten, sich überschlugen und ihre Mannschaft in den Schnee entleerten, wurden vom Publikum photographiert. Musik spielte auch hier. Die Zuschauer saßen auf kleinen Tribünen oder schoben sich auf dem schmalen Gehpfade hin, der neben der Bahn geschaufelt war. Holzbrücken, über die er später führte, die die Bahn überspannten, und unter denen von Zeit zu Zeit ein konkurrierender Bobsleigh dahinsauste, waren ebenfalls mit Menschen besetzt. Die Leichen des Sanatoriums droben nahmen den gleichen Weg, im Saus unter den Brücken dahin, die Kurven hinab, zu Tale, zu Tale, dachte Hans Castorp und sprach auch davon.
Selbst ins Bioskop-Theater von „Platz“ führten sie Karen Karstedt eines Nachmittags, da sie das alles so sehr genoß. In der schlechten Luft, die alle drei physisch stark befremdete, da sie nur das Reinste gewohnt waren, sich ihnen schwer auf die Brust legte und einen trüben Nebel in ihren Köpfen erzeugte, flirrte eine Menge Leben, kleingehackt, kurzweilig und beeilt, in aufspringender, zappelnd verweilender und wegzuckender Unruhe, zu einer kleinen Musik, die ihre gegenwärtige Zeitgliederung auf die Erscheinungsflucht der Vergangenheit anwandte und bei beschränkten Mitteln alle Register der Feierlichkeit und des Pompes, der Leidenschaft, Wildheit und girrenden Sinnlichkeit zu ziehen wußte, auf der Leinwand vor ihren schmerzenden Augen vorüber. Es war eine aufgeregte Liebes- und Mordgeschichte, die sie sahen, stumm sich abhaspelnd am Hofe eines orientalischen Despoten, gejagte Vorgänge voll Pracht und Nacktheit, voll Herrscherbrunst und religiöser Wut der Unterwürfigkeit, voll Grausamkeit, Begierde, tödlicher Lust und von verweilender Anschaulichkeit, wenn es die Muskulatur von Henkersarmen zu besichtigen galt, – kurz, hergestellt aus sympathetischer Vertrautheit mit den geheimen Wünschen der zuschauenden internationalen Zivilisation. Settembrini, als Mann des Urteils, hätte die humanitätswidrige Darbietung wohl scharf verneinen, mit gerader und klassischer Ironie den Mißbrauch der Technik zur Belebung so menschenverächterischer Vorstellungen geißeln müssen, dachte sich Hans Castorp und flüsterte dergleichen seinem Vetter auch zu. Frau Stöhr dagegen, die ebenfalls anwesend war und nicht weit von den Dreien saß, erschien ganz Hingabe; ihr rotes, ungebildetes Gesicht war im Genusse verzerrt.
Übrigens verhielt es sich ähnlich mit allen Gesichtern, in die man blickte. Wenn aber das letzte Flimmerbild einer Szenenfolge wegzuckte, im Saale das Licht aufging und das Feld der Visionen als leere Tafel vor der Menge stand, so konnte es nicht einmal Beifall geben. Niemand war da, dem man durch Applaus hätte danken, den man für seine Kunstleistung hätte hervorrufen können. Die Schauspieler, die sich zu dem Spiele, das man genossen, zusammengefunden, waren längst in alle Winde zerstoben; nur die Schattenbilder ihrer Produktion hatte man gesehen, Millionen Bilder und kürzeste Fixierungen, in die man ihr Handeln aufnehmend zerlegt hatte, um es beliebig oft, zu rasch blinzelndem Ablauf, dem Elemente der Zeit zurückzugeben. Das Schweigen der Menge nach der Illusion hatte etwas Nervloses und Widerwärtiges. Die Hände lagen ohnmächtig vor dem Nichts. Man rieb sich die Augen, stierte vor sich hin, schämte sich der Helligkeit und verlangte zurück ins Dunkel, um wieder zu schauen, um Dinge, die ihre Zeit gehabt, in frische Zeit verpflanzt und aufgeschminkt mit Musik, sich wieder begeben zu sehen.
Der Despot starb unter dem Messer, mit einem Gebrüll aus offenem Munde, das man nicht hörte. Man sah dann Bilder aus aller Welt: den Präsidenten der französischen Republik in Zylinder und Großkordon, vom Sitze des Landauers auf eine Begrüßungsansprache erwidernd; den Vizekönig von Indien bei der Hochzeit eines Radscha; den deutschen Kronprinzen auf einem Kasernenhofe zu Potsdam. Man sah das Leben und Treiben in einem Eingeborenendorf von Neumecklenburg, einen Hahnenkampf auf Borneo, nackte Wilde, die auf Nasenflöten bliesen, das Einfangen wilder Elefanten, eine Zeremonie am siamesischen Königshof, eine Bordellstraße in Japan, wo Geishas hinter hölzernen Käfiggittern saßen. Man sah vermummte Samojeden im Renntierschlitten durch eine nordasiatische Schneeöde kutschieren, russische Pilger zu Hebron anbeten, an einem persischen Delinquenten die Bastonade vollziehen. Man war zugegen bei alldem; der Raum war vernichtet, die Zeit zurückgestellt, das Dort und Damals in ein huschendes, gaukelndes, von Musik umspieltes Hier und Jetzt verwandelt. Ein junges marokkanisches Weib, in gestreifter Seide, aufgeschirrt mit Ketten, Spangen und Ringen, die strotzende Brust halb entblößt, ward plötzlich in Lebensgröße angenähert. Ihre Nüstern waren breit, ihre Augen voll tierischen Lebens, ihre Züge in Bewegung; sie lachte mit weißen Zähnen, hielt eine ihrer Hände, deren Nägel heller schienen, als das Fleisch, als Schirm über die Augen und winkte mit der anderen ins Publikum. Man starrte verlegen in das Gesicht des reizvollen Schattens, der zu sehen schien und nicht sah, der von den Blicken gar nicht berührt wurde, und dessen Lachen und Winken nicht die Gegenwart meinte, sondern im Dort und Damals zu Hause war, so daß es sinnlos gewesen wäre, es zu erwidern. Dies mischte, wie gesagt, der Lust ein Gefühl der Ohnmacht bei. Dann verschwand das Phantom. Leere Helligkeit überzog die Tafel, das Wort „Ende“ ward darauf geworfen, der Zyklus der Darbietungen hatte sich geschlossen, und stumm räumte man das Theater, während von außen neues Publikum hereindrängte, das eine Wiederholung des Ablaufs zu genießen begehrte.
Ermuntert durch Frau Stöhr, die sich ihnen anschloß, besuchte man hierauf noch, der armen Karen zu Gefallen, die vor Dankbarkeit die Hände gefaltet hielt, das Café des Kurhauses. Auch hier gab es Musik. Ein kleines, rotbefracktes Orchester spielte unter der Führung eines tschechischen oder ungarischen Primgeigers, der, von der Truppe gelöst, zwischen tanzenden Paaren stand und unter feurigen Körperwindungen sein Instrument bearbeitete. Mondänes Leben herrschte an den Tischen. Es wurden seltene Getränke herumgetragen. Die Vettern bestellten Orangeade zur Kühlung für sich und ihren Schützling, denn es war heiß und staubig, während Frau Stöhr süßen Schnaps zu sich nahm. Um diese Stunde, sagte sie, sei es mit dem Betriebe hier noch nicht völlig das Rechte. Der Tanz belebe sich noch bedeutend bei vorrückendem Abend; zahlreiche Patienten der diversen Heilanstalten und wildlebende Kranke aus den Hotels und dem Kurhause selbst, viel mehr noch, als jetzt, beteiligten sich später daran, und schon manche Hochgradige sei hier in die Ewigkeit hinübergetanzt, indem sie den Becher der Lebenslust gekippt und den finalen Blutsturz in dulci jubilo erlitten habe. Was Frau Stöhrs große Unbildung aus dem „dulci jubilo“ machte, war ganz außerordentlich; das erste Wort entlehnte sie dem italienisch-musikalischen Vokabular ihres Gatten und sprach also „dolce“, das zweite aber erinnerte an Feuerjo, Jubeljahr oder Gott wußte woran, – die Vettern schnappten gleichzeitig nach den Strohhalmen in ihren Gläsern, als dieses Latein in Kraft trat, doch focht das die Stöhr nicht an. Vielmehr suchte sie auf dem Wege der Anspielungen und Sticheleien, die Hasenzähne störrisch entblößt, dem Verhältnis der drei jungen Leute auf den Grund zu kommen, der ihr ganz deutlich nur war, soweit die arme Karen in Frage stand, welcher es, so sagte Frau Stöhr, wohl passen mochte, bei ihrem leichten Wandel von zwei so flotten Rittern zugleich chaperoniert zu werden. Weniger klar erschien ihr der Fall von seiten der Vettern aus gesehen; aber bei aller Dummheit und Unbildung verhalf die Intuition ihrer Weiblichkeit ihr doch zu einiger Einsicht, wenn auch nur zu einer halben und ordinären. Denn sie verstand und gab dem stichelnderweise Ausdruck, daß hier der wahre und eigentliche Ritter Hans Castorp sei, während der junge Ziemßen bloß assistiere, und daß Hans Castorp, dessen innere Richtung gegen Frau Chauchat ihr bekannt war, die kümmerliche Karstedt nur ersatzweise chaperonierte, da er sich jener anderen offenbar nicht zu nähern wußte, – eine Einsicht, Frau Stöhrs nur zu würdig und ganz ohne sittliche Tiefe, sehr unzulänglich und von ordinärer Intuition, weshalb Hans Castorp denn auch nur mit einem müden und verächtlichen Blick darauf erwiderte, als sie sie platt-neckisch zu erkennen gab. Denn allerdings bedeutete ihm der Verkehr mit der armen Karen eine Art von Ersatz- und unbestimmt förderlichem Hilfsmittel, wie alle seine charitativen Unternehmungen ihm dergleichen bedeuteten. Aber zugleich waren sie doch auch Zweck ihrer selbst, diese frommen Unternehmungen, und die Zufriedenheit, die er empfand, wenn er die bresthafte Mallinckrodt mit Brei fütterte, sich von Herrn Ferge den infernalischen Pleurachok beschreiben ließ oder die arme Karen vor Freude und Dankbarkeit in die Hände mit den verpflasterten Fingerspitzen klatschen sah, war, wenn auch von übertragener und beziehungsvoller, so doch zugleich auch von unmittelbarer und reiner Art; sie entstammte einem Bildungsgeiste, entgegengesetzt demjenigen, den Herr Settembrini pädagogisch vertrat, indessen wohl wert, das Placet experiri darauf anzuwenden, wie es dem jungen Hans Castorp schien.
Das Häuschen, worin Karen Karstedt wohnte, lag unweit des Wasserlaufs und des Bahngeleises an dem gegen „Dorf“ führenden Wege, und so hatten die Vettern es bequem, sie abzuholen, wenn sie sie nach dem Frühstück auf ihren dienstlichen Lustwandel mitnehmen wollten. Gingen sie so gegen Dorf, um die Hauptpromenade zu gewinnen, so sahen sie vor sich das kleine Schiahorn, dann weiter rechts drei Zinken, welche die Grünen Türme hießen, jetzt aber ebenfalls unter blendend besonntem Schnee lagen, und noch weiter rechts die Kuppe des Dorfberges. Auf Viertelhöhe seiner Wand sah man den Friedhof liegen, den Friedhof von „Dorf“, von einer Mauer umgeben und offenbar mit schönem Blick, vermutlich auf den See, weshalb er als Zielpunkt eines Spazierganges wohl ins Auge zu fassen war. Sie wanderten denn auch einmal hinauf, die drei, an einem schönen Vormittag, – und alle Tage waren nun schön: windstill und sonnig, tiefblau, heiß-frostig und glitzerweiß. Die Vettern, der eine ziegelrot im Gesicht, der andere bronziert, gingen im baren Anzug, da Mäntel lästig gewesen wären in diesem Sonnenprall, – der junge Ziemßen in Sportdreß mit Gummischneeschuhen, Hans Castorp gleichfalls in solchen, aber in langen Hosen, da er nicht körperlich genug gesinnt war, um kurze zu tragen. Es war zwischen Anfang und Mitte Februar, im neuen Jahre. Ganz recht, die Jahreszahl hatte gewechselt, seitdem Hans Castorp heraufgekommen; man schrieb eine andere jetzt, die nächste. Ein großer Zeiger der Weltzeitenuhr war um eine Einheit weiter gefallen: nicht gerade einer der allergrößten, nicht etwa der, welcher die Jahrtausende maß, – sehr wenige, die lebten, würden das noch erleben; auch der nicht, der die Jahrhunderte anmerkte oder nur die Jahrzehnte, das nicht. Der Jahreszeiger aber war kürzlich gefallen, obgleich Hans Castorp ja noch kein Jahr, sondern erst wenig mehr als ein halbes, hier oben war, und stand nun fest nach Art der nur von fünf zu fünf Minuten fallenden Minutenzeiger gewisser großer Uhren, bis er wieder vorrücken würde. Bis dahin aber mußte der Monatszeiger noch zehnmal vorrücken, ein paarmal öfter, als er es getan, seitdem Hans Castorp hier oben war, – den Februar zählte er nicht mehr mit, denn angebrochen war abgetan, gleichwie gewechselt so gut wie ausgegeben.
Auch zu dem Friedhof am Dorfberge also gingen die drei einmal spazieren, – exakter Rechenschaft halber sei auch dieser Ausflug noch angeführt. Die Anregung dazu war von Hans Castorp ausgegangen, und Joachim hatte wohl anfangs der armen Karen wegen Bedenken gehabt, dann aber eingesehen und zugegeben, daß es zwecklos gewesen wäre, mit ihr Verstecken zu spielen und sie im Sinne der feigen Stöhr vor allem, was an den exitus erinnerte, ängstlich zu bewahren. Karen Karstedt gab sich noch nicht den Selbsttäuschungen des letzten Stadiums hin, sondern wußte Bescheid, wie es mit ihr stand und was es mit der Nekrose ihrer Fingerspitzen auf sich hatte. Sie wußte ferner, daß ihre harten Verwandten vom Luxus des Heimtransportes kaum würden etwas wissen wollen, sondern daß ihr nach dem Exitus ein bescheidenes Plätzchen dort oben zum Quartier würde angewiesen werden. Und kurz, man konnte wohl finden, daß dieses Wanderziel moralisch passender für sie war, als manches andere, zum Beispiel der Bobstart oder das Kino, – wie es denn übrigens nicht mehr als ein anständiger Akt der Kameradschaft war, Denen dort oben einmal einen Besuch zu machen, gesetzt, daß man den Friedhof nicht einfach als Sehenswürdigkeit und neutrales Spaziergebiet betrachten wollte.
Im Gänsemarsch gingen sie langsam hinauf, denn der geschaufelte Pfad gestattete nur ein einzelnes Gehen, ließen die letzten, an der Lehne zuhöchst gelegenen Villen hinter und unter sich und sahen im Steigen das vertraute Landschaftsbild in seiner Winterpracht sich wieder einmal perspektivisch ein wenig verschieben und öffnen: es weitete sich nach Nordost, gegen den Taleingang, der erwartete Blick auf den See tat sich auf, dessen umwaldetes Rund zugefroren und mit Schnee bedeckt war, und hinter seinem fernsten Ufer schienen Bergschrägen sich am Boden zu treffen, hinter denen fremde Gipfel, verschneit, einander vor dem Himmelsblau überhöhten. Sie sahen das an, im Schnee vor dem steinernen Tore stehend, das den Eingang zum Friedhof bildete, und betraten die Stätte dann durch die eiserne Gittertür, die dem Steintore eingefügt und nur angelehnt war.
Auch hier fanden sie Pfade geschaufelt, die zwischen den umgitterten, schneebepolsterten Gräbererhöhungen, diesen wohl und ebenmäßig aufgemachten Bettlagern mit ihren Kreuzen aus Stein und Metall, ihren kleinen, medaillon- und inschriftgeschmückten Monumenten dahinführten; doch ließ kein Mensch sich sehen noch hören. Die Stille, Abgeschiedenheit, Ungestörtheit des Ortes schien tief und heimlich in mancherlei Sinn; ein kleiner steinerner Engel oder Puttengott, der, eine Schneemütze etwas schief auf dem Köpfchen, irgendwo im Gebüsche stand und mit dem Finger die Lippen schloß, mochte wohl als sein Genius gelten, – will sagen: als der des Schweigens, und zwar eines Schweigens, das man sehr stark als Gegenteil und Widerspiel des Redens, als Verstummen also, keineswegs aber als inhaltsleer und ereignislos empfand. Für die beiden männlichen Gäste wäre es wohl eine Gelegenheit gewesen, die Hüte abzunehmen, wenn sie welche aufgehabt hätten. Aber sie waren ja barhaupt, auch Hans Castorp war es, und so gingen sie denn nur in ehrerbietiger Haltung, das Körpergewicht auf die Fußballen legend und gleichsam mit kleinen Verbeugungen nach rechts und links, im Gänsemarsch hinter Karen Karstedt her, die sie führte.
Der Friedhof war unregelmäßig in der Form, erstreckte sich anfänglich als schmales Rechteck gegen Süden und lud dann ebenfalls rechteckig nach beiden Seiten aus. Ersichtlich hatte mehrfach Vergrößerung sich als notwendig erwiesen und war Acker angestückt worden. Trotzdem schien das Gehege auch gegenwärtig wieder so gut wie voll belegt, und zwar entlang der Mauer sowohl wie auch in seinen inneren, minder bevorzugten Teilen, – kaum war zu sehen und zu sagen, wo allenfalls noch ein Unterkommen darin gewesen wäre. Die drei Auswärtigen wanderten längere Zeit diskret in den schmalen Gehrinnen und Passagen zwischen den Mälern umher, indem sie dann und wann stehenblieben, um einen Namen nebst Geburts- und Sterbedatum zu entziffern. Die Denksteine und Kreuze waren anspruchslos, bekundeten wenig Aufwand. Was ihre Inschriften betraf, so stammten die Namen aus allen Winden und Welten, sie lauteten englisch, russisch oder doch allgemein slawisch, auch deutsch, portugiesisch und anderswie; die Daten aber trugen zartes Gepräge, ihre Spannweite war im ganzen auffallend gering, der Jahresabstand zwischen Geburt und Exitus betrug überall ungefähr zwanzig und nicht viel mehr, fast lauter Jugend und keine Tugend bevölkerte das Lager, ungefestigtes Volk, das sich aus aller Welt hier zusammengefunden hatte und zur horizontalen Daseinsform endgültig eingekehrt war.
Irgendwo tief im Gedränge der Ruhelager, im Inneren des Angers, gegen die Mitte zu, gab es ein flaches Plätzchen von Menschenlänge, eben und unbelegt, zwischen zwei aufgebetteten, um deren Steine Dauerkränze gehängt waren, und unwillkürlich blieben die drei Besucher davor stehen. Sie standen, das Fräulein etwas vor ihren Begleitern, und lasen die zarten Angaben der Steine, – Hans Castorp gelöst, die Hände vor sich gekreuzt, mit offenem Munde und schläfrigen Augen, der junge Ziemßen geschlossen und nicht nur gerade, sondern sogar ein wenig nach hinten abgeneigt, – worauf die Vettern mit gleichzeitiger Neugier von den Seiten verstohlen in Karen Karstedts Miene blickten. Sie merkte es dennoch und stand da, verschämt und bescheiden, den Kopf ein wenig schräg vorgeschoben, und lächelte geziert mit gespitzten Lippen, wobei sie rasch mit den Augen blinzelte.
Sieben Monate waren es in den nächsten Tagen, daß der junge Hans Castorp hier oben verweilte, während Vetter Joachim, der deren fünf auf dem Buckel gehabt hatte, als jener eingetroffen war, nun auf zwölfe zurückblickte, auf ein Jährchen also – ein rundes Jahr, – rund in dem kosmischen Sinn, daß, seit die kleine, zugkräftige Lokomotive ihn hier abgesetzt, die Erde einmal ihren Sonnenumlauf beendet hatte und zu dem Punkte von damals zurückgekehrt war. Es war Faschingszeit. Fastnacht stand vor der Tür, und Hans Castorp erkundigte sich bei dem Jährigen, wie das denn sei.
„Magnifik!“ antwortete Settembrini, dem die Vettern wieder einmal bei der Vormittagsmotion begegnet waren. „Splendide!“ antwortete er. „Das ist so lustig wie im Prater, Sie werden sehen, Ingenieur. Dann sind wir gleich im Reihen hier die glänzenden Galanten“, sprach er, und fuhr dann prallen Mundes zu medisieren fort, indem er seine Hechelreden mit gelungenen Arm-, Kopf- und Schulterbewegungen begleitete: „Was wollen Sie, auch in der maison de santé finden bisweilen ja Bälle statt, für die Narren und Blöden, wie ich gelesen habe, – warum nicht auch hier? Das Programm umfaßt die verschiedensten danses macabres, wie Sie sich denken können. Leider kann ein gewisser Teil der vorjährigen Festteilnehmer diesmal nicht erscheinen, da das Fest schon um 9½ Uhr sein Ende findet ...“
„Sie meinen ... Ach so, vorzüglich!“ lachte Hans Castorp. „Sind Sie ein Witzbold –! ‚Um 9½‘, – hast dus gehört, du? Allzu früh nämlich, als daß ‚ein gewisser Teil‘ der Vorjährigen noch ein Stündchen teilnehmen könnte, meint Herr Settembrini. Ha, ha, unheimlich. Das ist nämlich der Teil, der dem ‚Fleisch‘ unterdessen schon endgültig valet gesagt hat. Verstehst du mein Wortspiel? Aber da bin ich denn doch gespannt“, sagte er. „Ich finde es richtig, daß wir hier so die Feste feiern, wie sie fallen, und auf die übliche Art die Etappen markieren, die Einschnitte also, damit es kein ungegliedertes Einerlei gibt, das wäre zu sonderbar. Da haben wir Weihnachten gehabt und wußten, daß Neujahr war, und nun kommt also Fastnacht. Dann rückt Palmsonntag heran (gibt es hier Kringel?), die Karwoche, Ostern und Pfingsten, was sechs Wochen später ist, und dann ist ja bald schon der längste Tag, Sommersonnenwende, verstehen Sie, und es geht auf den Herbst ...“
„Halt! halt! halt!“, rief Settembrini, indem er das Gesicht gen Himmel hob und die Handteller gegen die Schläfen preßte. „Schweigen Sie! Ich verbiete Ihnen, sich in dieser Weise die Zügel schießen zu lassen!“
„Entschuldigen Sie, ich sage ja im Gegenteil ... Übrigens wird Behrens sich am Ende nun doch wohl zu den Injektionen entschließen, um meine Entgiftung zu erzielen, denn ich habe unentwegt siebenunddreißig-vier, -fünf, -sechs und auch -sieben. Das will sich nicht ändern. Ich bin und bleibe nun mal ein Sorgenkind des Lebens. Langfristig bin ich ja nicht, Radamanth hat mir nie was Bestimmtes aufgebrummt, aber er sagt, es wäre sinnlos, die Kur vor der Zeit zu unterbrechen, wo ich nun doch schon so lange hier oben bin und soviel Zeit investiert habe, sozusagen. Was nützte es auch, wenn er mir einen Termin setzte? Das hätte nicht viel zu bedeuten, denn wenn er zum Beispiel sagt: ein halbes Jährchen, so ist es sehr knapp gerechnet, man muß sich auf mehr gefaßt machen. Das sieht man an meinem Vetter, der sollte Anfang des Monats fertig sein – fertig im Sinne von ausgeheilt –, aber das letztemal hat Behrens ihm vier Monate zugelegt, zu seiner völligen Ausheilung, – na, und was haben wir dann? Dann haben wir Sommersonnenwende, wie ich sagte, ohne daß ich Sie reizen wollte, und es geht wieder auf den Winter zu. Aber für den Augenblick haben wir nun freilich erst einmal Fastnacht, – Sie hören ja, ich finde es gut und schön, daß wir hier alles der Reihe nach, und wie’s im Kalender steht, begehen. Frau Stöhr sagte, daß es in der Conciergeloge Kindertrompeten zu kaufen gibt?“
Das traf zu. Schon beim ersten Frühstück am Faschingsdienstag, der sofort da war, ehe man ihn von weitem nur recht ins Auge gefaßt, – schon in der Frühe gab es im Speisesaal allerlei Töne aus scherzhaften Blasinstrumenten, schnarrend und tutend; beim Mittagessen flogen vom Tische Gänsers, Rasmussens und der Kleefeld bereits Papierschlangen, und mehrere Personen, zum Beispiel die rundäugige Marusja, trugen papierne Kopfbedeckungen, die ebenfalls bei dem Hinkenden vorn in der Loge zu kaufen waren; aber abends entfaltete sich im Saal und in den Konversationsräumen eine Festgeselligkeit, die in ihrem Verlauf ... Nur wir wissen vorderhand, wozu, dank Hans Castorps Unternehmungsgeist, diese Fastnachtsgeselligkeit in ihrem Verlaufe führte. Aber wir lassen uns durch unser Wissen nicht hin- und nicht aus unserer Bedächtigkeit reißen, sondern geben der Zeit die Ehre, die ihr gebührt, und überstürzen nichts, – vielleicht sogar zögern wir die Ereignisse hin, weil wir die sittliche Scheu des jungen Hans Castorp teilen, die den Eintritt dieser Ereignisse so lange hintangehalten hatte.
Allgemein war man nachmittags nach „Platz“ gepilgert, um das Faschingsstraßenleben zu sehen. Masken waren unterwegs gewesen, Pierrotten und Harlekine, die klappernde Pritschen gehandhabt hatten, und zwischen den Fußgängern und den ebenfalls maskierten Insassen der vorüberläutenden, geschmückten Schlitten waren Konfetti-Scharmützel geliefert worden. Schon sehr hochgestimmt fand man sich zur Abendmahlzeit an den sieben Tischen ein, entschlossen, den öffentlichen Geist in geschlossenem Kreise fortzupflegen. Die Papiermützen, Schnarren und Tuten des Concierge hatten starken Abgang gefunden, und Staatsanwalt Paravant hatte mit weiterer Travestierung den Anfang gemacht, indem er einen Damenkimono und einen falschen, laut vielseitigem Zuruf, der Generalkonsulin Wurmbrandt gehörigen Zopf angelegt, auch seinen Schnurrbart mit einem Brenneisen schräg nach unten gezogen hatte und so wirklich aufs Haar einem Chinesen glich. Die Verwaltung war nicht zurückgestanden. Sie hatte jeden der sieben Tische mit einem Papierlampion geschmückt, einem farbigen Mond mit brennender Kerze im Inneren, so daß Settembrini beim Eintritt in den Saal, an Hans Castorps Tische vorbeistreifend, einen auf diese Illumination bezüglichen Dichterspruch zitierte:
„Da sieh nur, welche bunten Flammen!
Es ist ein muntrer Klub beisammen“,
äußerte er mit feinem und trockenem Lächeln, indem er zu seinem Platze weiterschlenderte, um dort mit kleinen Wurfgeschossen empfangen zu werden, dünnwandigen und mit einer wohlriechenden Flüssigkeit gefüllten Kügelchen, die beim Anprall zerbrachen und den Getroffenen mit Parfüm überschütteten.
Kurzum, die Festlaune war von Anfang an sehr ausgesprochen. Gelächter herrschte, Papierschlangen, von den Kronleuchtern herabhängend, wehten im Luftzuge hin und her, in der Bratensauce schwammen Konfetti, bald sah man die Zwergin mit dem ersten Eiskübel, der ersten Champagnerflasche geschäftig vorübereilen, man mischte den Sekt mit Burgunder, wozu Rechtsanwalt Einhuf das Signal gegeben, und als nun gar gegen Ende der Mahlzeit das Deckenlicht ausging und nur noch die Lampions den Speisesaal mit buntem Dämmer italienisch-nächtig erleuchteten, war die Stimmung vollkommen, und es erregte am Tische Hans Castorps viel Zustimmung, als Settembrini einen Zettel herübersandte (er händigte ihn der ihm zunächstsitzenden, mit einer Jockei-Mütze aus grünem Seidenpapier geschmückten Marusja ein), auf den er mit Bleistift geschrieben hatte:
„Allein bedenkt! Der Berg ist heute zaubertoll,
Und wenn ein Irrlicht Euch die Wege weisen soll,
So müßt Ihr’s so genau nicht nehmen.“
Doktor Blumenkohl, dem es eben wieder sehr schlecht ging, murmelte mit jenem ihm eigentümlichen Gesichts- oder eigentlich Lippenausdruck etwas vor sich hin, woraus man entnehmen konnte, was das für Verse seien. Hans Castorp seinerseits meinte die Antwort nicht schuldig bleiben zu dürfen, fühlte sich scherzhaft verpflichtet, eine Replik auf den Zettel zu schreiben, die freilich nur höchst unbedeutend hätte ausfallen können. Er suchte in seinen Taschen nach einem Bleistift, fand aber keinen und konnte auch von Joachim und der Lehrerin keinen erhalten. Seine rot geäderten Augen gingen nach Aushilfe gen Osten, in den links-rückwärtigen Winkel des Saales, und man sah, wie sein flüchtiges Vorhaben in so weitläufigen Assoziationen ausartete, daß er erbleichte und seine Grundabsicht überhaupt vergaß.
Zum Erbleichen gab es Gründe auch sonst. Frau Chauchat dort hinten hatte zur Fastnacht Toilette gemacht, sie trug ein neues Kleid, jedenfalls ein Kleid, das Hans Castorp noch nicht an ihr gesehen, – aus leichter und dunkler, ja schwarzer, nur manchmal ein wenig goldbräunlich aufschimmernder Seide, das am Halse einen mädchenhaft kleinen Rundausschnitt zeigte, kaum so tief, daß die Kehle, der Ansatz der Schlüsselbeine und hinten die bei leicht vorgeschobener Kopfhaltung etwas heraustretenden Genickwirbel unter dem lockeren Nackenhaar sichtbar blieben, das aber Clawdias Arme bis zu den Schultern hinauf frei ließ, – ihre Arme, die zart und voll waren zugleich, – kühl dabei, aller Mutmaßung nach, und außerordentlich weiß gegen die seidige Dunkelheit des Kleides abstachen, auf eine so erschütternde Art, daß Hans Castorp, die Augen schließend, in sich hineinflüsterte: „Mein Gott!“ – Er hatte diese Art Kleiderschnitt noch nie gesehen. Er kannte Balltoiletten, festlich statthafte, ja vorschriftsmäßige Enthüllungen, die weit umfassender gewesen waren als diese hier, ohne im entferntesten so sensationell zu wirken. Als Irrtum erwies sich vor allem die ältere Annahme des armen Hans Castorp, daß die Lockung, die vernunftwidrige Lockung dieser Arme, deren Bekanntschaft er durch dünne Gaze hindurch bereits gemacht hatte, ohne eine so ahndevolle „Verklärung“, wie er es damals genannt, sich vielleicht als weniger tief erweisen werde. Irrtum! Verhängnisvolle Selbsttäuschung! Die volle, hochbetonte und blendende Nacktheit dieser herrlichen Glieder eines giftkranken Organismus war ein Ereignis, weit stärker sich erweisend, als die Verklärung von damals, eine Erscheinung, auf die es keine andere Antwort gab, als den Kopf zu senken und lautlos zu wiederholen: „Mein Gott!“
Etwas später kam noch ein Zettel, auf dem es hieß:
„Gesellschaft, wie man wünschen kann.
Wahrhaftig, lauter Bräute!
Und Junggesellen Mann für Mann,
Die hoffnungsvollsten Leute!“
„Bravo, bravo!“ wurde gerufen. Man war schon beim Mokka, der in kleinen irden-braunen Kännchen serviert wurde, beziehungsweise auch bei den Likören, zum Beispiel Frau Stöhr, die Süß-Geistiges für ihr Leben gern schlürfte. Die Gesellschaft begann sich aufzulösen, zu zirkulieren. Man besuchte einander, wechselte die Tische. Ein Teil der Gäste hatte sich schon in die Konversationsräume verzogen, während ein anderer seßhaft blieb, dem Weingemisch weiter zusprechend. Settembrini kam nun persönlich herüber, sein Kaffeetäßchen in der Hand, den Zahnstocher zwischen den Lippen, und setzte sich hospitierend an die Tischecke zwischen Hans Castorp und die Lehrerin.
„Harzgebirg“, sagte er. „Gegend von Schierke und Elend. Habe ich Ihnen zu viel versprochen, Ingenieur? Heiß ich mir das doch eine Messe! Aber warten Sie nur, unser Witz erschöpft sich nicht so bald, wir sind noch nicht auf der Höhe, geschweige am Ende. Nach allem, was man hört, wird es noch mehr Masken geben. Gewisse Personen haben sich zurückgezogen, – das berechtigt zu allerlei Erwartungen, Sie werden sehen.“
Wirklich tauchten neue Verkleidungen auf: Damen in Herrentracht, operettenhaft und unwahrscheinlich durch ausladende Formen, die Gesichter bärtig geschwärzt mit angekohltem Flaschenkork; Herren, umgekehrt, die Frauenroben angelegt hatten, über deren Röcke sie strauchelten, wie zum Beispiel Studiosus Rasmussen, welcher, in schwarzer, jettübersäter Toilette, ein pickliges Dekolleté zur Schau stellte, das er sich mit einem Papierfächer kühlte, und zwar auch den Rücken. Ein Bettelmann erschien knickbeinig, an einer Krücke hängend. Jemand hatte sich aus weißem Unterzeug und einem Damenfilz ein Pierrotkostüm hergestellt, das Gesicht gepudert, so daß seine Augen ein unnatürliches Aussehen gewannen, und den Mund mit Lippenpomade blutig aufgehöht. Es war der Junge mit dem Fingernagel. Ein Grieche vom Schlechten Russentisch, mit schönen Beinen, stolzierte in lila Trikotunterhosen, mit Mäntelchen, Papierkrause und einem Stockdegen als spanischer Grande oder Märchenprinz daher. Alle diese Masken waren nach Schluß der Mahlzeit eilig improvisiert worden. Es litt Frau Stöhr nicht länger auf ihrem Stuhl. Sie verschwand, um nach kurzer Zeit als Scheuerweib wiederzukehren, mit geschürztem Rock und aufgestülpten Ärmeln, die Bänder ihrer Papierhaube unter dem Kinn geknotet und bewaffnet mit Eimer und Besen, die sie zu handhaben begann, indem sie mit dem nassen Schrubber unter die Tische, den Sitzenden zwischen die Füße fuhr.
„Die alte Baubo kommt allein“,
rezitierte Settembrini bei ihrem Anblick und fügte auch den Reimvers hinzu, klar und plastisch. Sie hörte es, nannte ihn „welscher Hahn“ und forderte ihn auf, seine „Zötchen“ für sich zu behalten, wobei sie ihn im Geiste der Maskenfreiheit duzte; denn diese Verkehrsform war schon während des Essens allgemein aufgenommen worden. Er schickte sich an, ihr zu antworten, als Lärm und Gelächter von der Halle her ihn unterbrachen und Aufsehen im Saal erregten.
Gefolgt von Gästen, die aus den Konversationsräumen kamen, hielten zwei sonderbare Figuren ihren Einzug, die mit der Kostümierung wohl eben erst fertig geworden waren. Die eine war als Diakonissin angezogen, doch war ihr schwarzes Habit vom Hals bis zum Saume mit weißen Bandstreifen quer benäht, kurzen, die nahe untereinander lagen, und seltneren, die über jene hinausragten, nach Art der Liniatur eines Thermometers. Sie hielt den Zeigefinger vor ihren bleichen Mund und trug in der Rechten eine Fiebertabelle. Die andere Maske erschien blau in Blau: mit blau gefärbten Lippen und Brauen, auch sonst im Gesicht und am Halse noch blau bemalt, eine blaue Wollmütze schief übers Ohr gezogen und bekleidet mit einem An- oder Überzuge aus blauem Glanzleinen, der, aus einem Stück gearbeitet, an den Knöcheln mit Bändern zugezogen und in der Mitte zum Rundbauche ausgestopft war. Man erkannte Frau Iltis und Herrn Albin. Beide trugen Pappschilder umgehängt, auf denen geschrieben stand: „Die stumme Schwester“ und: „Der blaue Heinrich“. In einer Art Wackelschritt zogen sie selbander um den Saal.
Das gab einen Beifall! Die Zurufe schwirrten. Frau Stöhr, ihren Besen unter dem Arm, die Hände auf den Knien, lachte maßlos und ordinär nach Herzenslust, unter Vorwendung ihrer Rolle als Scheuerweib. Nur Settembrini zeigte sich unzugänglich. Seine Lippen, unter dem schön geschwungenen Schnurrbart, wurden äußerst schmal, nachdem er einen kurzen Blick auf das erfolgreiche Maskenpaar geworfen.
Unter denen, die im Gefolge des Blauen und der Stummen aus den Konversationszimmern wieder herübergekommen waren, befand sich auch Clawdia Chauchat. Zusammen mit der wollhaarigen Tamara und jenem Tischgenossen mit dem konkaven Brustkasten, einem gewissen Buligin, der Abendanzug trug, strich sie in ihrem neuen Kleid an Hans Castorps Tische vorbei und bewegte sich schräg hinüber zu dem des jungen Gänser und der Kleefeld, wo sie, die Hände auf dem Rücken, mit schmalen Augen lachend und plaudernd stehen blieb, während ihre Begleiter den allegorischen Gespenstern weiter folgten und mit ihnen den Saal wieder verließen. Auch Frau Chauchat hatte sich mit einer Faschingsmütze geschmückt, – es war nicht einmal eine gekaufte, sondern von der Art, wie man sie Kindern anfertigt, aus weißem Papiere einfach zum Dreispitz zurechtgefaltet, und kleidete sie übrigens, quer aufgesetzt, vorzüglich. Das dunkelgoldbraune Seidenkleid war fußfrei, der Rock etwas bauschig gearbeitet. Wir sagen von den Armen hier nichts mehr. Sie waren nackt bis zu den Schultern hinauf.
„Betrachte sie genau!“ hörte Hans Castorp Herrn Settembrini wie von weitem sagen, während er ihr, die bald weiterging, gegen die Glastür, zum Saal hinaus, mit den Blicken folgte. „Lilith ist das.“
„Wer?“ fragte Hans Castorp.
Der Literat freute sich. Er replizierte:
„Adams erste Frau. Nimm dich in acht ...“
Außer ihnen beiden saß nur noch Dr. Blumenkohl am Tische, an seinem entfernten Platz. Die übrige Speisegesellschaft, auch Joachim, war in die Konversationsräume übergesiedelt. Hans Castorp sagte:
„Du steckst heute voller Poesie und Versen. Was ist nun das wieder für eine Lilli? War Adam also zweimal verheiratet? Ich hatte keine Ahnung ...“
„Die hebräische Sage will es so. Diese Lilith ist zum Nachtspuk geworden, gefährlich für junge Männer besonders durch ihre schönen Haare.“
„Pfui Teufel! Ein Nachtspuk mit schönen Haaren. So etwas kannst du nicht leiden, was? Da kommst du und drehst das elektrische Licht an, sozusagen, um die jungen Männer auf den rechten Weg zu bringen, – tust du das nicht?“ sagte Hans Castorp phantastisch. Er hatte ziemlich viel von der Weinmischung getrunken.
„Hören Sie, Ingenieur, lassen Sie das!“ befahl Settembrini mit zusammengezogenen Brauen. „Bedienen Sie sich der im gebildeten Abendlande üblichen Form der Anrede, der dritten Person pluralis, wenn ich bitten darf! Es steht Ihnen gar nicht zu Gesicht, worin Sie sich da versuchen.“
„Aber wieso? Wir haben Karneval! Es ist allgemein akzeptiert heute abend ...“
„Ja, um eines ungesitteten Reizes willen. Das ‚Du‘ unter Fremden, das heißt unter Personen, die einander von Rechtes wegen ‚Sie‘ nennen, ist eine widerwärtige Wildheit, ein Spiel mit dem Urstande, ein liederliches Spiel, das ich verabscheue, weil es sich im Grunde gegen Zivilisation und entwickelte Menschlichkeit richtet, – sich frech und schamlos dagegen richtet. Ich habe Sie auch nicht ‚Du‘ genannt, bilden Sie sich das nicht ein! Ich zitierte eine Stelle aus dem Meisterwerk Ihrer Nationalliteratur. Ich sprach also poetischerweise ...“
„Ich auch! Ich spreche auch gewissermaßen poetischerweise, – weil mir der Augenblick danach angetan zu sein scheint, darum spreche ich so. Ich sage gar nicht, daß es mir so ganz natürlich ist und leicht fällt, dich ‚Du‘ zu nennen, im Gegenteil, es kostet mich eine gewisse Selbstüberwindung, ich muß mir einen Ruck geben, um es zu tun, aber diesen Ruck gebe ich mir gern, ich gebe ihn mir freudig und von Herzen ...“
„Von Herzen?“
„Von Herzen, ja, das kannst du mir glauben. Wir sind nun schon so lange beieinander hier oben, – sieben Monate, wenn du nachrechnest; das ist ja für unsere Verhältnisse hier oben noch nicht einmal sehr viel, aber für untere Begriffe, wenn ich zurückdenke, ist es doch eine Menge Zeit. Nun, und die haben wir nun miteinander verbracht, weil das Leben uns hier zusammenführte, und haben uns fast täglich gesehen und interessante Gespräche miteinander geführt, zum Teil über Gegenstände, von denen ich unten überhaupt keinen Deut begriffen hätte. Aber hier sehr wohl; hier waren sie mir sehr wichtig und naheliegend, so daß ich immer, wenn wir diskutierten, in höchstem Grade bei der Sache war. Oder vielmehr, wenn du mir die Dinge als homo humanus expliziertest; denn ich hatte natürlich aus meiner bisherigen Unerfahrenheit nicht viel beizutragen und konnte immer nur außerordentlich hörenswert finden, was du sagtest. Durch dich habe ich so viel erfahren und verstanden ... Das mit Carducci war das Wenigste, aber wie beispielsweise die Republik mit dem schönen Stil zusammenhängt oder die Zeit mit dem Menschheitsfortschritt, – wohingegen, wenn keine Zeit wäre, auch kein Menschheitsfortschritt sein könnte, sondern die Welt nur ein stagnierendes Wasserloch und ein fauliger Tümpel wäre, – was wüßte ich davon, wenn du nicht gewesen wärst! Ich nenne dich einfach ‚Du‘ und rede dich sonst nicht weiter an, entschuldige, weil ich nicht wüßte, wie das geschehen sollte, – ich kann es nicht gut. Da sitzest du, und ich sage einfach ‚Du‘ zu dir, das genügt. Du bist nicht irgend ein Mensch mit einem Namen, du bist ein Vertreter, Herr Settembrini, ein Vertreter hierorts und an meiner Seite, – das bist du“, bestätigte Hans Castorp und schlug mit der flachen Hand auf das Tischtuch. „Und nun will ich dir einmal danken,“ fuhr er fort und schob seinen Glasbecher mit Sekt und Burgunder an Herrn Settembrinis Kaffeetäßchen heran, gleichsam, um auf dem Tisch mit ihm anzustoßen, – „dafür, daß du dich in diesen sieben Monaten so freundlich meiner angenommen hast und mir jungem mulus, auf den so viel Neues eindrang, zur Hand gegangen bist bei meinen Übungen und Experimenten und berichtigend auf mich einzuwirken gesucht hast, ganz sine pecunia, teils mit Geschichten und teils in abstrakter Form. Ich habe das deutliche Gefühl, daß der Augenblick gekommen ist, dir dafür und für all das zu danken und dich um Verzeihung zu bitten, wenn ich ein schlechter Schüler war, ein ‚Sorgenkind des Lebens‘, wie du sagtest. Es hat mich sehr gerührt, wie du das sagtest, und jedesmal, wenn ich daran denke, rührt es mich wieder. Ein Sorgenkind, das war ich wohl auch für dich und deine pädagogische Ader, auf die du damals gleich am ersten Tage zu sprechen kamst, – natürlich, das ist auch einer von den Zusammenhängen, die du mich gelehrt hast, der von Humanismus und Pädagogik, – es würden mir mit der Zeit gewiß noch mehrere einfallen. Verzeih mir also und denke meiner nicht im Bösen! Dein Wohl, Herr Settembrini, sollst leben! Ich leere mein Glas zu Ehren deiner literarischen Anstrengungen zur Ausmerzung der menschlichen Leiden!“ schloß er, trank, hintenüber geneigt, mit ein paar großen Schlucken sein Weingemisch aus und stand auf. „Nun wollen wir zu den anderen hinübergehn.“
„Hören Sie, Ingenieur, was ist Ihnen in die Krone gefahren?“ sagte der Italiener, die Augen voller Erstaunen, und verließ gleichfalls den Tisch. „Das klingt wie Abschied ...“
„Nein, warum Abschied?“ wich Hans Castorp aus. Er wich nicht nur figürlich aus, mit seinen Worten, sondern auch körperlich, indem er mit dem Oberkörper einen Bogen beschrieb, und hielt sich an die Lehrerin, Fräulein Engelhart, die eben kam, sie zu holen. Der Hofrat verzapfe im Klavierzimmer mit eigener Hand einen Fastnachtspunsch, den die Verwaltung gestiftet habe, meldete sie. Die Herren, sagte sie, möchten gleich kommen, wenn sie auch noch ein Glas zu erwischen wünschten. So gingen sie hinüber.
Wirklich stand dort drinnen, umdrängt von der Gästeschaft, die ihm kleine Henkelgläser entgegenhielt, Hofrat Behrens an dem runden Tisch in der Mitte, der weiß gedeckt war, und hob mit einem Schöpflöffel dampfendes Getränk aus einer Terrine. Auch er hatte sein Äußeres ein wenig karnevalistisch aufgemuntert, indem er nämlich zu dem klinischen Kittel, den er auch heute trug, da seine Tätigkeit ja niemals ruhte, einen echten türkischen Fez, karminrot, mit schwarzer Troddel, die ihm über das Ohr baumelte, aufgesetzt hatte, – Kostüm genug für ihn, dies beides zusammen; es reichte hin, seine ohnehin markante Erscheinung ins durchaus Wunderliche und Ausgelassene zu steigern. Der weiße Langkittel übertrieb des Hofrats Größe; brachte man die Nackenbeugung in Anschlag, indem man sie in Gedanken beseitigte und seine Gestalt zur vollen Höhe aufrichtete, so erschien er geradezu überlebensgroß, mit kleinem, buntem Kopf von eigentümlichstem Gepräge. Dem jungen Hans Castorp wenigstens war dies Gesicht noch nie so sonderbar vorgekommen, wie heute unter der närrischen Bedeckung: diese stutznäsig flache und bläulich hitzige Physiognomie, in der unter weißblonden Brauen die blauen Augen tränend quollen und über dem bogenförmigen, nach oben sich bäumenden Mund das helle und schief geschürzte Schnurrbärtchen stand. Abgeneigt von dem Dampfe, der vor ihm aus der Terrine wirbelte, ließ er das braune Getränk, einen zuckerigen Arrak-Punsch, im Bogen aus der Schöpfkelle in die dargereichten Gläser rinnen, unaufhörlich in seinem aufgeräumten Kauderwelsch sich ergehend, sodaß Lachsalven rund um den Tisch den Ausschank begleiteten.
„Herr Urian sitzt oben auf“, erläuterte Settembrini leise mit einer Handbewegung gegen den Hofrat und wurde dann nach Hans Castorps Seite fortgezogen. Auch Dr. Krokowski war anwesend. Klein, stämmig und kernig, sein schwarzes Lüsterhemd mit leeren Ärmeln um die Schultern gehängt, sodaß es dominoartig wirkte, hielt er sein Glas mit gedrehter Hand in Augenhöhe und plauderte fröhlich mit einer Gruppe von Masken travestierten Geschlechts. Musik setzte ein. Die Patientin mit dem Tapirgesicht spielte, von dem Mannheimer pianistisch begleitet, auf der Geige das Largo von Händel und danach eine Sonate von Grieg, deren Charakter national und salonmäßig war. Man applaudierte wohlwollend, auch an den beiden Bridge-Tischen, die aufgeschlagen waren, und an denen Maskierte und Unmaskierte saßen, Flaschen in Eiskühlern neben sich. Die Türen standen offen; auch in der Halle hielten sich Gäste auf. Eine Gruppe um den Rundtisch mit der Bowle sah dem Hofrat zu, der den Anführer zu einem Gesellschaftsspiel machte. Er zeichnete mit geschlossenen Augen, im Stehen, über den Tisch gebückt, dabei aber zurückgelegten Kopfes, damit alle sehen konnten, daß er die Augen geschlossen hielt, zeichnete auf die Rückseite einer Visitenkarte mit Bleistift blindlings eine Figur, – es waren die Umrisse eines Schweinchens, die seine riesige Hand ohne Zuhilfenahme der Augen hinmalte, eines Schweinchens im Profil, – etwas einfach und mehr ideell als lebenswahr, aber es war unverkennbar die Grundgestalt eines Schweinchens, die er unter so erschwerenden Bedingungen zusammenzog. Das war ein Kunststück, und er konnte es. Das Schlitzäuglein kam ungefähr dort zu sitzen, wohin es gehörte, etwas zu weit vorn am Rüssel, aber doch ungefähr an seinen Platz; es verhielt sich nicht anders mit dem Spitzohr am Kopf, den Beinchen, die an dem gerundeten Bäuchlein hingen; und als Fortsetzung der ebenso gerundeten Rückenlinie ringelte das Schwänzchen sich sehr artig in sich selber. Man rief „Ah!“ als das Werk getan, und drängte sich zu dem Versuch, von Ehrgeiz ergriffen, es dem Meister gleichzutun. Allein die Wenigsten hätten ein Schweinchen mit offenen Augen zu zeichnen vermocht, geschweige bei geschlossenen. Was kamen da für Mißgeburten zustande! Es fehlte an allem Zusammenhang. Das Äuglein fiel außerhalb des Kopfes, die Beinchen ins Innere des Wanstes, der seinerseits weit entfernt war, sich zu schließen, und das Schwänzchen ringelte sich irgendwo abseits, ganz ohne organische Beziehung zur verworrenen Hauptgestalt, als selbständige Arabeske. Man wollte sich ausschütten vor Lachen. Die Gruppe fand Zuzug. Aufsehen entstand an den Bridgetischen, und die Spieler kamen, ihre Karten fächerförmig in der Hand, neugierig herüber. Die Umstehenden sahen dem, der sich erprobte, auf die Augenlider, ob er nicht blinzle, wozu einige durch das Gefühl ihrer Ohnmacht sich verführen ließen, kicherten und prusteten, solange er seine blinden Irrtümer beging, und brachen in Jubel aus, wenn er, die Augen aufreißend, auf sein absurdes Machwerk niederblickte. Trügerisches Selbstvertrauen trieb jeden zum Wettstreit. Die Karte, obgleich geräumig, war rasch auf beiden Seiten überfüllt, sodaß die verfehlten Figuren sich überschnitten. Aber der Hofrat opferte aus seinem Portefeuille eine zweite, auf welcher Staatsanwalt Paravant, nach heimlicher Überlegung, das Schweinchen in einem Zuge hinzumalen versuchte, – mit dem Ergebnis, daß sein Mißerfolg alle vorangegangenen übertraf: das Ornament, das er schuf, wies nicht nur mit keinem Schweinchen, sondern überhaupt mit nichts in der Welt die entfernteste Ähnlichkeit auf. Hallo, Gelächter und stürmische Glückwünsche! Man brachte Menükarten aus dem Speisesaal herzu, – so konnten nun mehrere Personen, Damen und Herren, auf einmal zeichnen, und jeder Konkurrierende hatte seine Aufpasser und Zuschauer, von denen wiederum ein jeder Anwärter auf den Stift war, der eben gehandhabt wurde. Es waren drei Bleistifte da, die man sich aus den Händen riß. Sie gehörten Gästen. Der Hofrat, nachdem er das neue Spiel in die Wege geleitet und bestens im Gange sah, war mit dem Adlaten verschwunden.
Hans Castorp, im Gedränge, sah über Joachims Schulter einem Zeichnenden zu, indem er sich mit dem Ellbogen auf diese Schulter stützte, sein Kinn mit allen fünf Fingern erfaßt hielt und die andere Hand in die Hüfte stemmte. Er redete und lachte. Er wollte ebenfalls zeichnen, verlangte laut danach und erhielt den Bleistift, ein schon ganz kurzes Ding, man konnte ihn nur noch mit Daumen und Zeigefinger führen. Er schimpfte auf den Stummel, das blinde Gesicht zur Decke erhoben, schimpfte laut und verfluchte die Undienlichkeit des Stiftes, indem er mit fliegender Hand einen gräulichen Unsinn auf den Karton warf, schließlich sogar diesen verfehlte und auf das Tischtuch geriet. „Das gilt nicht!“ rief er in das verdiente Gelächter hinein. „Wie soll man mit einem solchen – zum Teufel damit!“ Und er warf den beschuldigten Stummel in die Punschbowle. „Wer hat einen vernünftigen Bleistift? Wer leiht mir einen? Ich muß noch einmal zeichnen! Einen Bleistift, einen Bleistift! Wer hat noch einen?“ rief er nach beiden Seiten aus, den linken Unterarm noch auf die Tischplatte gestützt und die rechte Hand hoch in der Luft schüttelnd. Er bekam keinen. Da wandte er sich um und ging ins Zimmer hinein, indem er zu rufen fortfuhr, – ging gerade auf Clawdia Chauchat zu, die, wie er gewußt hatte, nicht weit von der Portiere zum kleinen Salon stand und von hier aus dem Treiben am Bowlentisch lächelnd zugesehen hatte.
Hinter sich hörte er rufen, wohllautende ausländische Worte: „Eh! Ingegnere! Aspetti! Che cosa fa! Ingegnere! Un po di raggione, sa! Ma è matto questo ragazzo!“ Aber er übertönte diese Stimme mit der seinen, und so sah man Herrn Settembrini, eine Hand mit gespreiztem Arm über den Kopf geworfen – eine in seiner Heimat übliche Gebärde, deren Sinn nicht leicht auf ein Wort zu bringen wäre, und die von einem langgezogenen „Ehh –!“ begleitet war – die Fastnachtsgeselligkeit verlassen. – Hans Castorp aber stand auf dem Klinkerhof, blickte aus nächster Nähe in die blau-grau-grünen Epicanthus-Augen über den vortretenden Backenknochen und sprach:
„Hast du nicht vielleicht einen Bleistift?“
Er war totenbleich, so bleich wie damals, als er blutbesudelt von seinem Einzelspaziergang zur Konferenz gekommen war. Die Gefäßnervenleitung nach seinem Gesichte spielte mit dem Erfolg, daß die entblutete Haut dieses jungen Gesichtes blaßkalt einfiel, die Nase spitz erschien und die Partie unter den Augen ganz so bleifarben wie bei einer Leiche aussah. Aber Hans Castorps Herz ließ der Sympathikus in einer Gangart trommeln, daß von geregelter Atmung überhaupt nicht mehr die Rede sein konnte, und Schauer überliefen den jungen Menschen als Veranstaltung der Hautsalbendrüsen seines Körpers, die sich mitsamt ihren Haarbälgen aufrichteten.
Die im Papierdreispitz betrachtete ihn von oben bis unten mit einem Lächeln, worin keinerlei Mitleid, keinerlei Besorgnis angesichts der Verwüstung seines Äußeren zu erkennen war. Dies Geschlecht kennt ein solches Mitleid und eine solche Besorgnis überhaupt nicht vor den Schrecken der Leidenschaft, – eines Elementes, ihm offenbar viel vertrauter, als dem Mann, der von Natur keineswegs darin zu Hause ist und den es nie ohne Spott und Schadenfreude darin begrüßt. Übrigens würde er sich für Mitleid und Besorgnis ja freilich auch bedanken.
„Ich?“ antwortete die bloßarmige Kranke auf das „Du“ ... „Ja, vielleicht“. Und allenfalls war in ihrem Lächeln und ihrer Stimme etwas von der Erregung, die auftritt, wenn nach langem, stummem Verhältnis die erste Anrede fällt, – einer listigen Erregung, die alles Vorangegangene in den Augenblick heimlich einbezieht. „Du bist sehr ehrgeizig ... Du bist ... sehr ... eifrig“, fuhr sie in ihrer exotischen Aussprache mit fremdem r und fremdem, zu offenem e zu spotten fort, wobei ihre leicht verschleierte, angenehm heisere Stimme das Wort „ehrgeizig“ auch noch auf der zweiten Silbe betonte, so daß es völlig fremdsprachig klang, – und kramte in ihrem Ledertäschchen, blickte suchend hinein und zog unter einem Taschentuch, das sie zuerst zutage gefördert, ein kleines silbernes Crayon hervor, dünn und zerbrechlich, ein Galanteriesächelchen, zu ernsthafter Tätigkeit kaum zu gebrauchen. Der Bleistift von damals, der erste, war handlich-rechtschaffener gewesen.
„Voilà“, sagte sie und hielt ihm das Stiftchen vor die Augen, indem sie es zwischen Daumen und Zeigefinger an der Spitze hielt und leicht hin und her schlenkerte.
Da sie es ihm zugleich gab und vorenthielt, nahm er es, ohne es zu empfangen, das heißt: hielt die Hand in der Höhe des Stiftes, dicht daran, die Finger zum Greifen bereit, aber nicht vollends zugreifend, und blickte aus seinen bleifarbenen Augenhöhlen abwechselnd auf den Gegenstand und in Clawdias tatarisches Gesicht. Seine blutlosen Lippen standen offen, und sie blieben so, er benutzte sie nicht zum Sprechen, als er sagte:
„Siehst du wohl, ich wußte doch, daß du einen haben würdest.“
„Prenez garde, il est un peu fragile“, sagte sie. „C’est à visser, tu sais.“
Und indem ihre Köpfe sich darüber neigten, zeigte sie ihm die landläufige Mechanik des Stiftes, aus dem ein nadeldünnes, wahrscheinlich hartes, nichts abgebendes Graphitstänglein fiel, wenn man die Schraube öffnete.
Sie standen nahe gegeneinander geneigt. Da er im Gesellschaftsanzug war, trug er heute abend einen steifen Kragen und konnte das Kinn darauf stützen.
„Klein, aber dein“, sagte er, Stirn an Stirn mit ihr, auf den Stift hinunter mit unbewegten Lippen und folglich unter Auslassung des Labiallautes.
„Oh, auch witzig bist du“, antwortete sie mit kurzem Lachen, indem sie sich aufrichtete und ihm das Crayon nun überließ. (Übrigens mochte Gott wissen, womit er witzig war, da er ja offensichtlich keinen Tropfen Blut im Kopfe hatte.) „Also geh, spute dich, zeichne, zeichne gut, zeichne dich aus!“ Witzig auch ihrerseits schien sie ihn fortzutreiben.
„Nein, du hast noch nicht gezeichnet. Du mußt zeichnen“, sagte er unter Auslassung des m von „mußt“ und trat auf ziehende Art einen Schritt zurück.
„Ich?“ wiederholte sie wieder mit einem Erstaunen, das etwas anderem mehr als seiner Forderung zu gelten schien. In einer gewissen Verwirrung lächelnd blieb sie noch stehen, folgte aber dann seiner magnetisierenden Rückwärtsbewegung ein paar Schritte gegen den Bowlentisch.
Es zeigte sich jedoch, daß die Unterhaltung dort nicht mehr vorhielt, in den letzten Zügen lag. Jemand zeichnete noch, hatte aber keine Zuschauer mehr. Die Karten waren mit Unsinn bedeckt, jedermann hatte seine Ohnmacht erprobt, der Tisch stand fast verlassen, zumal eine Gegenströmung eingesetzt hatte. Da man gewahr geworden, daß die Ärzte fort waren, lautete plötzlich die Parole auf Tanz. Schon wurde der Tisch beiseite geschleppt. Man postierte Späher an die Türen des Schreib- und des Klavierzimmers, mit der Anweisung, durch ein Zeichen den Ball zum Stehen zu bringen, falls etwa „der Alte“, Krokowski oder die Oberin sich wieder zeigen sollten. Ein slawischer Jüngling griff mit Ausdruck in die Tastatur des kleinen Nußbaumpianinos. Die ersten Paare drehten sich im Inneren eines unregelmäßigen Kreises von Sesseln und Stühlen, auf denen Zuschauer saßen.
Hans Castorp verabschiedete sich von dem eben fortschwebenden Tisch mit der Handbewegung: „Fahr hin!“ Mit dem Kinn deutete er dann auf freie Sitzgelegenheiten, die er im kleinen Salon gewahrte, und auf die geschützte Zimmerecke rechts neben der Portiere. Er sagte nichts, vielleicht, weil ihm die Musik zu laut war. Er zog einen Stuhl – es war ein sogenannter Triumphstuhl, mit Holzrahmen und einer Plüschbespannung – für Frau Chauchat an den Ort, den er vorher pantomimisch bezeichnet hatte, und eignete sich selbst einen knisternden, krachenden Korbstuhl mit gerollten Armlehnen an, auf den er sich zu ihr setzte, gegen sie vorgebeugt, die Arme auf den Lehnen, ihr Crayon in den Händen, die Füße weit unter dem Stuhl. Sie ihrerseits lag allzu tief in dem Plüschgehänge, ihre Knie waren emporgehoben, doch schlug sie trotzdem das eine über das andere und ließ ihren Fuß in der Höhe wippen, dessen Knöchel über dem Rande des schwarzen Lackschuhs von der ebenfalls schwarzen Seide des Strumpfes überspannt war. Vor ihnen saßen andere Leute, standen auf, um zu tanzen und machten solchen Platz, die müde waren. Es war ein Kommen und Gehen.
„Du hast ein neues Kleid“, sagte er, um sie betrachten zu dürfen, und hörte sie antworten:
„Neu? Du bist bewandert in meiner Toilette?“
„Habe ich nicht recht?“
„Doch. Ich habe es mir kürzlich hier machen lassen, bei Lukaček im Dorf. Er arbeitet viel für Damen hier oben. Es gefällt dir?“
„Sehr gut“, sagte er, indem er sie mit dem Blick noch einmal umfaßte und ihn dann niederschlug. „Willst du tanzen?“ fügte er hinzu.
„Würdest du wollen?“ fragte sie mit erhobenen Brauen lächelnd dagegen, und er antwortete:
„Ich täte es schon, wenn du Lust hättest.“
„Das ist weniger brav, als ich dachte, daß du seist“, sagte sie, und da er wegwerfend auflachte, fügte sie hinzu: „Dein Vetter ist schon gegangen.“
„Ja, er ist mein Vetter“, bestätigte er unnötigerweise. „Ich sah auch vorhin, daß er fort ist. Er wird sich gelegt haben.“
„C’est un jeune homme très étroit, très honnête, très allemand.“
„Étroit? Honnête?“ wiederholte er. „Ich verstehe Französisch besser, als ich es spreche. Du willst sagen, daß er pedantisch ist. Hältst du uns Deutsche für pedantisch – nous autres allemands?“
„Nous causons de votre cousin. Mais c’est vrai, ihr seid ein wenig bourgeois. Vous aimez l’ordre mieux que la liberté, toute l’Europe le sait.“
„Aimer ... aimer ... Qu’est-ce que c’est! Ça manque de définition, ce mot-là. Der Eine hat’s, der Andere liebt’s, comme nous disons proverbialement“, behauptete Hans Castorp. „Ich habe in letzter Zeit,“ fuhr er fort, „manchmal über die Freiheit nachgedacht. Das heißt, ich hörte das Wort so oft, und so dachte ich darüber nach. Je te le dirai en français, was ich mir dachte. Ce que toute l’Europe nomme la liberté, est peut-être une chose assez pédante et assez bourgeoise en comparaison de notre besoin d’ordre – c’est ça!“
„Tiens! C’est amusant. C’est ton cousin à qui tu penses en disant des choses étranges comme ça?“
„Nein, c’est vraiment une bonne âme, eine einfache, unbedrohte Natur, tu sais. Mais il n’est pas bourgeois, il est militaire.“
„Unbedroht?“ wiederholte sie mühsam ... „Tu veux dire: une nature tout à fait ferme, sûre d’elle-même? Mais il est sérieusement malade, ton pauvre cousin.“
„Wer hat das gesagt?“
„Man weiß hier voneinander.“
„Hat Hofrat Behrens dir das gesagt?“
„Peut-être en me faisant voir ses tableaux.“
„C’est-à-dire: en faisant ton portrait!“
„Pourquoi pas. Tu l’as trouvé réussi, mon portrait?“
„Mais oui, extrêmement. Behrens a très exactement rendu ta peau, oh vraiment très fidèlement. J’aimerais beaucoup être portraitiste, moi aussi, pour avoir l’occasion d’étudier ta peau comme lui.“
„Parlez allemand, s’il vous plaît!“
„Oh, ich spreche Deutsch, auch auf Französisch. C’est une sorte d’étude artistique et médicale – en un mot: il s’agit des lettres humaines, tu comprends. Wie ist es nun, willst du nicht tanzen?“
„Aber nein, das ist kindisch. En cachette des médecins. Aussitôt que Behrens reviendra, tout le monde va se précipiter sur les chaises. Ce sera fort ridicule.“
„Hast du so großen Respekt vor ihm?“
„Vor wem?“ sagte sie, das Fragewort kurz und fremdartig sprechend.
„Vor Behrens.“
„Mais va donc avec ton Behrens! Es ist auch viel zu eng zum Tanzen. Et puis sur le tapis ... Wollen wir zusehen, dem Tanze.“
„Ja, das wollen wir“, pflichtete er bei und schaute neben ihr hin, mit seinem bleichen Gesicht, mit den blauen, sinnig blickenden Augen seines Großvaters, in das Gehüpf der maskierten Patienten hier im Salon und drüben im Schreibzimmer. Da hüpfte die Stumme Schwester mit dem Blauen Heinrich, und Frau Salomon, die als Ballherr, in Frack und weiße Weste, gekleidet war, mit hochgewölbter Hemdbrust, gemaltem Schnurrbart und Monokel, drehte sich auf kleinen Lack-Stöckelschuhen, die unnatürlicherweise aus ihren schwarzen Herrenhosen hervorkamen, mit dem Pierrot, dessen Lippen blutrot in seinem geweißten Antlitz leuchteten, und dessen Augen denen eines Albino-Kaninchens glichen. Der Grieche im Mäntelchen schwang das Ebenmaß seiner lila Trikotbeine um den dekolletierten und dunkel glitzernden Rasmussen; der Staatsanwalt im Kimono, die Generalkonsulin Wurmbrand und der junge Gänser tanzten sogar selbdritt, indem sie sich mit den Armen umschlungen hielten; und was die Stöhr betraf, so tanzte sie mit ihrem Besen, den sie ans Herz drückte und dessen Borsten sie liebkoste, als wären sie eines Menschen aufrecht stehendes Haupthaar gewesen.
„Das wollen wir“, wiederholte Hans Castorp mechanisch. Sie sprachen leise, unter den Tönen des Klaviers. „Wir wollen hier sitzen und zusehen wie im Traum. Das ist für mich wie ein Traum, mußt du wissen, daß wir so sitzen, – comme un rêve singulièrement profond, car il faut dormir très profondément pour rêver comme cela ... Je veux dire: C’est un rêve bien connu, rêvé de tout temps, long, éternel, oui, être assis près de toi comme à présent, voilà l’éternité.“
„Poète!“ sagte sie. „Bourgeois, humaniste et poète, – voilà l’allemand au complet, comme il faut!“
„Je crains, que nous ne soyons pas du tout et nullement comme il faut“, antwortete er. „Sous aucun égard. Nous sommes peut-être des Sorgenkinder des Lebens, tout simplement.“
„Joli mot. Dis-moi donc ... Il n’aurait pas été fort difficile de rêver ce rêve-là plus tôt. C’est un peu tard, que monsieur se résout d’adresser la parole à son humble servante.“
„Pourquoi des paroles?“ sagte er. „Pourquoi parler? Parler, discourir, c’est une chose bien républicaine, je le concède. Mais je doute, que ce soit poétique au même degré. Un de nos pensionnaires, qui est un peu devenu mon ami, M. Settembrini ...“
„Il vient de te lancer quelques paroles.“
„Eh bien, c’est un grand parleur sans doute, il aime même beaucoup à réciter de beaux vers, – mais est-ce un poète, cet homme-là?“
„Je regrette sincèrement de n’avoir jamais eu le plaisir de faire la connaissance de ce chevalier.“
„Je le crois bien.“
„Ah! Tu le crois.“
„Comment? C’était une phrase tout-à-fait indifférente, ce que j’ai dit là. Moi, tu le remarques bien, je ne parle guère le français. Pourtant, avec toi je préfère cette langue à la mienne, car pour moi, parler français, c’est parler sans parler, en quelque manière, – sans responsabilité, ou comme nous parlons en rêve. Tu comprends?“
„A peu près.“
„Ça suffit ... Parler“, fuhr Hans Castorp fort, „– pauvre affaire! Dans l’éternité, on ne parle point. Dans l’éternité, tu sais, on fait comme en dessinant un petit cochon: on penche la tête en arrière et on ferme les yeux.“
„Pas mal, ça! Tu es chez toi dans l’éternité, sans aucun doute, tu la connais à fond. Il faut avouer, que tu es un petit rêveur assez curieux.“
„Et puis“, sagte Hans Castorp, „si je t’avais parlé plus tôt, il m’aurait fallu te dire »vous«!“
„Eh bien, est-ce que tu as l’intention de me tutoyer pour toujours?“
„Mais oui. Je t’ai tutoyée de tout temps et je te tutoierai éternellement.“
„C’est un peu fort, par exemple. En tout cas tu n’auras pas trop longtemps l’occasion de me dire »tu«. Je vais partir.“
Das Wort brauchte einige Zeit, bis es ihm ins Bewußtsein drang. Dann fuhr er auf, wirr um sich blickend, wie ein aus dem Schlaf Gestörter. Ihr Gespräch war ziemlich langsam vonstatten gegangen, da Hans Castorp das Französische schwerfällig und wie in zögerndem Sinnen sprach. Das Klavier, das kurze Zeit geschwiegen hatte, tönte wieder, nunmehr unter den Händen des Mannheimers, der den Slawenjüngling abgelöst und Noten aufgelegt hatte. Fräulein Engelhart saß bei ihm und blätterte um. Der Ball hatte sich gelichtet. Eine größere Anzahl der Pensionäre schien horizontale Lage eingenommen zu haben. Vor ihnen saß niemand mehr. Im Lesezimmer spielte man Karten.
„Was tust du?“ fragte Hans Castorp entgeistert ...
„Ich reise ab“, wiederholte sie, scheinbar verwundert lächelnd über sein Erstarren.
„Nicht möglich“, sagte er. „Das ist nur Scherz.“
„Durchaus nicht. Es ist mein vollkommener Ernst. Ich reise.“
„Wann?“
„Aber morgen. Après dîner.“
In ihm ereignete sich ein umfangreicher Zusammensturz. Er sagte:
„Wohin?“
„Sehr weit fort.“
„Nach Daghestan?“
„Tu n’es pas mal instruit. Peut-être, pour le moment ...“
„Bist du denn geheilt?“
„Quant à ça ... non. Aber Behrens meint, es sei vorläufig hier nicht mehr viel für mich zu erreichen. C’est pourquoi je vais risquer un petit changement d’air.“
„Du kommst also wieder!“
„Das fragt sich. Es fragt sich vor allem, wann. Quant à moi, tu sais, j’aime la liberté avant tout et notamment celle de choisir mon domicile. Tu ne comprends guère ce que c’est: être obsédé d’indépendance. C’est de ma race, peut-être.“
„Et ton mari au Daghestan te l’accorde, – ta liberté?“
„C’est la maladie qui me la rend. Me voilà à cet endroit pour la troisième fois. J’ai passé un an ici, cette fois. Possible que je revienne. Mais alors tu seras bien loin depuis longtemps.“
„Glaubst du, Clawdia?“
„Mon prénom aussi! Vraiment tu les prends bien au sérieux les coutumes du carnaval!“
„Weißt du denn, wie krank ich bin?“
„Oui – non – comme on sait ces choses ici. Tu as une petite tache humide là dedans et un peu de fièvre, n’est-ce pas?“
„Trente-sept et huit ou neuf l’après-midi“, sagte Hans Castorp. „Und du?“
„Oh, mon cas, tu sais, c’est un peu plus compliqué ... pas tout-à-fait simple.“
„Il y a quelque chose dans cette branche de lettres humaines dite la médecine,“ sagte Hans Castorp, „qu’on appelle bouchement tuberculeux des vases de lymphe.“
„Ah! Tu as mouchardé, mon cher, on le voit bien.“
„Et toi ... Verzeih mir! Laß mich dich jetzt etwas fragen, dich dringlich und auf Deutsch etwas fragen! Als ich damals von Tische zur Untersuchung ging, vor sechs Monaten ... Du blicktest dich um nach mir, erinnerst du dich?“
„Quelle question? Il y a six mois!“
„Wußtest du, wohin ich ging?“
„Certes, c’était tout-à-fait par hasard ...“
„Du wußtest es von Behrens?“
„Toujours ce Behrens!“
„Oh, il a représenté ta peau d’une façon tellement exacte ... D’ailleurs, c’est un veuf aux joues ardentes et qui possède un service à café très remarquable ... Je crois bien qu’il connaît ton corps non seulement comme médecin, mais aussi comme adepte d’une autre discipline de lettres humaines.“
„Tu as décidément raison de dire, que tu parles en rêve, mon ami.“
„Soit ... Laisse-moi rêver de nouveau après m’avoir réveillé si cruellement par cette cloche d’alarme de ton départ. Sept mois sous tes yeux ... Et à présent, où en réalité j’ai fait ta connaissance, tu me parles de départ!“
„Je te répète, que nous aurions pu causer plus tôt.“
„Du hättest es gewünscht?“
„Moi? Tu ne m’échapperas pas, mon petit. Il s’agit de tes intérêts, à toi. Est-ce que tu étais trop timide pour t’approcher d’une femme à qui tu parles en rêve maintenant, ou est-ce qu’il y avait quelqu’un qui t’en a empêché?“
„Je te l’ai dit. Je ne voulais pas te dire »vous«.“
„Farceur. Réponds donc, – ce monsieur beau parleur, cet italien-là qui a quitté la soirée, – qu’est-ce qu’il t’a lancé tantôt?“
„Je n’en ai entendu absolument rien. Je me soucie très peu de ce monsieur, quand mes yeux te voient. Mais tu oublies ... il n’aurait pas été si facile du tout de faire ta connaissance dans le monde. Il y avait encore mon cousin avec qui j’étais lié et qui incline très peu à s’amuser ici: Il ne pense à rien qu’à son retour dans les plaines, pour se faire soldat.“
„Pauvre diable. Il est, en effet, plus malade qu’il ne sait. Ton ami italien du reste ne va pas trop bien non plus.“
„Il le dit lui-même. Mais mon cousin ... Est-ce vrai? Tu m’effraies.“
„Fort possible qu’il va mourir, s’il essaye d’être soldat dans les plaines.“
„Qu’il va mourir. La mort. Terrible mot, n’est-ce pas? Mais c’est étrange, il ne m’impressionne pas tellement aujourd’hui, ce mot. C’était une façon de parler bien conventionnelle, lorsque je disais »Tu m’effraies«. L’idée de la mort ne m’effraie pas. Elle me laisse tranquille. Je n’ai pas pitié – ni de mon bon Joachim ni de moi-même, en entendant qu’il va peut-être mourir. Si c’est vrai, son état ressemble beaucoup au mien et je ne le trouve pas particulièrement imposant. Il est moribond, et moi, je suis amoureux, eh bien! – Tu as parlé à mon cousin à l’atelier de photographie intime, dans l’antichambre, tu te souviens.“
„Je me souviens un peu.“
„Donc ce jour-là Behrens a fait ton portrait transparent!“
„Mon dieu. Et l’as-tu sur toi?“
„Non, je l’ai dans ma chambre.“
„Ah, dans ta chambre. Quant au mien, je l’ai toujours dans mon portefeuille. Veux-tu que je te le fasse voir?“
„Mille remerciements. Ma curiosité n’est pas invincible. Ce sera un aspect très innocent.“
„Moi, j’ai vu ton portrait extérieur. J’aimerais beaucoup mieux voir ton portrait intérieur qui est enfermé dans ta chambre ... Laisse-moi demander autre chose! Parfois un monsieur russe qui loge en ville vient te voir. Qui est-ce? Dans quel but vient-il, cet homme?“
„Tu es joliment fort en espionnage, je l’avoue. Eh bien, je réponds. Oui, c’est un compatriote souffrant, un ami. J’ai fait sa connaissance à une autre station balnéaire, il y a quelques années déjà. Nos relations? Les voilà: nous prenons notre thé ensemble, nous fumons deux ou trois papiros, et nous bavardons, nous philosophons, nous parlons de l’homme, de Dieu, de la vie, de la morale, de mille choses. Voilà mon compte rendu. Es-tu satisfait?“
„De la morale aussi! Et qu’est-ce que vous avez trouvé en fait de morale, par exemple?“
„La morale? Cela t’intéresse? Eh bien, il nous semble, qu’il faudrait chercher la morale non dans la vertu, c’est-à-dire dans la raison, la discipline, les bonnes mœurs, l’honnêteté, – mais plutôt dans le contraire, je veux dire: dans le péché, en s’abandonnant au danger, à ce qui est nuisible, à ce qui nous consume. Il nous semble qu’il est plus moral de se perdre et même de se laisser dépérir que de se conserver. Les grands moralistes n’étaient point des vertueux, mais des aventuriers dans le mal, des vicieux, des grands pécheurs qui nous enseignent à nous incliner chrétiennement devant la misère. Tout ça doit te déplaire beaucoup, n’est-ce pas?“
Er schwieg. Er saß noch immer wie anfangs, die verschlungenen Füße tief unter seinem knisternden Stuhl, vorgeneigt gegen die Liegende im Papierdreispitz, ihr Crayon zwischen den Fingern, und blickte aus Hans Lorenz Castorps blauen Augen von unten in das Zimmer, das leer geworden war. Zerstoben die Gästeschaft. Das Klavier, in der schräg gegenüberliegenden Ecke, tönte nur noch leise und abgebrochen, gespielt mit einer Hand von dem mannheimischen Kranken, an dessen Seite die Lehrerin saß und in einem Notenbuch blätterte, das sie auf den Knien hielt. Als das Gespräch zwischen Hans Castorp und Clawdia Chauchat verstummte, hörte der Pianist vollends zu spielen auf und legte auch die Hand, mit der er die Tasten leicht gerührt hatte, in den Schoß, während Fräulein Engelhart fortfuhr, in ihre Noten zu blicken. Die vier von der Fastnachtsgeselligkeit übriggebliebenen Personen saßen unbeweglich. Die Stille dauerte mehrere Minuten. Langsam neigten sich unter ihrem Druck die Köpfe des Paares am Pianino tiefer und tiefer, der des Mannheimers gegen die Klaviatur hinab, der Fräulein Engelharts auf das Notenheft. Endlich, beide gleichzeitig, wie nach geheimer Verständigung, standen sie vorsichtig auf, und leise, auf den Zehen, indem sie es künstlich vermieden, sich nach der anderen noch belebten Zimmerecke umzusehen, die Köpfe eingezogen und die Arme steif am Leibe, verschwanden der Mannheimer und die Lehrerin miteinander durch das Schreib- und Lesezimmer. „Tout le monde se retire“, sagte Frau Chauchat. „C’étaient les derniers; il se fait tard. Eh bien, la fête de carnaval est finie.“ Und sie hob die Arme, um mit beiden Händen die Papiermütze von ihrem rötlichen Haar zu nehmen, dessen Zopf als Kranz um den Kopf geschlungen war. „Vous connaissez les conséquences, monsieur.“
Aber Hans Castorp verneinte mit geschlossenen Augen, ohne im übrigen seine Stellung zu verändern. Er antwortete:
„Jamais, Clawdia. Jamais je te dirai »vous«, jamais de la vie ni de la mort, wenn man so sagen kann, – man sollte es können. Cette forme de s’adresser à une personne, qui est celle de l’Occident cultivé et de la civilisation humanitaire, me semble fort bourgeoise et pédante. Pourquoi, au fond, de la forme? La forme, c’est la pédanterie elle-même! Tout ce que vous avez fixé à l’égard de la morale, toi et ton compatriote souffrant, – tu veux sérieusement que ça me surprenne? Pour quel sot me prends-tu? Dis donc, qu’est-ce que tu penses de moi?“
„C’est un sujet qui ne donne pas beaucoup à penser. Tu es un petit bonhomme convenable, de bonne famille, d’une tenue appétissante, disciple docile de ses précepteurs et qui retournera bientôt dans les plaines, pour oublier complètement qu’il a jamais parlé en rêve ici et pour aider à rendre son pays grand et puissant par son travail honnête sur le chantier. Voilà ta photographie intime, faite sans appareil. Tu la trouves exacte, j’espère?“
„Il y manque quelques détails que Behrens y a trouvés.“
„Ah, les médecins en trouvent toujours, ils s’y connaissent ...“
„Tu parles comme M. Settembrini. Et ma fièvre? D’où vient-elle?“
„Allons donc, c’est un incident sans conséquence qui passera vite.“
„Non, Clawdia, tu sais bien que ce que tu dis là n’est pas vrai et tu le dis sans conviction, j’en suis sûr. La fièvre de mon corps et le battement de mon cœur harassé et le frissonnement de mes membres, c’est le contraire d’un incident, car ce n’est rien d’autre –“ und sein bleiches Gesicht mit den zuckenden Lippen beugte sich tiefer zu dem ihren – „rien d’autre que mon amour pour toi, oui, cet amour qui m’a saisi à l’instant, où mes yeux t’ont vue, ou, plutôt, que j’ai reconnu, quand je t’ai reconnue toi, – et c’était lui, évidemment, qui m’a mené à cet endroit ...“
„Quelle folie!“
„Oh, l’amour n’est rien, s’il n’est pas de la folie, une chose insensée, défendue et une aventure dans le mal. Autrement c’est une banalité agréable, bonne pour en faire de petites chansons paisibles dans les plaines. Mais quant à ce que je t’ai reconnue et que j’ai reconnu mon amour pour toi, – oui, c’est vrai, je t’ai déjà connue, anciennement, toi et tes yeux merveilleusement obliques et ta bouche et ta voix, avec laquelle tu parles, – une fois déjà, lorsque j’étais collégien, je t’ai demandé ton crayon, pour faire enfin ta connaissance mondaine, parce que je t’aimais irraisonnablement, et c’est de là, sans doute, c’est de mon ancien amour pour toi, que ces marques me restent que Behrens a trouvées dans mon corps, et qui indiquent que jadis aussi j’étais malade ...“
Seine Zähne schlugen aufeinander. Er hatte den einen Fuß unter seinem knisternden Stuhl hervorgezogen, während er phantasierte, und indem er ihn vorschob, diesen Fuß, berührte er mit dem anderen Knie schon den Boden, so daß er denn also neben ihr kniete, gebeugten Kopfes und am ganzen Körper zitternd. „Je t’aime,“ lallte er, „je t’ai aimée de tout temps, car tu es le Toi de ma vie, mon rêve, mon sort, mon envie, mon éternel désir ...“
„Allons, allons!“ sagte sie. „Si tes précepteurs te voyaient ...“
Aber er schüttelte verzweifelt den Kopf, das Gesicht über den Teppich, und antwortete:
„Je m’en ficherais, je me fiche de tous ces Carducci et de la République éloquente et du progrès humain dans le temps, car je t’aime!“
Sie streichelte ihm leicht mit der Hand das kurzgeschorene Haar am Hinterkopf.
„Petit bourgeois!“ sagte sie. „Joli bourgeois à la petite tache humide. Est-ce vrai que tu m’aimes tant?“
Und begeistert von ihrer Berührung, nun auf beiden Knien, den Kopf im Nacken und mit geschlossenen Augen fuhr er zu sprechen fort:
„Oh, l’amour, tu sais ... Le corps, l’amour, la mort, ces trois ne font qu’un. Car le corps, c’est la maladie et la volupté, et c’est lui qui fait la mort, oui, ils sont charnels tous deux, l’amour et la mort, et voilà leur terreur et leur grande magie! Mais la mort, tu comprends, c’est d’une part une chose mal famée, impudente qui fait rougir de honte; et d’autre part c’est une puissance très solennelle et très majestueuse, – beaucoup plus haute que la vie riante gagnant de la monnaie et farcissant sa panse, – beaucoup plus vénérable que le progrès qui bavarde par les temps, – parce qu’elle est l’histoire et la noblesse et la piété et l’éternel et le sacré qui nous fait tirer le chapeau et marcher sur la pointe des pieds ... Or, de même, le corps, lui aussi, et l’amour du corps, sont une affaire indécente et fâcheuse, et le corps rougit et pâlit à sa surface par frayeur et honte de lui-même. Mais aussi il est une grande gloire adorable, image miraculeuse de la vie organique, sainte merveille de la forme et de la beauté, et l’amour pour lui, pour le corps humain, c’est de même un intérêt extrêmement humanitaire et une puissance plus éducative que toute la pédagogie du monde! ... Oh, enchantante beauté organique qui ne se compose ni de teinture à l’huile ni de pierre, mais de matière vivante et corruptible, pleine du secret fébrile de la vie et de la pourriture! Regarde la symétrie merveilleuse de l’édifice humain, les épaules et les hanches et les mamelons fleurissants de part et d’autre sur la poitrine, et les côtes arrangées par paires, et le nombril au milieu dans la mollesse du ventre, et le sexe obscur entre les cuisses! Regarde les omoplates se remuer sous la peau soyeuse du dos, et l’échine qui descend vers la luxuriance double et fraîche des fesses, et les grandes branches des vases et des nerfs qui passent du tronc aux rameaux par les aisselles, et comme la structure des bras correspond à celle des jambes. Oh, les douces régions de la jointure intérieure du coude et du jarret avec leur abondance de délicatesses organiques sous leurs coussins de chair! Quelle fête immense de les caresser ces endroits délicieux du corps humain! Fête à mourir sans plainte après! Oui, mon dieu, laisse-moi sentir l’odeur de la peau de ta rotule, sous laquelle l’ingénieuse capsule articulaire sécrète son huile glissante! Laisse-moi toucher dévotement de ma bouche l’Arteria femoralis qui bat au front de ta cuisse et qui se divise plus bas en les deux artères du tibia! Laisse-moi ressentir l’exhalation de tes pores et tâter ton duvet, image humaine d’eau et d’albumine, destinée pour l’anatomie du tombeau, et laisse-moi périr, mes lèvres aux tiennes!“
Er öffnete die Augen nicht, nachdem er gesprochen; er blieb, wie er war, den Kopf im Nacken, die Hände mit dem Silberstiftchen von sich gestreckt, auf seinen Knien bebend und schwankend. Sie sagte:
„Tu es en effet un galant qui sait solliciter d’une manière profonde, à l’allemande.“
Und sie setzte ihm die Papiermütze auf.
„Adieu, mon prince Carnaval! Vous aurez une mauvaise ligne de fièvre ce soir, je vous le prédis.“
Damit glitt sie vom Stuhl, glitt über den Teppich zur Tür, in deren Rahmen sie zögerte, halb rückwärts gewandt, einen ihrer nackten Arme erhoben, die Hand an der Türangel. Über die Schulter sagte sie leise:
„N’oubliez pas de me rendre mon crayon.“
Und trat hinaus.
Druck vom Bibliographischen Institut in Leipzig
Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Schreibweise häufig vorkommender Namen wurde vereinheitlicht. Weitere Änderungen, teilweise unter Zuhilfenahme späterer Auflagen, sind hier aufgeführt (vorher/nachher):
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.