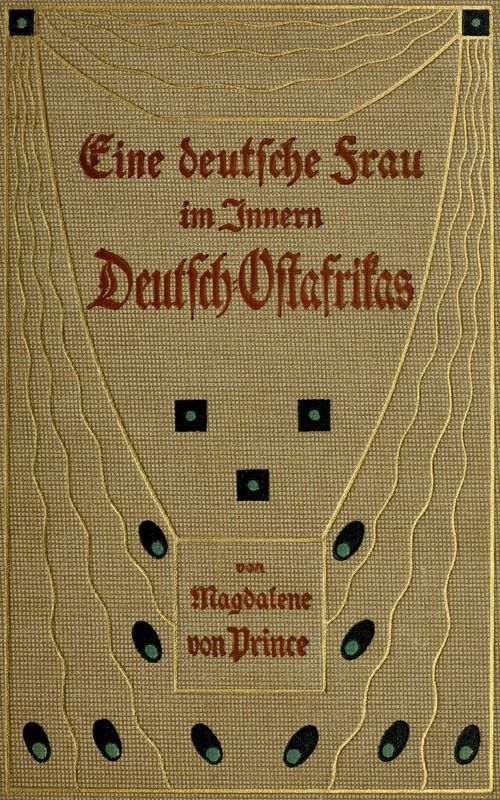
Original-Buchumschlag.
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1908 erschienenen Ausgabe der Zeitschrift so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Zeichensetzung und offensichtliche typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche sowie inkonsistente Schreibweisen wurden beibehalten, insbesondere wenn diese in der damaligen Zeit üblich waren oder im Text mehrfach auftreten.
Passagen in Swahili wurden nicht korrigiert, dies gilt auch für Abweichungen in der Schreibweise von Eigen- und Ortsnamen (z.B. ‚Kilimandscharo‘ -- ‚Kilimanjaro‘ -- ‚Kilimatscharo‘). Einige Begriffe wurden harmonisiert, wenn ansonsten der Sinn verfälscht werden könnte.
Die Originalausgabe wurde in Frakturschrift gesetzt. Textstellen in Antiquaschrift erscheinen im vorliegenden Text kursiv. Diese Schriftart wurde vorwiegend für fremdsprachliche Begriffe verwendet, aber auch für Einheiten (km) und akademische Grade (Dr.). Diese Auszeichnung wurde allerdings nicht konsequent eingehalten.
Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
Elf Jahre
nach Tagebuchblättern erzählt
von
Magdalene v. Prince
geb. v. Massow
Dritte, vermehrte Auflage
Mit einem Titelbilde, 22 Abbildungen und 1 Skizze
Berlin 1908
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Königliche Hofbuchhandlung :: Kochstraße 68–71
Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Übersetzungsrecht sind vorbehalten.
Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin
Auguste Viktoria
in tiefster Ehrfurcht gewidmet
von der
Verfasserin
och ist kein Jahr verflossen, und eine zweite Auflage des Buches wird nötig. Als ich die schlichten Aufzeichnungen zuerst in die Welt sandte, um auch in unserer deutschen Frauenwelt den kolonialen Gedanken zu beleben, hoffte ich kaum, solche Nachsicht zu finden. Allen denen Dank, die den guten Willen für die Tat nehmen.
Jetzt sind es nun schon fast vier Jahre, daß wir als Pflanzer hier leben, und wenngleich auch heftige Stürme und viele Fehlschläge, die ja bei keiner Gründung fehlen, nicht ausblieben, so möchte ich Euch, deutsche Frauen, auch jetzt locken in das Land, wo der Himmel blauer strahlt, wo der Wind linder weht, wo Mond und Sterne noch ganz anders leuchten und funkeln als daheim. Glaubt es mir, es liegt ein besonderer Reiz darin, aus Wildnis ein Stück Kultur zu schaffen, aber das gelingt freilich nur und trägt Früchte bei größter, nie versagender Geduld, eiserner Willenskraft und angestrengtester Arbeit.
Auf Grund meines Buches haben sich viele wegen Ansiedlung an mich gewandt; ich mußte sie leider immer auf spätere Zeit vertrösten, weil der zunächst noch herrschende Mangel an Verkehrsmöglichkeiten den Absatz unmöglich macht. Jetzt hat sich das Mutterland unsrer erbarmt, es wird uns Eisenbahnen schenken;[S. VI] hoffentlich auch nach Uhehe, wo anbaufähiger, fruchtbarer Boden in gesundem Bergklima reichlich genug vorhanden, um einer beträchtlichen Anzahl deutscher Familien eine neue Heimat bieten zu können. Haben wir erst Eisenbahnen, dann ist es jedem selbst in die Hand gegeben, sein Leben sich je nach Fleiß und Fähigkeiten zu gestalten.
So rufe ich auch jetzt Euch deutschen Frauen zu: lernt unsere deutschen Kolonien lieben, interessiert Euch für ihre Erschließung durch Verkehrswege, durch Feldbahnen und Eisenbahnen; sie sind es wert, deutsch zu sein. Laßt Eure Kinder auf neuem deutschen Boden aufblühen, Euch zum Stolz und zur Freude und zur Kräftigung des Deutschtums.
Sakkarani, West-Usambara, Herbst 1904.
Magdalene Prince.
ieder kann ich Euch deutschen Frauen und Mädchen einen von Afrikas Sonne durchglühten Gruß senden, möchte er in Eure Herzen fallen und diese für unsere Kolonie noch mehr entflammen.
Allen, die Ihr mir so gütige Worte und Überraschungen sandtet, möchte ich auch an dieser Stelle danken. Dazu gehört auch der „Züchtergruß aus Westfalen“, der mir vor wenigen Tagen die schönsten Rassenhühner zum Geschenk brachte.
Seitdem die zweite Auflage dieses Buches in die Welt ging, hat unsere Kolonie sowie das Schwesterland Süd-West-Afrika schwere Zeiten durchgemacht, allerorten loderte der Kampf der Rassenverschiedenheit auf, meistens durch zu viel falsche Humanität geschürt, und hat uns manches Opfer an Blut und Geld gekostet. Gerade dies aber schien nötig zu sein; wie es Mütter gibt, die erst dann den Wert und die Vorzüge ihrer Kinder schätzen lernen, wenn diese durch Krankheit ihnen Sorge und Arbeit machen, so erging es auch uns. Erst als wir an vielen Stellen bluteten, gewann das Mutterland Interesse an uns. Der Sieg des Volkes bei den Reichstagswahlen hat jene Wandlung am besten bezeugt.
Diese haben wir nicht zum wenigsten Euch deutschen Frauen zu danken, die Ihr so regen Anteil an dem Kampf genommen habt. Mit diesem Danke verbinde ich die Bitte, Eure Hilfe uns auch in Zukunft zu schenken; fügt noch mehr Wärme und Liebe dazu: Wir brauchen noch viel mehr Verkehrswege und Eisenbahnen, ehe die Kolonie ihrem Werte nach erblühen kann. Je mehr Frauen an ihrem Aufbau mitwirken, um so schneller und mächtiger wird sie erstehen. „Der Mann gründet das Haus, die Frau hält es!“
Sakkarani, Sommer 1907.
Magdalene v. Prince.
| Seite | |
| Einleitung | 1 |
| Erstes Kapitel. Auf dem Marsche von Dar-es-Salaam nach der Station Perondo | 6 |
|
Das erste Lager S. 7. — Abschied von Dar-es-Salaam S. 7. — Unser Koch, die Boys, die schwarzen Soldaten S. 9. — Zoologische Erwerbungen S. 11. — Die Boys und deren Frauen S. 11. — Heuschreckenplage S. 13. — Unsere Träger S. 13. — Übergang über den Kingani S. 15. — Schlechter Weg S. 15. — Der Jumbe von Perondo, die Notbrücke S. 17. — Fruchtbare Landschaft S. 17. — Jagdbeute S. 19. — Die Bedeutung der Jumben S. 21. — Die erste Station im Innern (Kisaki) S. 21. — Das Leben im Lager S. 23. — Anstrengender Marsch S. 23. — Das erste Fieber S. 23. — Übergang über den Ruaha S. 25. — Die „Teufelsstelle“ S. 25. — Der Urwald S. 27. — Krankheiten S. 27. — Offizieller Empfang S. 29. — Unser Küchenzettel, Markttag S. 29. — Gefährlicher Flußübergang S. 31. — Beschwerlicher Marsch S. 31. — Verödete Dörfer S. 33. — Wasserfälle S. 33. — Veränderte Marschordnung, vor dem Endziel S. 33. |
|
| Zweites Kapitel. In Perondo. Gründung der neuen Station Iringa | 35 |
|
Feierlicher Empfang in Perondo, die Station und ihre Umgebung S. 36. — Eine afrikanische Küche, großes Diner S. 37. — Leben und Treiben auf der Station S. 37. — Teuerung der Lebensmittel S. 39. — Revolverattentat, die Wahehe S. 40. — Hauswirtschaft und Geflügelhof S. 41. — Häuptling Kiwanga S. 43. — Der Wahehe-Sultan Quawa und seine Anhänger S. 43. — Toms Expedition gegen denselben S. 44. — „Bibi Sakkarani“, Kiwangas Gastgeschenk S. 45. — Ratten, Marsch zur neuen Station S. 47. — Alarm S. 49. — Erster Geburtstag als junge Frau, Wiedersehen mit Tom S. 50. — Die neue Station Iringa, militärischer Empfang, unser Heim S. 53. — Expedition gegen Quawas Brüder und Unterwerfung derselben S. 55. — Quawas Schwestern S. 55. — Regenzeit, Gründung von Dörfern S. 59. — Eine Hinrichtung, [S. X]unser Gemüsegarten und Viehstand S. 60. — Die Mitglieder der Wahehe-Sultansfamilie S. 61. — Briefe aus der Heimat und vom Gouvernement S. 62. |
|
| Drittes Kapitel. Mpangires Sultanat | 63 |
|
Feierliche Einsetzung Mpangires als Sultan der Wahehe und die Festlichkeiten bei derselben S. 65. — Unterm Christbaum, Silvester S. 67. — Kaisergeburtstagsfeier, Alarmnachrichten S. 67. — Feuer im Dorfe S. 68. — Neue Unglücksbotschaften S. 69. — Quawas Bruder Gunkihaka S. 71. — Streifzüge gegen die Wahehe, Mpangires Unzuverlässigkeit S. 73. — Kriegsgericht über Mpangire und seine Brüder S. 75. — Hinrichtung der Quawabrüder und Landesverweisung ihrer Familien S. 75. |
|
| Viertes Kapitel. Der Wahehe-Aufstand | 78 |
|
Raubzüge Quawas, Gegenmaßregeln S. 79. — Bautätigkeit auf der Station S. 79. — Ramassanfest der Mohammedaner S. 81. — Die „Frauenfrage“ in Uhehe S. 82. — Versammlung aller von Tom eingesetzten Jumben S. 83. — Sultan Merere S. 85. — Gute und schlechte Botschaften S. 87. — Großfeuer S. 87. — Die katholische Mission, Karawanenverkehr S. 89. — Neue Überfälle durch die Wahehes S. 91. — Der Stationsgarten S. 92. — Eine erfolglose Expedition S. 93. — Mordanfall bei der Station S. 95. — Toms Abmarsch, das Leben in der „Stadt“ S. 97. — Ankunft des Leutnants Braun, Mereres Besuch S. 98. — Afrikanische Dienstbotenleiden S. 99. — Gesundheitsstand der Station, die Totos S. 100. — Blinder Lärm, Ankunft von Missionaren S. 101. — Der Gartenbau S. 102. — Rückkehr Toms, Jagderlebnisse, Schlachtfest S. 103. — Kriegsspiele, Osterfest S. 105. — Die Wahehe-Hilfstruppen S. 106. — Schauri mit Merere S. 107. |
|
| Fünftes Kapitel. Expeditionen gegen Quawa. Gouverneur Oberst Liebert | 108 |
|
Toms Abmarsch, Ahnenkultus der Schwarzen und deren Begräbnissitten S. 108. — Toms Rückkehr, Quawa auf der Flucht, Ankunft des Leutnants Kuhlmann mit Askaris S. 111. — Trägerlöhne S. 112. — Große Expedition gegen Quawa S. 113. — Unser neues Haus und dessen Einrichtung S. 115. — Zahlmeister Winklers Tod und Begräbnis S. 117. — Ein Schreiben Toms über seine Expedition und den Kampf in den Felsenhöhlen S. 119. — Toms Rückkehr S. 121. — Fruchtbarkeit des Landes, Verkehrsverhältnisse und Kolonisation S. 122. — Ankunft des Gouverneurs S. 124. — Neue Expedition gegen[S. XI] Quawa unter Teilnahme des Gouverneurs S. 125. — Kiwanga und sein Kontingent S. 127. — Rückkehr und Erlebnisse der Expedition S. 129. — Verstärkung der Station in Uhehe, der Gouverneur spricht seine Anerkennung aus und verabschiedet sich S. 130. |
|
| Sechstes Kapitel. Auf Safari. Beendigung des Wahehe-Aufstandes und Quawas Tod | 131 |
|
Schwere Erkrankung, auf Sommerfrische S. 131. — Die Vegetation des Landes S. 133. — Steppenbrand S. 134. — Rückkehr, neue Expedition S. 135. — Jagdabenteuer des Leutnants Braun, Erfolge der Expedition S. 136. — Unsere Dienstboten, eine „mpepo“ S. 137. — Heimkehr der siegreichen Expedition S. 138. — Mereres Besuch, auf Safari S. 139. — Im Urwalde, Baumriesen S. 141. — Tal des Muúngu, Aberglauben der Schwarzen S. 142. — Förster Ockel, v. Prittwitz S. 143. — Kanugare, die Landschaft Hangana Mwakikongo S. 146. — Scharmützel mit den feindlichen Wahehes, Nahrungsmangel S. 147. — Sergeant Richter S. 148. — Rückkehr nach Iringa S. 149. — Die Händler, europäische Post, Überläufer S. 150. — Christabend und Neujahr S. 151. — Hauptmann Ramsay, Pater Ambrosius und dessen Nachrichten S. 152. — Verlauf einer Expedition gegen Quawa S. 153. — Bau einer Moschee, eines Hospitals und einer Schaurihütte S. 154. — Tod des Unteroffiziers Karsjens S. 155. — Militärisches Leben auf der Station S. 156. — Vasallentreue der Wahehe S. 157. — Feldwebel Merkl S. 159. — Ramassan, Tom schwer erkrankt S. 160. — Neue Niederlage Quawas und dessen vollständige Isolierung S. 164. — Auf Erholung, Lagerleben S. 168. — Die Landwirtschaftliche Versuchsstation Dabagga, Anwerbung der Arbeiter S. 171. — Iringa wird Poststation, Hauswirtschaft S. 173. — Tod des Tischlers Wunsch S. 176. — Ein Löwenabenteuer S. 177. — Quawas Tod S. 179. — Siegesjubel S. 182. — Quawas Kopf S. 183. |
|
| Siebentes Kapitel. Im Frieden. Besichtigungsreisen | 184 |
|
Personalien, Erinnerungen S. 185. — Pockenepidemie, Geburtstag S. 187. — Missionsschwestern S. 187. — Kiwanga, v. der Marwitz S. 189. — Auf Safari: Zelewski-Denkmal S. 189. — Der Jumbe Lupambili und die jüngsten Pflegekinder S. 191. — Die Ruaha-Quelle S. 191. — Beim Sultan Merere S. 193. — Die Malerei der Schwarzen S. 193. — Wildherden S. 194. — Kibokojagd S. 195. — Verteilung der Jagdbeute S. 197. — Der Wüstenkönig S. 197. — Mein erstes Kiboko S. 199. — Mondscheinzauber[S. XII] S. 199. — Dr. Fülleborn S. 201. — Die schwarzen Pocken, wieder in Iringa S. 201. |
|
| Achtes Kapitel. Abschied von Iringa. Auf der Heimreise | 202 |
|
Erdbeben S. 202. — Weihnachten, Missionsgesellschaften S. 203. — Abschiedsfeier S. 204. — Auf der Heimreise, Todesfall S. 205. — Heißes Klima, Fieber, Erinnerungsstätten S. 207. — In Kilossa, bei Pater Oberle S. 209. — Die Jumben S. 209. — Die erste Europäerin, an der Grenze der Zivilisation S. 211. — Eine deutsche Ansiedelung, die evangelische Mission S. 211. — In Dar-es-Salaam, an Bord des „Herzog“ S. 212. |
|
| Neuntes Kapitel. Wie unsere Plantage entstand | 213 |
|
Naturschönheit, Arbeiterfrage S. 215. — Urbarmachen des Waldes S. 217. — Hüttenbau, Arbeitsordnung S. 219. — Schlagen und Brennen des Waldes, Beetanlage S. 221. — Störche und Heuschrecken, Hausbau S. 223. — Arbeiterwohnungen, der Garten S. 225. — Gastfreundschaft, die Usambarabahn S. 227. — Heimweh nach Afrika, Jagdausflüge S. 229. — Aufstand, Besuch des Vaters S. 231. — Aussichten für Ansiedler S. 233. — Zukunftshoffnungen S. 235. |
|
| Anhang | 237 |
enn ich an alle die inhaltschweren Vorreden denke, die Verfasser oder Verleger ihren literarischen Erzeugnissen als Empfehlung mit auf den Weg zu geben pflegen, dann kommen mir doch gelinde Zweifel. Eines schickt sich nicht für alle, und was den mehr oder weniger anmutigen Kindern der Muse recht ist, braucht den anspruchslosen wirklichkeitsnüchternen Kindern der Muße einer afrikanischen Hausfrau noch lange nicht billig zu sein. Denn die nachstehenden Tagebuchblätter geben in der Tat nur die Aufzeichnungen wieder, zu denen ich in den ersten Jahren meines ostafrikanischen Hausfrauenlebens gelegentlich Zeit fand.
Für den Entschluß, diesen Blättern einige Worte zur Einführung voranzusetzen, war zunächst der Wunsch entscheidend, diesen bescheidenen literarischen Versuch dem Wohlwollen meiner Leserinnen zu empfehlen. Daß ich die zuweilen unter recht erschwerenden Umständen zu Papier gebrachten Notizen dereinst der Öffentlichkeit übergeben würde, ahnte ich freilich noch nicht, als ich Herrn v. Wissmann das Versprechen gab, ein möglichst getreues Tagebuch zu führen; die Ausführung stellte zuweilen recht hohe Anforderungen an Willens- und an Körperkraft, besonders wenn es galt, nach beschwerdereichem Marsche die Ereignisse des Tages noch schriftlich festzulegen, anstatt der wohlverdienten Ruhe zu pflegen. Die Energie zur Durchführung dieser selbstauferlegten Pflicht auch unter schwierigen Verhältnissen verdanke ich dem Beispiel meines Gatten.
Dann aber möchte ich mit diesem Vorworte der gesellschaftlichen Pflicht persönlicher Vorstellung nachkommen, indem ich die[S. 2] Vorgeschichte der Entstehung dieser Tagebuchblätter kurz kennzeichne. Da muß ich denn bis auf unsere Schulzeit in Liegnitz zurückgehen. Daß der damalige Schüler der Ritterakademie, Tom Prince, und ich füreinander bestimmt seien, das unterlag für uns beide schon damals keinem Zweifel, und diese Schülerliebe hat sich bewährt; aus den Kindern wurden Leute, das Schicksal führte uns weit auseinander: Tom wurde Offizier beim Infanterie-Regiment Nr. 99 in Straßburg im Elsaß und ich kam nach Königsberg i. Pr., wo mein Vater als Rittmeister bei den Wrangel-Kürassieren stand. Das war ungefähr das Höchste, was wir uns im Deutschen Reiche an Entfernung leisten konnten, es sollte aber noch ganz anders kommen. Zu jener Zeit zogen die kühnen und erfolgreichen Kämpfe Hermann Wissmanns und seiner tapferen Schar die Augen der Welt auf unsere junge Kolonie. Zu dem Tatendrang des jungen Leutnants kam die Sehnsucht nach den Tropen, wo einst seine Wiege gestanden. Tom ist auf der Insel Mauritius (Ile de France) geboren, wo sein Vater englischer Polizeigouverneur war, er entstammt einer englischen Familie; seine Mutter war deutscher Abkunft, eine Tochter des Missionars Ansorge, der viele Jahre hindurch in Indien gewirkt hat. So hielt es den jungen Offizier nicht länger in dem Einerlei des Garnisondienstes.
Der Name Wissmann war ein mächtiger Magnet für die kriegerische Jugend Deutschlands; zur Zeit, als Tom auf eigenes Risiko sich auf den Weg machte, um in der Wissmannschen Schutztruppe Dienst zu nehmen, standen ungefähr 1500 Anwärter vor ihm auf der Liste. In Sansibar heuerte er gleich nach seiner Ankunft eine Dhau, um so rasch als möglich sein Ziel zu erreichen. Diese Ungeduld sollte verhängnisvoll werden: das kleine Fahrzeug erlitt Schiffbruch, die arabische Bootsmannschaft ertrank, und nur Tom wurde gerettet, nachdem er 13 Stunden lang mit Hilfe einer Holzkiste sich über Wasser gehalten! All sein Gepäck, sein Geld, seine Papiere waren verloren. So gelangte er zu Wissmann, der ihn vorläufig seiner Truppe beigab, dann aber als Offizier einstellte, nachdem die erforderlichen Papiere[S. 3] aus Deutschland besorgt waren. Die Taten Wissmanns, dieses im Kampfe heldenmütigen, im Aushalten von Anstrengungen und Entbehrungen des Tropenkrieges unermüdlichen und vorbildlichen Führers der ersten deutschen Kolonialtruppe, gehören der Geschichte an und damit auch die meines Mannes. Was ich in jenen sieben Jahren durchlebte, in Furcht und Hoffnung um das Leben des Jugendgeliebten bangend, mit welcher Sorge die spärlichen Zeitungsnachrichten über neue Kämpfe und Expeditionen der Wissmannleute das Mädchenherz erfüllten, bis endlich einmal wieder ein Brief von Toms eigener Hand mir für kurze Zeit Beruhigung gab — das weiß nur ich und der allgütige Gott, der den Geliebten mir erhielt und mir die Kraft verlieh, das schier Übermenschliche zu tragen! So wurde mir der Brautstand zur strengen Lebensschule, zur Vorbereitung auf meinen Beruf als deutsche Offiziersfrau in den neugewonnenen Kolonien.
Endlich nach sieben langen bangen Jahren hatten die Verhältnisse in Deutsch-Ostafrika sich soweit geklärt, daß Tom mich nach seiner neuen, schwererkämpften Heimat hinüberholen konnte, an der auch ich mir in meinem sorgenvollen Brautstand ein Heimatsrecht erworben zu haben glaube.
Am 4. Januar 1896 war unsere Hochzeit in Militsch, und nach etwa einem halben Jahr, das wir noch in Deutschland verbracht, trafen wir in Dar-es-Salaam ein und warteten dort auf weitere Bestimmung für meinen Mann. Der letzte, gefährlichste Gegner der deutschen Herrschaft, der Sultan Quawa von Uhehe mit seinen tapferen Scharen, galt nach der Erstürmung seiner Hauptstadt für überwunden, ein Erfolg, an dem mein Mann in anerkannter Weise beteiligt war. Aber die Zeit sollte lehren, daß ein solcher Schlag nicht genügt, ein afrikanisches Kriegervolk niederzuhalten, dessen Hauptkriegskunst darin besteht, den Stößen des Angreifers geschickt auszuweichen.
Nach einem kurzen Aufenthalt in Dar-es-Salaam, wo mir von allen Seiten mit der größten und freundlichsten Fürsorge begegnet wurde, erhielt mein Mann den Befehl, die Station Perondo zu übernehmen, die an der Grenze von Uhehe neu gegründet war.[S. 4] Von dort aus sollte er die friedliche Unterwerfung des Volks der Wahehe weiter fördern. Nähere Kunde über die Station wie über die augenblickliche Stimmung Quawas und seiner Wahehe war aber zunächst nicht zu erhalten, denn die letzten Berichte waren infolge der Überschwemmungen im Inneren des Landes noch nicht zur Küste gelangt. Daß der verheißungsvolle Name Dar-es-Salaam, Hafen des Friedens, den wir bei unserer Einfahrt in die prachtvolle Bucht als günstiges Vorzeichen begrüßten, in Wahrheit nur geographische Bedeutung für uns haben sollte, ahnten wir freilich nicht, als wir hoffnungsvoll den Marsch nach der Stätte unseres Wirkens antraten.
Zum Schluß möchte ich noch einem Bedenken begegnen, das vielleicht gegen den Gebrauch so mancher fremdklingender Ausdrücke in den nachfolgenden Blättern erhoben werden könnte. Es ließe sich gewiß manches durch entsprechende deutsche Bezeichnung ausdrücken oder umschreiben, und in einem Buche mit lehrhafter Tendenz nach irgendwelcher Richtung sollte der Verfasser stets bemüht bleiben, die so oft gerügten Anleihen an die arabischen und Suaheli-Mundarten sowie an die uns aus den englischen Kolonien überkommenen Bezeichnungen zu vermeiden. Hier sind jedoch nur die frischen persönlichen Eindrücke wiedergegeben, die eine gänzlich „unliterarische“ junge Frau in ihrem Tagebuche zunächst für sich und ihre nächsten Angehörigen skizzierte; würde da nicht ein gut Teil von unmittelbarer Anschauung, „afrikanischer Lokalfärbung“ dieser anspruchslosen Skizzen verloren gehen? In diesem Sinne bitte ich für diese kleine Unart meines schriftstellerischen Erstlings um freundliche Nachsicht.
Seit zwei Jahren leben wir nun als friedliche, betriebsame Pflanzer in der neuen Heimat, nachdem mein Gatte den Degen mit dem Pfluge vertauscht. Gott schenke dem schönen Lande, das mit so vielem edlen Blut auf dem Schlachtfelde erkämpft, das so schwere Opfer an Leben und Gesundheit unserer wackeren Pioniere der Kultur gekostet, eine segensreiche Entwicklung. Noch stehen wir am Anfange dieser Kultur, möchte deutscher Unternehmungs[S. 5]geist sich mehr und mehr auf diesem neuen Gebiete betätigen, der Lohn wird nicht ausbleiben.
Möchten vor allem auch die deutschen Frauen regen Anteil nehmen an der friedlichen Eroberung des herrlichen, zukunftsreichen Landes. Der Mann gründet das Haus, die Frau hält es! Der Satz gilt heute mehr wie je auch für unsere Kolonien. Könnte ich doch Euch, Ihr deutschen Frauen und Mädchen, für unser junges Deutschland über See gewinnen. Was Ihr an gewohnten Annehmlichkeiten des Lebens, an Geselligkeit, Vergnügungen und Anregungen aller Art hier im Vergleich mit der alten Heimat entbehren würdet, es wird mehr als aufgewogen durch die Betätigung und Pflichterfüllung, in der Ihr Euch an der Seite eines geliebten Gatten ausleben könnt. Wahrlich, es ist ein schönes Los, in diesem Siegeszuge deutscher Kultur eine Stelle einnehmen zu dürfen! Deutsches Familienleben, deutsche Jugend in Ostafrika — wenn dieses hohe Ziel erreicht ist, dann erst strahlt unsere neue Heimat als herrlicher Edelstein in der deutschen Kaiserkrone!
Sakkarani (West-Usambara), Winter 1902.
Magdalene Prince geb. v. Massow.
Aulepschamba, 28. Mai 1896.
nser erster Marschtag liegt hinter uns. Eigentlich kann man diese Bezeichnung nicht gut anwenden, denn wir kamen nur eine halbe Stunde weit von Dar-es-Salaam weg. Der kurze Marsch hatte nur den Zweck, die Kompagnie und die Träger aus der Stadt hinaus zu bekommen; es ist das eine hergebrachte Sitte. Wenn die Leute im Lager angelangt sind, merken sie nämlich erst, was ihnen noch alles für den bevorstehenden Marsch fehlt, und schnell wird das dann aus der noch leicht erreichbaren Stadt nachgeholt.
Die Tage vorher schon war ich in fieberhafter Aufregung, konnte aber leider nicht viel tun und bestimmen, da mir die Verhältnisse noch zu fremd waren. Der Tagesanbruch fand uns bereits in den Kleidern, und die letzten Sachen wurden zusammengepackt. Tom (mein Mann) war fast die ganze Zeit fort, um die Lasten an die Träger zu verteilen und nach seiner Kompagnie zu sehen; als das alles besorgt war, schrieb ich noch an Eltern und Geschwister. Dann kam Herr v. Natzmer[1] und holte mich ab.
Eine so große Karawane hatte ich natürlich noch nie gesehen; auch anderen, die schon lange draußen waren, war sie etwas Neues.[S. 7] Wie ein unentwirrbarer Knäuel wälzte sich die Masse dahin. 130 Askaris (Soldaten), weit über 500 Träger, beladen mit Kisten der verschiedensten Arten, Paketen in Leinwand und in schwarzem Ledertuch, 1 Maxim- und 1 Berggeschütz, Zelte, Gewehre, Kästen mit Schweinen, Puten, Hühnern, Tauben, Enten, Schafen, Ananas, Mangos, Kokosnüssen, Weiber und Kinder in hellen oder vielmehr dunklen Haufen. Da beinahe jeder Askari zwei Boys (ich muß schon die bequeme englische Bezeichnung beibehalten, die sich in unserer Kolonie so fest eingebürgert hat, daß sie kaum noch zu verdrängen ist, umsoweniger, als es ein deutsches Wort, das diesen vielseitigen Begriff, der die ganze Stufenleiter vom „Silbendiener“ bis zum „Wichsier“ und „Putzkameraden“ umfaßt, nicht gibt) und zwei Weiber hat, der Träger aber auch von jeder Sorte eins, ist die Karawane gegen 1100 Mann stark. Die Askaris zogen voraus mit Pfeifen- und Trompetenschall, dann kamen sämtliche Offiziere der Schutztruppe, die uns bis zum ersten Lager begleiteten, zum Schluß die Träger mit ihrem Anhang, die mit dem üblichen Geschrei von den zurückbleibenden Abschied nahmen. Es war ein sinnbetäubender Lärm.
Im Lager wimmelte es wie in einem Ameisenhaufen, alles rührte sich in einer seltenen Geschäftigkeit. Die Zelte wurden aufgeschlagen, und rasch waren wir mit unseren liebenswürdigen Begleitern um den Frühstückstisch versammelt. Unsere niedlichen Frühstückskörbe, unsere Zelte, die Tische, Stühle und anderes Hausgerät, welches mein Mann für mich angeschafft hatte, wurde gebührend bewundert, dann aber auch fleißig getrunken und gegessen. Da es bald dunkel wurde, kehrten die Herren der Schutztruppe zurück, nachdem mein Mann ihnen für ihre Freundlichkeit gedankt hatte. Mit besonderem Danke sei hier noch einmal des Herrn v. Natzmer gedacht.
Es bedeutete diese Trennung für uns nicht nur einen Abschied von unseren Begleitern, sondern auch von der Kultur, denn von nun an sind wir nur noch auf uns allein angewiesen. In den nächsten Jahren werden wir kaum mit anderen Europäern zusammentreffen, und von Kultur nur das haben, was wir uns[S. 8] selbst schaffen. Ein ganz leichter Abschied war es also nicht. Bei der Trennung ließ mein Mann von den Askaris Herrn v. Natzmer noch ein dreifaches Hoch ausbringen, der diesen Abschiedsgruß in gleicher Weise erwiderte. Die Hochs klangen, wie es zu Hause kaum hätte besser sein können. Als die Herren uns verlassen, setzten wir uns mit unseren Reisebegleitern zu unserem ersten Mittagsessen auf dem Marsche. Lange nach dem Zapfenstreich trennten wir uns erst. Wir waren uns einig, daß wir trotz aller uns entgegengebrachten Liebenswürdigkeit und vieler schöner, gemeinsam verlebter Abende gern von Dar-es-Salaam fortgingen. An der Küste spürt man zu viel von den Nachteilen Europas, ohne dessen Vorteile zu haben.
Als gute Vorbedeutung für das Leben in der Wildnis nahm ich die Heimatswünsche, die am Morgen kurz vor dem Abmarsche uns die Post aus Deutschland gebracht hatte, an sich schon ein Ereignis, dessen Bedeutung jeder „Afrikaner“ zu würdigen weiß; für mich war es aber noch von besonderer Wichtigkeit; mein in Hamburg liegengebliebener Koffer mit all meinen Kleidern und aller Wäsche, Schuhen usw. war gleichzeitig angekommen, so daß ich meine gewohnte deutsche Garderobe noch mitnehmen konnte. Die sechzehn neuen, in indischen Läden von Männern fabrizierten Kleider sind mir doch nicht so bequem wie die in der Heimat gewohnten.
Ein dreibeiniger Hund kommt mitgelaufen, zukünftiger Kamerad von Schnapsel, meinem treuen, vierbeinigen Heimatsgenossen, den mir mein Vater schweren Herzens mitgegeben hatte.
Kongoramboto, 29. Mai 1896.
Um 5½ Uhr Reveille, um 6 Uhr abmarschiert. Da ich nicht ganz wohl war, mußte ich mich tragen lassen, ganz wie eine orientalische Fürstin: Großartige Sänfte mit Sonnendach und vier Träger, die zwei und zwei abwechselnd trugen, den Dolmetscher und einen Boy zur Seite, drei Stunden marschiert. Am Lagerplatz angelangt, sah ich von meinem Lehnstuhl aus dem Aufschlagen der Zelte zu: ein Schlafzelt und ein anderes zum Aufenthalt[S. 9] während des Tages. Unser Koch fängt an, mir zu imponieren. Es gab Huhn in afrikanischer Zubereitung. Unsere Leibgarde macht mir Spaß. Fünf Bengels in Khakianzug, kurzen Hosen, mit roten Aufschlägen und Achselstücken, unseren Reserve-Tropenhelmen und Toms Mützen. Die beiden kleinsten sehen aus wie schwarze Amoretten, und wenn sie auf dem Marsche hin- und herlaufen, ist es eine Freude, zuzusehen.
Kisserawe, 30. Mai 1896.
Lager nahe der auf einem hohen Hügel gelegenen Missionsstation. Der Marsch ging durch hügeliges, dicht bewaldetes Gelände. Ich wurde wieder getragen, war sehr müde und wollte schlafen; doch war die Gegend so schön, daß es mir keine Ruhe ließ, und ich soviel als möglich von meinem Lager aus sehen wollte. Tom fing sehr viel Schmetterlinge, die wir des Abends verpackten. Auf dem Marsche kurze Frühstücksrast an einer besonders malerischen Stelle. Tom hat alles sehr nett eingerichtet, es ist wie im Märchen: „Tischlein deck dich“ — im Nu stehen die verschiedensten Getränke und Chakula (Essen) vor mir, um sogleich wieder zu verschwinden, wenn zum Aufbruch geblasen wird. Essen — wieder Hühner, aber wieder anders zubereitet, und zwar sehr schön gebraten mit unglaublich wenig Butter; ich will dem Koch unsere Kochkunst lieber nicht beibringen.
Schnapsel trabt fleißig mit, da er aber zu eifrig auf die Jagd in die Büsche geht, müssen wir ihn anbinden, weil er uns doch sonst leicht abhanden kommen könnte. Kassuku[2] (unser Papagei) wird auf dem Kopf eines Trägers getragen und guckt sehr vergnügt zu seinem Käfig hinaus; im Lager klettert er auf Bäume und kommandiert sein „Gewehr ab“, „das Gewehr über“.
Das deutsche Kommando klingt in dieser Umgebung komisch, und zwar nicht nur aus dem Papageienschnabel; noch drolliger wirkt es aus dem Munde der schwarzen Soldaten. Die Kerls[S. 10] sind ganz famos einexerziert, sie marschieren mit einer Strammheit, wie unsere Soldaten zu Haus, machen „Kehrt“ und Schwenken usw., wie man es sich exakter kaum denken kann — und wie sie sich schlagen, haben sie auch schon zur Genüge bewiesen!
Kola, 31. Mai 1896.
Beim Abmarsch schenkte ich einem meiner Träger eine „Kokosnuß“, darob großes „Kelele“ (Geschrei). Die Boys wollten sie ihm wieder wegnehmen, sie fanden die Gabe zu verschwenderisch, da es jetzt nur noch schwer welche zu kaufen gab.
Gestern übrigens kam eine kleine Karawane mit einem Missionar und zwei Damen an unser Lager heran; dabei befand sich der kleine Sohn eines Häuptlings, der infolge einer früheren Anregung Toms zur Mission geschickt worden war, er suchte Tom sofort auf, und man erkannte seine Anhänglichkeit. Das Abc und ein paar deutsche Wörter hatte man ihm zwar beigebracht, er verstand aber deren Sinn noch nicht, so daß er sie herunter leierte wie ein aufgezogenes Uhrwerk. Er kam mit seinem schwarzen Lehrmeister.
Mlongoni, den 1. Juni 1896.
Heute ließ ich mich bis zum Frühstückszeltplatz tragen; doch länger hielt ich es nicht aus und setzte den Weg auf dem Maultiere fort. Es ging nun viel besser. Welche Freude machte es mir jetzt, die Gegend in ihrer ganzen Eigenart sehen zu können. Jede fremde Blume war mir willkommen, jeder Schmetterling, der uns umgaukelte, erfreute das Auge, und manch einer endete sein Dasein in unserer Sammlung. Bis jetzt sind wir auf einer vom Gouvernement angelegten Straße gewandert, heute bogen wir auf einen Negerpfad ein, den seiner Zeit auch die zweite, von Schelesche Waheheexpedition gegangen ist. Wir haben heute ein wunderschönes Lager bezogen und sind ganz abgesondert von allen Menschen, das ist zu schön!
Eine große Schlange haben wir gefangen. Wenn unsere Sammlung so fortschreitet, werden wir mit großen Koffern voll „Zoologie“ ankommen; schon jetzt sind Büchsen, Gläser und Kasten voll allerhand, das da kreucht und fleucht. Ich sah heute die[S. 11] Frau unseres zweiten Boys (Mabruk) und freute mich, daß sie mitgekommen war. In Dar-es-Salaam nämlich machten mir die Frauen von unseren Boys Juma und Mabruk „Besuch“. Das war sehr spaßhaft. Sie wollten trotz allem Bitten nicht mit. Die Juma gab sich sehr schüchtern, deshalb glaubte ich, sie würde sich nicht dazu bewegen lassen, denn Juma schwang ganz entschieden den Pantoffel. Er meinte: sie verdiente, wenn sie ihn im Stiche ließe, an die Kette zu kommen. Die andere hatte sehr gute silberne Armbänder an beiden Armen und Beinen, Ketten um den Hals, gute Tücher umgeschlagen und eines auf dem Kopfe, sowie Ringe an den Fingern. Sie kam in das Zimmer getänzelt, was hier als besonders vornehm und schick gilt und von den schwarzen Damen auch auf der Straße mit Hin- und Herwiegen des Oberkörpers geübt wird. Sie schaute mit ihrem jungen, runden, hübschen, schwarzen, durch ihren Nasenschmuck freilich verunstalteten Gesicht ganz keck in die Welt, schüchtern war sie durchaus nicht; sie bot mir einen „Jambo“ (guten Tag) und steuerte gleich auf den Spiegel zu, um sich ganz in ihren persönlichen Reiz zu vertiefen und den möglichst malerischen Faltenwurf ihrer Tücher auszuprobieren. Die Schwarzen verstehen es ausgezeichnet, sich mit Tüchern zu drapieren. Es liegt etwas ungesucht Malerisches darin. Sie besitzen übrigens große Geschicklichkeit, ihre Toilette vor aller Augen zu wechseln, ohne dabei mit unseren europäischen Anschauungen von Schicklichkeit in Konflikt zu geraten. Ich sagte „malerisch“, und in der Tat, diesen Abend sah ich einen Neger, der ein Stück Baumwollenstoff wie einen wallenden weißen Mantel umgehängt hatte und auf einer einsaitigen Gitarre entsprechend eintönige Musik zum besten gab. Entschieden ein anziehendes Bild.
Msenga, 2. Juni 1896.
Gleich vom Lager aus geritten, weshalb mir der Marsch sehr kurz vorkam. Bis zum ersten Ruheplatz sollte ich getragen werden, doch gab ich es bald auf. Das Sichtragenlassen ist nur auszuhalten, wenn man wirklich elend ist.
Viele Schmetterlinge, die es jetzt nach der Regenzeit mehr gibt (besonders an feuchten Orten) und viele seltsam erscheinende Tiere gesammelt, Molche, Schlangen und eine originelle Raupe, stachlig wie unser Igel, nur, daß die Stacheln am Finger hängen bleiben wie bei unseren Kletten und dann ekelhaft jucken. Diese angenehmen Kletten gibt es übrigens auch hier, beim Marsche machen sie sich sehr unangenehm bemerkbar. Auch eine Grasart mit kleinen Dornen ist sehr lästig auf dem Marsche. Die Engländer nennen sie bezeichnenderweise „wait a bit“.
Die Natur weist auch in Blumen manche europäischen Arten auf, so z. B. Winden der verschiedensten Sorten, gelbe, rote, blaue, lila; von Bäumen fiel mir der Reichtum an Akazien auf. Bei der Ruhepause unterhielt ich mich mit den Trägern; der „Engländer“, d. h. der englisch sprechende Schwarze, verdolmetschte. Die Leute erzählten, Quawa, der Sultan der Wahehe, werde sich nicht sehen lassen, das würde also gleichbedeutend sein mit Krieg. Welcher ungewissen Zukunft gehen wir entgegen!
Heute kamen wir durch einen Heuschreckenschwarm; der Himmel war buchstäblich schwarz, man kann es sich gar nicht vorstellen, lauter schwarze Punkte, die hin- und herschwirren, und ringsum alles, alles abgefressen, kein Blatt, kein Grashalm, nur die langen, dürren Stiele ragen noch in die Luft. Kommt der Schwarm aber tiefer und scheint die Sonne auf die glitzernden Flügel, dann funkelt alles weiß, wie Schneegestöber. Der Schwarm kann sich so verdichten, daß sich, nach dem Bibelwort, „die Sonne verfinstert“. Leute nur 10 Meter entfernt, sieht man nicht mehr. Der Schwarm läßt sich nieder, dann ist die Erde wie mit einer schillernden Haut überspannt. Flügel an Flügel, manchmal sogar dicht aufeinander sitzend. So etwas könnt Ihr Euch nicht vorstellen. Es wäre schön anzusehen, wenn es nicht die Zerstörung aller Vegetation bedeutete.
Mafisifähre, 3. Juni 1896.
Ein schöner Tag liegt hinter uns. Heute habe ich erst einen wirklichen Marsch mitgemacht. Man kann die Marschleistungen[S. 13] einer so großen Karawane allmählich steigern. Zu berücksichtigen ist, daß, wenn die Tete auch nur 3 Stunden marschiert, es für die Queue mindestens 4½ Stunden bedeutet; deswegen machen wir auch immer eine Ruhepause, um den Nachtrab herankommen zu lassen. Für diesen war es also ein anstrengender Tag, denn wir marschierten 3 Stunden und ritten 2 Stunden. Für mich war’s eine Kraftprobe und machte mir viel Spaß; obgleich manchmal der Weg so eng und so ausgehöhlt war, daß man den Fuß nicht ordentlich setzen konnte. Die Gegend war sehr schön, teilweise wie Parklandschaft, dann wieder wie ein Obstgarten, nur daß hier der Reiz des Unberührten sich darüber breitet. Das Lager war sehr hübsch wie eine Wagenburg anzuschauen. Unsere drei Zelte machen sich recht schön, dann zur Seite der Koch und die Boys mit ihrem Hofstaat in kleinen Zelten aus 3 Stöcken und einem Stück Tuch verfertigt; ringsum unsere Lasten mit den Trägern und ihren Zelten, so bunt und zusammengewürfelt.
Es ist spaßig, welches Vertrauen die Leute zu Tom haben; wie die Kinder sich Rat bei ihrem Vater holen, so kommen die Schwarzen zu ihm. Dann fällt er salomonische Urteile; z. B. zwei hatten sich geschlagen, der eine war auf den Kopf getroffen — dafür durfte er dem anderen mehrere Ohrfeigen versetzen; er war so erregt, daß er die ersten Male in die Luft schlug, ehe er traf. Schwieriger war der zweite Fall: Ein Träger hatte dem anderen mit Absicht ein Loch in sein Tuch gebrannt. Ein auf den Austausch der Tücher zwischen Schuldigem und Geschädigtem anspielender Vergleich wurde von letzterem abgelehnt, weil sein Tuch länger war als das des anderen. Zur Entschädigung durfte er sich dann ein Stück aus des Gegners Tuch ausschneiden, um das seinige wieder zu flicken. Beide zogen befriedigt und vergnügt ab.
Wir sind mit unserer Karawane sehr zufrieden: von den 1100 Menschen sind nur 20 Träger fortgelaufen. Wir werden jetzt viel von den Jumben (Dorfhäuptlingen) heimgesucht, welche Schafe, Hühner, Eier, Ziegen zum Geschenk bringen, dafür aber[S. 14] tüchtig bezahlt werden müssen; den ganzen Tag hocken sie um uns herum und wollen unterhalten sein, bis man sie endlich mit einem „Kwaheri“ (Lebewohl) fortschickt. Aber man ist auf sie angewiesen, denn sonst bekommt man kein Chakula, und man kann sehr froh sein, wenn sie überhaupt etwas bringen; ist ein Europäer wenig beliebt oder wenig bekannt, so bekommt er nur das Notwendigste. Mir ist es bis jetzt sehr gut gegangen, denn für den „Sakkarani“ (Spitzname meines Mannes, auf den ich sehr stolz bin, denn er bedeutet: der keine Furcht kennt) gehen sie durchs Feuer, und da geht es der „Bibi“ natürlich auch gut. Dr. C. Velten, der sich um die Suahelisprache mit großem Erfolg bemüht hat, schreibt: „der verbreitetste Spitzname ist bana sakkarani, d. h. der sich wie ein Betrunkener in jede Gefahr stürzt“; die Schwarzen können sich nämlich nicht vorstellen, daß es einen nüchternen Menschen gibt, der so mutig allen Feinden begegnet. Wie oft wurde mir gesagt: „Ihr Mann ist zu tollkühn, ein Draufgänger wie Blücher“ — aber stets behielt er kaltes Blut dabei, denn z. B., hätte er sonst schwerlich im heftigsten Kampfe bei der Erstürmung Iringas einem Offizier das Leben gerettet, indem er ihm zurief: „Aber Menschenskind, Sie stehen ja vor einer Schießscharte“ und — bums — schon knatterte ein Schuß daraus hervor. Derselbe Offizier wurde doch noch später bei demselben Gefecht verwundet. Eier und Hühner schenkt man mir persönlich, dafür spendiere ich dann Kognak. Heute brachte einer ein ganzes Poesiealbum an, in welchem sich die einzelnen Europäer durch schöne Verse verewigt hatten; ich war die erste Dame in dieser Sammlung. Bis jetzt hat kein Jumbe mehr als zwei weiße Frauen gesehen. Die Jumben kommen zum Sakkarani von weit her, der eine sogar von weit jenseits des Flusses.
Von der Mabrukschen Frau bekam ich vier Eier geschenkt. Schon in Dar-es-Salaam bekam ich welche von ihr, und ohne daß ich mich revanchiert hatte, brachte sie mir einen Teller Kuchen zum Geschenk, sehr ähnlich unseren Waffeln, ganz knusperig, also sehr schön.
Nordufer des Kingani, beim „Husarenjumben“,[3] 4. Juni 1896.
Heute wurde nicht so früh vom Lager aufgebrochen, denn wir wollten nur über den Kinganifluß mit der von Herrn v. Soden geschaffenen Fähre hinübersetzen. Durch diese, wie durch so viele andere grundlegenden Einrichtungen hat Herr v. Soden sich den dauernden Dank der Kolonie erworben. Es war für die Schwarzen ein Ruhetag, für die Europäer aber desto größere Arbeit und für mich anstrengender als ein Marschtag.
Die Fähre ist so klein, daß Maultiere und Esel den Fluß durchschwimmen mußten, nur an Stricken festgebunden; währenddessen wurde fortwährend ins Wasser geschossen, um die Krokodile abzuhalten. Es ist häufig vorgekommen, daß die Tiere im Wasser von den Bestien angefallen wurden. Der Übergang dauerte sechs Stunden. Für jeden Passanten mußten an den Jumben, der die Fähre in Ordnung hält, 2 Pesa gezahlt werden. Unter der Last der ihm in Kupfer ausgezahlten 2200 Pesas wankte unser „Husarenjumbe“ tief gebeugt aber seelenvergnügt nach Hause.
Wir hatten noch eine halbe Stunde Marsch. Hier sahen wir Vieh auf der Weide; ein gutes Zeichen, denn früher versteckten die Jumben vielfach ihr Vieh aus unbegründeter Angst, daß es ihnen weggenommen werden würde.
Heute wurden die ersten Träger bestraft, sie hatten „Chakula“ bei den Eingeborenen gestohlen. Nach neun Tagen die erste Bestrafung unter so viel Leuten; wir machten abends einen Gang durch das Lager. Die vielen kleinen Feuer, an denen die Leute an primitiven Herden (drei Steine und ein Topf mit Reis darauf) ihr Essen kochten, boten einen hübschen Anblick. Einige der Neger spielten Karten.
Geringeri, 5. Juni 1896.
Heute liegt ein tüchtiger Marsch hinter uns — ohne Pause von 6 Uhr 4 Minuten bis 12 Uhr 49 Minuten. Da ich es[S. 16] verschmähte, mich tragen zu lassen, mußte ich diesen wenig angebrachten Stolz mit recht schmerzhaften Blasen an den Füßen bezahlen. Der Weg war oft so eng und ausgehöhlt wie eine Straßenrinne, durch die das Wasser abfließen soll; es ging viel durch Dornengestrüpp und mannshohes Gras, welches einem fortwährend ins Gesicht schlug — eine wenig angenehme Zugabe zu dem ohnehin schon so anstrengenden Marsch. Im ganzen war die Natur recht ausgestorben: die fast blätterlosen Bäume mit ihren Dornen und das langstielige gelbbraune Gras gaben der Landschaft ein ödes Ansehen. Um so mehr freuten wir uns, als endlich vor uns dichtbelaubte Bäume sichtbar wurden, denn sie verhießen uns fruchtbares Land und somit aller Wahrscheinlichkeit nach auch Wasser, ein Dorf — und einen guten Lagerplatz. Bald trafen wir auch auf die ersten Schamben (Felder), und eine halbe Stunde vor dem Marschziele empfing uns auch schon der Jumbe mit seinen Untertanen.
Heute habe ich mich auch zum ersten Male um die Küche gekümmert: immer noch Huhn und Reis, dazu ein Täubchen, welches mein Mann mir alle Tage schießt und welches mir trefflich schmeckt. Ich sah auch heute die erste Affenfamilie und den ersten bunten Tropenvogel, der sich in dieser Einöde ganz prächtig ausnahm. Auch Ebenholzbäume sah ich viel.
Es scheint, als ob selbst die meist stumpfsinnigen Träger veredelndem Einflusse nicht unzugänglich sind. Die ersten Tage blieb alles stumm, wenn ich an ihnen vorüber kam und ihnen „Jambo“ (guten Tag) bot, heute schrie mir alles schon entgegen, ja, einer der Träger spielte sich als Kavalier auf, indem er mir eine seltene schöne Blume brachte; ich habe mich darüber recht gefreut. Am Morgen sah ich der Mabrukschen Frau zu, wie sie ihre Ohrenverzierungen herstellte: sie wickelte in gelbe und rote Farbe getauchte Zeugstreifen sauber auf und steckte sie in die ungefähr 1 cm großen Löcher in den Ohrmuscheln.
Den Jumbe von Perondo sind wir glücklich los, er muß voran marschieren, um uns Brücken über die Flüsse bauen zu[S. 17] lassen. In Dar-es-Salaam belästigte er uns unaufhörlich. Übrigens macht er einen ganz harmlosen, gemütlichen Eindruck.
Mkulassi, 6. Juni 1896.
Um 4½ Uhr schon zum Aufbruch geblasen, um 5½ Uhr Abmarsch aus dem Lager. Da wir den Geringeri passieren mußten, ging es sehr langsam vorwärts, denn die Notbrücke, die über den Fluß gelegt war, verdiente ihren Namen in der Tat. Die Tiere mußten den Fluß durchschwimmen, die Träger krabbelten langsam hinüber.
Um 1½ Uhr im Lager. Zur Abwechslung gab es heute einmal Ziege anstatt Huhn, für uns alle sehr erfreulich, auch Schnapsel profitierte davon. Der Hund hat uns viel Sorge gemacht; infolge eines Insektenstiches war ihm ein Auge ganz blutunterlaufen, so daß ich schon fürchtete, er würde es verlieren; ich habe es ihm tüchtig mit nassen Umschlägen gekühlt und hatte die Freude, es bald wieder heil zu sehen.
Tom geht es heute gar nicht gut, seit mehreren Tagen schon hat er Fieber, natürlich ist auch meine Stimmung dementsprechend. Mit der Kocherei fängt es an, besser zu werden.
Magugoni (Kinganifluß), 7. Juni 1896.
Heute wird Tom von allen Seiten von Eilboten bestürmt, infolgedessen hat er riesig viel zu tun. Um den Tag zu feiern, haben wir unsere Herren zu einer Bowle eingeladen. Der Marsch war heute wieder sehr schön, durch ein fruchtbares Stück Land. Vorgestern kamen wir durch ein 4 bis 5 m hohes Maisfeld, wohl eine halbe Stunde lang; das Marschieren war zwar nicht angenehm, aber wir freuten uns doch, da uns Tom erzählte, so fruchtbares Feld habe er seit 3 Jahren nicht gesehen, denn die Heuschrecken hätten zu arg gehaust; jetzt ist diese gräßliche Landplage, Gott sei Dank, im Aussterben. Gestern noch sahen wir ganz abgefressene Grashalme, mit großen braunen länglichen Punkten — tote Heuschrecken, zu fünf und sechs an einem Halm. Viele Wildspuren, aber kein Wild zu sehen, da das Gras,[S. 18] 3 bis 4 m hoch,[4] jeden Umblick hinderte. Zur Linken lugten zwischen einzelnen Baumgruppen waldige Hügel herüber, und zur Rechten zeichneten sich mit allen landschaftlichen Einzelheiten, mit ihren Wölbungen und Tiefen, die wunderschönen 8000′ hohen Uluguruberge in der durchsichtigen, klaren Luft ab. Wir marschierten 6¾ Stunden, eine ganz ansehnliche Leistung, wenn man den schmalen, gewölbten „Straßenrinnen-Weg“ in Betracht zieht, der, von darüber fallendem Gras bedeckt, uns zwingt, immer hübsch vor uns hinzusehen und der Steine und Wurzeln zu achten, denn das Stolpern bringt aus dem Marschtempo. Dazu die besondere Eigentümlichkeit, daß es hier kaum Bäume ohne Dornen gibt. Ich hatte keine Gamaschen angelegt und mußte diese Unterlassung beim Reiten durch zahlreiche Dornenrisse büßen.
Chansi, Kinganifluß, 8. Juni 1896.
Heute war ein schöner Tag — beinahe ein Ruhetag! Es wurde erst um 6¼ Uhr zum Aufbruch geblasen, dann ein kurzer Marsch bis zum Fluß, den wir in Kanoes kreuzten; die Leute wateten durch. — Nachmittags schossen die Herren die Gewehre ein. Während ich hier schreibe, lodern ringsum große Feuer gen Himmel, an denen schwarze Gestalten umherhocken. Die Feuer brennen die ganze Nacht hindurch, in ihrem Bereiche suchen sich die Leute ihre Lagerstätten.
Mihama, 1½ Stunde westlich von Tulu, 9. Juni 1896.
Trotzdem schon um 5¼ Uhr zum Abmarsch geblasen wurde, kamen wir doch erst um 7½ Uhr aus dem Lager. Die Soldaten hatten einige Gnus geschossen, die erst unter die Askaris verteilt wurden — ein großes Ereignis! Nachmittags war wieder Fleischverteilung, bei der ich zugegen war; mit welcher Gier stürzten sich die armen Kerls auf die leckere Beute! Auch einige Hartbeeste waren geschossen worden, darunter eins von meinem Mann,[S. 19] mit prachtvollem Gehörn. Wir behielten uns ein Stück des besten Fleisches, hoffentlich bereitet es der Koch auch schmackhaft zu. Von der Vorzüglichkeit unseres Küchenchefs bin ich nämlich schon längst abgekommen, trotz seines Rufes als des anerkannt besten seines Faches. Er bezieht ein Gehalt von 40 Rupien monatlich, hat als Assistenten einen Küchenjungen zu 3 Rupien und einen Esel zum Reiten auf der Safari (Reise) und muß außerdem noch sehr gut behandelt werden, damit er bleibt! Leicht hat er es übrigens ebensowenig wie unsere Jungens. Wenn wir ins Lager kommen, meistens gegen 12 Uhr und später, müssen die Zelte aufgeschlagen, der Tisch gedeckt, aufgewaschen und hunderterlei Kleinigkeiten besorgt werden, von denen eine deutsche Hausfrau keine Ahnung hat, die aber zu den täglichen Notwendigkeiten unseres afrikanischen Marschlebens gehören.
Dutumi, 10. Juni 1896.
Ein kurzer aber sehr beschwerlicher Marsch heute. Das an 4 m hohe, taufrische Gras hinderte uns sehr am Vorwärtskommen und durchnäßte uns bis auf die Haut. Zuweilen sahen wir, wenn das Gras einmal einen Ausblick gestattete, die waldigen Höhen der Uluguruberge rechts vorgelagert, ein Zeichen, daß unsere Karawanenstraße im großen Bogen lief; wir hatten diese Berge bisher immer zur Linken gehabt. Unsere Zelte stehen abseits von den übrigen unter einem großen Baum, der seinen Schatten nach allen Seiten hin spendet; ein ideal schönes Plätzchen. Während ich schreibe, üben unsere Askaris ihre Hornsignale. Wie mich das an Weißenrode erinnert, wenn vom Liegnitzer Haag die Musik der Königsgrenadiere herüberschallte. Es ist eigentümlich: der Zulu, obwohl musikalisch, ist zum Signalblasen nicht zu gebrauchen, da seine Lungen zu schwach sind; der Sudanese dagegen ersetzt, was ihm an musikalischer Begabung abgeht, durch kräftige Lungen; die Kerls blasen ihre Signale wie man’s zu Hause kaum besser hören kann. Die Sudanesen halten sich übrigens, wie ich hier einschalten will, für besser als die anderen Stämme und wollen nicht mit zu den Negern gerechnet werden.
Von dem gestrigen Wege bin ich so entzückt, daß ich die Schilderung heute nachholen möchte. Der Marsch ging auf breit ausgehauenem Pfade, auf welchem sogar 10 bis 15 Neger mit dem Ausjäten des Unkrautes beschäftigt waren. Solch Zeichen von Kultur hier zu finden, ist wie eine Oase in der Wüste, und zwar besonders erfreulich als Zeichen, daß der Jumbe in dieser wohlhabenden Gegend eine gewisse Macht besitzt; die Beschaffenheit der Wege kann man als besten Maßstab hierfür gelten lassen. Diese Jumben lassen sich mit unseren Dorfschulzen vergleichen, doch stehen ihnen größere Machtbefugnisse zu, denn das Gouvernement kann sich hier nicht um alle die Kleinigkeiten bekümmern, für die der Dorfschulze seinem Amtsvorsteher und Landrat verantwortlich ist; unsere Jumben hier stehen in dieser Beziehung doch selbständiger da, und das Gouvernement unterstützt ihre Anordnungen. So schön geebneten Weg hatten wir bisher noch nicht gefunden, vor allem nicht auf diese Länge hin, selbst die Brücken über die Flüsse fehlten nicht. Der Jumbe en chef hatte augenscheinlich die ihm unterstellten zehn Unterjumben gut im Zug. Er kam uns entgegen und war sehr enttäuscht, als wir unser Lager nicht in seiner Residenz aufschlugen.
Eine Stelle des Weges haftet mir besonders im Gedächtnis: Dornröschens Schloß meinte ich vor Augen zu haben, hohe Wände von dichtem grünen Laub, hochragende Baumwipfel als die Mauertürme dieses verzauberten Schlosses. — Die Temperatur war recht afrikanisch: trotz Tropenhelms und Regenschirms trug ich eine Brandblase auf der Nasenspitze davon. Das Trinkwasser ist hier recht unappetitlich, es gehört schon Überwindung dazu, sich in dieser trüben Flüssigkeit zu waschen — trinkbar ist es nur in der Form von Tee, und zwar aus silbernem Becher, um die trübe Brühe nicht beim Trinken auch noch sehen zu müssen.
Station Kisaki, 11. Juni 1896.
Die erste Station im Innern! Von meinem Mann 1892 erbaut; kurz vorher war Leutnant v. Varnbüler, der mit meinem Mann herausgekommen war, der Malaria erlegen. Es war[S. 21] doch schön, wieder einmal nachts ein Dach über sich zu wissen. Morgen ist nämlich Ruhetag, deshalb haben wir uns in der Station selbst einquartiert. Unsere Wohnung erinnert mich sehr an die in Dar-es-Salaam, dort wie hier fliegen die Schwalben ein und aus, denn wir haben weder Fensterscheiben noch Türen. Freilich ist alles hier noch viel baufälliger, da die Wände nur aus Lehm hergestellt waren. Zur Entschädigung gab es aber frische Milch und Salat — das ist eine große Erquickung. Der Weg ist bis Kisaki gut imstande, so daß uns die Mühsal des Marsches durch hohes Gras erspart blieb, aber die zahlreichen, teils trockenen, teils wasserführenden, oft metertiefen Bachrinnen, wohl an zwanzig von jeder Sorte, bildeten recht empfindliche Hindernisse. Die 4 bis 5 m hohen Ufer fallen sehr steil ab, so daß die Tiere nur mit Mühe durchzutreiben sind; man lernt hier das Klettern, aber schwindelfrei muß man sein.
Diesseits der Fähre bin ich die erste weiße Frau, die in diese Gegend kommt, und werde auch dementsprechend angestaunt, von den Frauen mehr noch wie von den Männern. Unsere Askaris stellen sich mit den Jumben im allgemeinen auf guten Fuß; gestern beobachtete ich eine solche Begrüßung: sie schüttelten sich, ohne dabei viel Worte zu machen, drei- bis viermal kräftig die Hand und wiederholten nach ein paar Minuten diese Szene. Händeschütteln ist hier sehr en vogue.
Vor ungefähr zwei Jahren ist Tom das letzte Mal durch diesen Landstrich marschiert; seitdem sind viele neue Dorfgemeinden hier entstanden, die ihre Felder bebauen und Viehzucht treiben; ein schönes Zeichen für den Segen, den die europäische Kultur in diese Gegend gebracht hat, in welcher sonst Kampf und Fehde unter der Bevölkerung herrschte, so daß von irgendwelchem wirtschaftlichen Betriebe keine Rede sein konnte.
Die Station ist ziemlich verwildert: 19 Mann Besatzung genügen nicht, um alles instand zu halten und dabei noch Garten und Feld zu bestellen. Die meisten Baulichkeiten liegen in Trümmern, da auf Herrn v. Wissmanns Befehl Bastionen,[S. 22] Mauern und Gebäude eingerissen wurden, um die Station der Verteidigungskraft der kleinen Besatzung anzupassen.
Mgeta, 13. Juni 1896.
Nachdem wir heute früh eine Anzahl von Wellblechlasten, einige Stühle und Pflanzen vom Gouvernement für die Station abgeliefert hatten, brachen wir ziemlich spät (gegen 9 Uhr) mit Hörnerklang und Trommelschlag von Kisaki auf, nicht ohne uns bei dem Unteroffizier für den schönen Salat, die frische Milch und allerhand Sämereien bedankt zu haben. Auch in das „Fremdenbuch“ der Station trugen wir uns ein. Nach anderthalbstündigem Marsche kam uns schon einer der Mafiti mit Hühnern und Mehl entgegen; früher war er mit seinem ganzen Anhang vor Tom geflohen, heute rechnete er es sich zur Ehre, Toms Gewehr tragen zu dürfen. Unser Weg ging auf breiter Straße an einem Mafitidorfe vorüber, welches erst seit Jahresfrist wieder aufgebaut ist, bis an den Mgetafluß. Hier schlugen wir unser Lager auf, mitten im hohen Gras, gegen welches unsere Soldaten in Reih und Glied in Sturmkolonne vorgingen, um durch Niedertrampeln einen glatten Lagerplatz zu schaffen. Den eigentlichen Feind trafen wir aber erst nach dieser siegreichen Attacke: es wimmelte von Ameisen, und zwar den blutgierigsten ihres Geschlechts! Wir konnten unsern Lagerplatz nur dadurch vor diesen Blutsaugern schützen, daß wir doppelte Decken ausbreiteten und ringsum einen „Zauberkreis“ zogen, d. h. ringsum einen Streifen Gras abbrannten, denn Asche bildet für sie ein unübersteigbares Hindernis.
Ich hatte mich dieses Mal durch den Fluß tragen lassen. Mitten im Flusse verlor mein Träger in der Strömung das Gleichgewicht, und wären nicht andere rasch zugesprungen, hätte ich im Wasser gelegen. Nun erhielt ich rechts und links Begleitmannschaften, aber trotz aller Sorgfalt kam ich bis an die Knie ins Wasser. Unsere Tageseinteilung hielten wir auch heute inne: Nach dem Marsche wurde gegessen, ein kurzes Schläfchen; nach dem Kaffee wissenschaftliche Beobachtungen: Höhenmessung[S. 23] durch genaueste Bestimmung des Siedepunktes des Wassers, eine Methode, die wir kurz „Höhe abkochen“ nennen, Uhrenvergleichen und Zeitberechnungen. Inzwischen tut Tom seinen Dienst. Dann schreibe ich meine Tagebuchnotizen, bis zum Mittagessen, abends 7 Uhr. Nach Dunkelwerden „gucken wir Sterne“, verpacken die auf dem Marsch gefangenen Schmetterlinge und spielen zum Schluß noch eine Partie Schach oder „Sechsundsechzig“. Um 9 Uhr ist’s Schlafenszeit. Von ½7 Uhr an ist es hier abends schon so kalt, daß wir Mäntel anziehen, und zwar je dicker je besser.
Kurz nach Dunkelwerden flog eine Schar schneeweißer Reiher wie eine dichte Wolke am dunkeln Himmel hin — ein feierlicher Anblick: Seelen, die ihrer Heimat zustreben!
Msengebach, 14. Juni 1896.
Heute liegt ein Marsch hinter uns, wie er angestrengter kaum gedacht werden kann; fortwährend durch hohes Schilfgras, das den Blick behindert; man muß mit den Füßen jeden Schritt fühlen und tasten — wie oft fällt man da über einen Baumstamm oder bleibt in Wurzelwerk und Schlingpflanzen hängen. Das starre Gras schlägt Gesicht und Hände blutig. Von der Landschaft sah ich natürlich wenig, dagegen fanden wir sehr viele Elefantenspuren und eine Löwenfährte.
Makirika, 20. Juni 1896.
Das erste Fieber überstanden! — Das waren böse Tage. Daheim wäre man bei 39° Bluttemperatur im dunkeln Zimmer ins Bett gepackt worden, hier sieht die „Krankenstube“ wesentlich anders aus. Ich wurde getragen, und Tom machte nur kurze Märsche von 2½ bis 3 Stunden; damit ich nicht zu sehr geschüttelt wurde, ließ er den Weg noch besonders aushauen und pflegte mich überhaupt während des Marsches nach Menschenmöglichkeit. Von der schönen Gegend, die wir durchzogen, sah ich natürlich nichts; erst gestern war ich wieder so klar, um erkennen zu können, wie wunderschön unser Lager, rings von Bergen umgeben, gelegen war.
Der gestrige Tag muß überhaupt in unserem Kalender rot angestrichen werden; seit 3 Wochen sahen wir die ersten Deutschen, die Herren v. Kleist und Albinus, die Tom von Perondo ablöst. Es war eine Freude, solche prächtige Menschen kennen zu lernen. Wir hoffen, Herrn Albinus als Leutnant zu bekommen. Sie schenkten uns eine Kalbskeule, die großartig geschmeckt hat. Herr v. Kleist litt ebenfalls so stark am Fieber, daß er getragen werden mußte, und Herrn Albinus sah man die beiden kürzlich überstandenen „Perniziösen“ auch noch an. Zum Frühstück waren wir recht gemütlich zusammen, Perondo bildete natürlich den Mittelpunkt unserer Unterhaltung. Um 10 Uhr hatten wir uns getroffen, um 2½ mußten wir uns schon wieder trennen. Uns blühten noch neunzehn Bachübergänge, alle mit den bekannten steilen Ufern; das gab viel Anstrengung, aber auch der Lohn fehlte nicht; die ersten Bergspitzen von Uhehe grüßten zu uns herüber!
Mfajeka, 21. Juni 1896.
Das große Ereignis des heutigen Tages war der Übergang über den Ruaha, der eine Stunde in Anspruch nahm. Vorher besuchte ich den Jumbe, dessen Hütte, Ställe und Garten auf einem waldigen Hügel am diesseitigen Ufer recht einladend aussahen. Zwei Kindern von drei bis fünf Jahren hätte ich gern die Hand gegeben, aber das kleinste fing an jämmerlich zu schreien, als ich auf sie zukam. Da war es allerliebst anzusehen, wie das ältere die Ärmchen um das kleine Schwesterchen schlang und den kleinen Angsthasen schützend zur Mutter führte, die mich von weitem mit nicht gerade freundlichen Blicken ansah. Sonst freuen sich die Frauen im Lager, wenn ich mit ihren Kleinen schön tue, obgleich diese auch zuerst immer jämmerlich schrieen. —
Der Flußübergang bot ein prächtiges Bild afrikanischen Lebens. In drei Kolonnen wälzte sich die Masse der Soldaten, Träger und ihres Anhanges von Weibern und Kindern durch den Strom bis zu einer Sandbank. Bei hohem Wasserstand ist auch diese überflutet, dann ist der Ruaha an dieser Stelle gegen[S. 25] 400 Meter breit. Von der Sandbank bis zum anderen (rechten) Ufer sah man, etwa 100 Meter weit, nur die schwarzen Köpfe und die Trägerlasten über dem Wasser. Die Frauen hatten sich ihre Babies mit dreieckigen Tüchern auf den Rücken gebunden, — die landesübliche Sitte des Kindertragens — und wurden mit ihrer lamentierenden Last von den Männern durchs Wasser gezogen, die größeren Kinder balancierten strampelnd und schreiend auf den Köpfen ihrer Mütter. Wir selbst bewerkstelligten den Übergang auf einem als Boot ausgeputzten großen Stück Baumrinde, auf welchem wir niederhockten und so von den Schwarzen durchbugsiert wurden. Besonders imposant war die Stellung nicht, in der wir in unser neues Reich einzogen, aber wir betraten es wenigstens trockenen Fußes. Hier fängt Toms neuer Wirkungskreis an: wir sind heute zum erstenmal auf eigenem Gebiete.
Während des Flußüberganges brach einer der Träger ein Bein: aus Schrecken vor einem in seiner Nähe auftauchenden Flußpferd war er ausgeglitten und gegen einen Felsen getrieben worden; er wurde sofort herausgeholt, geschient und verbunden.
Mfajeka, 22. Juni 1896.
Heute ist Ruhetag. Auf Herrn Ramsays Karte verfolgte ich unsern bisherigen Weg; er hat auch die „Teufelsstelle“ eingezeichnet, die wir am 15. d. M. passierten. Dort ist einmal jemand ermordet worden, nun bringt jeder Vorüberziehende den Manen des Ermordeten eine Gabe dar, damit er vor allen Fährlichkeiten bewahrt bleibe. Große Unkosten entstehen dem frommen Wanderer durch diese Opfergabe nicht: ein Stein, ein Blatt genügt, und wer das nicht zur Hand hat, begnügt sich damit — auszuspucken, und hat damit die Anwartschaft auf Schutz vor Krankheit, wilden Tieren und bösen Menschen entsprechend bezahlt.
Von meinem Platze aus kann ich die Kompagnie sehen, die oben zum Appell angetreten ist. Auf dem Marsche tragen unsere schwarzen Kerls je nach Geschmack alle möglichen Zierate[S. 26] an den Mützen: Federn, weiße Sterne u. a. m.; heute sehen sie in ihren, den Husarenkalpaks ähnlichen Mützen ganz militärisch und schmuck aus.
Dorf Kranse, 24. Juni 1896.
Der Abmarsch verzögerte sich, weil wir auf den Arzt warten mußten, der erst den im Ruaha verunglückten Träger neu verbunden hatte und dann noch nach einem kranken Kinde sehen mußte. Drei Stunden ließ ich mich tragen, versuchte dann, auf meinem Maskatesel weiter zu kommen, mußte mich aber bald bequemen, über einen durch Auswaschung entstandenen Erdspalt auf Baumwurzeln zu balancieren. Als nächstes Hindernis kam ein Urbusch, der erst gangbar gemacht werden mußte: dunkler Moorboden oder Graswuchs, lianenumschlungene Stämme mit dichtem Laub, Wasserpfützen mit dem bekannten metallisch-rötlich-schimmernden schleimigen Überzug, das alles in einem düstern Zwielicht, dazu eine Fülle von Tieren und Insekten — das ist das Bild eines afrikanischen Urbusches oder Urwaldes.
Unser Lager liegt dicht an den Bergen, die uns einen frischen Wind herübersenden; das erfrischt Mark und Nerven und hält die gefährlichen Fiebermiasmen der sumpfigen Niederung fern. Gegenüber ein prächtiger, breiter Wasserfall. Welch schöner Abend: ringsum die Lagerfeuer, an denen die Leute sich schon schlafen gelegt haben, silberklar zieht der Mond seine stille Bahn am tiefblauen Sternenhimmel, an dem einzelne Silberwolken glänzen, der Horizont begrenzt von den hohen Bergen von Uhehe — in die tiefe Stille dringt nur das gleichmäßige Rauschen des Wasserfalls herüber und ab und zu der Schritt des Wachtpostens.
Mahenge, 25. Juni 1896.
Um 6 Uhr 20 Minuten Aufbruch. Die ersten 3½ Stunden ließ ich mich tragen und las dabei, wie ich meistens tue. Dann ritt ich meinen braven Maskatesel. Der Weg durch den Wald war recht schlecht, Tom mußte einen Unteroffizier als Bahnbrecher[S. 27] vorschicken. Das Marschtempo ist im allgemeinen 100 Schritt in der Minute, der Schritt etwa 70 Zentimeter, so daß wir durchschnittlich in der Stunde 4 bis 4½ Kilometer vorwärtskommen. In einem hohlen Baum fand Tom heute ein ganzes Schmetterlingsnest, aus dem er die Tierchen wie junge Vögel ausnehmen konnte. Es war sehr niedlich. Jetzt kommen wir meist ziemlich manierlich ins Lager, freilich durch das hohe, nasse Gras gewöhnlich bis auf die Haut durchnäßt, und beim Durchreiten der Bäche kommt man auch oft genug mit den Füßen ins Wasser, obgleich ich im Sattel balanciere wie eine Kunstreiterin. Morgens regnet es hier auch öfters; im Gegensatz zu vielen anderen regenarmen Gegenden Deutsch-Ostafrikas ist das Land deshalb hier auch ungemein fruchtbar. Man macht sich keinen Begriff, mit welchem Reichtum die Natur diesen Landstrich ausstattet! Wir kamen durch einen Graswald, der uns mit seinem, die Bäume überragenden Schilfgras ganz vorweltlich anmutete; bei den Maisfeldern wuchsen sechs bis acht Stauden aus einer Wurzel durchschnittlich 5 bis 7 Meter hoch. Ein Stückchen solch fruchtbarer Erde in Europa!
Afrika geht auf die Gesundheit! Von uns fünf Europäern haben Tom und der Zahlmeister Winkler seit vierzehn Tagen fortwährend Fieber bis zu 40°, der Unteroffizier Hammermeister sogar bis 41°, und auch unser Arzt Dr. Stierling laboriert daran. Das beste Vorbeugungsmittel ist und bleibt kräftige Nahrung, um dann während der Fieberanfälle möglichst bei Kräften zu bleiben, denn auch bei nicht allzuhohem Fieber taten die Herren immer ihren Dienst. Man muß hier nach Möglichkeit gut leben, schon um den Dienst im Gange zu halten. Wer nur Wasser trinkt und nicht gut und kräftig ißt, der spart wohl — und zwar nicht unbeträchtlich! — am Geldbeutel, auf die Dauer wird er aber dieses Sparsystem nicht aushalten. Trotz alledem — Afrika hat doch Reize, die man in Europa vergeblich suchen würde. Wenn die Träger ins Lager ziehen und ihre Lieder vom „Sakkarani“ singen, wenn wir nach angestrengtem Marsche unsere Zelte aufschlagen als vorgeschobene Pioniere deutscher Kultur, mit dem[S. 28] Ziel vor Augen: wir wollen und können unserm deutschen Vaterlande auf diesem vorgeschobenen Posten dienen und nützen, jeder nach seinem Pfund! — das ist ein Bewußtsein, welches über den Mangel europäischen Komforts und selbst eine tüchtige Dosis Fieber kräftig hinweghilft!
Heute war offizieller Empfang! Eine Stunde vor dem Dorfe kam uns der Jumbe entgegen und begrüßte uns mit einer feierlichen Ansprache, die ich allen seinen deutschen Kollegen als Muster von — Kürze bestens empfehlen kann. Auch sonst fanden sich Vergleichspunkte mit europäischen Einzugsfeierlichkeiten: die Stelle der weißgekleideten Jungfrauen vertraten die mit schneeweißem Linnen drapierten Einwohner beiderlei Geschlechts, die uns zu Ehren angetreten waren. Das Dorf war rings um einen großen freien Platz angelegt, in dessen Mitte ein riesiger wilder Feigenbaum die Stelle unserer Dorflinde vertrat. Hier spielt sich das öffentliche Leben ab, in seinem Schatten wird Schauri gehalten, getanzt, gekneipt und wohl auch gelegentlich mal gerauft, ganz wie bei einer deutschen Kirmes. Unser Lager wurde unter einer stattlichen Baumgruppe aufgeschlagen, die als deutliches Zeichen dieser ihrer Bestimmung an einem Stamme ein — Reklameschild für deutschen Sekt trug! Die Herren v. Kleist und Albinus, die früher hier stationiert waren, hatten uns gesagt, wir würden wohl wenig Lebensmittel auftreiben, da die Leute sehr arm seien, höchstens einige Hühner, von Ziegen ganz zu schweigen; um so angenehmer waren wir überrascht, als uns eine Menge Ziegen, Hühner, Eier und Mehl gebracht wurde. Der Besuch nahm den ganzen Tag kein Ende. Es sieht zu drollig aus, wenn so dreißig bis fünfzig Schwarze um uns herum hocken; ich bewirte sie mit eigens für sie bestimmten Tassen mit Gin; gern würde ich mich auch mit ihnen unterhalten, aber ich verstehe ihre Sprache noch nicht.
26. Juni 1896.
Wir passierten eine Anzahl recht ansehnlicher Dörfer; die Hütten waren durchweg mit Veranda versehen. Unter dem[S. 29] Schwarm von Eingeborenen, die uns zur Station begleiten, um dort Schauri zu halten, befindet sich auch der Jumbe Farhenga, der früher oft gegen uns gekämpft hat, bis er sich ergab — Leutnant Brüning ist im Kampfe gegen diesen Stamm gefallen —; er war früher ein Anhänger von Quawa und glaubt bestimmt, daß dieser sich nicht sehen lassen würde.
27. Juni 1896.
Ruhetag. Gesundes Lager auf einem Hügel. Ich weihte meinen 40-Rupien-Koch in die Geheimnisse einer Eierspeise ein; aus dem Eifer, mit dem sowohl er wie sämtliche Boys und andere Schwarze mir allerhand Handreichungen taten, kann ich auf großes Interesse an der Sache schließen. Jede Neuerung in unserem Küchenzettel kostet viel Zeit und Mühe, denn die ganze Einrichtung besteht aus Eiertiegel und zwei Kochtöpfen nebst Messern, Gabeln, Löffeln und Tellern. Die Zutaten kann ich nur nach Gutdünken abmessen; ich freue mich, daß mir trotz alledem so wenig „vorbeigerät“. Heute kauften wir viele Eßwaren, die uns die Leute ins Lager brachten. Tom und der Zahlmeister eröffneten nun einen Handel, indem sie die Vorräte in zwei Hälften teilten, zum Verkauf an die Soldaten und an die Führer der Träger. Es wird mit den „Markttagen“ zwischen diesen zwei Gruppen immer abgewechselt, je nachdem Vorrat vorhanden. Heute kommen die Träger dran. Großes Gedränge — aber als die zweite Hälfte zum Verkauf gestellt werden sollte, fand sich nicht ein Stück mehr vor! Selbst siebzehn Hühner, die wir für die Messe behalten wollten, waren verschwunden. Die Kerls hatten mit einer so verblüffenden Frechheit vor meinen Augen alles fortgeschleppt, daß ich der Meinung war, sie hätten die Sachen wirklich gekauft! Da bei der Menge der „Kauflustigen“ die Spitzbuben nicht mehr ermittelt werden konnten, wurden sämtliche Träger vom weiteren Verkaufe ausgeschlossen und mußten ihren Bedarf auf eigene Faust aus der Umgegend zusammenkaufen. Übrigens reicht oft die ins Lager gebrachte Zufuhr für die ganze Truppe nicht aus, es müssen dann unsere Askaris das Nötigste aus den[S. 30] Dörfern herbeischaffen; damit sie die Einwohner aber nicht bedrängen, dürfen sie ihre Gewehre nicht mitnehmen.
Fakalla, 29. Juni 1896.
Flußübergang; die Strömung war so stark, daß die Lasten in zwei Kanoes durchgeschleppt werden mußten, ebenso ein Teil der Frauen und Kinder; die Truppen hatten genug mit sich selbst zu tun. Da die erste Bootsladung Weiber ins Wasser fiel (glücklicherweise ohne Schaden zu nehmen), mußten die übrigen auch durchwaten. Auch unser Kanoe wäre beinahe umgeschlagen, mein kleines Gewehr fiel dabei über Bord und war in der reißenden Strömung für immer verschwunden. Damit die Leute sich ordentlich verproviantieren können, machten wir nur einen kleinen Marsch, denn in den nächsten Tagen werden wir nichts auftreiben können.
An Ziegen und Mehl haben wir Überfluß, aber auf die tägliche Eierspeise, die es für Tom und mich bisher gab, werden wir verzichten müssen. Seit gestern nehme ich Chinin, ich habe etwas Fieber — kein Wunder, das fliegt einem hier beim Durchzug durch die sumpfige Niederung an. Auch Tom fühlt sich nicht wohl. Während ich hier schreibe, hocken meine einheimischen Besucher, Männer, Weiber und Kinder, mir gegenüber, ihre Toilette ist mehr oder vielmehr weniger als sommerlich, sie besteht eigentlich nur aus einem Lendentuche, mit dem sich auch die Frauen begnügen; sie schwatzen unaufhörlich, scheinen sich also doch viel zu erzählen zu haben; wo sie nur die Menge von Unterhaltungsstoff herhaben? Bei Tom sitzen zwei Jumben, ich reichte ihnen zum Gruße die Hand und war sehr erstaunt, als sie diese küßten. Die waldigen Berge, die Palmen, der üppige Blumenflor, das alles gibt ein wunderschönes Landschaftsbild, zu welchem die hochragenden Felsen in ihrer starren Größe mit ihren dunkeln Klüften den malerischen Gegensatz bilden. Seit Kisaki gibt es viele Vögel, auch Affen trafen wir an. Von den Vögeln ist uns der Milan und der Marabu stets willkommen: ersterer zeigt die Nähe von bewohnten Plätzen an, letzterer findet sich stets in der Nähe von[S. 31] Wasser; auch der Honigvogel ist ein angenehmer Reisegefährte, er führt stets an Stellen im Walde, wo man Honig findet. Schnapsel hat sich schon sehr afrikanisiert, seine Mittagsruhe hält er mit Vorliebe in der Sonne.
Am Fluß Ruipa, 1. Juli 1896.
Wieder zwei Marschtage durch Sumpf und hohes Gras. Erst brach das Maultier mitten im Wasser unter mir zusammen, dann blieb mein Esel im Schlamme stecken; beidemal mußte ich absteigen und mich weiterschleppen lassen, und zu guter Letzt rutschte mein Maultier das steile Flußufer mit mir hinab, so daß ich abgeworfen wurde. Der Ruipa ist an 3 Meter tief; also Übersetzen mittels Kanoes: eine sehr langwierige Geschichte bei der Menschenmenge und den vielen Lasten. Unsere Schwarzen sind übrigens sehr eifrig um mich bemüht; wenn Maultier und Esel versagen, werde ich wie ein Paket mit der Aufschrift „Vorsicht! Nicht stürzen! Zerbrechlich!“ weitergereicht, nur mit dem „Vor Nässe zu bewahren!“ sieht es meistens fraglich aus; es muß doch ein köstlicher Anblick sein, wenn vier Soldaten mich durch den Strom tragen, ausgleitend und stolpernd, so daß ich nie weiß, nach welcher Seite ich demnächst fliegen werde, oder aber wenn ich mitsamt meinen schwarzen Trägern im Schlamme liege. Das „Kelele“ (Geschrei) dann bei der gesamten Korona! — Heute den 34. Tag unterwegs!
Gima, 2. Juli 1896.
Der Tag fing mit einem Überfall durch Ameisen an, deren ich erst Herr werden mußte, ehe wir um 6¼ Uhr abmarschieren konnten. Der Marsch bot einige Abwechselung gegen die letzten Tage: ich fiel diesmal nicht mit meinem Reittiere, sondern es fiel mir der Tragebaum meiner Kitanda (Tragsessel) auf den Kopf — natürlich tolle Kopfschmerzen. Unerträgliche Hitze, nirgends Schatten, mein Siegellack ist wie weiches Wachs auseinandergegangen. Vergeblicher Versuch, in den Dörfern etwas zu kaufen; die Bewohner sind sämtlich weggelaufen, ein sicheres Zeichen, daß[S. 32] sie Anhänger von Quawa sind. Unsere Boys singen „Ich bin ein Preuße“ in den stillen Abend hinaus; es klingt so kindlich und heimatlich zugleich von den munteren schwarzen Burschen.
Ndemusdorf, 3. Juli 1896.
Auch heute alle Dörfer verödet — ein böses Zeichen! Quawa hat die Leute gegen uns aufgewiegelt. Zwar wohnen hier noch keine Wahehe, aber er hat in den Dörfern hier überall von seinen Wahehe einige sozusagen als „Stationschefs“ verteilt, die die Einwohner beherrschen. Um es jedoch nicht ganz mit uns zu verderben, haben diese vor ihrer Flucht das Gras niedergetreten und Bäume gefällt, uns also den Weg möglichst gangbar gemacht, und in den Dörfern, in denen wir unser Lager aufschlagen, erscheinen auch die Jumben. Sie dienen also zwei Herren. Daß die Leute bei unserem Nahen weglaufen, hat wohl auch seinen Grund in den schlimmen Erfahrungen, die sie früher stets mit den Handelskarawanen machen mußten; ihre Hütten wurden einfach als Quartiere benutzt, ohne daß sie dafür eine Entschädigung erhielten. Tom hat nun angeordnet, daß die Karawanen für jede Hütte, die sie benutzen und vor dem Abmarsche wieder reinigen, 5 Pesa zu bezahlen haben, überlassen sie die Reinigung dem Besitzer, so sind dafür weitere 5 Pesa zu entrichten. Die Hütten sind hier fast alle rechteckig und ganz aus Gras hergestellt, dabei aber ziemlich wetterfest. Der hiesige Jumbe hat sogar eine Veranda an seiner Wohnung; zwar keine Fenster, dafür aber zwei, allerdings sehr kleine Türen, so daß man sich tief bücken muß, um einzutreten.
Heute sah ich die erste Wildgrube, direkt am Wege, so daß ich sehr um unsere Schafe bangte. An einen steilen Hügel am Wege knüpft sich ein Negermärchen, das erste, von dem ich hörte: Hoch oben auf dem Gipfel weidete, so berichtet die Sage, eine Herde von schneeweißen Ziegen und im Innern des Berges sehe man ein großes Haus von Steinquadern, in welchem der Teufel wohne. Den Zusammenhang zwischen dem Schloßherrn und der Ziegenherde konnte ich leider nicht feststellen.
5. Juli 1896.
Meine Begeisterung für Wasserfälle steht nicht mehr auf ihrer früheren Höhe. Heute mit 4½stündigem Marsche sechzehn Flüsse passiert, die meistens von Wasserfällen kamen; meine Freude beim Anblick eines solchen ist also bereits sehr herabgestimmt. Heute die ersten Farnkräuter gesehen! — Es regnet unaufhörlich, Tag und Nacht, der Marsch deshalb ganz abscheulich. In der Nacht plötzlich großer Lärm: Schnapsel rast wie toll im Lokale herum, und draußen werden die Schweine und Puten mobil. Ursache: allgemeiner Überfall durch Ameisen, denen wir mit Insektenpulver und Asche energisch zu Leibe gingen. Die Puten pickten sich die Störenfriede gegenseitig ab. Gestern trafen wir die Karawane, die unser Haus trug, 350 Mann, die zur Küste zurückkehrten; wir benutzten sie gleich, das Gras auf dem Lagerplatze niederzutreten.
Am Kitalabach, 6. Juli 1896.
Bei strömendem Regen wieder ein ganz schauderhafter Weg. Es ist uns zwar nichts Neues, daß die Leute ½ Stunde lang bis über die Knie, oft bis zu den Hüften im Wasser waten, aber sie konnten sich sonst doch in der Sonne bald trocknen. Daran ist jetzt natürlich nicht zu denken; dazu ist es empfindlich kühl; im Zelt hatten wir um Mittag nur 14°. Auch sind wir nunmehr alle ziemlich abgespannt. Mein Mann hat arges Fieber, macht aber trotzdem die Wegeaufnahmen. Die Marschordnung war, um Tom Gelegenheit zu besserem Überblick zu geben, seit einiger Zeit geändert, wir marschieren nicht mehr an der Spitze, sondern halten die Mitte, so daß Tom die Biegungen des Weges besser sieht. Stößt die Spitze auf ein Hindernis, so wird dieses uns durch Winken angezeigt, dann heißt es „Kolonne halt“, bis der Weg frei. Für mich bedeuten diese Halts stets eine gewisse Spannung, denn je nach der Natur dieses Hindernisses richtet sich die Art meiner Weiterbeförderung: Postpaket, Seiltanzen oder Kunstreiten. Zu letzterem eigne ich mich erfahrungsgemäß am wenigsten, das kommt mir täglich zum Bewußtsein,[S. 34] wenn ich, Schnapsel auf dem Schoße haltend und die Füße möglichst zwischen die Langohren meines Esels gelegt, mich krampfhaft am Sattel festklammere, während der Weg mit Gleiten und Stolpern über Wurzeln, Steine, durch Sumpflöcher, Wasserpfützen und Flußläufe geht.
Am 7. Juli 1896.
Heute schlugen wir das Lager am Fuße des Mbongo auf — gegenüber dem Endziel unseres Zuges: Perondo, unserer Station, die wir morgen erreichen werden! Angesichts dieses Zieles tauchen eine Menge wichtiger Fragen auf, die es zweifelhaft machen, ob die Station auch wirklich hier errichtet werden kann. Wird Quawa Krieg anfangen? So friedlich, wie man ihn an der Küste glaubt, ist er nicht, je näher wir seinem Gebiete kamen, je mehr hatten wir Ursache, uns vom Gegenteile zu überzeugen.
Perondo, 8. Juli 1896.
m 6¼ Uhr Aufbruch, zunächst durch Sumpf bis zum Fluß, dann guter trockener Weg, mit Wassergräben an beiden Seiten. Hier machten wir sämtlich erst Einzugstoilette, auch die Kompagnie, die ihre neuen Uniformen anlegte. Wir Europäer ritten an der Spitze des Zuges, hinter uns die Soldaten zu je drei Mann breit — mehr gestattete der Weg nicht — so bewegte sich die Kolonne durch die schöne Berg- und Waldlandschaft. Schon weit von der Station kamen uns Herr v. Stocki, Graf Fugger und Dr. Berg entgegen, die auch für eine prächtige Ausschmückung der Station gesorgt hatten; Ehrenpforten waren errichtet, und alles prangte im Schmucke der Fahnen und Girlanden; kaum eine Hütte ohne Palmen und Blumen. Über der Messe wehten die deutsche Kriegs- und die Handelsflagge; die Unteroffiziere, die Soldaten und die ganze Einwohnerschaft, an 2000 Personen, bildeten Spalier. Es war ein farbenprächtiges, schönes Bild. Zum Willkommenstrunk wurde Sekt gereicht, dann ein kurzes Plauderstündchen — und der Dienst machte seine Rechte an unsere Herren geltend. Zu Mittag folgten wir einer Einladung Herrn v. Stockis nach der Messe zu einem afrikanischen Festmahle — wenn ich einen europäischen Maßstab anlegen soll, kann ich es nur ein Austern-Diner nennen: also großartig! Sekt — der letzte — wurde reichlich getrunken, dank seiner[S. 36] belebenden Wirkung und der Freude über das erreichte Reiseziel war die Stimmung äußerst vergnügt, trotzdem mein Mann und Graf Fugger Fieber hatten (letzterer hatte noch Tags zuvor 40° gehabt!). Solch einen schönen Empfang hatten wir uns nicht träumen lassen, möchte doch diese unerwartete Freude, dieser schöne Anfang eine gute Vorbedeutung für die Zukunft sein!
Die Station liegt auf einem kleinen Hügel mitten in den Bergen, gegenüber ein mächtiger Wasserfall. So prachtvoll sich das Landschaftsbild dem Auge darbietet, so wenig entspricht der Ort gesundheitlich den Anforderungen, die man an eine mit Europäern zu besetzende Station stellen muß: ringsum Sumpf! Es bleibt nichts übrig, als die Station zu verlegen, und zwar nach Uhehe. Das macht Tom viel Arbeit und erfordert vieles und gründliches Kopfzerbrechen. Zunächst allein: wie die 2000 Lasten mit nur 700 Trägern nach der neu anzulegenden Station zu dirigieren — ohne daß es zu viel kostet! Die Wohnungsverhältnisse sind mehr praktisch wie glänzend: die Messe besteht aus einer offenen Hütte, alles übrige, was auf die Bezeichnung „Wohnung“ Anspruch macht, sind Lehmhütten, in denen der Zimmermann die üblichen Löcher für Tür und Fenster gelassen hat, ohne durch Tischler und Glaser ergänzt zu werden.
Perondo, 9. Juli 1896.
Wenn ich abends von unserer hochgelegenen Boma ins Dorf hinuntersehe, brauche ich meine Einbildungskraft gar nicht übermäßig anzustrengen, um mir den Anblick einer Berliner Straße in abendlicher Beleuchtung zu vergegenwärtigen: alles hell erleuchtet, Licht an Licht. Heute ritt ich durch Perondo, die Soldaten standen stramm, Frauen und Kinder, alles was auf den Straßen kreucht und fleucht, kam heran, um mich zu begrüßen, unzählige Male mußte ich „Jambo“ sagen.
Perondo, 12. Juli 1896.
Gestern gaben wir ein großes Diner! Die Vorbereitungen dazu nahmen schon den ganzen Tag vorher in Anspruch, bis ich[S. 37] alles nötige Küchengerät zusammen und die sonstigen Vorbedingungen zu einem europäisch-afrikanischen Festmahle erfüllt hatte. Am Morgen des großen Tages ging ich schon früh um 6 Uhr an die Arbeit, hatte aber auch die Freude, daß alles trefflich gelungen ist. Die kleinen Pasteten wurden mit dem stumpfen Ende des Hammers geformt, der Teig mit dem — natürlich sorgfältig gereinigten — Gewehrlaufe glattgestrichen und ausgerollt, Löffel, Messer und Gabel je nach Bedarf als Quirl, Spicknadel und ähnliches verwandt, die Speise in Ermangelung eines Reibnapfes in einem Teller verrieben; Töpfe und Schüsseln avancieren zu Bratpfannen und Backformen. Freilich wartet schon immer eins aufs andere, denn viel Vorrat und Auswahl ist nicht vorhanden, — aber wie gesagt, es ging trotz aller Umständlichkeit ganz prächtig. Unser Koch konnte mir wenig helfen, seine Kunst beschränkt sich bis jetzt nur auf die Zubereitung von Ziegen und Hühnern, die ihm übrigens ganz leidlich gelingen. Die Ausschmückung unseres „Speisesaales“ hatte mein Mann übernommen. Unsere Hütte ist ein aus ungeschälten Stangen bestehender, viereckiger Kasten, die Wände aus Bambus, ausgefüllt mit roter Erde, das schräge Dach ebenfalls aus Stangen, Bambusstöcken und Stroh. Zum Schutz gegen den Staub ließ Tom als Zimmerdecke unter dem Dache ein weißes Tuch ziehen. Die Hütte ist in drei gesonderte Räume abgeteilt, unser Schlafzimmer hat sogar eine Türe — man kann sie zwar nicht schließen, es ist aber doch immerhin eine wirkliche Tür! Die Fensterscheiben werden durch Drahtnetz angedeutet, die Dielen ersetzt festgestampfte Erde. Die Einrichtung besteht aus Tischen, Stühlen und Feldbettstellen. Tom hatte noch eine Veranda anbauen lassen, die gerade an diesem Tage fertig geworden war; sie und der große Mittelraum wurden nun zur Feier des Tages geschmückt. An die Wände wurde blaues Tuch gespannt, überall hingen Blumen, und zum Ersatze der heimischen Eichenholztäfelung wurden unten ringsum große saftiggrüne Blätter befestigt; es sah wunderhübsch aus — stilvoll-afrikanisch. Dazu in der Mitte der festlich gedeckte Tisch, reich verziert mit Blumen; an Tischgerät, wie Teller, Gläser usw., war kein Mangel[S. 38] (ich hatte mir alles Nötige zusammengeborgt), daneben ein gedeckter Tisch zum Anrichten und als Trägerin der „historischen“ Maibowle (es wird wohl die erste ihrer Art gewesen sein, die im Innern Deutsch-Ostafrikas getrunken wurde!), eine festlich verhüllte leere Kiste.
Die Boys bedienten flott und geschickt; trotzdem bei jedem Gang Messer und Gabel gewechselt wurden, klappte alles so gut, daß wir das Menu in knapp zwei Stunden erledigt hatten. Wer die vergnügte Gesellschaft in dem festlich geschmückten Raume beobachtet hätte, wäre kaum auf den Gedanken gekommen, daß er hier ferne von aller Zivilisation Europas sich im Innern Afrikas befände. Unsern lieben Gästen zu Ehren hatte ich Toilette wie zu einer großen Gesellschaft zu Hause gemacht. Den Kaffee tranken wir auf der Veranda, wo Tom unsere Koffer mit weißen Tüchern zu Kaffeetischen umgestaltet hatte. Um 7 Uhr abends trennten wir uns. — Es ist doch schön in Afrika, selbst in einer Hütte mit harten Stühlen.
Perondo, 13. Juli 1896.
Um 7 Uhr ging Tom zum Dienste, kam um 8 Uhr zum Tee und verschwand dann wieder. Ich zahlte den Boys ihr Gehalt, um 9 Uhr kam Dr. Berg; dann besah ich meine schöne Vorratskammer, die sogar ein Gestell aus Wellblech hat, denn Holzbretter sind ein seltener Artikel.
Die übrig gebliebene Kalbskeule, mit der wir so schön taten, da sie seit sechs Wochen erst die zweite Unterbrechung der sonst immer nur aus Huhn und Ziege bestehenden Fleischkost bildete, dieses Haupt- und Prunkstück unseres festlichen Mahles, hat Schnapsel über Nacht aufgefressen. Der Feinschmecker!
Während ich hier schreibe, hält mein Mann Schauri. Das macht mir viel Spaß, und ich sehe gern zu; die Mimik der Schwarzen ist großartig. Meist handelt es sich um Diebstahl, und Kläger und Beklagter sind anwesend.
Perondo, 17. Juli 1896.
Ich war in den letzten Tagen nicht recht wohl und zu abgespannt zum Schreiben. Abends haben wir „Sterne geguckt“ oder die Herren waren bei uns. Am Sonntag ist Herr v. Stocki mit 300 Trägern ausgezogen, um Nahrungsmittel für die Leute zu kaufen; denn wer weiß, ob in Uhehe genügend Vorrat aufzutreiben sein wird. Graf Fugger ging gestern mit 300 Trägern, 24 Soldaten und einem Maximgeschütz nach Uhehe ab; zunächst muß er den ungemein steilen Berg hinauf, ein schweres Stück Arbeit mit den Lasten; etwa sechs Stunden weiter wird er dann eine kleine Boma anlegen, nach welcher später mit nur 700 Trägern 2000 Lasten hinaufgeschafft werden müssen; das nimmt für jeden Transport hin und zurück fünf Tage in Anspruch; die ersten sind schon unterwegs.
Schnapsel sucht sich durch besonderen Ordnungssinn wieder einzuschmeicheln, eben jagt er die Schweine fort, die sich bis an die Veranda gewagt haben; sonst sitzt er stundenlang vor einem Baum und beobachtet die Eidechsen oder lauert vor den Rattenlöchern in unserer Hütte.
Alles ist hier teuer. Ein Ei kostet 5 Pesa (10 Pfg.), ein mageres Huhn 1 Rupie (1,35 Mk.). Ein Grieche hat sich hier niedergelassen, der gute Geschäfte macht. Heute kommen 150 Futterlasten an. Reis gibt es reichlich.
Soeben erscheint die kleine, unansehnliche Figur unseres Koches auf der Bildfläche, um sich den heutigen Speisezettel zu holen. Nächstens werde ich wohl auch mit krummem Rücken und Triefaugen antreten, meine Küche ist ganz dazu eingerichtet: drei bis sechs offene Feuer an der Erde, deren Rauch die Augen beizt. Gestern habe ich eine Anzahl Lasten geöffnet. Eine wenig erfreuliche Arbeit: vieles ist verdorben, manches Notwendige finde ich überhaupt nicht.
In der Boma wird eifrig gebaut. Im Norden und Süden werden kleine Bastionen angelegt, Vorratskammern gebaut, mit Verandas für die beiden zurückbleibenden Europäer. Für Tom erhebt sich eine große Schwierigkeit: der Feldwebel scheint perni[S. 40]ziöses Fieber zu haben und wird vielleicht die Expedition nicht mitmachen können; mit ihm müßte dann auch Dr. Stierling hier bleiben, und das bedeutet für Tom den Verlust von zwei Europäern. — Eine rechte Landplage sind hier die kleinen stecknadelkopfgroßen Sandflöhe, die besonders den barfüßigen Negern, aber auch uns bös zusetzen. Ferner eine winzige Fliege, die uns vor allem an die Ohren geht, so daß wir vielfach Taschentücher um den Kopf gebunden tragen müssen — ein spaßiger Anblick.
Perondo, 18. Juli 1896.
Träger aus Kisaki brachten heute einige Möbel. Gegen Mittag kam Kapongo blutend an. Herr v. Stockis Boy hatte auf ihn mit einem Revolver geschossen. Wir hielten die Wunde mit Tüchern zu, bis Dr. Berg kam und ihn verband. Der Attentäter ist vorläufig eingesperrt; der hoffnungsvolle Junge ist erst ungefähr 13 Jahre alt. Zur Pflege des schwerkranken Feldwebels hat mein Mann Nachtwachen für die Europäer angesetzt. Hoffentlich läuft es gut ab, ich werde mich seiner besonders annehmen.
Eine Delikatesse haben wir jetzt auf der Station: frische Milch! Leider darf ich einer Magenverstimmung wegen keine genießen, aber mein Mann ißt jeden Morgen saure Milch und trinkt über Mittag Buttermilch. Wir machen nämlich frische Butter, eine große Wohltat für unsern Küchenzettel!
Perondo, 19. Juli 1896.
Mit den Wahehes scheint es kritisch zu werden. Graf Fugger meldet soeben durch einen Boten, daß die Einwohner alle vor ihm geflohen sind, die Männer zu Quawa, die Weiber und Kinder in das Pori. Da er auf seinem Zuge nirgends Nahrungsmittel findet, wurden sofort zehn Futterlasten an ihn abgesandt. Wenn Quawas Einfluß an den Grenzen seines Landes schon so fühlbar wird, wie wird es dann erst im Innern werden?
Kapongo ist trotz seiner Wunde vergnügt, dem Feldwebel geht es nicht schlimmer, er ist aber sehr schwach.
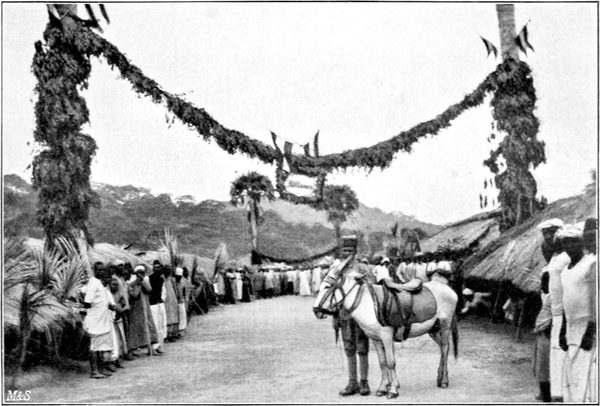
Empfang in Perondo. Reitesel der
Frau v. Prince.
(Zu S. 35.)

Von links nach rechts:
Oberleutn. Glauning. Hauptm. v. Kleist. Stabsarzt
Dr. Stierling. Hauptm. v. Prince. Leutn.
Graf Fugger. Leutn. Stadlbaur. — Frau Hauptm. v.
Prince.
Unser Eßzimmer ist jetzt großartig eingerichtet: eine ganze Kommode und ein Waschtisch haben sich eingefunden; man muß sich an diesen Luxus erst langsam gewöhnen. Nur des Staubes kann ich nicht Herr werden: Erdboden und Wände sorgen für immer neuen Vorrat.
Heute gibt’s Radieschen zu Mittag, wirkliche echte Radieschen!! Sie sollen aber auch für meinen mit Arbeit überhäuften Mann eine besondere Überraschung werden; ein paar Hände mehr könnte er gut gebrauchen und, wenn’s ginge, auch noch ein paar Köpfe. Das kommt und geht in einem fort. Berichte schreiben, Schauri abhalten, dazwischen kommen Meldungen über unseren Quälgeist Quawa, Träger mit Lasten wollen abgefertigt sein, an die auswärts befindlichen Leutnants müssen längere Dienstschreiben mit Befehlen und Verhaltungsmaßregeln abgesandt, Klagen und Beschwerden angehört, untersucht und entschieden werden, dazu noch die astronomischen Aufnahmen, die Kompagnie mit ihren täglichen Anforderungen, kurz gesagt: der Tag hat oft vierundzwanzig Stunden zu wenig, um die ganze Maschine im Gang halten zu können.
Perondo, 22. Juli 1896.
Heute fühlte ich mich so wohl, daß ich Krankenbesuche machen konnte: erst bei Kapongo, dann beim Feldwebel Spiegel; es geht ihm schon besser. Aber wie wohnen unsere Offiziere und Unteroffiziere! Von irgendwelcher Bequemlichkeit keine Spur. Es ist wirklich im höchsten Grade anzuerkennen, mit welcher Genügsamkeit sie sich hier einzurichten wissen. Wir haben doch wenigstens mehr Wohnraum und bessere Betten, und das ist hier eine Hauptsache. Nun, nach Weihnachten werden wir es alle besser haben, dann ist die neue Station fertig, auf die sich alle unsere Wünsche und Hoffnungen richten.
Ich kam bei einer Menge von Frauen vorüber, die Reis ausstampften und lustig sangen. Sie begrüßten mich alle mit lautem Geschrei, dem untrüglichen Zeichen von großer Freude: je lauter der Neger, desto vergnügter. Der Reis und andere Körnerfrüchte werden hier auch vielfach ausgedroschen; die Dresch[S. 42]flegel sind den unseren ähnlich, selbst der anheimelnde Rhythmus unserer deutschen Scheunentenne wird innegehalten. Heute erhielt mein Geflügelhof einen Zuwachs von elf Hühnern. Die ganze Haus- und Hofwirtschaft gewinnt täglich für mich mehr an Wert, besonders weil ich mir doch fast alles nach und nach selbst schaffen und zusammenbauen muß, ohne die vielen Hilfsmittel und Bequemlichkeiten, die einem zu Hause so überreich zu Gebote stehen. Noch nie ist es mir so zum Bewußtsein gekommen, was uns Kinder einst so in den alten Robinson-Geschichten fesselte, wie hier in unserem Nomaden- und Ansiedlerleben, wo alle die Kleinigkeiten, die man in der Heimat kaum der Beachtung wert hielt, in ganz anderem Licht erscheinen. Freilich, Steck- und Nähnadeln habe ich mir aus Fischgräten noch nicht anzufertigen brauchen, aber oft genug muß man hier zu Aushilfsmitteln greifen, die auch eine Frau Robinson nicht verschmäht haben würde.
23. Juli 1896.
Gestern abend gemütliches Zusammensein in der Messe bis nachts 1 Uhr. Vom Grafen Fugger kam Nachricht, er baut tüchtig an seiner Boma; von den Einwohnern der Temben läßt sich niemand sehen, die Wahehe dagegen haben Beobachtungsposten ausgestellt. Es spitzt sich mehr und mehr zu, trotzdem mein Mann mehrere Gesandtschaften an Quawa geschickt hat, um diesen über den friedlichen Zweck unseres Zuges aufzuklären. An den Küsten hat man von den hiesigen Zuständen keine Ahnung, es wurde dort behauptet, Perondo sei sehr gesund und alles atme hier Frieden! Jetzt hat der zweite Unteroffizier auch Fieber.
Mit der Zeit schärft sich der Blick für die schwarzen Gesichter, ich kann jetzt schon die Frauen von den Männern unterscheiden; anfangs war das durchaus nicht leicht; beide tragen als Gewand große Tücher um Brust und Körper, die nur den Kopf, die Arme und die Füße freilassen; selten sieht man einmal einen Mann, der einen Anflug von Bart trägt.
Eben sitzt Kiwanga, einer unserer größten Häuptlinge, bei meinem Mann, ein stattlicher schwarzer Herr in europäischer[S. 43] Kleidung. Benehmen und Sprechweise machen einen guten Eindruck; schade, daß ich nichts von der Sprache verstehe; er scheint sehr klug zu sein. Unser Kognak hat seinen Beifall, er hat eine ganze Tasse voll getrunken! Er erzählte Tom, daß Quawa bei Iringa einen Streifschuß am Oberschenkel erhalten habe. Hätte der Schuß damals besser getroffen, brauchte mein Mann jetzt nicht all das Häßliche durchzumachen, was uns nun als sicher bevorsteht.
Kiwanga, unser Gast, scheint hier in hohem Ansehen zu stehen; während ich mich sonst immer darüber ärgern mußte, daß Koch und Boys in Gegenwart von Gästen stets ganz ungeniert ins Zimmer platzten, um sich die Befehle für die Mahlzeiten zu holen oder ihrerseits Wünsche und Klagen anzubringen, kommen sie heute nur leise angeschlichen und reden nur im Flüsterton: die Nähe von so viel schwarzer Hoheit bedrückt sie ganz augenscheinlich.
28. Juli 1896.
Ich habe die Tage über nicht schreiben können, denn es lag mir wie ein Alp auf der Seele: heute sind die Sachen für meinen Mann gepackt, die er auf seinem Zuge mitnehmen will! Sobald er seinen Bericht fertig hat, geht es ab! Der Krieg ist unvermeidlich, trotz aller Versuche, mit Quawa zu friedlichem Verständnis zu kommen. Tom hatte den Auftrag, ihm ein Geschenk zu überbringen, das ist nun natürlich ganz ausgeschlossen. Wenn mein Mann nicht glücklicherweise etliche von Quawas Leuten hierbehalten hätte, würde dieser Mensch unsere Abgesandten einfach aufknüpfen; unter diesen Umständen ließ Quawa sie gar nicht zu sich herankommen, sondern wies sie unter Androhung des Todes zurück. Welche Gesinnungen ihn beseelen, dafür nur einen Beleg: seinen Großen, die ihm zum Frieden rieten, ließ er den Hals abschneiden, deren Frauen wurden durch Ohrabschneiden verstümmelt! An 80 Leute haben dran glauben müssen. Welch ein Glück für uns, daß es nicht noch mehr solche Neger gibt, die durch den blutigsten Despotismus die Stämme unter ihrem Einflusse halten — mit der Besitznahme von Deutsch-Ostafrika sähe es sonst sehr böse aus. Quawa hat seine An[S. 44]hänger um sich versammelt, man schätzt ihre Zahl auf 7000 bis 9000 Mann; ihnen stehen wir mit 130 Mann gegenüber, nach Abzug von 30 Mann Besatzung unserer Boma und weiteren 20 Mann, die die Verbindung der drei kleinen Bomas auf unserer Etappenstraße aufrecht erhalten müssen. Um unsere Boma gegen einen plötzlichen Handstreich zu sichern, haben wir sie in den denkbar besten Verteidigungszustand gebracht, der Versuch würde Quawa und seinen Kriegern teuer zu stehen kommen.
Ich bewundere bei all meiner Sorge die kaltblütige Ruhe meines Mannes. Bei der ungeheueren Verantwortlichkeit, die auf ihm ruht, bestimmt er alles mit einer Seelenruhe, als ob es sich um den alltäglichen Dienst handele! Mittags, gleich nach Tisch, ritt er ab mit 40 Soldaten und 100 Trägern. 400 Träger waren schon gestern abgegangen, sie sollten heute noch eingeholt werden. Ich begleitete Tom bis zum nächsten Fluß und war gegen 3 Uhr wieder zurück. Sofort erschien auch Kiwanga wieder und machte mir seinen Besuch, der mir in meiner sorgenvollen Stimmung wenig angenehm war. Ich setzte ihm Kognak und Zigaretten vor und da bei meinen mangelhaften Kenntnissen des Suaheli keine rechte Unterhaltung in Fluß kam, ging er bald wieder. Dann machte ich mir allerlei Beschäftigung, zog die Uhren auf, ging nach dem Hühnerstall und anderes mehr, bis der Dolmetscher mit der Meldung kam, soeben werde Herr v. Stocki schwer erkrankt ins Lager gebracht. Das war ein großer Schrecken. Ich ging sofort zu ihm, fand ihn glücklicherweise schon auf dem Wege der Besserung; er hatte ein perniziöses Fieber überstanden und hoffte, den Zug gegen Quawa schon mitmachen zu können. Nach dem Abendessen sah ich nach Lagerfeuern meines Mannes in den Bergen aus, es war aber nichts zu sehen.
29. Juli 1896.
In aller Frühe durch einen schriftlichen Gruß von Tom geweckt; ich schrieb sofort wieder, da der Bote mit Dienstsachen zurückging. Dann kam Kiwanga, brachte aber diesmal den Dolmetscher mit und blieb, da wir uns nun unterhalten konnten, eine[S. 45] ganze Ewigkeit. Außer dem üblichen Kognak und Zigaretten erhielt er einen kleinen Vorrat Salz zum Geschenk und einen von Toms Anzügen. Da ihm aber der Stoff an diesem Anzug nicht gefiel, mußte ich ihm einen anderen aussuchen, der seinem Geschmack besser entsprach! Später kam noch ein anderer Häuptling dazu, der ebenfalls mit Kognak und Zigaretten bewirtet werden mußte, sowie noch mehrere Gesandtschaften von weiter ab wohnenden Häuptlingen. Sie bleiben vier Tage hier; da geht es tüchtig über unsere Vorräte und besonders über die Zeuglasten her. „Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ — die Leute müssen warmgehalten und einigermaßen poussiert werden, damit sie uns Arbeiter für die Station schicken. Kiwanga war sehr erstaunt, als er zufällig sah, daß ich einen Revolver bei mir trage — ich sah, wie ich dadurch in seinem Ansehen stieg. Kiwanga war gekommen, um sich von mir zu verabschieden. Auf die Dauer fallen einem diese Gastfreunde doch etwas auf die Nerven.
31. Juli 1896.
Von Tom kommt jeden Tag — Gott sei Dank! — gute Nachricht, nur beunruhigt es mich, daß er über den voraussichtlichen Erfolg sich niemals äußert. Gott gebe, daß alles gut geht! Herr v. Stocki hat mir von seiner Safari zwölf Hühner mitgebracht. Er erzählte mir, warum die Wahehe uns nicht schon längst einmal überfallen hätten. Bei den Schwarzen ist die Zauberei noch sehr im Schwang, und „Medizinmänner“ stehen in hohem Ansehen. Es gibt aber auch „Medizinweiber“ unter ihnen, und eine solche schwarze Velleda hat sich auch Quawa rufen lassen. Die hat ihm denn nun folgendes offenbart: Der Sakkarani (nämlich Tom) habe sich eine Bibi Sakkarani mitgebracht, die einen großen Zauber besitze, nämlich eine kleine weiße Flasche; wenn sie die unter die angreifenden Wahehes werfe, würden sie sämtlich umkommen! Diese prophetische Warnung ist nun überall verbreitet, die Schwarzen ringsum erzählen sich schon davon.
Von meinem Gastfreund Kiwanga erhielt ich gestern als[S. 46] Geschenk ein kleines Mädchen zugesandt. Das arme kleine Ding, ich werde mich seiner recht annehmen. Zunächst ließ ich es durch Mabruks Frau gründlich waschen, dann wurde ihr der Kopf rasiert und sie mit neuen Tüchern ausstaffiert; sie soll stopfen, nähen und waschen lernen. Vorläufig habe ich als Gegengeschenk Zeug an Kiwanga geschickt, was weiter geschehen soll, wird Tom gelegentlich bestimmen. Jetzt geht’s in die Küche und dazu gehört immer ein fester Entschluß: eine Wellblechhütte, von der afrikanischen Sonne durchglüht, mit den offenen Feuern zum Kochen.
Perondo, 12. August 1896.
Ich habe keine Zeit gehabt, in diesen Tagen etwas zu schreiben. Nach neun Tagen der Einsamkeit das Wiedersehen mit meinem Manne und zugleich die Aussicht, ihn so rasch wieder für vier Wochen in das Ungewisse ziehen zu lassen! Wir haben in diesen wenigen Tagen nur der Gegenwart gelebt und die bange, trübe Sorge mit Gewalt zurückgedrängt. Das waren kurze Stunden des Glückes: Gott gebe, daß es nicht die letzten gewesen sind.
13. August 1896.
Als Tom wieder abzog, hatte er starkes Fieber; noch habe ich keine Nachricht von ihm, obwohl er besondere Leute für den Nachrichtendienst mitnahm. O diese Ungewißheit; jetzt gilt es vor allem, sich die trüben Gedanken, die aufregenden Vorstellungen von all den Gefahren fern zu halten, die Tom jetzt drohen! Denn nichts ist gefährlicher als diese Gemütserregungen, die meist heftige Fieberanfälle zur Folge haben sollen. Um mich zu zerstreuen, bitte ich öfters den Zahlmeister zu mir, auch der Lazarettgehilfe wird dann hinzugezogen, und da hilft dann Kartenspiel, „Sechsundsechzig“, über manche Stunde der Einsamkeit und der trüben Gedanken hinweg. Wir Europäer sind hier ganz besonders aufeinander angewiesen. Wenn sonst mein Mann weg war, ist mir nie so schwer zu Mute gewesen. Hier gilt es unsere ganze Zukunft, das Leben meines geliebten Mannes, die Sorge lastet auf mir wie eine dunkle Wolke.
15. August 1896.
Von Tom gute Nachricht! Mit seinem Fieber geht es besser. Gott sei gedankt für diese Freudenbotschaft.
Ich selbst leide am Fieber; dazu schlaflose Nächte und die ekelhafte Plage der Sandflöhe. Die bohren sich tief ins Fleisch, dann heißt es, die Blase mit den Eiern sorgfältig entfernen, damit nichts zurückbleibt, sonst wird die Sache nur noch schlimmer. Heute habe ich solche Geschwürchen herausgenommen. Die kleine Muhigu, Kiwangas Gastgeschenk, leidet so stark unter dieser Landplage, daß sie kaum gehen kann. Sie ist grundhäßlich, aber ein freundliches, zutuliches Wesen. Zu meinen Pflegebefohlenen gehört auch ein kleines, etwa vier Jahre altes Indermädchen; sie ist Waise, und da sie an krampfartigen Anfällen leidet, die sie meist am Gehen hindern, will niemand etwas von dem armen Kinde wissen; auch an den Händen ist sie gelähmt, dazu blöde Augen, — es ist schmerzlich, das arme Ding anzusehen. — Auf dem Hühnerhofe ein Erfolg: eine Pute legt Eier und eine Ente ist am Brüten. Letzte Nacht prachtvolles Steppenfeuer, das sich bis in die Berge zog und den Wasserfall wunderbar beleuchtete. Die Eingeborenen hatten auf weite Strecken hin das trockene Steppengras abgebrannt. Durch Schnapsels Rattenjagd werden meine Nächte auch nicht erquicklicher; er fängt natürlich keine, denn durch die engen Löcher in den Wänden kann er nicht nachkommen. Neulich fielen in der Nacht zwei von diesen scheußlichen Tieren von der Decke auf mich, ich schrie laut vor Schrecken; eine lebensmüde Ratte fand ich im Waschbecken ertrunken.
Lager am Ombascha-Posten, 19. September 1896.
Welche Glücksbotschaft gestern! Um vier Uhr kam ein Brief von Tom: sobald unser Gepäck „tajari“ (fertig gepackt zum Mitnehmen), soll ich zu ihm kommen! Er hatte für das Verpacken zwei Tage gerechnet — natürlich war ich schon am anderen Morgen „tajari“ und rückte mit meinem Begleiter, dem Oberlazarettgehilfen, ab. Ein tüchtiger Gebirgsmarsch. Sehr müde!
Lager am Kihansifluß, 20. September 1896.
Ich darf wenigstens sagen, daß ich Afrika kennen lerne; freilich ist dieser praktische Geographieunterricht recht anstrengend, dafür aber nur interessanter. In der Schweiz habe ich nicht solche Kletterpartien gemacht wie hier; selbst nicht am Julier, wo ich mir Edelweiß geholt habe von Stellen, die für Damen als unerreichbar galten. Gestern waren acht Berge zu nehmen, 600 bis 800 Meter hoch, so steil und unwegsam, daß ich mich oft hinaufziehen lassen mußte, wenn ich die für mich eingehauenen Stufen in den Felsblöcken selbst auf „allen Vieren“ nicht mehr schaffen konnte. Aber jeder bestiegene Berg war ja ein Hindernis weniger auf dem Wege zum Ziel! Da vergaß ich gern 33° Reaumur! Die Aussicht war großartig, aber die Müdigkeit ließ mich doch nicht zum Genuß kommen.
Magdalenenhöhe, 21. September 1896.
Morgen oder übermorgen sehe ich meinen Mann wieder! Was waren das für schreckliche Wochen! Wie zitterte ich um des Geliebten Leben, wie oft kamen Nachrichten, die mir das Blut in den Adern gerinnen ließen! Wußte ich doch Tom mit seinen 230 Mann und den 8 Deutschen — von denen drei eben erst das perniziöse Fieber überstanden hatten — einem an Zahl weit überlegenen blutdürstigen Feinde gegenüber. Anfangs erhielt ich alle paar Tage Nachricht — dann blieb vierzehn Tage lang jede Botschaft aus! Doch nun ist ja diese schreckliche Zeit der qualvollen Ungewißheit vorüber, ich ziehe ihm entgegen, soll ihn nun bald gesund und fröhlich wiedersehen! Die größte Gefahr ist abgewendet, wenn auch noch viel, sehr viel zu tun übrig bleibt: nämlich Quawas habhaft zu werden. Dazu müssen aber erst Hilfstruppen abgewartet werden, Toms kleine Schar ist in diesem ungeheuren Gebiete dieser Aufgabe natürlich nicht gewachsen. Für mich zum Glück: bis zum Eintreffen der Verstärkungen darf ich bei meinem Manne bleiben! Als Tom das Lager Quawas nahm, ist dieser entkommen, so konnte dem ganzen Feldzuge leider nicht mit einem Schlage ein Ende gemacht werden. Das Gefecht war[S. 49] infolge von Quawas Flucht ziemlich kurz, Tom hatte keine Verluste, auf der feindlichen Seite aber Tote, Verwundete und Gefangene. Es wurden an 1000 Stück Großvieh und 1100 Kleinvieh erbeutet — an Fleischmangel wird die Station also nicht mehr zu leiden haben.
Eine Episode aus diesen sechs Wochen Einsamkeit muß ich doch noch nachtragen. Eines Abends saß ich mit dem Zahlmeister Winkler und dem Lazarettgehilfen Prinage beim Skat, als plötzlich einige Griechen und Araber auf unserer Veranda mit der Schreckensnachricht angestürzt kamen: „Die Wahehe sind da! Sie wollen die Boma stürmen!“ Da hieß es „Kaltes Blut“ — nicht den Kopf verlieren; es war das erstemal, daß ich mich in solcher Lage nur auf mich selbst angewiesen fand. Während Winkler und Prinage Patronen an die sofort alarmierten Soldaten ausgaben, die Boys und Träger mit Vorderladern bewaffneten und jedem seinen Posten anwiesen, ließ ich Wasser herbeiholen, brachte die Reittiere in der Boma unter, sammelte die mit Speeren bewaffneten Männer aus dem Dorfe, brachte sämtliche Windlichter und Laternen zusammen und suchte möglichst Ordnung in das schwarze Menschengewühl zu bringen, denn Weiber und Kinder bildeten ein kaum entwirrbares Knäuel. Dann steckte ich Revolver und Patronen zu mir, legte mein Bestes an Schmuck obenauf im Koffer, um im Falle eiliger Flucht alles zur Hand zu haben, dann machten wir einen Rundgang, um uns von der richtigen Ausführung aller unserer Anordnungen zu überzeugen. Die ganze Alarmierung war in fliegendster Eile vor sich gegangen; nach kaum einer halben Stunde spielten wir auf unserer Veranda weiter. Wir blieben die ganze Nacht auf, — ich hatte die Weiber und Kinder inzwischen auch untergebracht — und vertrieben uns die Zeit mit Kaffeetrinken und Postenrevidieren. Der Höllenlärm unserer aufgeregten Nachtgäste ebbte nach und nach ab, und der prachtvolle Sonnenaufgang fand uns in verhältnismäßiger Ruhe. Die Wahehe waren nicht gekommen, unsere Vorbereitungen für einen möglichst warmen Empfang also vergeblich gewesen. Die Weiber trauten aber dem Landfrieden doch noch nicht: tagelang[S. 50] hielten sie sich in Zelten dicht an der Boma auf, aus Furcht vor den Wahehes.
Die Aufregung jener Nacht hatte wohltuende Wirkung: sie riß mich gewaltsam aus aller kopfhängerischen Angstmeierei, die doch zu nichts nützen konnte, und führte mir mit der wünschenswertesten Deutlichkeit vor Augen, daß ich hier, besonders wenn Tom nicht auf der Station anwesend, wirklich nicht „zum Staat“ da bin. An Beschäftigung habe ich mir in der Zeit alles nur Denkbare hervorgesucht. Meinen Pflegekindern habe ich Kleidchen gemacht, Wäsche geflickt u. a. m. Viel Arbeit verursachte die Herstellung eines Kopfkissens für Tom. Alles, was von Vieh etwas längere Haare hatte, wurde geschoren, aber der Ertrag war nicht groß, denn Ziegen und Schafe haben hier meist ein glattes Fell, Schafwolle kennt man nicht; da ich zu dieser Arbeit die Papierschere benutzen mußte, hatte ich bald Blasen an den Fingern. In diese sechs Wochen fiel auch mein erster Geburtstag als junge Frau! Die Feier hatte ich mir auch anders vorgestellt. Tom hatte für reichen Blumenschmuck meiner Hütte gesorgt, von ihm selbst kam ein herzliches Schreiben — aber doch eben nur ein Schreiben! Als Gratulanten erschienen der Zahlmeister und der Lazarettgehilfe; aus der alten Heimat kein Gruß, kein Glückwunsch. Die Soldaten gaben, wie an hohen Festtagen, mir zu Ehren drei Salven, dann spendierte ich ihnen Geld und den Boys eine Ziege.
Als wir von Perondo abzogen, kam das ganze Dorf, um mir eine gute „Safari“ zu wünschen, mindestens an 300 Weiber begleiteten mich ein Stück Wegs, und als sie schließlich Spalier bildeten, drängten sie sich alle an mich heran, um mir noch einmal „Kwaheri“ zu sagen. Diese Anhänglichkeit, über die ich mich wirklich freute, verdanke ich wohl meiner Gewohnheit, im Dorfe öfter selbst Einkäufe zu machen und die Kinder mit Erdnüssen und dergleichen zu beschenken.
Magdalenenhöhe, II. Etappe, 24. September 1896.
Wiedersehen mit Tom, den ich von hier aus begleite. Der Marsch bis zur II. Etappe (24. September) bot viel Schönes und[S. 51] Interessantes. Zerklüftete Berge, auf deren saftig grünen Matten sich kleine Ansiedelungen zeigten, die mich an die Schweizer Sennhütten erinnerten; rauschende Bergbäche, die ihr kristallklares Wasser in kleinen Kaskaden von Fels zu Fels stürzten, dichtbelaubte, blumenreiche Ufer und ein Wald von Farnen, deren Fiederfächer über uns zusammenschlugen. Unvergeßlich wird mir der große Wasserfall bei Magdalenenhöhe bleiben, zu dem Prinage mich begleitete. Der Weg war ungemein beschwerlich, glatt und steil, der Lohn für die Anstrengung aber ein hoher! In einer Breite von 8 bis 10 Metern stürzen gewaltige Wassermassen einen an 800 Meter hohen Felsen herab, um aus der Tiefe, an den durch Jahrtausende hindurch ausgehöhlten Klippen zerstäubt, als diamantenschillernde Wolke aufzusteigen, das Ganze umrahmt von üppigem Gehänge tropischer Flora, die überall zwischen den Klippen und Felsblöcken hervorquillt — und all diese Pracht im Farbenspiel der afrikanischen Sonne. Kein Maler hat Farben auf der Palette, den Zauber dieser Beleuchtung wiederzugeben — und Worte vermögen es noch weniger. Zu dem nachhaltigen Eindruck, den dieses Tropenbild auf mich macht, kommt noch das Bewußtsein: ich bin die erste weiße Frau, der dieser Anblick vergönnt ist.
Der Weg bis zur III. Etappe und weiter vom Ruaha aus bot ebenfalls viel Abwechselung, ich stand aber noch zu sehr unter dem mächtigen Eindruck dieses in all seiner fremdartigen Schönheit gewaltigen Landschaftsbildes, um der hügeligen Landschaft erhöhtes Interesse zuzuwenden. Während wir auf der II. Etappe waren, brachte einer unserer Schauisch (schwarzer Unteroffizier) 18 Wahehekrieger an, die er samt ihren Weibern und Kindern mit seinen Askaris gefangen genommen. Die Leute waren mit Mauser-Gewehren der Zelewski-Expedition und reichlicher Munition versehen, sie wurden demgemäß unter scharfer Aufsicht bis zur III. Etappe mitgenommen, wo Tom dann schließlich feststellte, daß sie auf dem Marsche nach der Station sich befanden, um sich zu ergeben, als sie von unseren Leuten aufgegriffen wurden. Das ist ein erfreulicher Erfolg von Toms geschicktem diplomatischen[S. 52] Verhalten: durch langsames Vorgehen, ohne Blutvergießen, ohne eine Tembe zu verbrennen, ist den Leuten ad oculos demonstriert worden, daß die Besitznahme des Landes auch auf friedlichem Wege möglich. Nun kommen sie so nach und nach an, um sich den neuen Herren zu unterwerfen. Aber bis mein Mann das erreicht hat, mußte er sich’s viel Sorge und Mühe kosten lassen, und wir alle beide haben diesen Erfolg mit einem Stück Gesundheit bezahlt!
Nun folgten schöne Tage. Mit meinem Mann zusammen konnte ich den letzten Teil unseres Marsches zurücklegen, aus dem mir noch eine höchst malerische Felsenbildung in Erinnerung steht, Trümmer und Säulen wohl vulkanischen Ursprungs, die in ihrer malerischen Anordnung uns das Kolosseum in Rom ins Gedächtnis riefen.
Am 29. September näherten wir uns unserer künftigen Station, und unsere Hochzeitsreise hatte nun ihr Ziel erreicht: Iringa!
Tom war sehr gespannt, ob schon Nachricht da wäre von den von ihm verlangten Truppen, ohne welche die Verfolgung Quawas nicht möglich wäre, und mich interessierte besonders, ob unser Haus schon fertig sein wird!
Wir wurden gleich militärisch empfangen: Leutnant Stadlbaur[5] und Dr. Reinhard mit den Askaris von Kilimatinde begrüßten uns beim Einzug. Die beiden Herren begleiteten uns, sobald die dienstlichen Geschäfte erledigt waren, zu unserem Haus: ein niedliches Strohhäusel, mitten in einem Wäldchen, mit Durchblick nach den Bergen und der Boma; wenn der Wind geht, pfeift er frischweg durch unsere drei Zimmer; es hat auch zwei Veranden, die hintere Veranda richteten wir gleich als Stapelplatz für Lasten und Futterkisten ein. Die Decken der Zimmer sind mit weißem, die Wände mit blauem Zeug ausgeschlagen; das machte alles einen wohnlichen Eindruck, die Herren hatten zudem[S. 53] noch die Wohnung so reizend mit Blumen geschmückt, daß wir unsere herzliche Freude daran hatten! So war uns doch unerwartet ein festlicher Einzug in unser neues Heim durch diese Liebenswürdigkeit bereitet worden. Sobald der Bauleiter eintrifft, wird ein größeres Haus aus festerem Material für uns aufgeführt werden. Die beiden Herren gaben uns ein Willkommensfrühstück auf unserer Veranda, sie selbst bewohnen ein Zelt; nachmittags besahen wir uns die Station, und abends waren die Herren unsere Gäste.
Am anderen Tage ging’s ans Auspacken und Einrichten; besonders das Wohnzimmer sah recht nett aus mit seinen Dekorationen an Gehörnen, Speeren, Gardinen und Felldecken. Als wir die Herren bei uns zu Tische sahen, waren sie freudig überrascht, alles so „europäisch“ zu finden. Sie empfanden es als eine lang entbehrte Wohltat, endlich wieder einmal an einem Tisch, mit wirklichem Tischzeug, mit vollständiger Gläser- und Serviergarnitur und Silberzeug speisen zu können. Unsere Lampen machten sich famos: die Glocken waren natürlich sämtlich gesprungen, aber Tom hatte aus rotem Zeug sehr geschickt Lampenschirme hergestellt; die Sache sah sehr „modern“ aus, genau wie die großen Seidenschirme Stück zu 40 Mark in Berlin W. Wir waren recht vergnügt; ich zog mich aber etwas früher zurück, da ich sehr müde war. Anderen Tags Abschiedspicknick auf einem schön gelegenen Felsen, der eine prächtige Rundsicht bot. Wir hatten Maibowle (Waldmeisteressenz, recht gut) und alles mögliche mitgenommen, u. a. auch Rebhühner. Die Herren waren bei bestem Humor, sie überboten sich im Erfinden neuer Aufmerksamkeiten. Als wir uns trennten, geschah es mit aufrichtigem Bedauern — am nächsten Tage marschierten sie ab. Die Station war also schön eingeweiht worden, meine Befürchtung, hier so ganz ohne Sang und Klang einziehen zu müssen, hatte sich dank der Liebenswürdigkeit der beiden Herren nicht verwirklicht. — —
Nun kamen zwei Ruhetage, in der die Kleinigkeiten in Ordnung gebracht wurden.
Dann traf Herr v. Kleist von Kilossa bei uns ein und nach[S. 54] weiteren zwei Tagen Leutnant Glauning aus Mpapua. Am vierten Tag zogen auch sie fort; wir begleiteten sie ein Stück Weges.
Darauf kam ein Pater Basilius, der hier eine Mission gründen will. Das würde für uns einen erfreulichen Zuwachs von zwei gebildeten Europäern bedeuten. Er blieb zwei Tage bei uns. Die nächsten Tage ruhte ich mich aus, denn es war doch etwas anstrengend gewesen.
Am 12. Oktober 6 Uhr abends erklärte plötzlich mein Mann: „Wir marschieren morgen, auf wie lange kann ich nicht sagen!“ Es handelte sich darum, den Bruder Quawas in unsere Gewalt zu bekommen. Im Nu war alles gepackt, und am nächsten Morgen um 7 Uhr marschierten wir ab. Das Einpacken hier zu Lande ist nicht so ganz einfach, denn da sind nicht nur Kleider, Wäsche usw. mitzunehmen, sondern Haus-, Wasch- und Kochgeschirr, Teller, Messer und Gabeln, kurz und gut, eine ganze kleine Einrichtung, und die Hauptsache: alles Essen und Trinken.
Es war für mich eine höchst interessante „Safari“. Am ersten Tage (13.) kamen wir nach Quawas Sultansresidenz, der eigentlichen Stadt Iringa, einer Negerstadt von etwa 9000 Einwohnern, von der noch ein großer Teil in Trümmern lag; auch Quawas Tembe ist nur zum Teil, und zwar niedriger wie früher, wieder aufgebaut; sie imponiert aber trotzdem durch ihre großen Räume und die zahlreichen labyrinthartigen Verbindungsgänge, in der Küche zählte ich an 60 der hier üblichen primitiven Feuerstellen. Unter dem großen schattigen Baume vor der Tembe war noch der erhöhte Sitz, von dem aus Quawa seine Truppenrevüen abhielt; hatte er doch seine Truppen in besonders kenntliche „Regimenter“ eingeteilt, mit Offizieren und Unteroffizieren; der eine dieser Truppenkörper trug z. B. nur ganz weiße Schilde!
Am 14. Oktober erreichten wir Quawas altes Lager; schon auf dem Wege dahin stießen wir auf viele kleine Lager; das große Lager liegt so versteckt in den Bergen, daß man es gar nicht gefunden hätte, wenn nicht Waheheleute es gezeigt hätten. Es maß wohl 1600 Schritte im Umfang.
Hier sollte sich der Zweck unserer Safari erfüllen: im Lager fanden wir Mpangire, den einzigen rechten Bruder Quawas, und Kapande, seinen Halbbruder, mit ihren Leuten. Sie kamen, sich zu unterwerfen.
Im Lager fand sodann großes Schauri statt, in welchem mein Mann erklärte, Mpangire solle als Sultan an Quawas Stelle eingesetzt werden; bis zur Gefangennahme Quawas jedoch müsse er ihn in Haft nehmen. Mpangire ist ein großer, hübscher Mann mit offenen Zügen und freiem Blick, sein ganzes Wesen macht einen guten Eindruck. Außer den beiden Brüdern Quawa und Mpangire (ein dritter Bruder endete durch Selbstmord) leben noch drei Schwestern: die eine ist die Frau des Merere, die beiden anderen waren bis jetzt bei ihrem Bruder Quawa, kamen aber mit Mpangire zu uns.
Mereres Frau ist es übel ergangen: als Quawa sich mit seinem Schwager Merere entzweite — er hatte auch eine Schwester von diesem zur Frau — ließ er dem armen Weibe, der Schwester seines nunmehrigen Feindes, die Augen ausstechen — worauf nun Merere an Quawa Rache nahm und dessen Schwester auf gleiche Weise blenden ließ!
Am 16. kamen wir mit unseren Schutzbefohlenen hier wieder an. Sie wurden in einer Tembe mit Dornboma untergebracht, die sie nicht verlassen dürfen, sonst kann jedermann sie besuchen. Am Tage haben sie zwei, nachts vier Wachtposten.
Zu meiner Freude fanden wir schon etwas Garten an unserm Hause angelegt.
21. Oktober 1896.
Heute besuchten mich eine richtige und eine Halbschwester von Quawa. Rotwein schien ihnen sehr zu schmecken, Butterbrot weniger, umsomehr aber Zucker und vor allem Cakes. Sie baten mich, ihnen das Nähen beizubringen, und wollen zu diesem Zwecke bald wiederkommen. Beide sind hübsche Geschöpfe mit kleinen Füßen und schmalen Händen, besonders Quawas rechte Schwester gefiel mir durch ihr offenes Wesen. Wir waren sehr lustig mit[S. 56]einander und schlossen gute Freundschaft. Nur beim Essen und in sonst noch einigen Bewegungen verrät sich zuweilen die „Wilde“.
Unser Renommierstück, auf welches Tom besonders stolz ist, wurde heute fertig: die Diele im Schlafzimmer. Alles, was an Einpackholz aufzutreiben war, ist dazu verwandt worden; sie sieht zwar demnach etwas sehr gestückelt aus, ist aber trotzdem sehr schön; da sie einen Fuß hoch über dem Boden angebracht ist, werden wir immer trockenen Fußboden haben. Das Linoleum kommt uns ganz besonders gut zu statten: wir haben es ringsum an der Wand des Schlafzimmers gezogen, nun hält es den Wind ab und sieht hochfein aus!
Ab und zu machen wir einen Spaziergang; ein Aussichtspunkt ist ganz in der Nähe, der sich mit den schönsten Schweizer Glanzpunkten messen kann. Dazu die prachtvolle, klare Luft; wir fühlen uns nach all den Sumpfniederungen wie in einem klimatischen Kurort, und das Bild unserer ersten Station Perondo kann neben diesem schönen Lande hier nicht aufkommen. Die Nachwehen unseres Marsches äußern sich übrigens, ich habe zuweilen kleine Fieberanfälle. Die Bazillen müssen erst wieder herausgetrieben werden. Heute kamen die Schwestern wieder und brachten 20 Ehefrauen Mpangires mit. Die beiden Quawa-Schwestern, Salatamanga und die Halbschwester Fulimanga, und die „größte“, d. h. erste Frau Mpangires, Hamuna, erhielten Stühle sowie Tee und Zucker, die andern hockten auf der Erde. Mit dem Nähen wurde es aber nichts: Hamuna erklärte mir, Arbeit sei etwas Häßliches, und nun wollen die beiden andern auch nichts mehr lernen. Hamuna ist hübsch und scheint außer ihrer Faulheit auch ein gut Teil Schlauheit zu besitzen, sie hat aber kein so gutes Gesicht wie die beiden Schwestern. Da aus der Nähstunde nichts wurde, zeigte ich ihnen die Bilder in Brehms Tierleben, das begeisterte sie sehr, namentlich die der ihnen bekannten Tiere. Da mein Toilettenspiegel zerbrochen angekommen ist, schenkte ich jeder ein Stück davon: das machte großen Eindruck, sie wurden nicht müde, sich darin zu bewundern.
Soeben schickt mir Mpangire das landesübliche Gastgeschenk:[S. 57] ein kleines Mädchen, Paligungire, ebenso landesüblich lasse ich das kleine Ding zunächst im Flusse einer gründlichen Reinigung unterziehen und stecke es dann in eines der Kleidchen meiner kleinen Muhegu; mein neues „Eigentum“ hat ein drolliges Kindergesichtchen, mit großen treuherzigen Augen. Vorläufig sehen sich nun beide Mädels Bilder an, morgen soll der erste Nähversuch gemacht werden. Mit Teller und Löffel hantieren sie ganz geschickt.
Aus der Heimat seit drei Monaten keine Nachricht!....
Das Auspacken und Einrichten macht viel Freude; die Wirtschaft wächst mir zusehends unter den Händen, und jedes frisch ausgepackte Stück wird wie ein lieber alter Bekannter begrüßt. Noch 14 Tage ungefähr, dann hört hoffentlich das Leben aus den Koffern und Kisten auf. Mit Vorräten für ein Jahr wirtschaften, ohne Vorratskammer oder Keller zu haben, über diese Aufgabe muß Henriette Davidis noch einen besonderen Nachtrag schreiben, für afrikanische Hausfrauen und solche, die es werden wollen.
24. Oktober 1896.
Heute brachte ich Mpangire und Kapande mein Gegengeschenk für das kleine Mädchen. Während ersterer durch stattlichen Wuchs sich auszeichnet und überhaupt vorteilhaft von seiner Umgebung absticht, ist der um vieles ältere Kapande kleiner und unansehnlich, hat aber ein gutes, freundliches Gesicht. Mpangires energisches, freies Auftreten, sein offener Blick zeigen Rasse. Für die Frauen nahm ich Tücher mit, für ihn eine Flasche Rotwein. Damit reizte ich seine Begehrlichkeit zu allerlei größeren Wünschen: noch einen neuen Anzug, ein Schwein und anderes. Ich erklärte ihm aber, ein so reicher Mann wie er, mit solchen Elfenbeinvorräten, könne sich das an der Küste alles selbst kaufen. Die Unterhaltung war nicht so ganz einfach. Mein Dolmetscher versteht auch kein Kihehe; meine Worte mußte er nun erst einem anderen Sprachkundigen übersetzen, der sie dann dem Sultan weiter vermittelte. In einer Ecke standen die Sklaven[S. 58] zusammengedrängt, die Frauen waren nicht anwesend; seine „erste Frau“ und die Schwester mußte ich rufen lassen, um sie zu begrüßen; sie entfernten sich gleich wieder. Die niedere Stellung, die den Frauen hier angewiesen ist, erschwert mir meine Aufgabe ganz bedeutend; wenn mich die Frauen hier auch als ihnen überlegen ansehen, den Männern gegenüber muß ich mir meine Stellung erst herausbeißen. Zu diesem Besuche hatte ich mir einen großen Stuhl hintragen lassen, auf dem ich Platz nahm, der Sultan saß auf einem niedrigen Stuhle, alles übrige stand um uns herum.
27. Oktober 1896.
Meine Boys machen mir viel Ärger; sie stehlen wie die Raben, dazu die angeborene Faulheit. Juma, der schon seit Jahren bei meinem Mann ist, und von dem ich glaubte, ob seines Verwöhntseins nicht mit ihm auszukommen, ist jetzt der Beste von allen; seine „Güte“ ist zwar niemals aufregend, aber er bleibt sich wenigstens immer gleich und zeigt vor allem niemals die ausgesprochen schlechten Eigenschaften seiner schwarzen Kollegen.
Abends machen wir gewöhnlich einen Spazierritt. Die Natur ist hier so herrlich, die Luft so klar und erfrischend, man fühlt bei jedem Atemzug: hier ist Gesundheit, hier ist das Quisisana, dessen wir nach all den Fiebergegenden, die wir durchzogen, so dringend benötigen. Kleine Fieberanfälle stellen sich leider bei Tom immer noch zuweilen ein, und selbst ich habe schon einige gehabt. Die vielen Reitwege ringsum geben uns gute Gelegenheit, die Gegend genauer kennen zu lernen; unsere Maultiere klimmen die steilsten Felsenpfade hinan, die für ein Pferd wohl ganz unpassierbar sein würden.
Meine schwarzen Damen scheinen mich heute nicht zu besuchen. Kürzlich zeigte ich ihnen einen an einem Gummiball mittels dünnen Schlauches befestigten, recht naturgetreu aussehenden Frosch, der infolge des Luftdruckes ganz natürlich forthüpfte: ganz wie in Europa fürchteten sich meine schwarzen Damen auch hier vor dem kleinen Ungetüm. Schade, daß ich bei den Weihnachtsbestellungen[S. 59] nicht an mehr dergleichen Spielereien gedacht habe; Weihnachten wollen wir nämlich großartig feiern. Hoffentlich treffen die bestellten Sendungen pünktlich ein.
30. Oktober 1896.
Die Regenzeit meldet sich an, bedeckter Himmel, entfernter Donner und heute der erste Regenguß — viel zu früh für uns, denn noch ist längst nicht alles unter Dach und Fach. Namentlich die wasserdichten Wohnungen für die Soldaten sind noch nicht fertig; es fehlt uns sehr an Werkzeug, um den Bau zu beschleunigen. Unsere Zimmer standen zum Teil, die Veranda vollständig unter Wasser, und es ist mir mancherlei verdorben. Übrigens sieht man hier schon den Kulturfortschritt: alle haben doch schon wenigstens einige Kleidungsstücke an! Die Männer allerdings im allgemeinen mehr als die Frauen.
Unser Garten wird sehr hübsch, bei seiner Bestellung spielt ein Rechen mit Zinken aus Zimmermanns-Nägeln die Hauptrolle. Der Blick von einem Fenster aus bietet viel Interessantes, ich sehe die rege Bautätigkeit und kann verfolgen, wie aus Holzstäben, Bast, Gras und Erde Häuser, eine Straße, ein ganzes Dorf entstehen. Die Einwohner, die sich mit ihrem Vieh und wertvollerem Besitztum in die Schluchten des unwegsamen Gebirges geflüchtet hatten, sind wieder zurückgekehrt, auch die meisten von Quawas Verwandten und seinem Anhang, die Sikki-Gesellschaft, die Mutter, eine Tochter mit Klumpfüßen und ein Sohn, haben sich in Toms Schutz begeben. Es war uns dies um so auffallender, da ihr Vater von Tom 1892 in Tabora geschlagen wurde. Als dessen Hauptburg fiel, sprengte er sich mit seinen Weibern in die Luft.
Mein Mann läßt den Sohn ein Wanjamwesi-Dorf hinter der Station gründen. Unten im Tal will er dann auch ein Dorf von Kondoa-Leuten anlegen; diese Einrichtung wird sehr nutzbringend für die Station sein, es können dann die von den Wahehe geraubten Leute dort Unterkunft finden.
Heute kam eine Frau, die aus Ubena entflohen war, um bei[S. 60] uns Schutz zu suchen. Ihr waren die Ohren abgeschnitten worden. Jetzt fangen die Frauen an, zu mir zum Schauri zu kommen, ich habe täglich sechs bis acht von ihnen bei mir, die natürlich dann auch beköstigt sein wollen.
31. Oktober 1896.
Heute ist der zweite Mhehe gehängt worden, der einen unserer Trägerführer am Ruaha ermordet hat. Mein Mann ließ diese durch die traurige Notwendigkeit zur Unerläßlichkeit gewordene Hinrichtung mit einer gewissen, auf die Gemüter der Eingeborenen wirksamen Feierlichkeit ausführen: Sämtliche Wassagira aus Iringa mußten der Exekution beiwohnen. Auch eine große schaulustige Menge hatte sich, wie mir Tom nachher erzählte, zu dem traurigen Schauspiel eingefunden, darunter sehr viele Frauen, welche Tom den Platz verlassen hieß. Die Schaulust zeigte sich jedoch hier stärker als der sonst eingefleischte Gehorsam, und erst als der Befehl durch Festnahme und Abführung eines der Weiber gründlichen Nachdruck erhielt, bequemten sich die übrigen, sich zu entfernen. Der Mörder ist so in sein Schicksal ergeben gewesen, daß er den Kopf selbst in die Schlinge gesteckt hat. Ein Gnadenschuß, den Tom bei solchen Exekutionen stets abgeben ließ, hatte den sofortigen Tod des Verurteilten zur Folge. Das abschreckende Beispiel einer solchen Hinrichtung ist um so nötiger, als auch einer unserer Askaris, der seinerzeit bei dem anstrengenden Marsche hinter der Kolonne zurückblieb, Meuchelmördern zum Opfer fiel. Die Täter sind noch nicht entdeckt.
Von Quawa kamen zwei Leute, angeblich um sich zu unterwerfen; in Wahrheit waren es Spione, die unsere Station auskundschaften wollten! Sie verschwanden bald wieder, und Tom ließ sie durch Patrouillen verfolgen.
1. November 1896.
Der Gemüsegarten wird in der Nähe der Stelle angelegt, wo nach Grundwasser gebohrt wird. Wir sahen uns die Arbeit an, die, da wir keinen Erdbohrer haben, nur langsam fortschreitet.
Wir haben jetzt 1000 Stück Vieh, und das zu verwalten ist auch keine Kleinigkeit. Mein Mann will dem Volk den Reichtum nicht ganz entziehen, deshalb gibt er ein Drittel dem Sultan, ein Drittel dem Gouvernement und ein Drittel wird größeren Leuten zum Beaufsichtigen gegeben, dieselben bekommen jedes dritte Kalb als ihr Eigentum, das andere soll zur Küste geschickt werden.
Heute nachmittag ließ mein Mann Mpangire und seine zwei Halbbrüder Kapande und Sadangamenda zu uns kommen. Bei ersterem und letzterem hat man wirklich nicht das Gefühl, sich mit Schwarzen zu unterhalten.
Entsprechend dem im ganzen Volke hier in einem Grade ausgeprägten Selbstgefühl, wie man es sonst bei Negern kaum findet, treten auch die Mitglieder der Sultansfamilie mit ganz besonderem Selbstbewußtsein auf. Sie wissen sich gut zu unterhalten, aus ihren klugen Fragen sprechen Wißbegierde und Intelligenz, unsere europäischen Gewohnheiten suchen sie sich möglichst anzueignen. So saß Mpangire kürzlich bei uns im Zimmer; der Teppich reichte nicht bis zu seinem Platz, deshalb glaubte er nichts Unpassendes zu tun, wenn er seinen Zigarettenstummel einfach auf den Boden warf. Sadangamenda dagegen, dessen Stuhl auf dem Teppich stand, wagte nicht, diesen zu beschmutzen und war sichtlich aus großer Verlegenheit erlöst, als ich ihm einen Aschbecher reichte, auf den er seinen Stummel deponierte. Mpangire verfolgte dieses Manöver mit großer Aufmerksamkeit, und bald hatte er — von mir anscheinend unbeobachtet — seinen Zigarettenrest vom Boden aufgelesen und in den Aschbecher praktiziert. Es ist ein Vergnügen, die beiden intelligenten Burschen zu beobachten, dabei sind es hübsche Leute, an Gesicht sowohl wie an Wuchs. Auch an Galanterie fehlt es ihnen nicht; Mpangire und seine Brüder küssen mir stets die Hand, und heute hat mir ersterer als Beweis seiner besonderen Wertschätzung einen schönen — Ochsen verehrt. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.
Die Kunst, dem Neger durch marmorne Unbeweglichkeit der[S. 62] Gesichtszüge zu imponieren, besonders wenn die unbewußte Komik unwiderstehlich zum Lachen reizt, habe ich immer noch nicht raus. Tom ist Meister darin. So mußte ich gestern einfach die Hütte verlassen, als ich mit ansah, wie ein Neger meinem Manne durchaus die Füße küssen wollte: der am Boden rutschende Neger, der Toms Füße zu haschen, und Tom, der sein Piedestal in Sicherheit zu bringen suchte, boten ein Bild, welchem meine Seelenruhe noch nicht gewachsen war.
3. November 1896.
Nach drei langen Monaten heute endlich die Post — Briefe aus der Heimat! Was das bedeutet, kann mir nur ein „Afrikaner“ nachfühlen. Auch die Boys erhielten Briefe, Mpischi z. B. einen von seiner Mama, d. h. seiner richtigen Mama, im Gegensatz zu der bei den Negern (auch den Frauen) beliebten angenommenen „Mama“, d. h. mütterlichen Freundin. Sie verwahrt dem Neger das verdiente Geld, macht seine Schauris, sorgt für seinen Anzug, kocht für ihn. Es gibt auch unter ihnen ganz junge „Mama’s“, die sind meistens recht kostspielig. Am liebsten würde mein Mann die Mamas an der Küste ganz abschaffen.
4. November 1896.
Heute traf vom Gouvernement die Genehmigung zu allem ein, was mein Mann bis jetzt getan hat und noch tun will. So wird alles in kürzester Zeit in schönster Ordnung sein. Auch Merere soll als Sultan in Ubena und Mpangire in Uhehe eingesetzt werden. Die Offiziere können mit den Kompagnien jeden Tag eintreffen. Ich schenkte heute Mpangire eine Flasche Gin und auf einem Teller ein schönes Stück Schinken. Den Teller wollte er natürlich auch behalten.
24. Dezember 1896.
as war ein wichtiger Tag für uns. Das deutsche Weihnachtsfest mußte vor der für unsere hiesigen Verhältnisse wenigstens großen Haupt- und Staatsaktion der feierlichen Einsetzung Mpangires an Bedeutung zurücktreten. Aber gefeiert haben wir unser erstes afrikanisches Weihnachten doch, und zwar recht feierlich, nachdem wir der Politik ihr Recht gegeben hatten.
Um 10 Uhr vormittags meldete der Feldwebel alles zur Einholung fertig, und mein Mann, in voller Gala natürlich, begab sich zu dem neuen Sultan. Inzwischen waren die Patres, der Doktor Stierling und ich auf den Festplatz gegangen, wo dicht gedrängt die Leute in schönsten, schneeweißen Gewändern, die Frauen in ihren besten Tüchern standen. Ein farbenprächtiges Bild, umgrenzt von saftigem Grün, die Berge als Hintergrund. Das blaue Himmelsgewölbe hat vorher wohl kaum auf eine so lebenslustige und heitere Volksmenge an dieser Stelle herabgeschaut. Die Stelle der „höchsten Zivilisation“ vertreten Leutnant Glaunings und meine photographischen Apparate, für welche die bevorstehende Feierlichkeit viel zu tun gab.
Über 500 Mann Truppen in Paradeaufstellung, Offiziere und Unteroffiziere vor die Front gezogen, standen zum Empfange des neuen Herrn bereit, den mein Mann einzusetzen im Begriff stand. Endlich schlugen die Tambours an; die Herren, mit denen[S. 64] wir inzwischen geplaudert, eilten auf ihre Posten und wir Photographen an unsere Guckkästen. Jetzt kamen sie an. Rechts zur Seite Toms die stolze, stattliche Erscheinung des Mpangire, der seiner Würde bewußt einherschreitet — „jeder Zoll ein König“, ein echter Vertreter des Quawageschlechts. Vor der Front der Truppen angekommen, schwenkte die Musik nach dem Flügel ab, während Herr v. Kleist den Frontrapport erstattete. Dann hielt Tom eine kurze Ansprache an die Wahehe, in welcher er ihnen Mpangire als neuen Sultan bekannt gab; dem Sultan überreichte er als Zeichen seiner Herrschergewalt eine deutsche Flagge und ein von Sr. Majestät unserem Kaiser zu diesem Zwecke verliehenes prachtvolles Schwert. Die Truppen präsentierten, und ein vielhundertfaches Hurra! auf unsern Allerhöchsten Kriegsherrn, den Kaiser, weckte das Echo der Berge. Unter der umstehenden Volksmenge herrschte lautlose Stille; diese militärische Feierlichkeit machte augenscheinlich tiefen Eindruck, es war, als wenn die Masse erstarrt wäre, alles sah auf den Brennpunkt: meinen Mann und Mpangire. Zum Schluß wurden zugweise Salven und Schnellfeuer abgegeben. Dann ging es im Umzug in Sektionskolonnen durch die Stadt. Voran die Musik, dann mein Mann, Herr v. Kleist, Mpangire mit seinen Brüdern, ich, zum Schluß die Truppe, und genau so wie zu Haus bei solchen Gelegenheiten umgab uns die jetzt lärmende Volksmenge. Alles war aufs schönste mit Blumengewinden, Fahnen und Fähnchen geschmückt, jede Hütte war ausgeputzt.
Ich hatte mich bald von dem Zuge getrennt, um den Festzug aufzunehmen. Was ich laufen konnte, eilte ich an den Apparat; als der Zug ankam, knipste ich — aber alle Mühe war umsonst! Der Verschluß versagte! Glücklicherweise haben die andern gute Aufnahmen machen können.
Mittlerweile war es 11½ Uhr geworden, und jeder zog sich zurück, denn um 2½ Uhr war Preisschießen. Zu Hause machte ich eine Schüssel Konfekt und Marzipan, in der Mitte eine Ananas, zurecht, auf der eine Karte mit der Mitteilung steckte, daß wir der Unteroffiziersmesse ein Kegelspiel zu Weihnachten, vorläufig allerdings erst schriftlich, stifteten.

Feierliche Einsetzung des neuen Sultans Mpangire.
(Zu S. 64.)

Lager des Sultans Kiwanga mit seinem Kontingente
in Iringa.
(Zu S. 126.)
Wir aßen zu Mittag, und um 2½ Uhr waren wir auf dem Schießplatz. Mein Mann schoß mir den ersten Preis, einen sehr schönen Elefantenzahn. Für die Einsätze und Reugelder waren Elefantenzähne als Preise angekauft worden. Es wurde mit Mauser-Gewehren geschossen. Die Unteroffiziere und die ersten schwarzen Dienstgrade schossen auch mit. Ich wurde mit dem Auftrag beglückt, die Preise zu verteilen.
Nach dem Preisschießen folgte ein Rennen. Beim Eselrennen gewann mein Esel, von Dr. Stierling geritten, den ersten Preis. Dann wurden fünf Ochsen am Spieße gebraten, ganz wie bei der Kaiserkrönung im alten römischen Reiche deutscher Nation, und vergnügter wie unsere Schwarzen hier können die „Frankfurt am Mainer“ auch nicht gewesen sein, wenn wir auch keine Springbrunnen mit rotem und weißem Weine sprudeln lassen konnten.
Eine große Volksmenge war auf dem Rennplatz noch versammelt, wo nach dem letzten Maultierrennen ein Wettrennen zwischen Boys, Fundis, Trägern und Askaris stattfand, der Erste am Platze konnte sich die großen hingeworfenen Preise (Tücher!) aufheben. Daran schloß sich Strickreißen. In die stärkere Partei wurden auch Tücher hinein geworfen, die derjenige bekam, der sie zuerst auffing, natürlich entstand dann oft ein großer Streit, der den Tüchern allerdings nicht zum besten gereichte.
Ein Gejauchze und Gejuble, daß einem ordentlich das Herz mit lachte! Es war wirklich alles so nett und vergnügt. So schön habe ich mich beim schönsten Ball nicht amüsiert. Den Höhepunkt erreichte aber das Jubeln, als mein Mann und ich Pesas unter die Menge warfen!
Die Sonne war bei alledem schon untergegangen, und die Dunkelheit nötigte uns, aufzubrechen. Zu Hause angelangt, ging ich nun an meine Arbeit, denn in 1½ Stunde sollten unsere Gäste schon kommen. Während der verschiedenen Veranstaltungen[S. 66] hatte ich mich manchmal unbemerkt davon geschlichen, um zu Hause nach dem Rechten zu sehen. Ich war daher sehr stolz, als beim Essen mein Tischnachbar zu mir sagte: „Wie haben Sie das alles möglich gemacht? Sie waren doch bei allem dabei?“
Im Garten hatten wir des Morgens einen Baum aufstellen lassen (im Zimmer war es zu gefährlich), der mit selbst fabrizierten Lichtern aus Honigwachs und Silberpapier geschmückt war. Vorn war eine Karte befestigt, auf der wir vorläufig schriftlich der Offiziersmesse ein Krocket stifteten. Die Tafel hatte ich mit Blumen ausgeschmückt, zwischendurch nach dem Essen gesehen und kaum hatte ich Zeit, mich in höchste Eleganz zu stürzen, als unsere Gäste auch schon eintrafen.
Es war ein fröhliches Mahl, und zum Schluß wurde der Christbaum angezündet. Da hat wohl jeder von uns seiner Lieben gedacht. Nach einer feierlichen Stille, die von der vorhergegangenen Lustigkeit abstach, stimmte einer der Herren „Stille Nacht, heilige Nacht“ an, das wir alle mitsangen. Weiß Gott, es war ergreifend, wie das heilige Lied von den Lippen der jungen Offiziere erklang; es dauerte ein Weilchen, ehe wir uns wieder in die Wirklichkeit zurückgefunden hatten; dann waren wir wieder vergnügt und lustig beisammen. Mit Champagner wurde das Wohl aller unserer Lieben ausgebracht; unter Gläserklingen folgte noch manch lustiges Lied.
Als das letzte Licht am Baum erloschen, setzten wir uns auf die Veranda, wo Kaffee, Kognak usw., der Marzipan und der Ringkuchen verzehrt wurden. Ich hatte in einen großen Napfkuchen einen Ring eingebacken, der Anlaß zu viel Scherz und Heiterkeit gab. Das Essen war gut geraten, und auch der mit allerhand Schwierigkeiten bereitete Marzipan fand Beifall; ich sah mit dem Stolze, der jeder Hausfrau verständlich sein wird, daß mein eigenhändig gebackener Marzipan bis aufs letzte Krümelchen aufgegessen wurde. Erst nach zwei Uhr nachts trennten wir uns.
Den Abend des 25. Dezember verbrachten wir im Kasino bei Illumination und „italienischer Nacht“ — wir wurden sogar[S. 67] mit Musik empfangen. Am 26. früh verabschiedeten sich die Offiziere, Pater Alphons und ich machten noch einige Gruppenaufnahmen, dann ein letztes Händeschütteln, die Abteilungen traten an, die Herren übernahmen ihre Kommandos, und jeder rückte nach seiner Garnison ab. — Der Abschied ging uns nahe, es waren alles so liebe prächtige Menschen, die uns da verließen. Gott gebe, daß uns allen ein frohes Wiedersehen beschieden!
Mein Mann hatte nun viel zu tun, besonders Berichte zu schreiben, und ich versuchte, meinen Haushalt wieder ins gewohnte Gleis zu bringen.
Den Silvesterabend verlebten wir mit Herrn v. Stocki und den Missionaren, die am 29. noch eingetroffen waren, nach deutscher Sitte. Am 2. Januar wurde Herr v. Stocki durch Graf Fugger abgelöst; auch die evangelischen und katholischen Missionare zogen wieder ab. Leutnant Stadlbaur schickte zwei Strauße; sie sind sehr zahm, spazieren in den Straßen herum und sind der Schrecken aller Weiber, die ihr Mehl zum Trocknen im Freien ausbreiten. Ein kleiner, etwa drei Tage alter Elefant konnte nicht am Leben erhalten werden; trotz der Unmengen von Milch, die wir ihm vermittelst eines aus Tuch hergestellten recht ansehnlichen „Lutschbeutels“ beibrachten, ging er nach acht Tagen ein.
27. Januar 1897. Kaisers Geburtstag.
Frühmorgens kam ein Bote aus Iringa mit einer Alarmnachricht von den Patres: „Quawa sei in der Nähe!“ Tom schickte ihnen sofort Askaris zur Verstärkung des Postens, der unter diesen Umständen bedroht erschien. — Dann feierten wir den Geburtstag Sr. Majestät mit Parade, Salut von Kanonenschüssen und Ansprache meines Mannes an die Askaris, die ihrem obersten Kriegsherrn drei kräftige Hurras ausbrachten.
Nach der Parade tranken die Herren bei uns Wein, und abends waren wir im Kasino. —
Ich vergaß zu erwähnen, daß auch an unserem Hochzeitstage, am 4. Januar 1897, ein Alarmbrief kam. Leutnant Fonck hatte wieder ein Gefecht in Ubena gehabt! Überall gärt es[S. 68] noch, das Land ist eben noch lange nicht in Ruhe. Die meisten Frauen und Kinder Quawas sind in der Gewalt der Station.
Trotzdem von allen Seiten schlimme Nachrichten kommen, welche die gefährliche Nähe von Quawa und seinem Anhange melden, bewahrt mein Mann, auf dem die ganze Verantwortlichkeit ruht, eine beneidenswerte Ruhe.
30. Januar 1897.
Die beiden letzten Nächte habe ich sehr unruhig geschlafen, denn der Gedanke, einer von Quawas Anhängern könnte Feuer an unsere Hütte legen, ist doch zu ungemütlich. Man könnte ja bei dem Stroh auch nichts retten.
Wenn ich Schritte in der Nacht dicht bei uns höre, überläuft’s mich ganz kalt.
Gestern war der Pater da und hat von 5 bis 11 Uhr nachts uns von Quawa erzählt und mich eingegruselt. Mein Mann hatte darüber schon von anderer Seite gehört; also etwas Wahres muß daran sein. Er meinte, angreifen werde Quawa uns nicht, ohne daß es lange vorher bekannt würde. Aber Schabernack spielen, wie Feuer anlegen usw., das wäre schon möglich. Mpangire ist auch nicht ganz zu trauen, er kann sein echtes Waheheblut nicht verleugnen. Meinem Mann ist das gleichgültig, wenn Mpangire nur sonst treu ist und hier tüchtig das Regiment führt. Über Nacht sind jetzt viele Posten ausgestellt. Diese Nacht ging ich mit meinem Mann Wachen revidieren. Es war herrlich, der Himmel strahlte in seiner Sterne Pracht. Der südliche Himmel ist doch bei weitem schöner wie der zu Hause, es tat uns beinahe leid, als unser Rundgang zu Ende war; ich legte mich gleich nieder, aber mein Mann arbeitete die Nacht durch, denn er wird jetzt sehr von seiner Schlaflosigkeit geplagt.
Als unsere Gäste uns gestern verließen (wir hatten den Grafen Fugger angefeiert), machten wir noch einen Spaziergang. Plötzlich flammte Feuerschein im Dorfe auf, und als wir zurück[S. 69]eilten, fanden wir die Kompagnie bereits unterm Gewehr. Zum Glück brannte nur eine Tembe; Tom lief voraus, und als ich zur Feuerstelle kam, stand er bereits auf dem brennenden Dach und leitete mit Wort und Tat die Löscharbeit. So sehr ich um das Leben meines Mannes bangte, so war ich doch auch stolz, zu sehen, mit welcher Ruhe und Umsicht er und Graf Fugger immer da waren, wo die Gefahr am größten.
2. Februar 1897.
Heute morgen war Mpangire mit Gefolge da; wie immer wurde er reichlich bewirtet, aber etwas kühler behandelt wie sonst, denn es ist ihm durchaus nicht fest zu trauen. Unter anderem bekam er eine Zimtsauce zu essen; plötzlich fragte er, was alles in der Sauce sei. Als ich ihm alles aufzählte und von Eiern sprach, erschrak er und legte sofort den Löffel weg. Bei den Wahehes ist es nicht Sitte, Eier zu essen.
Mein Mann schreibt eben ein Gesuch an Herrn v. Schele. Er hat bei den Teilnehmern der letzten Wahehe-Expedition den Gedanken angeregt, den Gefallenen der Zelewskischen Expedition ein Denkmal hier zu setzen; es sollen nur die Herren daran teilnehmen, die 1891 und 1894 gegen die Wahehe gekämpft haben. Während er noch schrieb, kam wieder ein Alarmbericht von den Missionaren, sie hätten einen „Haufen Quawaleute“ gefangen genommen und bäten um Verstärkung. Graf Fugger brach sofort auf, um nachzusehen.
11. Februar 1897.
Gestern abend, als wir vom Reiten kamen, schlichen sich dunkle Gestalten an meinen Mann heran. Es waren unsere Vertrauensmänner Farhenga, Lupambila (Sadalla fehlte), und um diese Zeit bedeutet das immer etwas Wichtiges. So war es denn auch: wieder Unruhen! Quawa hat einen Msagira, den mein Mann in Ubena eingesetzt hatte, getötet. Die Mageleute hielten zu Quawa und schickten ihm große Vorräte, die Ruahaleute seien alle weggelaufen.
Mein Mann wollte gleich nach Mage aufbrechen, doch da es schon zu spät war, um noch vor Sonnenaufgang dort anzukommen und sie zu überraschen, unterblieb es. Ich war sehr froh darüber, denn meinen Mann auf einem nächtlichen, zwölf Stunden langen strammen Marsch zu wissen, gehört nicht zu meinen Freuden. Morgen wird der Tschausch mit Askaris und Lupambila dahin gehen, das fällt weniger auf, als wenn ein Weißer kommt.
Unser zweiter Elefant ist gleichfalls trotz aller Mühe gestorben; wahrscheinlich verhungert, trotzdem er riesige Mengen Milch bekam. Die Kuhmilch mag wohl nicht genügend Nährkraft für einen Dickhäuterorganismus enthalten. Im „Brehm“ steht nichts über Aufzucht der Elefanten!
12. Februar 1897.
Was für eine qualvolle Nacht liegt hinter mir! Gestern nachmittag kam plötzlich mein Mann hereingestürzt und rief mir zu: „Bitte mach schnell Essen und zwei Decken zurecht“, dann war er auch schon verschwunden. Zwei Stunden zermarterte ich mein Gehirn, was bloß geschehen sein mochte! Jedenfalls wollte er irgendwohin abmarschieren.
Endlich kam er, und jetzt erfuhr ich, daß Quawa den Ruahaposten überfallen und die Askaris niedergemetzelt habe. Daraus kann man wohl auch schließen, daß Magdalenenhöhe und Perondo, so entsetzlich es auch ist, das gleiche erfahren haben. Tom wollte nun gleich nach Iringa, um Mpangires Nest auszuheben, während Graf Fugger nach den Etappen ging.
Alles wurde heimlich vorbereitet, damit die Wahehe hier nicht die Leute in Iringa benachrichtigen könnten. Als alles so ziemlich bereit war, wurde nach Quawas angesehenstem Halbbruder Gunkihaka geschickt, der vor ein paar Tagen angekommen war, um sich hier anzubauen. Mein Mann sagte gleich: „Dem muß ich tüchtig auf die Finger sehen.“ Nun war es schlimmer, als wir dachten: er wollte uns nicht bloß ausspionieren, sondern im[S. 71] Rücken überfallen. Daß in der letzten Zeit etwa 30 Temben gebaut wurden, erschien uns jetzt auch in einem anderen Licht.
Graf Fugger aß mit uns, da das Essen in der Messe noch nicht fertig war und es so am wenigsten auffiel. Dann ging er, seine Sachen zu ordnen. Selbst mein Mann war diesmal des Ausgangs nicht gewiß! Dann kamen Gunkihaka und ein Msagira, der eben erst angekommen war. Mein Mann hatte das Gewehr vor sich hingelegt, fertig zum Schuß, wenn Gunkihaka entfliehen wollte. Einen Menschen so vor dem Gewehrlauf sitzen zu sehen, war — milde ausgedrückt — aufregend! Aber konnte nicht derselbe Mensch sich plötzlich auf meinen Mann stürzen, ehe er losdrücken konnte?
Jeder Nerv war in höchster Spannung. Alles war regungslos und totenstill, auf einer Seite des Zimmers saßen Farhenga und Sadalla, gegenüber die zwei Boys, die die Unglücksbotschaft gebracht hatten.
In der Veranda mein Mann, Gunkihaka und ich um einen Tisch, auf dem die Lampe brannte, an der Erde hockend der gefangene Msagira, dahinter zu den Seiten zwei Askaris.
Gunkihaka benahm sich musterhaft, aber trotz der zur Schau getragenen Ruhe vibrierte seine Stimme etwas, und über sein Gesicht ging hin und wieder ein leichtes Zucken. Er sollte über ihren Plan berichten und über das Geschehene, doch es war keine Silbe aus ihm heraus zu bekommen.
Da kommt der Effendi (schwarzer Offizier) mit einem Träger atemlos mit der schrecklichen Botschaft, die II. Etappe sei auch überfallen, nur ein Askari entkommen! Gleich wurden die zwei Wahehe gebunden und dem Grafen Fugger mitgegeben, sie sollten diesem die Quawafährte zeigen.
Wie sie so dastanden, ein Bild von Kraft. Gunkihaka einen Kopf größer als mein Mann, der Msagira ihn aber noch fast um einen Kopf überragend. Der eine jung mit dem großen Auge, das alle Quawaangehörigen haben, der andere mit kleinen listigen Augen! Sie wurden abgeführt.
Jetzt bricht auch mein Mann auf, die Askaris sind lautlos angetreten, und so ziehen sie ins Dunkle hinein.
Als sie ein Weilchen weg sind, wird Alarm geblasen, und die Askaris treten für Graf Fugger an. Während wir so dastehen, kommen verschiedene Nachrichten, daß am Fuß des Berges viele Leute zu sehen seien, die ein Kriegsgeheul ausstoßen! Übrigens hatte mein Mann auch schon so etwas verlauten hören und sagte mir, ich sollte die Koffer mit dem Wertvollsten auf die Veranda stellen, damit, wenn die Wahehe Feuer anlegten, wenigstens das Wertvollste gerettet werden könnte, aber er glaube nicht, daß sie die Station angreifen würden! Die Frage, ob wir uns alle wieder sehen würden, lag uns sehr nahe, ach, es war — nein, ich finde keine Worte für die Stimmung! Aber trotzdem sagte auch Graf Fugger: „Das ist doch Leben, hier weiß man, zu was der Soldat da ist.“ Als auch er weg war, ging ich beklommenen Herzens nach Hause. Schlafen konnte ich nicht!
Als der Tag hereinbrach, war es mir eine Erlösung. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als mein Mann kam. Ich hörte Lärm und lief ihm schleunigst entgegen.
Er konnte mich nur flüchtig begrüßen, es genügte mir aber; war er doch heil zurück und seine Aufgabe gelungen! Alle Leute Mpangires, dieser selbst, seine Weiber und Brüder gefangen. Inwieweit Mpangire an der Verschwörung teilgenommen hat, ist noch nicht klar. Wenn er seinen Bruder Quawa nicht ausliefert, kann er nicht Sultan bleiben und kommt zur Küste. Wie weit die Rebellion um sich gegriffen und warum die Leute am Ruaha weggelaufen sind, ist noch nicht festzustellen! Jetzt gilt es, des Hauptschuldigen, Quawas, habhaft zu werden, aber wie und wo in dem großen Reich?
Mein Mann ruhte nur einige Stunden, dann wurde alles zu einem neuen Abmarsch für den Nachmittag fertig gemacht. Das war schnell getan, denn er nimmt fast nichts mit (trotzdem er auf unbestimmte Zeit fort bleibt), um nicht am schnellen Marschieren durch die Träger aufgehalten zu werden. Kein Bett, kein Zelt, keine Kochlast! Zwei Decken, ein Luftkissen, zwei[S. 73] Kochtöpfe, Messer, Gabel, Löffel, Teller, Tassen, ein Stück Zeug für die Nacht zum Überspannen, einen Stuhl und eine Last Essen! Und da war er noch ungehalten und sagte: „Früher habe ich oft noch viel weniger mitgehabt!“
Ich begleitete Tom den Berg herunter, aber es war schon ganz dunkel, und ich mußte zurück. Wenn ich nur nicht so schrecklich allein wäre!! Das Dach von unserem Haus ist fertig. Natürlich stockt überall die Arbeit. Spiegel, infolge des Perniziösen fast dienstuntauglich, ist nach Iringa und Stephan meinem Mann nachgegangen. Der beklagenswerte arme Baumeister ist immer noch krank, ich besuche ihn täglich.
Jetzt sind überall die Posten verstärkt, es sind zwei Hauptwachen. Ich bin ganz von Soldaten umgeben, auf der Veranda sogar schläft einer. So ist eigentlich nachts mehr Leben als am Tage, nur die Fundis arbeiten. Auf der Straße sehe ich nur zwei kleine Jungen mit dem Kreisel spielen.
Jetzt, wo mein Mann unterwegs ist, regnet es nicht nur am Tage, sondern auch fast die ganze Nacht hindurch.
17. Februar 1897, 10 Uhr abends.
Jetzt fängt es aber doch an, ungemütlich zu werden, vor allen Dingen, wo mein Mann nicht hier ist. Wo man hinhört, Aufruhr, Empörung! Heute nachmittag brachte mir Dr. Stierling die Nachricht, daß von Mage bis hierher alles in Aufregung sei, der Schmied habe viele neue Speere geschmiedet, und Quawa sei mit einer großen Heeresmacht nur 12 Stunden von der Station entfernt. Heute abend 8 Uhr rückte Dr. Stierling dahin ab.
Das Dorf ist in großer Aufregung, und die Kriegsegoma wird geschlagen, viele sind betrunken.
Ich ritt heute nach einer Tembe des Msagira Kimali Mali, doch war alles ausgeflogen, also wahrscheinlich auch bei Quawa.
Ich werde jetzt schlafen gehen, mich aber nicht ausziehen, denn man kann nicht wissen, wie es kommt. Den Revolver habe ich stets bei mir. Übrigens, noch eins! Die Karawane eines Arabers nach hierher ist bei Mage geplündert, der Araber[S. 74] getötet worden, gewiß auch der kleine Jumbe Mangatua mit seinem Anhang. Die Weiber, die er hier bekommen hatte, sollen in Quawas Hände gefallen sein.
20. Februar 1897.
Gestern nachmittag kam Tom zurück, er hat die Landschaft anscheinend ruhig gefunden, einen neuen Jumben eingesetzt und Stephan mit der Anlage eines Sicherungs-Postens beauftragt. Jetzt läßt er hier eine Dornenboma und Stacheldrahtzäune anlegen, als ersten Schutz gegen einen plötzlichen Überfall der Wahehe; derartige Hindernisse geben unseren Askaris bei nächtlichem Angriff genügend Zeit, ihre Verteidigungsstellungen einzunehmen und sich zum Ausfall zu sammeln. Am Abend kam Dr. Stierling zurück; er hat den Eisenfundi, den Speerschmied, gefangen. Leider sind aber sieben Kettengefangene entsprungen — das bedeutet für unseren Feind Quawa einen Zuwachs von ebensovielen Kriegern.
21. Februar 1897.
Die Post mit vielen Briefen und Berichten meines Mannes ging gestern abend ab, ehe ich etwas mitgeben konnte, und es ist dies ganz günstig. So denken sie daheim alle, wir sind ganz ruhig und sicher hier, und brauchen sich nicht zu ängstigen.
Der Pater Superior kam sehr elend gestern an, er soll sich hier etwas erholen. Mein Mann würde gern die Mission einziehen, doch würde er damit zu erkennen geben, daß er einen Überfall befürchtet, und um dies zu vermeiden, wird der Posten auf zehn Askaris verstärkt.
Gerade als wir fertig mit dem Abendbrot waren, kam Graf Fugger und brachte ausführliche Berichte. Von allen drei Etappen sind die Askaris hingemordet worden. Zu dem einen Askari sind drei Kerle gekommen, die ihm Essen zum Kauf anboten, sie haben ihn dann überfallen, gebunden und mit Stöcken totgeschlagen! Seine Frau mit Kind führten sie mit sich, doch[S. 75] ist die Frau wieder entflohen, und Graf Fugger, dem sie auf der Flucht begegnete, hat sie mit hergebracht. Von Magdalenenhöhe hat man noch nichts Näheres erfahren.
Bei Ruaha sollen die Leute von zwei Seiten gekommen sein, d. h. von den Utschungubergen und von Iringa! Inwieweit Mpangire beteiligt ist, kann man nicht ergründen, trotz Drohungen ist nichts aus diesem harten Waheheschädel heraus zu bekommen. Nur soviel steht fest, daß er und seine Brüder alles gewußt haben!
Jedenfalls hat Mpangire mit Quawa im Einverständnis gehandelt. Viele behaupten, er habe die Station auf Quawa hetzen wollen, um sie selbst dann leichter einzunehmen und die Europäer und Askaris niederzumetzeln.
Morgen wird Kriegsgericht gehalten, auch über Mpangires Brüder und zwei Msagiras. Sie haben hochverräterisch gehandelt und werden es wohl mit dem Leben büßen müssen. Sie haben ihr Quawablut nicht verleugnen können!
Daß sie bedeutende und befähigte Neger sind, beweist auch ihr jetziges Verhalten. Sie haben an Verstellung das Menschenmöglichste geleistet.
Natürlich ist die Spannung groß, wie die Wahehe es aufnehmen werden, wenn einer ihrer Größten aus der Quawafamilie den Tod als Verräter sterben muß.
Jenseit des Ruaha ist ein Teil der Bevölkerung zu Quawa gegangen, ein anderer aus Angst vor der Station in die Berge geflüchtet.
21. Februar 1897, 4 Uhr mittags.
Den ganzen Morgen habe ich mich zu nichts aufschwingen können; Tom ist auch ganz verstört. Während des Kriegsgerichts hielt ich es nicht mehr aus und ging ins Gefängnis zu den Mpangirefrauen. Sie saßen dicht zusammen, das Gesicht der Wand zugekehrt! Ich rief Mgumditemi zu mir. Sie war kaum wieder zu erkennen, so abgemagert und abgehärmt sah sie aus, die Tränen standen ihr in den Augen, sie litt wirklich mit Mpangire,[S. 76] während die andern, Sadangombe ausgenommen, nur ihr eigenes Schicksal zu betrauern schienen, sie bettelten auch gleich um besseres Essen. So sehr mich die Mgumditemi gerührt hat, so stießen mich die andern ab.
Stadt Iringa, 23. Februar 1897, abends.
Jetzt sitze ich mit meinem Mann um 7½ Uhr abends im Zelt in der früheren Sultanstadt. Vor ungefähr acht Wochen waren wir auch hier im Begriffe, den künftigen Sultan abzuholen. Jetzt ist es mit der Sultansherrlichkeit für immer vorbei. Mein Mann hatte gehofft, die Quawabrüder so zu verpflichten, daß sie der Station ergeben wären, aber der Quawatrieb, allein zu herrschen, war zu mächtig in ihnen, und so mußten sie es mit dem Leben büßen. — Sie wurden verurteilt, und als ihnen die Ketten abgenommen und sie zum Galgen geführt wurden, hat Mpangire einen noch recht menschlichen Zug gezeigt. Er hat gefragt, was wohl aus seinen Kindern werden würde! Das versöhnt einigermaßen wieder mit dem Verräter. Alle Europäer waren für ihn eingenommen, auch mich hatte das hübsche Gesicht, der freie Blick, das große Auge, das manierliche und nette Wesen, der chevalereske Ton, sein schnelles, kluges Auffassen so geblendet, daß mir sein jähes Ende sehr nahe ging; ich habe bitterlich geweint, und noch jetzt traure ich um den schwarzen Gentleman, trotzdem meine Vernunft sich dagegen sträubt.
Mein Mann ist jetzt zu einem Schauri in die Tembe eines Großen der Wahehe gegangen. Ich ängstigte mich um ihn! Wie leicht kann ein fanatischer Kerl ihm etwas antun. Die Askaris sind auch von Leuten, die schon 5 bis 6 Monate mit ihnen freundschaftlichst verkehrten, auf den Befehl von Quawa ermordet worden.
An der Küste müssen sie uns ganz in Frieden denken; ein Herr Kaufmann hat die Erlaubnis bekommen, meinen Mann um 20 Wahehe zu der Ostafrikanischen Ausstellung in Leipzig zu bitten — und wir sind froh und dankbar, wenn wir mit den Leuten zu einem friedlichen Verhältnis kommen!! — Schöne[S. 77] Exemplare sind es schon; es würde lohnen, sie auszustellen, freilich würden sie das als eine harte Bestrafung ansehen.
Die Weiber und Kinder der Quawafamilie und die Quawaanhänger, so auch der Eisenfundi, werden des Landes verwiesen und an die Küste geschickt.
Selbst auf unsrer Safari haben wir Gäste. Zum Abendessen war Pater Alphons, der uns schon entgegengekommen war. Pater Superior hatte auch am Kriegsgericht teilgenommen.
Iringa, 27. Februar 1897.
m 27. Februar abends kehrten wir von der Safari zurück, und mein Mann atmete erleichtert auf, daß nichts Ungünstiges in unsrer Abwesenheit vorgefallen war. Wir beschlossen daher, am 28. wieder aufzubrechen. Tom will das Land rekognoszieren und Jumben in den verschiedenen Teilen einsetzen. Abends waren wir mit Graf Fugger gemütlich bei uns.
Des Morgens früh wurde alles für die Safari zurecht gemacht. Gerade als wir aufbrechen wollten, kamen zwei Wahehe mit schlimmer Kunde. Quawa hat wirklich so viele Leute gesammelt, daß es ihm möglich gewesen ist, an einer Stelle 500 Stück, an einer anderen Stelle 60 Stück Rindvieh von den Msagiras, denen das Vieh zum Hüten gegeben war, wegzunehmen. Gerade der Teil der Landschaft, nach welchem unser Zug bestimmt war, sei zu Quawa übergegangen. So mußte die Safari unterbleiben, dafür rückten Graf Fugger und mein Mann, jeder mit einer Expedition, nach den gefährdeten Gebieten ab. Alle wünschen sehnlichst, daß es zum entscheidenden Kampfe kommen möge, doch Quawa weiß dem immer geschickt auszuweichen. Gott weiß, ich bin in derselben verzehrenden Angst wie damals in Perondo. Nur bin ich meinem Manne viel näher; Gott sei Dank. Wenn ihm ein Unglück zustößt, dann ist es auch mit uns in der Station vorbei.
Wie schnell ändern sich alle Pläne. Um 10 Uhr wollten mein Mann und ich abmarschieren und Graf Fugger sollte hier bleiben, statt dessen marschiert Graf Fugger um 12 Uhr ab, ich bleibe hier, und um 2 Uhr ging mein Mann, der noch vieles anzuordnen hatte.
Dieselbe böse Nachricht wurde, eine halbe Stunde später wie die Wahehe es meldeten, auch von Farhenga und Sadalla gebracht, also ist es unumstößliche Wahrheit.
Ein Revolver von der 1891 niedergemetzelten Zelewski-Expedition ist in meinem Besitze, er wurde in einer Tembe gefunden. Wie man von den Wahehe hört, hat sich die unglückliche Expedition tapfer verteidigt, 200 Wahehe fielen damals!
4. März 1897.
Wie die Ertrinkenden sind wir mit unseren Hoffnungen bald oben, bald unten, kaum haben wir uns auf die Oberfläche gearbeitet, reißt eine Welle uns wieder in die Tiefe. Gott gebe, daß wir nicht untergehen! — Ich war mit dem Pater spazieren gegangen; als ich zurückkam, waren von Leutnant Fonck wieder schlimme Nachrichten eingetroffen. Auch in Madibiro sind Unruhen, es wird Vieh gestohlen, ja es sind sogar mehrere Leute vor den Wahehe geflohen. Die Wahehe haben wieder neuen Mut geschöpft, und es ist nicht ausgeschlossen, daß sie sich an mehr wagen. Ich kann’s nicht sagen, wie leid mir Tom tut, auf den es von allen Seiten Unglücksbotschaften regnet.
Die Schwarzen hier in der Stadt müssen doch ein unbegrenztes Vertrauen zu uns haben. Die Bautätigkeit läßt trotz der unsicheren Zustände nicht nach, die Händler bauen weiter an ihren Hütten und Lagerhäusern, es entsteht Straße um Straße, daß es eine wahre Freude ist. — Ich bin tüchtig erkältet, wahrscheinlich Nachwehen von dem Ruahabade am Schluß der letzten Safari (Reise). Unser neues Haus steht unter Dach, es schreitet sehr langsam vorwärts unter den ungünstigen Verhältnissen. Kein Bauleiter, und jetzt kaum ein Europäer zur Aufsicht, Feldwebel Spiegel hat es aber sehr hübsch gemacht, trotz seines Augenleidens.[S. 80] An der Befestigung der Boma wird fleißig gearbeitet, es wird alles dazu herangezogen.
Von Tom sind schon ein Ruga-Ruga und ein Askari zurück, die nicht schnell genug mitkonnten. Von Feldwebel Langenkemper, mit dem Tom zusammentraf, mußten mehrere Lasten zurück. Tom scheint also vorwärts zu stürmen. Mir ist sehr ernst! Ich hätte gewünscht, bessere Nachricht nach Haus senden zu können! Aber so launenhaft ist das Schicksal. Vor drei Wochen war es hier wunderschön friedlich, und jetzt spukt es allerorten. Ein Segen, daß Tom den Aufstand schon im Entstehen erkannte und ihn im Keime ersticken kann. Quawas Freunde haben sich jetzt noch enger zusammengeschlossen und treten offen auf, die fein eingefädelte Überraschung des Überfalls ist ihnen nicht gelungen; wie weit die Funken reichen, was sie noch alles entflammen werden, ist unabsehbar. Doch ich weiß, Tom wird trotz alledem ihrer Herr, früher oder später, obgleich er in Quawa einen Gegner gefunden, der in Deutsch-Ostafrika kaum seinesgleichen hat.
Sonnabend, 6. März 1897.
Ich habe fest zu Bett gelegen, aber heute mußte ich doch aufstehen, um meine gratulierenden Sudanesen-Damen zu empfangen. Wir sind nämlich mitten im Ramassan, dem großen Feste der Mohammedaner. Des Schießens ist kein Ende, der Beginn der Festzeit wurde sogar mit Kanonenschüssen eingeleitet; der Neger beurteilt nun einmal aus seiner kindlichen Anschauung heraus jede Feier und jedes Vergnügen nach dem Lärm, den er dabei machen darf.
Meine Damen erscheinen bei mir zum Gratulieren, ich bewirte sie mit Bonbons und allerlei Süßem, der Frau des Effendi (farbigen Offiziers) lasse ich Kaffee und Wein reichen. Ein interessanter Anblick, meine acht Besucherinnen: von der nach hiesigen Begriffen gebildeten Effendi-Frau mit feingeschnittenem Gesicht, lebhaften, hübschen Zügen, bis zur kugelrunden, gutmütig ausschauenden und zufrieden lächelnden Rentiersgattin, auf deren dickem Gesicht das behagliche Lächeln angenehmen Gesättigtseins[S. 81] glänzt. Ich hätte früher nie geglaubt, wie viele Abstufungen innerhalb der schwarzen Rasse möglich sind; man lernt im täglichen Umgang rasch die Gesichter individualisieren, sie in die beiden, überall auf der Welt und in allen Ständen gebräuchlichen Hauptklassen einzuteilen: in sympathische und unsympathische Gesichter. Meine Sudanesinnen sind in mancher Beziehung zugleich meine Schicksalsgenossinnen; auch sie sind Fremde hier, die ihre Heimat verließen, um dem Gatten nach einem unbekannten Lande zu folgen; augenblicklich sind auch sie Strohwitwen, denn die Sudanesen sind unsere besten Askaris und werden zu jeder Expedition mitgenommen. Die Sudanesenfrau hält treu zu ihrem Manne, Ausnahmen kommen kaum öfter vor wie bei uns Weißen. Meine Kaffeegesellschaft bot einen wundervollen Anblick: Gelb und Weiß sind die bevorzugten Farben, und in dieser Auswahl bekunden die schwarzen Damen wirklich Geschmack, denn sie bringen die dunkle Hautfarbe zu malerischer Wirkung. Lang herabwallendes, weißes Krepptuch, je nach dem Stande der Trägerin von feinerem oder gröberem Gewebe, verhüllt die Gestalt vom Scheitel bis zu den Sohlen, darunter wird ein mit bunter Seidenborte oder mit feinen Klöppelspitzen verziertes Gewand getragen; ein weißseidenes Tuch bedeckt die Stirn bis an die Augenbrauen; dazu reicher Silberschmuck an Hals und Armen: lange schwere Silberketten mit in Silber gefaßten Löwenklauen, silbernen Dosen jeden Formates, Ringen und Talismanen. An den Fingern möglichst viele silberne Reifen, zum Teil in der Form unserer Siegelringe, mit Steinen besetzt. Man sieht unter diesen Schmucksachen zuweilen Stücke von ganz eigenartig schöner Ziselierung und Prägung. Nur eine der Frauen hatte Kinder, und diese hatte in berechtigtem Mutterstolze ihr Jüngstes mitgebracht. Den anderen Frauen waren die Kinder infolge der Strapazen und Entbehrungen auf den Safaris, auf denen sie ihre Männer begleiten mußten, schon im zartesten Alter gestorben.
Auch bei uns in Uhehe spielt die „Frauenfrage“ eine große Rolle: infolge der vielen Kriegszüge herrscht Mangel an jungen Männern, dagegen Überfluß an Frauen; dazu kommen noch die[S. 82] vielen geraubten Weiber aus anderen Stämmen. Kein Wunder, daß unter solchen Verhältnissen die schwarzen „Herren der Schöpfung“ verwöhnt sind — die Weiber reißen sich geradezu um die Männer. So hat denn ein jeder hier mehrere Frauen, denen nach dem einfachen Grundsatze: „je älter und häßlicher — um so härter die Arbeit und karger der Lohn“ die ganze Last der Haus- und Feldarbeit zufällt. So haben z. B. alle jungen hübschen Frauen bei den Wahehe Überfluß an weißen und bunten Tüchern, mit denen sie ihre schlanken Glieder verhüllen. Nur der meist prächtig geformte Hals mit dem tadellosen Büstenansatz, die vollen Schultern und die kräftigen Arme bleiben frei. Mit zunehmendem Alter und dem Schwinden der körperlichen Reize schwinden auch diese sichtbaren Zeichen sowohl eheherrlicher Gunst wie eifersüchtigen Verhüllens — der Rest ist Schweigen.
Am 8. März 1897.
Heute kam Tom zurück; ich war gerade im Garten und konnte ihm schon von weitem zuwinken. In die Freude des Wiedersehens mischte sich die Sorge um Graf Fugger, von dem noch keine Meldung gekommen ist. Auch Dr. Stierling bringt eine Hiobspost: wieder sind 16 Kettengefangene ausgebrochen; eine neue Verstärkung für Quawa!
9. März 1897.
Unsere Sorge um Graf Fugger war, Gott sei Dank, umsonst; heute nachmittag kam er unerwartet an. Er hat die verdächtige Gegend gesäubert und bringt erbeutetes Vieh mit. Kaum sind wir dieser Sorge enthoben, kommt eine neue Unglücksbotschaft: ein von Tom eingesetzter Msagira, Schabruma, ist von einem früher ausgebrochenen Kettengefangenen Jumba-Jumba, einem Halbbruder Quawas, ermordet worden. Quawa sichert sich seinen Einfluß auf die Großen seines Landes mit Energie: er schickt ihnen nachts einige ihm treu ergebene Anhänger zu, die ihnen die Wahl lassen zwischen Tod oder Gefolgschaft. Nichts zeigt übrigens so deutlich, daß wir es bei[S. 83] den Wahehe mit einem einigen, von einem Willen gelenkten Volke zu tun haben und nicht bloß mit einzelnen verbündeten Stämmen, als die Tatsache, daß es hier allerorten gleichzeitig im Lande spukt: Quawas mächtige Hand macht sich überall fühlbar, und all unser Denken und Sorgen, fast wie das einer Braut, die stets nur den Geliebten im Sinne trägt, beschäftigt sich mit „Ihm“.
10. März 1897.
Mein Mann hat heute alle von ihm selbst eingesetzten Jumben aufgeboten und hält ihnen eine sehr eindringliche Rede. Sie und ihre Leute sollen sich alle mit ihm vereinigen und gemeinsam gegen Quawa ziehen. Es ist unglaublich, welche Furcht und unausrottbarer Respekt vor der früheren Sultansgestalt selbst bei uns ganz ergebenen Leuten herrscht. Ich hörte zu. Mein Mann entwickelte eine Beredsamkeit, die ich ihm nie zugetraut hätte. Endlich waren sie alle sämtlich überredet und wollten alles tun, was Tom anordnet, — wie weit die guten Vorsätze gehen, wird sich bald zeigen.
Wir waren nun wirklich sehr aufgeregt, ob die Wahehe kommen würden. Fortwährend wurde die Frage: „Kommen sie, kommen sie nicht?“ erörtert. Gestern abend traf nämlich noch die Nachricht ein, in Ubena sei Mawala von 4 bis 6 Quawaleuten ermordet worden. Für meinen Mann ein schwerer Verlust, da er von Anfang an treu zu ihm hielt; Mawalas Vater ist nämlich von Quawa gehängt worden. Sein Bruder Sadamenda ist in Iringa-Bagamoyo als Sultan eingesetzt worden. Sofort wurden Boten an alle Jumben geschickt, die sie zu heute entbieten mußten. Unsere Sorge war, daß die Jumben dem Heerbann nicht alle folgen und daß die Angst, das Schicksal Mawalas zu teilen, sie ins Pori treiben würde: dann stünde Tom ohne Leute da.
Als wir nun einen Jumben nach dem andern ankommen sahen, wurden wir etwas ruhiger, aber die Sorge wurde wieder rege, als Sadamenda nicht kam; wir glaubten ihn schon entflohen, als sich beim Schauri herausstellte, daß er einen Stell[S. 84]vertreter geschickt habe, da er selbst „weinen“ müsse! Eine Art offizieller Trauerdienst um seinen Bruder!
Dann kam die Nachricht, daß Sagamaganga, der Bruder von Kiwanga, ermordet sei, also so weit dehnt sich Quawas Macht aus. Ferner sind drei Händler auf dem Wege erstochen, dann traf ein Askari von Kiwanga ein, der zum Schutz des Viehs dort war (das Vieh, 200 Stück, ist weggetrieben). Er hat sich vier Wochen durchs Pori heimlich hierher geschlichen und kam halb verhungert hier an.
Außerdem kamen Meldungen von Leutnant Fonck, daß Kiwanga, Mbeyera, Lupembe abgefallen seien. Ebenso die Wangoni, die sich alle zum Kampf gegen uns rüsteten!
Solche Nachrichten wirken gerade nicht beruhigend, obwohl mein Mann es nicht für möglich hält, daß Kiwanga abgefallen sei, selbst auch von den anderen scheint es ihm zweifelhaft.
Es herrschte auch Ungewißheit, ob Merere dem Aufgebot hierher folgen und wieviel Leute er mitbringen würde; denn Leutnant Fonck hatte auch geschrieben, daß Merere große Angst vor Quawa habe. Gegen 4 Uhr traf aber Leutnant Braun ein und mit ihm Merere und 140 Mann. Nun muß er hier bleiben und noch mehr Wassangus kommen lassen.
Es ist ihm ein Teil einer Straße eingeräumt worden, in der er mit seinen Leuten wohnt. Jeden Tag wird ein Ochse für ihn geschlachtet, er bekommt noch Zucker, Salz, Pombe (Bier) und er und sein Bruder je 1 Rupie, seine Leute je 10 Pesa. Die Leute, die ihm ihre Temben überlassen mußten, bekommen 1 Rupie per Tag Entschädigung. Sie wollten nicht so recht, da hieß es aber, das sei eben Einquartierung, und in Uleia (Europa) wär’s auch nicht anders.
Für uns ist Merere ein billiger Gast, da er Kognak, Wein und Zigaretten verschmäht, weil er dann betrunken wird, wie er sagt. Dafür ißt er desto mehr Zucker. Des Nachmittags wiesen wir ihm sein Quartier an. Er geht stets mit dem Säbel, den mein Mann 1893 seinem Vater schenkte, oder läßt ihn von einem[S. 85] dazu bestimmten Boy hinter sich hertragen, desgleichen hat er einen besonderen Stuhlträger.
Er ist sich sehr seiner Würde bewußt, bemüht sich aber nicht, bessere Manieren sich anzugewöhnen, ebenso wie er nichts Europäisches essen mag. Betteln tut er großartig, mit unglaublicher Zähigkeit.
Einen Sultan Mpangire gibt es eben nur einmal — um den schönen Kerl tut mir’s jetzt noch herzlich leid.
Merere hat kein dummes Gesicht; er ist mittelgroß, etwa 36 Jahre alt. Sein Blick ist freundlich, und ich habe den Eindruck, als wenn er gegen seine Untertanen gütig und gerecht wäre und auch auf den Rat seiner Großen höre. Seine Askaris sind teils mit Gewehren, teils mit Speer und Schild bewaffnet, er hat Chargen unter ihnen.
11. März 1897.
Gestern abend waren die Herren bei uns zu Tisch. Tom ist so angegriffen und hat so viel zu arbeiten. Ich machte als Speise einen Servietten-Pudding, den ich seit Weißenrode nicht gegessen hatte, er fand großen Anklang. Ein friedlicher Zug kam in unsere kriegerische Stimmung hinein, und doch wäre beinahe das ganze Fest verdorben gewesen, wenn Tom sich nicht beherrscht hätte. Auf seinen Schultern liegt doch alles, die anderen konnten schon eher lustig sein.
Kurz bevor die Herren zum Essen kamen, war die Nachricht gekommen, daß einer unserer Askaris den Anführer der noch treugebliebenen Wahehe (der Wadongwe) erschossen habe, weil derselbe eine Frau zurück haben wollte, die der Askari gestohlen hatte. Werden nun die Leute jetzt, nachdem ihr Führer ermordet, zu Quawa gehen? Für meinen Mann ist dieser Semulikanbe gar nicht zu ersetzen. Noch bei der Jumbenversammlung fiel mir seine große Gestalt mit dem eisernen Kopf voll Energie und Tatkraft auf. Er hatte Tom überall hin begleitet und ihm die treuesten Dienste geleistet. Dr. Stierling ging sofort hin, um den Askari zu verhaften und die Sache zu untersuchen.[S. 86] Farhenga ging als Stellvertreter von Tom den Verwandten des Ermordeten sein Beileid sagen.
Alle verfügbaren Unteroffiziere hat mein Mann jetzt verteilt. Hammermeister nach Iringa, Prinage nach Mage, Langenkemper nach Luhalali und Stephan nach Irandi, morgen geht Graf Fugger nach Ukalinga, und Sadalla ist mit dem Elefantenjäger Nenge und 25 seiner Leute, die 15 Mauser-Gewehre bekommen haben, ausgeschickt. Wenn das nur nicht einen Zuzug für Quawa bedeutet, es wäre zu schrecklich! Unsere Gäste blieben bis 1 Uhr, ein Zeichen, daß wir uns trotz aller kriegerischen Sorgen gut unterhielten.
12. März 1897.
Eine Aufregung folgt der andern, Dr. Stierling nicht zurück, trotzdem der Askari schon eingebracht wurde! Leutnant Braun wurde sofort auf die Suche geschickt. — Ich habe Merere auf seinem Ochsen photographiert, er reitet denselben nämlich auf Safari; es ist ein prachtvoller rabenschwarzer Reitochse, der dem Merere beinahe heilig ist, er ist auch durch Zauber gegen Unheil geschützt, ebenso drei schöne graue Kühe.
13. März 1897.
Bei Toms Schauri des Morgens fielen mir zwei Prachtkerle auf, beide Brüder aus Bueni, der eine ein Jumbe, der Tom um seine offizielle Einsetzung bat. Eine Freude, den hübschen Kerl zu sehen, er erinnerte mich etwas an Mpangire. Des Nachmittags mußte er festgenommen werden, denn sein Vater ist zu Quawa übergegangen, und er soll auch nicht ganz sicher sein. Man muß geradezu mißtrauisch gegen die hübschen Kerle werden! Ich war bei dem Verhör zugegen. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn, seine Brust hob und senkte sich schneller, sonst war ihm nichts anzumerken! Sein Obermsagira war dabei, damit er seinen Leuten die Botschaft bringen konnte, daß, wenn sie sich nicht ganz ruhig verhielten, ihr Jumbe es mit dem Leben büßen würde! Andernfalls solle ihnen aber ihr Jumbe bleiben.
Von der Mission wieder beruhigende Nachrichten, aber alles so wenig klar, daß nichts damit anzufangen war. Abends kam der Pater, brachte aber nichts Neues.
Ferner kam die schlimme Nachricht von Leutnant Fonck, daß Mtitima, der Jumbe von Idunda, mit seinem Besitz und Leuten entflohen sei. Es scheint ihm nicht genug auf die Finger gesehen worden zu sein, trotzdem er als unsicher und unzuverlässig galt.
14. März 1897.
Gott sei Dank: eben kommt die Nachricht, daß Dr. Stierling sich nur verirrt hatte. Es ist unglaublich, wie die Unruhen selbst auf unsere Boys wirken, nichts geht seinen gewohnten Gang. Sie sind ganz außer Rand und Band und machen mir viel Wirtschaft.
Merere besucht uns alle Tage; er ist doch der richtige „Mchensi“. Gestern hat Tom ihm drei Quawaweiber gegeben, heute wollte er noch mehr herauspressen.
15. März 1897.
Dr. Stierling und Leutnant Braun kamen heute wieder zurück. Morgen soll Kriegsgericht über den Askari zusammentreten. Tom hatte den Verwandten des Ermordeten reiche Geschenke angeboten; sie weigerten sich jedoch, sie als Sühne gelten zu lassen, und verlangen den Tod des Askari. Für Tom ein schweres Dilemma! Erhalten sie nicht volle Sühne für den Tod ihres Verwandten, so muß man befürchten, daß sie sich weigern werden, mit gegen Quawa zu ziehen — und es sind gerade die treuesten und schneidigsten von unseren Wahehes.
Gestern abend brannten einige Askarihütten ab. Es war ein mächtiges Feuer. Tom war natürlich wieder der Erste auf dem Platze, eine Stange fiel ihm aufs Bein und verursachte ihm große Schmerzen, er ließ sich aber nicht in seiner Feuerwehrtätigkeit stören.
In den brennenden Hütten platzten die Patronen, die die[S. 88] Askaris hatten liegen lassen, das machte die Sache gefährlich. Ein paar Ziegen und Schafe waren nicht mehr zu retten, ihr Geschrei klang schauerlich. Ein Schaf, dem schon die Wolle abgesengt war, konnte ich noch glücklich retten. Plötzlich hieß es, ein Fundi sei durch eine Patrone am Gesicht verwundet worden; da weder Arzt noch Lazarettgehilfe zugegen (beide waren abkommandiert), ließ ich mir den Mann holen und hatte die Freude, ihn tüchtig auslachen zu können, er hatte nur eine ganz geringfügige Schmarre, die wohl kaum von einer Patrone herrührte.
Nach dem Brande wurde gemeldet, ein Askari sei von der Tembe gefallen und habe ein Bein gebrochen. Ich ging hin, fand aber auch das nicht so schlimm. Ich hielt den Schaden für eine starke Sehnenzerrung oder Verstauchung und legte Verband an. Heute überzeugte ich mich, daß es nicht schlimm geworden war. Auch Dr. Stierling konstatierte später nur eine Verstauchung. Jetzt wird von den Leuten im Händlerdorf eine große Boma gebaut. Man kann und darf eigentlich schon „Stadt“ sagen bei ungefähr 3000 Einwohnern, und das alles in einer Zeit von sechs Monaten! Vor der Zeit war hier alles Pori (Wüste), und keine Menschenseele, weder weiß noch schwarz, hier in der ganzen Gegend. Die Dornenboma wird verstärkt und Bastionen werden angelegt. Jetzt sind schon solche Vorsichtsmaßregeln notwendig, während wir vor zwei Monaten ohne jeden Schutz hier lebten. Schnapsel amüsiert sich jetzt den ganzen Tag bis spät zur Nacht, bis er eben gesucht wird, auf eigene Faust; da er uns aber zu leicht weggefressen werden kann, besonders jetzt, wo außer den wilden Tieren auch unsere Wassangus Hundefleisch lieben, muß er die ganze Zeit angebunden sein und wird nur spazieren geführt. Merere behauptet, er und seine Leute äßen Hunde nicht mehr, aber sein Vater hat sie noch sehr geliebt, und da derselbe erst 1893 gestorben ist, halte ich Mereres Zivilisation noch nicht für so wurzelecht, als daß ich sie durch den täglichen Anblick Schnapsels ins Wanken bringen möchte.

Sultan Merere auf seinem Reitstier.
(Zu S. 86.)
16. März 1897.
Ein fortwährendes Gehen und Kommen von fremden Menschen bei uns. Man fürchtet sich vor jeder neuen Nachricht. So Tag für Tag auf der Lauer liegen, geduldig abwarten und nichts tun können, ist für Tom die größte Energieprobe; gar zu gern möchte er losschlagen. Es geht aber auch unglaublich auf die Nerven, an Schlafen ist kaum noch zu denken. Tom sieht schon ganz elend aus, und ich ängstige mich sehr um seine Gesundheit, um so mehr, als das große Schreckgespenst einer langen Trennung vor mir steht. Tom erwartet nur mehr Wassangus und Kiwangaleute, um loszuschlagen. Es ist eben keine leichte Zeit. Natürlich kann ich gar nicht alle Meldungen und Nachrichten hier einschreiben. Heute ist nur 20 Schritt von der Boma der Unteroffiziere ein Soldatenboy erstochen worden. Zwei Soldaten kamen gleich mit der Meldung. Also selbst auf ganz sicherem Gebiete ein Meuchelmord.
Gestern kam Kersten, um die gefangenen Weiber, Kinder, Anhänger von Quawa und Mpangire nach der Küste zu bringen. Der verurteilte Askari geht mit, das Kriegsgericht hat auf fünf Jahre Zuchthaus erkannt.
Das weiße Schwein wurde plötzlich so krank, daß wir glaubten, es würde eingehen. Hammermeister als gelernter Fleischer konstatierte aber nur Unmengen von Sandflöhen, Sohle und Kniescheibenhaut mußten abgeschnitten werden. Jetzt wird es fleißig gepflegt und verbunden werden, desgleichen das schwarze Schwein.
Abends ritten wir zu Merere hinüber; der sollte auf seinem Ochsen mitkommen, das gab natürlich viel Spaß, besonders, als er plötzlich von demselben heruntersegelte. Einmal ritt er als Dame, das andere Mal als Herr. Er versuchte sich auf dem Maultier, Tom führte es, als es aber leicht antrabte, strebte Merere mit allen Kräften hinunter. — Heute morgen hatte ich Mgumditemi bei mir, um sie zu fragen, ob sie bleiben oder mit den andern an die Küste und dann weiter zu ihrer Mutter gehen oder ob sie bei uns abwarten wolle, bis Quawa dingfest gemacht[S. 90] sei. Sie zog letzteres vor und war ganz selig darüber. Auf ihren Wunsch wirkte ich bei Tom aus, daß auch ihre kleine etwa neunjährige Schwester bei uns bleiben kann. Ich freue mich, daß Mgumditemi hier bleibt. Sie ist eine nette, kluge Frau. Jetzt ist sie ganz abgehärmt und kaum wiederzuerkennen. Das kleine Mädel ist auch nett.
Gestern abend kam der Bruder Mauritius, früher Tischler hier, von der Küste an, von Mage hatte er Begleitkommando bekommen. — Früher war bei der hiesigen katholischen Mission die Regel, möglichst einfach zu leben, da aber zu viele Brüder an Entkräftung starben, wurde die Maßnahme aufgehoben. Für die Mission ist noch ein zweiter Bruder bestimmt, der gut kochen soll. Einen deutschen Koch hier zu haben und sich um die Küche nicht zu kümmern brauchen, das müssen geradezu ideale Zustände sein! Heute frühstückte er bei uns, ich gab ihm Gemüse, und dann zog er zu seiner Mission.
Vom Lazarettgehilfen Prinage kam die Meldung, daß alle Karawanenstraßen von Quawas Wahehe besetzt werden sollen; jede Post, jede Karawane, jeder Händler soll niedergemacht werden. Das stimmt mit der Aussage des Bruders, der den Mörder des Boy beherbergt hatte: Quawa habe den Wahehe sagen lassen, sie sollten alles niedermachen, was ihnen in den Weg kommt, Karawanen, Post, Händlern usw. auflauern, alle den Weißen freundlich gesinnten Wahehe totschlagen, dann ins Pori verschwinden, das würde den Europäern so langweilig werden, daß sie wieder abzögen. Auf diese Art will er uns aus dem Lande treiben. Nun, erschrecken kann er uns, das beweist er täglich — aber wir bleiben doch! das Schlimme ist nur bei der Sache, daß Tom so wenig dagegen tun kann. Wenn man zu Hause in Deutschland ist, so denkt man, mit den Negern sei doch leicht fertig zu werden, sie seien ja solche untergeordneten Geschöpfe, daß es eine Kleinigkeit sei, sie zu regieren. Nun, ich wünschte, daß alle, die dieser Ansicht sind (ich war es früher nämlich auch), einmal hier zusehen könnten, dann würden sie sich überzeugen, daß die Leute auch ohne Schulbildung sehr schlau[S. 91] sind. Heute kam ein Ruga-Ruga an mit einer Speerwunde, seine zwei Begleiter sind erstochen worden. Die Täter konnten nicht ergriffen werden, denn sie flohen ins Pori. Tom weiß aber, wer sie sind. Kersten mit seinen Gefangenen wurden sofort Boten nachgeschickt, um ihn zu größter Vorsicht auf dem Marsche zu mahnen.
19. März 1897.
Der Abend schließt mit der Nachricht eines Überfalls und der Morgen beginnt damit. Zur Nervenberuhigung spielten wir gestern vor dem Schlafengehen noch Skat, als plötzlich ein schwarzes Gesicht und ein Gewehr sich am offenen Fenster zeigten; ich erschrak nicht wenig, aber der Soldatenkopf, der gleich darauf erschien, beruhigte mich über des Negers Absicht. Er war der traurige Rest von den Postleuten, die aus Langenburg am Nyassa-See die Post brachten, die andern waren von einem Trupp Wahehe erschlagen worden. Die Bestätigung also der gestrigen Nachricht Prinages war handgreiflich da; wir hatten schon unsere Verwunderung geäußert, warum Quawa die Karawanenstraße nicht beunruhige. Lasten von Langenburg sind hierher unterwegs; sie haben Askaribegleitkommando bekommen und dürfen nicht weiter (desgleichen Träger der Mission nach der Küste), da die nötigen Askaris zu den Begleitkommandos fehlen. Es wird jetzt schon schwer, Träger und Boten zu bekommen, sie wollen schon immer nicht mehr ohne Askaris gehen.
Heute morgen kam Nachricht, daß in der Tembe, dicht hinter der Mission 2 Stunden von hier, wo ich mit Tom auf Safari war und Tom einen Jumben eingesetzt hatte, das Vieh weggetrieben und zwei Leute dabei erschlagen worden seien. Der Jumbe ist gleich mit zwei Askaris und der Hälfte seiner Leute dem Vieh nachgegangen; die andere Hälfte ist zu Quawa übergelaufen. Mittags kam die Nachricht, daß drei Mann von Leuten Quawas angeschossen seien. Dr. Stierling ging gleich herunter, auch nur 1 Stunde von hier, und hat sie verbunden, morgen sollen sie auf die Station gebracht werden. Als Dr. Stier[S. 92]ling etwas lange ausblieb, wieder große Sorge! Also bis dicht vor unsere Tür wagt sich Quawa! Das Schlimme bei der Sache ist, daß die gutgesinnten Wahehe das Vertrauen zu uns verlieren, wenn unsere Anhänger so vor der Nase weggeschlachtet werden.
20. März 1897.
Tom wird wahrscheinlich Merere hier als Sultan einsetzen, um ihn mit zu dem großen Schlag benutzen zu können. Seine Leute sollen sich hier in der Nähe ansiedeln, damit sie an der Station einen Halt haben. Den ganzen Tag starker Regen.
Vorgestern waren wir im Garten und freuten uns, wie hier alles gedeiht, Weizen, Kartoffeln, alle Gemüsearten, sogar Rosenkohl, Salate, Radieschen, Rettich haben angesetzt. Auch die von der katholischen Missionsstation in Mrogoro geschenkten Apfelsinen-, Zitronen- und Mangobäumchen setzen Triebe an. Mapera, Papayen und Bananen selbstverständlich, auch das von Kisaki von uns mitgebrachte Gras und der Kaktus.
Ein vorzüglicher Boden ist hier: als Fata Morgana sehe ich schon alles mit Weißen besiedelt. So hatten wir im Garten einen Kohlkopf von 15 Pfund Gewicht. Rosen- und Kaffeebäumchen hat uns die Mission später auch geschickt.
Heute kam die Nachricht, daß zwei Soldaten und sieben Träger totgeschlagen seien auf dem Wege zu Kiwanga. Es ist furchtbar! Aber wenn ich bedenke, wie uns die erste Mordtat aufregte, kann ich uns beinahe gleichgültig der Nachricht gegenüber nennen. Nur ein Gedanke steht jetzt im Vordergrund: wie ist dem Zustand abzuhelfen? Was wird der nächste Tag bringen? Die Wahehe fördern immer neue Überraschungen zutage!
21. März 1897.
Wieder sitze ich abends allein und bete für meinen Mann, ob ich ihn gesund wiedersehen werde? Der Mensch kann doch viel ertragen, wenn es heißt: seine Pflicht erfüllen.
Tom hörte von einem Ort, an welchem Quawa stecken sollte,[S. 93] ließ nachforschen und fand es heute einigermaßen bestätigt; daraufhin ist er, als es dunkel war, heimlich aufgebrochen.
Immer und immer wieder ihn weggehen zu sehen und nicht zu wissen, ob er gesund wiederkommt, ist doch schrecklich.
23. März 1897.
Vorgestern konnte ich nicht mehr schreiben. Sadallaleute waren nach den verschiedenen Mördern ausgeschickt, die ziemlich erfolglos zurückkamen, sie brachten nur die Brüder und Weiber der Schuldigen an. Wir stehen hier wirklich im Kampf ums Dasein.
Die Wahehe haben ihre Vernichtung gewollt, sie haben den Kampf abermals durch Mordtaten begonnen. Jetzt heißt es, mit Strenge vorgehen, denn Toms Menschenfreundlichkeit halten sie, an Quawas Grausamkeit gewöhnt, für Schwäche. Die Nächte sind gräßlich. Heute konnte ich überhaupt nicht schlafen, der Anruf der Patrouillen dröhnt laut durch die Nacht und hält mich munter. Übrigens geht es nicht bloß mir so. Auch Winkler und Stierling schlafen schlecht und träumen von Wahehe, Mord und Totschlag, trotz ihrer eisenfesten Nerven.
Gestern habe ich Mgumditemi den ersten Schreibunterricht erteilt, es scheint sie aber so angestrengt zu haben, daß sie heute nicht kommen konnte, weil sie krank sei. Das hat mir nun sehr den Mut zum Weiterlehren genommen.
Beim heutigen Spazierengehen war ganz herrliche Beleuchtung, doch das ewige Revolverschleppen beeinträchtigt den Naturgenuß, und doch bin ich jetzt ziemlich ängstlich, so daß ich stets Sublimat bei mir trage; sollte es, was Gott verhüten möge, zum äußersten kommen und sich das Märchen von meiner Gefangennahme verwirklichen, so wäre mir wenigstens beim schlimmsten ein Ausweg möglich.
Tom mußte ich versprechen, nie ohne Begleitung zu gehen, deshalb nahm ich einen Ombascha mit. Heute habe ich meinen Schmuck und unser Silber aus dem Silberkasten alles in einen Koffer gepackt, um bei Feuer oder einer anderen Gefahr alles[S. 94] Wertvollere rasch bei der Hand zu haben. Dann habe ich Wein abgefüllt.
24. März 1897.
Gestern abend (ich entwickelte gerade Bilder) hatte ich noch die Freude, Tom gesund wieder zu sehen. Es kam mir ganz unerwartet. Tom war riesig vergnügt und erzählte seine Erlebnisse sehr amüsant. Bis 5 Uhr morgens durchmarschiert, im Walde versteckt gelagert, Brot und Wurst gegessen, dann in der nächsten Nacht zu der Höhle und den Temben geschlichen. Dort bis zur Morgendämmerung gelauert. Der Boy hatte vergessen, während der Nacht etwas Tee zu kochen, also wieder nichts Warmes, und dann auf dem Bauch zu den verschiedenen Temben gekrochen. Sie sind so leise herangeschlichen, daß sie die Leute drinnen sprechen hörten; endlich sind alle Temben umstellt, und Tom gibt das Zeichen, daß jeder die Tür seiner Tembe öffnen lassen sollte. Er selbst war bei der Haupttembe, wo sich folgende Szene abgespielt hat. Toms Leute haben an die Türe geklopft und zunächst in der Wahehesprache gefordert, sie möchten die Tür aufmachen, „sie seien Leute von Quawa“ — keine Antwort, darauf auf Kissangu, „sie seien Leute von Merere“, — keine Antwort, nun auf Suaheli, „sie seien Leute von bwana mkubwa“, worauf sofort die Tür aufgemacht wurde. Es waren friedliche Menschen, die uns treu gesinnt sind und Quawa fürchten. Tom ist sich ganz dumm vorgekommen; soviel Anstrengung, um unschuldige Leute aus dem Schlaf zu stören. Wäre Quawa darin gewesen, er hätte nicht entwischen können. Hoffentlich gelingt es mit Quawa ein andermal. Tom ist aber sehr froh, doch dagewesen zu sein, da er jetzt weiß, daß dort sichere Leute sitzen.
25. März 1897.
Gestern abend hätte uns beinahe das Schicksal ereilt. Tom und ich gingen zur Viehtembe, wo von dem jungen Sikki Rinder ausgeteilt wurden, ich wollte nun dieselbe Straße gehen, die Sikki später auch kommen mußte. Tom hielt das für langweilig[S. 95] und schlug einen anderen Weg durchs Dorf vor, und welch ein Glück war es, denn ein paar Minuten später zog Sikki seines Weges, und ein Wahehe schoß auf ihn und ergriff dann schleunigst die Flucht. Wir wären für ihn ein Ziel gewesen, das er vielleicht besser getroffen hätte. Wir hörten den Schuß fallen, glaubten aber, man habe einen Ochsen für die Merereleute geschossen. Hier werden die Ochsen nicht wie zu Hause geschlachtet, sondern erschossen. Wir gingen also ruhig weiter, als wir auf dem Rückwege waren, kam uns ein Mann mit Flinte und Revolver entgegen, es sei Alarm. Tom sagte, daß dies nicht möglich sei, da er wohl schon früher davon benachrichtigt worden wäre. Wir gingen aber doch schneller und hörten schon von weitem lauten Lärm im Dorfe; dort fanden wir alles in großem Aufruhr und mit allem möglichen bewaffnet. Die Ursache war der gefallene Schuß. Tom beruhigte die Bevölkerung, und jeder ging friedlich heim.
Tom erzählte, in Kilossa wäre es so ähnlich gewesen. Die Offiziere hätten im Kasino gesessen und gesehen, wie die Bevölkerung des ganzen Tales plötzlich in hellster Flucht davon gelaufen sei. Die Ursache sei ein halbverhungerter Mhehe gewesen, der krank von dem Kondoaüberfall zurückgeblieben sei und sich im Gras verborgen durch Kräuter usw. ernährt habe.
Des Abends waren wir ganz besonders fröhlich, daß nichts passiert war. Es wurden gleich Nachforschungen angestellt und heute hieß es, Quawa wäre bei Farhenga versteckt, wo noch außerdem ein Msagira mit Anhang gesehen worden sei, auf den Tom auch fahndete. Tom und ich hatten noch nicht gefrühstückt, bei der Nachricht verging uns aber doch der Appetit zum Essen. Also Farhenga auch Verräter? Tom überlegte sich die Sache noch. Da — was sehen unsere Augen — kommt Farhenga an und mit ihm der Msagira mit Brüdern. Nun, freudiger ist er wohl nie von uns begrüßt worden, wir gaben ihm auch gleich eine Flasche Gin, die er mit verständnisvollem Schmunzeln einsteckte. Es stellte sich auch heraus, daß der Mhehe, der geschossen, nie[S. 96] bei ihm gewesen ist. Er brachte gleich die gesuchten Leute mit, die nun an die Kette kamen.
Von Goritz kam Nachricht, daß er 28 Wahehe gefangen, an der Stelle, wo die Postboten überfallen wurden. Winkler marschierte ab, um sie hierher zu bringen. — Die Wahehe werden durch Boten aufgefordert, gegen Quawa mitzuziehen. Auf das Ergebnis, ob sie mitkommen werden, sind wir äußerst gespannt, davon hängt sehr viel ab.
Meine Puten machen mir noch viel Arbeit, da sie krank sind, sich erkältet und Fieber haben, ich behandle sie mit Chinin, Aloepillen usw.
26. März 1897.
Heute kamen die Wahehe an. Wieviel mitziehen werden, ist schwer zu sagen, da Tom noch unterwegs eine ganze Menge antrifft, jedenfalls von hier an 200. Es ist dies für Tom sehr schön. Gott gebe, daß sich kein Schurke darunter befindet, der nur so in Toms Nähe kommen will. Viel Schauri. Des Abends kam noch Dr. Stierling.
27. März 1897.
Noch des Morgens setzte Tom Stationsbefehl auf, gestern hatte er alle Befehle an die Kommandos geschrieben. Tom hat jetzt außerhalb elf Posten mit Europäern, dazu sieben Posten mit schwarzen Chargen besetzt. Die Leute müssen für alle nur denkbaren Eventualitäten mit sorgfältigsten Instruktionen versehen werden. Die Europäer müssen an den Bomen in Zelten schlafen; an jeder Bastion einer, auch Askaris schlafen dort, damit, wenn ein Angriff stattfindet, alles bereit ist; auch am Tage müssen 20 Soldaten immer zugegen sein. — Ehe die ganze Safari versammelt war, wurde es 9 Uhr. Tom nahm noch ein paar nachgekommene Wassangus mit. Wie stechen die kleinen Kerle in Ausdruck und Gestalt von den stattlichen Wahehe ab, ihrer Gesinnung nach sind sie mir aber lieber. Tom hat nur vier Soldaten mit sowie einige Sadalla- und vier Sikkileute. Ein malerischer[S. 97] Anblick, diese phantastisch gekleidete und bewaffnete Kriegerschar, die meisten Wassangus hatten allerdings wenig Stoff an sich. Ich begleitete Tom noch ein Stück Weges den Berg hinunter und bis zum Ruheka. Gegen Mittag kam ich erst nach Hause. Nun bin ich wieder ganz allein. Wie lange ist unbestimmt. Mir wäre lieber, Tom hätte die Wahehe nicht mit.
28. März 1897.
Heute kamen die Gefangenen mit Hammermeister aus Bueni (Goritz) hier an, aber nur 17 Mann, auch wieder große kräftige Kerls, vor denen man sich fürchten konnte. So wild und wüst im Aussehen, wie man sich die Räuber vorstellt. Von den 25 Gefangenen waren sechs schon bei Goritz ausgebrochen, dann noch zwei bei Winkler; sie stecken natürlich hier in unserer Nähe im Pori.
Eine Freude! Von Tom Nachricht; er ist gestern bis zu Stephan, also zehn Stunden, durchmarschiert. Meinen Spaziergang machte ich durch die Stadt. Die verschiedensten Gomas (Spiele, Tänze) gesehen, denn Leute von Kilimatinde tanzen anders wie die von Tabora, an der Küste usw., auch die Weiber und Männer tanzen wiederum verschieden. Die beginnende Dunkelheit begünstigte mein Inkognito, war ich aber doch erkannt, dann beeilten sich die Tänzer, mir ihre schönsten Touren zu zeigen und mir zu huldigen, was mich natürlich möglichst schnell vertrieb. So in der Dunkelheit durch die breit angelegten Straßen zu wandern, die sehr sauber gehalten werden, ist recht interessant. Das ganze Leben spielt sich auf der Straße ab. Alles lustwandelt, tanzt oder sitzt auf der Veranda, denn die Wohnung dient nur zum Schlafen oder als Zuflucht bei Kälte. Die Türe steht stets offen, und da es auf der Straße dunkel ist (zu Laternen haben wir es noch nicht gebracht), heben sich die um das Feuer hockenden Gestalten wunderschön ab. Auf der Veranda sitzen sie auch bei einem kleinen Licht.
29. März 1897.
Rettich, Zwiebeln, Radieschen, Möhren, Gurken gesät.
30. März 1897.
Heute morgen kam Leutnant Braun. Ist gestern schon hier angekommen. Boten an meinen Mann geschickt, erfuhr es erst heute. Braun hatte mich nicht wenig erschreckt. Ich hatte gerade im Hühnerhaus usw. recht herumgewirtschaftet, eine große Schürze dazu umgebunden, als ich mich plötzlich Leutnant Braun gegenüber sah. So wie zu Hause sich extra zum Wirtschaften etwas Schlechtes anziehen, gibt es hier nicht, hier muß man immer „tajari“ sein, denn wie gesagt, man ist hier nicht abgeschlossen und kann immer jemandem begegnen. Nun, die Waschkleider sind eben sehr schön, wenn sauber, und auch leidlich hübsch, man kann wenigstens immer gesehen werden. Des Nachmittags empfing ich Merere, der mit seinem Gefolge angezogen kam, letzteres mußte vor der Tür auf seinen Herrscher warten; nur ihm und seinem ersten „Minister“ wurden die heiligen Pforten geöffnet. Jetzt sitzt er schon ganz schön auf einem Stuhl, er fordert wieder Tabak (er raucht schon Zigaretten), Streichhölzer, Zucker, Salz usw. Ich gab ihm von allem etwas. Ich zeigte ihm seine Bilder, die ich aufgenommen hatte, er war ganz aufgeregt darüber, und ich mußte ihm einige geben, damit er sie seinen Leuten zeigen könne; besonders imponierte es ihm, daß auch sein Reitochse mit auf dem Bilde war.
An der Weckuhr hatte er viel Vergnügen — ich mußte sie immer wieder wecken lassen, daß mir die Ohren gellten — aber noch mehr an einem großen Stammbuchbild, zwei stehende Negerkinder darstellend, das muß ich ihm jedesmal zeigen. Nach 1½ Stunde entließ ich ihn in Gnaden. Heute ist Merere mit 500 seiner Leute und 15 Askaris ohne Herrn Braun, der erkrankt ist, ausgezogen.
Eins will ich noch klarlegen. Als Mpangire noch lebte, war alles so schön; war seine Hinrichtung nicht voreilig? Ja, in der Tat, es war alles in schönster Ruhe, — aber es war die Ruhe vor dem Sturm. Er oder wir — sein Tod war die dringendste Notwendigkeit, sonst wäre unser Schicksal besiegelt gewesen. Das[S. 99] Quawageschlecht übt eine unglaubliche Gewalt auf das Volk aus, und solange Quawa lebt, werden wir nicht zur Ruhe kommen.
Heute hatte ich zu Bett gelegen, infolgedessen glaubten meine Damen, ich würde den Hühnerstall nicht revidieren: statt 31 Hühner fand ich nur 20 dort. Jetzt müssen sie die fehlenden noch suchen. Auch hier heißt es: „Wenn die Katze nicht zu Hause ist, tanzen die Mäuse auf Tisch und Bänken.“ Der Mpischi ließ das Essen von den kleinen Boys machen, und ich bekam erst um 4 Uhr Mittagbrot; Mabruki schlug sich mit der Wache, so daß er an die Kette gekommen ist; das sind eben die kleinen afrikanischen Dienstbotenleiden. Meine drei Mädels machen es noch am besten, die habe ich schon so weit, daß sie ganz unglücklich sind und weinen, wenn sie etwas schlecht gemacht haben. Wenn ich sie schelte, sind sie schon sehr betrübt. Muhigu fängt sogar schon an die Empfindliche zu spielen, wenn ich sie schelte, früher machte nur Kofi (Ohrfeige) einigen Eindruck. Auf diesen Erfolg bin ich sehr stolz. Natürlich treten mir dadurch die Kinder viel näher, denn sie sind im Wesen ebenso wie die Kinder zu Hause. Auch spielen sie jetzt schon verschiedene Spiele, die ich ihnen gezeigt.
3. April 1897.
Ich war eben auf unser Haus geklettert, das sich jetzt zwar in das Kleid der Hoffnung zu hüllen anfängt, ja es hofft wohl selbst bald fertig zu werden, aber das ist leichtsinnig, denn die Arbeiter denken anders darüber. Ich glaube, die haben anscheinend die Absicht, es erst zur nächsten Regenszeit fertig zu stellen, sicher aber nicht vor Juni. Ein kleines Küken ist darüber lebensmüde geworden und hat sich in einen Farbentopf gestürzt. Ich wollte es noch retten, aber trotz aller Wiederbelebungsversuche war es verloren. Ich fürchte, die Puten gehen auch ein, trotz Aloepillen, Kur und Doktorei. Das weiße Schwein überlegt sich, wo es den besten Speck ansetzen will; daß es fleißig gemästet wird, scheint ihm sehr zu gefallen. Sobald Tom kommt, muß es daran glauben. Es hat Reißen oder Gicht in den Hinterpfoten und kann nicht mehr gehen.
Nun bin ich schon ein halbes Jahr hier und gottlob! trotz all der Aufregung habe ich kein Fieber mehr gehabt, nachdem die Fieberbazillen, die ich unten in so reichem Maße hineingeschluckt, abgewirtschaftet hatten. Daß es hier so gesund ist, mag neben der Höhe auch an der gleichmäßigen Temperatur liegen, die des Morgens zwischen 12 bis 16°, mittags zwischen 20 bis 25°, abends zwischen 13 bis 15° schwankt; durch Regen ist es manchmal mittags kühler.
4. April 1897.
Eben komme ich aus dem Garten, wo ich die aufgegangenen Kartoffelpflänzchen zählte. In acht Wochen haben wir Ernte, dann besteht die Station ein halbes Jahr, und wir haben schon Kartoffeln. Ich bin jetzt so nervös, wahrscheinlich auch vom schlechten Schlafen, daß ich mir einbildete, der Teufel sehe über meine Schulter; ich schrie so fürchterlich auf, daß Boy und die Totos hereingestürzt kamen; trotzdem ich sie sah, konnte ich mich eine ganze Weile nicht beruhigen. Um zur Vernunft zu kommen, ging ich mit den Totos spazieren. Ich nahm unseren Gartenaskari mit, der die Zelewski-Expedition mitgemacht hatte und davon erzählte. — Die Totos sind jetzt meine ganze Freude, wenn die drei schwarzen Krausköpfchen mit ihren hellen Leinwandkleidchen, mit rot garniert und roter Schürze, mit nackten Beinen so vor mir her zappeln und krabbeln. Früher gingen sie wie die Alten, jetzt springen und tanzen sie, klettern auf Bäume und necken mich. Ich bin den Kindern wirklich Mutter; wenn sie ganz besonders glücklich sind, nennen sie mich auch „Mama“. Die Sklavenbanden haben schwer auf ihnen gelastet, jetzt haben sie die Freiheit, ihre Kindheit zu genießen.
6. April 1897.
Gestern nacht wurde ich durch Alarm aus dem Schlafe geweckt. Ombascha Achmed kam schon, während ich mich ankleidete, mit der Nachricht, eine Menge Wahehe seien mit Gewehren in Sicht. Von weitem hörte man auch Schnellfeuer. Ich weckte die[S. 101] Totos und zog nun mit zwei Revolvern bewaffnet zur Wache, wo alle Europäer versammelt waren. Die Herren beschlossen einen Tschausch mit Askaris abzuschicken, um zu sehen, was los sei; wir wollten uns inzwischen schlafen legen und so der Dinge harren. Um die Mission und den Europäerposten in Iringa waren wir sehr in Sorge. Des Morgens stellte es sich heraus, daß Askaris geglaubt hatten, von Wahehe überfallen zu sein, und Schnellfeuer abgegeben hatten; die Wahehe schossen wieder, und erst am Morgen merkten wir, daß es uns freundlich gesinnte Wahehe waren. Dr. Stierling war gleich selbst des Morgens nachsehen gegangen. Es ist zu schwer hier, Freund und Feind voneinander zu kennen.
7. April 1897.
Heute kamen zwei Brüder für die Mission an, der eine hatte Fieber und zog sich bald zurück, dem andern zeigte ich unser Haus, den Garten und die Stadt. Er war einfach perplex, und trotzdem ich ihm versichert hatte, vor einem halben Jahr habe nur unsere Hütte gestanden und vor sieben Monaten sei noch alles Pori gewesen und keine Menschenseele hätte auf dem Bergrücken existiert, fragte er doch noch, ob hier nicht wenigstens schon Negerhütten gestanden hätten. Für so unglaublich hielt er das schnelle Entstehen der Stadt. Man braucht aber auch schon reichlich eine halbe Stunde, um durch die Stadt allein zu gehen, so viel Straßen sind schon entstanden. Es ist erstaunlich, wie der Name Sakkarani die Leute angezogen hat; wir fürchten nur, daß die Stadt zurückgehen wird, denn so viel Menschen können hier wohl kaum ihr Brot, d. h. ihren Mais verdienen. Dann gingen wir durch die Station zurück in das Dorf der Eingeborenen, welches sich hinter unserem Hause anschließt. Es ist schon bedenklich gewachsen und hat schon an 300 Mann; die Temben müssen allerdings noch zum Teil gebaut werden. Aus dem Erstaunen kam der Bruder gar nicht heraus.
Über unsern Garten war er auch sehr erfreut, denn alles gedeiht prachtvoll. Jede Rübenart, jede Kohlart, sogar Rosenkohl,[S. 102] Tomaten, Erbsen, Bohnen, Zwiebeln, Schnittlauch, Petersilie, Majoran, Sellerie, Dill, Pfeffermünzkraut, Salat, Rettich, Radieschen stehen schön. Mohn und Artischoken scheinen auch zu gedeihen, nur mit Gurken und Melonen hapert es, und wahrscheinlich nur, weil wir sie nicht zu ziehen verstehen. Kartoffeln stehen gleichfalls sehr schön. Die Brüder waren über unsern Garten schon so entzückt, was würden sie erst zu dem unten am Ruaha gesagt haben, wo alles noch besser gedeiht; dort stehen Apfelsinenbäumchen, Feigen, Mango, Zitronen, zwei kleine Weinreben. Hoffentlich gedeihen sie weiter so. Bananen, Ananas und auch eine Kokosnuß sind aufgegangen. Der Weizen steht niedrig, ist aber gleichmäßig gereift, was vielfach im Innern nicht der Fall sein soll, und Stroh brauchen wir nicht; es ist hier ein herrliches Ansiedelungsgebiet, und der Bauer würde sein schönes Auskommen haben, denn zu alledem kommen noch das schöne Vieh und Weideland. Auch ist die Gegend hier gesund, also alles „tajari“, nur die eine Frage ist nicht gelöst: Wie kommt der Bauer hierher?
Heute kamen ein Feldwebel und ein Bootsunteroffizier für Langenburg an, die einen Ruhetag hier machen und dann weiter marschieren, dann nehmen sie natürlich die 100 Lasten mit. Reichlich zwei Monate haben die Lasten hier liegen müssen, die Sachen werden also fünf Monate unterwegs sein. Wie schmerzlich werden sie von den Europäern erwartet werden? Meine Nähmaschine hatte ich gestern mit Mühe und Not zum Nähen gebracht, gestern ging sie sehr gut, doch plötzlich versagte sie. Da der Bootsunteroffizier in seinem Zivilverhältnis Uhrmacher war, glaubte ich, er würde sie mir wieder zurecht machen können. Der brave Mann hat sich auch so lange geplagt, bis er sie wieder in Gang hatte. Wegen meiner Maschine habe ich schon einmal einen fremden Unteroffizier zu Rate ziehen müssen. Wir erhielten auch die Bestätigung, daß Toms Breitenbestimmungen richtig sind; kein falscher Stern ist beobachtet. Hoffentlich gelingt es uns immer so.
8. April 1897.
Glückstrahlend kam Tom heute zurück: auf dem Rückmarsch hat er plötzlich dicht am Wege drei starke Elefantenbullen gesehen. Obwohl er seine Elefantenbüchse nicht mit hatte, pirschte er sich doch an und hatte das Glück, sie alle drei zur Strecke zu bringen. Eine Kugel, Modell 88, hatte sich an der Wurzel des großen Stoßzahnes plattgedrückt. Der größte Elefant ist 9 Meter lang, bei 3½ Meter Höhe; in seinem Wanst badeten acht Neger zu gleicher Zeit in dem Blute des Tieres — nach Negerglaube ein besondere Kräfte verleihendes Mittel. Den schwarzen Siegfrieden fiel kein Lindenblatt aufs Kreuz, Rücken und Rippen des kolossalen Tieres bildeten eine gut gedeckte Badezelle. Hinter dem Riesenkopf desselben konnte Tom sich decken, als er den zweiten Elefanten schoß. Der dritte rannte dicht an Tom vorbei; es war eine fatale Situation, mein Mann war allein, das dichte Farnkrautgestrüpp verhinderte ein Ausweichen — und doch kommt es darauf an, dem angeschossenen Riesen so rasch als möglich aus dem Gesicht zu kommen. Das Herz haben die Neger als große Delikatesse verspeist. Von einem Stück Rüssel machte ich Suppe; sie schmeckte etwa wie recht kräftige, mit Gelatine verdickte Rindfleischsuppe mit etwas leimigem Beigeschmack; das Fleisch war nach 24stündigem Kochen zäh wie Leder.
9. April 1897.
Heute wurde die Jagdbeute eingebracht, mit Jubel und Geschrei natürlich. Vorneweg die Sikkileute mit Tanz und Gesang. Hundert Mann hatten an dem Transport der drei Kolosse zu tun. Leider hat das größte Tier nur einen Zahn; dieser wog allerdings 106 Pfund. Den Kopf des kleineren mit den beiden Stoßzähnen (45Pfünder) habe ich photographiert.
12. April 1897.
Großes Schlachtfest! Unser Hofschlächter, Unteroffizier Hammermeister, besorgte die Sache nach allen Regeln der Kunst. Unsere Schwarzen staunten nicht wenig, daß unter seinen Händen[S. 104] ein schwarzes Schwein so weiß werden konnte! Aber von dem Fleische zu essen, weigerten sie sich voll Abscheu. Nur unser Juma, der in Deutschland Schweinefleisch essen lernte, aß auch hier davon, dafür wurde er aber auch von den anderen Boys verächtlich „Sklave“ geschimpft. Das Wellfleisch schmeckte prächtig. Da Pater Alfons die neu angekommenen Brüder bei uns vorzustellen kam, konnten sie an unserem Schlachtfest teilnehmen. Bis auf das bißchen Unterschied in der geographischen Länge und Breite ging’s bei uns ganz so zu wie beim Schweineschlachten in Weißenrode — mir war ganz heimatlich zu Mute, und wenn sich so etwas wie Heimweh zeigen wollte, dann wurde es flugs mit ins Wurstfleisch verhackt. Es war aber auch ein Staatstier, eigentlich viel zu schade, um seine Laufbahn in den nunmehr historischen Pökelfässern der Familie Prince zu beschließen. Unser Sachverständiger Hammermeister taxierte es nach deutschen Viehverhältnissen auf 180 Mark „unter Brüdern“.
13. April 1897.
Nach dem Schlachtfest heute „Pökelfest“ und großes Wurststopfen und dazu noch frische Kartoffeln! Tom, Winkler und ich hatten schon vor einigen Tagen Kartoffelernte gehalten: an manchen Stauden fanden wir bis zu 58 Knollen, darunter 22 große, von denen 10 aufs Pfund gehen; durchschnittlich kamen auf jede Pflanze 25 Kartoffeln. Es wurde alles genau gezählt, gewogen und an die Europäer verteilt, denn unsere erste Kartoffelernte ist ein Ereignis. Wir kochen nie mehr als sechs Stück, so sparsam gehen wir mit dieser Delikatesse um.
Aus Mage melden Wahehe, daß sie zwei Wahehewassagira, die zu den treuesten Anhängern Quawas gehörten, im Waldlager überfallen und niedergemacht hätten. Der eine der Erschlagenen ist Farhengas rechter Bruder. Dieser Bruderzwist, dessen Strömung Tom nach der alten Diplomatenregel „divide et impera“ geschickt in die für uns günstigste Richtung abgelenkt hatte, kommt uns nun in der Tat zu nutze.
Von den Sudanesenfrauen zeigte mir eine heute einen feinen, goldgelben, aber sehr festen Faden von seidenartigem Glanze, das Gespinst einer großen Spinne, welches man, wie die Frau erzählte, im Sudan zu feinen Stoffen verwebt. Ob sich das nicht auch hier erzielen ließe? In die Boma Prinages schlug der Blitz ein. Prinage selbst kam mit dem Schrecken davon, aber einer der besten Sudanesensoldaten wurde tödlich getroffen, drei andere leicht verletzt.
Karfreitag, 16. April 1897.
Den Karfreitag mußten wir heute durch kriegerische Schaustellung feiern, der wir uns nicht entziehen durften: die Kriegsspiele unserer Farhenga- und Sikkileute. Das Ganze war wie eine Pantomime im Zirkus Renz, freilich durch die Darsteller und die ganze lebenswahre Umgebung, in der die Spiele vor sich gingen, weit interessanter. Sikkis Oheim, ein stattlicher 1.90 m hoher Mann mit besonders ausdrucksvollem Kopfe, zeichnete sich als Haupt- und Vortänzer in diesem kriegerischen Schauspiele durch unglaublich hohe Luftsprünge aus; Sikki selbst tanzte, wie es seiner Jugend zukam, bei der Gruppe der jüngeren Leute; er ist nämlich noch nicht in dem Alter, in welchem ihm die Stammessitte erlaubt, Schmuck an Armen und Hals anzulegen. Der Kriegstanz unserer Wahehe bot ein wildbewegtes Bild ihrer Kriegführung, wie sie hinter ihren Schilden gedeckt den Feind beschleichen und überfallen. Den Hauptdarstellern lohnten wir ihre Anstrengungen mit einem Kognak, für den sie großes Verständnis zeigten.
Gestern, zum Gründonnerstag, hatte ich bunte Ostereier mit allerlei scherzhaften Zeichnungen darauf (ein Kater, Jüngling auf Bierfaß reitend) nach den Messen geschickt, für Tom hatte ich bei uns welche versteckt; wir hatten beim Eiersuchen dann noch viel Vergnügen.
Am 1. Osterfeiertag, 18. April 1897.
Keine Glocke läutet zum Ostertage — aber wir feiern das hohe Fest, obwohl ich fast immer liegen muß, mit inniger Dank[S. 106]barkeit gegen den allgütigen Gott, der uns bis hierher in seinen Schutz genommen.
Während Tom seine Berichte schreibt, erhebt sich draußen ein Heidenlärm: die für die Expedition aufgebotenen Wahehe rücken an. Vergessen sind Krankheit und Osterheimweh — ich gehe mit Tom hinaus, um das buntbewegte Bild dieses für uns so äußerst wichtigen Zuzuges anzusehen. Die Jumben traten ein jeder mit seinem Trupp zusammen, die Leute wurden aufgerufen, und jeder Gezählte kauerte in Reih und Glied mit seinen Kameraden, ein komisches Bild eines großen Appells. Die Zählung ergab 500 Wahehekrieger — ein großer Erfolg von Toms Politik, denn beim ersten Aufrufe hatten sich nur 200 gestellt. Der Weg zum Herzen dieses streitbaren Volkes heißt Krieg. Wer sie für sich gewinnen will, muß ihnen Gelegenheit geben zu Kämpfen und Raubzügen; ihren wilden Drang nach kriegerischer Betätigung auf die richtigen, unseren Zwecken günstigen Ziele abzulenken, war Toms hauptsächlichstes Bestreben, dazu kommt noch ein anderes bedeutsames Moment, welches uns die ansehnliche Schar dieser tüchtigen, im Kampfe erprobten Wahehekrieger noch wertvoller macht: in unserem Vernichtungskampf gegen Quawa bedeutet jeder einzelne Mann, der sich Toms Expedition anschließt, einen dauernden Verlust für unseren Feind, denn wer von seinen Leuten einmal auf unserer Seite gekämpft hat, dem ist qualvoller Tod sicher, sobald er in Quawas Gewalt kommt. Es war doch anfangs etwas beängstigend für uns, mitten unter diesen 500 wilden Kerlen sich zu bewegen, von denen jeder noch vor kurzem unsere Ermordung sich als besonderes Verdienst angerechnet hätte. Tom hatte auch alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, um etwaiger Überlistung gewachsen zu sein, das Maxim stand schußbereit, und die Wachen waren verstärkt. Unsere Befürchtung war jedoch grundlos, die Wahehe kamen in der Tat mit der ehrlichen Absicht, unter Tom zu kämpfen. Auf Toms Frage, warum so viele von ihnen ohne Schilde wären, erklärten sie, die Schilde hätten sie zerbrochen, denn Tom habe bekannt gemacht, daß er jeden als Feind erkläre, der mit Speer und Schild gesehen werde. Von Farhenga hätte ich[S. 107] gern einen schönen Speer gekauft, aber der geforderte Preis von 15 Rupien war mir doch zu unverschämt, 8 Rupien hätte ich ihm dafür gegeben.
Feldwebel Langenkemper traf hier ein, er hat krankheitshalber um Ablösung gebeten. Wir ritten den nächsten Tag nach, da Meldung von Leutnant Braun gekommen war.
Auch Merere ist wegen Krankheit schon lange zurück, er beehrt uns alle Minuten mit seinem Besuche, und der arme Tom muß ihm Tag für Tag dasselbe sagen; er tut das mit einer unbegreiflichen Geduld und Freundlichkeit; mir wäre schon längst die Geduld gerissen. Solch’ Schauri mit unserm langweiligen Gastfreund und Bundesbruder hat aber auch seine angenehmen Seiten. Hinter einer Tembe, 20 Schritt von uns, eine Viehherde, auf der anderen Seite eine Eselherde, aus allen Türen neugierige schwarze Gesichter hervorlugend; zu dem Schauri muß sich nämlich alles respektvoll entfernen. Merere hockt auf einem Fell, Tom und ich ihm zur Seite auf etwa sechs Zoll hohen Negerstühlchen, Merere furchtbar geheimnisvoll, als ging’s um ein Königreich; für ihn freilich war die Sache wichtig genug. Hoffte er doch, nach dieser Expedition auch in Iringa, also für ganz Uhehe, als Sultan eingesetzt zu werden. In Wirklichkeit saß sich’s bei dieser Haupt- und Staatsaktion gar nicht übel; abgesehen von der spaßigen Seite, bot das Ganze ein eigenartig schönes Bild. Vor uns der waldige Bergabhang, über den Bäumen die aufragenden Gipfel der Berge, zuerst in rotgoldener Sonnenglut, dann sich dunkler färbend, bis die untergehende Sonne zuletzt alles mit flammender Abendröte übergoß.
21. April 1897.
eute mittag ging Tom fort, ich konnte ihn nicht einmal begleiten, da ich fest liege. Für Tom auch schrecklich, mich hier so allein zurückzulassen. Da heißt’s eben: Kopf hoch! — Vorher noch großes Schauri mit Merere und Winkler. Merere will durchaus zu dem Grabe seines Vaters, um dort zu beten und Dawa zu machen. Er glaubt nämlich, sein Vater habe ihm die Krankheit zur Strafe geschickt, weil er so lange nicht am Grabe gebetet habe. Winkler soll ihn begleiten. Ein Sultan wird nach seinem Tode von seiner Familie als Gott verehrt; also der richtige ausgesprochene Ahnenkultus wie bei den Chinesen. Sein Grab wird mit besonderer Sorgfalt gepflegt. So sind z. B. auf dem des alten Quawa prachtvolle Elfenbeinzähne aufgestellt. Auch die erste Frau des Sultans wird in gleicher Weise geehrt. An den Gräbern beten dann der Sohn und die richtigen Brüder, also Söhne desselben Vaters und derselben Mutter. Die Halbbrüder und Großen des Landes dürfen bei dieser Feier zugegen sein. Ein Sultan geht nie ohne sein Gefolge zu dieser Andacht, an der nur die Söhne teilnehmen. Die Töchter, wie überhaupt alle Frauen, sind ausgeschlossen. Die andern Frauen des Sultans werden im Pori, also im Urwaldgebüsch, nur ganz oberflächlich verscharrt und zum Schutz gegen wilde Tiere mit Baumstämmen bedeckt. Dasselbe[S. 109] geschieht mit den Leichen der Halbbrüder; deren Weiber werden überhaupt nicht begraben, sondern in der Wildnis auf einem Stapel zusammengeschichteter Baumstämme ausgesetzt; ebenso die Großen des Landes nach einer sehr einfachen Rangabstufung: je kleiner der Mann, desto niedriger der Stapel. Die Sklavenleichen wirft man einfach ins Pori. Eine große Menge Leute geht mit, die Weiber weinen und machen großes Geschrei, ebenso weinen die Männer und die Verwandten. Haben sie die Leiche weggeworfen, dann baden die Verwandten und nächsten Freunde im nächsten Fluß. Im Trauerhause kommen dann die weiblichen Verwandten und Freundinnen zusammen, unter Fasten weinen, schreien sie drei bis vier Tage lang, die Mutter fünf Tage. Das Gesicht zur Wand gekehrt und in die Hände gestützt, kauern sie die ganze Trauerzeit über.
23. April 1897.
Seit 5 Wochen keine Post! Mein Schammy fand heute das Abzeichen eines Askari-Tschausch’s, sofort kam er damit an und meldete sich bei mir als „tschausch ya kuku“ (Hühnersergeant). Das Soldatenspielen steckt doch nun einmal allen Jungens im Blut, in Afrika so gut wie bei uns Deutschen. Alle unsere Leute sind sehr zutraulich und bringen ihre kleinen Sorgen und Freuden bei mir an. Meine kleinen Mädels spielen jetzt seht hübsch.
Heute Nachricht von Tom; als Morgengruß schickte er eine Giraffe mit wundervollem Fell, die ihm auf dem Marsch vor die Flinte gekommen war. Die Soldaten haben das Fell ausgespannt und gereinigt. Wie schwer es mir wird, jetzt zu liegen! Garten und Hühnerzucht den Schwarzen so ganz überlassen zu müssen, ist so schwer. Es war schon alles hübsch im Gange, nun geht es wieder zu Grunde. Der Neger bedarf doch einer ganz anderen und schärferen Aufsicht als die Leute zu Hause. Die gesamten Vorräte für Monate müssen nun wenigstens für die Boys zugänglich bleiben, und was die im Stehlen und Naschen leisten, das wird sich schon noch fühlbar machen. In diesem ungewohnten[S. 110] Zustande absoluter Freiheit in Haus und Garten vergessen meine schwarzen Dienstboten, daß sie überhaupt eine Herrin haben. Eines Tages waren sie samt und sonders am Morgen bereits verschwunden und kamen erst abends wieder. So lag ich denn den ganzen Tag über mutterseelenallein im Hause, zu schwach, um mich erheben zu können, ohne eine Menschenseele auch nur in erreichbarer Nähe zu haben. Der Tag gehört zu dem Schlimmsten, was ich hier durchgemacht habe.
26. April 1897.
Nun sind es noch neun Tage bis zu Toms Rückkehr! Ich streiche jeden Tag im Kalender mit einem dicken roten Strich durch, wie wir’s einst in der Pension taten, wenn die Ferien herankamen. Aus Iringa wieder böse Nachricht: ein Boy und ein Träger erstochen. Auch an häuslicher Unruhe fehlt es nicht. Der Mpischi (Koch) legt mir seine ehelichen Sorgen vor; seine Frau treibt sich seit sechs Tagen herum; da sie ihm seine Tücher und Hemden mitgenommen, lasse ich sie, nach genauer Feststellung des Tatbestandes, zur Wache bringen, damit sie beim nächsten Schauri bestraft wird. Heute ließ ich mir Mgunditemi holen; das arme Ding ist krank. Ich gab ihr Fleisch und Reis; sie ist übrigens eine schlanke, hübsche Frau.
Ich war heute einen Augenblick im Garten, die Kartoffeln sind schon ganz braun, wenn Tom zurück, müssen sie gleich herausgenommen werden, allein mag ich es nicht tun. Dann machen wir wieder Kartoffelfeuer, rösten Kartoffeln, das gibt uns viel Spaß, wie neulich unten im Garten. Leutnant Braun ist seit gestern zurück. Er sagte auch, daß sich die Wahehe ganz anders gezeigt hätten als die übrigen Neger. Er hat eine ganze Ortschaft zerstört und die Temben eingerissen; kaum war er zwei Stunden fort, so sah er, wie die Wahehe zurückkamen und ihre Temben wieder aufbauten, so daß er nochmals zurück mußte. Drei Träger sind an Überanstrengung gestorben, der eine davon ist unter seiner Last zusammengebrochen.
6. Mai 1897.
Ich habe vom 27. April an sehr schlechte Tage hinter mir. Am 29. war mir der Gedanke schrecklich, in Toms Abwesenheit operiert zu werden, es konnte doch auch schlecht ablaufen, und Tom wäre nicht zu erreichen gewesen. Aber Gott sei Dank, spät abends kam Tom wieder an. Er hatte so viele Gefangene, etwa 500 Leute und 200 Stück Vieh, daß er deswegen umkehren mußte, denn es waren jetzt mehr Gefangene, als Tom selbst Leute in seinem Zuge hatte; gefallen sind dabei 40 feindliche Krieger. Die Leute bei Iringa sind jetzt so beruhigt, daß sie mit Tom selbst gegen ihre Stammesbrüder ziehen; das ist ein großer Erfolg. Quawa ist jetzt in eine andere Wildnis übergesiedelt, in der alten Gegend fühlt er sich nicht mehr sicher. Er hält sich an einem Platz nie länger als zwei Tage auf, wie der ewige Jude wandert er von Ort zu Ort. Seine Anhänger setzen sich jetzt verzweifelt zur Wehr, immer noch erscheinen Trupps (Tom hat vier solche zu je 40 bis 60 Wahehekriegern angetroffen, die auf dem Zuge gegen uns begriffen waren, und sie zurückgejagt). Auf ihr Konto müssen wir die vielen Meuchelmorde setzen. — Tom hat sehr viel zu tun. Jetzt, wo ich elend bin, sehne ich mich doch sehr nach unserm Hause, ich werde dann auf der schönen Veranda liegen können. Das Liegen ist zu unangenehm, da man dabei kaum schreiben kann. Am 3. Mai sind der neue Feldwebel und der Bauleiter angekommen. Trotzdem er die Dielen der Hinterzimmer aufreißen läßt, weil sie zu schlecht gebaut sind, will er schon in 14 Tagen mit dem ganzen Haus fertig sein. Wahrscheinlich gehen Spiegel und Wilkins (Feldwebel und Bauleiter), beide wegen Krankheit abgelöst, morgen zur Küste. Eben bringt Tom mir wunderschönen Weizen, der auf ungedüngtem Boden gewachsen ist, überhaupt ist der Garten unten nicht gedüngt.
Gestern abend kam endlich die Post. Wie wir uns über die Schreiben und Zeitungsausschnitte freuten! Heute kam Leutnant Kuhlmann mit einem Unteroffizier und 30 Askaris hier an, um sich Tom zur Verfügung zu stellen. Es verlautet, daß der[S. 112] Gouverneur im Juni eine Reise in das Innere antreten und auch hierher kommen will, und daß Herr v. Eberstein krank sei.
Weizen geerntet, auf wasserdichten Decken statt Tenne ausgedroschen; der Ertrag ergab das 24fache der Aussaat, also das 24. Korn. Auch der Weizen ist ebensowenig wie der Garten weder gegossen noch gedüngt. Heute kam auch die Karawane für uns an. Wir hatten wieder allein fünf Träger für Postsachen — und der Trägerlohn ist jetzt auf 21 Rupien (Rp. = 1.40 Mk.) erhöht! Für ein kleines leichtes Weinfäßchen waren zwei Träger nötig, desgleichen zu einer kleinen Frachtkiste aus Liegnitz; der fünfte Träger brachte ein Postpaket. Wie groß, unendlich groß würde die Freude über alles sein, wenn es nicht den abscheulichen Beigeschmack der Trägerkosten hätte.
Nach Perondo bekamen wir die Zehnpfundpakete umsonst geschickt; dies ist jetzt nicht mehr der Fall, da aber nur drei solcher Pakete auf eine Last gehen, müssen wir diese Packungsweise vermeiden. Es empfiehlt sich vielmehr, alle Sendungen in Deutschland ansammeln zu lassen, bis sie zusammen, einschließlich Verpackung, etwa 60 Pfund wiegen — aber nicht mehr, sonst geht es uns wie mit dem Weinfaß, das nur 70 Pfund wog und zwei Träger brauchte. Bei allem muß man eben sein Lehrgeld zahlen, aber wir bleiben ja lange genug hier, um noch die Früchte davon zu ernten.
15. Mai 1897.
Leutnant Kuhlmann war ganz erstaunt über unsere große Stadt. An der Küste hätte man keine Ahnung davon. Man könnte sich ein so schnelles Wachsen einer Stadt nicht vorstellen. — Nun, ich freue mich, wenn der Gouverneur sich selbst von Toms Erfolgen überzeugen kann. Auch das kann man als „echt afrikanisch“ bezeichnen, in Deutschland wenigstens soll es nicht gerade üblich sein, daß die Offiziere sich nach den Besichtigungen durch ihre Vorgesetzten sehnen. — Übrigens hieß es plötzlich, der Gouverneur sei nur noch einen Tagesmarsch von hier; ich machte gleich Makronen, Schokoladenplätzchen, Räderkuchen, Waffeln, alles gelang schön. Da ich gerade Honig bekam, setzte ich auch noch Teig zu Honigkuchen an. — Mein spezielles Departement, das des Innern und der Haus- und Landwirtschaft, ist für den hohen Besuch ebenfalls in bester Verfassung.

Das Stationshaus in Iringa.
(Zu S. 114.)

Das Arbeitszimmer.
(Zu S. 115.)
Von der Taktik der Wahehe, die Wege ungangbar zu machen, konnte auch Leutnant Kuhlmann erzählen. Sie stecken giftige Bambusspitzen in den Weg, verlegen denselben mit riesigen Hindernissen, die großen Aufenthalt verursachen, oder legen kleinere Hemmnisse an, so daß die Leute fallen oder mindestens stolpern; ferner machen sie in die Urwälder und Pori große Sackstraßen, so daß man falsch geht; auch Graf Fugger weiß davon ein Liedchen zu singen.
23. Mai 1897.
Tom zog mit 1000 Wahehe aus, Leuten, die früher alle gegen uns standen. Kaum war er fort, so wurde in der Nacht Luhota von Quawa selbst und seinen Wahehe abgebrannt, 600 Stück Vieh und 700 bis 800 Weiber geraubt, die Männer niedergemacht. Quawa hat in der Nacht die Temben alle umstellt und, als die Männer herauskamen, sie einfach alle niedergemacht. Noch am Morgen sahen wir die Temben rauchen, es war ja nur eine halbe Stunde von der Station! Bei dem hügeligen Terrain und dem ausgedehnten Pori sind sie ohne Weg und Steg, von dem langen Grase verdeckt, herangeschlichen. Der Feldwebel wurde gleich nachgeschickt, da er aber nur sehr wenige Askaris hatte und die Leute gleich verteilen mußte, konnte er nur 90 Weiber und 40 Stück Vieh wiederbringen. Vieh, welches die Wahehe nicht mitnehmen konnten, haben sie niedergestochen; Merkel ist wohl an 80 Stück totem Vieh vorbeigekommen. Unter den fortgeführten Weibern ist auch eine von Farhenga, die unten gerade Chakula kaufte, und alle von dem Jumben Satima, diese hat Quawa direkt in sein Gefolge genommen. Eine von den Frauen des Satima hat sich bei der Verfolgung hinter einem Busch versteckt und sich so wieder zu uns retten können, sie erzählte, daß Quawa selbst bei dem Überfall im Hintergrunde[S. 114] gewesen sei und alles von dort dirigiert habe. Nachdem der Überfall geglückt, habe er sich in eine Tembe gesetzt und dort Pombe getrunken, die gefangenen Weiber um ihn. Von dort habe er auch seine Befehle im Fall einer Verfolgung gegeben. Parole: „Wenn ein Europäer verfolgt, ausreißen; verfolgen nur Askaris und Wahehe, dann angreifen!“ Die Furcht vor einem direkten Kampfe mit den Europäern ist gottlob groß. Die Wahehe wissen sehr wohl, daß sie ihre Zahl schonen müssen. Quawa selbst ist dann an der Spitze mit ein paar Getreuen und den genannten Weibern abgezogen. Seine Leute haben sich auch zerstreut. Tom schickt jetzt jede Nacht Patrouillen aus, um eine etwaige Annäherung des Feindes zu verhindern. — Ohne Bedeckung kann man jetzt nicht aus der Boma gehen, denn 5 Minuten von unserem Hause entfernt sind eine Frau und ein Fundi niedergestochen worden. Die letzten Tage hatte ich immer Angst, daß auch die Strohbude mit unseren Vorräten angezündet würde. Nun gottlob, Quawa hat die Gelegenheit verpaßt.
Die Nacht zum 1. Juni schlief ich zum ersten Male in unserem neuen Hause. Gerade ein Jahr, daß ich kein festes Dach, sondern immer nur Strohwände oder Zelt über mir hatte. Seit einem Jahr wieder einmal auf Holzdielen zu gehen, wenn auch noch so primitiven, ist ein Genuß! Jeder Schritt machte mir Vergnügen! Wenn mir nicht das Treppensteigen verboten wäre, würde ich aus Freude fortwährend herauf und hinunter gegangen sein. Wie ich stolz auf meine Treppe bin. Die Seligkeit, hoch zu wohnen! mit welcher Freude schließe ich Türen und Fenster; es ist mir alles noch so neu, ich möchte immer am Fenster stehen. Auch diese Freude ist afrikanisch! Ich freue mich schon auf Tom und seine Freude über unser stattliches Haus. Die Salzbäder, die ich nehmen soll, muß ich natürlich aussetzen. Der Doktor schilt; aber freilich, wenn es nach ihm ginge, so müßte ich stets liegen, und aus dem Umzug kann dann werden, was will. So haben die Boys wohl auch gedacht, denn nicht nur Mpischi, der schon seit Ostern liegt, sondern auch Mabruk ist schleunigst so krank geworden, daß er fort mußte, er bekommt aber natürlich[S. 115] seinen Lohn weiter, nun habe ich zum Umzuge nur einen Boy. Schammy, der kleine zehnjährige Bengel, ist mein Koch, seine Leistungen sind auch danach. Die kleinen Mädels müssen jetzt auch so helfen, daß sie ganz blaß aussehen, sie sind mir jetzt eine große Hilfe. Die drei Weiber, die ich noch habe, müssen buttern, Hühner besorgen, Geschirre waschen, sind sonst aber kaum zu gebrauchen. Denn sie verstehen kein Suaheli und vor allen Dingen wissen sie von keinem Gegenstande, wozu man ihn gebraucht, und diese Frauen habe ich jetzt schon vier Monate. Die schweren Sachen haben mir Träger herübergetragen, doch das ist ja das wenigste. Freilich klappt noch längst nicht alles, die Türen besonders bedürfen noch mancherlei Nachhilfe, ehe sie richtig schließen, ein Fenster hatte noch keinen Haken, so daß der Wind es gleich zerbrach usw.; überall sind noch Fundis tätig. Die Wohnung war zuerst hoffnungsgrün gestrichen; damit meine Vorhänge, Portieren usw. mit dem Anstrich harmonieren, habe ich sie jetzt noch einmal anstreichen lassen, und zwar rosa, — eine andere Farbe hatten wir nämlich nicht, es wird jetzt aber sehr niedlich. Nur kann ich mir Tom mit seinem Rauchen nicht so recht in diesem zarten Milieu vorstellen. Nun sind noch Gardinen zu nähen und aufzustecken, denn am 1. Juli kommt der Gouverneur nun wirklich; er hat sich schon angemeldet, und da möchte ich doch mit allem fertig sein. Wenn wenigstens der Mpischi bis dahin gesund würde.
Der Gouverneur will sich den Boden und die Ansiedlungsverhältnisse hier ansehen.
2. Juni 1897.
Heute sah ich mich nach meinen kleinen Schützlingen um, zwei kleine Askarikinder, denen die Mutter gestorben und deren Vater auf einer Expedition geblieben ist. Das eine Kind ist erst ein halbes Jahr alt und bekommt jetzt von meiner Kuhmilch, das andere ist schon zwei Jahre alt; sehr niedliche Kleine sind es, leider haben sie Angst vor mir. Von dort ging ich zum Griechen, um Petroleum zu kaufen, er wird aber erst in sechs Wochen[S. 116] welches erhalten; hoffentlich reicht mein Vorrat noch so lange. Dann ging ich zur Bibi (Frau) Effendi, um mich für Eier und ein seidenes Taschentuch zu bedanken; letzteres wollte ich nicht annehmen und schickte es zurück, aber sie schickte es abermals wieder, und um sie nicht zu beleidigen, behielt ich’s, werde ihr wohl eine Uhr dafür zurückgeben, aber erst nach ein paar Tagen, denn sonst nimmt sie es übel.
Wenn ich doch wenigstens ganz gesund wäre. Alle Tische für die Küche müssen auch erst gemacht werden, denn die ich bis jetzt in der Strohhütte hatte, sind in dem Boden festgemacht und beim Herausnehmen sind sie entzweigegangen; es waren allerdings nur Kistendeckel. Nun soll ich mich wieder schonen und Salzbäder nehmen, aber wann? In Kürze kommt der Gouverneur, und in solcher Zeit geht alles drunter und drüber. Dann bin ich Köchin, Dienerin und Hausfrau, d. h. ich repräsentiere deutsche Küche, Keller, Speisesaal und Salon hier alles in höchsteigener Person, so gut das eben hier, fern jeder Kultur, unter den schwarzen Menschenkindern sich tun läßt.
25. Juli 1897.
Nach langer Pause komme ich wieder einmal zum Schreiben. Eine Zeit voll Mühe und Arbeit liegt hinter mir, in die auch der Tod seine düsteren Schatten warf. Aus der Heimat kam eine mich bewegende Todesnachricht — und hier stand ich an der Bahre eines treuen Mitarbeiters, der auch mir so oft in schwerer Zeit mit Rat und Tat beigestanden: Zahlmeister Winkler starb am Abend des 7. Juni, des Pfingstmontags. Als Graf Fugger mir am 8. früh die Nachricht brachte, war ich tief erschüttert — zum erstenmal trat der Tod hier in Afrika in so ergreifender Weise in mein Leben.
Graf Fugger hatte das Zimmer mit Palmen geschmückt, und ich brachte, was ich an Blumen auftreiben konnte, so daß wir unserem entschlafenen Landsmann die letzte Ruhestätte wenigstens nach heimatlicher Sitte würdig schmücken konnten. Das Fieber hatte den stattlichen, blühenden Mann in wenigen Tagen furcht[S. 117]bar mitgenommen, elend und verfallen, aber mit dem Ausdruck friedlicher Ruhe lag er auf seinem Bette. In Perondo hatte er einst den Wunsch ausgesprochen, — wir sprachen gerade über das Sterben — dereinst ohne Bewußtsein ins Jenseits hinüberzuschlummern — wie bald hat sich dieser Wunsch erfüllt! Ohne Bewußtsein ist er aus dem irdischen Leben in die Ewigkeit eingegangen.
Um 3 Uhr setzte sich der Leichenzug in Bewegung, voran die Kompagnie mit der Musik, dann der von zwölf Askaris getragene Sarg und der Boy des Verstorbenen mit einem schwarzen Kreuz, welchem wir wenigen Europäer folgten. Am Grabe bildete die Kompagnie Spalier, der Sarg wurde heruntergelassen und mit Blumen und Palmenzweigen bedeckt. Graf Fugger[6] widmete dem jungen Landsmann und treuen Kameraden, der nun fern der deutschen Heimat sein Grab gefunden, herzliche Worte, darauf sprach Pater Ambrosius ein Gebet — und die Trauerfeier war zu Ende. Die Kompagnie rückte nach soldatischer Art unter fröhlichen Marschweisen ab, und wir gingen schweren Herzens still nach Hause. „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende!....“ Feldwebel Merkel beaufsichtigte die Arbeiter, die den Grabhügel aufhöhen und einzäunen. Winkler, der erst vor einigen Tagen von einer Expedition zurückgekehrt war, hatte sich[S. 118] den Keim zu diesem Fieber auf dem Rückmarsche mit Merere von Usafua an derselben Stelle am großen Ruaha geholt, an welcher früher einmal auch Tom und Graf Fugger daran erkrankt waren.
Noch nie hat mich Schwermut und Sehnsucht so gepackt wie an diesem Begräbnistage. Ich hielt es zu Hause nicht aus, die Einsamkeit trieb mich hinaus auf die Straßen; wie beneidete ich die Schwarzen, die in ihrem harmlosen Frohsinn so vergnügt in den Hütten herumhockten, wie sehnte ich mich in dieser traurigen Stimmung nach meinem Mann, schon die schlichte Frage eines Askari-Wachtpostens nach des bana mkubwa („großen Herrn“) und meinem Befinden, klang mir in meiner Einsamkeitsstimmung wie ein verheißungsvoller Gruß. Als ich von meinem Rundgang nach Hause zurückkam, fand ich einen Boten vor mit einem Briefe von Tom! In welcher Gefahr hatte mein Mann in dieser Zeit geschwebt. Der Brief berichtet ausführlich über seine Expedition; ich werde Toms eigene Worte hierher setzen:
(Aus Toms Brief vom 5. Juni 1897, zwei Stunden vom Muassi-See.)
„... Schlaflosigkeit und Erkältung behindern zwar sehr den fröhlichen Gedankenfluß, und meine Sitzgelegenheit — der Stuhl ist beinahe so hoch wie der Tisch — trägt auch nicht zur Bequemlichkeit bei, aber die komische Geschichte muß ich Dir doch noch erzählen:
Am 3. Juni stellte ich fest, daß die Bewohner einiger dicht bei Leutnant Foncks Lager gelegenen Temben sich in den Felsenhöhlen versteckt hielten. Dort hielten sie sich für sicher, denn weder andere Wahehe, noch viel weniger irgend ein anderer Neger würde ihnen in ihre Höhlenverstecke folgen. Die Gelegenheit war mir gerade recht, den Wahehe einmal zu zeigen, daß wir sie auch aus diesen, ihnen für absolut uneinnehmbar geltenden Felshöhlen herausholen. Ich nahm also Unteroffizier Schubert mit einigen Askaris sowie eine Anzahl Wahehe mit, letztere als Zuschauer und Augenzeugen. Nach sechsstündigem Marsche kamen wir an eine Felsenschlucht, in deren Klüften die Flüchtigen sich[S. 119] verborgen hielten. Sofort kam Leben in die ganze Sache, wie vor einem Kaninchenbau huschten die schwarzen Gestalten hin und her, zu schnell, um in der kurzen Zeit des Sichtbarseins von unseren Leuten scharf genug aufs Korn genommen zu werden. Eine der Höhlen, in welcher ich einen Mann verschwinden sah, beschloß ich, genau zu untersuchen. Sie war, wie sich bei näherer Besichtigung ergab, am Eingang etwa einen halben Meter weit und zweigte sich in etwa zwei Meter Tiefe nach rechts und links ab. Ich stellte einen Posten an den Eingang und suchte weiter. Aus dem nächsten Felsenloche, welches einen etwas bequemeren Eingang hatte, stöberte ich mit einigen Askaris gegen 30 Weiber und Kinder auf, die sich in den einzelnen Gängen versteckt gehalten. Das Geschrei der Aufgeschreckten und das Gebrüll meiner Leute in dem dunkeln Labyrinthe von Gängen da unten hatte übrigens doch etwas Unheimliches. In die nächste Höhle, die wir absuchten, trauten sich meine Askaris nicht hinein, es war ihnen zu dunkel — auch hatten wir sichere Zeichen, daß hier Weiber und Kinder versteckt lagen. Kaum war ich in den Eingang getreten, als mir von links her ein Speer scharf an der Brust vorbeisauste und klirrend an die Felswand schlug, zugleich bohrte sich zwischen meinen Füßen hindurch ein zweiter Speer in den Moderboden. Der Hausherr war also bereit, uns zu empfangen. Etwas oberhalb hinter mir stand ein Händler aus der Stadt, der sich freiwillig angeschlossen hatte — ein dritter Speer, der direkt von vorn kam und mir den Helm abriß, traf ihn in die Seite. Mit einem Satze war mein „Freiwilliger“ raus aus dem Loch. An seiner Stelle erschien nun aber oben mein Boy Juma, der mir voll Angst zuschrie, ich möchte mich doch ja recht gut decken. So vernünftig war er aber doch, daß er mir ein Gewehr herunter warf. Wie aber in der pechschwarzen Finsternis zielen? Zunächst deckte ich mich hinter einem Felsblock, damit meine Silhouette den im sichern, dunkeln Hintergrunde stehenden Speerschützen nicht allzudeutlich gegen die vom Eingange aus durchs Tageslicht beleuchtete Felswand sichtbar würde. Dicht hinter meinem Verstecke höre ich ein gleichförmiges Schaben und[S. 120] Knirschen — Tschirr! Tschirr! — da sitzt ein Kerl und schärft seine Speere. Ich schoß nach der Richtung hin, freilich ohne zu treffen, zugleich bemerkte ich aber dicht hinter mir ein tiefes Loch, dessen Boden ich mit einem Speere nicht erreichen konnte. Ein Speerwurf von da unten hätte voraussichtlich die Folge gehabt, daß ich auf meinem bereits geschilderten hochbeinigen Schreibsessel jetzt noch unbequemer sitzen müßte, und da aus der Finsternis vor mir wieder ein Speer über den Kopf weg gegen die Felswand klirrte, konzentrierte ich mich für diesmal mit erheblicher Geschwindigkeit nach rückwärts, nachdem ich noch durch einen Schuß ins Dunkle über den warmen Empfang quittiert hatte. So kam ich nicht zum Ziel. Ich ließ also Grasfackeln binden, hieß einige Askaris Schild und Speer nehmen, ebenso den schneidigsten meiner Wahehe, und drang mit ihnen wieder in die Höhle — sofort saß dem Wahehe ein Speer in der als Deckung vorgehaltenen Matte. Nun ließ ich zum Angriff blasen, die brennenden Grasfackeln wurden in die Gänge geworfen, und ich trieb meine Askaris, die wie die Wilden brüllten, vorwärts. Auf diese Weise säuberten wir eine ganze Anzahl dieser „uneinnehmbaren“ Schlupflöcher und förderten eine Menge Weiber und Kinder ans Tageslicht. In der ersten Höhle wurde ein Mann getötet, vier gefangen, zwei entkamen.“
Ich muß offen gestehen, daß mich beim Lesen solcher Geschichten doch ein Grausen ankam, wenn ich mir die näheren Umstände dieses kleinen Scherzes ausmalte.
Der 9. Juli war ein Glückstag! Ich war gerade dabei, im Wohnzimmer die letzten Gardinen aufzustecken, als meine Muhigu angerannt kommt: „Bana mkubwa!“ Ich dachte, es käme irgend ein Europäer, die die Muhigu uns wie üblich als „großer Herr“ anmeldete, und wollte eiligst ins Schlafzimmer, um mir die Haare aufzustecken, die ich heftiger Kopfschmerzen wegen offen trug, da lag ich aber schon in den Armen Toms, der der Muhigu auf dem Fuße gefolgt war! Vor freudigem Schreck schrie ich laut auf.
Und als ob es für einen Tag nicht Glücks genug wäre, kam am Nachmittage auch noch die langersehnte Post. Einige Tage[S. 121] konnte Tom sich erholen, die Strapazen der letzten Expedition hatten ihn doch sehr mitgenommen, und auch ich ließ alle Arbeit ruhen, um seiner Pflege mich ausschließlich widmen und mich seiner Gegenwart wieder einmal ungestört erfreuen zu können. Als Reiseerinnerung brachte er mir die Felle und Köpfe zweier prächtiger Giraffen und eines Zebras mit, die er unterwegs geschossen hatte, eine Anzahl eigenartig roter Perlen, die die Weiber hier als Schmuck tragen, und ein schönes Leopardenfell, aus dem ein Wahehekrieger sich einen „Kriegsmantel“ zurechtgeschneidert hatte — alles Gegenstände, die sich als malerischer und vor allem stilechter Wandschmuck verwerten lassen.
Nach einigen Tagen der notwendigsten Erholung begann wieder „des Dienstes ewig gleichgestellte Uhr“ ihr regelmäßiges Tick-Tack — Schauris von morgens bis abends. Nur eine Stunde, vom Abendsignal bis zum Abendbrot, wurde dem Krocketspiel gewidmet, an dem Graf Fugger wieder eifrig teilnahm; während Toms Expedition hatte er täglich, soweit es sein Dienst erlaubte, mir Gesellschaft geleistet und mich zu Spaziergängen abgeholt. Und wie jede gute Tat ihren Lohn erhält, so auch hier; denn der Auftrag, dem Gouverneur entgegenzuziehen und ihn an der Grenze von Uhehe zu begrüßen, erfüllte den lebenslustigen jungen Offizier mit heller Freude; hatte er doch nach langer Zeit einmal wieder Gelegenheit, deutsche Kameraden zu begrüßen.
Bei uns brachte währenddessen jeder Tag seine besondere Abwechselung. Zuerst wurde Farhenga krank, und zwar so plötzlich, daß man auf eine Vergiftung schließen mußte; dieser Verdacht liegt hier sehr nahe, denn Gift und Selbstmord sind bei unseren schwarzen „Großen“ an der Tagesordnung. Dann aber brachte sich Quawa wieder in Erinnerung: als Tom eines Tages vom Schauri nach Hause kam, erzählte er mir, — so ganz nebenbei, es schien ihm nicht besonders nahe zu gehen — es sei ihm gemeldet worden, Quawa habe zwei Wanyamwesi-Leute von der etwa eine Stunde von uns entfernten und uns freundlich gesinnten Ansiedelung gegen hohe Belohnung gedungen, Tom bei nächster Gelegenheit zu ermorden. Mein Mann schickte natürlich eine[S. 122] Patrouille, die die beiden Biedermänner nach ein paar Tagen auch richtig einlieferte. Mein Haushalt erhielt einen Zuwachs in Gestalt eines etwa vier Tage alten kleinen Zebras, es ging aber trotz aller Pflege schon nach drei Tagen ein; nicht einmal photographieren konnte ich das niedliche Tierchen, denn ich lag gerade an jenen Tagen wieder mal fest. Eine Sendung Apfelsinen kam mir damals gerade recht gelegen. Sie hatten nur den bittern Nachgeschmack, daß jede einzelne Frucht durch den Trägerlohn auf eine halbe Rupie (70 bis 90 Pfennig) zu stehen kommt. Wie gute Dienste würde mir jetzt die Eismaschine leisten, aber gerade jetzt versagt sie, die Gummiringe schließen nicht fest genug. Auch eine unserer großen Demijeon-Flaschen kam zerbrochen an, von denen je zwei von einem Träger getragen werden. Das läuft ins Geld: seitdem wir hier sind, haben wir schon 247 Träger gehabt, pro Mann 21 Rupien!
Da ich gerade von unseren Landplagen schreibe, darf ich auch Mereres Freund, den Araber Jemadari, nicht vergessen. Er gehört zu den „Großen“, also kostet mich die Ehre seines Besuches täglich das ortsübliche Gastgeschenk, das jeder bekommt, der sich persönlich nach dem Befinden seines Sultans erkundigt — und das ist Tom für sie. Zum Glück geht dieser teure Gastfreund nach Iringa, wo er als Wali eingesetzt werden soll; auf die Dauer hätten meine Fruchtsaft-, Öl- und andere Vorräte diese täglichen Opfer auf dem Altar der Gastfreundschaft nicht mehr leisten können.
Die hohen Trägerkosten sind das schwierigste Hindernis, das einer regelrechten Kolonisierung im Wege steht: wie sollen sich unsere deutschen Unteroffiziere, auf die man doch in erster Linie mit rechnen könnte, hier eine eigene Familie begründen: die einfachsten Lebensbedürfnisse, ohne die man einer deutschen Frau den Aufenthalt nicht zumuten kann — von irgendwelchem, auch dem allerbescheidensten Luxus ganz abgesehen — würden an Trägerlohn mehr erfordern, als ein Unteroffizier von seinem Gehalt aufwenden kann. Es ist ein Jammer, daß sich für dieses herrliche, fruchtbare Gebirgsland von Uhehe kein deutscher Unternehmungsgeist mobil machen läßt. Deutsche Bauern, die selbst Hand anlegen, fänden[S. 123] hier Gelegenheit, ein reiches Gebiet dauernd der Kultur zu gewinnen. Wir haben in Iringa Versuche mit europäischen Feld- und Gartenfrüchten gemacht, die zu den besten Hoffnungen berechtigen. Bedingung für das Gedeihen einer Kolonisation im größeren Maßstabe ist natürlich die Erschließung der natürlichen Zugangsstraßen nach der Küste, zunächst also der wasserreichen Flüsse Kihansi und Ulanga, ferner die Anlage einer festen Straße zur Umgehung der die Bootsfahrten hindernden Stromschnellen — doch halt! die Phantasie „beflügelt meinen Kiel“ — sie erhebt ihre Schwingen sogar bis zu dem kühnen Bilde einer — Schmalspurbahn, die von Ngahoma am Ulanga aus diesen Fluß mit dem Rufidji verbinden müßte!
Wie dicht übrigens unsere Leute an Quawa heran waren, erzählte der Sohn des Jumben Chetamaruru, der von dem Sultan bei Luhota gefangen, ihm aber später im Pori glücklich entkommen war. Diesem Berichte nach sei Dr. Stierling ganz nahe an dem Busche vorbeigezogen, in welchem Quawa mit seinen Gefangenen sich versteckt hatte. Um die Verfolger auf falsche Fährte zu locken, hatte der alte Fuchs seine Weiber nach einer andern Richtung abziehen lassen und freute sich nun im Busche über das Gelingen seiner Kriegslist. Er hätte aber sicherlich keine Freude erlebt, wenn er mit dem schneidigen Doktor zusammengetroffen wäre.
Mit meinen Leuten hatte ich erst recht viel Ärger. Die Frauen, die sich bis jetzt bei mir tüchtig herausgefuttert hatten, sollten nun beim Umzug helfen; das war nun nicht nach ihrem Geschmack — sie drückten sich einfach. Schammy rauchte Haschisch und versuchte in seinem Delirium, seinen Kollegen Humadi zu erschießen; der schlug aber zum Glück noch den Gewehrlauf nach oben, so daß der Schuß in die Decke ging. Auf diese Weise kann man noch einmal vom eigenen Hausboy über den Haufen geschossen werden. Als er gefesselt werden sollte, entwickelte der Bengel Riesenkräfte, zerschlug alles, was ihm unter die Fäuste kam, und verschwand schließlich im Pori. Dort fanden ihn nach zwei Tagen einige Askaris zwischen den Steinen hockend, hungrig, zitternd — mit einem Mordskater! Natürlich war er sehr ge[S. 124]knickt, als sie ihn mir anbrachten, und bat de- und wehmütig um Verzeihung. Die Unglückspfeife habe ich vor seinen Augen zerschlagen und verbrannt. Unter diesen Umständen hatte ich bei der großen Arbeit nur noch Humadi und die Totos (Kinder), da ich auch Sitamira auf Knall und Fall entlassen mußte — sie war zu hübsch — leider aber auch ebenso leichtsinnig. Der einzige Lichtblick in dieser Zeit voll allerlei Verdruß war die Rückkehr meines Koches, der gerade noch kurz vor Ankunft des Gouverneurs aus dem Lazarett entlassen wurde. Ich mußte ihn zunächst mit Wein und Milch aufpäppeln, da er noch sehr klapperig war, er hat mir aber doch nach besten Kräften geholfen; wußte ich doch wirklich manchmal nicht, wo mir der Kopf stand, bei all den tausenderlei Vorbereitungen — die Herren sollen nach ihren anstrengenden Märschen einmal wieder die Empfindung haben, in ein deutsches Haus zu kommen.
Der Gouverneur hatte sich für den 11. Juli angemeldet. Tom wollte ihm einen Tagemarsch entgegenziehen und brach am 10. auf. Ich war eben dabei, unsere Schlafzimmer für den Gouverneur als Wohnung einzurichten, als Juma, den Tom mitgenommen hatte, atemlos angestürzt kam: „In einer Stunde ist der Gouverneur da!“ Er hatte den Marsch über Mage genommen und traf nun einen Tag früher ein, als wir ihn erwarteten! Also reingefallen mit all meinen Vorbereitungen, und ich hatte mir doch alles so schön ausgedacht. Zunächst weinte ich vor Ärger über das Mißlingen meiner schönen Küchen- und Tafelpläne — dann ging’s aber um so flinker. Leberwurst und Sülze konnte ich den Herren nun freilich nicht zum Frühstück vorsetzen, und die Wildtauben, die es zu Mittag geben sollte, flogen noch lustig und lebendig umher, so mußte ich Gang für Gang von meinem kunstvoll zusammengebauten Menu streichen. Zum Glück traf der Gouverneur erst gegen 1 Uhr mittags ein, so daß er sein Wohnzimmer fix und fertig vorfand.
Zum Frühstück konnte ich unseren Gästen nur eine Kalbskeule vorsetzen, dazu allerlei kalte Speisen und Konserven, auch zu einer Bowle hatte ich noch Zeit gefunden. Abends tafelten wir nach[S. 125] festlichem deutschen Zuschnitt; meine Fleischpastetchen fanden vielen Beifall, desgleichen der Plumpudding. Daß die Europäer „brennende Speise“ essen, wurde von der schwarzen Bedienung und ihrem Anhang mit offensichtlichem Staunen beobachtet. Zu Ehren des Gouverneurs hatten wir ein großes Festprogramm aufgestellt. Fackelzug, Kostümfest und verschiedene andere Kurzweil, die Herren hatten aber so viel zu tun, daß es beim guten Willen bleiben mußte.
Der Gouverneur war erstaunt und erfreut über die militärische Haltung der Wahehe, die am 17. Juli hier für einen neuen Quawa-Zug unter Führung ihrer Jumben auf der Station antraten. Tom hatte, wie er vorausgesetzt hatte, wirklich 1300 Wahehe und 300 andere Neger für die Station zusammengebracht.
Nachmittags 4 Uhr brach der Zug auf, am 20. standen sie bereits dicht bei Quawas Kriegslager; leider war ihr Angriff ohne das gewünschte Ergebnis; als der Gouverneur und Tom mit der 6. Kompagnie den steilen Berg, ohne auf Widerstand zu treffen, erstiegen hatten, fanden sie das Negerdorf sowohl wie das Kriegslager verlassen, nur einige Nachzügler wurden noch abgefaßt, die über die Besetzung des Lagers durch Quawa Auskunft gaben — der Biedermann hatte, als er acht Europäer an der Spitze der Angreifenden zählte, die günstige Stellung aufgegeben und die sichere Deckung im Pori dem immerhin zweifelhaften Ausgange eines Verteidigungskampfes vorgezogen. Ich bin ihm persönlich dafür dankbar. Das Lager war auf der Spitze einer aus einem tiefen Talkessel terrassenförmig sich aufbauenden Kuppe angelegt, die dem Angreifer nicht die geringste Deckung gewährte, so daß die den Hang erklimmenden Truppen bequem Mann für Mann von der Höhe aus aufs Korn genommen werden konnten. Wer weiß, wer von den Herren nicht dort den Angriff mit dem Leben bezahlt hätte!
27. Juli 1897.
Gestern abend, kurz vor Schlafengehen, brachte mir ein Wachtposten noch einen langen Brief von Tom. Aber anstatt der erwarteten Nachricht seiner baldigen Rückkehr lese ich, daß die[S. 126] Expedition sich wohl über vier Wochen ausdehnen wird. Sie waren bereits dicht an Quawas Lager heran, und nun suchen sie möglichst auf seine weiteren Spuren zu kommen. Das sind für mich recht böse Aussichten, denn nun ist der glückliche Wahn gründlich zerstört, daß dies unsere letzte längere Trennung gewesen sei. Tom schreibt, der Gouverneur sei sehr erfreut über die gute Disziplin der Wahehe, über das Nachrichtenwesen und die gute Laune, die trotz des zwölfstündigen Marsches in der schwierigen Gebirgsgegend bei den Leuten herrscht. Der Gouverneur wird sich dann von Tom trennen, um noch weiter die Bodenverhältnisse auf ihre Ansiedelungsfähigkeit zu untersuchen. Soweit bis jetzt zu übersehen ist, eignet sich das Land ganz hervorragend zur Besiedelung, und Oberst Liebert will die Kolonisation nach Kräften beschleunigen.
Heute beehrte mich der Sultan von Mahenga, mein alter Freund Kiwanga aus Perondo, mit seinem Besuch. Zu dieser Antrittsvisite hatte er sich 800 Leute aus Perondo mitgenommen, eine Vorsichtsmaßregel, die ich ihm eigentlich nicht verdenken kann; der schlaue Fuchs Quawa hatte ihm nämlich durch einen Msassagira-Boten sagen lassen, er solle sofort mit seinen Leuten sich Quawa anschließen, der Sakkarani (nämlich Tom) wolle ihn hängen lassen. Kiwanga hatte jedoch Vertrauen zu Toms früherer Zusage, er lieferte den Quawa-Boten an Leutnant Kuhlmann aus und machte sich auf den Weg zu uns; so ganz sicher schien er aber seiner Sache nicht zu sein, wenigstens mußte ich ihm immer und immer wieder versichern, daß Tom ihn nicht zu dem Zwecke herbestellt habe, um ihn hier aufzuknüpfen, und es gelang mir auch, sein Zutrauen vollständig zu festigen. Er bemühte sich dann noch eifrigst, mir den Hof zu machen; daß er dabei meinen Mann bis in den Himmel hinein lobte und pries, hielt er für das geeignetste Mittel, seiner Huldigung besonderen Nachdruck zu geben. Als Freund Kiwanga sich endlich empfahl, kam Pater Alfons zum Abendbrot, mit dem ich dann noch ein gemütliches Plauderstündchen hielt.
28. Juli 1897.
Pater Alfons kam heute zum Frühstück. Dann machte ich einige photographische Aufnahmen von Kiwangas Leuten. Ihn selbst photographierte ich vor seinem Zelt, mit seinem Tisch, Stuhl, Flasche, Glas und Teller; auf seine europäische Zelteinrichtung ist er nämlich sehr stolz. Beim Griechen hatte er sich soeben einen eleganten Anzug und neue Schuhe gekauft, da ihm seine Safari-Garderobe für die Station nicht mehr ansehnlich genug erschien. Als ich mein Bad genommen und die verordneten Umschläge gewissenhaft erledigt hatte, ließ ich mir von Kiwanga und seinen 800 Kriegern ihre ngoma (das Wort bedeutet sowohl „Trommel“ und „Musik“ wie auch „Tanz“) vorführen, zuerst den Kriegstanz der Mafiti, dann den der Wahehe. Kiwanga ist reiner Mhehe, sein und Quawas Vater waren rechte Vettern, deren Feindschaft auch auf die Söhne forterbte.
Es war ein interessantes Schauspiel, die 800 wilden Kerle in der ganzen Eigenart ihrer heimischen Kampfweise diese Kriegsspiele, denn auf die Darstellung eines Angriffes läuft die ganze Sache hinaus, vor mir manövrieren zu sehen. Ich muß gestehen, daß es mir doch eine gewisse Verlegenheit bereitete, vor dieser ganzen Menschenmenge als die Bibi mkubwa, die „große Frau“, gefeiert zu werden, besonders da Kiwanga an der Spitze seiner Leute mir seine Huldigung erwies. Der Sultan führte die ganze Sache selbst und tanzte und sprang mit einer Gewandtheit und einem feierlichen Ernst, der in den europäischen Kleidern etwas unsagbar Komisches hatte. Erst als die neuen Schuhe, die auf derartige Kriegsstrapazen nicht geeicht waren, ihm an den Füßen zerplatzten, und seine Leute von dem tollen Rennen und Brüllen erschöpft waren, ließ er mich durch den Effendi um die Erlaubnis bitten, das Kriegsspiel beenden zu dürfen. Ich ging nun zu ihm und bedankte mich für das schöne Schauspiel, worauf er mit seiner Kriegerschar sehr befriedigt abzog. Daß die ganze Stadt sowie unsere Askaris mit Weibern und Kindern als Zuschauer versammelt waren, versteht sich von selbst, eine „große Parade“ wirkt immer und überall „aufs Zivil“.
Als besonders komischen Zwischenfall muß ich noch die Heldentat meiner beiden Hunde Schnapsel und Pombe erwähnen. Mit wütendem Gebell fuhren sie einem der Mafiti, der ihnen etwas zu nahe gekommen war, in die Beine und verfolgten ihn unter dem Gelächter der Zuschauer weit über den Plan. Es gelang mir nur schwer, ihren kriegerischen Sinn wieder soweit zu dämpfen, daß sie von der Verfolgung abließen, dann setzten sie sich aber mitten auf den Platz, gleichsam als die Angriffsobjekte des ganzen Manövers, und beobachteten mit mißtrauischem Ohrenspitzen jede Bewegung ihrer Feinde, entschlossen, nur der Übermacht zu weichen.
Abends kam Kiwanga, um Abschied zu nehmen; er wird morgen in aller Frühe abmarschieren, um sich mit seinen Leuten Tom anzuschließen. Er bat mich, ihm einen Brief an meinen Mann mitzugeben, was ich denn auch tat. Der schwarze Bundesbruder hat mir doch viel Zerstreuung geboten, und das hat mir gerade in diesen Tagen recht wohl getan, es blieb mir nur wenig Zeit, meinen trüben Gedanken nachhängen zu können. Besonders erbaulich war nun freilich nicht alles, womit mein Gastfreund mich zu unterhalten suchte; so schilderte er mir recht anschaulich, daß sein Bruder Sagamaganga zehn von seinen jungen Weibern aufgehängt und sich dann selbst vergiftet hat. Beweggrund auch hier: Cherchez la femme. Ich habe diesen Sagamaganga, der einer der mächtigsten Sultane zwischen Mahenga und Schabruma war, zusammen mit seinem Bruder Kiwanga auf einer Photographie, er war ein auffallend stattlicher, hübscher Neger.
29. Juli 1897.
Heute früh marschierte Kiwanga mit seinen Leuten ab. Nachmittags kam Dr. Stierling aus Idunda zurück, er hat dort Leutnant Fonck behandelt, der an Malaria erkrankt war, sowie einen augenleidenden Unteroffizier. Den Besuch in Idunda hatte Dr. Stierling um 14 Tage verschieben müssen, da er hier den Bauleiter Hentrich, der krank von der Küste ankam, nicht ohne ärztliche Behandlung lassen konnte; jetzt hat sich Herr Hentrich einigermaßen erholt; er sieht schon viel wohler aus wie bei seiner Ankunft von der Küste. Wie es in Idunda steht, werde ich wohl morgen von Dr. Stierling erfahren.
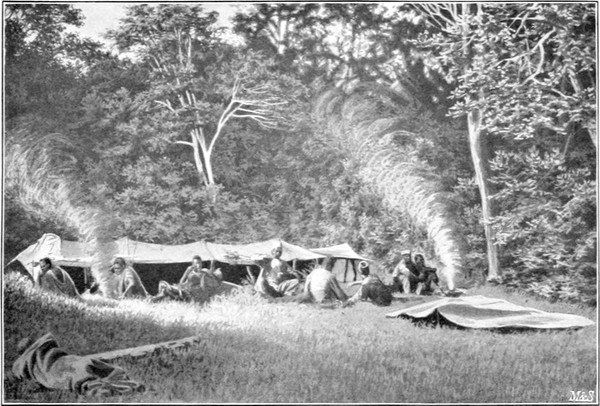
Lagerleben: Askarizelte.
(Zu S. 131.)
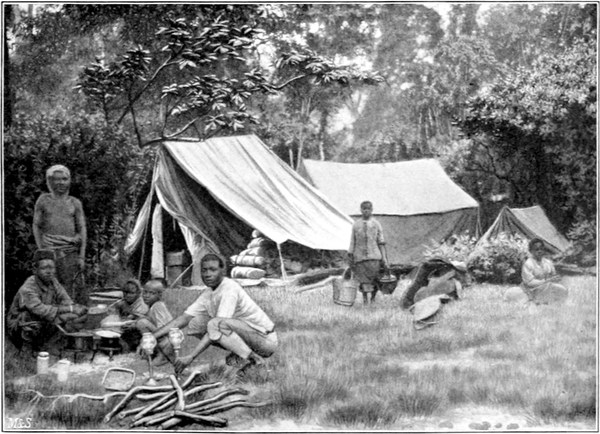
Lagerleben: Die Safari- (Reise-) Küche.
(Zu S. 131.)
3. August 1897.
Am 1. August kam Oberst Liebert zur Station zurück, mit ihm Herr v. Bruchhausen und Graf Fugger, während Tom die Expedition weiter leitete. Wenn auch der Zweck nicht erreicht war und unser Todfeind Quawa auch diesesmal wieder entkam, so sprach der Gouverneur doch seine Freude aus, jetzt auch den „afrikanischen“ Krieg praktisch kennen gelernt zu haben; wie Tom so hat auch er mit seinen Begleitern einen Höhlenkampf mitgemacht: er war an eine der Höhlen herangetreten, um die Insassen zum friedlichen Herauskommen zu bewegen, als ihm ein Schuß aus nächster Nähe entgegenkrachte. Der Geistesgegenwart seines Boys, der ihn zurückriß, hat der Gouverneur es zu verdanken, daß ihn die Kugel nicht traf. Eine solche unterirdische Kriegführung war ihm, wie er mir lachend erzählte, weder 1866 in Böhmen, noch 1870 in Frankreich vorgekommen.
In Tanangosi hatte sich unser Freund Kiwanga ihm angeschlossen und seine Krieger für den Quawafeldzug zur Verfügung gestellt. Jetzt war er wieder zurückgekehrt. Er schien sehr beglückt, daß der Gouverneur seine Leute gelobt habe, als er sie ihm truppweise „im Laufschritt“ vorgeführt hatte und ließ es sich nicht nehmen, seine Scharen nun auch im Kriegstanze zu zeigen, von dem ich dem Gouverneur viel erzählt hatte. Dabei wurde ich durch die unbewußte Galanterie eines dieser schwarzen Helden etwas in Verlegenheit gesetzt: anstatt vor dem Gouverneur kniete einer der den Reigen anführenden Wahehekrieger vor mir nieder; auf meinen Wink verbesserte er aber sofort diesen Irrtum und brachte dem Gouverneur seine Huldigung. Natürlich tanzte dazu auch diesesmal der Sultan höchsteigenbeinig an der Spitze seiner Leute; es mag dem Gouverneur nicht leicht geworden sein, angesichts dieser grotesken Figur in weißer Uniform mit Tropenhelm, die mit geschwungenem Säbel die unglaublichsten Luftsprünge aus[S. 130]führte, den nötigen Ernst zu bewahren. Diesesmal waren Kiwangas Schuhe übrigens der anstrengenden Übung gewachsen.
4. August 1897.
Heute verabschiedete sich der Gouverneur von uns, um den Rückmarsch nach der Küste über das Utschungwa-Gebirge anzutreten. Leutnant Passavant war nach Idunda gegangen, um dort die 3. Kompagnie zu übernehmen. Bezirksamtmann Zache blieb bei der 6. Kompagnie, die der Gouverneur nebst der 2. Kompagnie zur Verstärkung der Stationen in Uhehe für den Vernichtungskampf gegen Quawa hier gelassen hat. Nur Herr v. Bruchhausen kehrte wieder mit an die Küste zurück. Kiwanga und seine Krieger gaben ihnen das Geleite. Es waren schöne, frohbewegte Tage, die hinter uns liegen. Möchte dieser Zug des Gouverneurs durch das Gebirgsland Uhehe bald segensreiche Früchte für unsere neue Heimat tragen. Der Abschied war herzlich, Oberst Liebert sprach Tom seine Anerkennung aus für alles, was er hier geschaffen, und auch ich kam nicht zu kurz dabei als „erste deutsche Hausfrau im Innern von Deutsch-Ostafrika“. Der Gouverneur legte mir besonders dringend ans Herz, unter allen Umständen hier zu bleiben, wo wir unentbehrlich seien. Unentbehrlich??... Qui vivra verra!
17. August 1897.
Von Leutnant Stadlbaur erhielt ich eine zierlich als Brosche in Gold gefaßte Löwenklaue, von einem Löwen, den er hier geschossen hat; ich habe ihm für dieses hübsche afrikanische Geschenk heute schriftlich gedankt. Der Besuch des Gouverneurs bietet unerschöpflichen Gesprächsstoff, wir sitzen zuweilen bis spät in die Nacht hinein und leben die bewegten, ereignisreichen Tage noch einmal in der Erinnerung durch. Auch Graf Fugger leistet uns oft Gesellschaft. Gestern abend haben wir den neuen Zahlmeister und den neuen Pater „angefeiert“. Die Stimmung war deshalb besonders froh, weil aus Bueni gute Nachrichten eintrafen; die Bewohner kehren allmählich wieder in ihre Temben zurück.
Am 11. November 1897.
chwere Wochen liegen hinter uns, ich war sehr krank — am 18. August traten die ersten Anzeichen einer schweren schmerzhaften Leberentzündung auf, die mich wochenlang ans Bett fesselte. Gott sei Dank, es bildete sich kein Leberabszeß, so daß die gefürchtete Operation nicht nötig wurde. Allein die furchtbaren Schmerzen, die zeitweise kaum durch die vierzehn Tage lang regelmäßig angewandten Morphiumeinspritzungen bewältigt werden konnten, hatten mich sehr mitgenommen. Und mein armer Mann! Zu allen Sorgen und Lasten des Tageslaufs nun noch der einzige Pfleger seiner schwer kranken Frau! — Als ich wieder mich in Haus und Garten bewegen konnte, war Tom selbst so gründlich herunter, daß er notgedrungen einmal ein paar Tage ausspannen mußte.
Am 11. Oktober gingen wir auf Safari, d. h. wir zogen für drei Tage „auf Sommerfrische“ in die Berge. Das waren drei herrliche Tage, in denen kein Schauri, kein Dienst, kein Berichtschreiben unsere Ruhe störte. Unsere Askaris und Träger wurden stets nach dem jeweiligen Lagerplatz vorausgesandt, und wenn Tom und ich dann nach kürzerer oder längerer Wanderung durch die herrliche Landschaft ankamen, fanden wir Zelt und Kochplatz bereits fertig vor. Abends bot dann unser Ruheplatz ein besonders malerisches Bild; wenn sich die abenteuerlichen Gestalten unserer Begleitung um das hellodernde Wachtfeuer[S. 132] drängten. Für diese drei Tage war die unausgesprochene Losung: „pole pole“, d. h. ruhig, mit Bedacht! — keine Überstürzung — ganz im Gegensatz zu unseren sonstigen Safaris, wo meist alles Hals über Kopf gehen mußte. Aber so ein „take it easy“ hat doch seine großen Reize, man kommt erst eigentlich zum Bewußtsein der herrlichen Gotteswelt, in der wir uns bewegen; welche Farbenpracht der Vegetation, welche Mannigfaltigkeit der Linien, in denen Berg und Tal sich abheben, jeder Baum, jeder Felsen von anderer Form wie sein Nachbar, oft grotesk und allem mir bisher Bekannten spottend — und doch: welche Harmonie liegt über diesem Gesamtbild! Vor unserem Zelte ein frisch dahinströmender Gebirgsfluß, dessen Rauschen unwiderstehlich lockt, als Abschluß des Bildes die dunkle Wand des Urwaldes. Und dazwischen wir munteren Menschenkinder, die wir in dieser grandiosen Natur Erholung suchen nach sorgenvollen Tagen! Wahrlich, nirgends fühlt man sich seinem Schöpfer näher, als inmitten seiner gewaltigen Werke....
So großartig das Landschaftsbild auch war, es konnte doch die Erinnerung an unsern deutschen Wald nicht verdrängen. Ich habe vor Jahren einmal irgendwo in einer Reiseschilderung einen Vers gelesen: „Das starre Laub am fremden Holz, es ist zum Flüstern viel zu stolz“. In der Tat, das geheimnisvolle Leben und Weben, das Flüstern und Kosen der leicht beweglichen Blätter, das unserem lieben deutschen Laubwald eigen, ist dem Tropenwald fremd. Oberon und Titania mit ihrer luftigen, lustigen Elfenschar kann ich mir nur im Rauschen unserer Eichen und Buchen oder auf dem Moosteppich unserer dunkeln Tannenwälder vorstellen.
Am zweiten Tage unserer Safari fand ich Gelegenheit, in einem prächtig klaren Gebirgsfluß, der ausnahmsweise einmal kein felsiges, sondern sandiges Ufer hatte, ein erfrischendes Bad zu nehmen. Da mir das Gewässer in Bezug auf Untiefen, Stromschnellen und Wirbel unbekannt war, mußte ich meiner Lust nach einer längeren Schwimmtour Zügel anlegen; daß man hier während des Badens auf das Auftauchen eines „Kiboko“ (Nilpferd) gefaßt sein muß, erhöht den Reiz ganz wesentlich — unsere deutsche Schul[S. 133]jugend plätschert ja bekanntlich auch mit Vorliebe an den Stellen im Fluß herum, die durch eine Tafel: „das Baden ist an dieser Stelle streng verboten“ als besonders geeignete Badeplätze kenntlich gemacht werden, und ob man sich dabei schuldbewußt nach dem Flurschützen und Gendarm oder nach einem Kiboko umschaut, das ist — ohne jede anzügliche Beziehung zwischen heimatlicher Obrigkeit und afrikanischer Zoologie — schließlich doch ganz egal! Selten hat mir im Leben ein Frühstück so gut geschmeckt wie der Spickaal, den ich mir nach diesem Bade spendierte.
An demselben Tage kamen wir auch an Höhlenwohnungen vorüber, wie sie unsere Herren kürzlich aufgestöbert hatten; diesmal ging der Besuch aber friedlich ab. Von der Bergspitze aus bot sich ein prachtvoller Anblick über die im saftigsten Grün und farbigem Blütenschmuck prangenden Wiesenflächen im Tal, durchzogen von silberglänzenden Gebirgsbächen, dazu der frische, erquickende Bergwind, der uns die Lungen weitete und das Blut frischer durch die Adern pulsieren machte. Beim Anblick dieser Landschaft wurde das Geheimnis von Quawas unerschöpflichen Hilfsquellen offenbar: das Land ist so fruchtbar, daß an ein Aushungern nicht zu denken ist. Die Felder und Wiesen sind so reichlich bewässert, daß sie selbst im heißesten Sommer nicht unter der hier sonst gewöhnlichen Dürre zu leiden haben; in jedem der vielen kleinen Seitentäler, die oft nur schluchtenartig vom Gebirgskamm ausgehen, finden sich Bäche, deren Wasserreichtum das ganze Jahr hindurch aushält. Auf dem Rückmarsch konnte ich es mir nicht versagen, in eine jener Höhlen hineinzuklettern, die mir durch die Kämpfe im Juli besonders interessant geworden waren. Wie sah es da aus! Mir krampfte sich das Herz zusammen bei dem Gedanken, daß Tom unsere Feinde in solchen unterirdischen Gängen und Höhlen aufgesucht hatte, und ich dankte Gott, daß er ihn in dieser furchtbaren Gefahr beschützt hatte. Tom sprach freundlich zu den Bewohnern dieser Höhlenniederlassung, er hielt ihnen vor, was für ein elendes Dasein sie führten im Vergleich mit ihren Stammesgenossen, die unter dem Schutze der Deutschen wieder ihre Felder bebauen, erzählte ihnen, wie sie von dem gefürchteten[S. 134] Quawa weder etwas zu fürchten noch zu erhoffen hätten, und bewog sie, sich in der Nähe von Prinages Boma wieder anzubauen.
Wir hatten die Karawane vorausgeschickt und fanden unser Zelt beim Eintreffen auf dem Ruheplatz fertig vor. Um für das Lager den nötigen Platz zu gewinnen, hatten die Träger das hohe verdorrte Gras angezündet; so saßen wir denn, angesichts dieses kleinen Steppenbrandes, vergnügt beim Frühstück. Die Sache gefiel mir ungemein, es lag ein gut Teil Romantik in der Szene, so etwas wie „Lederstrumpf“- und „Waldläufer“-Poesie, unsere schwarzen Askaris und Träger an Stelle der Komanchen, Apachen oder Sioux, es gehörte wirklich wenig Phantasie dazu, sich die Lieblingslektüre aus der Jugendzeit hier in die Wirklichkeit zu übertragen. Lange konnten wir uns dem Zauber dieses schönen Bildes nicht hingeben; der Wind hatte sich gedreht, und der beizende, scharfe Rauch trieb uns die Tränen in die Augen. Zugleich nahm der Steppenbrand die Richtung direkt auf unseren Lagerplatz. Schnell ließ Tom sämtliche Askaris und Träger antreten und den Raum zwischen uns und dem Feuer von allem Brennbaren, wie Gras, Buschwerk und ähnlichem säubern. Zuweilen suchte sich eine Flamme aus der lodernden Steppe durch das von unseren Leuten künstlich isolierte Gebiet zu drängen, da hieß es, gut aufpassen und sie noch rechtzeitig ausschlagen, damit sie nicht bis zum Zelt kam. Aufregender wurde die Sache, als plötzlich der Feind uns im Rücken angriff! Rasch wurde auch auf dieser Seite eine neutrale Zone hergestellt, so daß wir endlich richtig zwischen zwei Feuern saßen. Zum Glück war der Wind nicht stark, unser Zelt mit all unseren Vorräten wäre sonst verloren gewesen, so kamen wir mit einigen angesengten Kleidern davon. Mit großem Interesse beobachtete ich das eigentümliche, sozusagen sprungweise Vorgehen des Feuers, das ganz plötzlich, ohne sichtbare Verbindung mit dem Hauptherde, an einzelnen entfernteren Stellen aufflammte, während ich andererseits wieder, nachdem das Feuer niedergebrannt war, mehrfach einzelne lange, trockene Grashalme unversehrt aus der Asche hervorragen sah, an denen Glut und Flamme vorbeigezogen waren. Am anderen[S. 135] Morgen hatten wir anfangs einen bösen Weg durch all die Asche zu machen, bevor wir wieder im grünen „Pori“ unsere Erholungs-Partie fortsetzen konnten.
An diesem letzten Tage unserer Safari (14. August) machten wir noch eine lange „pumsika“, d. h. Ruhepause; wir wollten den Tag noch recht auskosten und erst spät abends nach der Station zurückkehren. So zogen wir denn abends auch nicht auf der Hauptstraße ein, sondern ritten um die Boma herum nach unserem Hause, um den Abend noch für uns allein zu haben. Mit dem Erfolge unserer Safari konnten wir in jeder Beziehung zufrieden sein — politisch, weil es Tom gelungen war, die Leute zu überzeugen, daß sie von Quawa hier in unserer Nähe nichts zu fürchten haben, um wieder viele von den verschüchterten Eingeborenen zur Ansiedelung in der Nähe der Station zu veranlassen, und gesundheitlich, weil diese abwechslungsreichen Tage uns beiden frische Kraft, körperlich wie seelisch, gespendet hatten.
Für Tom, der nur drei Tage auf der Station bleiben konnte, begann nun wieder eine endlose Reihe von Schauris; die Wahehe fingen an, des ewigen Kriegszustandes müde zu werden, und es kostete Tom übermenschliche Geduld, den Jumben immer und immer wieder in eindringlicher Rede klar zu machen, daß der Kampf bis zur Vernichtung fortgesetzt werden müsse, ehe sie auf Ruhe und Frieden rechnen könnten. Das waren sorgenvolle Stunden, als an dem zum Abmarsch bestimmten Tage sich keiner der versprochenen Wahehe sehen ließ! Endlich gegen Abend trafen sie ein, und zwar noch in größerer Zahl, als Tom erwartet hatte. Am anderen Tage brach Tom auf, die 500 Wahehe, zum Teil ganz prächtige Kerle, schlossen sich ihm an. Diesmal nahm er auch unseren Forstmann, Herrn Ockel, mit, der an einer geeigneten Stelle eine Versuchs-Landwirtschaft anlegen soll. Bei diesem Zuge durch unser Gebirgsland hat er die beste Gelegenheit, die Verhältnisse kennen zu lernen. Herrn Dr. Fülleborn gelang es, eine Anzahl recht guter photographischer Aufnahmen von unseren Wahehe zu machen; besser wie die meinigen, denn mein „Momentverschluß“ funktionierte nicht rasch genug. Dr. Fülleborn arbeitet[S. 136] allerdings auch mit einem Apparat, der ihm mit allem Zubehör 2000 Mark gekostet hat. Die Gelegenheit zu anthropologischen Studien und Schädelmessungen hat er hier mit fabelhaftem Fleiße und bestem Erfolge ausgenutzt. Am 26. August marschierte Dr. Fülleborn hier ab, um sich der Expedition anzuschließen. Wie gern hätte ich ihn begleitet, um wieder in Toms Nähe zu sein. Auch Herr v. Kleist, der mir nach Toms Abmarsch stets treulich Gesellschaft geleistet, hätte den Zug gern mitgemacht, aber am 28. Oktober traf mittags 1 Uhr die Post ein, die ihm den Befehl brachte, an Leutnant Engelhardts Stelle nach Songea abzugehen — zwei Stunden später war er schon unterwegs. Ein interessantes Jagdabenteuer des Leutnants Braun erfuhr ich von Dr. Stierling, der jetzt von Idunda zurück ist. Auf einem Jagdausflug sah Leutnant Braun sich plötzlich einem Trupp von fünf Löwen gegenüber. Zwei davon brachte er zur Strecke, zwei andere entkamen, nur eine alte Löwin stürzte sich auf ihn und schlug ihr Gebiß in seine linke Seite — ein Wunder, daß sie nicht ein paar Rippen zermalmt hatte. Leutnant Braun verlor aber in dieser gefährlichen Lage nicht die Besonnenheit: er schob die Mündung der Büchse mit der Rechten unter dem linken Arm durch und drückte ab, zum Glück traf die Kugel so sicher, daß die Löwin tot zusammenbrach. Als alles vorbei, erschienen auch die Askaris und Träger, die gleich beim ersten Auftauchen der Löwen sich im Pori verkrochen hatten, und trugen den schwerverwundeten Jäger nach der Station. Jetzt, nachdem die Bißwunden gut geheilt, freut Leutnant Braun sich seines afrikanischen Abenteuers.
Tom schreibt recht zufrieden über den Verlauf seiner Expedition. Zunächst ist Quawas wichtigster Msagira und Ratgeber, Mkakao, gefallen, und vier Weiber von Mpangire nebst dessen fünf Kindern sind gefangen. Bis jetzt hat Tom schon 400 Gefangene; das sind Verluste für Quawa, die er nicht mehr wieder gutmachen kann.
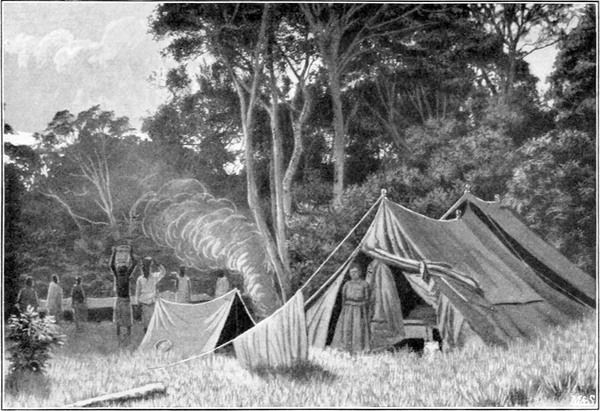
Lagerleben: Wasserträger.
(Zu S. 131.)

Lagerleben im Urwald: Ruhepause.
(Zu S. 141.)
Um die Einsamkeit weniger fühlbar zu machen, suche ich täglich an Arbeit zusammen, was irgend geht. Große Kleiderrevision mit Nähen und Flicken, Küche und Speisekammer werden gründlich kontrolliert und eine allgemeine Inventur gemacht, — letztere schien mir besonders nötig, denn es war mir bezüglich der Ehrlichkeit meiner schwarzen Hausbediensteten manches verdächtig vorgekommen. Richtig erwischte ich auch einen der Boys, wie er eine ihm vom Koch zugesteckte Flasche Wein in Sicherheit bringen wollte. Eine Revision unseres Weinvorrates hatte natürlich ein sehr betrübendes Ergebnis: die Kerle hatten gestohlen wie die Raben. Natürlich ließ ich sie, obschon es bereits 9 Uhr abends war, sofort zur Wache bringen. Den Koch freilich muß ich mir bei Toms Rückkehr wiederholen, denn dann ist er mir unentbehrlich — und das Schlimmste bei der Sache ist, daß die schwarzen Schlingel das selbst ganz genau wissen.
Auch das Photographieren betreibe ich eifrig, es gelingt mir aber nicht, auch nur halbwegs so gute Bilder zu erzielen wie Dr. Fülleborn. Am besten geriet noch eine Aufnahme, die ich von einer „mpepo“ machen konnte, der ich in der Hauptstraße begegnete. Mit grellbunten Tüchern, Perlenschnüren und Fellen behangen, das Gesicht rot und weiß bemalt und gepudert, durchzieht diese „Besessene“ (mpepo bedeutet eigentlich „Geist“, „Wind“, „Sturm“, dann in weiterem Sinne eine von einem Geist Besessene, Hexe, Zauberin) die Straßen, begleitet von einer ihr ergebenen Frau, die ihre Verzückungen und wirren Reden dem staunenden Volke ausdeutet. In diesem oft wochenlang anhaltenden Zustand darf der „mpepo“ kein Mann zu nahe kommen — im gewöhnlichen „nicht besessenen“ Zustande dagegen ist sie nichts weniger als Männerfeindin — an die von ihr gebrauten Liebestränke und andere „Dawa“ glauben die Schwarzen natürlich unerschütterlich fest. Leider konnte ich diese schwarze Miß Mabel Vaughan nicht während eines ihrer wilden Tänze photographieren, da der Momentverschluß meines Amerikaners wieder nicht klappte. Die Spekulation auf die Dummheit der lieben Mitmenschen macht sich übrigens auch hier bezahlt — diese „mpepo“ hat sich ein ganz ansehnliches Vermögen zusammengezaubert.
14. November 1897.
Ich nahm mir den Ombascha und zwei Ruga-Ruga heute mit, um Tom entgegenzugehen. Wahehekrieger, die uns begeg[S. 138]neten, erzählten, Tom sei dicht hinter ihnen; also trotz der tropischen Sonnenglut munter vorwärts — da kommt nach dreistündigem Marsche eine ganz entgegengesetzte Meldung: Tom habe einen anderen Weg nach der Station eingeschlagen! Das war eine böse Nachricht! Ich schickte sofort den einen Ruga-Ruga quer durch den Wald nach der mutmaßlichen Übergangsstelle am Ruaha, den Tom passieren mußte, den anderen ließ ich in der von mir zuerst eingeschlagenen Richtung weitergehen; ich selbst ging mit dem Ombascha auf demselben Wege zurück. Als wir am Ruaha anlangten, hörten wir den Lärm der Karawane seitwärts von uns: also den Ombascha (Gefreiten) im Laufschritt fortgeschickt, obwohl er behauptete, das sei nicht desturi (Sitte, Gebrauch), und Tom werde ihn bestrafen, wenn er mich allein im Walde gelassen habe; ich bestand aber so fest auf meinem Willen, daß er schließlich doch forttrabte. Kurz vor der Stadt erreichte er Tom und brachte mir in atemlosem Laufe diese Nachricht zurück; auch mein Ruga-Ruga fand sich nach achtstündigem Marsche wieder bei mir ein, so daß ich das letzte steile Stück Weg frohen Mutes zurücklegen konnte. Wir kamen gerade noch zurecht, um an dem feierlichen Einzuge in die Station teilnehmen zu können, wo die heimkehrende siegreiche Truppe mit Jubel und Freude von den Einwohnern begrüßt wurde.
Die Zählung der Gefangenen ergab die stattliche Zahl von 550 Köpfen. Mit Ausnahme der Kinder Mpangires und seiner Halbschwester Fulimanga, die wohl und gutgenährt aussehen, befinden sich die Frauen und Kinder in einem elenden Ernährungszustand; wurden doch mehrere dabei betroffen, als sie Raupen und Käfer als Nahrung für sich und ihre Kinder sammelten! Mpangires Kinder, besonders einen hübschen vierjährigen Knaben mit großen schönen Augen, hätte ich gern bei mir behalten, die Politik gebietet aber, alle Mitglieder der ehemaligen Sultansfamilie aus unserem Gebiete zu entfernen; Tom schickte sie mit dem Lazarettgehilfen, der den kranken Bauleiter begleiten muß, zur Küste. Auch Mgundimtemi kam, um die Kinder ihres Mannes und seine Halbschwester Fulimanga zu begrüßen. Die hellen[S. 139] Tränen standen ihr in den Augen; sie trauert noch um ihren Mann, weder Schmuck noch bunte Tücher hat sie seit seinem Tode getragen.
Unser Garten am Ruahaufer steht in herrlichster Blüte, mit seinen Rosen, Nelken, Astern und Balsaminen macht er einen ganz heimatlichen Eindruck; jedenfalls ist er in seiner Art ein Unikum im tropischen Innern Ostafrikas.
Während Toms Abwesenheit beehrte mich auch Merere wieder mit seinem Besuch, ebenso seine Bibis; diese Huldigung, die nach afrikanischer Sitte stets mit einem Gegengeschenk erwidert werden muß, machte eine tüchtige Lücke in meine Vorratskammer. Für Tom brachte Merere ein ethnographisch sehr interessantes Stück mit: das aus einem mindestens zentnerschweren Stoßzahn geschnitzte Elfenbeinszepter des Sultans; diese Stücke sind schon recht selten geworden. Übrigens hat die Kultur, die alle Welt beleckt, sich auch auf unsern Freund Merere erstreckt: er hat sich für 500 Rupien einen Esel gekauft — zu meinem Bedauern; es sah ganz stattlich aus und paßte so ganz in das afrikanische Milieu, wenn Merere im goldgestickten schwarzen Rock und langen weißen Kanzu[7] auf seinem großen schwarzen Reitochsen, einem Prachtexemplar seiner Gattung, langsam einhergezogen kam. Aber Sultan Kiwanga reitet auf einem Esel wie in Uleia (Europa), und Farhenga, der jetzt in Uhehe der Mächtigste ist, hat sich ebenfalls einen Reitesel zugelegt, da war er es natürlich seiner Würde schuldig, vom Ochsen gleichfalls auf den Esel zu kommen.
Auf dem Marsche nach Likininda.
Jetzt sind wir wieder mal unterwegs! Oberlazarettgehilfe Prinage sollte, wie ich schon schrieb, den kranken Bauleiter zur Küste bringen und zugleich seinen Urlaub antreten, ein anderer Europäer war für diesen vorgeschobenen Posten nicht verfügbar, so entschloß sich denn Tom, selbst nach Likininda zu gehen und die Station so einzurichten, daß sie einige Zeit hindurch dem sehr[S. 140] tüchtigen Betschausch überlassen werden kann. Es haben sich bei der Boma dort bereits 40 Familien angesiedelt, die zu Quawas Anhängern gehörten; unter ihnen ein früherer Msagira Quawas, der seinem Herrn den Vorschlag gemacht hatte, sich den Deutschen zu unterwerfen. Für diesen gutgemeinten Rat hat Quawa ihm den Sohn erschlagen; einem andern hat er aus der gleichen Veranlassung Vater und Bruder getötet! Also Krieg bis zur Vernichtung, jeder andere Ausweg ist gänzlich ausgeschlossen.
Am 19. November brachen wir von Iringa auf, marschierten aber an diesem ersten Tage nur bis an den Ruaha. Am 20. ging es 4½ Stunden weit über Berg und Tal, weniger hoch wie steil, und deshalb besonders anstrengend. Von dem Landschaftsbilde ist besonders nördlich in der Ferne eine Felsengruppe bemerkenswert, die von den meist kuppenförmigen Bergen sich durch ihre zerklüfteten Zacken auffallend abhob; der nicht sehr hohe Gipfel erinnert mich lebhaft an den Dent du Midi. Beim Aufsuchen eines guten Zeltplatzes fanden wir in einer Felshöhle drei Trägerlasten mit Chakula. Zwar behauptete Farhenga, er habe die Lasten in jener Höhle versteckt, da er aber über den Inhalt keine Angaben machen konnte, wurde er tüchtig ausgelacht und die Lebensmittel an die Askaris und Träger verteilt. Da war die Freude groß. In dieser menschenleeren Gegend gibt es nirgends etwas zu kaufen oder zu — stehlen, so daß unsere Leute nur auf die von der Station mitgenommenen Vorräte angewiesen sind, und da sie diese auch noch selbst schleppen müssen, ist es leicht erklärlich, daß nur sehr knappe Rationen auf den Mann kommen. Ein Sack Mais, 60 Pfund, für zehn Träger auf vier Tage. Dieser unerwartete Zuwachs zu unserem Reisevorrat hatte übrigens unsere Schwarzen hellsichtig gemacht, sie krochen emsig in allen Winkeln der Höhle umher und förderten wirklich noch ein paar Lasten zu Tage. Tom verteilte gleich alles an die Träger, denen eine Extramahlzeit wohl zu gönnen war, und machte dabei aus der Not eine Tugend: hätten wir die Vorräte unberührt gelassen, so durften wir sicher sein, daß in der nächsten Nacht uns sämtliche Träger ausgekniffen wären, um sich an den[S. 141] Lebensmitteln gütlich zu tun, deren Versteck ihnen nun einmal bekannt geworden war. Am Nachmittag führt uns Farhenga an eine interessante Felsenformation, einen überhängenden Felsblock von gewaltigen Dimensionen, unter dessen Wölbung bequem zwei Zelte Platz gefunden hätten; schade, daß wir den schattigen kühlen Lagerplatz nicht früher kannten.
Dabagga, 21. November 1897.
Heute nur drei Stunden marschiert, da ich nicht recht wohl. Im dichten Busch, wo kaum ein Sonnenstrahl durchdringt, schlägt Tom sein Bureau auf und schreibt seine Berichte, während ich auf dem Feldbette mich gesund schlafe. Auf dem ganzen Marsche war ich wieder einmal ganz die gebietende Sultanin, so etwas wie „Königin von Saba“, die ja übrigens, wenn ich nicht irre, auch „aus hiesiger Gegend“ stammte. Toms aufmerksame Fürsorge ebnete mir den Weg durch die Wildnis. Der Marsch führte durch fruchtbares, wenn auch nicht angebautes Bergland. Unsere Wahehe fühlten sich in dem frischen Bergklima nicht so wohl wie in den wärmeren Teilen Uhehes, da es ihnen zu kühl und feucht hier oben.
Eine Zeitlang folgten wir einer Elefantenspur, ohne jedoch auf die Tiere selbst zu stoßen — zu meinem Bedauern — ich hätte diese Riesen, deren elementare Gewalt wir an den umgerissenen Bäumen und dem zerstampften Boden erkennen konnten, gern einmal in Natur betrachtet. Der Wald bot wundervolle Bilder: mannshohe Farne, üppig wucherndes Unterholz und Bambus, dazwischen rankten sich Schlinggewächse von Baum zu Baum, und das alles überspannt von dem dichten Blätterdach der Baumkronen, durch welches sich nur verstohlen hier und da ein Sonnenstrahl verlor. Die einzelnen Stämme fielen weniger durch ihren Umfang wie durch ihre gewaltige Höhe auf, leider waren die Lichtungen zu gering, um den zum Photographieren nötigen Abstand nehmen zu können; ich hätte gern einige Aufnahmen gemacht, um im Vergleich mit den Gruppen unserer Begleiter die menschliche Gestalt als Maßstab für die Baumriesen[S. 142] zu gewinnen. Im Laufe des Nachmittags passierten wir ein schönes, von einem hellen Gebirgsbach durchflossenes Tal, welches durch seine besonders in die Augen fallende Fruchtbarkeit unser Interesse erregte. Während wir uns über diese zur Ansiedelung einladende Stelle unterhielten, fiel es uns auf, daß unsere ganze Karawane, ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit, sich lautlos, schweigend weiter bewegte, Tom und mich mit ängstlichen Blicken streifend. Auf Befragen wurde uns die Erklärung, dies sei das Tal des Muúngu (Gott), welches die Menschen nur schweigend betreten dürften, — wer dies Gebot übertrete, über den habe der Sheitani (Teufel) Macht und werde ihm auf dem weiteren Marsche Übeles antun. Um uns von dem Verdachte zu reinigen, daß wir nunmehr dem Sheitani verfallen, ließ Tom zum Entsetzen der Karawane Signale blasen, die das Echo der Berge weckten; als da kein Sheitani erschien, beruhigten sich die abergläubischen Schwarzen sichtlich — der schwarze Teufel hat also augenscheinlich keine Gewalt über Europäer. — Wir fanden dieses ganze Berggebiet sehr fruchtbar, Wasser gab’s überreichlich, Bergbäche mit kristallklarem Wasser durchziehen die Täler, üppiger Farnwuchs deutet auf guten Boden. Zum Plantagenbau ist die Gegend sicher besonders geeignet, ob für den Pflug, scheint mir fraglich; die Hänge sind sehr steil.
Kuifuiri, 23. November 1897.
Die Märsche sind sehr anstrengend, besonders die Lianen zwingen zu großer Vorsicht beim Reiten; einmal wäre ich fast von meinem Maultiere herabgerissen worden, da sich eine Ranke mir um den Hals geschlungen; zum Glück hatte Tom es sofort gesehen und konnte sie durchschneiden, aber der Hals ist mir jetzt nach Tagen noch zerkratzt und zerschunden. Die Marschverpflegung besteht für Tom früh in einem Teller Milch (von den Kühen, die wir für die Station mitführen); ich esse, meines Magenleidens wegen, Mehlbrei. Während wir an schattiger Stelle in dem köstlichen klaren Wasser ein Bad nehmen, wird das Schlafzelt abgebrochen, während des Frühstücks auch das[S. 143] Wohnzelt; dann ertönt Toms Signalpfeife, und die Karawane ordnet sich zum Aufbruch. Während des Marsches gibt es kalten Tee. Am Lagerplatz angelangt, werden zunächst Tisch und Stühle aufgestellt, dann die Zelte gerichtet. Zum Abendessen wie zum Frühstück Fleisch oder Wurst sowie Wasser mit Kognak. Als abendliche Lektüre haben wir diesmal Treitschkes Deutsche Geschichte mitgenommen, auch die alten Zeitungen kommen hier noch einmal zu Ehren. Um den Abend im Freien verbringen zu können, wird eine Blätterlaube errichtet, in der Tom seine schriftlichen Arbeiten, Berichte usw. erledigt, dann spielen wir gewöhnlich noch eine Partie Schach oder Halma, bis das Abendessen fertig. Suppe aus Knorrschen Suppentafeln, Schaf- oder Hühnerfleisch, Wild, Reis mit Curry, Pickles.
Uquega-Likininda, 2. Dezember 1897.
Die letzten Tage machten wir nur kurze Märsche von etwa je 3½ bis 4 Stunden, allein die Flußübergänge machten sie recht beschwerlich: der Funsuku mit seinen steilen Ufern wird mir besonders in Erinnerung bleiben, zunächst rutschte ich auf einem Steine den steilen Abhang bis zum Flusse hinab, ein abgekürztes Verfahren, welches mir von den Treppengeländern aus der Kinderzeit im Elternhaus noch geläufig war und mich der halsbrecherischen Kletterei enthob. Durch den Fluß, den wir der Klippen wegen nicht durchreiten konnten, ging’s dann in vorsichtigen Sprüngen von Stein zu Stein.
Den Lukossi konnten wir durchreiten. Der Strom ist leider für die Bootfahrt nicht zu benutzen, seine Stromschnellen und Wasserfälle sind zwar recht malerisch, verhindern aber den Verkehr zu Wasser mit dem großen Ruaha. Die Station Likininda liegt auf einer freien, weithin sichtbaren Höhe inmitten einer guten Gras-Landschaft. Förster Ockel kam uns am Fuße des Berges entgegen. Seinen Ansprüchen genügt die Gegend nicht zum Anlegen einer Musterfarm, auch hält er sie für zu steil, als daß man hier mit dem Pflug viel ausrichten könnte; ich fürchte übrigens, daß er auch auf dem weiteren Entdeckungszug in der[S. 144] Nähe kaum ein Gelände finden wird, das seinen europäisch hochgestellten Anforderungen entsprechen wird: eine viel größere ebene Fläche mit üppig wuchernden Farnen, dem Anzeichen fruchtbaren und kulturfähigen Mutterbodens, wird er kaum finden, und unter dem tut er’s nicht. Er soll sich jetzt Herrn v. Prittwitz anschließen, um die Gegend nach Perondo zu sich anzusehen. Förster Ockel hat als tüchtiger Weidmann unseren Tisch reichlich mit Antilopenfleisch versorgt. Oberlazarettgehilfe Prinage war schon ganz nervös vor freudiger Aufregung: er möchte rechtzeitig zu dem am 5. Januar von Dar-es-Salaam abgehenden Dampfer kommen, um seinen Heimatsurlaub in Deutschland zu verleben. Tom entließ ihn denn auch gleich nachmittags, gleichzeitig entsandte er aber auch einige Züge Wahehe in die Berge, die richtig am 27. November 20 Weiber und Kinder einbrachten; von Quawas Kriegern waren drei gefallen. Dieses fortwährende Inatemhalten ist das einzige Mittel, unseren Todfeind nach und nach so zu isolieren, daß ihm weder Anhänger noch Lebensmittel bleiben. Deshalb bedeuten die gefangenen Weiber für uns insofern einen Erfolg, als nach Negerart den Frauen alle Feldarbeit obliegt.
Am 29. kam Herr v. Prittwitz an, der im Augenblick sich auch mit der Wegaufnahme beschäftigte. An einem großen Zuge, den Tom jetzt vorhat, wird er sich beteiligen; auch einigten sich die Herren darüber, wie die Leute in Muhanga zur Ansiedelung zu bewegen seien, in der Art, wie es seinerzeit bei uns in Iringa gelungen war; Tom überließ Herrn v. Prittwitz zur besseren Durchführung dieses Planes unseren bisherigen Begleiter Farhenga. Wir verlebten recht gemütliche Abende mit ihm, bis er am 2. Dezember abzog. Am Tage vor Herrn v. Prittwitz’ und Ockels Abmarsch kam der zweite Zug Wahehe zurück, den Tom in die Berge geschickt hatte, er brachte 33 Weiber und Kinder ein, mehrere Quawa-Krieger waren gefallen.
Lukossi, 3. Dezember 1897.
Von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr Verteilung der Gefangenen an die Wahehe, zum Zwecke schärferer Beaufsichtigung und Aus[S. 145]gabe von Chakula an Askaris und Träger. Um 8 Uhr Abmarsch nach dem Lukossi-Fluß, der Übergang nahm 1½ Stunde in Anspruch, besonders der steilen Ufer wegen. Mein kleiner Ombascha Achmed zeigte seine Schwimmkünste; er hat sicher früher zu den Jungen gehört, die in Aden vor den Dampferpassagieren ihre Fertigkeit im Schwimmen und Tauchen produzieren, indem sie nach kleinen Geldstücken tauchen, die ihnen von Bord aus zugeworfen werden. Es wurde unerträglich heiß: nirgends ein Baum oder Strauch, nur der heiße ausgedörrte Boden, dazu kein Lufthauch — der Marsch über die steilen kahlen Berge in der glühenden Sonnenhitze ließ mich die Leiden einer Safari gleich en gros empfinden. So kamen wir nur 2½ Stunden weit. Auch das Lager mußten wir an einem gänzlich schattenlosen Bergabhang aufschlagen und den Tag über im Zelt bleiben. Das einzig Angenehme dieses Marschtages war ein hübscher Blick nach einem Wasserfall, deren der Lukossi hier eine ganze Anzahl bildet.
Manasanga, 4. Dezember 1897.
Viereinhalb Stunden marschiert, mit ½stündiger Pause, meist durch bewaldete Berge. Wir fanden einige gut versteckte Maisfelder von Quawas Leuten, die frischen Maiskörner schmeckten ganz gut; ich fing einen prächtigen grünen Schmetterling von einer mir ganz neuen Art. Während des Marsches plötzlich „Halt!“, alles kauert im Grase nieder: Feind in Sicht! Ich machte mich fertig, um in dem in Aussicht stehenden Gefecht nicht als müßige Zuschauerin beiseite zu stehen, aber der Feind, eine Anzahl schwarzer Gestalten, hielt nicht stand, sondern verschwand eiligst im Pori; unsere verfolgenden Askaris und Wahehe brachten richtig wieder fünf Weiber an, von denen die eine wieder zu ihren Leuten entlassen wurde, um sie zur Ansiedlung bei der Station zu bewegen. Abends stellten sich dann auch drei Männer, große, stattliche Gestalten mit offenen, klugen Gesichtern, jetzt aber erbärmlich abgehungert; sie hatten mit ihren Weibern die Felder bebaut, die wir heute passiert, und Quawa mit Mais versorgt. — Das Ge[S. 146]lände scheint günstiges Ansiedlungsgebiet, flache Hügel mit gutem Boden.
Landschaft Quihangana Mwakikongo, 8. Dezember 1897.
Vier anstrengende Marschtage mit allerhand Aventiuren und Fährlichkeiten. Zunächst verschwand am 5. Dezember morgens, als wir die Landschaft Majida (Mapalele) passierten, ein Träger mit der Last (es war die Kiste mit Schwämmen, Seife und anderem notwendigen Gerät). In 5¾stündigem Gewaltmarsch, ohne die übliche, längere Pause, kommen wir bis Kanugare. Hier hat jeder Berg, jedes Tal, jeder Fluß seinen besonderen Namen. Unterwegs hatte Tom das hier seltene Jagdglück, eine Elen-Antilope zu schießen, ein besonders stattliches Tier. Wir nahmen die Decke für uns, das Fleisch ließen wir den Trägern (der Rücken allein bildete eine Trägerlast), die sich tagelang daran labten. Am anderen Tag hatten wir ein tüchtiges Gewitter, das Lager also denkbar ungemütlich. Das Gebiet durchweg fruchtbar und für Ansiedler geeignet; hier wäre der Platz für Plantagen- und Ackerwirtschaft. Im Gegensatz zu den dürren Steppenflächen, in denen die trockenen, harten Grashalme büschelweise aus dem ausgedörrten Boden zwei bis drei Meter hoch emporschießen, hier in den Gebirgstälern herrliche Wiesen, reichliche Bewässerung durch klare, wasserreiche Bäche, deren sich oft mehrere in ein und demselben Tale finden. Selbst der Blumenschmuck fehlt nicht, die Rasenfläche ist bunt übersät mit den mannigfachsten Arten von Feldblumen — mein galanter Gatte pflückte mir heute einen prachtvollen Strauß, und was sonst den afrikanischen Blumen fehlte, fand ich hier: sie dufteten lieblich.
Am 7. Dezember wurden uns wieder Gefangene eingebracht, die das bestätigten, was Toms Patrouillen erkundet hatten: in der Nähe ein großes Feindeslager. Der Ombascha, der mit den Askaris sofort dahin aufbrach, fand aber die Vögel bereits ausgeflogen und mußte sich begnügen, das Lager zu zerstören. Am 8. Dezember wieder 5 Stunden marschiert, mit einem Umweg in die Landschaft Quihangana-Mwakikongo. Die Gegend scheint ihres[S. 147] Grasreichtums am meisten zur Viehzucht geeignet. Unterwegs wurden mit dem Feinde einige Schüsse gewechselt, auf feindlicher Seite ein Toter, dann großes Schauri mit den Gefangenen, kurzen, gedrungenen Gestalten mit wahren Galgengesichtern, während die Wahehe doch eigentlich durchweg stattliche, hübsche Leute sind, ihre Weiber freilich sind fast ohne Ausnahme häßlich, so daß man sich fragen muß, wie solche häßlichen Frauen meist so ansehnlichen Söhnen das Leben geben können. Bei uns ist jetzt Schmalhans Küchenmeister; die nachbestellten Träger sind nicht eingetroffen, Gott weiß, wo sie stecken. Nun sind Brot, Mehl, Zucker, Wein, Tee, Kaffee und Salz auf die Neige gegangen. Dagegen hilft nur ein Mittel, der Humor, und der ist reichlich vorhanden. Während wir zum Frühstück Yams und Bataten (die süßlichen Verwandten unserer braven deutschen Kartoffel) verspeisen, schwelgen Askaris und Träger in Elenbraten. Dem Geruch nach zu urteilen, der zuweilen zu uns herüber dringt, befindet sich das Wildpret bereits in einem Zustand, für den „le plus haut-gôut“ nur eine schwache Andeutung ist.
Station Iringa, 11. Dezember 1897.
Über Ugawiro (am 9.) und Himbu (am 10.) heute glücklich wieder eingerückt. Auch diese letzten Tage wurden wir durch feindliche Wahehes belästigt, so daß ich einmal schon glaubte, selbst zum Revolver greifen zu müssen. Sie ließen einen Toten am Platze, einen Verwundeten nahmen sie mit. Eine Anzahl wurde gefangen eingebracht, andere stellten sich freiwillig. Nachmittags hatte ich viel zu tun; ich verband die Wunden und freute mich, zu beobachten, wie dankbar und anhänglich die Leute für diese Hilfe waren. Die Gegend wurde etwas steiniger, der Boden war jedoch immer noch gut. Wir fanden viele Termitenhügel im Walde, während solche sonst meist nur auf baumlosen Flächen vorkommen. Ich machte eine gelungene Aufnahme von einigen unserer Wahehe, die einen einzelnen riesigen Felsblock erklettert hatten; ihre Wachsamkeit gleicht der der Gemsen, jeden erhöhten Punkt benutzen sie zum Ausblick. — Kurz vor Himbu erreichten[S. 148] uns Boten von der Station mit Briefen: auf der Station sind einige leichte Pockenfälle vorgekommen. Wir mußten zweimal über den Mtitufluß, die Gegend ganz im Charakter wie bei Iringa. In Himbu schickte uns der Msagira Tengulemembe durch seine Großen Kartoffeln und Pombe als Geschenk, die ich mit einem bunten Tuche erwiderte. Bei der üblichen Poliklinik nachmittags großes Gedränge: jeder will zuerst verbunden sein. Am Wege wiederum Menschenschädel als Spuren früherer Überfälle. In Himbu inspizierte Tom die von den Askaris geschickt und mit einem gewissen Geschmack errichtete Boma. Das Dorf machte einen vorteilhaften Eindruck, die Leute waren freundlich und zutraulich — noch vor wenigen Wochen würden sie uns überfallen und ermordet haben. Während Tom Schauri hielt, ließ ich mir Tengulemembes Kinder zeigen und schenkte der ersten seiner Frauen ein Tuch, das sie mit großer Freude gleich anlegte. Da der Verwundeten so viele waren, konnte ich sie nicht alle verbinden, sondern mußte an die Jumben Verbandmittel für ihre Leute verteilen.
Die vermißten Lasten trafen ein, nun war wieder Vorrat von allem vorhanden. Wir aßen an dem Tage gleich ein ganzes Brot auf. Zugleich traf auch der Sudanesen-Ombascha Musa mit schlimmer Nachricht ein: Sergeant Richter von unserer 2. Kompagnie ist verwundet. Richter war mit acht Askaris einer feindlichen Spur gefolgt, als er sich plötzlich Quawa gegenüber sah, der mit etwa 100 Mann — davon die Hälfte mit Hinterladern bewaffnet — gleich Feuer auf den kleinen Trupp gab. Es gelang dem Sergeanten, obwohl verwundet, mit zwei Askaris in das Pori zu gelangen, wo er sich vier Tage lang ohne Nahrungsmittel, ohne Wasser, geschwächt von Blutverlust, versteckt hielt, während der Ombascha zur Station weiter eilte. Dr. Stierling ist gleich mit Verstärkung zu Richter abgegangen, und die Station ist zurzeit ohne ärztliche Hilfe — trotz der Pocken. Das ist ein bedeutungsvoller Zwischenfall: Quawa stellt sich also selbst zum Kampf, dem er bisher immer auszuweichen wußte! Der Ort des Gefechtes liegt etwa 2 Stunden Wegs abseits unserer[S. 149] letzten Safari-Route. Quawa und seine Anhänger nennen Tom den „Kapirimbu“, d. h. „der alle Kraft an sich zieht“. Noch immer ist die Furcht vor der Rache ihres ehemaligen Sultans groß: unser Freund Kiwanga hat sich aus Ukalinga zurückgezogen und Schutz vor einem Überfalle Quawas im Pori von Massalika gesucht, und gerade jetzt kommt es darauf an, daß Kiwanga bei uns stand hält. An Stelle des beurlaubten Grafen Fugger wird Leutnant Kuhlmann ihn aufsuchen und seinen Mut wieder etwas auffrischen. Bei der Rückkehr nach der Station Iringa empfing uns Leutnant Kuhlmann und zu unserer großen Überraschung auch Leutnant Braun, der auf dem Wege zu Hauptmann v. Prittwitz’ Kompagnie ist. Abends 6 Uhr rückten wir ein, Leutnant Kuhlmann ließ es sich nicht nehmen, das Ende unserer Safari mit Sekt zu feiern. Mit dem Erfolge sind wir zufrieden; es war uns eine stolze Genugtuung, selbst beobachten zu können, wie meines Gatten kluges Verhalten den Wahehe gegenüber sich bewährt hat — möchte doch endlich auch der letzte Schlag gelingen, den bösen Geist der Auflehnung gegen die deutsche Oberhoheit für immer zu bannen. Auch körperlich ist die Safari uns gut bekommen, ich bin von der Sonne braun gebrannt, meine Hände haben die Farbe reifer Kastanien.
Sonntag, den 12. Dezember 1897.
Seit 6 Uhr Rundgang durch die Station, im Bureau alles in Ordnung, Feldwebel Merkl hat seine Sache wieder einmal gut gemacht. Dann Besuch von zwei Missionspatres, die sich verabschiedeten. Zu Ehren Leutnant Kuhlmanns, der, energisch wie immer, schon morgen abmarschiert, hatte ich die Herren zum Mittagessen eingeladen, da sich aber mein Koch und die Boys betrunken hatten, mußte ich mich auf belegte Brötchen mit Bowle beschränken, die ich ohne diese schwankenden „Stützen der Hausfrau“ herstellte.
15. Dezember 1897.
Am 13. rückte Leutnant Kuhlmann ab. Ich beschäftigte mich viel mit Mpangires Kindern, sie tun mir sehr leid. Es[S. 150] macht mir viel Spaß, unsere Sudanesenweiber zu beobachten, mit welcher Energie trotz ihrer Häßlichkeit sie die Männer unterm Pantoffel haben. Auch der Juma kauft sich beim Griechen, dem „Rudolph Hertzog“ im Lande Uhehe, stets die teuersten Hemden von leichtem Mullstoff, die natürlich schnell zerreißen; auf meine Frage sagte er: „Ja, sonst hat mich meine Frau nicht lieb.“
Mit den Händlern habe ich viel Ärger. Dieser Tage boten sie mir meine eigenen beiden Strauße, die mir abhanden gekommen waren, zum Kauf an, das Stück zu 12 Rupien! Obwohl es weit und breit in der Gegend nur mein Straußenpaar gibt, behaupteten sie ganz frech, sie seien ihr Eigentum.
Am 14. Post aus Europa mit Geburtstagsbriefen, Büchern und Wein! Ich lege alles beiseite, um Tom am Weihnachtsabend zu überraschen. Meine Küche ist nun auch fertig. Der Gouverneur hat mir eine eiserne Herdplatte geschickt, nun hat die Negerwirtschaft mit den Steinen ein Ende. Eine Küche mit eiserner Herdplatte und einem wirklichen, echten Rauchfang — so etwas hat die afrikanische Sonne in diesen Breiten sicher noch nicht beschienen. Nun macht das Kochen noch einmal so viel Freude.
Heute stellte sich ein angesehener Häuptling mit 30 Kriegern; einige davon waren aus Quawas Lager. Dieser habe, wie sie berichten, einen Aufruf an alle Wahehe erlassen, „Wer ihn liebe, solle sich ihm anschließen,“ jetzt sei er mit seinem Anhange in Viransi. Auf dem Marsche dahin ist der Zusammenstoß mit unserem Sergeanten Richter erfolgt. Die Vernehmung der neu angekommenen Quawaleute hatte ein interessantes Ergebnis: Der Sultan hat seine Leute ganz militärisch organisiert, in Kompagnien mit eigenen Hauptleuten und Unterführern, sein Nachrichtenwesen ist sehr gut eingerichtet; es stellt sich immer mehr heraus, was für ein gefährlicher Gegner er ist.
23. Dezember 1897.
Gott sei Dank, Tom kann den geplanten Zug noch nicht unternehmen: Dr. Stierling schreibt, vor dem 1. Januar sei[S. 151] Sergeant Richter nicht transportfähig. So verleben wir doch den heiligen Abend zusammen. Ich konnte und wollte Tom das Herz nicht schwer machen mit Klagen, wenn ihn die Pflicht abrief; aber jetzt bin ich froh, daß er nun doch Weihnachten noch bei mir ist.
25. Dezember 1897.
Den heiligen Abend verlebten wir froh, ich mit besonders dankbarem Herzen. Auf der Veranda brannte der Christbaum; leider waren die bestellten Weihnachtsgeschenke nicht eingetroffen. An die Herren auf den verschiedenen Außenposten, Hauptmann v. Prittwitz, Förster Ockel, nach der Mission, an Unteroffizier Buchner hatte ich Marzipan, Kuchen und Pfeffernüsse geschickt, an den Leutnant Kuhlmann eine gebratene Ente, so daß möglichst jeder unserer deutschen Landsleute eine kleine Weihnachtsfreude haben sollte. Wir hatten diesmal auch die Unteroffiziersmesse eingeladen und waren bei Bowle und Abendessen recht vergnügt.
5. Januar 1898.
Neujahr verlebten wir still für uns. Was wird das neue Jahr bringen? — Gestern, an unserem Hochzeitstage, marschierte Tom ab, genau zu derselben Stunde, in der wir vor zwei Jahren unseren Traualtar aufstellten.... Quawa hatte am 28. Dezember ein Gefecht mit unseren Wahehe gehabt und 39 von ihnen erschlagen, er selbst verlor nur 3 Mann. — Am 1. Januar Alarm, weil Unteroffizier Schubert und der Dolmetscher unweit der Mission Gewehrschüsse und Weiber- und Kindergeschrei gehört hatten. So fing das Jahr für uns an.
Am 2. Januar traf Hauptmann Ramsay bei uns ein, der auch gestern abmarschierte. Es war mir eine Freude, einmal einen unserer „alten Afrikaner“ kennen zu lernen. Nachts wurde wieder alarmiert.
7. Januar 1898.
Tom schickte die Zelte und Feldbetten zurück sowie alles Entbehrliche — wie wird es ihm nun bei der Regenzeit an allem[S. 152] fehlen. Ich fühle mich krank vor Sorge und Aufregung. Sie folgen jetzt der Quawaspur. Dr. Stierling hat schon seine chirurgischen Bestecke verpackt, um bei der ersten Nachricht von einem Gefechte aufbrechen zu können. Jede Nacht wird die Station alarmiert; diese ununterbrochene Aufregung geht an die Nerven. Gestern hatte ich Pater Ambrosius als Gast — seine Nachrichten lauteten auch nicht gerade beruhigend: an dem kleinen See in der Nähe der Mission ist wieder ein Araber mit 15 Chakula-Trägern ermordet worden. Die Lebensmittel werden jetzt sehr teuer, und wenn nun auch noch die Heuschrecken einfallen sollten, die ich schon in dichten Wolken über uns hinwegziehen sah, dann haben wir die Hungersnot im Lande. Im Garten habe ich täglich zwei Weiber, die mit leeren Petroleumkannen einen Heidenlärm vollführen, um die Heuschrecken abzuhalten. Meine Mädels müssen jetzt auch tüchtig mit im Garten und Feld helfen, dafür brennen sie mir abends gern durch, um sich herumzutreiben, wie z. B. gestern abend. Nachmittags war ich zum Griechen gegangen, um einige Einkäufe zu machen, als ich in der Ferne Trommelschlag hörte: Tom kehrte mit seiner Truppe zurück! Morgen ist sein Geburtstag, ich hatte mich schon in den Gedanken eingelebt, den Tag ohne ihn verbringen zu müssen!
Über den Verlauf seines Zuges erzählte Tom mir etwa folgendes:
Es war ihm gemeldet worden, Quawa beabsichtige einen Einfall in das Tal Makaneras, wo er große Rinderherden wußte; auf dem Marsche dorthin hatte er unsere 39 Wahehe bei einem Überfalle erschlagen, deren Leichen Tom am Ruaha-Übergange noch vorfand. Nun änderte Quawa seinen Plan; Tom hatte durch Überläufer die Lager von Quawas Leuten ermittelt und ging mit Feldwebel Merkl und Hammermeister, 130 Soldaten, 160 ausgesucht tüchtigen Wahehe und dem Maximgeschütz am 4. Januar nach dort ab. Eine neue Meldung, die sich aber als falsch herausstellte, verursachte zunächst einen Zeitverlust von 48 Stunden, auch mußte Tom sicherheitshalber einige Soldaten und 60 Wahehe von seinen Leuten abzweigen.
In ununterbrochenem 21stündigen Marsche, bei strömendem Regen, erreichten sie am 7. Januar Quawas Lager, dasselbe lag westnordwestlich von Viransi in der Landschaft Quihangana auf hohen, mit breiten Waldstreifen umgebenen Hügeln, übrigens sonst in ziemlich übersichtlichem Gelände. Des Dickichts wegen konnte nur der Zugangsweg für den Angriff benutzt werden, dessen letztes Stück einen dicht überwachsenen Laubtunnel bildete. Das Lager selbst bestand aus etwa 250 im Dickicht verstreuten erbärmlichen Hütten, die so gut versteckt waren, daß sie erst aus allernächster Nähe zu sehen waren; so war es den Bewohnern leicht, beim ersten Alarm im Pori zu verschwinden.
Kaum waren unsere Leute, Tom und Merkl voran, aus dem Laubtunnel in das eigentliche Lager eingedrungen, als sie sofort heftiges Feuer aus Gewehren Modell 71 erhielten. Im Laufschritt nahmen unsere Wahehe den Angriff auf und stürmten in das Lagerdorf, welches schnell geräumt war. Vom Feinde fielen 19 Mann, darunter drei sehr wichtige Wasagira; unter den gefangenen 100 Weibern und Kindern waren ein Sohn und zehn nahe Verwandte Quawas. Die Leute sahen erbärmlich abgemagert aus; im ganzen Lager, das an 1000 Insassen gehabt, fand sich nicht eine Last Getreide vor. Zuletzt hatte Quawa überhaupt nur noch von der Jagd gelebt; er soll kürzlich an 30 Elefanten erlegt haben, um für sich und seine Anhänger Lebensmittel zu haben.
Quawa selbst entkam wieder. Tom erbeutete aber sein letztes Besitztum: seinen Patronengürtel aus Otterfell, einen Speer und eine Anzahl Lendenschurze und Halsschnüre aus Perlen von seinen Weibern und Kindern. Unsere Wahehe haben sich bewährt, sie gingen mit solcher Wut gegen die Quawaleute vor, daß sie von Greueltaten und Grausamkeiten zurückgehalten werden mußten.
Das ist ein großer Erfolg, umso mehr, als dem Volk durch diesen Angriff auf das von dem gefürchteten Sultan selbst befehligte Lager nun ein gut Teil von dessen Nimbus des Unbesiegbaren geschwunden ist. Patrouillen, die Tom zur Ermittelung von Quawas Aufenthalt ausschickte, bestätigten die Mitteilungen unserer Gefangenen: Quawa tritt jetzt persönlich in den[S. 154] Kampf, den er mit aller Verzweiflung nun um seine Existenz führt. Jedes Gefecht kostet ihn einige seiner Anhänger, ein Verlust, den er nie mehr ersetzen kann.
12. Januar 1898.
Mein Leberleiden macht sich wieder fühlbar; ich suche ihm mit Karlsbader Salz beizukommen. Der Frühspaziergang, der zu dieser Kur gehört, wird zur Inspizierung der Station benutzt, da ich meinen Mann auf seinem Rundgang begleite.
Die Moschee ist beinahe fertig, es fehlen nur noch die Türen. Zum Beginn des Ramassan soll sie den Arabern übergeben werden. Schon jetzt bitten sie Tom, er möge die heilige Stätte nur noch unbeschuht betreten. Das Fundament für das Hospital ist gelegt; bis jetzt diente eine geräumige, von einem schönen schattigen Baum überschattete Hütte als solches; auch eine geräumige Schauri-Hütte ist bereits in Angriff genommen, halbkreisförmig mit einer nischenartigen Ausbuchtung für den Tisch des Schauri-Leiters, der von da aus sämtliche Anwesende gut übersehen kann. Sobald die Moschee fertig ist, geht es an den Bau einer Markthalle.
Auf der Station wimmelt es von Wahehe, die gleich Tom auf sichere Meldungen warten, um die Quawa-Jagd wieder aufzunehmen. Es ist wirklich viel von den Leuten, trotz der Erntezeit hier wochenlang untätig zu liegen, während auf ihren Schambas die Feldfrüchte der Ernte entgegenreifen. Ihre Anhänglichkeit an Tom hält stand; Dr. Stierling sagte noch gestern: wer weiß, wie sich die Wahehe nach Toms Abgang stellen würden; sie haben sich ihm persönlich unterworfen, und es liegt nahe genug, daß sie seinem Nachfolger auf der Station sich nicht so botmäßig zeigen werden. Dr. Stierling sieht wohl zu schwarz, immerhin bereitet Tom die Wahehe jetzt schon darauf vor, daß er demnächst die Station verlassen werde.
Am 23. ging Leutnant Orthmann nach Idunda ab.
30. Januar 1898.
Aufregende Tage; Patrouillen und Meldungen, aber niemals eine sichere Nachricht. In Rungembe, welches als Sammelpunkt für die Expedition bestimmt war, ist Leutnant Engelhardt mit fast 2000 Kriegern des Merere und der anderen befreundeten Häuptlinge angekommen.
Über den Tod des unglücklichen Unteroffiziers Karsjens berichtet ein Mann unseres Freundes Farhenga näheres: er hatte den Unteroffizier gewarnt, Quawa sei ganz dicht in der Nähe, er solle die Leute, die zu seinem Trupp gestoßen, als Spione festhalten — das ist aber nicht geschehen! Andern morgens wurde plötzlich der Posten vor dem Zelte niedergeschossen, von den sich um das Zelt sammelnden Askaris fielen unter dem mörderischen Mauser-Gewehrfeuer aus dem Dickicht sofort drei Mann, ein Vierter etwas später. Unteroffizier Karsjens erhielt beim Heraustreten aus dem Zelte die tödliche Kugel. Sein Boy trug ihn nach dem Feldbett, wo er binnen wenigen Minuten verstarb.
Die Askaris hatten sich bei dem Überfall sehr schneidig gezeigt; nachdem sie die eigene Munition verschossen, leerten sie die Patrontaschen der gefallenen Kameraden, ehe sie sich ins Pori zurückzogen; Karsjens Boy nahm das Gewehr und die Munition seines Herrn nach dessen Tod an sich und versteckte beides im Gebüsch, wo sie Unteroffizier Schubert, der zur Beerdigung der Leichen an den Unglücksplatz ging, fand. Jeder der Gefallenen hatte zwei Speerstiche in der Brust.
Tom hat in diesen Tagen mit der Verteilung von Saatkorn begonnen. Die Lebensmittel fangen an, knapp zu werden, deshalb hat Tom so viel Korn wie möglich aufgekauft, damit fürs nächste Jahr genügend ausgesät wird. Für jeden Sack Saatkorn, den die Leute erhalten, müssen sie nach der Ernte zwei Säcke zurückgeben. Ich habe vor ungefähr 14 Tagen den ersten frischen Mais geerntet.
Heute meldete ein Mhehe, sein Sohn Magunda, welcher zu Quawas Gefolge gehörte, sei von diesem bei dem Lukanda-Über[S. 156]fall gefangen und getötet worden, weil er sich auf der Station stellen wollte.
7. Februar 1898.
Auf der Station reges militärisches Leben, Patrouillen und Boten kommen und gehen, und die Schauris nehmen kein Ende. Quawas Beweglichkeit erfordert immer neue Maßnahmen. Leutnant Kuhlmann, Feldwebel Merkl und die Unteroffiziere auf den einzelnen Posten, jeder muß von den bei uns „im Hauptquartier“ eingegangenen Meldungen in Kenntnis gesetzt werden und entsprechende neue Instruktion empfangen. In all dem sorgenvollen Trubel nur einmal ein Lichtblick: Msatima kommt, mir seine Aufwartung zu machen, und zwar angetan mit einer roten Bluse, die ich seiner Frau geschenkt hatte. — Leutnant Kuhlmann meldet, daß Quawa weiter westlich zu suchen sei — also wieder neue Dispositionen an die Einzelposten! Herr v. Prittwitz kommt an. Es wird großes Schauri mit sämtlichen Jumben gehalten; als dessen Ergebnis erfolgt die Festnahme des Jumben Makirendi; er wird an die Kette gelegt und ihm Todesstrafe angedroht, wenn seine Leute sich als Verräter zeigen sollten. Das ist eine Gewaltmaßregel, zu der Tom durch die gefahrdrohenden Umstände gezwungen ist, obwohl er ganz genau weiß, wie leicht die Festnahme eines angesehenen Häuptlings schlimme Folgen haben kann. Es bleibt kein anderes Mittel, als den Wahehe zu zeigen, daß sie kein doppeltes Spiel wagen dürfen; viele von ihnen wollen erst abwarten, ob Quawa nicht doch wieder hochkommt, wie damals 1894, wo er bei dem Scheleschen Zuge nach Ubena, und früher, gelegentlich der Zulu-Invasion, nach Ugogo geflüchtet war und nach dem Abzug der Europäer aus seinem Lande triumphierend wieder einzog.
8. Februar 1898.
Es ist eine erschütternde Tragödie, die sich in unserem weltfernen Winkel hier abspielt: der Kampf um die Heimat, und die Treue, mit der dem vertriebenen Herrscher seine Krieger Gefolg[S. 157]schaft leisten, versöhnt auch uns, seine Feinde, mit diesen schwarzen Söhnen der Berge. 1½ Jahr dauert nun schon dieser Vernichtungskampf, Hunderte von Kriegern sterben als Märtyrer ihrer Vasallentreue für einen Herrscher, der ihnen weder Nahrung noch Kleidung mehr gewähren kann, während sie täglich erfahren, daß ihre auf und bei den deutschen Stationen angesiedelten Stammesgenossen ein sorgenfreies Dasein genießen. Die Tragik dieses Kampfes, in welchem ein Volk für das Leben seines Sultans verblutet, trat mir gestern recht ergreifend vor Augen: die Gefangenen sollten über den Aufenthalt ihres Herrn aussagen. Man sah ihre innere Aufregung, die Angst, als Aufrührer zum Tode verurteilt zu werden — aber Quawas Name kam nicht über ihre Lippen. Das sind Feinde, denen man die Achtung nicht versagen kann.
Ein anderes Verhör brachte etwas zu Tage, was Tom längst vorausgesehen hatte: 26 von Unteroffizier Lachenmeyer eingebrachte Leute waren Spione Quawas! Auf seinen Befehl hatten sie sich unterworfen, um ihren Herrn mit dem Ertrage unserer Felder zu versorgen und ihm genaue Angaben über die Stärke der einzelnen Stationen und detachierten Posten zu machen. Dann sollte an einem bestimmten Tage der große Schlag gegen uns geführt werden! Gott sei Dank, daß wir die Möglichkeit eines solchen Überfalles niemals außer acht gelassen haben — was wäre aus uns geworden, wenn Tom im Gefühl scheinbarer Sicherheit die schärfste Beaufsichtigung unserer neuen Ansiedler und Zuzügler nicht so streng durchgeführt hätte.
Unter diesen Spionen waren auch die Anführer des Überfalles von Mtandi und der Mörder des unglücklichen Karsjens; sie waren dem Feldwebel Merkl als Patrouillenführer mitgegeben worden; kein Wunder, daß der Streifzug keinen Erfolg hatte. Karsjens hatte, wie sich nun herausstellt, einen Schuß durch beide Oberschenkel erhalten, der ihn niederstreckte, den von seinem Boy auf dem Feldbette niedergelegten Wehrlosen hat der Mörder mit zwei Speerstichen in die Brust getötet.
Unsere Leute sind furchtbar erbittert; als für einen sofortigen[S. 158] Streifzug unter Unteroffizier Schubert „Freiwillige vor!“ kommandiert wurde, traten unsere Askaris sämtlich wie ein Mann vor.
10. Februar 1898.
Heute marschierte Herr v. Prittwitz ab nach Himbu; Bauleiter Selling ist nach Kuifuri, um dort nach Holzarten zu suchen, denen die Bohrkäfer nichts anhaben können. Auf der Station wimmelte es von gefangenen Weibern, aber auch halbverhungerte Träger finden sich ein; von Förster Ockels Karawane sind hier schon 16 Mann eingetroffen.
12. Februar 1898.
Jetzt ist kein Halten mehr; einer der Führer hat Quawas Lagerplatz verraten! Tom benachrichtigte sofort alle von der Station abkommandierten Europäer, er selbst zog sofort los (nur ein Unteroffizier bleibt hier). Zunächst bis Ndéuka, in der Nacht geht’s dann weiter, so daß bei Tagesanbruch das Lager überfallen werden kann. Gott gebe ihm diesmal Erfolg, damit endlich diese furchtbare Aufregung aufhört, der ich auf die Dauer doch nicht gewachsen bin.
8 Männer kommen mit 48 Weibern, um sich zu unterwerfen.
13. Februar 1898.
Aus der Nachmittagsruhe wurde ich durch Lärm auf der Veranda gestört. Zuerst glaubte ich, es sei Tom, und rannte hinaus, fand mich aber einem schwarzen Ehepaare gegenüber; es war schwer zu sagen, wer von beiden am betrunkensten war, der Mann oder die Frau; diese war von ihrem Gatten dermaßen geschlagen worden, daß ihr das Blut am Körper herunterlief, bei mir hatte sie Schutz suchen wollen. Ich nahm ihr das Kind ab, das jeden Augenblick in Gefahr war, ihr vom Arme zu fallen, und warf beide Eltern schleunigst hinaus; dann brachte mir ein Suaheli noch ein weinendes Kind, welches nach mir verlangt hatte. Es ist ein unruhiges Leben auf der Station, eine unheimliche Aufregung hat sich aller bemächtigt; auf der Wache können[S. 159] sie kaum alle die Männer und Frauen unterbringen, die täglich eingeliefert werden.
17. Februar 1898.
Gestern kam Feldwebel Merkl mit vielen Gefangenen zurück; er ist krank und elend, die Strapazen dieses Marsches bei Tag und Nacht haben den kräftigen, kerngesunden Mann entsetzlich mitgenommen. Was unsere deutschen Unteroffiziere hier leisten müssen, davon macht man sich in Deutschland keinen Begriff, aber sie sind mit einem Pflichteifer und mit einer Liebe zur Sache dabei, die höchste Anerkennung verdienen.
Da ich am 14. keine Nachricht von Tom erhielt, muß ich annehmen, daß sein Zug erfolglos war. Heute kommt auch die Bestätigung.
18. Februar 1898.
Von Quawas Anhängern macht sich besonders Kolakola bemerkbar; er hat unsere Leute bei Kissinja überfallen und sich dann in unserem Tale, unweit der Station, Eßvorräte geraubt; dann überfiel er, nach Toms Abmarsch, Lula, schleppte mehrere Kinder fort und erschlug neun Leute. Was mir am meisten Sorge macht, ist, daß Tom einem solchen unvorhergesehenen Überfall auf dem Marsche zum Opfer fallen kann. Einer seiner besten Wahehe erhielt von einem im Grase versteckten Feind einen Speerstich in den Oberschenkel, an welchem er verblutete.
23. Februar 1898.
Tom kam sehr elend zurück. Das Kommando hat er Herrn v. Prittwitz übergeben, da der Hauptteil des Zuges erledigt.
26. Februar 1898.
Großer Ramassan mit der üblichen Gratulationscour. Zuerst kommen die schwarzen Händler; sie werden von Tom zur Rede[S. 160] gestellt, weil sie sich geweigert hatten, unsern Askaris den Mais für 5 Rupien zu verkaufen; sie verbrauen den Mais nämlich lieber zu Pombe (pombe = eigentlich Bier aus Hirse) und verdienen am Sack dann 15 bis 20 Rupien. Dann erscheinen die Araber und Beludschen, die ich mit Tee, Kaffee und Schokoladenplätzchen bewirte. Wir waren in nichts weniger als festlicher Stimmung — sollte doch noch an demselben Tage das Urteil an den vom Kriegsgericht zum Tod durch den Strang Verurteilten vollstreckt werden! Von den zwölf Verurteilten waren drei begnadigt worden.
Nachmittags kamen sämtliche Sudanesenfrauen, 36 an der Zahl! alle in ihrem schönsten Staat, mit silbernen Ketten und Armringen von riesigem Umfang und großen Silberdosen als Anhängsel, in denen sie ihre dawa (Medizin, Zaubermittel) bewahren. Mit ihren faltigen, farbigen Gewändern und weißen Tüchern über den schwarzen Gesichtern bilden sie wirklich malerische Gruppen. Sie werden wie die Araber mit Tee, Kaffee und allerlei Süßigkeiten bewirtet, ebenso wie diese ihre Sandalen ablegen, ziehen auch sie vor dem Eintritt in mein Zimmer ihre Schuhe aus.
6. März 1898.
Seit dem 27. Februar liegt Tom an schwerem Bronchialkatarrh zu Bett; inzwischen kam Leutnant Orthmann zurück, er hat sich einen tüchtigen Gelenkrheumatismus geholt, mit dem er drei Wochen lang sich durch die unwegsamen Berge schleppen mußte; heute kam noch Dr. Stierling, mit ihm Leutnant Kuhlmann, der an Milzanschwellung mit starkem Fieber leidet. Sergeant Richter laboriert an seiner Schußwunde, die Wunde eitert noch, und zuletzt wird Lazarettgehilfe Schuster von der 3. Kompagnie auch noch krank, starker Bronchialkatarrh mit hohem Fieber. Von den acht Europäern der Station sind nur zwei gesund.
Tom hat jetzt eine annähernd genaue Liste von Quawas Anhängern aufgestellt: Es müssen deren jetzt noch etwa 250[S. 161] sein. Sein Häuptling Kimulimuli, der sich seinerzeit mit Mpangire gestellt hatte, dann aber wieder heimlich zu Quawa zurückging, ist jetzt bei diesem gestorben; seine Frau hat sich dann erhängt, um ihrem Herrn und Gebieter in den Tod zu folgen. — Als Mpangire noch Sultan war, sollen diese und Kimulimuli den zur Unterwerfung bereiten Quawa mit Gewalt davon abgehalten haben. Wie viel Blutvergießen wäre vermieden worden, wenn Quawa damals mit Tom persönlich hätte verhandeln können.
9. März 1898.
Vorgestern kamen unsere Wahehe von der Expedition zurück. Ich freute mich, das Gaunergesicht unseres braven Farhenga wiederzusehen; gestern trafen der neue Zahlmeister und ein Unteroffizier für die 6. Kompagnie ein; auch Offenwanger soll mit dorthin gehen. Da bleibt also der Doktor allein zurück — über Mangel an Beschäftigung wird er nicht zu klagen haben, er hat hier für vier bettlägerige und zwei revierkranke Europäer zu sorgen — abgesehen von den Schwarzen. Richter mußte operiert werden; es wurden sehr große Knochensplitter aus der Wunde entfernt.
10. März 1898.
Heute besuchten Tom und ich den kranken Leutnant Orthmann. Um jede Zugluft abzuhalten, sind die Wände der Strohhütte ganz dicht verstopft worden; so kann der arme Patient sich nicht einmal die Zeit mit Lesen vertreiben. Wir haben ihm in der Boma ein luftiges, lichtes Zimmer herstellen lassen, damit er dort seine Krankheit leichter übersteht.
Mein Name wird hier schon als Machtmittel mißbraucht! Von unseren Wahehe wird mir gemeldet, daß 20 Händler und Träger nebst zwei Eseln in der Gegend umherziehen und von den Leuten Chakula eintreiben — und zwar in meinem Namen! Tom schickte sofort eine Askari-Patrouille hinter ihnen her, die die Kerle auch richtig abfaßte. Heute erscheinen sie de- und wehmütig und spielen die reuigen Sünder. Zunächst müssen sie den Eigentümern[S. 162] die gestohlene Chakula bezahlen und dann erhalten sie wegen Mißbrauchs meines Namens pro Mann 25 Hiebe. Das hat hoffentlich gewirkt.
Von Quawas nächster Umgebung, seiner Leibgarde, stellten sich heute drei Mann mit Gewehren Modell 71. — Das Ende des Gefürchteten naht!
15. März 1898.
Gestern vergnügtes Picknick bei Farhenga in der Nähe des Aussichtspunktes; abends gegen 9 Uhr kamen wir bei Laternenschein nach Hause. Heute mittag kam Leutnant v. d. Marwitz an; ich hatte ihn mir ganz anders vorgestellt, ein breitschulteriger brünetter Hüne. Herr v. der Marwitz ist seit vier Jahren in Afrika, er war längere Zeit im Kilimandscharo-Gebiete.
16. März 1898.
Leutnant Engelhardt verabschiedete sich heute, er brachte mir noch hübsche Blumen. Zum Kaffee war Herr v. der Marwitz bei uns. Seit langer Zeit wieder große Freude: gute Nachricht von zu Hause!
20. März 1898.
Am 17. war Tom mit Leutnant Kuhlmann nach Dabagga marschiert, um dort nach dem Rechten zu sehen — heute kamen sie schon zurück, also viel früher, als ich erwartete. Solche friedlichen Expeditionen lasse ich mir gefallen, die Zeit vergeht viel schneller, wenn mich die Angst um meinen Mann nicht aufreibt. Morgens besorge ich die Hausarbeit, während der tollsten Mittagshitze ruhe ich oder lese, dann holen mich die Herren ab zum Krocket oder Spaziergang, wir besuchen unseren kranken Leutnant Orthmann und machen Einkäufe bei unserem „Hoflieferant Borchardt“, dem Griechen. So vergehen mir die Tage, die Tom abwesend ist, im Fluge. — Mit meiner Hühnerzucht habe ich viel Verdruß: die eben ausgekrochenen jungen Perlhühner sind nach wenigen Tagen eingegangen. Gestern abend in der blumenge[S. 163]schmückten Messe großes Festmahl, gegeben von Dr. Drewes und Bauleiter Hentrich; die Sache verlief sehr hübsch. Wir waren alle sehr vergnügt und kehrten erst gegen Mitternacht zu den häuslichen Penaten zurück.
Schnapsels Nachkommenschaft ist erloschen, er überlebt sein Geschlecht. Seinen Sohn und präsumtiven Nachfolger hat ein Leopard direkt von unserm Hofe weggeholt; der Posten schoß auf den frechen Räuber, so daß er seine Beute fallen ließ; so konnten wir den treuen Wächter des Hauses andern Tags im Garten begraben. Schnapsel trug bei der Bestattung eine dem tragischen Ende seines Sprößlings angemessene Trauer zur Schau; er scheint ihn noch lange vermißt zu haben. Einige Abende darauf holte der Leopard sich auch noch den andern Hund, und zwar diesmal von der Veranda!
Unter unserem Dach hat sich ein Bienenschwarm eingenistet, alles Ausräuchern ist vergeblich, wir müssen uns die Mitbewohner also gefallen lassen.
30. März 1898.
Tom ist wieder hinter Quawa her! Heute brachten unsere Wahehe einen Trupp Gefangener ein; zu unserer freudigen Überraschung waren darunter Quawas wichtigste Frauen und seine Schwester. Diese wollte Tom an Quawa zurückschicken mit der Botschaft an ihren Bruder, er solle sich mit seinem ganzen Anhange stellen, als Strafe würde er nur des Landes verwiesen werden, sein Leben sei bei gutwilliger Unterwerfung nicht bedroht. Allein die Schwester weigerte sich, diese Botschaft zu überbringen, weil Quawa sie ohne weiteres dafür töten würde. Es befanden sich weiter unter den Gefangenen fünf Sultanstöchter, Schwestern des jetzigen Sultans Merere, der sie nach Ubena abholte, ferner Tochter und Nichte des Sultans von Sikki, erstere eine interessante Erscheinung, von präraffaelisch schlankem Wuchs mit feinen Zügen und großen, traurig blickenden Augen — ich mußte an die zarten und doch so vornehmen Frauenbilder von Alessandro Botticelli denken. Für Tom war diese Begegnung mit der Tochter des[S. 164] Sikkisultans von besonderem Interesse: als er 1893 dessen Boma stürmte, waren gerade Quawas Abgesandte dort, um diese Tochter für ihren Herrn als Frau zu holen; sie entging damals nur knapp der Gefangenschaft — heute hat sie das Geschick doch ereilt. Sie berichtete uns, Quawa habe geäußert, wenn er gewußt hätte, daß wir uns so lange in Uhehe halten würden, hätte er sich gestellt; er habe angenommen, daß wir auch diesesmal, wie 1894, bald wieder abziehen müßten.
Während ich beim Entwickeln photographischer Platten bin, höre ich großes Geschrei — eine gute Nachricht ist von der Expedition eingetroffen: am 26. hat Tom das Lager Quawas aufgestöbert und zersprengt: diesmal bestand es nur aus einzelnen, im Gebüsch verstreuten Feuerstellen; der Sultan selbst entkam ins Pori, sein Schwager fiel, einer seiner Schwiegersöhne und mehrere Weiber und Kinder wurden gefangen, darunter ein sechzehnjähriger Sohn, alle bis zum Skelett abgemagert. Tom schickte den ganzen Troß mit den Wahehe zurück, um den Schein zu erwecken, die Expedition sei nach der Station zurückgekehrt, er selbst blieb mit Leutnant v. der Marwitz und den Unteroffizieren Schubert und Hammermeister im Versteck, um die Versprengten noch einmal zu überraschen, die sich wahrscheinlich an dieser Stelle wieder zusammenfinden würden. Eine der gefangenen Quawafrauen hatte kurz vorher einen Knaben geboren; beide befinden sich nach den Anstrengungen des Marsches wohl. Auch bei unserem Effendi ist der Storch eingekehrt — übrigens, um auch diese naturwissenschaftliche Tatsache festzustellen: die jungen Erdenbürger kommen mit weißer Haut zur Welt und bilden einen eigenartigen Farbenkontrast zu ihren schwarzen Müttern; von der zweiten Woche an beginnen sie nachzudunkeln.
2. April 1898.
Der 1. April brachte mir eine freudige Überraschung: Tom kam zurück. Sein Plan war richtig: die Quawaleute sammelten sich auf einem Maisfelde, um Chakula zu holen; sie wurden überfallen, und in dem Kampfe fielen die meisten von Quawas letztem[S. 165] Anhange, viele wurden gefangen, und der Rest ist dermaßen zersprengt, daß es nicht mehr lohnte, sie weiter zu verfolgen. In die Freude über Toms glückliche Rückkehr mischte sich auch ein gut gemessen Teil Stolz, daß es wiederum mein Gatte war, der unsere schlimmsten Gegner in ihrem eigenen Lager angegriffen.
6. April 1898.
Gestern feierten wir Leutnant Kuhlmanns Geburtstag; früh sandte ich ihm eine Sandtorte und einen Likörbecher, mittags waren der „Jubilar“ sowie Herr v. der Marwitz und der neue Zahlmeister unsere Gäste. Ich bin mit meinem Koche schon so eingefuchst, daß unsere afrikanischen Diners immer vorzüglich klappen! Von der Arbeit macht eine deutsche Hausfrau sich freilich keine Vorstellung.
Heute traf ein Mann auf der Station ein, dem Quawa früher einmal die Hände und Ohren abgeschnitten und ihn derart verstümmelt an seinen Sultan zurückgesandt hatte, um diesem die Strafe für Verräter ad oculos zu demonstrieren!
Mittags 12 Uhr marschierte Tom wieder ab; Herr v. der Marwitz und Sergeant Richter, dessen Wunde noch immer nicht ganz verheilt, begleiteten ihn: auf den Feldern von Iringa sind Spuren gefunden worden, die auf Quawa deuten. Es sollen nur drei kleine Lasten mitgenommen werden, da muß ich genau überlegen, welche Stücke unumgänglich nötig, welche entbehrlich sind.
Karfreitag.
Ich feierte den „stillen Freitag“ in Wahrheit in aller Stille — Gott gebe meinem Manne den langersehnten Erfolg, damit das Land nach jahrelangen Kämpfen endlich zum Frieden komme! — Ein gutes Anzeichen: kurz nach Toms Abmarsch stellte sich ein Krieger aus Quawas nächster Umgebung! Tom ist auf der richtigen Spur; damit unser Todfeind diesmal nicht ausbrechen kann, marschieren Merkl und Hammermeister, die eben erst von einem Zuge zurückkamen, gleich wieder in den von Tom ihnen bezeichneten Richtungen ab; überall sieht man die Signalfeuer unserer Wahehe: das Wild ist umstellt!
Als Belohnung für die Einlieferung Quawas hat das Gouvernement große Elefantenzähne im Preis von 5000 Rupien ausgesetzt, die hier für jedermann zur Ansicht ausliegen.
Ostersonntag.
Tom kehrte heute zurück. Er hat dreimal Quawas Feuerstelle gefunden, einmal war er, wie gefangene Weiber aussagen, bis auf 50 Meter an Quawa heran, als dieser noch mit der Gewandtheit eines Wiesels im Pori verschwand. Auf dem steinigen Boden war schließlich auch für Waheheaugen die Spur nicht mehr erkennbar. Mit einem guten deutschen Schweißhund hätte man die Verfolgung weiterführen können.
Von seiten unserer Jumben kommen sehr häufig — so auch heute — Lasten mit Chakula für uns an; sie schicken sie als den üblichen Sultanstribut; als solchen nehme ich sie natürlich nicht an, sondern erwidere das Geschenk mit dem gleichen Werte an Zeug, aber erst durch die ausdrückliche Erklärung, daß ich das als ein Gegengeschenk, nicht etwa als Kaufpreis betrachte, kann ich sie zur Annahme bewegen.
15. April 1898.
Was Tom im Dezember vorigen Jahres in einem Berichte an den Gouverneur in bestimmte Aussicht gestellt hatte, ist in Erfüllung gegangen; binnen vier Monaten wird Quawa, von allen seinen Anhängern getrennt, dem Hungertod im Pori verfallen sein. Nach dem Verzeichnis, das Tom von allen Quawaanhängern zusammengestellt und dessen Richtigkeit durch die Aussagen von Gefangenen und durch Berichte unserer Patrouillen bestätigt wurde, kann er jetzt nur noch seinen ältesten Sohn und präsumtiven Nachfolger Sapi, einen jüngeren Sohn und zwei Mann der Leibwache bei sich haben. Seine Spur wurde dicht bei unserer Station wiedergefunden, auf einem Berge, von dem aus man einen guten Überblick hat. Der Blick auf das blühende, rege Leben in der Stadt, auf die Boma, die vielen Ansiedelungen und auf unser massiv aus Steinen gebautes Haus — ein solches[S. 167] hat er wohl nie vorher gesehen — mag ihm eindringlich genug bewiesen haben, daß seine Hoffnung auf den baldigen Abzug seiner Feinde diesmal nicht wieder in Erfüllung gehen wird! — In diesen Tagen fieberhafter Aufregung, wo alles aufgeboten wurde, den Todfeind zum entscheidenden Kampfe zu stellen — hat dieser selbe gehetzte Flüchtling in einer Tembe unweit der Station übernachtet, sich am langentbehrten Herdfeuer Speise bereitet und die müden Glieder geruht! Merkls Patrouillen sahen den Rauch dieser Tembe und wollten darauf zu marschieren, allein die führenden Wahehe hielten die Askaris unter allerhand Ausflüchten davon ab: es seien Leute in jener Hütte, die das Wild von den Feldern abhalten sollten, und ähnliches. Die Sache erschien aber unsern Askaris verdächtig, sie gingen in der Richtung der verdächtigen Tembe vor, und richtig: von einem als Posten ausgestellten Jumben gewarnt, eilte Quawa mit seinen beiden Söhnen und den letzten beiden Kriegern seiner Leibwache dem Walde zu, nachdem er noch einen unserer Askaris erschossen. Die Kugeln unserer Patrouille erreichten ihn nicht mehr. Der Wald nahm ihn in seinen Schutz. — Doch der Überfall sollte gute Folgen haben; zwei Tage danach stellten sich die beiden Quawasöhne und die beiden letzten Krieger; sie hatten ihren Herrn im Pori nicht wiedergefunden! —
So ist denn Quawas Geschick besiegelt! Er steht nun ganz allein, jede Aussicht auf Unterstützung, auf Zufuhr ist ihm abgeschnitten; wird er seinen Ausspruch wahr machen, den er einst getan: er werde sich erschießen, sobald sein Sohn in die Hände des Bana Kapirimbu fiele? In der Tembe fanden die Askaris Quawas Messer und Trinkbecher. Die Leute erzählen sich, der Sultan habe weder Feuerholz bei sich, noch, verstehe er überhaupt selbst Feuer anzumachen, da er hierfür immer seinen besonderen Diener gehabt habe. Trotz aller Sorge und Todesangst, die ich in diesen zwei Jahren um meinen Mann gelitten, hätte ich dem tapferen Feinde doch ein anständigeres Ende, den Tod von einer deutschen Kugel, gewünscht, als es ihm jetzt beschieden ist: Hungertod oder Selbstmord!
Mgaga, den 6. Mai 1898.
Der Arzt hat uns am 28. April auf Safari geschickt; die Strapazen der letzten Streifzüge haben Tom sehr mitgenommen, und auch meine Nerven bedürfen nach all der Aufregung der Auffrischung. Tom benutzt diese „Erholungstour“ zur Erkundung und Kartierung der Umgegend. Wir machen kartographische Aufnahmen der Wege, stecken die Basis für die trigonometrischen Messungen ab; Azimutbestimmung, Entfernungsmessen, Bestimmung der geographischen Breiten füllen unsere Tage aus. Mein Herbarium schwillt an, der Dolmetscher hat mir eine Blumenpresse angefertigt, sie ist etwas sehr geräumig ausgefallen (für eine Reise um die Erde könnte ich sie als Handkoffer benutzen), aber sie erfüllte ihren Zweck. Vom Gongo ya Luimtuira, einem 2100 Meter hohen Felsengipfel, großartige Aussicht! Am 3. Mai waren wir wieder in unsern alten lieben Bergen, die wir schon früher durchwanderten. Leider werden unsere astronomischen Ortsbestimmungen durch trübes Wetter sehr beeinträchtigt, auch die Kälte macht sich recht unangenehm bemerklich. Einmal mußten wir mit unserm Lager dem Überfalle eines echt afrikanischen Feindes weichen; die Siafus, eine bösartige Ameisenart, die sich weder mit Wasser noch mit Feuer vertreiben lassen, zwangen uns, den Lagerplatz weiter den Berg hinan zu verlegen. Wahrscheinlich hatten sie von dem großen „Schlachtfest“ Witterung bekommen; da unser Mehlvorrat verbraucht war, ließ Tom nämlich zum Jubel unserer Leute einen Ochsen schlachten; es war ein buntes, bewegtes Bild, als er im Kreise der rings um ihn hockenden Schwarzen stand und jedem nach Verdienst und Würdigkeit seine Fleischportion zuteilte; die helle Freude leuchtete aus den Augen der armen Kerls über die Aussicht, sich einmal wieder an Fleisch sattessen zu können.
Mgaga, 10. Mai 1898.
Nach dem neunstündigen Ritt bin ich heute sehr müde. Unser Lagerplatz befindet sich an einer Stelle am Saume des Urwaldes, an der vor kurzem noch unsere Feinde sich häuslich eingerichtet hatten; eine Anzahl Feuerstellen ist noch vorhanden, auch[S. 169] einige niedere Grashütten wurden von unseren Askaris aufgestöbert. Tom ist allein losgezogen, ich habe inzwischen „Höhe abgekocht“, Pflanzen gepreßt und mich in Semmlers „Tropische Agrikultur“ vertieft. Eine angenehme Unterbrechung bot die Ankunft der Postsachen, mit ihnen der vergessene — Spiegel, der aus Versehen nicht mit eingepackt worden war. Früher hätte ich es einfach für unmöglich gehalten, daß ein weibliches Wesen vierzehn Tage lang ohne Spiegel existieren könne, ich bin aber doch schon so stark verafrikanert, daß ich ihn wirklich kaum noch vermißte. Als Ersatz für Schnapsels Sohn Pombe, den uns der Leopard totgebissen, haben wir jetzt eine Tochter dieses in der Blüte seines Daseins Geknickten in Gestalt eines muntern, sehr zierlichen Hündchens als Haus- bzw. Zeltgenossen, dem wir, seinem lebhaften mutwilligen Wesen entsprechend, den Namen „Sillery“ gaben; die Dynastie Schnapsel blüht also weiter. An Stelle meines bisher besten Boys — er stand bei allen Gläubigen als Zugehöriger zur Familie der direkten Nachkommen des Propheten in hohem Ansehen —, den ich seinem Vater auf dessen Wunsch zurückgab, habe ich jetzt einen jungen Mhehe, ein prächtiges Kerlchen mit großen, klugen Augen. Mein Koch klagt mir wieder sein Hauskreuz: seine bessere Hälfte behandelt ihn zu schlecht! Das würde mir nun wenig Kopfschmerzen machen, wenn diese ehelichen Zwistigkeiten sich nicht auf meine Küche erstreckten. Eines schönen Tages war meine „Perle“ verschwunden — für mich ein unersetzlicher Verlust! Tom hetzte sofort den Wali und unsern Freund Farhenga auf seine Spur, die auch Leute auf die Suche schickten; überdies wurde für seine Einlieferung ein Rind als Belohnung ausgesetzt! Endlich — ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, meine Perle je wiederzusehen — kam mein Mpischi ganz von selbst wieder an — seine Frau hatte ihn wieder mal so schlecht behandelt, daß er im Pori Schutz gesucht hatte. Hoffentlich wirkt die Safari auch auf seinen Lebensmut wieder auffrischend; noch hat er sich von seinem Seelenschmerz nicht erholt.
12. Mai 1898.
Tom wieder unterwegs, um womöglich die Quelle des Kihansi zu finden. Aus Berlin traf ein Brief von Toms Jugendfreund, Leutnant v. Thaer, ein, der mich meiner Lieben daheim wegen sehr beunruhigt. Herr von Thaer ist sehr besorgt um unser Schicksal; ihm war die Schreckensnachricht zugegangen, Tom und ich seien von den Wahehe ermordet worden, selbst die Einzelheiten dieses Mordes waren angegeben; auf persönliche Anfrage beim Auswärtigen Amt hatte man ihm gesagt, amtlich sei nichts derartiges bekannt, nach einigen Tagen wurde die Nachricht dann auch offiziell als unbegründet bezeichnet. Hoffentlich bewährt sich auch an uns der alte Volksglaube: daß Totgesagte ein hohes Alter erreichen! Welcher Schrecken aber für alle unsere Lieben daheim, wenn sie tagelang unter dem fürchterlichen Druck der Ungewißheit leben müssen, falls das Gerücht auch zu ihnen gedrungen ist! Ich habe die Briefe von zu Hause noch nie mit solcher Sehnsucht erwartet, wie diesmal.
Dabagga, 15. Mai 1898.
Toms topographische Ausbeute ist reichlich: er hat die Quellen nicht nur des Kihansi, sondern auch die des Mtitu festgestellt; so sehr ich mich über jeden Erfolg meines Mannes freue, so unzufrieden bin ich doch manchmal mit ihm, denn im Eifer, das vorgesetzte Ziel zu erreichen, vergißt er Essen und Trinken; so hat er auch diesmal wieder den ganzen Tag nichts genossen; er war aber über das Ergebnis seiner Erkundungsmärsche so vergnügt, daß ich die Gardinenpredigt, mit der ich ihm das Abendbrot zu würzen gedachte, für eine bessere Gelegenheit noch zurückhielt.
Der Regen hat uns übrigens auf dieser geographischen Expedition zu vielen Marschpausen gezwungen, da wir bei trübem, nassem Wetter keine genauen Aufnahmen erzielen. Tom hat jedoch seine Karte um eine große Zahl wichtiger Punkte bereichern können, und für mich war es noch besonders wertvoll, unser Gebiet so kreuz und quer zu durchstreifen.
Meine Sorge, daß unsere Lieben in Deutschland durch die[S. 171] Tataren- oder vielmehr „Kaffern“-Nachricht von unserer Ermordung in Angst gesetzt seien, wird durch heute eingelaufene Zeitungen bestätigt: Papa hat nach Dar-es-Salaam um Nachricht telegraphiert. Nun haben sie inzwischen wohl alle die beruhigende Nachricht erhalten, daß es uns gut geht. Wie mag wohl das Gerücht entstanden sein? Gott sei’s gedankt, Toms politische Haltung den Schwarzen gegenüber, sein kluges, freundliches Eingehen auf die nationale Eigenart der einzelnen Stämme hat uns die Herzen dieser großen Kinder Schritt für Schritt gewonnen, wir fühlen uns sicher mitten unter ihnen. Wer hätte früher je gedacht, daß die stolzen Wahehekrieger einst für die Weißen friedliche Arbeit tun würden? Jetzt schlagen sie Wege für uns durch den Urwald und sind anstellig für jede friedliche Beschäftigung. Selbstverständlich lassen wir uns nicht in untätige Sicherheit einwiegen, sondern halten die Augen nach allen Seiten hin offen. So hat Tom jetzt für die Feldarbeit auf der vom Förster Ockel eingerichteten landwirtschaftlichen Versuchsstation hier in Dabagga auch Wapawagas aus dem Bezirk Uhehe eingestellt; es hatten sich auf die erste Aufforderung hin sofort 30 Mann gemeldet, vorsichtshalber wurden aber erst 15 zur Probe angenommen; sie mußten sich jeder in einem besonderen, mit ihrem Handzeichen versehenen Kontrakt auf vorläufig drei Monate verpflichten, eine Förmlichkeit, bei der sie sich ungemein wichtig vorkamen; jetzt führen sie mit viel Geschick den Spaten; der Förster ist sehr zufrieden mit ihnen. Ob sie aushalten werden, ist eine Frage der Zeit. Neue Besen kehren gut. Je länger man in Afrika lebt, je klarer offenbart es sich einem, daß das Gedeihen der Kolonie davon abhängt, wie man sich die Schwarzen erzieht; ihre richtige Behandlung ist eine Kunst, für die nicht jeder zugänglich ist.
Ich war von Dabagga überrascht, es würde sich bei der schönen Lage zum Luftkurort eignen. Der Förster hat sich ein allerliebstes Häuschen gebaut und sein Wohnzimmer schmuck und heimisch eingerichtet. Im Kamin prasselte ein tüchtiges Feuer, um welches wir uns, da es empfindlich kalt geworden war, gemütlich zusammenfanden. Der Boden ist vorzüglich: Weizen[S. 172] und Raps gedeihen gut, ebenso Erdbeeren, Mandeln und allerlei Baumarten; nur mit dem Gemüse klappt es noch nicht, ohne ersichtlichen Grund. Nachmittags hielten wir Scheibenschießen: von den Askaris erzielte der beste Schütze zweimal zehn Ringe bei freihändigem Schießen auf 170 Meter.
Als besonders denkwürdig notiere ich noch: photographierte das Forsthaus und den ersten deutschen Pflug im Lande Uhehe!
Suka, 20. Mai 1898.
Am 18. Mai Abschied vom gastlichen Förster[8], vier Stunden Marsch nach dem Ifigaberge, wo Tom Vermessungen machte, Basis absteckte und andere topographische Arbeiten. Die Safari nähert sich ihrem Ende, wir denken stark an den Heimmarsch. Wahehe, die noch vor wenigen Wochen gegen uns gekämpft haben, sind unsere Führer!
Station Iringa, 24. Mai 1898.
Am Sonntag, den 22., trafen wir wohlbehalten wieder ein, abgesehen von einem ohne Folgen verlaufenen Sturz mit dem Maultier, ohne jeden Unfall; ich habe mich prächtig erholt — von Tom ist es mir fraglich, er hat sich auf der Safari wenig Ruhe gegönnt. Unser Haus fanden wir schön mit Blumen geschmückt, den Tisch zierlich gedeckt; dann kamen sämtliche Europäer an, uns zu begrüßen; wir saßen noch zwei Stunden beim Weine und erzählten uns.
Am 2. Pfingstfeiertag, 30. Mai 1898.
Iringa wird Weltstadt! Wir sind Poststation geworden, als sichtbares Zeichen unserer Zugehörigkeit zum Weltpostverein wurde der erste Briefkasten angebracht, und jeder drängt sich, seine Korrespondenz ihm eigenhändig einzuverleiben! Gleich am ersten Tage wurden ihm über 500 Postkarten anvertraut, die der staunenden Mitwelt von dem großen Ereignis Mitteilung machen[S. 173] sollten. Natürlich gab das auch Anlaß zu einer mehr feucht-fröhlichen wie feierlichen Einweihung. Für Leutnant Braun, der auf Urlaub geht, kam Leutnant Bischoff als Ersatz, für Feldwebel Langenkemper Feldwebel Schütz, mit ihnen Tischler Wunsch und vier Goanesen, die sich auf Tischlerarbeit verstehen. Die Station soll gut ausgebaut werden; projektiert sind zunächst ein Försterhaus und ein Haus für den demnächst eintreffenden Landwirt Hirl.
Gestern mittag zum 1. Pfingstfeiertag haben wir die Herren bei uns angefeiert, da gab’s denn morgen für mich viel Arbeit; nachmittags ruhte ich ein Stündchen, um 7½ Uhr waren wir in der Messe eingeladen. Das war ein anstrengender Tag. Zum Pfingst-Heiligenabend war großer Zapfenstreich mit Fackelzug und am Sonntag früh großes Wecken — ganz so, wie es sich für eine deutsche Garnisonstadt gehört!
31. Mai 1898.
Leutnant v. der Marwitz marschierte heute ab, um die Station Mlangali zu übernehmen. Quawa ist verschollen, allerorts, wo er in letzter Zeit sich in den Bergen aufgehalten, wird nach seinem Gewehr gesucht; man vermutet, daß er tot sein muß, denn es ist kaum anzunehmen, daß er so ganz allein sich im Pori halten kann.
Durch ganz Uhehe zieht sich jetzt ein Netz von Straßen. Die Wahehe, noch vor kurzem der Schrecken aller Nachbarstämme, bewähren sich in friedlicher Arbeit; sie hauen die Wege durch den Urwald, auf der Station helfen sie beim Bau einer Tembe, ja auf unserer Safari trugen sie sogar unsere Lasten mit Chakula. Ihre stramme Organisation zeigte sich besonders beim Bau längerer Straßen, sie arbeiteten unter besonderen Aufsehern, jeder Trupp an der ihm übertragenen Strecke, und ihre Jumben haben sich in der Nähe der Baustrecke niedergelassen, um das Ganze besser kontrollieren zu können.
1. Juni 1898.
Der Monat fing bös an. Das Kriegsgericht mußte einen von einer Patrouille eingebrachten Msagira zum Tode verurteilen,[S. 174] der einige unserer Askaris ermordet hat; heute fand die Exekution statt. Solch ein Tag ist für mich schrecklich; gebe Gott, daß es der letzte gewesen. — Als seinerzeit der Mörder gehenkt wurde, der den Araber und seine Leute erschlagen hatte, baten Leute aus unserer Stadt um seine Leiche, um sie aufzuessen! Sie halten das für die wirksamste Rache an dem Mörder und für eine Sühne, die sie dem Erschlagenen schuldig sind. Welch schwere Aufgabe, in dieser geistigen Nacht einen Funken göttlichen Geistes zu erwecken.
4. Juni 1898.
Meine kleinen Mädels und zwei Frauen kauern auf der Veranda hinter dem Hause und reiben Weizen zu Mehl; ihre Handmühle besteht aus einem flachen, muldenartig vertieften Stein, auf welchem sie die Körner mit einem andern Stein zerreiben. Ihr fröhliches Lachen und Singen dringt bis zu uns herein, so daß ich sie ab und zu zur Ruhe bringen muß, da wir bei dem Lärm nicht arbeiten können. Die Jungen sieben das Mehl durch; ich erziele so ein wirklich gutes, reines Brotmehl.
Mit der Ernte, unserer zweiten in Uhehe, sind wir sehr zufrieden: 5 Lasten Saat haben 106 Lasten = 53 Zentner ausgedroschenen Weizen ergeben.
Heute habe ich einen 80 Pfund schweren Elefanten-Stoßzahn im Werte von 400 Rupien gekauft, ein schöngeschwungenes Prachtexemplar und großartiges Dekorationsstück! Es sah bei mir aus wie in einem Laden: auf dem Boden hatte ich alles ausgebreitet, was sich die Leute als Gegenwert gedungen hatten; nun suchte sich jeder nach seinem Geschmack und Bedarf aus. Sie waren so vergnügt über das gute Geschäft, daß sie wie berauscht mit ihren Schätzen abzogen. Die Händler in der Stadt werden nun ein paar gute Tage haben.
Die deutsche Reichspost funktioniert übrigens doch noch nicht mit fahrplanmäßiger Sicherheit, trotz des neuen Briefkastens: unsere Weihnachtskiste aus Liegnitz ist heute erst angelangt. Wir sehen hier aber weniger auf die Fixigkeit, und wenn’s nur mit[S. 175] der Richtigkeit stimmt, dann ist die Weihnachtsfreude auch im Juni groß! Diesmal bin ich persönlich aber auch ganz besonders auf meine Kosten gekommen: Schokolade, gefüllt und ungefüllt, verzuckerte Walnüsse, Pralinés, gebrannte Mandeln — für die ich immer geschwärmt! — und von Leutnant Glauning aus Berlin ein Postkistchen voll herrlichsten, auserlesensten Konfektes und Früchte! Seit zwei Jahren hatte ich solche süßen Herrlichkeiten nicht gesehen — und nun dieser embarras de richesse! Tom meint, unter einer gründlichen Magenverstimmung würde es wohl nicht abgehen! Aber nein: es wird hübsch haushälterisch mit den Schätzen gewirtschaftet, nur so ab und zu einmal genascht. Der Wein, von dem mir die Eltern schreiben, ist nicht mitgekommen, aber die Schuhe passen vorzüglich. Bis auf die gefüllten Schokoladensachen, aus denen der Likör ausgeflossen, kam alles in tadellosem Zustande an.
7. Juni 1898.
Heute sind’s 14 Jahre seit unserer Verlobung! Ich trug noch das Schulränzel, als wir uns darüber einig waren, daß wir zwei zueinander gehörten. Den 7. Juni feiern wir als den eigentlichen Verlobungstag, den Segen unserer Eltern empfingen wir zehn Jahre später, am 19. Juni 1894. Ich habe jetzt viel Zeit, die Geschichte meines Lebens zu rekapitulieren, denn ich muß seit einigen Tagen liegen. — Überanstrengung in der Wirtschaft nennt es unser Äskulap und verordnet mir Ruhe, nochmals Ruhe und zum drittenmal Ruhe.
13. Juni 1898.
Meine Wirtschaft muß sehen, wie sie ohne mich fertig wird; ich darf vor 10 Uhr nicht aufstehen, dann muß ich warme Bäder nehmen. Juma hat das Plätten hübsch gelernt, er stärkt und plättet die Kragen ganz schön. Das ist ein großer Luxus, der hier, wo alles „ungeplättet“ einhergeht, berechtigtes Aufsehen macht. Die Herren wollen sich nun auch Plätteisen von der Küste kommen lassen. Sergeant Hammermeister ist gestern auf Urlaub[S. 176] nach der Küste abgegangen; wir werden den tüchtigen Mann alle vermissen; Tom schätzte ihn sehr als äußerst zuverlässigen Unteroffizier, und dann war er, was für unsere Verhältnisse besonders ins Gewicht fällt, ein tüchtiger Landwirt, dessen Umsicht wir für den Erfolg unserer Weizenernte viel verdanken, und — last not least — das Schweineschlachten und Wurstmachen verstand er großartig. Feldwebel Richters Wunde eitert noch, Unteroffizier Schubert liegt wieder an Lungenentzündung, den Feldwebel Merkl hat Herr v. der Marwitz mitgenommen, so ist die Kompagnie ohne Unteroffiziere, und Tom und Leutnant Kuhlmann besorgen den Dienst allein. Gestern brachte Farhenga einen Mhehe aus Quawas Anhang mit 14 Weibern und Kindern an.
1. Juli 1898.
Heute haben wir den Tischler Wunsch beerdigt. Binnen 1½ Jahr schon der dritte Europäer, der dem Fieber erlegen — alle drei junge, kräftige Leute. Sie alle haben sich die Krankheitskeime auf den Märschen durch die sumpfigen Niederungen geholt, denn die Lage von Iringa ist anerkannt gesund und vor allem fieberfrei. Der Tod war für den armen Mann eine Erlösung. Ich habe ihn täglich besucht, er war mir so dankbar dafür: nur in den letzten zwei Tagen vor seinem Ende konnte ich seine furchtbaren Qualen nicht mehr mit ansehen, die ihm doch niemand erleichtern konnte! In den neun Jahren, die er in Afrika zubrachte (er war als Laienbruder der katholischen Mission herübergekommen), hat er siebenmal Fieber gehabt, d. h. perniziöses Fieber; die gewöhnlichen Fieberanfälle werden ja nicht gerechnet. Sein Tod wurde durch ein Geschwür herbeigeführt, welches sich nach dem letzten Fieberanfall am Ohre bildete und schließlich bis auf die Kinnladen ging, so daß der Ärmste weder essen noch trinken konnte. Der neue Pater Superior der Mission, Severin, hielt ihm die Grabrede. Das Begräbnis war sehr feierlich.
Mit Pater Severin kam zugleich ein neuer Bruder, der mit dem bisherigen Superior, Pater Ambrosius, in Ubena eine Missionsstation gründen soll.

Station Mlangali.
(Zu S. 173.)
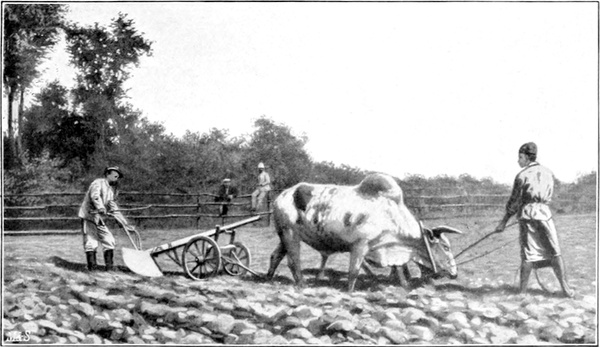
Der erste Pflug im Lande Uhehe.
(Zu S. 172.)
Am 23. vorigen Monats traf von Herrn v. Kleist eine Anzahl Obstbäumchen ein, die er uns zum Geschenk machte; sie waren sehr sachgemäß verpackt, und wir hoffen, daß der größte Teil davon trotz des weiten Transportes gut fortkommen wird. Wir gaben die Bäumchen nach Dabagga, weil sie in unserm Garten doch vielleicht nicht so gut gediehen wären, wie unter der fachmännischen Pflege unserer landwirtschaftlichen Versuchsstation.
Mdogori, 8. Juli 1898.
Heute sind es zwei Jahre, daß wir in Perondo ankamen! Ich sitze im herrlichsten Urwald, der Tag ist ganz für mich, denn Tom kommt heute abend erst von Iduma zurück, wohin ich ihn nicht begleiten konnte, da der Tagesmarsch für mich zu anstrengend. Wir brachen am 4. dieses Monats von Iringa auf. Unser Haus und meine kleinen Totos habe ich einer zuverlässigen Sudanesenfrau übergeben, die ich mir als „Stütze der Hausfrau“ angelernt habe. Sie soll die Wirtschaft führen, solange ich mich nicht darum kümmern kann, und mich pflegen, wenn ich krank bin. — Hoffentlich erfüllt sie die auf sie gesetzten Hoffnungen. —
Gestern habe ich nun auch mein Abenteuer erlebt, ohne das ein „Afrikaner“ eigentlich keinen Anspruch hat, ernstgenommen zu werden — in Deutschland wenigstens —: ich habe einem Löwen gegenüber gestanden! Ich hatte mir ein schattiges Plätzchen zur Siesta ausgesucht, unweit des Lagers, aus welchem die Klänge von „Heil Dir im Siegerkranz“ und „Ich bin ein Preuße“ zu mir herüber drangen, als plötzlich mein Schnapsel mit allen Zeichen des Schreckens und wütend bellend unter meinem Kleide Deckung suchte; ich sah mich um: etwa 40 Schritte ab steht zwischen den Bäumen eine Löwin! Im ersten Augenblick stockte mir der Atem, dann rief ich nach dem Ombascha, der auch sofort angesprungen kam, leider ohne Gewehr. Ich sah die Löwin noch im Dickicht verschwinden und schickte Askaris hinterher, die Spur war aber bald verloren, und die Leute kamen unverrichteter Sache zurück. Nach etwa einer halben Stunde wurde ich in meiner Lektüre wieder durch Schnapsels Bellen aufmerksam; links von mir, kaum[S. 178] zehn Schritt weit, steht die Löwin wieder und äugt nach uns! Hätte mein braver Schnapsel mich nicht gewarnt, hätte die heimtückische Bestie sicher den Sprung getan! Diesmal trat ich aber schleunigst den Rückzug nach dem Lager an, indem ich wieder nach dem Ombascha rief. Auch diesmal entging uns die Beute; sie wird aber sicher wiederkommen. Schnapsel band ich fest, — auf ihn hatte die Löwin es wohl zunächst abgesehen, dann stellten wir eine Falle mit Selbstschuß. Nun habe ich auch mein Löwenabenteuer! Schade, daß Tom nicht zugegen war, sie wäre dann gewiß nicht entkommen. Einen Leoparden, der sich in einer von Dr. Stierling gestellten Falle gefangen, sah ich kürzlich. Das stattliche Tier hatte die Fangeisen mit furchtbarer Gewalt aus dem Boden gerissen und war mit denselben auf einen Baum gesprungen, wo sich die Kette derart in den Ästen verschlungen hatte, daß ihm jede Flucht abgeschnitten war. Ein gutgezielter Fangschuß machte ihm dort ein Ende.
Dabagga, Sonntag den 10. Juli 1898.
Mittags kamen wir hier an; der Förster hat uns ein reizendes Häuschen aus Bambus errichtet, bestehend aus einem Zimmer mit Veranda, und bewirtete uns mit einem trefflichen, von ihm selbst bereiteten Mittagsmahl. Sehr betrübt erzählte er uns, wie ungern er jetzt von der Stätte seiner Tätigkeit scheide; er hat alles so praktisch und wirklich schön eingerichtet, daß er nun nicht gern einem andern Platz machen möchte. Daß er es rasch gelernt hat, die Eingeborenen richtig zu behandeln, beweisen die Wahehe-Ansiedelungen, die sich unter seiner Leitung bei der Station Dabagga schön entwickeln.
12. Juli 1898.
Wir machten einen Ausflug nach Langomoto, herrliche Bergpartien, von denen wir die Stätten der zahlreichen Quawakämpfe übersehen konnten. Auf Anraten des Dr. Drewes, der von Muhanga gekommen war, bewilligte Tom einen Ruhetag — zu[S. 179] meiner Freude, denn dadurch gewinnen wir einen Tag für das schöne Dabagga.
Iringa, 21. Juli 1898.
Endlich! Endlich! Aus vollem, dankbarem Herzen möchte ich es hinausjubeln in alle Welt, die Freudenbotschaft: „All’ Fehd’ hat nun ein Ende“ — Quawa ist tot! Mit dieser Nachricht erst ist Toms sieben Jahre langer Kampf um den Besitz Uhehes zum guten Ende gelangt! Wie dankbar bin ich, daß meinem Mann nun die Freude ward, das Werk seiner unsäglichen Mühe und Sorge, die Arbeit von sieben Jahren voller Kämpfe und Strapazen mit Erfolg gekrönt zu sehen. Nun ist der Name Tom Prince für immer verknüpft mit der Geschichte unserer deutschen Kolonien. Wer will es mir, seiner Frau, verdenken, wenn ich mit frohem Stolze auf den Geliebten blicke; ist er mir doch durch dieses letzte Ereignis in dem blutigen Vernichtungskampfe erst so recht eigentlich neu geschenkt! Wie oft zitterte ich um sein Leben, wenn ich ihn auf dem Zuge gegen Quawa wußte, mit welcher Furcht, mit welch heißem Gebet traf ich stets die Vorbereitungen für seinen Marsch — und durfte ihm doch das Herz nicht schwer machen mit meiner Angst, mußte Frohsinn heucheln, während mir die Angst die Gedanken benahm — und nun steigt die Morgenröte des Friedens strahlend über unsern schönen Bergen auf! —
Das Siegeszeichen, welches Feldwebel Merkl heute bei Tom ablieferte, ist freilich gräßlich — und doch gab es keinen anderen Ausweg, den Tod unseres furchtbarsten Feindes dergestalt ad oculos zu demonstrieren, daß kein Zweifel mehr an seiner endgültigen Vernichtung übrig bleiben kann: Merkl brachte den Kopf des erschossenen Sultans Quawa mit zur Station! Auf seinen ruhelosen Streifzügen durch sein ehemaliges Gebiet war Quawa mit vier Boys, einem seiner letzten Getreuen und dessen Weib und Kind endlich auch in den Bereich der 2. Kompagnie gekommen. Toms Vertreter, Leutnant Kuhlmann, schickte sofort, als dies der Station gemeldet wurde, wie üblich, den Feldwebel Merkl mit[S. 180] 14 Askaris und 10 Wahehe zur Verfolgung aus. Ich lasse am besten unseres braven Merkl Bericht hier folgen:
„Pawaga erreichten wir am 15. Juli 1898 mittags 12 Uhr nach dreizehnstündigem, anstrengendem Marsche. Wir versteckten uns im dichten Busch und verkleideten uns als Wahehe. Hierher ließ ich mir den Jumben Kissogrewe kommen, der die Nachricht zur Station gebracht und aus Furcht, Quawa werde vor dem Eintreffen der Europäer entfliehen, einen Zug gegen Quawa unternommen hatte. Um 5 Uhr nachmittags traf der Jumbe ein, mit drei Boys von Quawa, die gefangen waren. Von den Boys erfuhr ich, daß er nach Makibuta gehen wolle. Er führe einen Karabiner Modell 71 bei sich, an dem vor einigen Tagen der Lauf an der Mündung geplatzt sei, was ihn sehr beunruhigt habe. Sein Begleiter habe eine Jägerbüchse. — Den Ombascha mit fünf Askaris und fünf Wahehe schickte ich nach Makibuta, blieb aber selbst mit den übrigen Leuten hier, weil die am großen Ruaha verloren gegangene Spur Quawas nach Pawaga zeigte und hier das Stehlen in den im dichten Gebüsch versteckten Schamben und den so sehr verstreuten Hütten sehr leicht ist. — Am 16. Juli 1898 wurde das Weib des Quawa begleitenden Mannes gegen Morgen 4 Uhr ergriffen. Sie sagte, Quawa wäre vom großen Ruaha nach dem südlichen Teile von Pawaga gegangen, von wo er nach dem Utshungwegebirge zurück wolle. Sie selbst sei ausgerissen und irre die ganze Nacht umher. Mittags erhielt ich Nachricht, daß Quawa Mais und ein Schaf geraubt habe. Ich nahm sofort die Verfolgung auf. Die Spur, ins Pori in westlicher Richtung führend, konnten nur die Wahehe erkennen. Gegen 5 Uhr verloren auch sie dieselbe und konnten sie bis zum 17. d. Mts. trotz des Umherstreifens nicht wiederfinden. Quawa mit seinem Getreuen und den Boys marschierten jeder in einer anderen Richtung. Das Schaf wurde mit zugebundenem Maule getragen. Am 18. d. Mts. kam der Ombascha zurück. Am 19. schritten wir am linken Ruahaufer in der Richtung Iringa nach der Stelle zurück, wo wir am 16. die Spur verloren hatten. Hier gingen wir durch den Busch auf Humbwe zu. Mittags 12 Uhr erreichte ich es mit[S. 181] dem Ombascha Adam Ibrahim, Askari Said Ali I und Said Borelli und dem Uhehe-Msagira Mtaki. Wir machten Halt, um die zurückgebliebene Karawane zu erwarten. Plötzlich sahen wir einen etwa fünfzehnjährigen nackten Knaben auf uns zukommen, der, sobald er uns sah, die Flucht ergriff, aber doch eingefangen wurde. Auf energisches Zureden gestand er, der vierte Boy Quawas zu sein. Er war des Morgens weggelaufen. Quawa liege drei Stunden weit krank danieder und spucke Blut. Gestern abend habe Quawa seinen Begleiter erschossen. Sofort brachen wir auf. Eine halbe Stunde marschiert, hörten wir in südwestlicher Richtung einen Schuß fallen. Um 2 Uhr nachmittags waren wir nach Aussage des Boys Quawa sehr nahe. Ich beschloß jetzt, Gepäck abzulegen und die Schuhe auszuziehen. Um die Stelle zu beobachten, kletterte ich auf einen Baum. Da der Boden sehr steinig war, war der Marsch ohne Schuhe sehr schmerzhaft. In kurzer Entfernung sahen wir Rauch aufsteigen. Wir mußten etwa 200 Meter auf dem Bauche rutschen. Jetzt konnten wir nicht näher heran, ohne gehört zu werden. Wir sahen zwanzig Schritt vor uns zwei Gestalten, anscheinend schlafend, liegen. Die eine wurde von dem Jumben als Quawa bezeichnet. Da sehr viel dichtes Gebüsch in der unmittelbaren Nähe war und ein Sprung genügt hätte, daß uns Quawa vor der Nase entwischt wäre, wie’s ihm schon oft gelungen, schossen wir auf ihn. Unsere Schüsse waren umsonst; Quawa hatte seinem Leben selbst ein Ende gemacht. Bei ihm war noch nicht die Leichenstarre eingetreten, und den Schuß, den wir gehört, hatte er sich selbst gegeben.“ —
So bleibt der 2. Kompagnie das Verdienst, den Quawafeldzug zum guten Ende geführt zu haben; sie allein hat mit Quawa direkt zu tun gehabt, sie hat ihn aufgestöbert und verfolgt, so ist es nur recht und billig, daß ihr auch jetzt, gerade noch vor Toresschluß, zu dem soldatischen Ruhme treuester Pflichterfüllung auch der materielle Lohn zuteil wird: 5000 Rupien — etwa 8000 Mark hatte bekanntlich das Gouvernement auf Quawas Kopf gesetzt! Dieses Preisausschreiben sollte nur noch bis zum 1. August in Kraft bleiben, es fehlen also nur noch 14 Tage, und Feldwebel[S. 182] Merkl und die 2. Kompagnie wären um den wohlverdienten Lohn gekommen.
Der Jubel, der unsere kleine Welt hier erfüllt, kennt keine Grenzen. Europäer, Soldaten und Eingeborene, einmütig feiern sie alle Tom als den Führer, durch dessen Umsicht und Tatkraft der Quawafeldzug nun endlich beendet ist. Leutnant Kuhlmann hatte alles mögliche ersonnen, um Tom zu ehren, und auch ich kam nicht zu kurz bei all dem Jubel: die Soldatenfrauen trugen mich im Triumphzug durch die Straßen mit Freudengeschrei und Jauchzen. Halb betäubt von dem ohrenzerreißenden Lärm und nicht ohne blaue Flecke wurde ich von Leutnant Kuhlmann der freudetrunkenen Schar entzogen und beim Griechen in eine weniger lebensgefährliche Umgebung gebracht; aber auch hier folgte man mir; gegen 200 Weiber kamen, um mich dort zu feiern; wie vor ihrem Sultan lagen sie vor mir am Boden, mit Jubelgeschrei und Grüßen. Eimerweise ließ ich ihnen Scherbet (Fruchtlimonade) reichen. Die Soldaten machten ihrem Jubel durch tolles Schießen Luft, sie waren ja auch in der Tat „die Nächsten dazu“ — war doch kaum einer unter ihnen, der im Laufe dieser sieben Kriegsjahre nicht an einem Zuge gegen Quawa beteiligt gewesen war. Aber der Wahrheit die Ehre: wir Europäer gaben uns dem Jubel über unsern Erfolg ebenso freudig hin. Bei Beginn der Dunkelheit brachte die Kompagnie uns einen prächtigen Fackelzug, an der Spitze Leutnant Kuhlmann, der Tom einen Kranz überreichte, und die Unteroffiziere. Dann zogen Tom und ich an der Spitze des Zuges durch die Stadt, Tom brachte ein „Hoch“ aus auf den obersten Kriegsherrn, unsern geliebten Kaiser Wilhelm, dann forderte Leutnant Kuhlmann die Kompagnie zu einem „Hoch“ auf ihren Hauptmann auf. Unter dem Siegesgesang der Sudanesen zogen wir dann nach unserm Hause, wo ich mich verabschiedete, während Tom wieder mit zum Griechen mußte. Es dauerte lange, bis auf die große Aufregung dieses bedeutungsvollen Tages die Reaktion eintrat, aber allmählich kam doch die Erschöpfung, und ich fiel in einen festen wohltätigen Schlaf. —
Tom machte von Quawas Kopf eine photographische Auf[S. 183]nahme. Noch im Tode gönnt dieser mächtigste und tatkräftigste aller Negerfürsten, dessen Antlitz gesehen zu haben sich bisher kein Weißer rühmen kann, seinen Todfeinden nicht den Anblick seines wahren Gesichtes, er hat sich in den Kopf geschossen, so daß seine Züge entstellt sind. Doch ist das Charakteristische des Kopfes noch zu erkennen: kleines Gesicht mit eigenartigen, geschlitzten und dennoch verhältnismäßig großen Augen; starke Nase, wulstige Lippen, besonders die Unterlippe auffallend herabhängend, fast bis zu dem stark hervortretenden energischen Kinn; dieses Kinn, die wulstigen Lippen und die vorgeschobenen Kinnladen geben dem Kopf einen ausgesprochenen Zug von Grausamkeit und Willenskraft. Eine stark angeschwollene Beule auf der Stirn, von einem Speerstich herrührend, hat wohl den Anlaß zu der weitverbreiteten Meinung gegeben, Quawa trage ein Horn an der Stirn. Wie Feldwebel Merkl berichtet, war Quawa von großer, sehr kräftiger Gestalt, etwa 1,80 Meter. Sein Körperbau entsprach also vollkommen dem gewaltigen Herrschergeist und dem eisernen Willen dieses letzten Sultans von Uhehe. Seine Tat, als er sein Reich und sich selbst verloren gab, entsprach diesem blutigen und doch in seinem Verzweiflungskampfe uns sympathischen Despoten: seinen letzten, treuen Begleiter erschoß er auf der Flucht, um nicht wie ein gewöhnlicher Mensch allein, ohne eine dem tapferen Häuptling und Krieger gebührende Begleitung ins Jenseits zu gehen!
26. Juli 1898.
ie Fest- und Jubeltage, die Tom reichlich bewilligen mußte, sind nun endlich vorüber; der Lärm Tag und Nacht hat mich sehr angestrengt, umsomehr, als ich wieder bettlägerig war; in der freudigen Aufregung der ersten Tage habe ich mich wohl nicht genug geschont. Heute geht es mir besser, die Ruhe wirkt wohltuend. Es waren über 1000 Wahehe zur Station gekommen, die in ihren bunten Tüchern einen malerischen Anblick boten. Am 19. d. Mts. ist der neue Landwirt Hierl angekommen; als Ersatz für Hammermeister kam Feldwebel Liebhard und ein Unteroffizier Künster; als früherer Pionier wurde er gleich beim Brückenbau angestellt; hoffentlich hört nun das Balancieren über Baumstämme bald auf.
31. August 1898.
Förster Ockel ging gestern zur Küste ab; er nahm die Kettengefangenen mit, zu denen noch Schubert einige Quawaanhänger eingeliefert hatte. Später verabschiedete sich Herr v. Prittwitz vor seinem Abmarsche. Heute war Leutnant Kuhlmann unser Gast. Jetzt wird es auch bekannt, daß wir auf unserer letzten Safari in unmittelbarer Nähe von Quawa gewesen sind; wir haben sogar den Rauch seines Lagerplatzes gesehen, nahmen aber an, daß es Herrn v. Prittwitz’ Leute sein müßten, die unserer Berechnung nach in jener Richtung marschierten! Aber das Interessanteste dabei ist: unser Waheheführer wußte genau, daß Quawa dort[S. 185] lagerte! Die hohe Belohnung, die auf Quawas Kopf gesetzt war, lockte ihn nicht, seinen früheren Herrn zu verraten. Noch zwei Tage, bevor er bei uns sein Führeramt antrat, hat er dem Flüchtling Nahrungsmittel gebracht. Tom war oft stundenlang allein mit dem Führer im Pori; wie leicht hätte der ihn hinterrücks niederstechen können, wenn Tom mit Zeichnen und Aufnahmen beschäftigt war! Jetzt ist es mir auch klar, weshalb unsere Wahehe stets die seitlichen Anhöhen erstiegen, um Ausschau zu halten.
Ein schöner Charakterzug in diesen Leuten: sie wollten den Frieden für ihr Land, doch nicht nur durch Verrat an ihrem Sultan sollte er erkauft werden. Eins ist uns unbegreiflich: warum hat Quawa, der doch den Überfall von Kondoa, jenseits Kilossa, damals so strategisch wirklich scharf durchdacht angelegt und meisterhaft ausgeführt hat, bei all seiner Energie und Macht niemals unsere Station angegriffen!
Toms Schicksal ist ganz mit Uhehe verwoben — schon 1891 war er bis Mage vorgedrungen, dort mußte er umkehren, weil sich seine Zulus weigerten, noch weiter zu marschieren. Am Ruaha hat er sich dann mit einem Askari im Pori verirrt. Die Lage war sehr kritisch. Feinde ringsum, überall sahen sie die Feuerstellen ihrer Verfolger, der feindlichen Wahehe. Tom erzählte mir viel und interessant von jenen Tagen, wie sie vorsichtig auf Händen und Füßen die Lagerstätten der Wahehe in weitem Bogen umkreisten, bis sie eines Tages sich plötzlich einem größeren Lager gegenüber befanden, von dessen Bewohnern sie sich bereits entdeckt sahen! Da hat ihm doch das Herz geklopft, der Revolver war schußbereit zur Hand, um im letzten Augenblick mit einer Kugel der Gefangenschaft und dem qualvollen Tode unter den blutdürstigen Schwarzen zuvorzukommen — wie atmete er erleichtert auf, als sich die Neger als freundlich gesinnt erwiesen.
In Iringa hat Tom dann das Pulvermagazin Quawas in die Luft gesprengt. Zündschnur hatten sie nicht zur Hand, so wurde denn die Tembe, in welchen gegen 3000 Fäßchen voll Schießpulver lagerten, innen mit Stroh ausgekleidet und von der Türe aus in Brand gesteckt — und dann hieß es laufen! Tom[S. 186] hatte mit seinem Unteroffizier gerade hinter einer Tembe Deckung gefunden, als das Feuer das Pulver erreichte, eine furchtbare Explosion, ein Balken hätte beinahe den Unteroffizier erschlagen — und damit war Quawas Munitionsvorrat für lange Zeit vernichtet. Auch 1891 flog bei der Erstürmung von Sinna (am Kilimandscharo) ein feindliches Pulvermagazin auf; damals wurde Tom von dem gewaltigen Luftdruck zu Boden geworfen.
3. September 1898.
Heute besuchte mich Mgundimtemi; es fiel mir auf, daß sie nicht mehr in Trauer geht, sie trägt wieder bunte Tücher, Ketten und Armbänder. Sie hat einen ehemaligen Msagira aus einer reinen Wahehefamilie geheiratet, Tom will ihn als Jumbe eines kleinen Bezirkes einsetzen.
Auf der Station treten die Pocken wieder auf, diesmal ziemlich bösartig. Die Leute sind zum Glück recht vernünftig, beim geringsten Anzeichen bringen sie ihre Kranken. Auch die ankommenden Karawanen werden genau untersucht. Etwa eine halbe Wegstunde von der Station entfernt ist ein Pockenhospital eingerichtet. Ich wünsche sehnlichst, die Lymphe käme endlich von der Küste an, damit wir uns alle impfen lassen können.
Von Quawas Grausamkeit werden immer mehr Beispiele bekannt. Als er damals von Luhota aus entfloh, hielt er sich einen Tag in der Nähe der Station versteckt; dort erschlug er einen seiner Anhänger, dem er nicht mehr traute, und schnitt ihm einen Fuß und ein Stück Schulterfleisch ab; die am Feuer gedörrten Stücke trug er dann stets bei sich; wirklich hat Feldwebel Merkl beides bei seiner Leiche gefunden.
Um so erfreulicher blüht Handel und Wandel jetzt nach des Unruhestifters Tod. Tom unterschreibt soeben wieder einen Scheck; in diesem Monate haben die Händler bereits 16000 Rupien in die Stationskasse eingezahlt. Das ist für unser Iringa doch gewiß ein schöner Umsatz. Auch die Bautätigkeit ist rege.
Meinen Geburtstag mußte ich ohne Tom verleben, aber trotzdem ging es hoch her! Schon früh am Morgen war alles be[S. 187]kränzt. Dann kamen der Wali mit den Honoratioren, der Effendi namens der Kompagnie, sämtliche Europäer und Abordnungen von Frauen der Askaris, der Fundis, Farhengas große Bibis, kurz, die Gratulanten nahmen kaum ein Ende. Abends besuchten mich dann zu meiner Freude die am 18. August hier angelangten Schwestern, mit denen ich noch einer Einladung nach der Messe folgte; dort wurde ich auch angefeiert. In der Stadt und im Askaridorfe herrschte lustiges Treiben an allen Ecken und Enden, mit Tanzen und Jubeln. Die Schwestern blieben bis zum nächsten Nachmittage; ich hatte aus unserer Vorratskammer mit Hilfe von Decken und Zeug ein hübsches Zimmerchen für sie hergerichtet. Auf Toms dringenden Wunsch sind uns diese vier Schwestern bewilligt worden, der Präfekt Maurus[9] brachte sie uns selbst. Ich empfing die willkommenen Gäste mit einem feinen Diner und mit Sekt; dem Präfekten ließ ich einen Rosenstrauß überreichen; von dem Empfange waren sie sichtlich gerührt. Die Schwestern erzählten mir, daß die Schwarzen ihnen schon viel von der weißen Bibi erzählt hätten, die in Iringa wohne, die lesen und schreiben könne, stets einen Revolver bei sich trage, sehr langes Haar und nur einen Mann habe. Daß die vier neuen Bibis auf der Station großes Aufsehen erregten, ist natürlich; ich hatte große Mühe, unseren Leuten beizubringen, daß die Schwestern nicht die Frauen der Patres von der Mission seien.
21. September 1898.
In unserem Garten liegen große Stapel von Holzstämmen; die Wahehe verdienen sich das erste Geld, was sie je in Händen gehabt, mit Baumfällen; sie sind so eifrig dabei, daß sie mehr anbringen, wie für die Dachbauten voraussichtlich nötig sein wird. Je nach der Güte der Stämme erhalten sie ihre Pesas, die sie vergnügt in der Stadt beim Händler schleunigst wieder ausgeben.
Diese Förstertätigkeit macht viel Arbeit, jeder Stamm muß besichtigt werden, und dann zahlt Tom auch den Leuten selbst aus. Am meisten beschäftigt ihn jetzt die Steuerfrage! Die Wahehe haben ihre Steuern reichlich durch Kriegsdienst und Straßenbau abgeleistet, ebenso die meisten Einwohner unseres Bezirkes. Nur die Leute am Ruaha, die Wapawegas und andere, die für körperliche Anstrengungen zu schlaff sind und denen der Chakula sozusagen in den Mund wächst, sollen eine Naturaliensteuer entrichten. Von den Stadtleuten wird eine Hüttensteuer erhoben.
3. Oktober 1898.
Heute ist unser Freund Kiwanga[10] wieder abgezogen; er kam am 28. v. M. mit seiner großen Bibi auf Besuch zu uns; wir besuchten ihn auch einigemal in seiner Tembe. Ein Versuch, sein ausgesprochen jüdisches Profil durch einen Schattenriß an der Wand zu verewigen, scheiterte an seiner Beweglichkeit, der photographischen Kamera entging er aber auch diesmal nicht, trotz seiner herzbewegenden Klage: „Ach Bibi, jeder Europäer macht Bilder von mir, ich werde alle Tage photographiert.“ Als ich ihm aber die Bilder zeigte, die ich früher von ihm und seinem Kriegslager aufgenommen hatte, geriet er doch in die freudigste Aufregung. Auch unser braver Schnapsel war in diesen letzten Wochen krank, ein großer Hund hatte ihn in den Hals gebissen; dank der liebenswürdigen Bemühungen Dr. Drewes und unserer sorgsamen Pflege kam er wieder zu Kräften; wir hätten den treuen Hausgenossen doch schwer vermißt. Dem Hühnerstalle hat ein Leopard einen nächtlichen Besuch abgestattet und 7 Enten mitgenommen; ich glaubte erst, es seien Diebe gewesen, heute nacht hat er aber wieder einige 30 totgebissen und zum Teil gefressen, auch meine Puten sind verschwunden; deutliche Spuren und vereinzelte Federn verrieten aber, daß hier ein zweibeiniger Spitzbube auf Konto seines vierbeinigen Kollegen gearbeitet hat.
11. Oktober 1898.
Gestern brachte Pater Ambrosius den am Fieber erkrankten Herrn v. der Marwitz nach der Station und ging mit dessen Stellvertreter, dem Unteroffizier Künster, wieder auf seinen Posten zurück.
Ich war in großer Unruhe! Herrn v. der Marwitz’ Fieberanfall hatte noch in der letzten Woche unseren Arzt sechs Tage lang von der Station ferngehalten, jetzt gerade, wo ich ärztlicher Hilfe voraussichtlich bald dringend bedarf! Gott sei Dank, diese Sorge bin ich los, nun geht das „große Reinemachen“ noch einmal so flott. Es soll wenigstens alles in Haus und Hof imstande sein, wenn ich nicht jeden Tag selbst mehr nach dem Rechten sehen kann.
Utengule, 28. Mai 1899.
Schwere Zeiten liegen hinter mir, Wochen und Monate so banger, verzehrender Sorge, wie sie nur einer Mutter beschieden sein können..... Wir befinden uns auf Safari. Tom hatte schon früher den Wunsch geäußert, sich die Gegend hier genauer anzusehen, nun sind wir seit dem 27. April unterwegs.
Die Landschaft Irole übertrifft an Fruchtbarkeit alle unsere Erwartungen, sie liegt 1400 Meter hoch und zeichnet sich durch gesundes Klima und für uns Europäer angenehme Temperatur aus. Am 30. April besuchten wir das auf einer Anhöhe bei der Residenz des Jumben Kawenda von Irole gelegene Zelewski-Denkmal: eine 8 Meter hohe Steinpyramide auf einem 7 Meter hohen Sockel, in welchen eine Kupferplatte mit den Namen der zehn Gefallenen der unglücklichen Zelewski-Expedition von 1891 eingefügt ist. Mit tiefer Rührung las ich die Namen: vor acht Jahren fielen zehn deutsche Männer an dieser Stelle im blutigen Kampfe gegen die Wahehe — und heute stehen wir hier als die Herren des Landes, und die Wahehe sind unsere tapfersten Kampfgenossen. Das teure Blut unserer tapferen Landsleute ist nicht fruchtlos geflossen.
Wir schmückten das Denkmal mit Blumen und Laubgewinden und zogen weiter in die steilen Utshungwe-Berge. Anhaltendes Regenwetter vereitelte aber Toms Arbeiten, Wegaufnahmen und Kartieren; auch ich hatte natürlich keine Freude an dieser „Wasserpartie“. Kurze Sonnenblicke, die zuweilen die Nebelwand zerrissen, ließen erkennen, daß wir uns in fruchtbarem und eigenartig schönem Berggebiete befanden.
Sehr überrascht waren wir eines Morgens, als wir aus unserem Zelt anscheinend in eine Schneelandschaft traten; es war jedoch nur der frische Morgentau, der auf den dicht behaarten Halmen einer weißlich schimmernden Grasart glänzte. Die Täuschung war wirklich überraschend. Auf dem Rückzug aus den Bergen mit vielen Flußübergängen ist mir besonders eine prächtige Schirmakazie aufgefallen, die ihr flaches Dach gegen 7 Meter weit nach allen Richtungen hin ausbreitete; leider konnte ich den stattlichen Baum nicht photographieren, Nebel und Regen folgten uns auf dem ganzen Marsch bis Malangali.
Von besonderem Interesse war mir auf dieser Safari, daß wir am 5. Mai an einem Platze Halt machten, in dessen Nähe ich vor 2½ Jahren mit Tom nach monatelanger, in dem Fieberneste Perondo unter Angst und Sorge um sein Leben zugebrachter Einsamkeit wieder zusammenkam. Das Wiedersehen wog all die sorgenvollen Wochen auf! Noch eine andere Erinnerung knüpft sich an diesen Platz: hier wurde damals der Askari meuchlerisch ermordet, das erste Zeichen des beginnenden Aufstandes.
Zu unserer Begrüßung kam der Jumbe Lupambile aus Mugama, ein Verwandter des Sultans Kiwanga, ins Lager. Er brachte mir die Hühner und andere Lebensmittel, die ich vorausgesandt hatte. Ihm vertraute ich meine beiden jüngsten Pflegekinder an: Mumiri und Mpanga. Wider Erwarten zeigten sich die beiden Kleinen den Anstrengungen der Safari nicht gewachsen, die ersten paar Tage hielten sie auf ihren Eseln, die ich besonders für sie angeschafft hatte, ganz tapfer aus, besonders Mumiri; das kleine frische Kerlchen klammerte sich mit den Armen um den Hals seines Grautieres, auf die Dauer freilich wurde ihm diese Stellung[S. 191] doch zu unbequem; sobald er sich aufrecht setzte, fiel er herunter, auch wurde er oft von den Bäumen aus dem Sattel gestreift. So war es denn besser, die Kinder hier zu lassen, umsomehr, als sie bei Lupambile in bester Hand sind.
Am 6. Mai rasteten wir am Iragolabach; von der Fülle der herrlichsten Blumen, Lilien und Orchideen, nahmen wir eine Menge Knollen zum Einpflanzen mit. Der Zug durch die Landschaft Fuagi war besonders für unsere Schwarzen beschwerlich, es fehlte an Holz zum Lagerfeuer; die armen Kerle froren Tag und Nacht. Auch der Übergang über den Uuhai (Nebenfluß des Ruaha) bot, der steilen Ufer und des weichen Moorbodens auf unserer Seite wegen, große Schwierigkeiten; die Karawane brauchte länger als eine Stunde zum Durchwaten, ich „schwebte“ wieder auf den Köpfen von zwei Askaris über die Flut hinweg; ein besonders langer Mhehe stapfte hinterher, um die teure Last vor unfreiwilligem Bade zu bewahren, falls einer meiner beiden Träger im Wasser stolpern oder fallen sollte. Es ging aber gut ab. Von Wild sahen wir nur ein Wildschwein und eine Antilope auf einem Felsblock, deren Silhouette sich scharf gegen den rotglühenden Morgenhimmel abhob — ein prächtiges Bild. Am Kufaribache (8. Mai) fand sich viel Brennholz; trotz der milden Sommernacht schichteten die Träger wahre Scheiterhaufen zusammen, als wollten sie sich nun bei dem reichlichen Holzvorrat nachträglich noch an Hitze ersetzen, was sie in den holzarmen Strecken entbehren mußten.
Am 9. Mai stellten wir die Quelle des Ruaha fest. Wir hielten da einen Ruhetag, weil Tom Berichte schreiben und seine Beobachtungen und Aufnahmen in Ordnung bringen wollte. Unser Herbarium erhielt auch hier reichen Zuwachs; in dem die Ruahaquelle umgebenden Sumpfe wuchsen wunderschöne Blumen, von denen wir uns einen Vorrat preßten; freilich mußten wir in dem Sumpf und dem Bache herumwaten. Das ganze Land ist sehr wasserreich: binnen sechs Tagen mußten wir mehr als 250 Wasserläufe passieren, zum Teil von ansehnlicher Tiefe. Am 12. lagerten wir am Malangali-Ruaha, den wir zum Unterschied von unserem großen Flusse den Ruahabach nannten. Bemerkenswert[S. 192] waren die in der Nähe befindlichen charakteristischen Erderosionen, wie man sie selten von solcher eigenartigen Schönheit antrifft.
Am 14. Mai trafen wir auf Station Malangali ein, wo Herr v. der Marwitz ein wunderhübsches Offiziershaus mit Wohnzimmer, Schlafzimmer und Baderaum gebaut hatte. Hier war soeben der arme Geograph Schmidt am Fieber gestorben. Auch Idunda passierten wir, die Station, welche Tom seinerzeit eingehen lassen mußte, weil der Platz von Dysenterie so verseucht war, daß man der Krankheit nicht Herr werden konnte. Am Sanibach kamen wir in das Gebiet Mereres, nach Ubena. Der Charakter dieser Landschaft ist ganz verschieden von dem Uhehes, lang ausgedehnter welliger Steppenhügel mit wenig Wasser, doch fehlt es nicht an fruchtbaren Stellen. Am meisten fällt der gänzliche Mangel an Baumwuchs auf, es gibt hier meilenweit weder Baum noch Strauch. Als Brennmaterial dient der Dünger der Rinderherden, der hier von den Schwarzen überall gesammelt und in der Sonne zum Trocknen ausgebreitet wird. Die Temben sind meist aus Schilf, selten ist einmal ein Holzstab durchgezogen, den sie sich von weit her holen müssen.
In Gawiro kam uns Merere entgegen, an der Spitze seines Hofstaates. Er ist jetzt ganz „Europäer“ geworden, selbst den Gebrauch des Taschentuches hat er sich angewöhnt. Übrigens spielt er in seinem, gegen manchen seiner Stammes- und Standesgenossen stark kontrastierenden Selbstbewußtsein als Sultan eine gute Figur. Mich behandelte er mit ausgesuchter Höflichkeit; es imponierte ihm, daß ich lesen und schreiben kann. Als Tom in Ruipa neulich Volkszählung hielt, sagte Merere: „Wir zählen nicht einmal unsere Rinder, wie sollen wir unsere Frauen zählen?“ Daß Tom gefragt wird, wieviel Rinder er für mich bezahlt hat, kommt öfter vor.
Beim Einzug in Gawiro war feierliche Einholung; von weither kamen uns die Leute entgegen, in Gawiro selbst offizieller Empfang. Merere nahm auf dem von seinem Vater ererbten, schön geschnitzten und mit Metall eingelegten Stuhle Platz, der ihm überall von einem eigens hierzu angestellten Jüngling nach[S. 193]getragen wird. Wir setzten uns neben den Sultan. Die Leute knieten nieder, indem sie, die Handflächen aneinander reibend, die vorgestreckten Arme hin und her bewegten, und sagten „adse senja“ (Gegrüßt seist du, Rindvieh!), worauf Merere erwidert: „Guiri juga“ (Guten Morgen, wir grüßen dich!). Wenn Merere von einer Reise zurückkehrt, wird er mit dem zweimal wiederholten Rufe begrüßt: „Guage senja“ (Guten Morgen, Rind!), „Wadjeri Msenga“ (Guten Tag, o Rindvieh!). Die Halle, in der diese Begrüßung stattfand, war mit Spiegeln an den Wänden, Fellen und Waffen ganz geschmackvoll ausgestattet. Auch die übrigen Räume fand ich ganz wohnlich eingerichtet; unter Mereres Stuhl war sogar ein schönes Leopardenfell als Teppich ausgebreitet. Von besonderem Interesse war für uns Mereres Haus, da es an den Außenseiten mit Wandmalereien geschmückt war, die in der ganzen Auffassung des Dargestellten am besten für die kindlich naive Anschauungsweise unserer schwarzen Freunde sprechen. Auf den Bildern aus grellbunten Erdfarben, die der eingeborene al fresco-Künstler sich an Ort und Stelle zusammengemischt hatte, war Quawa dargestellt, wie er mit Mpangire und seinen Brüdern zum Kriege auszieht, die Fahne voran; ferner ein Jäger, der, hinter einem Baum versteckt, auf einen Elefanten schießt; die Zeichnung des Elefanten, dem der Maler beide Stoßzähne auf die dem Beschauer zugekehrte Seite gemalt hatte, erinnerte lebhaft an die naiven Darstellungen auf altägyptischen Bildern; an der Vorderseite waren zwei große Giraffen aufgemalt. Diese Wandbilder sind im ganzen Gebiete die einzigen Zeichen von künstlerischer bezw. malerischer Betätigung; Quawa hatte sie sich auf die Wände seiner Tembe malen lassen; da sie in der dunklen Halle jedoch nicht zur Geltung kamen, ließ Merere auf den Außenwänden seiner Tembe dieselben Bilder anbringen. Bemerkenswert ist auch, daß Merere als erster schwarzer Herrscher im Innern sich ein zweistöckiges steinernes Haus bauen läßt; das Aufrichten lotrechter Wände macht ihm freilich viel Kopfschmerzen.
Mit Herrn v. der Marwitz, der inzwischen eingetroffen, setzten wir uns weiter in Marsch, und zwar kamen wir nun in wild[S. 194]reiche Gegend; besonders die Zebras, denen ich auf meinem Maultiere mich bis auf etwa 100 Meter nähern konnte, boten einen prächtigen Anblick; die mit Leierantilopen vermischten Herden formierten sich manchmal wie eine Kavallerie-Brigade mit vorgezogenen Kommandeuren und Adjutanten. Bei Usafa, etwa drei Stunden nördlich von Gawiro, geht das charakteristische weitgewellte Ubena-Grasland der Uheheberge auf, und es beginnt die Tischplatten-Niederung des Mpangali oder großen Ruaha, welche zunächst bis zur größten Ortschaft Kiwere mit Busch und Strauch bedeckt ist. Über Kiwere hinaus, und zwar bis an den Usafaabfall im Westen, die Vorhügel von Niam-Niam im Norden, an die Irongoberge im Osten, dehnt sich, soweit das Auge reicht, eine gewaltige, fast baumlose Ebene aus, die zwar in der Regenzeit mit Gras bestanden, aber in den trockenen Zeiten, namentlich nach den Grasbränden, unbeschreiblich öde wäre, wenn nicht die kolossalen Wildherden Leben in das Bild brächten. Verschiedentlich glaubte ich noch aus 1500 Meter Entfernung, mitten in der gelben Ebene, eine lange Strecke Buschwald vor mir zu sehen, der sich aber bei Annäherung als eine etwa 1000 Stück starke Herde von vorherrschend Zebras und Leierantilopen auswies. Rhinozeros und Elefanten sind auch nicht selten, während Löwen nachgerade hier zu Hause zu sein schienen. Merere wurde eingehend über den Wert des Zebras belehrt. Am Mpangali selbst liegen keine Dörfer, wohl aber ist eine Reihe Niederlassungen, meist Neuansiedelungen, durch Merere ein bis zwei Stunden vom Flusse ab in der Steppe verstreut; nur am linken Ufer ist die Steppe von Ulanga westlich menschenleer und fast ohne Wald. Bei Ulanga, einer Niederlassung mit 60 Hütten, trennten wir uns am 19. Mai 1899. Merere ging auf direktem Wege nach seiner neuen Residenz Utengule, um Vorbereitung zum Schauri zu treffen.
Am Ruaha schlugen wir unser Lager auf, an der einzigen Stelle, wo der Fluß einigermaßen passierbar ist; die vielen Krokodile, die sich hier aufhalten, machen den Übergang doch etwas riskant, ich balancierte, die Füße auf den Hals meines Maul[S. 195]tieres gelegt, glücklich und ohne weitere Anfechtung hindurch. Dann trafen wir nach kurzer Mittagspause Vorbereitungen zur Kibokojagd (Nilpferd). Ich war in keiner geringen Aufregung: zum erstenmal auf Flußpferde pürschen — da darf man schon Jagdfieber haben.
Wir waren kaum 300 Meter am Ufer entlang gegangen, als wir auch schon die ersten Tiere sahen: prustend kamen zwei unförmliche Schnauzen aus dem Wasser, um nach ein paar schnaufenden Atemzügen rasch wieder unterzutauchen. — Hier faßte Herr v. der Marwitz Posten, während Tom und ich weitergingen. Bald fanden wir eine ganze Familie: die Alten scheu und vorsichtig immer nur auf Augenblicke den Kopf aus dem Wasser reckend, die Totos dagegen vergnügt und sorglos herumplätschernd. Wir beobachteten eine Zeitlang das interessante Bild, als plötzlich von der Seite unseres Jagdgenossen ein Schuß fiel, dem bald noch mehrere folgten. Jetzt galt es auch für uns, zum Schusse zu kommen, ehe die Dickhäuter sich von dem Knall verscheuchen ließen. Ich stellte mich hinter Tom, um ihm rasch die Patronen zureichen zu können. Es war nicht ganz leicht, den stärksten Kopf von den oft nur sekundenlang auftauchenden Ungetümen aufs Korn zu nehmen, und es dauerte lange, bis Tom endlich schoß. Das getroffene Tier warf sich hoch auf aus dem Wasser, schlug mit den kurzen plumpen Beinen und versank dann lautlos; wir hatten die Kugel dicht unter dem Auge einschlagen sehen, wenn es also nicht zu weit abtrieb, mußten wir das Tier finden.
Die badende Kibokoherde hatte eine Anzahl Krokodile angelockt, von denen Tom eins, welches auf einer Sandbank am Ufer sich sonnte, zur Strecke brachte; es war ein stattlicher Bursche.
Herr v. der Marwitz hatte Glück gehabt, sein Kiboko hatte ihm den Gefallen getan, angeschossen auf das Ufer zu klettern, wo er ihm den Fangschuß geben konnte. Angesichts dieses Kolosses wurden wir doch zweifelhaft, ob unser Kiboko auch wirklich tödlich getroffen wäre; es ließ Tom keine Ruhe, und so ging er denn selbst noch einmal, um den Fluß abzusuchen; sehr vergnügt[S. 196] kehrte er mit der Nachricht zurück, daß auch unsere Jagdbeute glücklich auf einer Sandbank im Strome gestrandet sei.
Am anderen Morgen galt es, die beiden Kolosse und das Krokodil zu bergen. Das war keine leichte Arbeit; unsere Leute strengten sich gewaltig an, die starren, unbeweglichen Fleischkolosse durch den Fluß und die Uferhöhe hinauf zu schleppen; die Aussicht auf den seltenen Überfluß an Fleisch schien ihnen Riesenkräfte zu verleihen.
Die Nachricht von unserem Jagdglück hatte sich mit Windeseile in der Gegend verbreitet, von allen Seiten kamen Einwohner der umliegenden Dörfer, um von der Beute ihr Teil zu holen. Ehe wir sie ihnen überließen, photographierte ich die beiden Kibokos und das Krokodil; dann wandten wir uns ab von dem scheußlichen Anblick dieser gierigen, heulenden, hungrigen Schar, die mit Messern, Äxten und Speeren in dem Fleische der toten Tiere herumwühlte und sich um die besten Stücke zankte.
Nur mit Mühe brachten die Wasagiras, die sich vorher schon über die Verteilung des Fleisches geeinigt hatten, Ordnung in dieses tobende Chaos.
Während hier der tollste Lärm um unsere Riesenbeute tobte, saß Herr v. der Marwitz unweit davon am Ufer und holte mit seiner Angelschnur in größter Seelenruhe Fisch auf Fisch aus dem Wasser, die uns zu Mittag vortrefflich schmeckten.
Nachmittags passierten wir, nachdem wir den Fluß nochmals durchschritten, eine Stelle, an der Herr v. der Marwitz vor einigen Monaten 32 Flußpferde erlegt hatte; die von den Hyänen abgenagten Knochenhaufen machten einen unheimlichen Eindruck. Kurz darauf kamen wir nach Ulanga, einem Dorfe mit runden Hütten. Am anderen Morgen großer Alarm: soeben war ein Trupp Elefanten dicht am Dorfe vorbeigelaufen, in der Ferne konnten wir sie noch sehen! Eine Verfolgung blieb, wie zu erwarten, ohne Erfolg, nur einen Antilopenbock brachte Tom zur Strecke. Mehr Glück hatten wir später in der Nähe einer kleinen Ansiedelung von acht Hütten, Karadja; dort konnte ich eine Strecke photographieren, bestehend aus 1 Zebra, 1 Kuhantilope,[S. 197] 3 Nämära, 1 Swala, 1 Schwarzfersenantilope. Die Leute leben hier fast ausschließlich von der Jagd, Feldfrüchte bauen sie fast gar nicht, tauschen solche vielmehr in den Nachbardörfern gegen das Fleisch ihrer Jagdbeute ein, und damit ist beiden Teilen aufs beste geholfen.
Im weiteren Verlaufe unseres Marsches hatte ich Gelegenheit, mich dicht an einen größeren Trupp von Zebras anzupirschen und die prächtigen Tiere lange zu beobachten; ein wunderbares Bild: die zierlichen Tiere fühlten sich ganz sicher, die Fohlen spielten und sprangen um die alten Tiere herum, die sorglos grasten; erst als mein Maultier hart auf einen großen Stein auftrat, schraken sie zusammen und wurden flüchtig.
Das wichtigste Ereignis stand mir jedoch noch bevor. Etwa 150 Schritt abseits unseres Weges stieg plötzlich eine schwarze Wolke von Aasgeiern auf, dort mußte also ein ausgiebiger Futterplatz sein. Aber sollten wir auf diese Entfernung hin das Frühstück gestört haben? Ich schickte einen Wahehe nach der Richtung, doch der war kaum in die Nähe gekommen, als sich plötzlich ein mächtiger Löwe aus dem hohen Grase erhob! Es war ein prachtvolles starkes Tier mit dichter Mähne, die er zornig schüttelte. Der Wahehe stand vor Schreck wie festgenagelt, und ich meinte nicht anders, als daß der Löwe ihn im nächsten Augenblicke unter seinen Pranken haben würde — aber ich hatte den Wüstenkönig überschätzt. Ehe noch Tom aus dem Sattel und mit der Büchse zur Stelle war, hatte der Löwe sich schon bis auf etwa 300 Schritt entfernt; dann wandte er sich wieder und äugte nach uns herüber, sobald wir ihm aber folgten, brachte er immer größere Strecken zwischen sich und uns, bis er endlich am Horizonte verschwand.
Das ganze Benehmen deutet auf alles andere, als auf die vielgerühmte Tollkühnheit und Tapferkeit des sogenannten „Königs der Tiere“ — mir kam es erbärmlich feige vor, als das kraftvolle stattliche Tier Reißaus nahm. Unverbesserliche Optimisten mögen darin vielleicht ein Zeichen der sprichwörtlichen „Großmut“ erkennen, daß er sich nicht auf den Wahehe stürzte. Das[S. 198] Urteil über die bewundernswerten Eigenschaften des Wüstenkönigs scheint mir nach allem, was unsere „Afrikaner“ davon erlebt und erzählt und was ich selbst von ihm gesehen habe, sehr der Revision bedürftig. Jedenfalls darf man den Begriff „König“ nicht in dem Sinn auffassen, wie wir Europäer das zu tun gewohnt sind; man kommt der Sache schon besser bei, wenn man den Begriff nach dem Beispiele der sehr ehrenwerten Mitglieder des Pickwick-Klub „in a Pickwickian i. e. African point of view“ nimmt.
Da Tom für seine kartographischen Aufnahmen den Fluß als Basis benutzen wollte, hielten wir uns die nächsten Tage am Ruaha auf. Noch am Vorabende unseres Aufbruches, am 24. Mai, hatte ich Gelegenheit, mich auf eine Kibokofamilie anzupirschen, die sorglos im Strom badete. Ich muß gestehen, daß ich in nicht geringer Aufregung war, als ich zum ersten Male die Büchse erhob, das Herz schlug mir hörbar bis zum Hals hinauf, so daß ich mein Ziel, den in kurzen Zwischenräumen auftauchenden Kopf meines Wildes, kaum fest in die Visierlinie bringen konnte: ich hatte das richtige Büchsenfieber! Endlich, als sich meine Nerven beruhigt hatten, paßte ich meine Gelegenheit ab; ich blieb im Anschlag liegen, bis der ungefüge Kopf des zur Beute erkorenen Tieres aus dem Wasser auftauchte, und diesmal ließ ich ihm keine Zeit, mich wieder zu necken; noch ehe er wieder im Wasser verschwinden konnte, gab ich Feuer — die Kugel schlug dicht über dem rechten Auge ein, und mein Kiboko verschwand im Wasser! Wenn ich auch meiner Sache ganz sicher zu sein glaubte, daß der Schuß gut gesessen, war ich doch in großer Spannung, in die sich allmählich auch gelinde Zweifel mischten, ob wir das Tier finden würden, um so größer daher meine Freude, als unsere Leute mit Jubelgeschrei verkündeten, daß mein Kiboko mit weidgerechtem Kopfschuß etwas weiter stromabwärts an einer Sandbank angetrieben sei.
Mein Jagdglück feierten wir nach dem Abendbrote unten am Fluß. Im Mondschein floß der Ruaha wie ein silbernes Band leise rauschend durch die dunklen Schatten seiner waldigen, hügeligen Umgebung; als afrikanische Staffage belebt dies in[S. 199] majestätischer Ruhe vor uns ausgebreitete Landschaftsbild eine Familie von Flußpferden, die im Gefühl, so ganz unter sich und zu Hause zu sein, ihre schwarzen nassen Leiber im Silberglanze des Mondlichtes aufblitzen ließen, die kühle wohltuende Nachtluft, säuselnd in den Palmenwipfeln — es war ein herrlicher Abend, der mir unvergeßlich bleiben wird, es waren Stunden, die zum inneren Erlebnis werden, die Herz und Gemüt, Körper und Geist so vollkommen mit ihrem Zauber durchdringen, daß sich die tiefste Trauer, der heftigste Schmerz in linde Wehmut lösen, in stille Sehnsucht, wie Windstille nach dem Sturme. Die schwere Zeit, die eben jetzt hinter mir liegt, mit ihren Ängsten und Sorgen, mit ihren Leiden und — Hoffnungen, werden mich solche Stunden freilich nicht vergessen machen; aber es liegt jetzt wie ein verklärender Schimmer über der Erinnerung an jene Leidenszeit, eine versöhnliche Stimmung, die den unfruchtbaren Hader mit dem Schicksal aufgibt und den Blick wieder fest und vertrauensvoll auf das gesteckte Ziel richtet. Blicke ich zurück auf diese unsere letzte Safari in unserem ersten Wirkungskreise, in dem ich meinem Gatten bei Erfüllung der schweren Pflichten seines Amtes, soweit es in meinen Kräften stand, zur Hand gehen konnte, dann ist es mir, als wollte dies wilde, unwegsame Land der „weißen Bibi“ nach all ihrem Leid nun auch alle seine Wunder offenbaren, wie zum Trost für das schwere Opfer, mit der das Mutterherz sich ein Heimatsrecht in diesem Lande erkaufen mußte.
Ja, Afrika ist jetzt unsere zweite Heimat, wir haben sie uns erkämpft und erstritten, nicht nur mit der Waffe in der Hand. Und das Zeichen unseres Sieges?... ein kleiner Grabhügel in Iringa, der nun alles birgt, was Elternherzen an hoffnungsvollen Zukunftsträumen gehegt! Ruhe sanft in deutscher Erde, Du liebes Jungchen!
Am 25. Mai brechen wir vom Zusammenflusse des Barali und Kumani mit dem Ruaha auf, einem landschaftlich besonders interessanten Punkte; die drei großen Flüsse bilden eine seeartige Erweiterung, auf deren flachen Sandbänken sich zahlreiche Krokodile[S. 200] sonnten; Tom schoß zwei davon. Über Kimara erreichten wir am 27. den Kimarafluß in der Nähe des Dorfes Komalingi; hier hatten kürzlich die Pocken furchtbar gehaust, von 62 Bewohnern waren nur 23 übrig geblieben. Am 28. waren wir in Mtengule, dem Stammsitze Mereres, dessen Vorväter schon hier als Sultane gesessen haben. Tom hielt hier Steuer-Schauri, in Anbetracht der langjährigen Bedrückungen von seiten des Sultans Quawa wurden die erbetenen Vergünstigungen gewährt. Tom hatte den Ort an Merere wieder zurückgegeben, der nun, nach unser aller Quälgeist, Quawas, Tod zum Mittelpunkt einer seßhaften, landbauenden Bevölkerung zu werden verspricht. Merere thronte auf dem von seinen Vätern ererbten Stuhle, auch ein großes, mit allerhand Stäbchen durchflochtenes Perlenhalsband gehörte mit zu den Attributen seiner Würde.
Hier trafen wir auch den auf einer Forschungsreise begriffenen Dr. Fülleborn. Er versah uns reichlich mit Lymphe, so daß wir im weiteren Verlaufe unseres Zuges zahlreiche Impfungen vornehmen konnten. Wir verlebten mit diesem liebenswürdigen Gelehrten recht frohe Stunden. Von allen Ehrungen, die uns von seiten Mereres zuteil wurden, war der Tanz seiner etwa 300 alten und jungen Weiber entschieden die anstrengendste für beide Teile, denn diese Feierlichkeit dauerte 24 Stunden! Wir sahen sie uns natürlich nur für kurze Zeit an, aber das Geschrei dieser schwarzen Mänaden klang noch in unsere Nachtruhe hinein. Übrigens stellten wir zu unserer Verwunderung fest, daß von sämtlichen jungen Frauen auch nicht eine einzige wirklich hübsch zu nennen war.
Am 30. Mai kamen wir nach ziemlich anstrengendem Marsche durch eine etwa 40 Kilometer breite, rings von Bergspitzen und Kuppen umsäumte Grasebene nach Ruipa, dem Grenzorte von Mereres Reich und Residenz seiner Mutter. Die alte Dame — man kann diesen europäischen Begriff in der Tat auf die weißhaarige, mit einer gewissen vornehmen Zurückhaltung auftretende Mutter des Sultans anwenden — machte auf uns den besten Eindruck; sie hat viel natürlichen Anstand, und die Unterhaltung[S. 201] mit ihr war wirklich interessant. So viel Achtung und Ehrerbietung die kluge, alte Sultanin auch bei ihrem Volke genießt, in Gegenwart ihres Sohnes, des regierenden Herrn, darf sie sich nicht auf einen Stuhl setzen, sondern muß in seiner Nähe auf dem Boden kauern, wie es auch die Araber tun müssen, die sich doch weit erhaben über die Neger dünken.
An der Ruahaquelle, am 13. Juni 1899.
Die letzten beiden Wochen passierten wir mehrere Dörfer, in denen die schwarzen Pocken furchtbar gewütet hatten; vom Kinde bis zum ältesten Greise kaum eine Person ohne Pockennarben. Auch die Malaria machte sich wieder recht fühlbar. Wir haben, jedenfalls aus dem Lager am 3. Juni in Mbarali, die Fieberkeime mitgebracht; Toms heftiger Anfall ging zum Glück rasch vorüber, aber ich bin so schwach, daß ich mich für den Rest unserer Safari noch tragen lassen muß.
Am 21. Juni treffen wir wieder in Alt-Iringa ein.
Iringa, 25. September 1899.
tarkes Erdbeben. Wie die Wahehe erzählen, werden Erdstöße hier öfter beobachtet. In der Tat hatten solche auch in den Tagen nach Quawas Tod, vor Jahresfrist etwa, stattgefunden; dieses Naturereignis war damals von den Wahehe mit dem politischen Ereignis des Todes des gewaltigsten Negersultans in ursächlichen Zusammenhang gebracht worden.
Am 22. November traf die Genehmigung von Toms Urlaubsgesuch ein. Seit der Rückkehr von unserer Safari, am 21. Juni, war ich krank, wochenlang nicht imstande, das Bett zu verlassen, es war eine furchtbare Zeit. Auch Toms Gesundheit war infolge der Strapazen der letzten Jahre so erschüttert, daß er, wenn auch schweren Herzens, den schönen Beruf, dem er mit Leib und Seele angehörte, wohl aufgeben müssen wird. Ein längerer Urlaub in der Heimat wird, so Gott will, uns beide wieder für die Aufgabe stärken, die wir uns infolgedessen gestellt haben: fernerhin als deutsche Landwirte und Kolonisten in diesem Lande zu wirken. — Nun geht es ans Einpacken. Die Hauptsorge, wo bleiben meine Totos, meine kleinen schwarzen Pflegekinderchen, ist auch glücklich gelöst. Missionar Neuberg wird sie bis zu unserer Rückkehr in Pflege nehmen.
Weihnachten.
Den heiligen Abend verlebten wir still für uns. Die beiden Feiertage folgten wir einer Einladung nach der katholischen Mission, wo die erste Taufe an erwachsenen Eingeborenen stattfand. Abends hatten die lieben Schwestern der Mission es sich nicht nehmen lassen, uns einen Weihnachtsbaum zu schmücken, sie und Pater Severin hatten allerhand hübsche Weihnachtsüberraschungen für uns in Gestalt von geschnitzten Holzgeräten, wie Näpfe, Löffel und dergleichen, in deren Anfertigung die Wahehe sehr geschickt sind.
Mit schmerzlicher Wehmut gedachten wir des heiligen Abends im vergangenen Jahre; in der zu einer Kapelle umgewandelten Halle hatten wir freudigen Herzens unsern Erstgeborenen taufen lassen und dann das heilige Abendmahl genommen.
Zur Taufe war der uns sehr sympathische Missionar Bunk von der Berliner evangelischen Missionsgesellschaft von seiner Station zu uns herübergekommen. Seitdem die Verhältnisse in Uhehe friedlicher geworden sind, ist auch diese Missionsgesellschaft hier in Arbeit getreten. Sie hatte schon mehrere Stationen im Kondelande am Nyassa und ist nun von dort, also von Westen her, an mehreren Punkten in Uhehe vorgedrungen. Ihre rasch angelegten Stationen versprechen guten Erfolg. Tom ist es eine Freude, diesen tüchtigen deutschen Männern in mancherlei Beziehung hilfreich sein zu können. Schwierigkeiten könnten ja entstehen aus einem Wettbewerb der katholischen und evangelischen Missionen. Aber bei den Größenverhältnissen unseres Landes und bei dem auf beiden Seiten vorhandenen Taktgefühl wird das kaum zu befürchten sein.
Auf der Station ging es nun auch ans Abschiednehmen. Wir besuchten noch einmal alle die Stätten unserer Tätigkeit; besonders der Garten mit seinen gleichmäßigen, gutgepflegten Beeten und Wegen bezeugte es mir, daß ich hier nicht vergeblich gearbeitet und gesorgt hatte, seine Erträgnisse kommen nun unsern Nachfolgern und ihrer Küche zugute. Die Übergabe der Station an Herrn v. der Marwitz erfolgte unter militärischer Feierlichkeit, in Gegenwart sämtlicher Jumben. Tom hielt eine Ansprache an die[S. 204] Askaris, in der er betonte, er freue sich, seinem Nachfolger eine so erprobte, tüchtige Kompagnie übergeben zu können; dann reichte er jedem Askari die Hand; auch die Jumben mahnte er zur Treue, sie hätten nun gesehen, daß der deutschen Macht keiner auf die Dauer mit Erfolg sich widersetzen könne, selbst Quawa habe unterliegen müssen. Für ihre Treue und Anhänglichkeit würden sie dann durch den Segen friedlicher Arbeit unter dem mächtigen Schutze der schwarz-weiß-roten Flagge belohnt werden. Alles war sehr feierlich gestimmt, nach afrikanischer Sitte freilich ringsum ein Höllenlärm mit Schießen und Schreien, in welchem vor allem die schrillen, gellenden Weiberstimmen dominierten, die ganze Stadt war auf den Beinen und des Abschiednehmens und Händeschüttelns kein Ende. Dann setzte sich die Musik an die Spitze, und geleitet von sämtlichen Europäern, unsern Askaris und großem Gefolge aus der Einwohnerschaft, zogen wir den Berg hinab. Dort verabschiedeten wir uns zum letztenmal von unsern Soldaten, dem Wali, dem Griechen und anderen alten Bekannten; die Europäer begleiteten uns noch weiter bis zu unserem ersten Lager am Ruaha. Eine Abschiedsbowle versammelte uns zum letztenmal um den Tisch, die Herren benutzten unsere Kisten als Stühle, und manche herzliche Rede, heiter und ernst, stieg uns zu Ehren nach alter schöner Heimatsitte.....
5. Januar 1900.
Der steile Abstieg liegt hinter uns. Das waren anstrengende Tagemärsche und noch dazu in strömendem Regen. Das Gebirgsland Uhehe liegt hinter uns, jetzt nähern wir uns wieder der Ebene. Der Temperaturunterschied ist bereits fühlbar, die frische, reine Bergluft werden wir nun nicht wieder atmen, die Ebene mit ihren warmen, fieberbergenden Ausdünstungen macht sich geltend. Ich ließ unsere Karawane an mir vorüberziehen, Träger, Askaris mit ihren Frauen und Boys, alles in allem etwa 150 Menschen; unter ihnen die Witwe eines unserer Askaris, eine Sudanesin, die nach dem Tode ihres Mannes wieder in ihre Heimat zurückkehren will; sie hat mir oft in Haushalt und Küche geholfen, bei[S. 205] dem Begräbnis ihres Mannes schloß ich mich dem Gefolge an, nicht als Bibi Kwubwa („gnädige Frau“), sondern als Leidtragende, was ihr damals von den anderen Frauen als hohe Ehre angerechnet wurde, jetzt geht sie unter meinem Schutze zurück zur Küste.
Die Jumben aus der Umgegend stellen sich alle ein, um uns glückliche Reise zu wünschen; dabei tauschten wir alte Erinnerungen aus, wie sie uns damals feindlich gegenüberstanden, als Quawas Einfluß noch wirksam; ich frug sie, warum sie mich damals in Perondo nicht angegriffen hätten, obgleich sie wußten, daß Tom auf einem Kriegszuge abwesend war; die Antwort lautete wieder: wir hatten Furcht vor dir, man hatte uns überall gesagt, du würdest uns alle töten! Nähere Erklärungen über diese heikle Frage vermied ich mit diplomatischer Gewandtheit, im Stillen segnete ich aber die Urheber jenes Gerüchtes, dem ich es verdanke, daß ich mich jetzt wohlbehalten auf der Heimreise befinde. Von großem Interesse ist es mir, aus Toms und der Jumben Unterhaltung zu hören, wann und wie nahe wir uns oft gegenübergestanden haben; das wird jetzt alles mit einer Gemütlichkeit und einem Interesse verhandelt, als gälte es einem Jagdzuge auf Kibokos und nicht dem Vernichtungskampfe auf Leben und Tod. Gott sei Dank, daß wir jetzt so ruhig über jene Zeit reden können.
Mgowero, 6. Januar 1900.
Der Übergang aus dem gesunden Gebirgsklima Uhehes zur heißen Ebene macht sich geltend; der heutige Marsch in der Glühhitze war furchtbar. Als wir am Lagerplatz unser Zelt aufschlagen ließen, stürzte einer der Leute vom Hitzschlag getroffen und starb trotz aller angewandten Mittel bald. Seine Frau wollte mit ihrem Jungen, einem allerliebsten kleinen Bengel von drei Jahren, bei der Leiche zurückbleiben, doch redete ich ihr so lange zu, bis sie sich entschloß, mit mir weiterzuziehen; was wäre aus dem armen Weibe in der Wildnis geworden?
7. Januar 1900.
Übergang über den sehr breiten, aber nicht tiefen Ruaha, in etwa 500 Meter Meereshöhe. Der Abstieg zum Teil ungemein steil, die Hitze nimmt zu. Die Vegetation zeigt schon ein ganz anderes Bild; die herrlichen Pelargonien, die in Irole so üppig wuchsen, daß ihre Blüten die Hügel und Abhänge ringsum wie mit Rosa überzogen erscheinen ließen, sind verschwunden. Der gestrige Todesfall hat bös auf die allgemeine Stimmung gewirkt, heute sind uns zwei Träger fortgelaufen; die Hitze wird immer fühlbarer; der schöne Algierwein, der all die Jahre über unsere Freude und Stolz gewesen, will nicht mehr schmecken, dagegen steigt der beinahe verächtlich behandelte Moselwein in unserer Sehnsucht; überhaupt kommt alles Saure und vor allem Früchte zur Geltung, während uns Fleisch anwidert.
Unter dem Allerleirauh unserer Karawane zeichnet sich ein Wanjamwesi-Ehepaar aus; sie hilft ihrem Manne beim Tragen der Last, im Lager geht sie mir viel zur Hand; ein angenehmer Gegensatz zu den meist so faulen Weibern unserer Soldaten. Die Jumben mit ihrem Anhange, die uns hier besuchen, zeigen auch schon einen von den schneidigen Wahehe in den Uhehebergen ganz verschiedenen Typus; Jumbe Musaka von Marore, der heute im Lager war, machte ganz den Eindruck eines alten, gemütlichen Bierphilisters; nichts mehr von jenem stolzen, natürlichen Selbstbewußtsein, das unsere stattlichen Wahehe so ungezwungen zur Schau trugen; das heiße Klima der Ebene erschlafft.
8. Januar 1900.
Wir passierten das Dorf Marore; hier waren die Hütten schon alle aus Stroh gebaut, nichts erinnert mehr an die Bergstämme von Uhehe. Das Land ist von üppigster Fruchtbarkeit, wir sehen viele Ziegen, aber keine Rinder.
Kisenguana, 9. Januar 1900.
Toms Geburtstag! Mein armer Mann ist leider wieder sehr elend, das Fieber hat ihn auf unserem Marsche noch kaum einen Tag verschont. So feierten wir den Tag recht still.
Ndisi (auf Deutsch „Bananen“), 10. Januar 1900.
Leider sind die Bananen noch nicht reif. Sehr zustatten kommen uns die Rasthäuser, die auf der Strecke angelegt sind, man findet nach dem heißen, anstrengenden Marsche doch gleich einen schattigen, kühlen Aufenthalt unter dem Schutze dieser weiten Strohdächer; die ganze Karawane, Menschen und Vieh, drängt sich um diesen gegebenen Mittelpunkt zusammen.
Mangatua, 11. Januar 1900.
Der Jumbe, ein noch junger Bursche, dessen Vater Tom gekannt hat, kam uns mit seinen Leuten zwei Stunden weit entgegen. Hier hatte Chef Fließbach damals nach dem Wahehe-Überfall die Boma Uleia gebaut (bei Kondoa), wo der tapfere Leutnant Brüning den Heldentod starb. Unser Weg ist überhaupt reich an Erinnerungsstätten für Tom an frühere Kämpfe und Überfälle; ein Netz solcher denkwürdiger Punkte erstreckt sich bis zum Rikwasee, von Songea, Tabora bis hinauf nach dem Kilimatscharo, sieben Jahre Kämpfe lassen ihre Spuren zurück. Die Angst vor den Wahehe ist hier noch unverkennbar, zehn dieser wilden Gesellen würden genügen, die ganze Einwohnerschaft zu verjagen. Gott sei Dank ist kein Grund mehr zu dieser Befürchtung vorhanden, seitdem Tom dieses tapfere Volk in sich zersplittert und unseren Interessen dienstbar gemacht hat. Bis hierher hatte sich Quawas Machtbereich erstreckt. Dem Jumben von Lusolwe, welcher Herrn v. Zelewski Chakula geliefert hatte, hatte er zur Strafe den Kopf abschlagen lassen, nur Farhenga, sein politischer Agent, brachte sich schleunigst in Sicherheit, um nicht auch der Rache des blutdürstigen Tyrannen zu verfallen. So ist es zu verstehen, daß die Leute hier in dem mächtigen, ehemaligen Quawa-Gebiete und den angrenzenden Landschaften in Tom jetzt ihren Befreier begrüßen.
Kilossa, 12. Januar 1900.
Heute starker Marsch, von 6 bis 10 Uhr und nachmittags von 1 bis 3½ Uhr. Meinem Manne machte es große Freude, die[S. 208] Station Kilossa, die er 1891 gegründet, wieder zu sehen, und freute sich über die schöne Entwicklung. Auf der Boma herzlichster Empfang und die liebenswürdigste Gastfreundschaft; Leutnant Abel war uns zu unserer freudigen Überraschung eine große Strecke entgegengeritten. Wir trafen hier die Leutnants Sand[11] und Pfeiffer[12], die, von Dar-es-Salaam kommend, auf dem Marsche nach Iringa sich befanden, sowie Zahlmeister Asp, der nach Muanza ging. Kilossa ist wie ein Taubenschlag, stetes Kommen und Gehen; um so höher müssen wir die Liebenswürdigkeit unserer Gastfreunde einschätzen, die uns in einer Weise aufnahmen, als seien Gäste für sie ein ganz ungewöhnliches, seltenes Ereignis. Leutnant Abel und Dr. Brückner hatten sogar ein trauliches Zimmer für uns hergerichtet; wir wurden gleich mit kühlem Bier erfrischt; dann besahen wir uns den Garten, die Ställe usw. und waren dann beim Diner äußerst vergnügt.
Am 16. hatten wir die große Freude, einen alten Freund meines Mannes, den Pater Oberle, auf seiner Station Mrogoro zu begrüßen, bis wohin unser alter Bundesbruder Kingomdogo von Geringeri aus uns das Geleite gegeben hatte.
Die Mission ist sehr schön gelegen, inmitten steiler, aus der Ebene unvermittelt schroff emporragender Berge, an einem Abhange, von dem aus sich eine wunderbare Fernsicht bietet. Im Garten eine reiche Auswahl von tropischen Kulturpflanzen: Kaffee, Orangen, Zitronen, Custard-Appels, Zimt, Kokospalmen und anderen jungen Anpflanzungen, ebenso ein prächtiger Blumenflor. Die Kirche ist das stattlichste Gebäude, was ich je, mit so unzulänglichen Mitteln errichtet, gesehen habe, 46 m lang, 10 m breit, 8 m hoch. Der Pater Superior ließ die Missionskinder singen; es war wirklich überraschend, wie hübsch die deutschen Gesänge zur Geltung kamen; besonderes Lob konnten wir aber[S. 209] dem schwarzen Organisten für sein wirklich schönes Orgelspiel spenden. Der Pater Superior Oberle und Tom sind schon seit 1892 befreundet, als Tom Chef der Station Kilossa war. Erst spät am Abend trennten wir uns von dem lieben Gastfreund, der uns gern noch länger beherbergt hätte.
Unsere Karawane hatten wir nach Simbamuene vorausgeschickt, wohin wir ihr bei schönstem Mondschein folgten. Dort schwingt eine Frau das Szepter als Jumbin, und zwar mit Erfolg. Wir wurden gleich nach unserer Ankunft in ihrer Hütte mit Bananen, Milch, Eiern und Hühnern reichlich bewirtet, da der unerträgliche Rauch uns aber allzusehr in die Augen biß, verabschiedeten wir uns möglichst bald von der gastfreundlichen alten Dame.
Am 17. waren wir in Mrogoro. Unser Lager ist wieder der Sammelplatz aller Jumben aus der Gegend, die uns begrüßen wollen; die Anhänglichkeit der Leute hier, wo Tom seit 1895 nicht wieder gewesen ist, ist wirklich rührend. Mit Gesang, Trommeln und Schießen werden wir eingeholt und im Triumphzug nach dem Lagerplatze geleitet. So ging es jeden Tag seit unserem Abschied von Kilossa, der Begriff „Ruhe“ ist für mich zum Gegenstand stiller, aber heißer Sehnsucht geworden. Unterwegs trafen wir den Landwirt Hierl mit einem kleinen, von zwei Eseln gezogenen Wagen, dem ersten Gefährt, das von Dar-es-Salaam auf so weite Entfernung ins Innere gelangt ist. Diese erste Fahrt ist ein gutes Zeichen für die künftige Erschließung von Uhehe; wird erst ein praktikabeler Fahrweg für größere Fuhrwerke angelegt und instandgehalten, dann bilden auch die steilen Mageberge kein Hindernis mehr, da man sie dann umgehen kann.
Am 18. passierten wir Kiroka, das „Pensionopolis“ unserer Askaris, von denen sich eine Anzahl nach Ablauf ihrer Dienstzeit hier angesiedelt hat (also eine Art Görlitz „in Schwarz“), auch sie kamen uns weit entgegen, um ihren früheren Chef zu begrüßen. Abends rasteten wir in Kikundi. Von hier aus wird[S. 210] die Gegend ganz eben, die Rasthäuser sind schmutzig und für uns unbenutzbar, auch das gute Wasser wird selten.
Sabiro, 19. Januar 1900.
Die Hitze auf dem heutigen Marsche hat mich ganz elend gemacht, auch das Wasser ist schlecht, ebenso das Rasthaus. Dicht neben unserem Wege tauchte plötzlich ein Leopard aus dem dichten Gebüsch auf; er entkam, ehe Tom schußfertig war, denn auf solche Begegnungen hatten wir kaum noch gerechnet.
Geringeri, 20. Januar 1900.
Die erste verheiratete Europäerin, die ich seit vier Jahren sah. Leutnant v. Trotha, auf dem Marsche nach dem Kivu-See, und Sergeant Heß, dieser mit seiner Frau auf dem Wege nach Tabora, kamen heute hier an; wir bewirteten sie bei uns; sie ist die erste Unteroffiziersfrau, die nach einer der Stationen im Innern geht, eine stattliche, große Erscheinung, blond, von energischem Wesen; sie scheint mir für die Verhältnisse im Innern sehr gut geeignet, und das Beispiel einer rührigen, praktischen Hausfrau wird bei dem bekannten Nachahmungstriebe der Neger, die gern sich nach den Gebräuchen der höherstehenden weißen Rasse richten, sicher gute Früchte tragen.
Am 21. waren wir in Kigongo, am 22. Ruhetag.
Am 24. Januar bei Msenga, besonders heißer Marschtag, aber auch besonders merkwürdig; wir erreichten den ersten Kilometerstein, 80 km von Dar-es-Salaam!! Da waren wir also glücklich wieder an der Grenze der Zivilisation angelangt; ich glaubte, meinen Augen nicht trauen zu dürfen, als sich plötzlich dieses altgewohnte Zeichen deutscher Kultur an unserer Karawanenstraße erhob. Wie wir als Kinder oft auf der Landstraße die Schritte von einem Meilenstein zum anderen gezählt hatten, so kontrollierten wir nun hier, mit der Uhr in der Hand, die Zeit, die wir für jeden Kilometer brauchten; das Ergebnis war erfreulich, wir machten den Kilometer durchschnittlich in 10 Minuten.
25. Januar 1900.
Nach fünfstündigem Marsche wohltuende Ruhe. Wir besuchten einen unserer früheren Unteroffiziere, Sabatke, der sich hier angesiedelt hat, und freuten uns der hübschen Häuslichkeit, in der eine deutsche Hausfrau waltet. Das Heim, das sich diese jungen Ansiedler geschaffen, blitzt und glänzt von Sauberkeit, unter schattigen Bäumen Tische und Stühle mit zierlichen weißen Decken, und ringsum das lebhafte Treiben und Lärmen des gutbesetzten Geflügelhofes mit Hühnern, Enten und Tauben, auch die Esel gaben ihr Teil zu dem ländlichen Konzert. Nach einem letzten Wegetrunk nahmen wir Abschied von unseren Landsleuten und kehrten nach dem Lagerplatz zurück, wo wir unsere Leute in freudiger Aufregung bei großen Mengen von Reis fanden, an denen sie sich für die Entbehrungen auf dem Marsche schadlos hielten. Es war doch oft bei ihnen recht knapp zugegangen, doch nun winkt ja das Ende: wir sind an der Küste.
Kisserawe, 26. Januar 1900.
Auf der Evangelischen Mission. — Wie schön ist es hier, ein irdisches Paradies — und doch lauert der Tod ringsum in dem Schatten der Bäume, noch hat das Fieber hier seine Stätte.
Man kann den Opfermut der Missionare nicht genug bewundern, mit dem sie den schier aussichtslosen Kampf gegen den unsichtbaren Feind aufnehmen, jeder Fuß breit Landes wird schwer erkämpft, Grabsteine bezeichnen die Etappenstraße, auf der die Kultur ihren Einzug hält. Auf der Station herrscht reges Leben, eine Welt im kleinen hat sich hier gebildet, überall wird gearbeitet, denn die Väter führen ihre schwarzen Pflegebefohlenen recht eigentlich im Geiste des „Bete und arbeite“ dem Christentum zu. Tischler und Drechsler, Schmiede und Zimmerleute und was sonst noch alles für Handwerker beim Bau und der Entwicklung der Station gebraucht werden, haben sie sich aus dem spröden, aber bei verständnisvoller Behandlung doch bildungsfähigen schwarzen Menschenmaterial herausgemodelt. Ein schönes[S. 212] Haus mit Türen und Fenstern zeugt von dem erzieherischen Wirken unserer evangelischen Mission; der Segen der Arbeit ruht sichtbar auf ihrem Tun. Nachdem uns die Kinder noch mit einigen deutschen Gesängen erfreut, nahmen wir Abschied von den gastfreundlichen Missionaren und gingen nach unserem Lagerplatze bei Pugu, der Versuchsstation für Viehzucht, die Gouverneur Liebert angelegt hat. Dort trafen wir Herrn Leopold, der aus Dar-es-Salaam zur Besichtigung der Station gekommen war, und verlebten einen fröhlichen Abend.
Der Gegensatz der abwechselungsreichen Geselligkeit der letzten Tage zu dem oft monatelangen Entbehren europäischer Gesellschaft — für uns während der letzten vier Jahre doch eigentlich der Normalzustand — wirkte geradezu aufregend; wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt erschien uns aber der erste Reitersmann, der unbehindert durch Träger, Askaris, Weiber und Boys wohlgemut sein Rößlein tummelte — wir sind an der Küste!
Dar-es-Salaam, Kaisers Geburtstag, 1900.
Wir sind da! Der erste Abschnitt unserer afrikanischen Tätigkeit ist zu Ende. Morgen gehen wir an Bord des „Herzog“, der uns der alten Heimat zuführen soll. Nicht für immer, ein Erholungsaufenthalt von einigen Monaten soll meinem Gatten, den Asthma und Fieber in den zehn Jahren seiner ostafrikanischen Tätigkeit bös mitgenommen haben, und auch mir, an der diese vier Jahre Ostafrika nicht ohne Spuren vorübergingen, frische Spannkraft verleihen zu unserem Lebensziel: als deutsche Landwirte in friedlichem Wettstreite an unserem Teil mitzuarbeiten an der wirtschaftlichen Erschließung unseres deutschen Afrika.
Dazu wolle Gott uns seinen Segen geben!

MassowFrau v. Prince
Hasso Adalbert
Frau v. Prince mit ihren Kindern.
(Zu S. 213.)
orstehend sind in erster Linie unsere Wander- und Kriegsfahrten geschildert worden. Wir, mein Mann und ich, sind seitdem friedliche Pflanzer geworden. Wir haben uns in der Fremde eine neue Heimat gegründet und sie sehr lieb gewonnen. Unser Heim Sakkarani liegt im gebirgigen West-Usambara, und von ihm, wie es entstand und wuchs, von den kleinen Leiden, aber auch von den großen Freuden deutscher Kulturpioniere will ich nachstehend erzählen.
Mein Mann hatte als alter, erfahrener Afrikaner alle Vorbereitungen sorgsam erwogen, und wir gingen mit reichlicher Ausrüstung ans Werk. Vielleicht in manchem mit allzu reichlicher. Man verfällt leicht in den Fehler, möglichst viel Wagen, Pflüge, Maschinen usw. gleich aus Europa mit hinüber zu bringen, weil man glaubt, es sei vorteilhafter, sie persönlich auszusuchen, als sie später schriftlich zu bestellen und lange auf sie warten zu müssen. Man vergißt dabei aber, daß man all das Gerät im Anfang schwer unterbringen kann, und man muß dann mit Schmerzen sehen, wie es Wind und Wetter und Ameisen ausgesetzt verdirbt, ehe man es in Gebrauch nehmen kann. Als Kuriosum möchte ich übrigens noch erwähnen, daß die Fracht für die bewegliche Habe, mit der wir in Dar-es-Salaam landeten, von dort nach Tanga, von wo aus wir ins Innere vorrückten, den gleichen Preis kosten sollte, den wir von Hamburg bis Ostafrika bezahlt hatten! Im Interesse der schnelleren Besiedelung der Kolonie wird eine Ermäßigung der enorm hohen Frachtsätze sehr zu wünschen sein.
Wir fanden im übrigen bei den Behörden das bereitwilligste Entgegenkommen. Dankbar gedenke ich der Liebenswürdigkeit des damaligen stellvertretenden Gouverneurs v. Estorff, der jetzt in Deutsch-Südwestafrika sich frische Lorbeeren errang, und der Gastfreundschaft, die ich in Wilhelmsthal beim Bezirkshauptmann v. Keudell fand, während mein Mann „Land suchend“ ins Innere vorausging. Schon nach wenigen Tagen holte er mich aber ab, und wir zogen hoffnungsvoll in die Berge, der Stätte unserer Zukunft entgegen.
Ich kann es nicht genug betonen, wie mich damals trotz aller begeisterten Schilderungen, die ich schon vorher gehört hatte, die Schönheit unserer neuen Heimat überraschte. Die Fülle der Naturherrlichkeiten, die sie bietet, und die wunderbar ozonreiche Luft, die das Höhenklima auch hier mit sich bringt, — es ist immer wieder, als könne die Brust sich nicht stark genug weiten, um sie einzuatmen — begeisterten mich förmlich. Schon in jenen ersten Tagen träumten wir von Luftkurorten und Sanatorien in den Bergen Usambaras für die armen Landsleute, die in der heißen Steppe oder an der Küste das kostbarste aller Güter, die Gesundheit, einzubüßen Gefahr laufen.
Es war Anfang Oktober; um diese Zeit herrscht überall in Ostafrika Trockenheit, alles Gras ist gelb und verdorrt. Hier oben aber, auf etwa 1500 Meter Höhe, wo mein Mann seine Wahl getroffen hatte, mutete das Gelände noch frisch an, der Boden atmete Fruchtbarkeit und erfüllte uns zukünftige Landwirte mit froher Zuversicht. Einige Kopfschmerzen machte uns dafür zunächst das geringe pflugfähige Land auf den meist ziemlich steilen Hängen. Es war auch ein recht ermüdendes Klettern, ehe wir ans Ziel gelangten und unsere Zelte bei unserem nächsten Nachbar, dem Jumben Mtangi, aufschlagen konnten. Der Mann gefiel uns schon deshalb, weil er Verstand genug gehabt hatte, seinen Sitz auf mäßig steiler Höhe zu nehmen, anders als die anderen Waschambaas, die ihre Hütten meist auf den unzugänglichsten Bergspitzen bauen; ein Erbteil aus der Zeit vor der[S. 215] deutschen Herrschaft, als die räuberischen Massais ihnen mit steten Einfällen drohten.
Es galt nun zunächst, das abzuholzende, für die Pflanzungen vorzubereitende Gelände genau kennen zu lernen. Vor den steilsten Bergkuppen schreckten wir dabei nicht zurück, um Einblick in unser Gebiet zu gewinnen. Das Land selbst ist ja noch spottbillig, aber es richtig auszunutzen, darauf kommt es an. Auf alles mögliche muß man achten, z. B. auch auf die Einwirkung des Windes. Denn nicht selten stellt sich, nachdem der Wald geschlagen ist, heraus, daß auch eine scheinbar ganz geschützte Stelle dem Winde so sehr ausgesetzt ist, daß man nachher mit Kosten und Mühen Windschutzbäume anpflanzen muß.
Ich muß einiges über unsere Arbeiter einschalten. Eine Arbeiterfrage gibt es ja auch in Ostafrika, wenn sie auch anders gestaltet ist, als im lieben alten Deutschland.
Man muß da unterscheiden zwischen den Tagearbeitern und dem angeworbenen Arbeiterstamm, den kein Pflanzer entbehren kann. Jene kommen aus der Nachbarschaft und arbeiten nur auf Tage, höchstens auf eine Woche; dann gehen sie wieder nach Hause, um das eigene Feld zu bestellen oder, richtiger gesagt, zuzuschauen, wie das ihre Frauen besorgen, Pombe zu trinken und zu schwatzen. Nur wenn sie Geld für irgendein Kleidungsstück gebrauchen, verdingen sie sich wieder auf einige Tage. Das Kleid kann allerdings auch für ihre Bibi (Frau) sein.
So ist die Sammlung eines Stammes ständiger Arbeiter von der höchsten Wichtigkeit. Ihn zusammenzubringen ist aber nicht so einfach. Es bedarf dazu genauer Landeskenntnis und vieler Geduld. Wenn man mit der Absicht, eine Pflanzung anzulegen, nach Ostafrika kommt, wird man wohl oder übel schon an der Küste eine Anzahl Leute anwerben müssen. Aber das ist fast stets unzuverlässiges, aus allerlei Stämmen zusammengelaufenes Volk und bildet nur den Anfang und den Übergang zu besseren Leuten. Man richtet dann meist auf die Wanyamwesi und die Wassukuma ein besonderes Augenmerk und findet auch sonst von den anderen Volksstämmen den einen oder anderen brauchbar.[S. 216] Während von dem von der Küste mitgebrachten Volk die schlechten Elemente bald das Weite suchen, gibt man den Vertrauen Erweckenden Anwerbegeld in die Hand und schickt sie auf „Leutesuche“. Oft kommen die Entsendeten nicht wieder, und man ist geprellt, oft auch bringen sie unbrauchbares Material, das bald wieder davonläuft. Anfangs wird man leicht nervös, wenn es wieder und wieder heißt: „Heut sind vier — sechs — zehn Arbeiter verschwunden.“ Man denkt auch wohl, das läge an falscher Behandlung. Gewiß — auch die Behandlung des Negers will gelernt sein. Der Hauptgrund aber ist doch der unausrottbare, zigeunerhafte Wandertrieb des Negers, der gar zu gern von Tür zu Tür zieht, um auszuprobieren, wo er sich am bequemsten von der leidigen Arbeit drücken kann. Dabei kommt eine Abart des europäischen „Zug nach dem Westen“ in Ostafrika, nämlich zur Küste, zur Geltung. Man ist dem gegenüber nur zu wehrlos. Ich hatte mir auch mein Ideal zurechtgezimmert; ich wollte Herz für unsere Arbeiter haben, mich um ihr Wohl und Wehe kümmern, ihnen in der Not meinen Beistand, bei Krankheiten ungebetene Pflege und Hilfe bringen. In der ersten Zeit hab’ ich das auch treulich gehalten — aber als ich sah, daß sie nachher doch davonliefen, beschränkte ich mich darauf, ihnen nur dann Verband und Arznei zu geben, wenn sie darum baten. Jetzt läuft uns nie ein Arbeiter fort; es sei denn: „Cherchez la femme.“ —
Bei unseren Geländeerkundungen hatten wir endlich auch unsere zukünftige Hausstelle gefunden und siedelten mit unserem Zeltlager, nachdem der Platz einigermaßen gesäubert war, zu ihr über. Eine Robinsonade im Freien begann damit, voller Entbehrungen und viel harter Arbeit — und doch denke ich gerade an sie so gern und freudig zurück. Oft genug hatten wir nicht einmal frisches Fleisch, denn die Eingeborenen waren noch so mißtrauisch, daß sie uns nur spärlich ihre Ziegen und Hühner verkauften. Es mag auch originell genug um unsere provisorische Niederlassung ausgesehen haben: Staub in den Zelten gab’s freilich nicht zu wischen, aber dafür mußte immer darauf gedacht werden, den bösen Schimmel von Kleidungsstücken und Geräten fernzuhalten oder zu entfernen. Sobald die Sonne herauskam, wurden Kisten und Koffer geöffnet, der Inhalt ausgebreitet, die Kleider und Decken über Sträucher und auf die Bäume gehängt — manchmal kam mir’s vor, als wäre das alles ein Warenhaus im Freien.
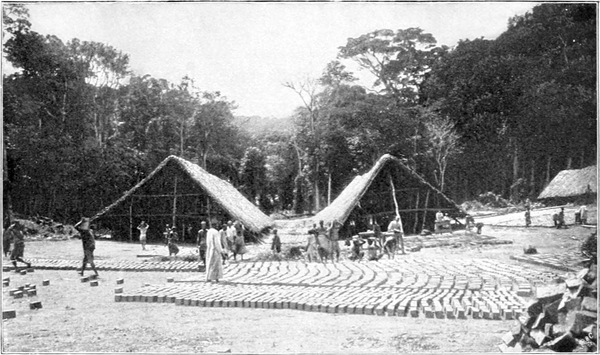
Ziegeltrocknen in der Sonne.
Im Hintergrunde die Schuppen.
(Zu S. 223.)

Landschaft in West-Usambara.
Im Mittelgrund Wasser tragender Küchenboy.
(Zu S. 226.)
Die Arbeit in der nächsten Umgebung begann. Ringsum erschallten die Axtschläge, die Bäume krachten nieder. Manchmal fiel’s uns schwer genug, solch altem ehrwürdigen Riesen zu Leibe zu gehen, und einigemale siegte die Sentimentalität. Aber wir haben das später bereut, denn solch ein geschonter Urwaldbaum verträgt es nicht, allein zu stehen; er geht bald ein, wird zur Unzierde, und seine herabfallenden Äste richten Schaden an.
Dann folgte die Periode des „Abbrennens“. Die Axt allein wäre ja des Waldes nicht Herr geworden. In dieser Zeit dünkte ich mich oft wie eine tränende Räucherware, denn der beizende Rauch war entsetzlich. Unsere Gesichter waren gar nicht mehr rein zu erhalten, unsere Hände gleich denen eines Schornsteinfegers, alle Kleider wurden ruiniert; wo man ging und stand, streifte man an verkohlte Äste, Zweige, Unkrautstengel, und die ganze Luft war mit schwarzen Staubteilchen erfüllt. Heilfroh war ich, als die Brandfackel aus der Umgebung des Zeltlagers weitergetragen wurde. Aber die helle Freude dann, als ich die mitgebrachten Apfel- und Zitronenbäumchen in das erste frisch gewonnene Land einpflanzen konnte, an deren Früchten wir uns jetzt schon erquicken! Das Roden machte ja noch unsägliche Arbeit, doch bald kamen auch Kartoffeln in die Erde, und Gemüsebeete wurden angelegt. Auf diesem zuerst gerodeten Stück Land von etwa 30 Hektar liegen heute unser Haus, Garten, Arbeiterwohnungen und unsere Wiese, deren frisches Grün wir sehr lieb haben und die sich so schön, wie eine rechte Alpenmatte, aus dem sie umgebenden Busch- und Kaffeeland abhebt.
Unser „Haus“, schrieb ich soeben stolz. Soweit waren wir aber lange noch nicht. An die Stelle der Zelte trat zunächst noch die „Hütte“. Gewaltige Lasten Malamba, verwelkte, getrocknete Bananenblätter nämlich, brachten die Negerinnen auf ihren[S. 218] Köpfen herangeschleppt. Mit Bindfaden wurden die Umfassungslinien der Hütte abgesteckt, längs des Fadens wurde Erde ausgehoben; von zwei zu zwei Metern kam ein stärkerer Stamm zu stehen, die Zwischenräume füllten dünnere, mit Lianen verflochtene Stämme; ähnlich entstand das Dach; unter vielen Schweißtropfen, mit unendlichem Ach und Weh, Zureden, Stöhnen kam der starke Dachfirststamm hinauf, und schließlich wurde das Gerippe überall mit den Bananenblättern durchwoben, wie man in einen Smyrnateppich die Fäden einzieht, und das Ganze innen und außen mit einem dicken Brei nasser Erde verklebt.
Tanzen hätte ich vor Freude mögen, als ich zum ersten Male den festgestampften glatten Boden der Hütte unter mir fühlte! Möbel hatten wir, durch frühere Erfahrungen gewitzigt, nicht mitgebracht. Aus Kisten und Kasten wurde aber bald das Notwendigste an Stühlen, Tischen, Regalen zurechtgezimmert. Es ging ganz gut, trotzdem wir zunächst sogar auf Fenster verzichteten und uns mit Vorhängen behalfen.
Nicht lange, und wir hatten auch eine Sägerei und damit etwas sehr Wichtiges, nämlich Bretter. Anfangs wollten die Neger an das Sägen absolut nicht heran, oder sie sägten so ungleichmäßig und langsam, daß man die Bretter ebenso billig hätte aus Berlin beziehen können. Allmählich fanden sie aber Geschmack an der Arbeit, und mit den ersten brauchbaren Brettern kleideten wir die Innenwände unseres Heims aus und legten Dielen. Als dann Gardinen, Decken und allerhand kleiner Krimskrams aus den Kisten herausgeholt war, hatte ich’s bald wohnlich und täglich neue Freude an jedem Fortschritt.
In Europa, gar nun in der Großstadt, kennt man solche Freuden gar nicht, wie sie das Schaffen auf dem unberührten Urwaldboden mit sich bringt. Wie froh waren wir, als wir den ersten breiten Weg gebahnt hatten; wie empfanden wir’s, als wir — das Angenehme immer gern dem Nützlichen zugesellend — uns auch einen Spazierpfad in ein verborgenes Stück Waldesherrlichkeit anlegen konnten! Mitten durch die Urwaldriesen mit ihren Lianen, durch mächtige Baumfarne bis zu einer wunderbaren[S. 219] Fernsicht, von der das Auge weit, weit über den grünen Wald, über romantische Felswände fortschweift. Heut noch ist uns dieser Weg vor allem wert. Und ich muß immer wieder daran denken, wie wir ihn zum ersten Male in der Nacht gingen, durch die tiefe Stille, während der Wald sich mit Myriaden von Leuchtkäferchen geschmückt hatte, von denen jedes sein Laternchen auf dem Rücken trug, die Luft magisch durchflimmernd. Es war so recht eine Stunde, in der sich das Herz mit Dankbarkeit gegen den Schöpfer füllte!
Inzwischen war wacker an der Plantagenanlage gearbeitet worden.
Des Morgens in aller Frühe schellt die Glocke. Die Leute treten an, der Assistent — wir würden in Deutschland Verwalter oder Inspektor sagen; natürlich ein Weißer — trägt ihre Namen in das Arbeitsbuch ein. Am Abend werden dann, um das vorweg zu nehmen, die Namen verlesen, und jeder erhält sein Poscho, das Geld für den Tagesbedarf, und eine Marke; diese Marken werden später gegen Geld eingelöst. — Nach dem Aufschreiben geht’s an die Arbeit. Die ausgesucht kräftigsten Leute ziehen zum Axtschlag hinaus. Bei ihnen bildet sich bald eine besondere Art der Arbeit heraus. Die Axt wird im Takt geschwungen, und während sie sich mit tänzelnder Pose in den Hüften wiegen, dringt der Schlag tief in den Leib des Riesen ein, Hieb auf Hieb, bis die Schwere der Baumkrone nicht mehr das Gleichgewicht halten kann, der Baum niedersaust, im Fallen schwächere Stämme mit sich reißend. Im letzten Augenblick springen die Schläger — sechs Mann z. B. bei einem Stamm von etwa drei Meter Umfang — geschickt zur Seite und begleiten das Niederkrachen mit wildestem Freudengeheul. Manchmal bleiben die Stämme aber auch, durch Lianen gehindert, hängen, und dann wird das Niederlegen besonders gefährlich. Verletzungen kommen häufig vor, ernste Unglücksfälle doch selten, und die erstaunliche „Heilhaut“ des Negers hilft ihm über leichtere Verwundungen schnell hinweg.
Sind vom Assistenten die kräftigsten Männer abgeteilt, so kommen die schwächeren an die Reihe, die Leute für das Reinigen[S. 220] und Gießen der schon fertigen Saatbeete, die Leute für meinen Garten, die Steinschläger und Ziegelformer — denn wir arbeiten ja nun auf das wirkliche Haus los —, endlich der große Trupp, der den Spuren der Axtschläger folgt. Es beginnt der erste Kleinschlag am gemordeten Walde. Alle großen Baumkronen werden zerschlagen, damit das Holz enger zusammenzuliegen kommt und später um so besser brennt.
Denn wenn das Schlagen ein gut Stück vorwärts gerückt ist, folgt wieder die Brennperiode; bei gutem Trockenwetter bald, bei schlechtem Wetter erst nach sechs Monaten. Überall lodert’s dann, die Flamme züngelt übers Feld, hier offen fast einer glitzernden Schlange gleich, dort unter dem Blattwerk verborgen fortschleichend. Und darüber ballt sich der Rauch in allen Schattierungen. Oft ist die ganze Anlage in undurchdringlich dichten Rauch gehüllt, darüber erhebt er sich zu Wolken, die aus weiterer Entfernung wie ungeheure Gewitterwolken ausschauen.
Ist der Boden ausgekühlt, so schreitet man zum zweiten Kleinschlag. Der Brand hat bereits alles Blattzeug und die kleineren Äste fortgeräumt. Jetzt wird außer den größten Stämmen der ganze Rest in kleine, leicht bewegbare Stücke zerschlagen. Schließlich müssen die Stämme und alles übrige zu Haufen geschafft werden, meist in den Schluchten, und über diese Haufen geht nun noch einmal die vernichtende Flamme hin. Es ist dies keine leichte Arbeit, und zumal das Schieben und Rollen der ganz großen Stämme kostet ungezählte Schweißtropfen. Der beaufsichtigende Assistent hat es oft verzweifelt schwer dabei, denn unsere guten Neger verstehen die Drückebergerei aus dem ff! Es gilt aufzupassen und überall einzugreifen, anzufeuern. Auch die schwarzen Vorarbeiter, die Simamissis, die freilich mit ihren Untergebenen nicht selten gemeinsame Sache machen, müssen ihr Teil dazu tun, wobei bisweilen ein nicht ganz sanftes deutsches Schimpfwort, das bei ihnen Anklang fand, höchst drollig dem Gehege ihrer Zähne entflieht. Ein gröberes wird angewandt, um die Widerspenstigen, bei denen allzu große Faulheit Pate stand, zur Vernunft zu bringen. Und wird geschlagen? Ich kann es mit gutem Ge[S. 221]wissen aussprechen: der weiße Mann mit der Knute existiert nur in der Phantasie mit den Verhältnissen absolut nicht vertrauter Europäer. Geschlagen darf nur bei grober Frechheit gegen den Weißen werden: dann ist ein schneller Schlag allerdings meiner Ansicht nach unentbehrlich und von der besten Wirkung. Sonst aber ist man von den Arbeitern viel zu abhängig, um sie durch Schläge zu reizen, und man kommt auf die Dauer ohne das leidige Prügeln viel, viel besser aus. Streng muß der Neger, der ein Kind ist und bleibt, behandelt werden, für Milde und nachsichtige Güte hat er wenig Verständnis und deutet sie stets als Schwäche. Aber auf gleichmäßig gerechte Behandlung hat er Anspruch, und sie wirkt stets am besten auf ihn!
Ist endlich das Feld gereinigt, so geht es an die Beetanlage. Wir bauten zunächst nur Kaffee, und von ihm allein spreche ich daher hier. Das Land wird in rechteckige Gärten eingeteilt; mit eingeknoteten Stricken, die von zwei Leuten in gleichmäßigem Zwischenraum gespannt werden, während ein dritter bei jedem Knoten einen Stock in die Erde stößt, werden die Pflanzlöcher bezeichnet, die 75 cm tief und 60 cm breit auszuheben und dann mit fruchtbarer, lockerer Erde auszufüllen sind. Dabei terrassiert man zugleich gewissermaßen die Beete, denn die Pflanzen müssen stets auf flachem Boden stehen. Hat sich nach einiger Zeit der Boden gesackt und ist schönes, feuchtes Wetter, so kommt endlich das Pflanzen an die Reihe. Die Pflänzchen, die in den Saatbeeten ¾ bis 1½ Jahre alt geworden sind, werden herausgenommen und sorgsam eingepflanzt. Und nun hebt die Sorge für sie an mit unaufhörlichem Reinigen von Unkraut usw. — aber ich will hier keine Schilderung der Kaffeekultur geben. Sei’s daher mit dem Gesagten, das ja auch nur ein sehr grobliniges Bild der Arbeiten ist, genug.
Gut ist’s nur, daß der Kaffee wenigstens nichts von dem gefährlichsten Feinde aller afrikanischen Kulturen zu fürchten hat — von der Heuschrecke nämlich. Uns haben diese bösen Gesellen auch einmal gründlich heimgesucht, und sie erschienen unter Umständen, die mich noch weit mehr überraschten, als das Auftreten[S. 222] der Heuschrecken selber. Dem Storch ist die Heuschrecke eine besondere Leckerei, wie übrigens dem Neger auch, der sie, nachdem er ihr Beine und Flügel abgerissen hat, in der Sonne dörrt und dann mit Wonne verspeist. Eines Tages kamen nun als Vorläufer einige Störche bei uns in Sicht, und die Neger verkündeten gleich, daß die Heuschrecken folgen würden. Aber noch vor ihnen zogen gleich schweren, dicken Wolken Riesenschwärme von Störchen, die einzigen, die ich in zehn Jahren in Afrika sah, heran. Sie mußten schon eine weite Reise hinter sich haben, denn sie setzten sich ermüdet auf Dächer und Bäume. Es waren unzählige. Ich übertreibe nicht: der Wald sah schließlich weiß von ihnen aus, wie eingeschneit. Ich hätte nicht geglaubt, daß es in der ganzen Welt so viele Störche gäbe. Am nächsten Morgen waren sie verschwunden. Ein paar Tage darauf aber bedeckten Myriaden von Heuschrecken die ganze Gegend, und als diese endlich weiterzogen, starrten die Äste im Walde kahl und öde gen Himmel, und in meinem armen Garten sah es nicht besser aus; unsere liebe, saftige Wiese war eine trockene, gelbe Grasfläche geworden. —
Als unsere Plantage — ja immer das Wichtigste! — einigermaßen im Gange war, konnten wir endlich auch an den Bau eines massiven Hauses denken. Guter Ton für die Ziegel war nach einigem Suchen gefunden worden, und die Ziegelei mit all ihren Finessen längst im Betrieb. Für das Fundament unseres Hauses aber brauchten wir Steine; zum Steinschlagen jedoch hatten die Neger merkwürdigerweise weder Neigung noch Fähigkeit. Es war ihnen zu neu, sie bildeten sich auch wohl ein, es sei eine furchtbar anstrengende Arbeit. Erst nachdem ihnen mein Mann höheren Lohn gab und einige besondere Vergünstigungen zugestand, ließ sich das seltsame Vorurteil wenigstens bei den besten überwinden. Allmählich lernten sie sich auch ganz gut ein: anfangs schlugen sie nur kleine Steine los, bald verstanden sie jedoch auch größere Quadern zu lösen. Übung macht den Meister. Umständlich und schwierig war der Transport der Steine zur Baustelle, wie auch der der Ziegel. Einen Fahrweg anzulegen, lohnte nicht, zumal da eingefahrene Tiere nicht zu kaufen sind. Ein Ver[S. 223]such mit Eseln aber scheiterte kläglich an deren Störrigkeit. So mußten wir schließlich doch zu der alten afrikanischen Transportart zurückgreifen: die Steine und Ziegel wurden von den Negern herangetragen.
Nachdem wir sehr gründlich als unsere eigenen Architekten den Plan des Hauses durchberaten hatten, ging’s ans Abstecken und das Bodenausheben für das Fundament. In der Nähe der Baustelle war ein Loch ausgehoben worden, in dem der Mörtel zurechtgestampft wurde. Leichtfüßige Knaben trugen ihn in leeren Petroleumfässern — die in Afrika ein gar begehrter, vielseitig verwendeter Artikel sind — den Maurern zu, die schon am Werk waren mit nicht geringem Geschrei: „Udongo! Udongo!“ — „Erde her!“, also ungefähr unserem „Lehm up“ entsprechend. Die Herren Maurer sind wie bei uns verschieden geschickt; so erhielten die gewandteren die Erker, Fenster-, Türkanten zugewiesen, die minder tüchtigen die glatten Flächen, wobei sich freilich beim Nachprüfen mit dem Lot oft genug die Notwendigkeit ergab, ein ganzes Stück windschiefer Arbeit wieder einreißen zu lassen, denn Augenmaß ist den Negern nicht gegeben.
Mit wachsender Freude sahen wir die Mauern emporsteigen und den Inder in Tätigkeit, der hier den Zimmermann spielte, Tür- und Fensterrahmen und den Dachstuhl bearbeitete. Grade damals — zwischen Tür und Angel sozusagen — wurde mir mein erster, kleiner Usambarit geschenkt, der mit seinem schwarzen Milchbruder um die Wette prächtig heranwuchs, ja jenen bald überholte.
So kam das Rüstfest heran, denn ein solches darf auch in Ostafrika nicht fehlen. Als der Dachstuhl lag und mit Wellblech, wie hier fast überall, eingedeckt war, meldeten sich die Maurer um ihren Backschisch, und ein junges Öchslein mußte zur Feier des Tages sein Leben lassen; natürlich auf „koschere“ Art, denn die meisten Neger essen kein Fleisch, wenn das Tier nicht am Halse durchschnitten wurde — selbst mit der Jagdbeute verfahren sie nach Möglichkeit so.
Bald war das Haus auch verputzt, und frohen Sinnes zogen[S. 224] wir in das erste Zimmer, das fertig geworden war. Wirklich sehr frohen Sinnes, weil das Wohnen in der Hütte uns durch die Ratten gründlich vergällt wurde — so sehr, daß wir sogar schon reumütig zu den Zelten zurückgekehrt waren. Endlich, endlich hatten wir jetzt ein eigenes, festes Dach über uns! Eine bleibende Stätte! Es kam uns vor, als hätten wir einen steilen, steilen Berg erklommen und dürften nun befriedigt und dankbar von unserer Höhe auf die arbeitsreiche Zeit zurückschauen, die hinter uns lag, und zuversichtlich hinaus auf die Zukunft vor uns!
Stillestehen, ruhen und rasten freilich darf man nie. Unsere Anlage wurde denn auch fortgesetzt vergrößert und ausgebaut. Massive Ställe entstanden und massive Arbeiterwohnungen, zu denen sich die Waschambaas drängten — solch schmuckes, sauberes Häuslein zieht sie doch mächtig an — und wir erkannten in ihrem Bau ein wichtiges Mittel, uns einen festen Arbeiterstamm zu sichern. Natürlich erhält jeder Mann zu seinem Hause auch soviel Feld, wie er haben will, um ihn recht seßhaft zu machen, und er wird bei der Einrichtung nach allen Richtungen hin unterstützt. Ich muß es immer aufs neue wiederholen: wir sind ja auf den Neger angewiesen und müssen ihn durch seinen Vorteil an uns zu ketten suchen.
Die Plantage machte die erfreulichsten Fortschritte; wir können bis heute mit dem Wachstum des Kaffees durchaus zufrieden sein. Mit welcher Freude verfolgt man das von Jahreszeit zu Jahreszeit! Am schönsten ist es, wenn die Pflanzung abblüht; dann sieht es aus, als wenn frischgefallener Schnee über den Feldern liegt, und geht man hindurch, so duftet es fast betäubend. Später beobachtet man wieder den Fruchtansatz mit gespanntem Interesse, die wachsende Rundung und Vergrößerung der Kirsche. Allmählich färben sich die grünen Beeren dabei gelblich, schließlich nehmen sie eine prachtvolle Purpurfarbe an, und ihr süßliches Fleisch winkt den Vögeln als schmackhafte Speise. Nun ist auch die Zeit der Ernte gekommen. Männer, Frauen und Kinder ziehen mit ihren Körben in langen Reihen aufs Feld. Am Nachmittag wird das Geerntete heimgebracht und am Pulper aufgeschüttet. Der Strahl einer Wasserleitung führt die Kirschen durch den Pulper, wobei sie ihres Fruchtfleisches beraubt werden, in die Gärbassins. Darauf kommt der Kaffee — die Bohnen — in Waschbassins, während die Schalen für spätere Düngung gesammelt bleiben. Die Bohnen wandern dann zur Sonnentrocknung auf Tennen, wo sie beständig gewendet werden müssen, und schließlich, oder bei schlechtem Wetter auch sofort, in die Aufbereitungsanstalt. Bei schlechtem Wetter! Ja, des Wetters Gunst oder Ungunst spielt bei uns dieselbe Rolle, wie nur bei irgend einem ostelbischen Agrarier, und heilfroh sind wir, wenn der letzte Träger mit dem letzten Sack Kaffee sich auf den Weg zur Bahnstation macht.

Blick auf unsere Kaffeeplantage.
Im Vordergrunde offene, mit gutem Boden für die Pflanzen hergerichtete
Löcher.
(Zu S. 224.)

Unser fertiges Wohnhaus.
Rückseite mit Aussicht auf den Hof.
(Zu S. 224.)

Eine Ecke der Diele im Hause Prince mit
Durchblick in das Speisezimmer.
(Zu S. 224.)

Idyll auf dem Hofe der Kaffepflanzung zu Sakkarani.
(Zu S. 229.)
Meine besondere Hausfrauenfreude ist natürlich mein Garten. Da blühen und duften als deutsche Lieblinge längst Veilchen und Rosen, zwischen ihnen aber auch eine schöne Afrikanerin, eine lilienartige Amaryllis mit einem prächtigen Kranz von fünf großen, weißleuchtenden, bräunlichrot gestreiften Blättern. Zu den ersten Apfelsinenbäumen haben sich Apfelbäume und Pfirsiche hinzugesellt, welch letztere in anderthalb Jahren drei Meter hoch wurden und prächtig tragen; auch Kirschen, Birnen und Pflaumen ernte ich schon. Ausgezeichnet gedeihen die angepflanzten Eukalyptusbäume, die in vier Jahren die enorme Höhe von fünfzehn Metern erreichten und mich, aus der Ferne gesehen, oft an unseren heimischen Fichtenwald erinnern. An europäischem Gemüse fehlt es meiner Küche nie. Aber auch allerlei Versuchsbeete sind angelegt worden: Chinin, Kampfer, Gerberakazie. Man muß erproben, was zu bauen sich lohnt. Neuerdings versprechen wir uns, neben dem Kaffee, viel vom Kautschuk und, was meinen Lesern neu sein wird, von Zedern-Anpflanzungen. Das Zedernholz ist ja, schon für die Bleistiftfabrikation, ungemein gesucht. Ich darf’s als unsere bestimmte Hoffnung verraten: unsere Usambara-Zedern werden dereinst es mit den historischen vom Libanon mindestens aufnehmen können.
Wie wir leben?
Wir arbeiten! Das ist das beste. Aber man denke nun[S. 226] nicht, daß wir in ostafrikanischer Einsamkeit versauern. Es gibt heut, mindestens bei uns in den schönen Usambara-Bergen, keine Einsamkeit in dem Sinne, wie der Deutsche in der Heimat sich das vorstellen mag. Es fehlt uns durchaus nicht an Verkehr. Gleich den Gutsbesitzern daheim wechseln wir Besuche mit den befreundeten Besitzern der Nachbarplantagen, mit den Herren vom Bezirksamt, mit den Gästen des nahen Sanatoriums. Das Traumbild, das uns vor fünf Jahren, beim ersten Einrücken in unser Reich, aufstieg, hat sich nun verwirklicht, und so mancher Leidende aus den heißen Gebieten holte sich im Usambara-Sanatorium bereits frische Kraft.
Und dann gibt es viele, viele liebe Gäste. Freilich ist der Besuch sehr verschiedener Art. Da sind, um mit dem Auslande anzufangen, durchreisende Engländer; besonders dankbar für die genossene Gastfreundschaft. Dann deutsche Jäger: zumal willkommen hiesige Bekannte und solche Männer, die, wie Prof. Dr. Paasche, aus reinem Interesse für die Kolonie zu uns kommen und sich mit offenem Blick in ihr zu orientieren vermögen. Auf der andern Seite fehlt’s aber auch nicht an „verbummelten Genies“, die sich von einer Plantage zur andern durchfuttern und die man nicht selten, mehr oder minder sanft, herausgraulen muß, am leichtesten meist durch sich steigernde Einschränkung — der geistigen Getränke. Weiter kommen Stellungsuchende, oft sehr fragwürdiger Art, und auch Goldsucher fehlen nicht. Wir liegen wirklich nicht mehr außerhalb der Welt. Was bedeuten denn die vier Stunden zu unserer Bahnstation Mombo? Für unsere Eltern war’s daheim oft weiter bis zum nächsten Schienenstrang. Ein Hotel gibt es eben in unserer Nähe nicht, und so ist jeder Reisende auf Gastfreundschaft angewiesen, die aber überall in Deutsch-Ostafrika aufs freundlichste gewährt wird.
Soll ich nun auch noch etwas von unserem materiellen Leben erzählen? Ich denke, wir essen recht gut. An Gemüse fehlt es nie; Butter ist vielleicht manchmal etwas knapp, aber ich habe eine schöne Rinderherde. Eier gibt’s reichlich — nur sehr klein sind sie. Frisches Fleisch liefern Schaf, Ziege, Huhn und[S. 227] manchmal Rind und Schwein; Ziegenbraten, über den man daheim leicht die Nase rümpft, ist gut zubereitet etwas ganz Vortreffliches.
Früh — meist recht früh — gibt es Tee oder Kaffee mit Eiern und kaltem Fleisch; um 12 Uhr bringt die zweite Mahlzeit ein Fleischgericht mit Gemüse und Kompott; am Abend — um 6 Uhr wird nämlich mit der Arbeit Schicht gemacht, und der gebildete Europäer macht Toilette — gibt es unser Mittag: Suppe, wieder ein Fleischgericht mit Gemüse und Kompott, süße Speise oder Käse. Also eigentlich ganz wie im lieben Deutschland. Nur ein Unterschied ist in der Tageseinteilung: wenn wir nicht Gäste haben (wobei dann auch häufig musiziert und wohl auch mal ein Tänzchen gewagt wird), gehen wir kaum je später als neun Uhr zu Bette. Dafür heißt’s aber auch früh aufstehen.
Vieles Gute verdanken wir natürlich der Bahnverbindung. Ja, unsere Usambarabahn! Wenn es nicht Tatsache wäre, man möchte es für einen Traum halten: Vor fünf Jahren war das Land längs ihres Laufes noch Wildnis — heut reiht sich hier eine Plantage an die andere. Alles Land an der Bahn selbst, ja darüber hinaus, ist schon in festen Händen. Dabei ist an Landspekulation nicht zu denken: das Gouvernement verpachtet jetzt nur noch, und erst wenn das gepachtete Land bebaut ist, kann man noch einmal soviel kaufen. Also 5 ha bebautes Land ergeben auf 10 ha Ankaufsrecht. Wir selbst wollten kürzlich ein bestimmtes Stück Land zu einer Gummiplantage kaufen, kamen aber ausgerechnet um 24 Stunden zu spät! Das alles hat lediglich die Bahn ermöglicht — und doch gibt es immer noch kluge Leute, die gegen Kolonialbahnen eifern.
Aber nun wieder zurück zu unserem Leben. Da muß ich vor allem noch der Post gedenken. Der Augenblick, in dem, etwa alle vierzehn Tage, der Bote mit der Europapost ankommt, ist immer ein großes Ereignis. Man träumt ihn schon im voraus mit offenen Augen durch, und der Gedanke an ihn verdichtet sich bis zu Visionen, in denen Eltern, Geschwister, liebe Freunde auftauchen. Der Briefwechsel hält uns Afrikaner am festesten mit der alten Heimat zusammen. Leider muß ich es sagen: die Briefe von den[S. 228] Angehörigen und Freunden werden seltener. Vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein. Aber ich empfinde, als ob auf die Dauer die Verschiedenheit der Interessen, die Schwierigkeit, sich in so ganz andere Verhältnisse hineinzudenken, den intimen Briefwechsel, den wirklichen Austausch der Gedanken erschwert. Schmerzlich empfinde ich es, wie sich allmählich die Verbindung doch lockert. Und ich kämpfe immer aufs neue dagegen an.
Aus diesem Grunde reiste ich nach Hause und nahm unsere Kinder mit, um sie den Großeltern vorzustellen. Trotz fünfjähriger Abwesenheit waren mir die alten Verhältnisse so vertraut, als ob ich nie fortgewesen wäre. Ich war glücklich, Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde gesund wieder zu sehen und manche neue Verbindung zu knüpfen.
Ich habe geschwelgt in Kunst und Theater und war entzückt und begeistert für alles Schöne, ich schwärme dafür, auch habe ich sehr viel für gute Leckereien übrig, und trotz allem war ich froh, als mein Urlaub zu Ende ging. Afrika zog mich förmlich zu sich zurück. Es wäre dies auch der Fall gewesen, wenn mein Mann nicht dort geblieben wäre. Es ist eben ein eigen Ding um die Tropen.
Außer den Briefen bringt die Post uns ja aber auch die deutschen Zeitungen (mit ihren für uns oft so drollig verspäteten Nachrichten) und so oft als geschenkliche Überraschung Büchersendungen von Mittler & Sohn aus Berlin. Nein, wir versauern nicht! Wir haben unsere gute Bibliothek, die wir fortdauernd durch alle besseren Neuerscheinungen bereichern, wir haben unsere guten deutschen Zeitschriften, unter denen auch Velhagen & Klasings Monatshefte uns immer aufs neue erfreuen. Und wir haben unseren Gedankenaustausch darüber. Denn nach des Tages Last und Mühe sitzen mein Mann und ich gerne zu einem Plauderstündchen beisammen, werfen alles Äußerliche und Alltägliche hinter uns und suchen unsere schönste Erholung in der Pflege höherer Interessen. Das kann, das darf der Europäer in der Fremde nicht entbehren. Er muß sich auch dadurch seine Überlegenheit wahren; er bedarf dessen, um sich selber in Zucht zu halten.
Eine wundervolle Erholung bietet endlich die Jagd. Auf[S. 229] eigenem Grund und Boden haben wir ja freilich außer Buschbock und Wildschwein nur kleineres Raubzeug und Vögel, und das würde dem verwöhnten Afrikaner auf die Dauer nicht genügen. Aber wir sind beweglich. Wir entschließen uns, wenn die Arbeit es gestattet, schnell einmal zu einer ausgedehnteren Jagdexpedition — immer wir beide, denn in Afrika (und das ist wieder das Schöne) geht die Frau immer mit dem Mann. So ziehen wir denn in die waldreiche Steppe mit Zelten und Betten und Trägern — „das Bündlein“ für solch eine Expedition zu schnüren, ist nicht ganz so leicht, wie das Kofferpacken in Europa. Aber desto schöner, erquickender ist auch die goldene Freiheit solch eines Nomadenlebens. Jedesmal kommen wir erholt, angeregt, von neuer Arbeitsfrische erfüllt, heim und freuen uns dann doch auch wieder unseres gemütlichen Hauses, seines Komforts — und natürlich zu allermeist des Wiedersehens mit unseren drei Buben, die gottlob! in der gesunden Luft unserer Berge prächtig gedeihen. Unser Jüngster Adalbert fing sein kleines Leben mit guten Vorbedeutungen an. Am Geburtstag meines Vaters, einen Tag vor dem Seiner Majestät, geboren, weilte zu derselben Zeit der erste Hohenzollernsproß, Prinz Adalbert von Preußen, in unserer Kolonie, und Seine Königliche Hoheit war so gnädig, die Patenstelle bei unserem Nesthäkchen anzunehmen.
Seitdem ich dies schrieb, hat die Kolonie ihren Aufstand gehabt. Überall hat es unter den Schwarzen gegärt. Der ganze Süden war in hellem Aufruhr bis dicht an die Grenzen der Wahehe. Es war ein Segen, daß die Wahehe treu zur Fahne hielten, denn dadurch wurde den Flammen des Aufstandes Einhalt geboten und verhindert, daß sie nach Norden übergriffen, der sich ja nur abwartend verhielt. Die Wahehe der Landschaft Mage und jener Gegend warfen sich den andringenden Wasagara entgegen und hielten unter schweren eigenen Verlusten das Eindringen der Empörer in ihr Land ab. Auch der so tüchtige Großjumbe Muvigny, auf den sich meine Leser als meinen ritterlichen Begleiter bei einer Reise besinnen werden, und unser braver, treu ergebener Farhimbu, den mein Mann von Sakkarani aus in[S. 230] Irole, nahe dem Zelewski-Schlachtfelde, angesiedelt hatte, bezahlten ihre Treue mit ihrem Leben. Ebenso hat mein alter Freund Sultan Kiwanga seine von Anbeginn der deutschen Herrschaft bestehende Freundschaft für sie mit dem Leben büßen müssen. Häuptlinge, die zu rebellieren beschlossen hatten, lockten ihn in einen Hinterhalt und ermordeten ihn. Unsere anderen schwarzen Freunde bogen die Sache durch und erfreuen sich noch ihrer Stellungen, Jumbe Mtaki bekam sogar ein Sultanat. —
Die Kompagnie Iringa unter der tapfern Führung des Hauptmanns Nigmann und dem zielbewußten Oberleut. v. Krieg hat eine hervorragende Rolle auch in diesem Aufstand gespielt. Schnell entschlossen eilte Hptm. Nigmann mit ihr in das Kampfgebiet, entsetzte die Station Wahenga noch in elfter Stunde und befreite sogar die fern im Süden gelegene Station Songia von den sie umlagernden Wangoni. Wie schneidig aber die Stämme der dortigen Gegenden sind, beweist der Umstand, daß bei Songia der einzige Europäer, der in dem Aufstand im offenen Felde gefallen ist, Dr. Wiehe, den Heldentod fand. Abermals hat Heldenblut besonders schwarzer deutscher Untertanen den Boden Afrikas getränkt, möchte es segensreiche Frucht tragen und endgültig allen Kampf von dem schönen Lande fernhalten.
Wenn die alten Namen alte Erinnerungen doppelt lebhaft zurückrufen, tauchen auch unsere früheren Mitkämpfer, mit denen wir meistens noch in brieflichem Verkehr stehen, wieder auf. Bei denjenigen, die seitdem aus dem Leben geschieden sind, habe ich dies vermerkt. Von den andern sind manche verschollen, einige leben in Deutschland pensioniert oder wie Hptm. Engelhardt in der Armee, Prof. Dr. Fülleborn in Hamburg am tropischen Institut. Andere, wie Major v. Prittwitz, Hptm. v. d. Marwitz, Albinus, Prof. Dr. Ollwig, sind noch so glücklich, ihre Kraft der kaiserlichen Schutztruppe hier oder wie Glauning in Kamerun weihen zu können. Nur zwei, Feldwebel Merkl und Richter, sind unserm Beispiel gefolgt und haben, als ihre Gesundheit den kaiserlichen Dienst nicht mehr gestattete, sich als Ansiedler in der Kolonie, und zwar[S. 231] am Kilimandjaro, niedergelassen. Die letzte Post brachte uns für August die Einladung zur Hochzeit des Herrn Richter in Tanga.
Einen herben Verlust erlitten wir durch das Hinscheiden unseres hochverehrten Gönners und Freundes Hermann von Wissmann, von dem ich noch 14 Tage vor seinem Tode einen herzlichen Brief erhielt, in dem er dankbar von seinem Glücke schrieb, das er täglich durch seine Frau und Kinder genösse. Aber nicht nur seiner Familie und seinen Freunden wird er unvergeßlich sein, sondern soweit die deutsche Zunge reicht, wird sein Name mit Stolz als der unseren Einer genannt werden. Möchte das Denkmal, zu dessen Aufbau sich alle rüsten, als Wahrzeichen der großen Taten des Begründers der Kolonie Deutsch-Ostafrika bald errichtet werden.
Inzwischen haben sich auch zum ersten Male einige Reichstagsabgeordnete, als Vertreter des deutschen Volkes, von dem Wert unserer Kolonie überzeugt. An solchen Reichtum und solche Fülle von Naturschönheiten hatten sie nicht geglaubt. Mein Wunsch wäre es, dieses Jahr kämen einmal die ärgsten Kolonialfeinde heraus, sie würden besiegt und bekehrt nach Hause gehen und selbst am eifrigsten für Verkehrswege und Eisenbahnen werben. Man kann nur solange das Fortschreiten der Kolonie verhindern, als man sie nicht selbst gesehen hat. Darum schnürt das Ränzel und überzeugt euch. Ehre allen den Männern, die sich ihrem Beruf auf lange Zeit entrissen, um sich dann mit solcher Hingebung der selbstgestellten Aufgabe zu unterziehen. Uns brachte der Besuch noch eine besonders große Freude; auch mein verehrter Vater, mit seinen 64 Jahren, war nicht einmal vor der weiten Reise zurückgeschreckt und nahm sich die Mühe, die beschwerlichsten Touren mitzumachen. Seitdem die Augen meines Vaters auf Sakkarani geruht haben, seitdem kommt mir unser Heim noch heimatlicher vor. Zu beklagen war nur die Kürze seines Hierseins — 3 Tage —, die noch täglich durch lange Ausflüge zu 2–4 Stunden entfernten Ansiedlern eingeschränkt wurden. Hier konnte sich mein Vater von dem Vorwärtskommen und der Zufriedenheit der Leute überzeugen. Dieses sind durchweg[S. 232] Leute, die bei der Einwanderung 10000 Mark haben mußten. Noch geeigneter würde der kleine Mann ohne Heller und Pfennig sein, ja womöglich solcher, der in Deutschland Not an Kleidung und Nahrung leidet. Er wird hier ein lebensfrohes, menschenwürdiges Dasein führen, und je mehr er Not mit seiner Familie — je zahlreicher desto besser — litt, um so mehr wird er die Wohltat des Lebens ohne Hungern und Frieren empfinden. In dem gesunden, relativ keimfreien Lande kann er mit Frau und Kindern selbst den Boden bearbeiten, so daß er keine Tagelöhner braucht. Damit die Kinder nicht unwissend aufwachsen, wird bei genügender Anzahl für Schulunterricht gesorgt werden; aber bei den allerersten Familien muß es auch so gehen, vielleicht helfen da die Missionen aus. Auf jeden Fall aber wäre es für die Kinder ein Segen, wenn sie, anstatt im Winter vor Kälte und Hunger zu verkümmern an Geist und Leib, hier in kräftiger, gesunder, warmer, freier Luft arbeiten und dann ihren Hunger an Mais, Gemüse, Kartoffeln, Eiern stillen. Als Sonntagsgericht gäbe es auch ein Huhn in den Topf, ab und zu wohl gar ein Schweinchen oder eine Ziege, von der sie noch die Milch hätten.
Auch bei der leidigen Wohnungsfrage wäre es ein Glück nicht nur für den einzelnen, sondern für das ganze Volk, wenn die Jugend in Gottes freier herrlicher Natur heranwüchse, anstatt in dumpfigen, schmutzigen, von Menschen überfüllten Räumen zu vegetieren, wo sie der Hauch der moralischen Verwesung umgibt. Meine Jungen tragen jahraus jahrein nur ein Hemdchen, Hose und Bluse und sind glücklich, wenn sie barfuß gehen können; sie frieren nie, trotzdem der Ofen ein unbekannter Gegenstand im Hause ist. Dafür tragen sie lange Haare, um das Genick gegen die intensiven Sonnenstrahlen zu schützen, denn der Tropenhelm wird von den wilden Buben doch gar leicht zur Seite geworfen.
Welche Wohltat liegt schon in dem Gedanken, die Jugend mit roten Backen aufwachsen zu sehen, anstatt der hohlwangigen, verfallenen, alten Gesichterchen der frierenden kleinen Geschöpfe im Winter. Hier müßten sich wohltätige Frauen zusammentun und Geld sammeln, um es solchen verarmten Familien zu er[S. 233]möglichen, ein neues segensreiches Leben zu beginnen. Es gibt soviel Wohltätigkeitsvereine, und darum bitte ich, gründet auch einen zur Unterstützung armer Familien, die auswandern wollen. Laßt das deutsche Blut nicht in fremdem Lande verloren gehen, sondern wirkt dahin, daß es Wurzeln in deutschen Kolonien schlägt und dort zu schönem Stamme aufschießt.
Es liegt nicht im Nahmen meines Buches, mich darüber noch näher auszulassen, doch erwähnen möchte ich, daß kleine Handwerker, wie Schuster, Schneider, Schlosser, besonders gut vorwärtskommen würden; sie würden sich viele kleine Nebenverdienste hierzulande schaffen können, ähnlich den Handwerkern in kleinen Dörfern, die ja auch ihr Feld nebenbei bestellen. Dieselben Vorteile, die man den Deutsch-Russen zuteil werden läßt, sollte man auch unsern auswanderungslustigen Landsleuten gewähren. Anfangs werden manche vielleicht in den ungewohnten Verhältnissen sich unglücklich fühlen, „was der Bauer nicht kennt, das frißt er nicht“, das Gasthaus, der Klatsch, die Sonntagsrauferei werden fehlen, doch allmählich werden sie sich einleben und zufrieden sein. Am meisten für hier würden Leute aus verarmten Gebirgsgegenden sich eignen, da sie an das Bergeklettern gewöhnt sind und auch verstehen, den Pflug an steilen Abhängen zu führen. Es müssen aber saubere, arbeitsame, vorwärtsstrebende Leute sein und in Gruppen angesiedelt werden, damit sie sich gegenseitig zur Arbeit anspornen, denn in der Einsamkeit würden sie bald die Selbstzucht verlieren und verbummeln. Ein gewisser Druck dürfte nicht fehlen. Die Kolonisten müßten zu kleineren Dorfschaften vereint werden, die Dorfschulzen müßten dahin wirken, daß das Saatgut, die Zuchttiere, das Handwerkszeug, das von der Regierung zu stellen wäre (es kommt ja später durch Zölle usw. wieder ein), nicht aufgegessen und verkauft werden könnte. Manch ein erwachsener Sohn würde als Holzfäller, Pflugführer, Wagenlenker sein gutes Auskommen auf größeren Farmen, manch erwachsene Tochter als Dienstmädchen gute Stellung in Familien finden und meistens sich bald verheiraten. Sie würden sich dann auch nicht einsam fühlen, denn Eltern und Geschwister wären ja in erreichbarer Nähe. Ein anderes Verfahren erscheint nicht zweckmäßig, da es in den Bergen an dem genügenden Absatz fürs erste noch fehlen würde und die Verbindungen zur Küste noch viel zu schlecht und teuer sind und die deutschen Ansiedler doch schon mehr Ansprüche machen, auch tritt für die Kinder die Schulfrage in den Vordergrund.

Die Reichstagsabgeordneten auf ihrer Studienreise
nach Deutsch-Ostafrika Juli-August 1896.
1. Hr. Dr. Arendt. 2. Hr. Justizrat Dietrich. 3. Hr. Amtsgerichtsrat
Schwarz. 4. Hr. Oberstabsarzt Hönmann (der hiesige Begleiter). 5.
Hr. Oberamtsrichter Kalkhof. 6. Hr. Ingenieur Hackbarth (Leiter der
Usambara-Bahn). 7. Hr. v. Prince. 8. Hr. Kapitän Doherr von der
Deutsch-Ostafrika-Linie. 9. Hr. Lehmann. 10. Hr. Bezirksamtmann Zache
von Tanger. 11. Hr. Oberst v. Massow. 12. Fr. v. Prince.
(Zu S. 231.)
Für Unverheiratete, die in der Steppe eine Farm gründen wollen, sind Kapitalien von 30000–50000 Mark erforderlich. Für Familien mit Kindern ist eine Ansiedlung dort wegen der Malaria nicht zu raten.
Ich schreibe dies im „Wonnemonat Mai“, wo zu Hause alles blüht und sprießt und zu neuem Leben erwacht ist. Auch uns gibt der Mai frisches Leben durch seine große Feuchtigkeit. April und Mai sind für uns die Winterzeit, die hier sogenannte große Regenzeit, für sie wird schon Monate vorher fleißig vorgearbeitet. Da wird der Boden urbar gemacht und zubereitet, um die Pflanzen, wenn die Regenzeit beginnt, aufnehmen zu können. Den neuen Anpflanzungen gibt der Regen frische Kraft, daß sie schneller anwurzeln. Dies ist für alle Kulturen das gleiche und ändert sich nur in der Art des Geländes; bei Grasland z. B. ist die Arbeit eine entsprechend geringere als bei Buschland. Ein guter Pflanzer ist derjenige, der bis zur großen Regenzeit — so genannt zum Unterschied von der kleinen Regenzeit im November und Dezember, weil es in diesen Monaten weniger regnet — sein gestecktes Ziel erreicht hat.
Überhaupt, gesund sind wir alle! Früher galt der Satz als unumstößlich richtig: wo es in Afrika fruchtbar ist, ist es ungesund und gesund nur, wo es unfruchtbar ist. Nun, Usambara liefert den Beweis, daß das in dieser Verallgemeinerung nicht zutrifft. Auch außerhalb der Usambara-Berge weist Deutsch-Ostafrika noch weite, weite Strecken Landes auf, in denen der Deutsche arbeiten kann.
Ich hoffe und ich glaube es bestimmt, unsere Berge werden in nicht allzu ferner Zeit vielen fleißigen deutschen Siedlern eine neue Heimat auf deutschem Boden gewähren. Es herrschen vielfach auch darüber ganz übertriebene Vorstellungen, welches Grundkapital dazu erforderlich sei, sich hier eine Existenz zu gründen.[S. 235] In Wirklichkeit gehören dazu nicht Hunderttausende. Schon mit einem Kapital von 30–50000 Mark kann man vorwärtskommen. Freilich: das Vermögen allein tut es wahrlich nicht. Zäher Fleiß und unbeugsame Energie und die Gabe, sich in den neuen Verhältnissen zurechtzufinden, müssen sich dazu gesellen. Man muß sich zu schicken wissen, muß Entbehrungen in den Kauf nehmen können. Man darf nicht mit den Allüren des großen Herrn nach hier kommen, der einen breiten Train mit sich führt, mit kostspieligem Aufsichtspersonal rechnet. Selbst ist der Mann — das gilt hier! Und die Frau muß dem Mann als wahre Helferin, recht als guter Kamerad zur Seite stehen. Das Leben ist auch hier ein Kampf. Aber dieser Kampf birgt unzählige Freuden in sich. Das Ringen mit der Wildnis, das Erschließen eines Stückchens Land nach dem anderen gewährt immer neue Genugtuung. Und immer neue Befriedigung bringt auch das Erhalten des Errungenen, denn die Wildnis sucht sich jedes Fleckchen Erde, das man ihr abgewonnen, unausgesetzt zurückzuerobern. Wir sind glücklich bei alledem gewesen, andere können es auch sein: in dem Bewußtsein, für die eigene Familie zu arbeiten, die Pflicht gegen sie — und zugleich damit eine Pflicht gegen unser teures Vaterland und seine schönste Kolonie zu erfüllen.
Dort oben auf meinem Bücherbrett stehen Goethes Werke — er hat auch uns ein gutes Wort gegeben:
„Wenn jeder von uns als einzelner seine Pflicht tut und jeder nur im Kreise seines nächsten Berufes brav und tüchtig ist, so wird es um das Wohl des Ganzen gut stehen... Jeder wisse den Besitz, der ihm von der Natur, von dem Schicksal gegönnt war, zu würdigen, zu erhalten, zu steigern; er greife mit allen seinen Fähigkeiten so weit umher, als er zu reichen fähig ist. Immer aber denke er dabei, wie er andere daran will teilnehmen lassen.“ — — —
Ballade.[13]
shairi la bwana Prinzi.
E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW., Kochstr. 68–71.
Skizze der Reiseroute der Frau v. Prince in Deutsch-Ostafrika.
Lageplan von Sakkarani, des jetzigen Besitztums.

Verlag der Königl. Hofbuchhandlung E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW., Kochstr. 68–71.
Fußnoten:
[1] Vom 18. September 1895 bis zum 3. Juni 1900 (seinem Todestage) Oberführer und charakterisierter Major der Kaiserlichen Schutztruppe in Ostafrika.
[2] Der graue Papagei heißt im Kiswahili „Kassuku“.
[3] Der Dorfschulze trägt nämlich eine großartige, englische Husarenuniform.
[4] Das ganz lange Gras, 3 evtl. 4 m, kenne ich nur an der Ulanga-Niederung in größeren Partien.
[5] Einige Monate später wurde er mit Speerstich verwundet und erlag bald darauf dem Würgengel Afrikas, der Malaria.
[6] Auch dieser tapfere Offizier und liebenswürdige Kamerad nahm im Kolonialdienst ein tragisches Ende: am 5. Februar 1903 wurde er bei Marrua in Kamerun als Oberleutnant der Kaiserlichen Schutztruppe während einer Expedition ins Innere des Schutzgebietes, vor seinem Zelte sitzend, von einem Neger überfallen, der zwei vergiftete Pfeile auf ihn abschoß; der zweite Schuß traf in den rechten Oberschenkel; der Pfeil wurde zwar sofort entfernt, aber schon binnen fünfzehn Minuten erlag Graf Fugger der tödlichen Wirkung des Pfeilgiftes. Bis zu seinem letzten Atemzug bei vollem Bewußtsein, hat er noch an seine Braut geschrieben. Seine letzten Worte sind würdig, der Erinnerung erhalten zu werden: „Nehmt nicht Rache an diesen Schwarzen, sie wissen nicht, was sie taten. — —“ Man hat so vieles Schlechte von Afrika in die Welt posaunt, aber von solchem Adel der Gesinnung erfährt man nichts.
[7] Kanzu = langes weißes Negerhemd.
[8] Seitdem an Malaria gestorben.
[9] Wenige Jahre später war dieser kleine Kreis stark gelichtet. Präfekt Maurus erlag in Medibira dem Fieber, was er sich wohl von der Küste mitgebracht hatte, zwei Schwestern fielen der Pest zum Opfer bei Ausübung ihrer barmherzigen Krankenpflege, und Schwester Gabriele, die mich mit großer Aufopferung gepflegt hatte, starb an Lungenentzündung.
[10] Wurde, weil er treu zu uns hielt, bei dem Aufstand 1906 ermordet.
[11] Ein halbes Jahr später raffte diesen hoffnungsvollen Offizier das perniziöse Fieber auf seinem Heimatsurlaub dahin.
[12] Wurde bei Lupembe verwundet und verunglückte vor einem Jahre auf einer Elefantenjagd.
[13] Durch die Freundlichkeit des Herrn Professor Dr. Velten, der sich um die Erforschung der Eigenart unserer Neger so hoch verdient gemacht hat, erhielt ich dies Gedicht. Es wurde wohl 1894 nach dem Wahehezug des Gouverneurs Exz. v. Schele gedichtet, als mein Mann seinen ersten Urlaub nach 5jährigem Aufenthalt in Afrika antrat.