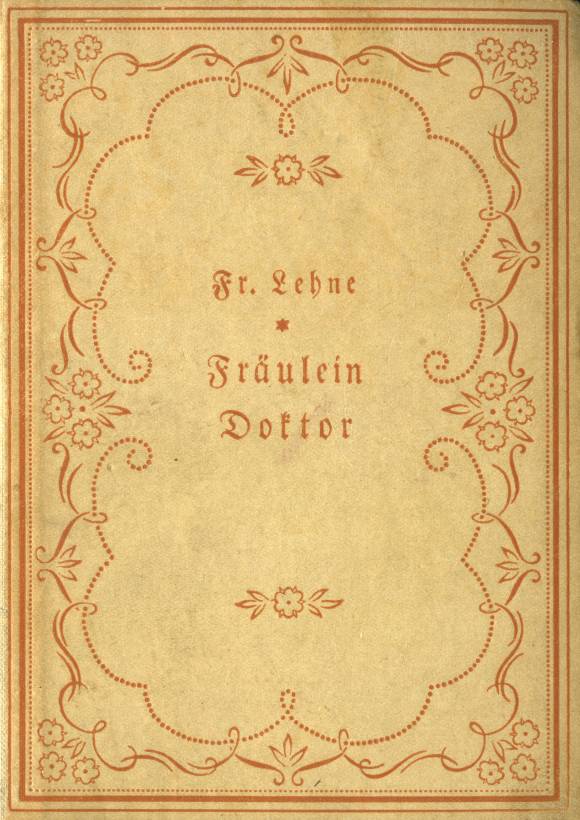
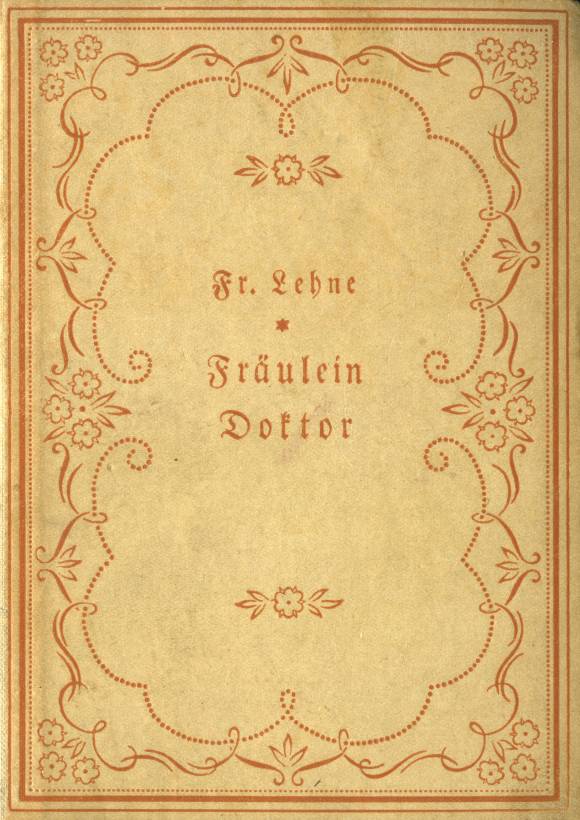
Anmerkungen zur Transkription:
Worte, die im ursprünglichen Fraktur-Text in Antiqua gesetzt waren, sind hier kursiv wiedergegeben. Die Rechtschreibung und Zeichensetzung des Originals wurde weitgehend übernommen. Am Ende des Textes befindet sich eine Liste vorgenommener Korrekturen.
Roman
von
Fr. Lehne

Leipzig und Bern
Verlag von Friedrich Rothbarth
Alle Rechte vom Verleger vorbehalten
Verlagsnummer 141
Printed in Germany
Buchdruckerei Helm & Torton, Leipzig O 27

Ruhig, mit einem ganz kleinen Lächeln um den feinen, klugen Mund, blickte Beate ihrem aufgeregt im Zimmer herumgehenden Vater nach.
Sie war sich ihrer Sache gewiß, und es stand fest bei ihr, daß sie ihr Vorhaben auf jeden Fall auch ausführen wollte! Halb hatte sie ja den Vater schon bekehrt; der erste Ausbruch seiner Erregung war bereits vorüber — was er jetzt sagte, war nur noch ein schwacher Versuch zum Widerstand.
»Du bist ja verrückt, Beate!« Herr Haßler schüttelte den Kopf und blieb vor der Tochter stehen, die bequem in einem Schaukelstuhl lag, die Hände im Nacken verschränkt.
»Aber warum, Vater?« lautete ihre gleichmütige Frage. »Ich sehe die Berechtigung dieses Ausspruchs nicht ein!«
»Ach was! Larifari,« brummte er, »jeder vernünftige Mensch wird mir recht geben, wenn ich dir kurzerhand verbiete, zu studieren! Ich ärgere mich schon genug, daß ich dir nachgegeben habe darin, ein Gymnasium zu besuchen — wenn ich geahnt hätte —«
»Aber, Vaterchen,« unterbrach sie ihn in schmeichelndem Ton, »aber, Vaterchen, hat dich denn mein glänzend bestandenes Abiturium nicht gefreut?«
»Das wohl, Mädel, und ganz kolossal! Aber ich dachte, damit wäre der Unsinn endgültig vorüber.«
»Nein, jetzt soll es erst recht beginnen.« Sie breitete die Arme weit aus. »Ach, du glaubst nicht, wie ich mich darauf freue, weiter zu lernen!«
»Noch mehr lernen? Ich meine, du hättest gerade genug unnützes Zeug in deinen Kopf gepropft! — Was dir nun noch fehlt, das kannst du hier bei Mutter am besten lernen! Bekümmere dich jetzt mal um die Küche und das Haus — ich glaube, davon verstehst du weniger als ein zehnjähriges Mädchen!«
Beate lachte. »Da magst du schon recht haben, Vaterchen, aber dennoch verspüre ich zu derartigen prosaischen Beschäftigungen durchaus keine Lust — andernfalls würde ich schon schnell hinter die Geheimnisse von Mamas Walten und Wirken kommen! Denn was ich will, das kann ich auch.« Bei diesen Worten trat ein Ausdruck in ihr Gesicht, daß man nicht gut an deren Wahrheit zweifeln konnte.
Sie stand auf und legte schmeichelnd die Arme um den Hals des Vaters. Bittend sah sie ihn mit den schönen klugen Augen an. »Nicht wahr, alter Herr, du bist lieb und erfüllst mir meinen Herzenswunsch! Ach, du glaubst ja nicht, wie ich damit verwachsen bin — es würde für mich ein Aufgeben aller Lebensfreuden bedeuten, wenn du mir das verwehren wolltest!«
Sie zog ihn zu sich aufs Sofa. »Komm, setzen wir uns, und höre mir mal ruhig zu, wie ich mir so alles gedacht habe.«
Etwas ängstlich war Frau Rechtsanwalt Haßler, eine freundliche, sehr gütig blickende Dame, dem Wortgeplänkel des Gatten und der Tochter gefolgt. Sie saß am Fenster des Wohnzimmers mit einer feinen Handarbeit beschäftigt. Für sie war Beates Wunsch keine Überraschung mehr; denn am Morgen schon hatte das junge Mädchen zu ihr davongesprochen, und jetzt nach dem Nachmittagsschläfchen war auch dem Vater die Eröffnung darüber gemacht.
Die erste Aufregung und der erste Widerstand waren vorüber, und Beate sah, daß der Vater jetzt ihren Erklärungen zugänglicher war. Sie erfaßte deshalb ihren Vorteil. »Siehst du, alter Herr. Du kannst doch nichts dagegen haben — als Jurist weißt du genau, daß du gar keine stichhaltigen Gründe hast, mich zurückzuhalten! — Ja, wenn ich mich zu dem Studium der Rechtswissenschaft entschlossen hätte, könnte ich das begreifen, denn Konkurrenz läßt man nicht gern neben sich aufkommen.«
Sie lächelte bei diesen Worten und sah ihm schelmisch ins Gesicht. Er zupfte sie am Ohrläppchen. »Mutter, sieh nur diese eingebildete Person, dies Küken!«
»Siehst du, Vater,« fuhr Beate fort, »da ich aber Ärztin werden will, hat das doch keine Gefahr für dich! Ich lasse mich hier bei euch nieder; Ihr räumt mir das erste Stockwerk ein, und wenn euch etwas fehlt, habt ihr den Arzt gleich im Hause!« Sie bat und schmeichelte; auf alle seine Einwendungen hatte sie die schlagendsten Erwiderungen — er mußte schließlich seiner Tochter, auf deren Klugheit er nicht wenig stolz war, nachgeben. Ihre Art, zu bitten, war unwiderstehlich; außerdem war sie sein Abgott; sie konnte viel bei ihm erreichen!
»Alles, Kind, was du da vorbringst, ist ja recht schön und gut, und wenn einmal dein Herz so daranhängt, will ich dir durchaus nicht mehr entgegen sein! Aber, kurz herausgesagt, du bist mir zu schade, Mädel, daß du deine schönsten Jahre so in der Arbeit verbringen willst. Andere tanzen und amüsieren sich in deinem Alter, und du —«
»Ja, daran habe ich eben keine Freude — de gustibus non est disputandum — lasse mich nach meiner Fasson selig werden! Glaube aber darum nicht, daß ich etwa ein Blaustrumpf oder ein verdrehtes Frauenzimmer werde; nein, ich will dennoch meine Jugend genießen.«
Da mischte sich zum erstenmal Frau Haßler ins Gespräch. »Warum nur so viel Aufregungen? Ich denke, daß du über kurz oder lang doch heiraten wirst!«
»Heiraten, ich, Mutter? Ich denk nicht daran; wenigstens vorläufig noch nicht. Dahin komme ich noch früh genug, wenn es einmal sein muß. Jetzt will ich noch lernen.«
»Aber dein ganzes Streben und Arbeiten wird dich niemals so beglücken können wie das Bewußtsein, einem geliebten Mann anzugehören! Ich habe bisher geschwiegen, um alles zu hören, was du dir in deinem Köpfchen zurechtgelegt hast. Aber auf das eine, woran Vater noch nicht gedacht hat, möchte ich dich noch aufmerksam machen: Du beraubst dich selbst der reinsten, heiligsten Freuden, die dir durch nichts ersetzt werden können, wenn du auf deinem abenteuerlichen Vorsatz beharrst.«
»Weißt du denn das so genau, du Liebe, Gute? Ich will gar nicht endgültig darauf verzichten, in einer Ehe glücklich zu werden. Wenn mir jemand begegnet, dem ich gut sein kann und der mich heiraten möchte, dann können wir immer noch darüber reden; und wer weiß, ob ich nicht gar schon an jemand denke? Jetzt aber will ich vor allem selbständig sein und mir einen Beruf schaffen, daß ich allen Möglichkeiten gegenüber gewappnet bin. Wenn ich nun alte Jungfer werde? Das ist doch auch nicht ausgeschlossen! Das Leben ist so ernst, die Zeiten sind so schwer, daß man nicht so in den Tag hineinleben kann. Und was unser guter Monsieur Adolf kostet, wissen wir zu genau.«
»Na und ob!« Ein hörbarer Seufzer begleitete diese Worte des Rechtsanwalts. »Der Junge treibt’s auch manchmal zu toll! Aber deshalb, mein Töchterchen, ist doch für dich gesorgt, und auch ganz anständig. Nun möchte ich endlich meinen Kaffee haben; von dem vielen Reden ist mir ordentlich der Mund trocken geworden. Und meine Pfeife gibst du mir wohl mal ’rüber! Was man an seinen Kindern für Überraschungen erleben muß!«
Flink und gewandt hatte ihm Beate die »Friedenspfeife«, wie sie scherzend bemerkte, gestopft und angebrannt, aus der er jetzt die ersten Züge tat, und es war, als kam da eine gewisse Behaglichkeit über ihn.
Der Kaffeetisch war bereits gedeckt, und Beate bediente die Eltern. Der Mutter trug sie die Tasse nach dem Fenster, weil diese zu ihrer Arbeit das volle Tageslicht brauchte. »Hier alter Herr, zur Beruhigung!« lächelte sie dem Vater zu. »Ist genügend Sahne und Zucker daran? Und hier Kuchen — Mutters Osterkuchen winkt so verlockend.«
Er nahm ein Stück davon und versuchte den Kaffee. »Alles richtig getroffen.«
Lächelnd sah sie ihm zu, während sie mit dem Löffel in ihrer Tasse rührte.
Rechtsanwalt Haßler war einer der beliebtesten und meistbeschäftigtsten Anwälte der Stadt. Er war ein Mann in guten Verhältnissen. Zwei Kinder nannte er sein eigen, einen Sohn von fünfundzwanzig Jahren und Beate, die Tochter, die neunzehn Jahre zählte. Sie war ein außerordentlich begabtes Kind, sodaß die Eltern ihren Bitten nicht hatten widerstehen können, ein Gymnasium zu besuchen. Dort hatte sich immer mehr der Wunsch in ihr befestigt, zu studieren. Es dünkte sie herrlich, immer weiter in den Born des Wissens zu tauchen, in die Geheimnisse der Wissenschaft einzudringen.
Und heute stand sie am Ziel ihrer Wünsche; die Eltern hatten nachgegeben!
»Rate, Beate, wer jetzt über die Straße kommt?« sagte da Frau Haßler, in den Fensterspiegel blickend.
»Kläre Brückner?«
»Nein, ganz jemand anders! Doch du wirst sicher nicht darauf kommen.«
Die Hausglocke schlug hell an, und wenige Minuten später meldete das Mädchen: »Herr Doktor Scharfenberg.«
Ein freudiges Rot überflog da Beates Gesicht. »Soll ’reinkommen!« rief der Rechtsanwalt gemütlich.
»Ist schon da!« Eine schlanke Männergestalt stand im Rahmen der Tür und eilte dann auf das Ehepaar zu. »Tag, Onkel! Tag, Tantchen! Wie gehts euch denn? Und da ist auch Bea — Mädel, bist wohl noch gewachsen?«
Freudestrahlend blickte er sie an, während er ihr herzlich die Hände drückte.
Endlich war die Wiedersehensfreude zu Ende, sowie die übrigen Fragen nach dem Befinden. »Bei euch ist’s immer noch so gemütlich! Wie heimelt mich doch das Wohnzimmer hier gerade an, Tante Christine,« sagte er herumblickend, »dort in jener Ecke hinter dem Ofenschirm haben wir so oft gesessen, Adolf und ich, und die gebackenen Pflaumen und Birnen verspeist, die wir dir so fein aus deiner Vorratskammer zu stibitzen verstanden hatten —,« man lachte, und er fuhr fort: »und neue Gardinen hat Tantchen, sogar ganz moderne — Brises-Brises — oder wie die neumod’schen Dinger heißen — Mutter hat ja auch welche — darum habe ich dich gar nicht sehen können, Tante, so sehr ich auch nach deinem Fenster gespäht.«
»Für mich ist das aber umso günstiger! Dann kann ich beobachten, was auf der Straße vorgeht, ohne gesehen zu werden!«
»Fängt Tantchen auf ihre alten Tage noch an, neugierig zu werden? Ei, ei, das ist ein Fehler, den ich noch gar nicht an ihr bemerkt habe,« scherzte er, »sollten die Jahre dich verändert haben?«
Er hatte eine so kindlich-fröhliche Art, die unwillkürlich die Herzen für ihn einnahm. »Nun sag’ erst einmal, Schorschchen, hast du Adolf gesehen? Er schrieb, daß er keinen Urlaub habe bekommen können.«
»Nur flüchtig hab’ ich ihn gesprochen; ich hatte in letzter Zeit rasend zu tun, und er war dienstlich ebenfalls sehr in Anspruch genommen. Im übrigen geht es ihm gut; er ist wieder etwas magerer geworden. Pfingsten hofft er fünf Tage herauszuschlagen!«
»Das freut mich! Ohne den Jungen hab’ ich gar kein richtiges Fest!« meinte Frau Haßler. »Trinkst du vielleicht ein Täßchen Kaffee mit uns? Es gibt heute frischgebackenen Quarkkuchen.«
»Der ja deine Spezialität ist. Da kann ich nicht widerstehen.«
Beate bediente ihn; sie goß ihm Kaffee ein und bot ihm Kuchen an. Mit Entzücken ruhten Georgs Blicke auf dem schönen Mädchen, dessen Bewegungen von großer Anmut und Ruhe waren. »Wann bist du gekommen?« fragte Herr Haßler.
»Heute morgen. Ich bin die Nacht durchgefahren, um einen Tag zu sparen. Übrigens viele Grüße von Mutterchen. Sie ist sehr glücklich, daß ich es so gut mit meiner Stellung getroffen habe. Assistenzarzt bei Professor Brause wird so leicht nicht jeder — aber der Herr hält große Stücke auf mich ...«
»Noch eine Tasse Kaffee gefällig, Schorschchen?«
»Ja, bitte, Bea, wenn es dir keine Mühe macht —« und dann mit bewunderndem Blick: »Wie du dich verändert hast in den zwei Jahren, die wir uns nicht gesehen haben.«
»Wundert dich das so, Schorsch? Aus Kindern werden Leute.«
»Und aus Mädchen Bräute,« scherzte Herr Haßler.
Ein jähes Erschrecken zuckte über Georgs Gesicht. »Bräute? Wie soll ich das verstehen? Bist du verlobt, Beate, und —«
»Aber nein, Schorschchen, ich denk’ ja nicht daran — Papa spaßt nur.«
»Nun, zu verwundern wäre es gerade nicht. Du bist doch in dem Alter.«
»Kaum die Schule verlassen und schon Braut — nein, so eilig hab ichs doch nicht.«
»Na, lieber wäre es mir schon, als daß sie ihre verrückte Idee verwirklicht und studiert,« brummte der Rechtsanwalt.
»Was, Bea, du willst studieren? Ist das denn wirklich wahr?«
Ein so großem Staunen klang aus seinen Worten, daß sie etwas pikiert fragte: »Und warum sollte ich nicht? Traust du mir die Fähigkeit nicht zu?«
Sie lachte: »Da staunst du, wie? Sogar vergißt du, deinen Kaffee auszutrinken.«
»Ja, ja, Schorschel,« nahm der alte Rechtsanwalt das Wort, »kämpfe du gegen diesen Dickkopf an! Sie pocht auf ihr glänzend bestandenes Abiturium und will durchaus auf die Universität! Wer weiß, wer ihr all’ das dumme Zeug in den Kopf gesetzt hat — studieren! Als ob es nichts anderes zu tun gäbe!«
»Aber, Bea, das ist ja verrückt, glatt verrückt!« fuhr es dem jungen Arzt heraus.
»Hab ich auch schon gesagt, ganz dasselbe,« meinte Papa Haßler vergnügt, einen Beistand gefunden zu haben.
»Du bist ja sehr höflich, mein Freund, das muß ich sagen,« entgegnete das Mädchen ruhig, »doch läßt es mich sehr kalt, wie du mein Vorhaben beurteilst. Ja, ich will studieren, und zwar Medizin!«
»Auch das noch!«
»Du fürchtest wohl die Konkurrenz, Georg? — Vorläufig hast du das nicht nötig,« lächelte sie ein wenig spöttisch. »Du bist mir ja so viele Semester voraus.«
»Wie bist du nur auf die unglückliche Idee gekommen, Beate? Es ist doch blanker Unsinn! Du und studieren!«
Sie zuckte ein wenig ungeduldig die Achseln und hielt sich die Ohren zu. — »Ach geht, ihr werdet nachgerade langweilig mit eurem Staunen! Wie ich auf die Idee gekommen bin? — Ganz von selbst, da ich einen meinen Neigungen passenden Beruf ergreifen will.«
»Aber gerade Medizin! Beate, Mädel, hast du denn keine Ahnung, wie schwer das für ein Weib ist — welche Selbstüberwindung das kostet?«
Ihre schönen dunklen Augen ruhten spöttisch auf seinem Gesicht. »Mein lieber Herr Doktor, Krankenschwester ist auch nicht viel anders als Ärztin: auch sie hat mit Sachen zu tun, die vollste Selbstüberwindung verlangen, und wie sehr wird gerade dieser Beruf als der weiblichste gepriesen!«
»Na, erlaube mal, das ist doch ganz etwas anderes. Aber deine Frauenlogik —«
Mit einer Handbewegung schnitt sie ihm das Wort ab: »Lieber Schorsch, spare dir deine Mühe, mir mein Vorhaben leid zu machen. Deine Ansicht darüber hast du ja genügend gekennzeichnet mit den Worten »glatt verrückt!« Das erübrigt mir alles andere! Gewiß, ich verhehle mir keineswegs, daß ich schwere Jahre vor mir habe, aber glücklicherweise gehöre ich ja nicht zu den Schwächsten meines schwachen Geschlechts. Ich habe Kraft, noch viel mehr zu überstehen! Du scheinst sehr gering von meinem Können zu denken!«
Mit einem langen, schmerzlichen Blick sah er auf das schöne Mädchen, das er als halbes Kind schon geliebt. Und heute war er mit so großen Hoffnungen gekommen, heute, da er ihr eine gesicherte Zukunft bieten konnte. Hatte sie denn ganz vergessen, in welcher Weise sie vor zwei Jahren Abschied genommen hinten im Garten in der Geißblattlaube, wo er sie geküßt und sie seinen Kuß auch erwidert hatte?
Kühl blickten jetzt ihre dunkelbraunen Augen, und ihre Worte klangen herbe; sicher hatte er sie verletzt. »Verzeihe, Beate,« entgegnete er daher, »ich hatte dich nicht kränken wollen, trage mir nicht nach, was ich gesagt habe! Es erscheint mir nur gar so unfaßlich, daß du deine Jugend und Schönheit in solch unnützem Streben verbringen willst.«
»Unnütz? Verzeihung, mein Freund, du bist aber nicht sehr glücklich in der Wahl deiner Entschuldigungen. Ich hoffe, daß ich einmal ein sehr nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft werde! Du scheinst wirklich zu denken, daß ich nur als Sport betreiben will, was mir sehnlicher Wunsch und Bedürfnis ist.«
»Da höre einer das Mädel an! Gib dir keine Mühe, Schorsch, es ist doch vergebens! — Stecke dir lieber ’ne Zigarre an, da drüben stehen sie — die nicht, die kleine Kiste — so —« sagte Herr Haßler. »Beate muß nun mal ihren Willen haben! Na, meinetwegen! Ich bin nur neugierig, wenn sie die Sache satt kriegt! Denn ich kann es nicht glauben, daß sie durchhalten wird. Wenn sie erst am Seziertisch steht, wird ihr die Lust bald vergehen.«
»Meinst du, Vater?« fragte sie, und ihre Augen blitzten. »Das wirst du niemals erleben; ein Umkehren gibts für mich nicht — nie!«
»Und wo willst du studieren, Beate?«
»Zuerst in Zürich, dann in Berlin! Ich nehme mein Studium durchaus ernst und will dahin gehen, wo man am wenigsten auffällt.«
Wie ein Schatten war es auf Georgs Fröhlichkeit gefallen, und bekümmert blickte er auf Beate, die ihm in ihrer kühlen Sicherheit so fremd erschien. Um von dem ihm so unsympathischen Thema abzulenken, fragte er sie nach ihrer Gymnasialzeit. Voller Stolz zeigte sie ihm da ihre tatsächlich hervorragenden Zeugnisse. — Georg lobte sie sehr.
»Weißt du, Bea, wenn du weniger wüßtest, wäre es mir schon lieber,« versuchte er zu scherzen.
Sie gab ihm einen leichten Schlag auf die Hand. »Ja, Schorschchen, darnach gehts aber nicht! Hast du nicht selbst den Grund dazu gelegt? Denke doch an die Stunden, in denen du mir Griechisch und Lateinisch beibrachtest und niemals ungeduldig wurdest,« entgegnete sie in gleichem Tone. Lächelnd hielt sie ihm die Hand hin: »Na, wollen uns wieder vertragen!«
Georg Scharfenberg war der einzige Sohn von Rechtsanwalt Haßlers bestem Freunde, der vor einigen Jahren gestorben war. Zwischen den beiden Familien hatte stets ein reger Verkehr stattgefunden, der durch die Nachbarschaft der Häuser noch erleichtert wurde. Georg Scharfenberg und Adolf Haßler waren in gleichem Alter und besuchten das Gymnasium zusammen — nur mit dem Unterschiede, daß Georg stets einer der Ersten und Adolf einer der Letzten war.
Dieser war ein liebenswürdiger, ziemlich leichtsinniger Sausewind, dem so leicht niemand böse sein konnte, während Georg ernster und schwerfälliger veranlagt war. Beate, das schöne, begabte Kind wurde von allen verzogen. Und Georg besonders opferte seine meiste freie Zeit dafür, ihren nie zu besiegenden Wissensdurst zu stillen; er führte sie in die Geheimnisse der griechischen und lateinischen Sprache ein, und er war erstaunt über die ungeheuer leichte Auffassungsgabe des Kindes.
Dann bezog er die Universität, während Adolf in das Heer eintrat.
Kam er in den Ferien nach Hause, wurde er von Beate mit jubelnder Freude begrüßt. Sie hing sehr an dem älteren geduldigen Freunde und lernte unter seiner Leitung weiter, das in Privatstunden Gelernte wiederholend.
Und vor zwei Jahren, als er sie wiedersah, war er betroffen, zu welch lieblicher Mädchenblüte sich der halbwüchsige Backfisch während seiner Abwesenheit entwickelt hatte. Im ganzen Reiz ihrer holden Siebzehn stand Beate vor ihm: er konnte sich nicht satt sehen an ihrer jungen Schönheit. Und die Zuneigung, die er immer schon für das Kind gehabt, verstärkte sich bald zu einer tiefen, innigen Liebe.
Wenn er ihr auch nichts davon gesagt, so mußte sie es doch fühlen, ahnen; denn der gute Mensch konnte sich nicht verstellen; seine Blicke sprachen zu deutlich. Und am Tage seiner Abreise, als er sie im Garten wußte, suchte er sie dort auf, um Abschied zu nehmen.
Wie es dann gekommen, wußten beide selbst nicht — er hatte den Arm um sie gelegt, ihren zarten roten Mund geküßt und leise gesagt: »Liebe, süße Bea!« Weiter nichts. Sie hatte seine Liebkosung still hingenommen, und seit jener Zeit lebte die Liebe stark und mächtig in ihm und der Gedanke, sobald als möglich in die Lage zu kommen, der Geliebten eine sichere Existenz bieten zu können; vorher wollte er nicht sprechen; sie verstanden sich auch so.
Daß sie nun dennoch das Gymnasium besuchte, war durchaus nicht nach seinem Sinn. Er tröstete sich aber in dem Bewußtsein, daß das auch ein Ende haben würde. Darum wirkte heute doppelt schmerzlich die Eröffnung auf ihn, daß sie studieren wollte. Denn er hatte von einem andern Berufe für sie geträumt; von dem einer liebenden und geliebten Frau, die Sonnenschein und Behaglichkeit in seinem Heim verbreitete!
Hätte er sie nur erst allein gesprochen! Seine ganze Beredsamkeit wollte er aufbieten, sie von ihrem törichten, ungesunden Vorhaben abzubringen. Wenn sie ihn liebte, mußte sie ihm auch folgen. Er hatte sie zu sich herangebildet, mit seinen Idealen und Anschauungen ihr Herz erfüllt, und nun wollte sie andere Wege gehen, fern den seinigen, wo sie beide doch zusammengehörten!
Doktor Georg Scharfenberg hatte am andern Tag Beate Haßler ausgehen sehen. Eilig stürmte er ihr nach und hatte auch das Glück, sie einzuholen. Etwas außer Atem fragte er sie: »Tag, Bea! Wie gehts? Darf ich mich dir anschließen?«
Freundlich reichte sie ihm die Hand. »Wenn es dir Vergnügen macht, Schorschchen; ich habe für Muttchen einige Besorgungen zu machen.«
Glücklich schritt er neben dem geliebten Mädchen einher, das ihm unsagbar lieblich und anmutig erschien. Beate trug ein enganliegendes, dunkelblaues Kostüm, das die Vorzüge ihrer schlanken, gut gewachsenen Gestalt vorteilhaft zur Geltung brachte.
Ihr kluges, schmales Gesicht mit den etwas zarten, aber gesunden Farben wurde ungemein belebt durch die großen dunkelbraunen, fast schwarzen Augen, die im Verein mit den dunklen Wimpern und Brauen in wirkungsvollstem Gegensatz zu dem köstlichen aschblonden Haar standen. Ihr Mund war sehr schön geschnitten, etwas herb und streng im Ausdruck, wenn sie schwieg, aber reizend beim Lächeln.
Unbefangen plauderte sie von diesem und jenem, während er im stillen nach einem Anfang suchte, von dem zu reden, was ihm auf dem Herzen lag, jetzt aber noch klug vermeidend, das Gespräch auf den Gegenstand von gestern zu bringen.
Obwohl es noch ziemlich früh im April war, hatte der warme Sonnenschein der letzten Tage die Knospen wach geküßt, und wie ein zarter, grüner Schleier in helleren und dunkleren Abtönungen, so lag nun das junge Grün auf den Sträuchern.
»Heut’ ist’s doch köstlich-richtiges Osterwetter,« sagte Beate, »sieh nur, Schorschchen, wie reizend die gelben und lila Krokus dort auf dem Beet, und da die ersten Kastanienblätter — wie schüchtern sie aussehen! Ich freue mich immer so über das Auferstehen der Natur, und deshalb ist mir gerade Ostern das liebste von allen Festen!«
»Wie herrlich muß es jetzt im Pfaffenbusch sein,« bemerkte Georg, »ein Gedanke, Bea, — Du hast doch Zeit? Wollen wir mal hingehen? Weit ist’s ja nicht.«
Bereitwillig stimmte sie zu, und nicht lange danach befanden sie sich in dem Gehölz, das unmittelbar an die Stadt grenzend ein beliebter Spazierort war.
Heute traf man nur ganz vereinzelte Spaziergänger an, was Georg sehr recht war. Denn das, was er jetzt mit Beate zu reden hatte, konnte nur in der Stille geschehen.
»Wie schön, Schorsch,« sagte das junge Mädchen, tief Atem holend, »hier offenbart sich die Schöpferkraft der Natur so herrlich; im Walde halte ich meine Kirche, da bin ich immer so gläubig und fromm.«
»Und sonst nicht, Bea?« fragte er eindringlich.
»Wie du es vielleicht meinst, nicht, Georg! Es ist alles so von allein gekommen, und je mehr man nachdenkt, desto mehr bröckelt von dem alten Kinderglauben ab.«
»Beate, so sieht es in dir aus?«
»Ja, Schorschchen — und wundert dich das so sehr? Übrigens, wie du denkst, weiß ich ganz genau, auch wenn du mir gerade davon nie gesprochen hast.«
»Weil es kein Thema war, dies mit dir zu erörtern. Aber wer weiß, was du alles für Bücher gelesen hast, die gar nicht für dich geeignet sind, und naturgemäß verwirren sich —«
»Erlaube, Georg,« unterbrach sie ihn lebhaft, »erlaube, was ich mir zu lesen auserwähle, ist nie ungeeignet für mich! Und wenn du mich bei guter Laune erhalten willst, dann betrachte mich nicht immer noch als halbes Kind, dessen Meinung und Ansichten man gutmütig belächelt und nicht für voll ansieht,« eine leise Gereiztheit klang aus ihrer Stimme.
Begütigend faßte er ihre Hand und blieb stehen. »Nicht doch, Bea — das liegt mir ganz fern! — ich habe etwas ganz anderes auf dem Herzen.«
Er schwieg einen Augenblick, und erwartungsvoll sah sie ihn an. Sie wußte offenbar nicht, wo er hinaus wollte. Schwer atmend fuhr er da fort, ihre Hände an seine Brust führend: »Bea, du hast mir eigentlich noch gar nicht recht Willkommen gesagt, so wie man es sich nach dem Abschied sagt, den wir damals genommen haben.«
Ein lichtes Rot überflog ihre feinen Züge und sie suchte ihre Hände zu befreien; er ließ sie aber nicht. »Weißt du es nicht mehr, Bea? — In eurer Laube am Pfingsttag war es! — Sag’, Mädchen, hast du noch daran gedacht?« fragte er weich.
Statt aller Antwort hob sie die dunklen Augen zu ihm empor, und was er darin las, mochte ihn wohl dazu ermutigen, seinen Arm um die holde Gestalt zu legen und einen innigen Kuß auf ihren Mund zu drücken. »Mein Herzlieb,« flüsterte er in tiefer Bewegung, »hast du mich noch ein bißchen lieb?«
Sie schmiegte sich fester an ihn. »Ja, Schorsch, nicht bloß ein bißchen, sondern viel, viel mehr als du alter Schulmeister es eigentlich verdienst,« entgegnete sie innig.
Da beugte er sich nieder, und ihren Lippen wurde süßer Lohn zuteil für diese Antwort. Gern überließ sie sich seinen starken Armen, in denen es sich fest und sicher ruhte. »Du lieber Schorsch,« sagte sie leise und küßte ihn zart und innig wieder.
Sie liebte den treuen Freund ihrer Kindheit mit der tiefen Zuneigung, deren ihre Natur fähig war, und wenn auch bis jetzt noch kein Wort von Liebe gesagt war zwischen ihnen, so war es doch ein stillschweigendes Bewußtsein gewesen, daß sie beide zusammengehörten. Sie schritten langsam weiter durch den Wald, und doppelt reizvoll erschien ihnen jetzt das erste sprossende Grün, der lichtklare, blaue Himmel.
Georg hatte seinen Arm um die Geliebte gelegt und sprach ihr davon, wie er stets nur an sie gedacht, und wie er nun glücklich sei, ihr jetzt eine gesicherte Zukunft bieten zu können. Er hoffe, daß sie nächstes Jahr um diese Zeit schon seine kleine Frau sei.
Da blieb sie stehen. »Aber nein, Schorschchen, so bald nicht, das ist doch unmöglich.«
»Aber warum? Ich hab doch mein schönes Gehalt, dazu die Zinsen von meinem Kapital, freie Wohnung — da läßt es sich doch bei nicht allzu großen Ansprüchen ganz gut leben.«
»Ach, daran habe ich nicht gedacht! — Nein, Schorsch, erst muß ich doch meinen »Doktor« machen. Du vergißt wohl ganz, daß ich studieren will?«
»Aber Bea, das kann doch dein Ernst nicht mehr sein, jetzt, wo wir uns gefunden haben,« sagte er, unangenehm von ihrer Äußerung überrascht.
Sie löste sich aus seiner Umschlingung und blickte ihm ruhig und gerade in die Augen. — »Doch, es ist mein Ernst!«
»Aber Beate, das ist ja Unsinn! Dann liebst du mich nicht, wenn du daran noch denken kannst,« rief er ganz aufgeregt.
»Denkst du denn so ausschließlich an mich? Hast du denn nicht deinen Beruf, der deine ganzen Kräfte, dein ganzes Interesse in Anspruch nimmt?« fragte sie kühl. —
»Beate, sieh doch ein, daß das etwas anderes ist — ich bin doch ein Mann!«
Da lachte sie kurz auf. »Ja, natürlich, das ist etwas ganz anderes — ein Mann! Und ich als Weib muß mich fein demütig bescheiden, muß meine innersten Wünsche und Neigungen verleugnen, wenn es dem Mann nicht paßt. Aber das darfst du niemals verlangen — du weißt doch ganz genau, daß ich eine selbständige Natur bin.«
»Ja, das weiß ich, und ich will dich auch gar nicht anders haben! Nur lasse ab von der unglückseligen Idee, zu studieren! Ich bitte dich herzlich darum! Was hast du denn davon, du vertrauerst deine schönsten Jahre, die du ganz anders ausnützen könntest.«
»Bitte, Georg, darüber habe ich eine andere Ansicht, und von der lasse ich mich auf keinen Fall abbringen.«
Es war merkwürdig, wie kühl ihre Stimme klang und ihre Augen blickten; die Weichheit und Herzensgüte, die sonst daraus strahlte, war mit einemmale verschwunden. Sie schüttelte ein wenig den Kopf. »Wirklich, Georg, ich hätte dich für großgeistiger gehalten. Aber ihr Männer seid euch darin alle gleich.«
Er faßte ihre Hand. »Beate, hast du mich wirklich lieb?« fragte er eindringlich.
Noch einmal wollte er versuchen, sie umzustimmen. Er kannte gar wohl ihren harten Kopf, glaubte aber durch eine Berufung auf ihre Liebe schließlich doch den Sieg zu gewinnen. Sie mußte ja ein Einsehen haben.
Innig ruhten ihre klaren Augen auf ihm, als sie sagte: »Ja, Georg, ich hab dich lieb, und ich bin glücklich, daß du mich zu deiner Gefährtin erwählt hast. Ich denke es mir herrlich ein Leben an deiner Seite.«
Ein Freudenstrahl huschte über sein kluges Gesicht, und beglückt zog er sie an sich. »Meine geliebte Braut, mein guter Kamerad, du —«
»Ja, eben das will ich auch sein — im wahrsten Sinne des Worts!« unterbrach sie ihn. »Ich will dir in deinem Berufe ganz zur Seite sein — ich will dich bis ins kleinste verstehen, und deshalb, Georg, bitte ich dich, hindere mich nicht in meinem Vorhaben, ich bitte dich darum, um unser Glück!« Und süßflehend schaute sie ihn an.
Der Freudenschimmer auf seinen Zügen erlosch jäh, und eine tiefe Falte grub sich zwischen seine Augenbrauen. »Um unser Glück!« wiederholte er bitter. »Mein Glück verlangt es wirklich nicht, daß du als ausgebildete Ärztin und Kollegin an meiner Seite lebst, nein, ich will dich als meinen guten Kameraden, als mein geliebtes Weib, Bea, bei dem ich mich von den Anstrengungen meines Berufes ausruhen kann.«
Eine heiße Zärtlichkeit klang aus diesen letzten Worten, und heftig drückte er ihre Hand.
»Und als meine Haushälterin, vergißt du hinzuzusetzen, die da nachsieht, ob alle Knöpfe gut angenäht sind,« entgegnete sie ironisch. »Denn das gehört ja mit zu dem Bilde, wie du dir deine Ehe ausmalst. Aber dazu, Georg, habe ich durchaus kein Talent, das sage ich dir vorher!«
»Doch oft sichern angenähte Knöpfe das Glück einer Ehe mehr als die gelehrtesten, geistreichsten Gespräche es vermögen, wenn sonst der Haushalt vernachlässigt wird,« antwortete er mit grimmigem Humor. »Du bist auf einem ganz falschen Wege, Beate, wenn du so denkst! Und du hast wirklich nicht zu befürchten, daß ich dich auf das Niveau einer bloßen Haushälterin herabdrücken will, nein, Bea, gerade so wie du bist, will ich dich haben: mein schönes, kluges Weib, gegen das ich mich aussprechen kann, das mich versteht, auch ohne daß es gerade vom Doktortitel geschmückt wird, den du ja von mir bekommst.«
»Den aber aus eigener Kraft zu erreichen, der Traum meines Lebens ist! — Gib dir keine Mühe, Georg, was du auch vorbringen wirst, ich gebe nicht nach, zu tief ist der Plan mit meinem Innersten verwachsen.«
»Du denkst dir alles so ideal, komme aber erst in die Wirklichkeit und sieh, wie schwer es ist, Beate, Mädchen! Du hast ja keine Ahnung, was es zu überwinden gibt, wie die Anstrengungen dich aufreiben werden, dir deine Schönheit, deine köstliche Jugend und Frische nehmen — und dann all der Ekel und der Jammer!«
»So schlimm, wie du es schilderst, ist es ja doch nicht, Georg, du kannst mich nicht abschrecken, weil ich mir alles selbst schon gesagt habe. Und siehst du, mich jammern gerade die armen kranken Kinder so; denen möchte ich so gerne helfen! Wie oft hast du mir früher gesagt, daß das dein Wunsch ist, gerade Kinderarzt zu sein!«
»Ja, Beate, und an meiner Seite hättest du da die beste Gelegenheit, dich in dieser Vorliebe zu betätigen — als meine Frau in meiner Klinik.«
Doch eigensinnig schüttelte sie den Kopf. »Ich will, wie ich will, Georg! Bitte laß uns nicht weiter darüber sprechen und uns den schönen Tag verderben! Meine Absicht steht fest. Ich sehe nicht ein, warum sich mein Studium mit meiner Heirat nicht vertragen sollte! Die paar Jahre werden bald vergehen, ich bin jetzt zum Heiraten noch viel zu jung.«
Ein Zug ernster Entschiedenheit trat da in sein Gesicht. »Nun denn, Beate, wenn du meinen Bitten, meinen berechtigten Einwendungen und Gründen durchaus kein Gehör schenken willst, muß ich es dir entschieden verbieten.«
»Du mir verbieten? Und mit welchem Recht?« Sehr erstaunt klang diese Frage, und ebenso erstaunt sah sie ihn an.
»Mit dem Recht als dein Verlobter! Nimmer werde ich zugeben, daß du eine Universität besuchst. Du gehörst jetzt mir! Niemand kann zween Herren dienen!«
»Ah, ist es das, mein Freund?« gab sie kalt zurück. »Dann wisse, daß ich nicht gewillt bin, so über mich verfügen zu lassen. Ich tue, was mir beliebt, und du hast kein Recht, in solcher Weise bestimmend auf mich einzuwirken. Ich lasse mich nicht tyrannisieren! Und kurz: ich gehe nach Zürich.«
Er wurde bleich bis in die Lippen bei ihren mit großer Entschiedenheit gesprochenen Worten. »Beate, ist das dein letztes Wort?«
»Mein letztes!«
»Treibe es nicht bis zum äußersten! Denke an unsere Liebe, an unser Glück! Wollen wir uns das durch eine Laune zerstören lassen? Beate, sei doch vernünftig! Wenn ich nur eine Zweckmäßigkeit, eine Notwendigkeit deines Studiums einsehen könnte! Aber so! Beate! —« Seine Stimme bebte doch, und erwartungsvoll waren seine Augen auf ihr Gesicht gerichtet, eine Sinnesänderung darin zu lesen. Sie konnte doch nicht so starrköpfig sein, wo es sich um beider Lebensglück handelte.
Doch vergebens. Kein Zug in ihrem Antlitz veränderte sich. Es blieb kalt und unbeweglich. »Du kennst meinen Entschluß, er ist unwiderruflich!« sagte sie dann, und wie ein Eiseshauch wehte es ihn an aus ihren Worten.
Er sah, daß sie wirklich ihr letztes Wort gesprochen; fremd und kühl begegnete sie seinem bittenden Blick — da griff er nach seinem Hut. »Dann lebe wohl, Beate! Mögest du nie bereuen, so auf deinem Eigensinn beharrt zu haben.«
Ohne ihr die Hand zu geben, verneigte er sich und ging davon. In wenigen Augenblicken war er durch eine Wegbiegung ihren Blicken entschwunden.
War er das wirklich, ihr allzeit nachgiebiger Freund, der heute so starr war und nicht einen Schritt zurückwich, trotz ihrer Bitten?
Beate stand noch da, die Hand unwillkürlich auf ihr Herz gepreßt, in dem es einen so wunderlichen Stich gab, als die hohe Gestalt des Jugendfreundes ihren Blicken entschwand. Und stieg es da nicht wie warme Tropfen in ihren Augen auf? Ach Unsinn! Und ärgerlich über sich selbst schüttelte sie den Kopf.
Sie konnte doch froh sein, daß sich die Sache noch so gewendet, nachdem sie gesehen, daß Georg ebenso egoistisch und kleinlich denkend wie andere Männer war. Und wie hatte sie es sich schön gedacht, als sein Weib tatkräftig und verstehend an seiner Seite zu schaffen!
Da hieß es denn auf diesen Traum verzichten und von jetzt an für sich allein bleiben — in angestrengter Arbeit Ersatz für das Aufgegebene zu suchen!
Vielleicht war es auch besser so; denn er hatte ja selbst gesagt: »niemand kann zween Herren dienen«, — entweder also die Wissenschaft oder die Liebe, und da es nur eins sein konnte, wählte sie eben die Wissenschaft, die ihr nun alles geben mußte!
Aber ein häßlicher Schatten war doch über ihre Osterfreude gefallen, und traurig und gedankenvoll schritt sie dem Heimweg zu.
Es war erreicht!
»Fräulein Dr. med. Beate Haßler«, hieß es seit mehr als einem Jahr!
Die Studienzeit war vorüber. Die Examina hatte Beate glänzend bestanden, und mit Stolz konnte sie auf ihre Erfolge blicken. Ein Jahr hatte sie schon praktisch in einem großen Krankenhause gearbeitet, und man rühmte ihr große Sicherheit und Tüchtigkeit nach. Mit vieler Liebe hingen die kranken Kleinen auf der Kinderstation an ihr, und großer Jubel herrschte unter ihnen, wenn die »gute Tante« kam — jedes wollte von ihr genommen und gepflegt sein.
Und es war wirklich wunderbar, wie das ernste Gesicht der jungen Ärztin sich aufhellte, wenn sie mit den Kleinen scherzte und ihnen gut zuredete. Welch weiche, linde Töne da ihre klare Stimme fand, welch’ Leuchten in ihre Augen trat — sie hatte dann wirklich etwas Unwiderstehliches an sich.
»Wissen Sie, Fräulein Doktor, was ich Ihnen wünschte?« sagte eines Tages Schwester Therese zu ihr, als beide damit beschäftigt waren, bei einem reizenden zweijährigen Kinde, das sich arg verbrüht hatte, den Verband zu erneuern.
»Nun, da bin ich wirklich neugierig,« lächelte Beate in ihrer gewinnenden Weise, um dann gleich darnach das Kind zu beruhigen, das anfing zu weinen.
»Ich wünschte Ihnen, daß Sie selbst solch herziges Wesen Ihr Eigen nennten! Sie hätten heiraten müssen, Fräulein Doktor,« meinte die Schwester warm, indem sie einen bewundernden Blick auf das schöne Mädchen richtete, das bei diesen Worten tief errötete. »Wer so mit Kindern umzugehen versteht ...«
»Sie können das wohl nicht, Schwester?« entgegnete Beate. »Schließlich liegt doch in jedem weiblichen Wesen das Muttergefühl, und mein Beruf gibt mir genug Gelegenheit, ihm nachzugeben! Das ist doch nichts besonderes an mir!«
»Ja, wenn auch, Fräulein Doktor, aber gerade Sie — —«
Schwester Therese hielt es jetzt doch für geratener, nicht weiter zu sprechen; denn sie sah, wie Beates Gesicht einen abweisenden Zug angenommen hatte; vielleicht rührte man da unbewußt an eine wunde Stelle. Und sie hatte mit dieser Annahme wohl nicht ganz unrecht. Beate hatte den teueren Jugendfreund nicht vergessen können. Noch immer glaubte sie seine mit so schmerzlichem Ausdruck auf sie gerichteten Augen zu sehen, wie er damals von ihr ging, als sie das nachgebende Wort, das er so sehnlich erwartete, nicht gesprochen!
Dann hatte er dennoch noch einmal geschrieben, warm und eindringlich, aber sie hatte auf ihrem Willen beharrt, und von der Zeit an hatte er vermieden, je wieder mit ihr zusammenzutreffen; sie sahen sich nicht mehr.
Desto mehr hörte aber Beate von ihm, er war die rechte Hand von Professor Brause in S., der ihm das Zeugnis eines äußerst geschickten, tüchtigen Chirurgen ausstellte. Alles das erzählten ihr die Eltern, und mit Herzklopfen lauschte sie darauf. Aber was hätte es für Zweck gehabt, sich in unnütze Träumereien zu verlieren?
Mit um so größerem Eifer stürzte sie sich in ihre Arbeit, und mit der ihr eigenen Energie und Geschicklichkeit überwand sie alle Schwierigkeiten. Wie oft mußte sie an Georgs Worte denken, als er ihr das Studium so schwer geschildert — wie manchmal drohte der Ekel sie zu überwältigen — aber sie biß die Zähne zusammen — und es ging!
Mit stolzer Freude stand sie dann am Ziel ihrer Wünsche, und ein Hochgefühl erfüllte ihre Brust; sie hatte ihm beweisen können, ihm und den anderen, daß es für sie nichts Unerreichbares gab.
Nun war sie schon sechsundzwanzig Jahre und eine Erscheinung, die nicht zu übersehen war. Wohl war die erste Jugendblüte entschwunden; aber die intensive Geistesarbeit und ihr reiches Innenleben hatten ihrem Antlitz seine Spuren aufgedrückt; hohe Intelligenz und Klugheit, gepaart mit echt weiblicher Herzensgüte, leuchteten nur so daraus hervor, daß man dem Zauber ihrer Persönlichkeit sich nicht zu entziehen vermochte. Ihre Gestalt war sehr elegant, von schlanker Fülle, und Beate verstand auch, sich anzuziehen. Stets war ihre Kleidung geschmackvoll, wenn auch einfach und unauffällig.
Gegen ihre männlichen Kollegen war sie von einer liebenswürdigen Zurückhaltung. Manch einer hätte die schöne Beate gern sein Weib genannt — doch ein gewisses Etwas in ihrem Wesen hielt jeden davon ab, ihr auch privatim näher zu treten, sie war und blieb unnahbar.
In ihrem Beruf war sie unermüdlich fleißig und tätig, schließlich aber doch ihre Kräfte überschätzend, bis die versagten. Sie hatte sich keine Ruhe gegönnt; stets auf ihre eiserne Natur pochend, hatte sie sie zu ihrem Willen gezwungen, bis es eben nicht mehr ging. Ohnmächtig brach sie an einem Krankenbett zusammen. Ein heftiges typhöses Fieber warf sie darnieder.
Nachdem sie viele Wochen gelegen und auf das sorgsamste gepflegt worden war, ging sie zur gänzlichen Erholung auf einige Zeit nach Hause, zu den Eltern, die ihren Liebling mit großer Freude begrüßten und im stillen hofften, daß Beate endgültig bei ihnen bleiben würde.
Aber daran schien sie doch nicht zu denken, denn mit großer Liebe und vielem Interesse sprach sie von ihrem Beruf, die Zeit herbeisehnend, ihn wieder ausüben zu können. —
Es traf sich gut, daß sie noch zu Hause war, als nach dem Manöver ihr Bruder Adolf in Begleitung eines Freundes für zehn Tage auf Urlaub kam. Mehr als zwei Jahre hatte sie ihn nicht gesehen. Beate war zu Hause geblieben, nach dem Rechten zu sehen, auf diese Weise der Mutter die Freude ermöglichend, den Sohn mit von der Bahn abzuholen. Sie hatte den Tisch hergerichtet, ihm mit frischen Blumen ein festliches Aussehen gegeben und war nun mit allen Vorbereitungen fertig.
Wunderbarerweise hatte sie der Aufenthalt im Elternhause gelehrt, an kleinen wirtschaftlichen Anordnungen und Handreichungen Freude zu empfinden. — Die Hausklingel ertönte, ein Zeichen, daß man von der Bahn zurückkehrte. — Schnell begab sich Beate hinaus, den Ankommenden entgegenzugehen.
Mit aller Lebhaftigkeit, die ihm eigen war, begrüßte Adolf die Schwester. Er schloß sie in die Arme und küßte sie herzlich auf beide Wangen. »Mädel, Bea, ich freue mich kolossal, dich wiederzusehen, und in deiner Würde als »Fräulein Doktor!«« —
»Ja, ja, Rolf,« wandte er sich an seinen Freund, »nun komm’ erst mal her und lasse dich bekannt machen mit meiner gelehrten Schwester.«
Der schlanke, schöne Offizier verneigte sich tief. »Adolf hat mir so viel von Ihnen erzählt, daß ich schon längst begierig darnach war, Sie kennen zu lernen, gnädiges Fräulein.«
Ein helles Auflachen Adolfs unterbrach ihn. »Gnädiges Fräulein,« parodierte er, »mein Freund, das ist wohl nicht die rechte Anrede für so ein gelehrtes Haus.«
»Aber, so lasse doch, Adolf,« mahnte Beate, »ich bitte dich.«
Rolf von Hagendorf war rot geworden. »Pardon, Fräulein Doktor, ich war — ich hatte —,« stotterte er.
Freundlich gab sie ihm die Hand.
»Hören Sie nicht auf Adolf! Wie ich sehe, ist er noch immer der alte geblieben, dem es Spaß macht, seine Mitmenschen zu necken.«
»Na, Mutting, nun dürfen wir uns wohl erst den Reisestaub abschütteln, und dann gibts sicher etwas zu essen, ich muß gestehen, ich habe einen Mordshunger. Rolf übrigens auch! Und bei dir duftet es schon so verführerisch, so nach Rebhühnern mit Sektkraut; Fränze, das alte Faktotum, wird schon ihr möglichstes getan haben, wenn so hoher Besuch kommt!«
»Jawohl, Herr Oberleutnant.«
Die alte Köchin war soeben aus der Küche gekommen, den Sohn des Hauses zu begrüßen, und sie hatte die letzten Worte gehört. Sie wischte sich die Hände erst noch einmal an der Schürze ab, ehe sie ihre Rechte etwas zaghaft in die Hand Adolfs legte, der sie dann freundschaftlich auf die Schulter klopfte.
»Nicht wahr, Fränze, wir zwei beide, wir verstehen uns, was?«
»Na, und ob, Herr Ad..., Herr Oberleutnant« — sie strahlte über das ganze gute Gesicht! Er war doch immer noch derselbe geblieben, stets lustig und guter Dinge. Wie oft hatte sie ihn vor dem elterlichen Zorn und vor Strafe in Schutz genommen, wenn er als Junge Zuflucht bei ihr gesucht, und wie eine Henne ihre Küken schützt, so hatte sie ihn gegen den väterlichen Rohrstock verteidigt. Beate war ihr fremder geblieben; sie konnte es ihr nicht verzeihen, daß sie nicht heiraten wollte, besonders wo sie, Fränze, es doch für eine ausgemachte Sache gehalten, daß Beate und Scharfenbergs Georg mal ein Paar würden!
Kaum eine Viertelstunde später befand man sich bei Tisch. Die Herren ließen es sich gut schmecken; sie taten dem wirklich vorzüglichen Essen alle Ehre an. Mit einigen sehr warmen Worten dankte Rolf von Hagendorf den Eltern seines Freundes nochmals herzlich, daß sie ihm Gastfreundschaft gewähren wollten; es tue ihm so unendlich wohl, einmal wieder in Familie zu sein und wahres Familienleben zu genießen, was er eigentlich gar nicht kenne, da er als kleiner Junge schon ins Kadettenhaus gekommen sei und dort auch meistens die Ferien verbringen mußte!
Behaglich fühlte sich Rolf gleich in der ersten Stunde bei Rechtsanwalt Haßlers; ein Gefühl des Fremdseins war gar nicht in ihm aufgekommen. Das wäre auch wunderbar gewesen; denn niemand konnte es seinen Gästen traulicher machen, als Frau Haßler durch ihre liebe, gütige, mütterliche Art.
Noch lange saß man in anregendem Gespräch bei Tisch, und im stillen bewunderte Rolf von Hagendorf die Schwester seines Freundes. Nach dessen Erzählungen hatte er sich unter Beate eine emanzipierte, auf ihr Wissen eingebildete Person vorgestellt und war nun aufs höchste überrascht, eine junge Dame von auffallender, ja rassiger Schönheit vor sich zu haben. Es gewährte ihm einen eigenen Reiz, sie zu beobachten. Sie schien das zu fühlen; mehr als einmal hob sie wie magnetisch angezogen den Blick, und jedesmal begegnete sie Rolfs kecken, grauen Augen, die in so deutlicher Bewunderung auf ihr ruhten.
Sie wurde ärgerlich darüber; seine Art verletzte sie fast, sie war doch nicht gewöhnt, so lediglich als Weib angesehen zu werden. Aber sie konnte sich nicht verhehlen, daß der junge Offizier durch seine persönlichen Vorzüge wohl imstande war, auf junge unbehütete Herzen eine große Macht auszuüben. Er hatte etwas Hinreißendes, Zwingendes an sich; lag es im Lächeln seines Mundes, im Blick seiner heißen Augen, der ihr sagte: du entgehst mir nicht, wenn ich nur will; sie wußte es nicht! —
»— Ihr habt doch gewiß auch gehört,« bemerkte da Adolf, »daß Georg Scharfenberg so gut wie verlobt ist —«
»Nein, keine Ahnung davon, du mußt dich irren, Adi,« entgegnete Frau Haßler aufs höchste erstaunt — »nein — sonst müßten wir es doch wissen.«
»Ja, eben —«
Beate war um einen Schein blasser geworden, und sie preßte die Lippen fester zusammen, daß ihr kein unbedachter Ausruf entfuhr.
»Doch, Mutterle, ich hörte es für ganz bestimmt sagen. Ich wollte ihn immer schon selbst fragen, traf ihn aber nicht — hab ihn überhaupt lange nicht gesehen!«
»Ihr kommt wohl nicht mehr zusammen?« fragte Beate.
»Selten nur noch! Denn es sind doch so ganz andere Interessen und Kreise, die jeder von uns hat — er ist ein kolossaler Streber geworden.«
»Was du nicht sagst! — Das glaube ich aber doch nicht,« meinte Papa Haßler, »er war stets fleißig, woran sich andere ein leuchtend Beispiel nehmen könnten.«
»Ja, ei ja — das weiß ich längst.« Lachend hielt Adolf sich die Ohren zu. »Ich wundere mich überhaupt selbst, daß ich es noch so weit gebracht habe! Da hätte mir Beate von ihrem unheimlichen Wissen gern abgeben können. Ihr hätte es nicht geschadet und mir ungeheuer genützt. Weißt du, Mädel,« und lustig zwinkerte er mit den Augen, »weißt du, ich hatte immer gedacht, daß aus dir und Schorsch mal ein Paar werden würde. Ihr waret ja unzertrennlich, ihr beide — die reinen Inseparables.«
Interessiert blickte da Rolf Hagendorf auf Beate; er sah das Zucken in ihrem Gesicht und das gezwungene Lächeln, mit dem sie antwortete: »Adi, deine Kombinationsgabe war immer sehr schwach! Denke daran, daß sie dir einmal zwei Stunden Karzer eingebracht hatte! Und die »vier« in Mathematik vergißt du wohl ganz? Sehr kühn und großartig waren deine Voraussetzungen stets, beruhten aber auf falscher Grundlage, wie in diesem Falle! Was sollte Schorsch wohl mit einer gelehrten Frau anfangen?«
»Wer ist denn seine Auserwählte?« unterbrach Frau Haßler das Wortgeplänkel der Kinder — »das wirst du doch sicher wissen?«
»Ich hörte die Tochter von Professor Brause, in dessen Familie er ja so ganz heimisch ist.«
»Ist sie hübsch?« fuhr es Beate heraus, die aber sofort über diese echt weibliche Frage errötete, besonders, als der Bruder sie lächelnd fixierte und dann sagte: »Hm, so hübsch wie du, Bea, freilich nicht, dir kann überhaupt keiner ...«
»Ach, laß doch die dummen Scherze,« wehrte sie ärgerlich ab, »ich bin doch kein Backfisch mehr, auf den so etwas Eindruck macht, hauptsächlich, wenn es ein Leutnant sagt.«
»Danke, Schwesterlein! Also, Marianne Brause ist ein sehr hübsches und gescheites Mädel, das muß ihr der Neid lassen, nicht wahr, Rolf?«
Der Angeredete nickte zustimmend, während sein Blick beständig Beates Auge suchte: er las in dem stolzen Gesicht etwas, das ihm zu denken gab. War es Schmerz und Kränkung über verschmähte Liebe? Denn Doktor Scharfenbergs Verlobung ging ihr bestimmt näher, als alle anderen ahnen mochten, als sie sich selbst eingestehen wollte! Rolf Hagendorf war ein erfahrener Frauenkenner, der auch in den sprödesten, verschlossensten Herzen lesen konnte.
»Das ist aber unrecht von Georgs Mutter, daß sie mir das verheimlicht hat,« ereiferte sich Frau Haßler.
»Nicht doch, Mutterle, sie weiß vielleicht gar nichts darüber. Erst kurz vor meiner Abreise hörte ich davon sprechen — allerdings mit großer Bestimmtheit. Und so dumm wäre das gar nicht von Schorschchen — er käme da in ein gemachtes Bett! Professor Brause ist ein schwerreicher Mann, Marianne das einzige Kind, man bezeichnet ihn jetzt schon als die rechte Hand des Professors, der ihn ungemein schätzt und hochhält, wäre ihm das schließlich so zu verdenken?«
»Nein, durchaus nicht,« sagte Beate mit seltsam tonloser Stimme und trank hastig ihr Glas leer.
Ihre Hand zitterte, als sie es auf den Tisch stellte, und einen Moment schloß sie die Augen. Als sie die Wimpern wieder hob, blickte sie gerade in Rolfs forschende Augen, und sie hatte das Bewußtsein: er ahnt, was in dir vorgeht! O, nur das nicht! Gerade er durfte nicht wissen, wie unglücklich sie sich in diesem Augenblick fühlte — daß sie verschmäht wurde, da, wo sie doch noch im stillen liebte und hoffte!
Sie zwang sich zur Heiterkeit und ging lachend auf die Scherze des Bruders ein. Aber die Wangen brannten ihr vor innerer Aufregung, und sie sehnte die Stunde herbei, in der sie endlich allein in ihrem Zimmer war.
Dort saß sie dann mit gefalteten Händen auf dem Rande ihres Bettes und starrte vor sich hin. An ihrem Schmerz fühlte sie, wie sehr sie Georg noch liebte, wie tief in ihrem Innersten der Gedanke an ihn gelebt, wie sie gehofft, ihn durch ihre Erfolge doch noch zu überzeugen, daß er ihr unrecht getan mit seiner Forderung, auf das Studium zu verzichten; jetzt wäre sie gerne sein Weib geworden und hätte Hand in Hand mit ihm gearbeitet; welch köstlich Leben wäre das geworden, und nun nahm er eine andere!
Brennende Tränen traten in ihre Augen, und in Grübeln und Sorgen verbrachte sie die Nacht.
Acht Tage waren vergangen, in denen Adolf Haßler und sein Freund das Haus mit frischem, fröhlichem Leben erfüllt hatten. Immer gab es etwas anderes; die beiden hielten alle in Atem, und wider Willen fast wurde Beate mit fortgerissen. Sie machte Ausflüge mit ihnen und lachte und scherzte wie wohl nie zuvor in ihrem Leben. Sie mußte sich ja beherrschen und durfte nicht ahnen lassen, was in ihr vorgegangen war; denn sie fühlte, wie Rolf von Hagendorf sie beständig beobachtete. Er war der ritterlichste, aufmerksamste Gesellschafter, den sie sich denken konnte, und in der zartesten Weise brachte er ihr seine Huldigungen dar.
Beate beherrschte seine Sinne vollständig — ihre eigenartige Schönheit hatte ihn gefangen genommen. Und wiederum war er sich seiner Macht über die Frauen vollkommen bewußt, und hier in diesem Falle nutzte er sie weidlich aus. Er wollte für sich in Beate ein wärmeres Gefühl erwecken; sie interessierte ihn, wie nie ein Weib zuvor, und es dünkte ihn süß, von diesen spröden, stolzen Lippen Tribut zu nehmen. Mit Freuden sah er, wie Beate manchmal unter seinem Blick und Händedruck errötete. Er deutete das zu seinen Gunsten; wie in einen weichen Schleier hüllte er sie mit seiner Verehrung ein!
Da hatte Rolf das Unglück, sich eine Hand zu verstauchen; er war in dem spiegelblank gebohnten Treppenhaus ausgeglitten und gefallen. Adolf betrachtete diesen kleinen Unfall von der besseren Seite.
»Du Glücklicher!« meinte er, »nimmst einfach noch einige Tage Urlaub! Den Arzt haben wir ja auch gleich im Hause! Nun zeig mal, Mädel, was du kannst, ob das teuere Lehrgeld nicht vergebens bezahlt ist?!« lachte er die Schwester neckend an, die mit weicher, geschickter Hand die verletzte Rechte des jungen Offiziers verband.
Erleichtert aufseufzend ließ sich Rolf in den bequemen Stuhl fallen, den ihm Adolf gebracht hatte. »Mensch, du hast ein unverschämtes Glück — na ja, wie immer,« meinte er gemütlich, indem er dem Freunde eine Zigarette in Brand setzte, »ich muß übermorgen abdampfen, und du kannst hier bei den Fleischtöpfen Ägyptens bleiben.«
Rolf widersprach; er könne doch der verehrten Familie nicht noch länger zu Last fallen, aber da kam er bei Mama Haßler schön an. Er solle sofort schweigen, wenn er sie nicht ernstlich erzürnen wolle. Zuerst müsse er gesund werden, dann dürfe er ans Reisen denken. Er fügte sich schließlich, im Herzen wohl zufrieden. Das Verwöhntwerden tat ihm so gut! Den ganzen Tag fast waren die Familienmitglieder um ihn besorgt, und die alte Fränze konnte sich nicht genugtun, ihm die feinsten Leckerbissen zurechtzumachen. Denn in wortreichem Jammer gab sie sich selbst die Schuld an dem Unfall des Herrn Leutnants; sie hätte auch mit dem Bohnern noch einige Tage warten können.
Der letzte Tag von Adolfs Urlaub war da; morgen in aller Frühe hieß es abrücken. Rolf hatte einige Tage Nachurlaub erhalten. Behaglich lag er heute zur Mittagsruhe schon ausgestreckt, als Adolf nach ihm sah. »Na, Rölfchen, bleibst du hier, oder willst du mit ’rauf kommen? Nein? Glaub’ ich dir auch! Die alte Dame hat ja schönstens für dich gesorgt. Dann kann ich beruhigt gehen und ebenfalls eine Stunde pennen,« er gähnte und streckte sich, »na, schlaf schön, alter Junge.«
Der junge Offizier war allein. Er lag in der Veranda, die an das Eßzimmer stieß. Die Tür zum Garten stand weit offen; denn es war ein wundervoller Tag, und die Sonne lachte fast sommerlich warm vom blauen Himmel. So still war es um ihn her; auch Adolfs Eltern hatten sich zurückgezogen, und Beate, die Einzige, war ebenfalls nicht zu sehen.
Wie ihn nach dem Mädchen verlangte! Er schloß die Augen und dachte an sie; zum greifen deutlich stand sie in ihrer lebensvollen Schönheit vor ihm. Noch nie hatte ein so interessantes Geschöpf seinen Lebensweg gekreuzt; die Frauen, die er kannte, waren alle anderer Art.
Gerade die Unnahbarkeit, die über Beate lag, reizte ihn. Er wollte ergründen, was ihre schöne Hülle barg, ob nicht auf dem Grunde ihrer Seele etwas Geheimnisvolles schlummerte, wovon ihre Augen ihm so viel verrieten, diese wunderschönen dunklen Augen! Die laue Luft hatte ihn doch müde gemacht und eingeschläfert.
Wie lange er geschlafen, wußte er nicht; er erwachte durch das Geräusch von Schritten auf dem Kies des Gartens. Unwillkürlich richtete er sich etwas auf, und da sah er Beate, wie sie von einem Rosenstock einige Blüten abschnitt. Er beobachtete sie, und mit Entzücken ruhten seine Augen auf dem angebeteten Mädchen. Als sie weitergehen wollte, sprang er hastig auf und rief sie — »Fräulein Doktor.«
Sie wandte sich um; als sie ihn in der Verandentür stehen sah, ging sie bis zu deren Stufen. »Warum schlafen Sie nicht, Herr von Hagendorf?« Ein leiser Vorwurf klang aus ihrer Stimme.
»Ich kann nicht.«
»Und warum nicht? Haben Sie Schmerzen?«
»Ja, die Hand tut mir doch recht weh.« Ein verstecktes Lächeln lag da in seinen Mundwinkeln; aber er hatte erreicht, was er gewünscht: Beate kam herauf und untersuchte den Verband seiner Hand.
»Ich begreife aber nicht, Herr von Hagendorf, es ist doch alles in Ordnung, nun, und die Schmerzen sind doch für einen Soldaten zu ertragen!« Sie schüttelte leicht den Kopf.
Er seufzte. »Ja, wenn man so allein sitzt, Fräulein Doktor, da bildet man sich mancherlei ein — ich bin ein komischer Kauz — ich mag nicht gern allein sein.«
»Ah, Adolf schläft wohl? Ich glaubte, er würde Ihnen Gesellschaft leisten.«
»Nein, so weit geht seine Freundschaft doch nicht, die geliebte Mittagsruhe zu opfern, und wie ich ihn kenne, pflegt er sie so lange wie möglich auszudehnen, aber Sie, Fräulein Beate, haben Sie denn nicht geruht?«
»Nein, ich habe etwas gelesen und wollte nun hier im Garten den schönen Tag genießen! Sicher sind uns in diesem Jahre nicht mehr viele so schöne Tage beschieden.«
»Da hab’ ich Sie nun in Ihrem Vorhaben gestört — ah, und die schönen Rosen, köstlich.«
»Mögen Sie sie?« Schnell tat Beate die Blumen in eine Vase, die sie auf das Tischchen neben dem Liegestuhl Rolfs stellte. »So, Herr von Hagendorf, nun sollen Sie auch noch Freude an den Rosen haben! Und jetzt ruhen Sie noch ein wenig; ich verordne es Ihnen! Sie wissen, seinem Arzt muß man stets gehorchen.« Eine reizende Schelmerei klang aus ihren letzten Worten.
»Ja, ich will es tun, wenn Sie mir eine Weile Gesellschaft leisten, Fräulein Beate, ich bitte Sie.«
Sie errötete ein wenig; dann — mit einem schnellen Entschluß — zog sie einen Stuhl zu sich heran. »Gern, Herr von Hagendorf. Sie sollten aber eigentlich schlafen.«
Er nahm seinen früheren Platz wieder ein. »Schlafen? Nein, Fräulein Beate! Ich bin glücklich, wenn Sie mir armen Sterblichen die Gunst Ihrer Anwesenheit schenken.«
Lachend nahm sie neben ihm Platz. Bequem lehnte sie sich in den weiten Korbsessel zurück, die Arme auf dessen Lehne legend. »Aber Herr von Hagendorf, wenn Sie unsere Unterhaltung so beginnen, vertreiben Sie mich in der nächsten Minute wieder! Sie dürfen nicht so billige Phrasen machen.«
»Verzeihung, ich vergaß —« er lächelte, was ihm einen hinreißenden Ausdruck verlieh, »ich vergaß, daß Sie, Fräulein Beate, mit einem anderen Maßstab — nein, nein, Sie brauchen mich nicht so strafend anzusehen; ich schweige schon, aber doch das denkend, was ich nicht sagen darf!«
Er machte eine kleine Pause, während er sie lächelnd ansah. Unbefangen hielt sie seinem Blicke stand, und er fuhr fort: »Nicht wahr, ich bin gehorsam, Fräulein Beate? — Wie war ich im Anfang um eine Anrede verlegen! »Gnädiges Fräulein« ist für Sie viel zu banal, und »Fräulein Doktor« geht mir bei so viel Schönheit und Anmut doch nicht so recht über die Lippen, und so nenne ich Sie einfach bei Ihrem Vornamen, ich darf doch? Er ist so schön, so eigenartig, ich spreche ihn gern aus. Beate, meine Seligkeit — das hab’ ich aus dem Lateinischen noch behalten — oder ist’s doch nicht ganz richtig?«
Sie errötete leicht. Er hatte eine Art an sich, die sie manchmal verwirrte.
So hatte Georg Scharfenberg nie zu ihr gesprochen. Immer hatte er sie schulmeistern, bevormunden wollen, ihre Persönlichkeit unterdrücken, und hier offenbarte sich ihr eine fast schrankenlose Bewunderung. Sie war doch so viel Weib, um das angenehm zu empfinden; es umschmeichelte sie, und vielleicht war es nicht ganz ohne Reiz für sie, ihre Macht zu erproben.
Mehr als einmal hatte sie, besonders jetzt, daran denken müssen, wie Georg Scharfenberg ihr gesagt, ihre Schönheit ginge in ihrem anstrengenden Beruf verloren. Es mußte aber doch wohl nicht so gewesen sein; denn mit dem feinen Instinkt der Frau fühlte sie, daß sie dem jungen Offizier gefiel, ja, daß sie ihm nicht gleichgültig war. Seine Augen führten eine zu beredte Sprache, die sie gar wohl verstand, und sie konnte sich auch nicht ganz dem Reiz entziehen, der von diesem ungewöhnlichen Beisammensein ausging; die Mittagsstunde umspann sie unmerklich mit ihrem Zauber.
»Darf ich Sie etwas fragen, Fräulein Beate?« unterbrach er die Stille mit seiner schmeichelnden weichen Stimme, indem er sich zu ihr neigte, »aber nicht böse sein; wenn ich vielleicht ein wenig neugierig bin; ich habe so viel über Sie nachgedacht: weshalb haben Sie eigentlich nicht geheiratet? Denn bei Ihren Vorzügen müssen Sie doch sicher der Frage näher gestanden haben.«
»Sehr einfach, Herr von Hagendorf, weil ich nicht wollte, weil mein Beruf mir volle Befriedigung gibt«, sagte sie lächelnd, frei seinem forschenden Blick begegnend, wenngleich ihr bei dieser unvermuteten Frage doch das Herz etwas klopfte — sie mußte an Georg denken!
»Wirklich?« —
»Ja, weshalb zweifeln Sie daran? Es war doch mein freier Wille, Ärztin zu werden; mich hat niemand dazu gezwungen. Im Gegenteil, nach vielen Kämpfen erst habe ich es durchgesetzt. Doch Sie wissen ja alles, und warum Längstgesagtes wiederholen? Ich werde nicht gern an jene Zeit erinnert.«
»Und doch ist es schade,« sagte er leise.
»Wieso? ich verstehe Sie nicht.«
»Nun, — es ist schade, daß so viel Schönheit und Anmut, wie Sie besitzen, Fräulein Beate, in Ihrem anstrengenden Berufe vergehen sollen, wie sehr würden Sie einen Mann damit beglücken können, der in Ihnen sein Höchstes sieht, sein alles.« Heiß kam das von seinem Mund, und leidenschaftlich ruhten seine Augen auf ihr.
Ihre Brust hob sich in schnellen Atemzügen, und die Farbe kam und ging auf ihrem Antlitz. Er verwirrte sie mit seinen heißen, werbenden Worten, so daß sie nicht wußte, was entgegnen. Sie senkte die Augen vor seinen verzehrenden Blicken. Da griff er nach ihrer Hand: »Beate!«
»Nicht doch, Herr von Hagendorf, nein.« Hastig sprang sie auf, dunkelrot im Gesicht, und er erhob sich ebenfalls.
Er trat dicht hinter sie und flüsterte ihr ins Ohr: »Beate, süßes, angebetetes Weib, ahnen Sie denn nicht, wie es in mir aussieht, wie Sie meine Gedanken so ausschließlich beherrschen, daß nichts anderes mehr Raum in ihnen hat?« Dabei legte er seinen Arm um ihre schlanke Hüfte, zog sie unwiderstehlich an sich und suchte ihren Mund in heißem Kusse.
Sie war wie betäubt. Halb hingebend, halb widerstrebend duldete sie seine Liebkosung. »Nun bist du mein,« frohlockte er und preßte sie von neuem an sich.
Da kam sie zur Besinnung. Sie suchte sich aus seiner Umschlingung zu befreien; er ließ sie nicht; und da sah sie zu ihrem größten Schrecken den Bruder in der Tür stehen. Der hatte die Arme in die Seiten gestemmt und blickte aufs höchste überrascht von einem zum andern. Da überkam sie eine große Trostlosigkeit, und matt ließ sie die zum Widerstand erhobenen Hände wieder sinken.
»Na, Kinder, hört mal!« rief Adolf, nachdem er sich von der ersten Überraschung erholt. »Na, das ist — mir fehlen einfach die Worte, ich bin baff!«
»Du hast doch längst gewußt, alter Junge, wie sehr ich deine Schwester verehre,« sagte Rolf warm.
»Natürlich! Aber daß Beate — im Ernst, das hätte ich nicht geglaubt! Wieder mal ein Beweis, daß du wirklich Hans im Glück bist!«
»Deshalb, lieber Adi, wirst du uns hoffentlich deinen Glückwunsch nicht versagen?«
»Nee, Kinder, meinen Segen habt ihr.« Halb gerührt, halb lachend umarmte er die beiden. »Wenn du aber jetzt denkst, daß ich um die Verlobungsbowle kommen soll, bist du sehr im Irrtum, ich telegraphiere. Einen Tag gebe ich zu, den darf mir der Alte nicht vorenthalten, umsomehr, da es meine Familie ist, aus der ihm der Zuwachs ins Regiment kommt. Und was für einer! Fast könnte ich dich beneiden, wenn es nicht meine Schwester wäre! Nun aber schnell ein paar Flaschen Sekt aufs Eis, das frohe Ereignis zu begießen! Was werden die alten Herrschaften sagen! Entschuldigt, wenn ich euch noch einige Minuten allein lassen muß.« Er zwinkerte mit den Augen, ehe er davon eilte, die beiden in drückendem Schweigen zurücklassend.
Beate stand da, leichenblaß im Gesicht, und zwei große Tränen tropften langsam aus ihren Augen. Ihr Anblick rührte ihn; er trat auf sie zu und faßte ihre Hand. »Beate, können Sie mir verzeihen?« fragte er leise. Sie zuckte unter seiner Berührung zusammen und wandte sich ab.
Er wußte wohl, daß er sie mit seiner stürmischen Werbung überrumpelt hatte, und daß sie bei ruhiger Überlegung nicht so schnell oder vielleicht gar nicht die Seine geworden wäre.
Dieses Bewußtsein gab ihm etwas Niederdrückendes, Unfreies und verdarb ihm die Freude, daß Beate jetzt ihm gehörte. »Beate, ich kann ja selbst nichts dafür; eigentlich bin ich ja furchtbar glücklich. Aber wenn ich Sie so traurig dastehen sehe, weil Adolf uns so schnell miteinander verlobt hat, wird mir das Herz schwer. Wollen Sie nicht versuchen, mir nur ein wenig gut zu sein?«
Er brachte das Du nicht über die Lippen, obwohl sie nun seine Braut war. Die Situation war ihm äußerst ungemütlich; er hatte sich auch zu schnell hinreißen lassen. Sie schwieg noch immer; nur ein unterdrücktes Schluchzen verriet, was in ihr vorging.
Da fühlte er sich gekränkt. »Ja, wenn ich Ihnen so widerwärtig bin, Beate, dann machen Sie doch ein Ende. Aufdrängen will ich mich Ihnen nicht, und die Schuld liegt lediglich an mir.« Er nagte an seinem hübschen, dunklen Bärtchen und blickte verdrießlich vor sich hin.
Sie schüttelte heftig den Kopf und in halberstickten Tränen rang es sich von ihrem Munde: »Es war nur alles so schnell, so plötzlich, und nun muß ich doch meinen Beruf aufgeben.«
Um Gottes willen, Rolf durfte ja nie ahnen, daß es nur die große Scham war, die sie so unglücklich sein ließ, die Scham darüber, daß sie vielleicht durch ihr halbes Entgegenkommen einem Manne den Mut gemacht, sie zu küssen. Und Beate Haßler küßt nur den Mann, dem sie sich fürs Leben zu eigen geben will! Um diesen Punkt drehten sich alle ihre Gedanken.
Bei ihren Worten atmete Rolf erleichtert auf. Wenn es nur das war, was sie so bekümmert sein ließ, dann war es ja nicht schlimm. »Ja, das allerdings, Beate,« entgegnete er ernst. »Aber ich denke, daß es Ihnen nicht gar zu schwer sein wird. Meine Liebe soll Ihnen alles ersetzen, was Sie aufgeben. Ich will Sie glücklich machen, Beate, soviel in meinen Kräften steht, nur wissen muß ich, ob Sie mich lieb haben.« Er war ganz nahe zu ihr getreten; sie fühlte seine Nähe, die sie beängstigte, verwirrte, und tief senkte sie den blonden Kopf.
»Beate«, er faßte sie mit der gesunden Hand an der Schulter und zwang sie, ihn anzusehen, »warum sprechen Sie denn nicht?« Ärgerlich klemmte er die Unterlippe zwischen die Zähne, und seine Stirn furchte sich.
»Haben Sie doch Nachsicht mit mir!« flehte sie.
»Alles, Beate — nur sagen sollst du mir, ob du mich lieb hast!« rief er ungestüm.
»Ja!«
So leise sie es gesagt, sie mußte es ja tun, er hatte es doch verstanden. Mit einem Male war der Bann von ihm gelöst. Keinen Augenblick zweifelte er an ihrem Wort, und mit einem Jubelruf schloß er sie in seinen Arm. Ihren stillen Widerstand hielt er für mädchenhafte Scheu, für Stolz und Trotz, daß sie wider Willen so schnell die Seine werden mußte, und wie ein Rausch überkam es ihn, dieses seltene Geschöpf an seinem Herzen zu halten. Er preßte seine Lippen auf ihr schimmerndes Haar, auf ihre Augen, auf den blühenden Mund und flüsterte ihr zwischen seinen Küssen die zärtlichsten Liebkosungen zu, und sie ließ sich von der Gewalt seiner Leidenschaften mit forttragen, denn denken durfte sie ja nicht!
Natürlich war bei Papa und Mama Haßler die Überraschung groß, als Adolf ihnen mitgeteilt, daß er soeben Zeuge von Beates Verlobung mit Rolf von Hagendorf gewesen war. Als Beate die Eltern kommen hörte, riß sie sich aus den Armen des Verlobten und flüchtete auf ihr Zimmer — o, nur eine kurze Zeit der Sammlung!
Halb verlegen trat Hagendorf ihnen entgegen; er suchte nach Worten, eine offizielle Werbung vorzubringen. Doch zu seiner Erleichterung wurde flüchtig darüber hingegangen; man begnügte sich mit der vollzogenen Tatsache und hieß ihn herzlich in der Familie willkommen. Er war doch kein Fremder mehr. Durch Adolf wußte man, daß er in glänzenden Verhältnissen lebte; er war eine sogenannte »gute Partie«, um die man Beate sicher beneiden würde.
Am meisten freuten sich die Eltern darüber, daß die Tochter nun endgültig daran denken mußte, ihren Beruf aufzugeben, der ja nie nach ihrem Sinn gewesen war.
Beate lag in ihrem Zimmer vor ihrem Bett, das Gesicht tief in die Kissen gewühlt, um das Schluchzen zu unterdrücken, das ihren Körper schüttelte. Was in ihr vorging, war unbeschreiblich. So streng ging sie mit sich ins Gericht und klagte sich an, durch ihr Verhalten Rolf Hagendorf zu seinem kecken Vorgehen ermutigt zu haben; er war nicht der Mann, der eine Blume an seinem Wege ungebrochen ließ, und nun mußte sie jene einzige Minute so bitter büßen!
Ihr ganzes, schönes, arbeitsfreudiges Leben lang! Denn eher wäre sie gestorben, als zuzugeben, daß sie sich in einer verliebten Laune hatte küssen lassen.
Wenn sie auch Rolf ganz gern hatte, so genügte dieses Gefühl doch nicht, ein Leben an seiner Seite ihr wünschenswert erscheinen zu lassen. Dazu hatten sie viel zu wenig Berührungspunkte und gemeinsame Interessen. Sie war eine zu ernst und tief angelegte Natur, um das nicht schmerzlich zu empfinden. Rolf war ein glänzender Schmetterling, der über die schwierigen Fragen des Lebens gaukelte, sie mit einem Lächeln abtuend.
Wie anders war dagegen Georg Scharfenberg! »Streber« hatte ihn Adolf genannt — nein, das war er sicher nicht — aber ein Mann, dessen Lebenszweck ein immer weiteres Forschen nach Erkenntnis war. So gut begriff sie ihn; keine wohl verstand ihn wie sie, und doch hatte er jetzt sein Herz einer anderen zugewandt! Die war wohl fügsamer, nachgiebiger, als die Jugendgeliebte, die aus gleichem Holz wie er geschnitzt war. Bei dem Gedanken an ihn kam es wie ein stiller Trotz über sie; er hatte sie verschmäht, sich nie wieder um sie gekümmert; nun war es ganz gut, wenn er sah, daß sie trotzdem noch begehrenswert war, sogar für einen Mann, der zu den Begünstigten seines Geschlechtes gehörte!
Endlich raffte sie sich auf, damit ihr Fernbleiben nicht unliebsam auffiel. Sie kühlte die brennenden Augen und ordnete ihr zerzaustes Haar; auch legte sie ein anderes, festlicheres Kleid an.
Mit Ungeduld wurde sie schon unten erwartet.
»Meine liebe Beate, Kind, wie hast du uns überrascht und erfreut.« Mit Tränen umarmte Frau Haßler ihre Tochter, die sich wie ein müdes, verflattertes Vögelchen an sie schmiegte.
»Na, Mädel, endlich mal was Gescheites, was du getan, freue mich unbändig, daß du noch rechtzeitig hinter das alte Wort gekommen bist: es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei.«
Etwas lauter noch als sonst und etwas geräuschvoller sprach Herr Haßler, wohl um die Rührung, die ihn überkam, zu unterdrücken. Er faßte ihre Hände und preßte sie heftig, mit feuchten Augen in ihr schönes Gesicht sehend. Dann führte er sie zu Rolf: »Hier mein Junge, haben Sie sie, und machen Sie mir mein Mädel, meine Einzige, recht glücklich, sie verdient’s.«
Blaß vor innerer Erregung sah Rolf auf die Geliebte, und mit seiner unverletzten Hand zog er sie an sich. Er drückte einen Kuß auf ihre klare Stirn: »Meine Bea,« flüsterte er innig.
Währenddessen hatte Adolf, dem die allgemeine Rührung ungemütlich wurde, mit geübter Hand eine Flasche Sekt geöffnet und goß das schäumende Naß in die Kelche. »Auf euer Glück, Freund und Schwesterchen,« und in einem Zuge trank er das Glas leer.
Still beglückt saß Rolf neben der Braut, die er immer von neuem entzückt betrachtete. Nun war sie sein, die stolze, kluge Beate! Und wie schön war sie mit ihren großen, leuchtenden Augen in dem zarten, durchgeistigten Gesicht und der schweren Haarkrone darüber. Er konnte sich mit ihr sehen lassen!
Seine Verlobung würde wie eine Bombe in die Gesellschaft von S. schlagen, das wußte er, und ebenso, daß seine Erwählte die schärfste Kritik über sich ergehen lassen mußte — aber »Doktor Beate« stand über allen, und dieses Bewußtsein erfüllte ihn mit Hochgefühl. — —
Rolfs erbetener Nachurlaub war zu Ende. Noch vor seiner Abreise wurde die Hochzeit festgesetzt, die im März stattfinden sollte. Beim Abschied drückte er seine Braut heftig ans Herz. »Lerne mich lieben, Beate, ich bin eifersüchtig, wenn deine Gedanken nicht ausschließlich mir gehören,« bedeutungsvoll sah er sie an; sie verstand die stumme Mahnung und senkte den Kopf.
War ihr Inneres denn so durchsichtig für ihn, hatte sie sich so wenig in der Gewalt, daß er doch gemerkt, welches Interesse sie noch immer für Georg Scharfenberg hegte?
Rolf hatte an jenem Tage zu ihr davon gesprochen, als sie erfahren, daß der Jugendfreund doch nicht verlobt war. Der Erwählte von Marianne Brause war ein Freund von Georg, ein Marinearzt, und durch seine Vermittlung hatten die heimlich Verlobten miteinander korrespondiert. An dem Gerede sei kein wahres Wort, hatte Georgs Mutter erzählt, und hinzugefügt, daß ihr Sohn überhaupt nicht ans Heiraten denke, sondern sein Leben lediglich der Wissenschaft widmen wolle.
Da war es, als ginge ein Stich durch Beates Herz, und ein Gefühl sagte ihr, daß es nur ihretwegen sei.
Da fragte Rolf seine Braut, der er ihre Bewegung wohl ansah, nach Georg. Offen gestand sie ihm zu, daß sie Scharfenberg wohl geliebt, aber doch aus tiefgehenden Meinungsverschiedenheiten auf ein Leben an seiner Seite verzichtet habe.
»Aber du denkst dennoch noch an ihn, Beate — und in Liebe?« — Einen Augenblick zögerte sie mit der Antwort, ehe sie sagte: »Wohl habe ich öfter seiner gedacht, ob aber in Liebe? Er ließ mir damals die Wahl zwischen seiner Liebe und der Wissenschaft — wie du weißt, wählte ich das letztere.«
»Und jetzt?«
»Jetzt, Rolf, bin ich deine Braut, und da erübrigt sich wohl alles andere,« entgegnete sie ernst. — Ungestüm umschloß er sie. »Ja, ja Geliebte! Aber doch ist es mir, als stünde er zwischen uns, ich weiß es, du hast noch viel für ihn übrig.«
»Das ist wohl begreiflich, Rolf, da mich so viele Erinnerungen mit ihm verbinden. Wir haben zusammen gespielt; er war mein geduldiger Lehrer, dem ich viel zu verdanken habe, und dennoch habe ich ihm sehr wehe getan. Wir haben uns nie wiedergesehen. Doch lassen wir das, Rolf, wozu alte Erinnerungen heraufbeschwören.«
So ganz zufrieden war er aber doch nicht mit dieser Erklärung, wenngleich er sich hütete, weiter zu forschen. Beate war ein eigenes Geschöpf, das anders als die andern behandelt sein wollte. Er begriff das und richtete sich darnach. Denn er liebte seine Braut leidenschaftlich und sehnte den Tag herbei, der sie ihm ganz zu eigen gab. Auch war etwas wie verletzte Eitelkeit in ihm, daß sie ihm so ruhig zugab, einst den Jugendfreund geliebt zu haben, ohne ihm dann aber zu versichern, daß er, Rolf, jetzt ihr alles sei, das wurmte ihn — sie sollte nur allein noch an ihn denken!
Zur Kräftigung ihrer Gesundheit brachte Beate den Januar im Süden zu, nachdem sie sich noch von ihren Verbindlichkeiten gelöst. Es war ihr doch sehr schwer geworden, sich von der Stätte der liebgewonnenen Tätigkeit loszusagen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, als sie Abschied von den Kollegen nahm, die ihr in herzlichsten Worten Glück wünschten.
So lag dieser Abschnitt ihres Lebens endgültig hinter ihr.
Mehr als ein halbes Jahr war Dr. Beate Haßler nun schon Frau Oberleutnant v. Hagendorf und wegen ihrer Schönheit und Klugheit sehr gefeiert. Sie hatte es verstanden, sich durch ihr Auftreten eine Stellung zu schaffen, wenngleich anfangs von einigen Seiten sehr gegen sie intrigiert wurde; man hatte es dem »Fräulein Doktor« übel vermerkt, den Liebling der Gesellschaft für sich eingefangen zu haben; wer weiß, ob sie es verstand, ihn glücklich zu machen! — Eine Studierte als Hausfrau — undenkbar!
Aber selbst die aufmerksamsten Beobachter vermochten nicht, in dem Haushalt Beates die kleinste Unregelmäßigkeit zu entdecken; es ging alles am Schnürchen; sie repräsentierte mit ruhiger Würde, und nach der tadellos verlaufenen ersten Gesellschaft, vor der ihm doch ein wenig gebangt, schloß Rolf Hagendorf sein junges Weib stürmisch in die Arme; es hatte alles vorzüglich geklappt, und in den anerkennendsten Worten hatte ihm die gestrenge und gefürchtete Kommandeuse ihre Befriedigung über den »so genußreichen Abend« und über seine reizende »Frau Doktor« ausgesprochen, der sie, offen gesagt, solch’ hausfrauliches Talent gar nicht zugetraut habe. — — — — —
Hagendorfs bewohnten eine kleine Villa für sich allein, die Beate mit dem ihr eigenen gediegenen Geschmack eingerichtet hatte. Es hatte ihr schließlich doch Freude gemacht und ihr in etwas über die quälenden Zweifel hinweggeholfen, denen sie manchmal zu unterliegen meinte. Aber ein Zurück gab es für sie nicht mehr, sie war gebunden für ihr ganzes Leben, und klar lag ihr Weg nun vor ihr, wenn er auch anders war, als sie einst geträumt!
Sie wußte ja, daß ihr Gatte ihr geistig nicht ebenbürtig war, daß er leicht über Fragen des Lebens hinwegging, die sie so gern mit ihm besprochen hätte. Daß er so oberflächlich war, wie er ihr sich jetzt zeigte, hatte sie aber doch nicht gedacht, und seufzend mußte sie den Gedanken aufgeben, Rolf nach ihrem Sinn zu modeln; Dienst, Sport und tausend Nichtigkeiten des Lebens bildeten sein Hauptinteresse — sie waren zwei ganz verschiedene Naturen, die sich innerlich niemals näherkommen konnten; Beate war im Grunde eine einsame Frau!
Sonst konnte sie sich aber keineswegs über den Gatten beklagen; denn mit größter Liebe und Aufmerksamkeit umgab er sein junges Weib. Der Sommer war Beate ganz erträglich vergangen; aber vor dem Winter graute ihr, der sie in ein gesellschaftliches Leben hineinziehen würde, das ihrer ganzen Geschmacksrichtung entgegen lag. Sie fürchtete sich vor den ewigen, großen, steifen Abfütterungen, auf denen man immer dieselben Gespräche hörte. Sie konnte sich aber nicht ausschließen, ohne Anstoß zu erregen. Außerdem wünschte es Rolf; er fühlte sich wohl in dem gesellschaftlichen Strudel, und sie gab nach.
Bisher hatte Beate Georg Scharfenberg nicht gesehen, und es war ihr auch recht so. Durch Adolf hörte sie manchmal von ihm, auch daß er letzthin Professor und selbständiger Leiter der Klinik von Professor Brause geworden war, der sich aus Gesundheitsrücksichten zurückgezogen hatte. — Für heute abend hatten Hagendorfs eine Einladung zu Hauptmann Bertholds. »Schon wieder,« seufzte Beate ein wenig, während sie vor dem großen Spiegel in ihrem Ankleideraum stand und letzte Hand an ihre Toilette legte.
Hellgrüne Seide mit duftigen Spitzeneinsätzen schmiegte sich in weichen Falten um ihre schöne Gestalt und hob die zarten Farben ihres Antlitzes aufs vorteilhafteste; bildschön sah sie aus, und sie konnte gar wohl mit ihrem Spiegelbild zufrieden sein.
Es klopfte an der Tür, und Rolf trat herein im Waffenrock mit blitzenden Epaulettes. »Bist du fertig, Schatz?« fragte er.
»Ja — nur die Handschuhe noch, gib sie mir bitte. Dort auf dem Toilettentisch liegen sie mit dem Fächer.«
»Weißt du, Bea, es ist eigentlich eine großartige Eigenschaft von dir, daß du stets fertig bist!«
»Und im Grunde auch immer noch schneller als du,« lachte sie fröhlich.
»Und wie du wieder aussiehst, zum Küssen!« Er trat auf sie zu und wollte sie an sich ziehen.
Doch sie wehrte ihm: »Du zerdrückst mir ja meine Robe.«
»Das tut nichts — dann bekommst du eine andere!«
»Du bist ja riesig freigebig; die Rechnung für diese hab’ ich ja noch nicht mal.«
»Einer — seiner schönen Frau gegenüber muß man stets galant sein!« Dann faßte er ihre Hand. »Sag, mir eigentlich, Schatz, wo du doch so riesig gescheit bist, viel, viel mehr als ich, bist du noch immer mit mir Durchschnittsmenschen zufrieden? Manchmal hab ich eine Heidenangst, wenn man dich so herausstreicht, du könntest mir eines Tages davongehen.«
So scherzhaft er sprach, es klang doch ein leiser Unterton der Sorge heraus, den sie gar wohl verstand. »Bist du mir noch gut, Bea?« Ein lichtes Rot trat in ihr Gesicht; warm ruhten ihre Augen auf dem Gatten, und sie schmiegte sich innig an ihn.
»Ja, Rolf, ich bin dir gut!« sagte sie leise, und dankbar küßte er ihre Hand.
Beate sprach die Wahrheit. Sie liebte ihren Gatten herzlich, wenn es auch nicht jenes Gefühl war, das sie einst für Georg Scharfenberg gehegt. Sein stetes Werben um sie hatte sie gerührt, und jetzt, wo sie seit kurzem die Gewißheit hatte, daß ihr das süßeste Glück erblühen würde, war sie nicht mehr so unglücklich über das böse Verhängnis, das sie in Rolfs Arme getrieben. Sie zwang sich, nicht mehr über vergangene Dinge nachzudenken; unnützes Grübeln hatte keinen Zweck — fortan lebte sie nur dem Kommenden, und das verlieh ihr eine gewisse Freudigkeit und schöne Sicherheit.
Man war bei Hauptmann Bertholds angekommen. Plaudernd stand man im Salon umher, und mehr als einmal flogen die Blicke der Gastgeber nach der Tür; augenscheinlich wurde noch jemand erwartet. Sonst waren die Geladenen schon vollzählig versammelt. Es war nur ein kleiner aber auserwählter Kreis. Die intimen Abendessen bei Hauptmann Berthold waren berühmt, und man hielt es für einen großen Vorzug, von ihm dazu eingeladen zu werden.
Die Frau des Hauses stammte aus einer bekannten Künstlerfamilie und war schöngeistig veranlagt. So war es sehr begreiflich, daß sie gerade für die schöne und gelehrte Dr. Beate von Hagendorf eine große Vorliebe gefaßt hatte. Endlich meldete der Diener: »Herr Professor Scharfenberg —« und im selben Augenblicke trat der Gemeldete ein.
Einen Herzschlag lang stockte Beate der Atem; das hatte sie doch nicht erwartet! Er entschuldigte sich wegen der unbeabsichtigten Verspätung und begrüßte die Herrschaften.
Als ihn die Hausfrau Beate von Hagendorf vorstellen wollte, sagte die junge Frau verbindlich: »Ich kenne Herrn Professor schon, und sicher länger als Sie, gnädige Frau, — wir waren ja Nachbarskinder, nicht wahr, Herr Professor? oder erinnern Sie sich nicht mehr?« Und liebenswürdig reichte sie ihm die Hand, die er an seine Lippen führte.
Es war das Beste und Vernünftigste, ihre Stellung gleich von vornherein klarzulegen — nach mehr als sieben Jahren standen sie sich jetzt zum ersten Male gegenüber, und wer weiß, wie er über jene Episode seiner Jugendzeit noch dachte! »O doch, gnädige Frau! Die Erinnerung an die froh verlebte Kindheit mit ihren kleinen Freuden und Leiden ist noch stets eine Feierstunde für mich gewesen,« lautete seine Erwiderung.
»Ah, denken Sie auch so, Herr Professor?« meinte Frau Hauptmann Berthold, eine weniger schöne als interessante, sehr schlanke Erscheinung mit lebhaften klugen Augen in dem etwas streng geschnittenen Gesicht — »ich bin glücklich, Sie so sprechen zu hören! Wie wenige gibt es doch heutzutage, die das fühlen; für die meisten ist es unnützer Ballast! Dann kann ich überzeugt sein, daß Sie gern mit Frau von Hagendorf bei Tische weiter darüber plaudern! Frau Doktor ist ja Ihre Tischdame, ich war überzeugt, daß Ihnen unsere gelehrte Freundin am meisten von uns armen Sterblichen genügen wird.«
»Sie sind wirklich die Güte und Bescheidenheit selbst, meine liebe gnädige Frau —« er verneigte sich vor der Frau des Hauses und bot dann Beate den Arm, da soeben das Zeichen zum Beginn der Tafel gegeben wurde.
Mit eigenen Empfindungen ging er an ihrer Seite. Er hatte ja vorher gewußt, daß er sie heute abend hier treffen würde, und mit Herzklopfen diesem Augenblick entgegen gesehen. Denn er hatte Beate Haßler nie vergessen können — sie war der Traum seiner Jugend gewesen, und ihretwegen nur blieb er einsam!
Der Abschluß ihrer kurzen Tätigkeit als Ärztin, das so schnelle Aufgeben ihres vorher doch mit so großer Hartnäckigkeit erkämpften Berufes als Braut eines Offiziers hatte ihn befremdet und sein Herz mit schmerzlicher Bitterkeit erfüllt. So war sie auch nicht anders als die anderen, ein echtes Weib, das sich von einem hübschen Gesicht, einer glänzenden Außenseite blenden ließ!
Anscheinend war sie glücklich und vollbefriedigt in ihrer Ehe mit Rolf Hagendorf, den er als gutmütigen, aber sehr leichtsinnigen und leicht zu beeinflussenden Mann kannte, ganz wie Adolf Haßler, Beates Bruder, mit dem er jetzt nur selten noch zusammen kam. Sein Beruf führte ihn andere Wege, in andere Kreise, und so war es ganz von selbst gekommen, daß sich die Bande der Jugendfreundschaft gelockert hatten.
Die Unterhaltung bei Tische war sehr anregend und frei von allem Zwang. Beates anfängliche Befangenheit schwand ihr vollständig, da sie sah, welchen Gleichmut, welche Ruhe Georg Scharfenberg ihr zeigte. Sie beobachtete ihn. Er hatte sich recht verändert. Die Gestalt war breiter geworden, und der dunkle, zugespitzte, sorgfältig gepflegte Bart gab ihm ein fremdes Aussehen — er stand ihm gut, fand sie.
Seine sonst so warm und gütig blickenden Augen hatten einen kühlen, prüfenden Ausdruck, und in der Unterhaltung vermied er jede persönliche Note. Man hatte ja auch so viele andere Berührungspunkte; außerdem saß Frau Hauptmann Berthold ihnen gegenüber, die sich in ihrer lebhaften Art an dem Gespräch beteiligte. Beate mußte sich gestehen, daß sie sich seit langem nicht so gut unterhalten hatte; von früher her wußte sie ja noch, daß Georg ein geistvoller Plauderer war, wenn er aus sich herausging.
Rolf Hagendorf war von seiner Tischdame, Ilse von Malten, der jungen, lebhaften Frau eines Kameraden, sehr in Anspruch genommen; unaufhörlich lachte und plauderte sie mit ihm, und bereitwillig folgte er ihr. Doch trotzdem beobachtete er seine Frau, und mit Befriedigung stellte er bei sich fest, daß sie die Schönste in diesem Kreise war. Wenn seine Blicke sich mit den ihren trafen, hob er grüßend das Glas gegen sie, und freundlich lächelnd nickte sie ihm zu.
Professor Scharfenberg hatte das beobachtet und daraus den Schluß gezogen, daß sie glücklich sei. Warum auch nicht? War ihr Gatte doch der eleganteste, schneidigste Offizier des Regiments! Ihr stolzer, trotziger Charakter mußte sich aber vollständig geändert haben, denn damals hatte sie trotz des Bekenntnisses ihrer Liebe für den Jugendfreund doch ein herbes »nein« gehabt, als es sich um das Aufgeben ihres Planes, zu studieren, handelte. Doch weg mit diesen Erinnerungen, die nur trübe stimmen konnten.
Beate war die Frau eines anderen, und ihm war sein Lebensweg klar vorgezeichnet. Er hatte auf das Glück durch ein Weib verzichtet, seit sie sich von ihm losgesagt. Sein Beruf mußte ihm dafür alles geben; er fand volle Befriedigung darin, und sein Name wurde bereits rühmend genannt — alles konnte man eben nicht haben!
Die Tafel war zu Ende und im Salon wurde der Kaffee gereicht. In anregendem Gespräch wußte die Hausfrau Professor Scharfenberg an ihre Seite zu fesseln, ebenso auch Beate Hagendorf, die sie in ihr Herz geschlossen hatte. Sie fühlte eine starke Sympathie für die liebenswürdige kluge Frau und zeigte sie ihr auch ganz offen. Im Fluge verging die Zeit, und mit Bedauern, daß der genußreiche Abend so schnell seinen Abschluß gefunden, trennte man sich.
Auf dem Heimweg war Beate ziemlich schweigsam; in Gedanken durchlebte sie noch einmal die verflossenen Stunden, und wider ihren Willen trat Georg Scharfenberg in deren Vordergrund. Fortan würde sie ihm öfter begegnen; denn wie sie heute abend erfahren, war er ein guter Freund von Hauptmann Berthold. Ob das aber für ihren inneren Frieden gut war? Sie hatte sich nach vielen Kämpfen dazu hindurchgerungen und wollte ihn nicht gern wieder einbüßen — aber die Erinnerung an ihre erste Liebe war doch zu lebendig.
»Du bist so still, Beate«, unterbrach Rolf ihren Gedankengang, indem er seinen Arm unter den ihren schob. Fast wurde sie durch seine Anrede erschreckt.
»Ich bin müde, Rolf, und ein wenig abgespannt.«
»Wir sind ja gleich daheim! Hast du dich diesmal gut amüsiert?« Er betonte das Wort diesmal etwas auffällig und sah sie forschend an.
»Ja,« entgegnete sie unbefangen, »ich bin gern mit Frau Berthold zusammen, bei ihr ist alles so harmonisch, und mit ihr kann man sich wenigstens auch mal über etwas anderes unterhalten als mit den meisten anderen Damen.«
»Nun ja, Schatz, du schraubst deine Ansprüche gar zu hoch — die kleine Malten beklagte sich fast bei mir, daß du ihr gegenüber zu zurückhaltend bist.«
»Ich mag sie nicht, Rolf, und kann mich auch nicht verstellen.«
»Ja, aber warum nicht? Sie ist doch sehr liebenswürdig.«
»Das bestreite ich gar nicht; ihre Liebenswürdigkeit ist aber nicht echt; außerdem ist sie mir wirklich zu oberflächlich.«
»So gründlich gebildet wie du kann allerdings nicht jede sein und den Doktortitel haben, Gott sei Dank, möchte man da beinahe sagen! Und da sich die anderen dir unmöglich anpassen können, dürftest du ihnen wohl gern ein wenig entgegenkommen.«
»Das tue ich genügend, Rolf, wie du ganz gut weißt! Aber gerade Frau von Malten ist mir direkt unsympathisch. Sie ist auch nicht aufrichtig, und wenn ich dieses Gefühl von jemand habe, kann ich nicht herzlich sein. Übrigens ist mir ihr Horizont zu beschränkt; über Toiletten und Flirt geht er nicht.«
»Freilich, einen so guten Lehrer wie du in Doktor Scharfenberg hat sie nicht gehabt,« entgegnete er mit leisem Spott.
Verletzt zog sie ihren Arm aus dem seinen. »Ah, willst du da hinaus? Dann konntest du dir die Vorrede sparen.«
»Du warst ja so sehr in die Unterhaltung mit ihm vertieft, daß es allgemein auffiel.«
»Mit »allgemein« kannst du sicher nur Frau von Malten meinen, deren boshafte Zunge ich längst kenne; ich wundere mich aber nur, daß du dich so von ihr beeinflussen läßt.«
»Und du warst sicher glücklich, endlich deinen Jugendfreund wiedergesehen zu haben.«
Beate blieb stehen. »Willst du mich durchaus kränken, Rolf? — ich habe dir keine Veranlassung dazu gegeben! Du weißt um meine Jugendfreundschaft mit ihm, weißt auch, was ihr ein Ende gemacht hat. Frau Berthold hätte uns nicht als Tischnachbarn bestimmt, wäre ihr das bekannt gewesen — für diesen Zufall bin ich nicht verantwortlich.«
»Anscheinend war er dir aber nicht unangenehm?« Rolf war in eine etwas gereizte Stimmung geraten, deren Grund er sich selbst kaum erklären konnte.
War es die Anwesenheit Scharfenbergs bei Bertholds, oder eine boshafte Bemerkung Frau von Maltens über Beates Gelehrsamkeit — genug, er wußte es nicht, und die ruhigen Entgegnungen seiner Gattin reizten ihn fast, daß er sich zu seinen mißtrauischen Fragen hinreißen ließ. »Wenn du mich fragst, Rolf, nein« — entgegnete sie gelassen, »seine Unterhaltung im Verein mit der Frau Bertholds war mir in der Tat eine angenehme Abwechslung — ich hörte einmal etwas anderes reden, als daß die Glockenröcke so ungeheuer schick seien, aber doch sicher bald wieder unmodern würden.«
Ein leiser Sarkasmus klang aus ihrer Stimme — sie wollte durchaus keine Szene und ging ruhig weiter, nahm aber den angebotenen Arm des Gatten nicht an.
Rolf sah an ihrem Gesicht, daß es nicht ratsam war, weiter zu sprechen. Durch seine Worte, die ihm vielleicht von einer gewissen Eifersucht diktiert waren, hatte er ihr die Stimmung verdorben, und in etwas ungemütlichem Schweigen legten sie den Rest des Weges zurück. — — —
Beate von Hagendorf lebte jetzt sehr zurückgezogen, und sie war froh, einen Grund dazu zu haben. Nur mit der ihr so lieben Frau Hauptmann Berthold verkehrte sie, und durch sie hörte Beate auch noch manchmal von Professor Scharfenberg. Sie hatte ihn einmal kurz nach dem Abend ihres Wiedersehens auf der Straße getroffen. Er hatte grüßend den Hut gezogen und war stehen geblieben, sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Es waren gleichgültige Worte gewesen, die man gewechselt, und doch war Beate in einen Zustand der Unruhe versetzt worden.
Nein, es war nicht gut, daß sie mit ihm zusammenkam; es schaffte ihr nur unnütze Aufregung und brachte sie aus dem schönen Gleichmaß ihrer Seele, zu dem sie sich hindurchgerungen. Sie durfte auch Rolf das nicht antun, sich so viel in Gedanken mit dem Jugendfreund zu beschäftigen — denn ihr Gatte trug sie jetzt förmlich auf Händen; er konnte sich in Aufmerksamkeiten nicht erschöpfen. — — —
Und als die Rosen blühten und die Erde in herrlicher Blütenpracht prangte, hatte Beate dem Gatten einen Sohn geschenkt. Seine Freude war unbeschreiblich. Bebend vor innerer Bewegung kniete er an ihrem Bette und küßte ihre Hände voll heißer Dankbarkeit. Beate hatte schwer gelitten; sie konnte sich trotz ihrer kräftigen Natur lange nicht erholen. Wochenlang war sie bettlägerig, und die Sorge wich nicht von ihrem Lager.
Als sie zum ersten Male wieder aufstehen durfte, zeigte die Natur schon herbstliche Färbung, und mit etwas wehmütigem Lächeln schaute die junge Frau in den Garten, auf dessen wohlgepflegten Wegen die Amme den Kinderwagen schob und mit dem Kleinen tändelte. Tränen feuchteten ihre Augen. Ihr Kind! Was hatte sie bis jetzt davon gehabt, und wie innig sehnte sie sich nach ihm! Wenn sie nur nicht gar so schwach noch und elend wäre!
Prüfend flog ihr Blick nach dem Spiegel. Sie war bloß noch ein Schatten ihres früheren strahlenden Selbst — um Jahre gealtert kam sie sich vor. Das Gesicht war so bleich und abgezehrt, um den Mund lag ein müder Zug, und die Fülle der Gestalt war geschwunden. Schmerzlich seufzte sie. Sie war doch genug Weib, um das nicht bitter zu empfinden.
Beate erhob sich vom Diwan, auf den man sie gebettet, und machte mit Anstrengung einige Schritte nach der Balkontüre, um nach dem Kinde zu rufen. Da sah sie auf dem Wege zwei sommerlich gekleidete Gestalten daherkommen, die jetzt am Kinderwagen Halt machten und sich darüber neigten, seinen Inhalt in Augenschein zu nehmen. »Du kleiner Kerl, kennst du mich denn nicht? Ich habe dich doch schon öfter begrüßt! Nicht weinen, du, du, ich bin doch die gute Tante,« hörte Beate ganz deutlich die etwas scharfe, helle Stimme der Frau von Malten zu sich heraufschallen, »sieh nur, Viola, er ist doch gar zu goldig — und wie klug er schon guckt.«
Da trat Rolf ziemlich hastig ins Zimmer. »Ausgeschlafen, Bea? Fühlst du dich noch so wohl wie am Mittag? Das ist ja herrlich« — er küßte sie flüchtig auf die Stirn — »du siehst auch brillant aus, ganz brillant. Da bist du sicher imstande, Frau von Malten mit ihrer Schwester zu empfangen.«
»Rolf!« weiter sagte sie nichts.
Er verstand den stummen Vorwurf in dem Blick der großen Augen. Etwas verlegen fuhr er sich durch das Haar. »Ich bin selbst untröstlich, Schatz, aber es geht nicht anders. Abweisen kannst du sie nicht. Heute morgen begegnete sie mir, fragte mich natürlich nach deinem Befinden, und als ich ihr erzählte, daß du zu meiner großen Freude aufstehen wolltest, stellte sie mir ihren Besuch in Aussicht.«
»Warum hast du mir nichts davon gesagt?« fragte sie vorwurfsvoll.
»Weil ich es selbst noch nicht recht geglaubt, nachdem ich schon früher einigemale abgewinkt! Sie war in jeder Hinsicht so aufmerksam, daß es direkt ungezogen gewesen wäre; sieh, jetzt kommen sie schon die Treppe herauf, eine Abweisung ist unmöglich,« sagte er dringend, schon im Hinausgehen begriffen.
Draußen hörte sie lautes Lachen, lebhaftes Begrüßen, und wenige Augenblicke später betraten die beiden Damen das Zimmer. Als Beate sich aus dem bequemen Stuhl, in dem sie jetzt ruhte, erheben wollte, um ihnen entgegen zu gehen, eilte Frau von Malten auf sie zu, sie daran zu hindern.
»Nein, nein, Liebste, Beste, das geht nicht! Sie bleiben hübsch sitzen, wenn Sie nicht wollen, daß wir gleich wieder gehen!«
Sie küßte Beate auf beide Wangen — »wie bin ich glücklich, Sie so wohl zu sehen. Gott, wie hab’ ich mich um Sie gesorgt — wir alle, nicht wahr, Viola? Nun bringe ich Ihnen so ohne weiteres mein Schwesterlein, das darauf brennt, die berühmte »Doktorin« kennen zu lernen. — Sie sind mir doch nicht böse, Liebste, daß ich so bei Ihnen eindringe? Aber Ihr Gatte meinte, es sei durchaus keine Störung; im Gegenteil, Sie müßten etwas Zerstreuung haben, und mir ließ es keine Ruhe, seitdem ich wußte, daß Sie auf sind, und diese Rosen hier, die letzten Kinder des Sommers, sollen meinen Wunsch begleiten, Sie recht bald in unserer Mitte, gesund und vergnügt zu sehen!« Dabei legte sie den Strauß köstlicher Rosen, den sie bisher in der Hand gehalten, in Beates Schoß und setzte sich neben sie.
Die junge leidende Frau war von dem Redeschwall der andern förmlich betäubt, und fast mechanisch hieß sie Viola Düsing willkommen, die schon seit längerer Zeit bei Maltens zu Besuch war. Sämtliche Herren schwärmten von ihr, auch Rolf nicht ausgenommen.
Sie war eine auffallende Erscheinung, Mitte der Zwanzig, mehr pikant als schön mit dem stark rotblonden Haar, den dunkelgrauen Augen und dem üppigen, ein wenig aufgeworfenen Munde in dem frischen, sehr gepuderten Gesicht. Ihre Gestalt war tadellos, aber ein wenig zur Fülle neigend. Der Schick, mit dem sie gekleidet, hatte schon die Grenzen überschritten, die einer Dame in der Wahl ihrer Toilette gezogen sind; Beate war fast befremdet darüber. Viola Düsing kam der fein empfindenden, maßvollen Frau wie eine Soubrette, eine Varietéprinzessin vor; sie konnte sich dieses Gefühls nicht erwehren.
Rolf hatte sich mit dem jungen Mädchen in ein lebhaftes Gespräch vertieft, während die beiden Frauen über den kleinen Karl Friedrich sprachen, wieviel er zunahm und was dergleichen Fragen mehr sind, die Mütter interessieren.
Da wandte sich Viola zu Beate. »Gnädige Frau, Ihr Bub’ ist herzig — ich habe ihn vorhin so bewundert; kaum konnt’ ich mich von ihm trennen, er ist einzig süß, und wie gleicht er so ganz seinem Vater, einfach süß,« wiederholte sie und warf einen sprechenden Blick auf Rolf, der fast verlegen über die ihm so offensichtlich dargebrachte Schmeichelei seinen Schnurrbart drehte. Mit tiefem Befremden hörte Beate diese Worte. Vergaß das junge Mädchen so ganz seine gute Erziehung, um in einer solchen Weise einem Herrn entgegenzukommen?
Es war, als ahne Frau Ilse Malten Beates Gedanken, denn sie sagte: »Viola schwärmt ja so sehr für kleine Kinder — sie sind ihr ganzes Entzücken. Ich habe den ganzen Tag zu schelten, weil sie mir meine beiden Jungen in Grund und Boden verwöhnt und verzogen hat; sie tobt wie ein Kind mit ihnen, und die Buben wissen genau, an wem sie Rückhalt haben! In der Zeit ihrer Anwesenheit hat sie das Haus förmlich auf den Kopf gestellt! Und ebenso wild reitet sie. Ich habe manchmal Angst, daß sie mir nicht mit heilen Gliedern nach Hause kommt, und ich bin froh, wenn sie mir meinen Mann gesund abliefert!«
»Na ja, dein Otto ist ’ne Schlafmütze,« lachte Viola und ihre Zähne blitzten; dann schlug sie sich wie erschrocken auf den Mund — »o bitte um Verzeihung wegen dieses unparlamentarischen Ausdrucks; er entfuhr mir nur so! Aber der gute Otto! Der Sonntagsreiter! Was ich unter Reiten verstehe, ist etwas ganz anderes: über Sturzäcker reiten, Gräben und Zäune nehmen, das ist nach meinem Sinn — an mir ist ein Kavallerist verloren,« — ihre Lippen waren halb geöffnet, und ihre Brust hob sich in tiefen Atemzügen, als genösse sie dieses Vergnügen ihres wilden Reitens.
Entzückt ruhten Rolfs Augen auf dem lebensvollen Geschöpf — das war etwas nach seinem Sinn! »Ganz meine Ansicht, gnädiges Fräulein«, entgegnete er lebhaft, »auch ich fühle mich als ein anderer, wenn ich auf einem Gaul sitze.«
»Sie haben Ihren Herrn Gemahl gewiß immer begleitet,« wandte sich Viola an Beate, »das muß köstlich gewesen sein!«
»Sie irren, Fräulein Düsing! Ich habe nie ein Pferd bestiegen; auch muß ich gestehen, daß ich diesem Sport sehr gleichgültig gegenüberstehe«, entgegnete Beate etwas steif; ihr mißfiel das Wesen des Mädchens immer mehr.
Rolf ärgerte sich in diesem Augenblick über seine Frau. Sie kam ihm spießbürgerlich und schulmeisterhaft vor, richtig pedantisch, während die andere voll frischen, heiß pulsierenden Lebens war, fröhlich und unbekümmert, so, wie er es liebte!
»Ah«, machte da Viola auf Beates letzte Bemerkung, und sehr erstaunt und ungläubig, fast ein wenig geringschätzig, blickten ihre grauen Augen, und ganz leicht schüttelte sie den Kopf, als sei ihr unbegreiflich, was die andere gesagt.
»Du darfst nicht vergessen, Kind, daß Frau von Hagendorf ganz andere Interessen hat,« meinte Ilse Malten in leicht verweisendem Tone, »du weißt doch, daß sie studiert und den Doktortitel errungen hat; da fehlte die Zeit für derartigen Sport!«
»Ach ja, liebe, gnädige Frau, bitte erzählen Sie doch von Ihrer Studienzeit, das muß doch furchtbar interessant gewesen sein, das flotte, freie Burschenleben — »’s gibt kein schöner Leben, als Studentenleben, wie es Bacchus und Gambrinus schuf« — ach, bitte, erzählen Sie —« und wie ein Kind klatschte sie in die Hände, erwartungsvolle Augen machend.
Ein leichtes, ironisches Lächeln zuckte um Beates Mundwinkel. »Ein solches Studentenleben, wie Sie denken, Fräulein Düsing, habe ich nicht genossen. Ich hatte mein Studium ernst und nicht als Sport genommen. Da hieß es arbeiten, um vorwärts zu kommen. Amüsieren und flirten gab es da nicht! Und doch habe ich Stunden reinsten Glücks und vollster Befriedigung gehabt, wie es nur die kennen und mir nachfühlen, die ernste Arbeit zu ihres Lebens Ziel und Inhalt machen. Ich denke sehr gern an jene Zeit zurück.«
»Das alles haben Sie aber aufgegeben, als der Rechte kam! Gestehen Sie, Liebste, die Ehe ist doch das einzig Richtige für uns, nicht wahr? Da vergißt man alles, die ganze Gelehrsamkeit, den Durst nach Ruhm und Erfolg,« meinte Frau Ilse in leicht neckendem Tone, sich vorbiegend und in Beates ernste Augen sehend.
»Ich muß Ihnen recht geben, wenn die Ehe eine ehrliche Kameradschaft für das Leben ist und die Ehegatten sich gegenseitig ergänzen und verstehen — und man ein lieb Kind sein eigen nennt,« schloß Beate mit leiser weicher Stimme.
Rolf küßte ihre Hand. »Ja, meine Bea, du sprichst mir aus dem Herzen.« Es war ihm, als müsse er etwas gut machen; denn er sah, wie sie sich nur mühsam aufrecht erhielt. Der Besuch der beiden Damen griff sie doch noch zu sehr an. Spöttisch lächelnd beobachtete Viola diese kleine Szene. Rolf bemerkte das und wurde rot.
In plötzlicher Schwäche schloß Beate die Augen. Frau von Malten sah das. Sofort sprang sie auf. »Ist Ihnen nicht gut? O, verzeihen Sie, daß wir so lange verweilt haben! Doch verplaudert sich die Zeit so schnell bei Ihnen, Liebste! Nun wollen wir aber gleich gehen, Viola, und Sie, liebe Frau Beate, legen sich sofort zu Bett! — Also auf Wiedersehen! Nächste Woche dürfen wir doch wiederkommen?« Sie küßte Beate auf die Wangen, und nach wortreichem Abschied entfernten sich die beiden.
Rolf von Hagendorf geleitete sie hinaus. In gut gespieltem Bedauern meinte da Ilse Malten: »Gott, Hagendorf, unser Besuch hat doch Ihrer lieben Frau nicht etwa geschadet? Sie sah übrigens nicht so gut aus, wie Sie dachten! Ihr Männer habt dafür gar keine Augen, wenn man wirklich krank ist. Ihr seid Barbaren! Hoffentlich wird es nicht zu lange dauern, bis Frau Beate ihre vielbewunderte Schönheit wieder bekommt: sie ist richtig alt geworden! Du mußt nämlich wissen, Viola, daß unseres Freundes Frau die schönste Dame des Regiments war, — nein, nein, kein Widerspruch aus Galanterie, lieber Hagendorf. Sie wissen es doch ganz genau selbst. Und wie ist ihr Haar dünn geworden! Gegen dessen frühere Pracht, Viola, würde selbst dein schönes Haar nicht aufgekommen sein!«
Rolf warf einen bewundernden Blick auf die rotgoldene Haarfülle des jungen Mädchens — »das weiß ich doch nicht, Gnädigste, ob Sie da nicht zu viel sagen: dieses Tizianblond ist einzig, köstlich.«
Viola sagte gar nichts darauf, sondern lächelte ihn nur in seltsam berückender Weise an. Ilse schlug scherzend nach ihm.
»Glaube ihm nicht, Kind — hüte dich vor ihm — er ist ein gefährlicher Mann! Nun komm, Herz, sonst wird schließlich Diavolo ungeduldig — er muß heute noch geritten werden!«
»Wenn ich Sie einmal begleiten dürfte, gnädiges Fräulein, würde ich sehr glücklich sein,« bat Rolf.
»Ich habe nichts dagegen! — ob aber Ihre Frau Gemahlin es Ihnen erlauben wird —?« Etwas herausfordernd blickten ihre hübschen, kecken Augen ihn an.
Er klemmte die Unterlippe zwischen die Zähne. »Pardon, meine Gnädigste, sehe ich aus, wie ein Pantoffelheld?«
Sie schwieg einen Augenblick, wobei sie ihn ungeniert musterte; dann sagte sie achselzuckend: »Je nun, Sie kennen doch die Antipathie Ihrer Frau Gemahlin gegen das Reiten — meinetwegen sollen Sie sich nicht in Gefahr begeben!«
Ihre Art hatte etwas Aufreizendes für ihn. »Ich will Ihnen beweisen, daß ich keine Gefahr scheue,« rief er stürmisch, »es ist überhaupt ganz widersinnig, von Gefahr zu reden. Bitte, bestimmen Sie einen Tag, an dem Ihnen meine Begleitung angenehm ist.« Erwartungsvoll sah er sie an.
»Gut, sagen wir, morgen in acht Tagen«, entgegnete sie überlegend.
»Dann erst? Warum nicht schon früher? Ich bin wirklich begierig, Ihr Kavalier zu sein, da Ihnen Malten so wenig genügt,« und dringlich blitzten seine hübschen Augen sie an, »bitte, seien Sie barmherzig.«
»Ich kann es wirklich noch nicht bestimmen! Sie werden durch Otto Bescheid bekommen, Herr von Hagendorf,« meinte sie leichthin, dann blickte sie sich suchend um. »Ach, Ihr Bubi ist nicht mehr hier — schade, ich hätte das goldene Kerlchen gern noch mal gesehen — nun, komm, Ilse, sonst wird es zu spät!«
Sie reichte ihm die Hand, die er mit feurigem Druck an seinen Mund führte. »Auf Wiedersehen, Herr Oberleutnant!«
»Das war also die berühmte, schöne Doktor Beate Hagendorf,« meinte Viola zu ihrer Schwester, als sie heimgingen, »so ein Bildungsprotz, einfach gräßlich! Sie ist genau so langweilig und feierlich wie ihr Name. Beate, da muß ich an meine Großmutter denken! Sie paßt nicht im geringsten zu dem Mann.«
»Nein, da hast du recht. Siehst du, liebe Viola, den hatte ich für dich im Sinn,« entgegnete Ilse, »wenn du vor zwei Jahren auf meine dringliche Einladung gekommen wärst, könntest du Frau von Hagendorf sein. Ich hatte mir schon alles so schön gedacht und ihm von dir vorgeschwärmt. Aber die Reise nach Budapest war dir damals wichtiger, und doch hast du nicht erreicht, daß du die Gräfin Hohenfels geworden bist!«
Ein böses Licht glimmte in Violas Augen auf, und ein Zug trat in ihr Gesicht, der es recht gewöhnlich aussehen ließ.
»Und wer trägt daran die Schuld? Du! Ihr! weil Papa notwendig die großen Zahlungen für euch leisten mußte,« sagte sie heftig. »Du hast stets das meiste Geld bekommen, und ich habe das Nachsehen gehabt! Was ist für mich denn aus dem Gutsverkauf übrig geblieben?« Sie schnippte mit den Fingern. »So gut wie nichts, alles ihr, und was wird aus mir?«
»Ereifere dich doch nicht, Viola«, begütigte die andere, »es war doch nichts anderes zu machen. Papa hat ebenfalls viel Schuld mit an allem! Doch laß uns nicht mehr darüber reden; es hat keinen Zweck mehr! Übrigens brauchst du dich nicht um deine Zukunft zu sorgen; du hast hier die besten Chancen, unterzukommen — da ist z. B. der lange Plessow, der ist toll verliebt in dich, sagt Otto, fabelhaft reich dabei — eine bessere Partie könntest du gar nicht machen!«
»Ach, geh’ mir mit dem«, meinte die Schwester geringschätzig, »der ist ja wie Milchsuppe! Da ist mir Hagendorf doch lieber, in dem steckt Rasse, Temperament.«
»Aber Viola, was redest du da! Er ist doch verheiratet, und ein Flirten mit ihm hat gar keinen Zweck.«
»Und warum nicht? Schon um seine famose Frau zu ärgern, die mir mit ihrem Vortrag über ihr Studentenleben verschiedene Stiche versetzt hat; na, ich hätt’s anders gemacht! Himmel, der Mann muß doch bei so viel Gelehrsamkeit Angst bekommen! Sie hatte wohl viel Geld?«
»Ja, das wohl! Doch hat er nicht nötig gehabt, darauf zu sehen, da er selbst reich ist! Ich gebe dir nochmals den guten Rat, Viola, sei vorsichtig.«
»Ja, ja, du kannst überzeugt sein, daß ich trotz allem meinen Vorteil nicht aus dem Auge lasse; den langen Plessow kann ich jetzt schon um den Finger wickeln, der ist mir sicher, deshalb will ich mich noch amüsieren! — Übrigens, die Hagendorf hatte einen schicken Schlafrock an, wo kauft sie? Hier doch nicht.«
»Nein, sie bezieht durch Vermittlung der Berthold, ihrer Busenfreundin, sämtliche Garderobe aus Wien.«
»Ach, die lange Bohnenstange mit ihren ewigen Reformkleidern? Na, die beiden passen ja zusammen!« Sie schüttelte den Kopf. »Wie kann nur ein Mann wie Hagendorf an der Frau Gefallen finden, die ihn sicher den ganzen Tag mit ihrer Gelehrsamkeit langweilt. »Fräulein Doktor«, sie konnte nur bei ihrem Berufe bleiben.«
»Das sage ich auch! Immer sucht sie zu imponieren — sie will alles besser wissen.«
»Nur das eine weiß sie nicht, wie man einen Mann fesselt.« Bei diesen Worten lächelte Viola vor sich hin. Ihre Schwester sah sie von der Seite an; welche Gedanken mochten da in diesem kapriziösen Köpfchen spuken? Ilse konnte aus ihr nie klug werden.
Als Rolf Hagendorf ins Zimmer zu seiner Frau zurückkehrte, fand er sie mit geschlossenen Augen auf der Chaiselongue liegen, bleich und abgespannt aussehend. Mit forschendem Blick betrachtete er sie. Weiß Gott, die Malten hatte recht, ihm war das nur nicht so aufgefallen; Beate war sichtlich alt geworden; von der Nase zum Mund zogen sich zwei scharfe Falten, die ihr einen alten, leidenden Zug gaben, und die Hände, die schönen, schlanken, weißen Hände, die er früher so oft in seiner Verliebtheit geküßt, wie waren sie mager und gelb geworden; doppelt hob sich das von der dunkelseidenen Decke ab, auf der sie nervös hin und her glitten. Ein unangenehmes Gefühl beschlich ihn. Wie hatte er die Schönheit seiner Frau geliebt, wie war er stolz darauf gewesen! Er dachte nicht daran, daß sie noch zu leidend war, um schon wieder so gut wie früher auszusehen, und unwillkürlich drängte sich Violas lebensvolles Bild in seine Vorstellung.
Beate hob die Wimpern und sah ihn an; es war, als hätte sie den Blick seiner Augen gefühlt. Kosend strich er über ihr Gesicht. »Na, Maus, nun ist das auch überstanden! Recht, daß du dich ein wenig gelegt hast«, meinte er leichthin.
»Möchtest du, bitte, klingeln? Ich will doch lieber gleich zu Bett gehen, der Besuch hat mich sehr angegriffen.«
»Nun, so lange haben sich die Damen doch nicht aufgehalten. Frau von Malten wollte dir gern ihre Schwester vorstellen.«
»Sie hätte ruhig damit warten können. So bald möchte ich beide nicht wiedersehen.«
»Aber Beate, ich begreife dich einfach nicht, zwei so liebenswürdige Damen,« ein leiser Unmut klang aus seiner Stimme.
»Wir wollen nicht weiter darüber sprechen. Ich habe gesehen, daß Martina Berthold wirklich recht hat. Viola Düsing ist keine Dame, sie hat etwas vom Varieté an sich.«
Mit Mühe bezwang Rolf seine Ungeduld, seinen Unwillen über diese Äußerung Beates. Er sagte gar nichts, sondern war ihr behilflich, ins Schlafzimmer zu gehen. Dann zog er sich um und ging fort, einen Bummel nach der Stadt zu machen, um dort vielleicht Bekannte zu treffen.
Durch Beates lange Krankheit war manches anders geworden. Rolf hatte allmählich seine Junggesellengewohnheiten wieder angenommen und fühlte sich sehr wohl dabei. Er ging alle Tage aus. Was sollte er auch zu Haus? Die verheirateten Kameraden bekümmerten sich um ihn; sie luden ihn in ihre Häuslichkeit ein, und die Damen nahmen herzlich teil an Beates Leiden. Frau von Malten tat sich besonders hervor; sie hatte eine Schwäche für den liebenswürdigen Offizier und sah ihn gern bei sich. Sie fühlte wohl die geringe Sympathie, die Beate für sie hegte; jedoch kümmerte sie sich weiter nicht darum, im Gegenteil, sie befleißigte sich der größten Aufmerksamkeit gegen die gefeierte, kluge Frau, da sie durchaus mit ihr verkehren wollte, aus Berechnung! Im Grunde nämlich erwiderte sie Beates Antipathie aus vollem Herzen.
Sie hatte es gut verstanden, Rolf nach sich zu ziehen, und der beste Magnet war ihre Schwester. Viola, ein rassiges, temperamentvolles Geschöpf, die ihm ein starkes Interesse einflößte. Doch daraus war jetzt mehr geworden! Rolf schmachtete in ihren Banden. Mit raffinierter Koketterie hatte sie es dahin gebracht. Er durfte sie auf ihren täglichen Spazierritten begleiten; und nicht lange dauerte es, so war das Paar ein Gegenstand lebhaften Gesprächs geworden, und man bedauerte sogar schon die arme junge Frau Hagendorfs. Viola, in ihrer stark ausgeprägten Eigenart, kümmerte sich wenig um ein Gerede, das sich mit ihrer Person beschäftigte, und auch Rolf war es gleich; sein einziger Gedanke war jetzt nur noch das üppige, rotblonde Mädchen, und glühende Eifersucht erfüllte ihn auf den Oberleutnant Plessow, von dem sich Viola ebenfalls stark den Hof machen ließ. Sie war unberechenbar: heute war sie von abstoßender Kälte, morgen von unvergleichlicher Liebenswürdigkeit, und das machte ihn fast toll.
Beate litt sehr unter seinen jetzt so wechselnden Stimmungen; sie wußte ja nicht, mit welch widerstreitenden Empfindungen er kämpfte. Ihre Genesung hatte, da ihre kräftige Natur endgültig die Oberhand gewonnen, sehr schnelle Fortschritte gemacht. Die Gestalt rundete sich wieder; ihr Gang und ihre Haltung bekamen die frühere Elastizität und Frische; sie war ganz die alte geworden, wie Martina Berthold mit Freude feststellte. Diese war ein fast täglicher, gern gesehener Gast bei Beate; die beiden so gleichgestimmten Frauen wurden durch eine treue Freundschaft miteinander verbunden.
Professor Scharfenberg verkehrte viel bei Bertholds; zu jeder Tageszeit war er willkommen in dem gastfreien Hause. Mit einem leisen Gefühl des Neides hörte Beate die Freundin oft von den anregenden Stunden erzählen, die ihr durch den Verkehr mit dem geistvollen Professor zu teil wurden. Wie anders war es jetzt dagegen bei ihr! Sie war fast jeden Abend allein, da Rolf stets etwas vor hatte. Und blieb er mal zu Haus, war er zerstreut, unruhig, sprach von dem ewigen Ärger im Dienst, daß er es »satt bis oben ’ran« hätte, von Rennen und ähnlichen Dingen.
Brachte Beate das Gespräch auf etwas anderes, Tieferes, dann wurde er ungeduldig: »Ach, laß mich mit dem Quatsch in Ruhe; du weißt doch, daß ich nun mal nichts davon verstehe, hab’ auch gar kein Interesse dafür; habe meinen Kopf so voll!« Dann las er flüchtig seine Sportzeitung, gähnte einigemal recht vernehmlich und ging dann schlafen.
Die feingebildete, ruhige Beate langweilte ihn; er mußte Abwechslung haben, und dazu hatte ihn Viola gebracht, sie war so ganz anders als seine Frau — sie hätte viel besser zu ihm gepaßt! Wenn er ahnte, daß Beate gar nicht so ruhig war, wie es ihm schien, daß hinter ihrer weißen Stirn rebellische Gedanken wohnten! Mehr als ihr lieb war, mußte sie an Georg Scharfenberg denken, mehr und mehr sah sie ein, daß ihre Ehe ein grenzenloser Irrtum war. Das bißchen Scheingefühl, das sie im Anfang gehabt, war verflogen; sie fühlte sich tief unglücklich an Rolfs Seite. Aber niemand bekam Einblick in diese stolze Frauenseele; still trug sie ihr Geschick für sich.
Ihr lebhafter Geist brauchte Anregung oder wenigstens Verständnis und Entgegenkommen, wenn sie geistig nicht verkümmern sollte, und das gesellschaftliche Leben, in dem Rolf sich so wohl fühlte, genügte ihr gar nicht. Sie mußte ihre geistigen Fähigkeiten rühren, und mit ihrer zunehmenden Kräftigung war auch der alte Tatendrang in ihr erwacht. Sie kehrte zu ihrer Wissenschaft zurück. Sie hatte ja so viel Zeit. Aufmerksam verfolgte sie alle Neuerscheinungen darin, worüber Rolf sie manchmal auslachte oder, in schlechter Stimmung, sich diese Emanzipationsgelüste verbat, die sich gar nicht für eine Offiziersdame schickten; er wolle sich außerdem bei seinen Kameraden nicht lächerlich machen lassen.
Auf solche Ausfälle erwiderte sie gar nichts, sondern suchte Halt bei ihrem Kinde, an dem sie mit abgöttischer Liebe hing. Wenn sie das nicht gehabt hätte! Und doch vermochte der kleine Karl Friedrich die grenzenlose Öde und Leere in ihr nicht auszufüllen. Aber nachdenken durfte sie nicht!
»Komm, Bubi, mein Liebling, mein Einziges, wir wollen uns fein machen, und Tante Martina zum Geburtstag gratulieren!« Beate kleidete das Kind um; sie wurde kaum damit fertig; denn immer von neuem freute sie sich über sein rundes, festes Körperchen, herzte und küßte es, ihm tausend Liebkosungen gebend. Endlich war er fertig und lag in dem eleganten, hellen Kinderwagen. Sie legte die Blumen und eine Photographie, die Bubi bringen sollte, auf dessen seidengestickte Decke. »Fahren Sie immer zu,« sagte sie dann zu der Amme. »Bleiben Sie aber in der Sonne, ich komme gleich.«
Ihre Toilette nahm nicht so lange Zeit in Anspruch, und bald war sie in ihr resedafarbenes Promenadenkostüm umgekleidet, das ihr vorzüglich stand. Sie sah sehr gut aus; jede Spur der Krankheit war verschwunden. Ihre mädchenhafte schlanke Figur ließ sie jünger erscheinen als sie war, und die frische, klare Herbstluft, man schrieb den 10. November, färbte ihr zartes, durchgeistigtes Antlitz mit lichter Röte und vertiefte den Glanz der ernsten, schönen Augen. Nur ihr Gatte schien das nicht zu sehen; sein Blick war zerstreut, und unruhig glitt er über sie hin, als sie sich begegneten; er kam gerade vom Dienst, und in der Haustüre trafen sie zusammen.
»Ah, Rolf, das ist gut, daß du schon kommst. Da kannst du mich ja begleiten, Martina zu gratulieren.« Er blickte an sich nieder auf die schmutzigen Stiefel, den bestaubten Rock. »In diesem Aufzug? Unmöglich, Kind!«
»Nun, du bist doch schnell umgezogen, und ich warte gern.« Er hatte aber keine Neigung dazu.
»Bertholds haben sich doch für den Vormittag Besuch verbeten, da heute abend so wie so großer Zauber ist.«
»Mit uns ist das doch etwas anderes: Martina wird sich sicher sehr freuen, wenn du mitkommst.«
»Es geht nicht, Beate! Hab’ es überdies Bünau und Malten versprochen, nachher schnell zu einer Besprechung ins Kasino zu kommen. Wir hatten heute morgen manchen Ärger: der Alte war mal wieder eklig geladen. Sag’ also deiner Freundin vorläufig meine herzlichsten Glückwünsche. Heute abend werde ich sie wiederholen.« Sein Blick vermied den ihren, und sichtlich strebte er fort.
»Ich will dich dann nicht weiter aufhalten. Du bist doch pünktlich zum Mittagessen wieder da? Hast du Bubi gesehen? Nein? Schade, er sah so lieb aus. Adieu, Rolf.« Flüchtig küßte er ihre Hand.
»Adieu, Beate.«
Sie streifte die zartfarbigen Handschuhe über, als sie durch den Garten nach der Pforte ging.
Immer Malten! Als ob es niemand anders mehr gäbe! Doch sie sagte gar nichts mehr darüber; denn Rolf nahm trotz ihrer Abneigung gegen diese Familie keine Rücksicht darauf; darum ließ sie ihn willfahren, wenngleich sie sich sehr wunderte.
Martina Berthold stand zufällig am Fenster, als sie die Freundin mit dem Kinde kommen sah. Sie eilte ihr entgegen; herzlich gratulierte Beate und nahm dann den kleinen Karl Friedrich aus dem Wagen. »Da, Tina, Bubi will dir auch Glück wünschen.«
»Du lieber, kleiner Kerl.« Frau Martina nahm ihn auf den Arm, und mit ihm tändelnd und scherzend schritt sie die Treppe hinauf nach dem Wohnzimmer. »Du kommst doch gleich mit hier in mein Reich, du mußt doch meinen Geburtstagstisch sehen; nun schnell deine Blumen ins Wasser tun, die köstlichen Rosen, und, was sehe ich? Bea, du mit dem Jungen? Das erste Bild von euch beiden! Du Böse, hast mir nichts gesagt, daß du beim Photographen warst.«
»Es sollte doch eine Überraschung sein.«
»Die dir glänzend gelungen ist! Und wie gut du getroffen bist! Vielen, vielen Dank! Eine größere Freude konntest du mir gar nicht machen! Denke, wenn mir auch solch Kleinod beschert wäre,« eine leise Wehmut klang aus ihrer Stimme, und verstohlen wischte sie sich eine Träne aus dem Auge.
Herzlich drückte ihr Beate die Hand; sie kannte den Schmerz der kinderlosen Frau; wie reich kam sie sich in diesem Augenblick vor gegen Martina, der sonst nichts zu wünschen übrig blieb vom Leben!
Fröhlich plauderten sie miteinander. Beate entschuldigte Rolf wegen seines Fernbleibens, da er im Kasino erwartet würde. Martina warf da einen eigentümlichen Blick auf die junge Frau; die sah ganz unbefangen aus, schien also nicht zu ahnen, in welcher Weise über Rolfs Verkehr bei Maltens gesprochen wurde. Es war jetzt hohe Zeit, daß Hauptmann Berthold einige ernste Worte als Kamerad zu dem jüngeren Kameraden sprechen und ihn auf das Unbedachte seiner Handlungsweise aufmerksam machen mußte, ehe Beate von anderer Seite erfuhr, daß er Viola Düsing in einer Weise huldigte, die für einen verheirateten Mann nicht passend war.
Mitten in ihr Plaudern hinein meldete das Mädchen: »Herr Professor Scharfenberg.«
»Bitten Sie Herrn Professor, sich sogleich nach oben zu bemühen.«
Martina ging dem Eintretenden entgegen, ihm beide Hände entgegenstreckend. »Herzlich willkommen, lieber Freund.« Nachdem er seine Glückwünsche dargebracht hatte, begrüßte er Beate, die er seit Monaten nicht gesehen. Sie hatte das Kind gerade auf dem Arm und drückte dessen Köpfchen süß beschwichtigend an ihre Brust; denn bei dem Eintritt der fremden Person wollte es anfangen zu weinen. Wehmütig ruhte sein Auge auf der heimlich geliebten Frau, die ihm so hold und weich in ihrer jungen Mutterwürde erschien.
»Nun, was sagen Sie, lieber Professor, zu dem kleinen Hagendorf? Habe ich Ihnen zu viel vorgeschwärmt? Sehen Sie sich ihn getrost in der Nähe an«, scherzte Martina arglos; denn sie ahnte ja nichts von dem, was diese beiden ihr so werten Menschen einst miteinander verbunden hatte. »Nehmen Sie ihn mal einen Moment, und Sie werden sehen, was für ein Prachtkerl er ist — da« — —
Ohne weiteres nahm sie ihn der hocherrötenden Beate vom Arm und gab ihn dem Professor. Der neigte sich tief über das Kinderköpfchen, damit man ihm das mächtige Gefühl nicht ansah, das ihn bewegte.
»Allerdings, Sie haben recht, liebe Freundin«, sagte er dann mit leicht bebender Stimme, und zu Beate: »Ich beglückwünsche Sie zu dem Kind, gnädige Frau.«
»Er hat mir bis jetzt auch — unberufen — noch keine Sorgen gemacht«, meinte sie, etwas befangen.
»Nun ja, wer eine wirkliche Doktorin als Mutter hat — Spaß! Die versteht doch alles aufs genaueste,« scherzte Martina.
Mittlerweile hatte er das Kind in den Wagen gelegt. Karl Friedrich war ganz zutraulich geworden. Mit den großen dunklen Augen — es waren die der Mutter — sah er zu dem fremden Mann auf und faßte nach dessen Uhrkette, die er nicht loslassen wollte.
Martina lachte. »Nein, liebster Professor, wenn Sie jemand so sähe!«
»Dann wäre es nicht das erstemal — die Kinder in meiner Klinik, und seien es die kleinsten, sie kennen mich alle.«
Beate wurde blaß. Sie vermied seinen Blick; denn sie wußte, sie fühlte es förmlich — er dachte jetzt dasselbe wie sie, daß sie ihm einst gesagt, wie es ihr Wunsch sei, ihm in seiner Klinik als getreue Helferin zur Seite zu stehen, und nun war doch alles anders gekommen! Sie war eine glänzende Offiziersdame geworden, die ihr Leben in geschäftigem Müßiggang verbrachte; daß aber ein solches Dasein der einst so tatenfrohen Beate zusagte, konnte er nicht recht begreifen.
Etwas hastig sagte sie da: »Es wird Zeit, daß ich gehe. Mein Mann ist sicher schon daheim und wartet auf seine unpünktliche Frau.«
Georgs Nähe brachte ihr Verwirrung; die alten Erinnerungen waren zu mächtig. Es dünkte sie Unrecht an dem Gatten, deshalb wollte sie fort.
»Bleibe doch noch einen Augenblick, Beate, du nimmst mir ja die Ruhe mit! Hagendorf wird noch nicht zu Hause sein.«
»Das glaube ich auch nicht, denn als ich auf dem Wege nach hier war, sah ich Herrn von Hagendorf mit den Maltenschen Damen gerade ins Promenadencafe gehen«, meinte Georg.
Die junge Frau verfärbte sich etwas. Also hatte Rolf sie belogen, und sie dadurch die Freundin; wie peinlich für sie, ein eisiges Gefühl durchrieselte ihre Adern. »Halte mich nicht mehr, Tina; ich komme heute abend dafür etwas früher. Karl Friedrich muß jetzt auch trinken; es ist seine Zeit.«
Sie reichte Scharfenberg zum Abschied die schlanke, kühle Hand, die leicht bebend in der seinen lag. »Auf Wiedersehen, Herr Professor, heute abend.«
»Sie hätten vielleicht lieber nicht sagen sollen, daß Sie Hagendorf mit den Maltenschen Damen gesehen haben —« bemerkte Martina nach Beates Weggang.
»Ja, mein Gott, warum nicht?« lautete seine erstaunte Frage.
»Wissen Sie nicht, ach nein, wir haben ja nie davon gesprochen, und der Klatsch ist Ihnen so fremd. Also — Hagendorf macht der Schwester Frau von Maltens in auffallender Weise den Hof und reitet täglich mit ihr aus. Frau Beate scheint davon nichts zu wissen, auch kein Wunder, denn sie geht kaum aus und lebt nur für ihr Kind. Kurz vorher, ehe Sie kamen, hatte sie den Gatten aus anderen Gründen entschuldigt.«
Er sprang auf. »Das ist mir aber peinlich, ganz außerordentlich peinlich,« rief er erregt aus.
»Nun, nun,« begütigte Martina, »so schlimm ist es ja nicht, was Sie verbrochen haben. Übrigens will mein Mann morgen oder übermorgen dem Hagendorf mal die Leviten lesen, daß er nicht zu sehr vergißt, was er seiner Frau schuldig ist. Ich möchte ihr jede Unannehmlichkeit ersparen; denn ich habe sie sehr lieb, sie ist eine prächtige Frau, diese Beate mit ihrem klugen, hochstrebenden, vornehmen Sinn. Doch zu wem sage ich das? Sie kennen sie ja von früher her, wissen das ebenso gut wie ich.«
Er bejahte durch ein Kopfnicken. Da sagte Martina Berthold in ihrer impulsiven Art: »Wissen Sie, lieber Freund, woran ich oftmals gedacht? Weshalb Sie und Frau Beate eigentlich kein Paar geworden sind!«
Er fuhr auf. Beschwichtigend legte sie ihre Hand auf seinen Arm. »Aber, lieber Professor, ist einem Freunde nicht ein offenes Wort gestattet? Wäre das denn so unnatürlich gewesen? Nachbarskinder, täglich beisammen, da kommt so etwas von selbst, und, offen gestanden, Sie hätten doch viel besser zu der geistvollen Frau gepaßt, als der im Grunde herzlich unbedeutende Hagendorf, der wohl ein schöner Mann ist, aber auch nichts weiter als das! Ich glaube, lieber Professor, da haben Sie über Ihren Büchern und Ihrem Wissensdrange ganz übersehen, daß aus dem Kinde, das Sie unterrichtet und belehrt haben, ein liebenswürdiges Weib geworden war. Vielleicht hätten Sie jetzt das trauliche Heim, das Ihr Wunsch ist, wie Sie immer sagen, wenn Sie sich eher dazugehalten hätten!«
Während ihrer halb neckenden, halb vorwurfsvollen Rede hatte er am Geburtstagstisch gestanden, die Photographie Beates mit ihrem Kinde in die Hand genommen und sie sinnend betrachtet. Bei Martinas letzten Worten wandte er sich hastig um. »Wissen Sie denn so genau, daß ich das nicht getan habe? Daß ich wirklich so blind war?« kam es halb erstickt aus seinem Munde, und er strich mit der Hand über die Stirn, wie um eine schmerzliche Erinnerung hinwegzuscheuchen.
»Um Gottes willen,« erschreckt heftete die Frau ihre klugen Augen auf sein tief erregtes Gesicht, »um Gott, verzeihen Sie, liebster Professor, wenn ich da in so wenig zarter, allein mir selbst unbewußter Weise an eine wunde Stelle in Ihrem Inneren gerührt habe.«
Er schüttelte trübe den Kopf. »Ich werde Ihnen ein andermal erzählen, Frau Martina, warum Ihr Freund ein einsamer Mann geblieben ist. Jetzt lassen Sie mich gehen!«
Die schlanke Frau legte ihre blassen, durchsichtigen Hände auf seine Schultern und sagte leise: »Jetzt begreife ich alles. Wer eine Beate geliebt hat, kann nach ihr so leicht keine andere finden.«
Er nickte; dann drückte er einen Kuß auf Martinas Hand und ging.
Teilnahmsvoll sah sie ihm nach. Jetzt war ihr so vieles klar, daß er keinen Besuch in Villa Hagendorf gemacht, sein sichtliches Fernhalten von der Familie mit der Begründung, daß ihm der junge Offizier nicht so viel Sympathie einflöße, um in ihm den Wunsch zu erwecken, mit ihm zu verkehren. Armer Mann! Er wollte sich nur nicht die unnütze Qual auferlegen, die Geliebte als die Frau des anderen zu sehen.
Aber daß Beate — sie schüttelte verwundert den Kopf. Welch seltsam Ding ist doch das Frauenherz!
Kurze Zeit danach kam Hauptmann Berthold nach Hause. Zärtlich umfing er seine Gattin. »Nun, mein liebes Geburtstagskind, du siehst so erregt aus, hast doch wohl Besuch gehabt?«
»O, nur Beate. Und dann kam auch noch Scharfenberg.«
»Das sind dir ja liebe Leute! Doch jetzt schnell mit meiner Neuigkeit vom Herzen, die dich sehr verwundern wird. Du mußt die Tischordnung umstoßen. Plessow hat mich soeben gebeten, ihm auf jeden Fall Fräulein Düsing als Tischdame zu geben. Er hat sich gestern mit ihr verlobt.«
»Gottlob, nun wird doch Hagendorf endlich zur Besinnung kommen,« sagte Martina mit wahrhaft erleichtertem Aufatmen, »ob er es schon weiß? Scharfenberg hat ihn vorhin erst mit ihr und der Malten im Promenadencafe gesehen.«
»Auf keinen Fall werden sie schon davon gesprochen haben, denn es soll eine große Überraschung für die Gesellschaft sein. Man hat geplant, daß bei uns die Verlobung bekannt gegeben werden soll, und zwar erst nach zwölf, also morgen; denn da feiern Maltens ihren siebenjährigen Hochzeitstag — aus diesem Grunde wollten sie warten, wie Plessow sagte.«
»Und auch besonders darum, weil Viola Düsing die Sensation liebt. Sie will selbst Zeuge von der Überraschung sein, die ihre Verlobung hervorrufen wird; sie will die erstaunten Gesichter aller sehen, besonders Hagendorfs, mit dem sie in unverantwortlicher, wirklich frivoler Weise kokettiert hat. Ich bewundere nur Plessow, wie er das so ruhig mit hat ansehen können.«
»Der gute Philipp! Übrigens ist er ganz unheimlich glücklich; er kann die Zeit kaum erwarten, bis die Düsing vor aller Welt seine Braut wird; er strahlte förmlich vor Seligkeit, als er mir die Mitteilung machte.«
»Möge es ihm nur gut bekommen! Von Herzen wünsche ich es ihm. Ich allerdings bin von diesem Zuwachs des Regiments nicht sonderlich erbaut. An einer Düsing haben wir gerade genug! Doch wollen wir nun sehen, wie wir die Plätze verteilen. Haffner sollte ursprünglich die Düsing führen. Er wird sehr enttäuscht sein! Und dann möchte ich dir auch etwas von unserem Professor sagen — nein, jetzt nicht, nach Tische — komm, Schatz.«
Sie nahm seinen Arm, und beide schritten nach dem schon festlich hergerichteten Speisesaal, um dort die gewünschte Änderung vorzunehmen.
Mit den widerstreitendsten Empfindungen war Beate Hagendorf nach Hause gekommen. Nichts war ihr peinlicher als das Bewußtsein, eine Lüge ausgesprochen zu haben, wenn sie auch selbst im guten Glauben geredet; was mußte Martina denken! Wie konnte Rolf ihr das antun! Alles wegen dieser Malten!
Einem Blitzstrahl gleich flammte da in ihr die Erkenntnis auf, daß Rolf sie schon mehrmals belogen, und ein Argwohn erfüllte sie, der ihrer vornehmen Seele bisher fremd gewesen war. Ihr Gatte hatte Heimlichkeiten hinter ihrem Rücken — er spielte falsches Spiel mit ihr. Dies und jenes fiel ihr ein, worüber sie sonst gar nicht nachgedacht, was sich aber zu einer Kette von Beweisen verdichtete; wie Schuppen fiel es jetzt von ihren Augen. Seine täglichen Spazierritte, sein häufiges Ausgehen, seine Launenhaftigkeit und Verdrossenheit gegen sie, alles das hatte einen tieferen Grund — und der war Viola Düsing! Jetzt war ihr alles klar.
Ein bitteres Lächeln zuckte um ihren Mund; sie empfand aber gar keinen Schmerz darüber, und daran fühlte sie, daß ihr Gatte ihr vollkommen gleichgültig war. War sie aber besser als er? Fast scheu sah sie sich um, als habe jemand ihr diese Worte laut zugerufen. Nein, sie war nicht besser, gab sie sich in grausamer Selbsterkenntnis zur Antwort; denn auch sie liebte einen andern! Aber sie kämpfte wenigstens ehrlich gegen diese Liebe, die kein Sinnenrausch war, sondern nur die Erkenntnis, daß sie von Anbeginn zu dem andern gehörte, denn sie war Geist von seinem Geist: gleiche Gedanken wie er hegte auch sie — ihre Seelen waren wahlverwandt und wunderbar auf einen Akkord gestimmt. Und sie selbst hatte in törichter Verblendung diese Harmonie zerrissen — und nun war es zu spät zum Glück für sie.
Diese Selbsterkenntnis ließ sie Rolfs Verhalten milder beurteilen; sie war ja auch schuldig, aber die Unwahrheit durfte er nicht sprechen; denn nichts haßte und verachtete sie mehr als die Lüge, die sie als Verteidigungsmittel feiger, kleinlicher Seelen verdammte.
Rolf war natürlich noch nicht zu Hause. Lange hatte sie mit dem Essen warten müssen, bis er mit vom Wein geröteten Gesicht endlich erschien. »’n bißchen lange geworden, Beate. Du weißt, Plessow ist ein Sumpfhuhn, ebenso wie Bünau und Malten; man kann kein Ende finden, will auch nicht gleich aufstehen, um nicht in den Verdacht zu kommen, daß man unter dem Pantoffel steht,« suchte er sein spätes Heimkommen zu entschuldigen.
Beate war über diese offenbare Lüge empört. »Warum sagst du mir eigentlich nicht die Wahrheit, Rolf?« Groß und ruhig blickte sie ihn dabei an.
»Was fällt dir ein, an meinen Worten zu zweifeln?« rief er heftig, »wenn ich dir sage, daß ich bis jetzt mit den Kameraden im Kasino war, so muß dir das genügen! Im übrigen habe ich nicht nötig, dir über mein Tun und Treiben Rechenschaft abzulegen. Fange nur so an, dann ist es recht.«
»Das verlange ich gar nicht. Sage dann aber lieber nichts, als daß du mich belügst. Denn ich weiß, daß du nicht im Kasino warst, sondern im Promenadencafe mit Frau von Malten und ihrer Schwester.«
Er biß sich auf die Lippen und zerrte nervös an seinem Schnurrbart. »Ah, du hast mir nachspioniert?« lachte er gezwungen auf, »weshalb fragst du erst, wenn du es doch schon weißt? Das ist ja niedlich, daß man wie ein Schuljunge auf Schritt und Tritt bewacht wird. Du bist wohl gar eifersüchtig, meine Teure?«
Da richtete sie sich zu ihrer vollen Größe auf und ein stolzer Blick flammte über ihn hin. — »Nein! Und auf eine Viola Düsing am allerwenigsten,« sagte sie kalt.
»Du scheinst sehr hoch von dir zu denken, daß du einen Vergleich mit ihr wagen willst,« entgegnete er hohnvoll.
»Oder vielleicht auch von meinem Gatten, daß er sich nicht zum Gegenstand ihrer berechnenden Koketterie machen läßt.«
Klar und groß ruhten ihre Augen auf ihm; er konnte deren Blick nicht erwidern, sondern starrte ingrimmig vor sich hin. Sie legte die Hand auf seine Schulter. »Rolf, ich bitte dich um deinetwillen, ziehe dich von Maltens zurück, ehe du dich zum Gespött machst.«
Beate hatte sich aber doch in ihren Worten vergriffen. Er schleuderte ihre Hand zurück. — »Was fällt dir ein?« rief er heftig in tief verletzter Eitelkeit. »Willst du mich schulmeistern? Ich sage dir, damit hast du kein Glück! Wissen möchte ich aber doch, wer dich auf einmal so gut unterrichtet hat!«
»Dein auffallend intimer Verkehr mit Maltens, trotz meiner Abneigung, hat mir stets zu denken gegeben. Und daß du dich hinter Unwahrheiten verschanzest, gibt mir die Gewißheit, daß dein Gewissen nicht rein ist! — Weshalb gestandest du mir nicht zu, daß du im Promenadencafe warst, überhaupt Absicht hattest, dahin zu gehen? Dann wäre mir das peinliche Bewußtsein erspart geblieben, bei Martina dein Fernbleiben mit einer Unwahrheit zu entschuldigen.«
»Ah, und dort hast du auch erfahren —«
»Ja, allerdings.«
»Und von wem, wenn ich fragen darf?«
Sie zögerte einen Augenblick mit der Antwort; dann sagte sie ruhig: »Professor Scharfenberg hat dich gesehen; er kam ebenfalls zum Gratulieren.«
Da lachte er auf, ein böses, höhnisches Lachen. »Ah, der famose Professor! Der allerdings wird eine besondere Freude gehabt haben, dir das mitzuteilen!«
»Inwiefern?« erstaunt sah sie ihn an.
»Na, tue nur nicht so, Beate! Der »geistvolle, kluge Mann« versteht dich ja viel besser als dein simpler Gatte. Ihr seid beide sehr schlau, daß ihr euch bei deiner gefälligen Freundin so ungestörte Stelldicheins gebt — hahaha — in der Tat, sehr bequem.«
Sie wurde leichenblaß. »Pfui, Rolf! Komme doch zu dir! Ein weiteres Wort habe ich nicht — denn mir scheint, daß du — betrunken bist, und mit solchen Leuten rechtet man nicht.«
Damit stand sie vom Tisch auf und ging hinaus, ohne ihren Gatten eines Blickes zu würdigen.
Sie sah ihn erst wieder, als sie zu Bertholds fuhren. Am liebsten wäre sie zu Haus geblieben; aber Martinas wegen, deren Geburtstagsfeier sie nicht fernbleiben konnte, mußte sie sich bezwingen, wenngleich sie sich sehr elend fühlte. Rolfs Worte hatten das Heiligste in ihr besudelt, in den Staub gezogen, und ihr war, als könne sie niemals wieder freundlich zu ihm sein. Und ihm war sehr unbehaglich zu Mute, während er neben seiner Frau im Wagen Platz nahm. Ihr blasses, kühles Gesicht veränderte sich nicht, als er eine Unterhaltung anfangen wollte; es blieb genau so steinern und unbeweglich wie heut Mittag, als sie das Zimmer verlassen hatte.
Teufel, er hatte sich doch wohl zu sehr hinreißen lassen mit seinen Worten, die ihm im Grunde gar nicht ernst gewesen waren. Aber ihre Art hatte ihn gereizt, daß er nicht überlegte, was er sagte, und außerdem hatte Viola ihn mit ihrem Übermut gequält, gepeinigt und auf seine gelehrte »Frau Dr. med.« gestichelt, daß er ganz aus dem Gleichgewicht gebracht war. Er meinte, das rotblonde Mädchen zu hassen und fieberte doch darnach, sie wieder zu sehen. Ihre Gegenwart schien ihm Lebensbedürfnis, und freudig strahlten seine Augen auf, als er sie in Bertholds Salon erblickte — Maltens waren schon da.
Wie raffiniert sie wieder angezogen war, eine schwarze, tief ausgeschnittene Chiffontoilette, die einen wirkungsvollen Gegensatz zu der leuchtenden Haarfarbe und dem blendenden Nacken bildete — berückend sah sie aus! In ihrer temperamentvollen Art hatte sie einen Kreis von Herren um sich geschart, von denen sie sich auf Tod und Leben den Hof machen ließ, und als man bei Tische saß, klang mehr als einmal ihr lautes, vergnügtes Lachen durch den festlichen Raum. Sie trug überhaupt ein sehr siegesbewußtes, übermütiges Wesen zur Schau.
Zu Rolfs Verwunderung war ihr Tischherr der lange Philipp Plessow, mit dem sie sehr vertraut tat; beide sahen sich tief in die Augen, wenn sie miteinander anstießen, und lächelten sich in auffallender Weise an.
Martina Berthold hatte für Leutnant Hagendorf den Platz so gewählt, daß er Viola Düsing gar nicht oder nur sehr schlecht sehen konnte, womit sie ihm eine Qual auferlegt hatte. Er vernachlässigte seine Tischdame fast bis zur Unhöflichkeit, was aber Professor Scharfenberg, der zu ihrer Rechten saß, in etwas gut zu machen suchte — um Beates willen! Denn er sah ihr an, daß sie sich mit etwas quälte; ihm entging so leicht keine Veränderung in dem geliebten Antlitz. Heimlich bewunderte er sie. Sie sah so anmutig, fast mädchenhaft in dem weißen Kleid aus, und im stillen verglich er ihre keusche Schönheit mit der so aufdringlich wirkenden der andern.
Beate beobachtete den Gatten, der ihr schräg gegenüber saß; sie sah, wie ihn die innerliche Ungeduld fast verzehrte, sah, wie er vergebens einen Blick mit Viola auszutauschen versuchte und bemerkte auch das erleichterte Aufatmen Rolfs, als endlich die Tafel aufgehoben wurde. Während er Viola »Mahlzeit« wünschte, sah er ihr bei seinem feurigen Handkuß in die Augen.
»Mein gnädiges Fräulein, ich beklage mich sehr über die Grausamkeit, daß Ihr entzückender Anblick mir bis jetzt entzogen wurde.«
»Warum beklagen Sie sich da bei mir? Ich kann nichts dafür — das lag doch an der Tischordnung,« entgegnete sie etwas schnippisch. Er wollte darauf erwidern; aber in diesem Augenblick trat der lange Plessow zu ihnen. Mit verliebtem Blick sah der auf Viola und schob seinen Arm unter den ihrigen. »Will meine holde Tischdame mir etwa untreu werden? Das gibts nicht!«
Rolf war wütend. Was fiel dem Kerl ein — diese Dreistigkeit gegen Viola! Er hatte wohl gar schon zu viel getrunken? Unmutig schlenderte er umher. Dabei sah er, wie der Kommandeur lange mit Beate sprach und wie dessen wetterharte scharfe Gesichtszüge sich zu einem wohlwollenden Lächeln verzogen.
Nachher sagte der zu ihm, ihn wohlwollend auf die Schulter klopfend: »Wissen Sie, Hagendorf, um Ihre gelehrte Frau sind Sie wirklich zu beneiden — Sie sind ein wahrer Glückspilz! Kann’s sonst nicht leiden, wenn die Weiber gar so gescheit sind — ’s ist nicht mein Fall — sind sie aber nebenbei so hübsch und interessant wie Ihre kleine liebe Frau, dann drückt man gerne beide Augen zu bei so vieler Gelehrsamkeit.«
Rolf klappte die Hacken zusammen und verneigte sich, einige dankende Worte murmelnd.
Da sah er Viola Düsing in der Tür stehen. Sie blickte gerade zu ihm hin — er vermeinte, darin eine direkte Aufforderung zu lesen, ihr zu folgen. Man hatte sich in den eleganten, künstlerisch ausgestatteten, lichtdurchfluteten Räumen zerstreut. Die Damen saßen plaudernd im Salon, die Herren bei dem jetzt gereichten Bier im Rauch- und Spielzimmer, und so konnte Hagendorf dem jungen Mädchen folgen, ohne daß es auffiel. Ihr Tischherr, Plessow, war jetzt vom Kommandeur in Beschlag genommen, der anscheinend sehr gute Laune hatte — gemütlich unterhielt er sich mit dem langen Oberleutnant und lachte wiederholt. Für eine Weile war also Viola von der lästigen Gegenwart ihres Tischherrn befreit, und diese Spanne Zeit wollte Rolf nützen.
Er fand das junge Mädchen im Wohnzimmer der Hausfrau. Viola stand an dem Tisch, auf dem die Geburtstagsgeschenke Martinas aufgebaut waren, und hielt eine Photographie in ihren Händen. Sie hörte ihn eintreten. Bei dem Geräusch wandte sie sich um. — »Ah, Sie, Herr von Hagendorf, mein Gott, wie haben Sie mich erschreckt.«
Sie waren allein. Das Zimmer war nur schwach erhellt und durchflutet von süßem Blumenduft. Es lag im ersten Stockwerk und gehörte nicht mit zu den Gesellschaftsräumen, die sich im Erdgeschoß befanden. Er trat auf sie zu, und sie empfand einen prickelnden Reiz, mit ihm hier zusammen zu sein.
»Wie haben Sie sich hierher verirrt?«
»Ich wollte Sie sprechen, Viola.«
»Das können Sie doch unten ebenso gut! Ich wollte mir Frau Bertholds Geburtstagstisch ansehen und entdeckte darauf — raten Sie — das Bild Ihres Jungen, ich finde es wunderhübsch! Ihre Frau »Doktor« ist ebenfalls gut getroffen — und Karl Friedrich ist einzig, wie sind Sie aber nur auf den feierlichen Namen gekommen? — Rolf wäre doch viel hübscher gewesen! Ich bin dem Kinde wirklich gut,« plauderte sie unbefangen mit ihm.
Da faßte er ihre Hand mit seinen heißen, bebenden Fingern. »Viola, viel glücklicher würde es mich machen, wenn Sie seinem Vater auch gut wären — ein klein wenig.«
Sie bog den blonden Kopf zurück und sah ihn mit einem seltsamen Blick aus den halbgeschlossenen Augen an.
»Was hätte das wohl für Zweck, Herr von Hagendorf?«
»Fragen Sie doch nicht, Viola, ich denke nicht, ich weiß nur, daß ich Sie liebe, Sie anbete«, flüsterte er leidenschaftlich. »Sie haben mich ganz toll gemacht.«
Sie lächelte — jetzt hatte sie das Bekenntnis seiner Liebe, nach dem sie verlangt — sie hatte den elegantesten Offizier des ganzen Regiments zu ihren Füßen gezwungen, und ein triumphierendes Gefühl erfüllte sie. Wenn seine hochmütige Frau das ahnte! Sie würde nicht mehr so herablassend auf das junge Mädchen blicken, das keine große Gelehrsamkeit, aber was mehr ist, Schönheit aufweisen konnte!
Alle diese Gedanken flogen durch ihren Kopf, als sie abwehrend sagte: »Herr von Hagendorf, ich darf Sie nicht hören, nein —« und doch lauschte sie seinem heißen Werben; sie duldete, daß er seinen Arm um ihre Taille legte und blickte ihn an, süß und verheißend, ihm dadurch das letzte Restchen Besinnung raubend. Wild preßte er sie an sich.
»Viola, holdes, berauschendes Mädchen —« und seine Lippen suchten ihren Mund in heißem Kusse, den sie ihm ebenso zurückgab. Da überschüttete er sie mit seinen Liebkosungen.
»Nein, nein, lassen Sie mich —« es war, als erwache sie aus ihrer Selbstvergessenheit — sie suchte sich jetzt aus seinen Armen zu befreien, doch er umschlang sie fester. Sie stemmte ihre Hände gegen seine Brust.
»Noch einmal sage ich, lassen Sie mich, oder ich rufe.«
Die Situation würde sonst noch gefährlich für sie, — nun war es genug — ihr Triumphgefühl war gesättigt, ihre Macht genügend erprobt! Da hörte sie jetzt auch Schritte und sah, wie die Tür sich öffnete.
»Ist denn niemand, der mich von dem Wahnwitzigen befreit?« rief sie halblaut, daß die soeben Eintretenden es hören mußten.
In diesem Augenblick erkannte sie in ihnen Malten und Plessow. Mit einem letzten Kraftaufwand stieß sie Rolf zurück und flog auf die beiden zu, die wie erstarrt dastanden.
Violas Augen füllten sich mit Tränen, und ihr Atem ging heftig. »Was ist das?« fragte Plessow herrisch.
Malten schwieg; er sah seine Schwägerin nur mit einem eigentümlichen Blick an. Da er sie sehr genau kannte, wußte er sich die Sachlage recht gut zusammenzureimen.
»Nun, Herr von Hagendorf, weshalb bleiben Sie mir die Antwort schuldig?«
»Und ich frage Sie, Herr von Plessow, mit welchem Recht Sie sich in meine Angelegenheiten mischen.«
Rolf war auf das äußerste durch die herausfordernde Art des andern gereizt. Die Adern schwollen dick an auf seiner Stirn. Er biß die Zähne zusammen und ballte die Hände. Der reichlich genossene, schwere Wein machte sich bei beiden geltend, und dazu kam noch die gegenseitige Abneigung.
Plessow lächelte höhnisch. »Erstens mit dem Recht, jeder von einem Aufdringlichen belästigten Dame zu Hilfe zu kommen —«
»Herr —« fuhr da Hagendorf auf. »Sie werden unverschämt.« Er hatte alle Besinnung verloren und machte eine Bewegung, als wolle er sich auf den andern losstürzen.
»Meine Herren, ich bitte — um Gotteswillen,« rief Malten aufs höchste erschrocken aus, indem er zwischen die beiden trat — »Mäßigung!«
Aber es war zu spät. Plessow sagte kalt: »Sie werden mir für Ihre Worte Genugtuung geben.« Zustimmend, mit kurzer, knapper Verbeugung verneigte sich Rolf. Ehe er aber etwas sagen konnte, fuhr der andere fort:
— »Und zweitens habe ich doch wohl das Recht, meine — Braut gegen Sie zu schützen.« Dabei legte er seinen Arm um das Mädchen.
Wie vom Blitz getroffen stand Rolf da. Er war kreidebleich geworden, und seine Züge hatten sich förmlich verzerrt, zu jäh und niederschmetternd war ihm die Eröffnung gekommen. Er warf einen langen, unbeschreiblichen Blick auf Viola. Ein neugieriges, grausames Lächeln spielte um ihren üppigen Mund, und in ihren Augen glitzerte ein kaltes Licht, während sie sich an ihren Verlobten lehnte und mit den roten Nelken an ihrem Kleide spielte. Sie hatte jetzt ihre Sensation!
»Ich werde meinen Schwager, Herrn Oberleutnant Haßler, beauftragen, das Weitere zu verhandeln. Ich stehe jederzeit und in jeder Weise zu Diensten.«
Er hatte seine Selbstbeherrschung wiedergefunden. Stolz richtete er sich auf, grüßte steif und ging festen Schrittes hinaus, ohne Viola noch eines Blickes zu würdigen.
Mit leichtem Vorwurf in der Stimme wandte sich da Malten zu ihr. »Wir haben dich schon überall gesucht, Viola! Es ist gleich zwölf Uhr. Eure Verlobung soll jetzt bekannt gegeben werden, und zwar will der Kommandeur das selbst tun — und die Hauptperson fehlt!«
Er war sehr erregt über den vorangegangenen Auftritt, der aber die beiden andern gar nicht weiter zu rühren schien. Wie ein Schmeichelkätzchen schmiegte sich Viola an den Verlobten, um ihn schnell darüber wegzubringen. Sie wollte unnütze Fragen vermeiden, und der lange Plessow war zu verliebt, um von ihrer Zärtlichkeit nicht beglückt zu sein.
Unmutig entgegnete sie ihrem Schwager: »Hat dir denn Ilse nicht gesagt, daß ich mir Frau Bertholds Geburtstagstisch ansehen wollte? Sie war doch mit oben — und ich war eben im Begriff zu gehen, als Hagendorf kam. Ich kann doch nichts dafür —«, auf keinen Fall durfte es den Anschein haben, als ob ihr Zusammensein mit Hagendorf doch nicht ganz so zufällig war.
»Er soll es mir büßen, daß er dich in solcher Weise belästigt hat,« sagte Plessow ingrimmig. »Längst hat es mich verdrossen, daß er wie dein Schatten war. Ich werde ihm einen gehörigen Denkzettel geben. Nun komm, damit unser Fernbleiben nicht auffällt.« Er zog ihren Arm durch den seinen und sie begaben sich zu der Gesellschaft zurück, ohne daß sie nur ein Wort der Angst und Sorge äußerte, wie das Duell wohl für den Verlobten ausfallen würde.
Wie vorauszusehen war, hatte das Bekanntgeben der Verlobung Viola Düsings mit Philipp v. Plessow ungeheures Aufsehen erregt. Lächelnd stand das Brautpaar da und nahm die Glückwünsche der Anwesenden entgegen. Unwillkürlich mußte Beate zu dem Gatten hinübersehen, der mit düster glühenden Augen dastand, und sie bemerkte, daß viele das gleiche taten.
Wie mußte seine Eitelkeit leiden unter dem Gaffen der Menge, die um seine Vorliebe für jenes kokette, kaltherzige Mädchen gewußt, das nun so siegessicher seinen letzten Trumpf ausgespielt, ihn damit wirklich dem spöttischen Mitleid der anderen preisgebend! Und das große Erbarmen ihrer echten, edlen Weibesnatur erwachte. Sie vergaß, was er ihr angetan, sie fühlte nur, daß ein längeres Verweilen für ihn unerhörte Qual bedeuten mußte, wenn es auch klüger war. Aber so wurde geredet und so auch; da blieb es sich schließlich gleich.
Sobald es möglich war, verließen sie unauffällig die Gesellschaft, und Martina hielt sie auch nicht zurück, es war ihr selbst lieber so.
Rolf war seiner Frau von Herzen dankbar, daß sie ihm die Gelegenheit dazu gegeben, ihm in ihrer feinfühligen, verstehenden Art entgegenkam. Ihre Worte über Viola fielen ihm ein. Wie hatte sie recht in ihrem Urteil gehabt, und eine tiefe Scham erfüllte ihn, daß er um ein solches Geschöpf sein hochherziges Weib vernachlässigte, und die Erkenntnis tauchte in ihm auf, spät genug freilich, was er in seinem Leichtsinn aufgegeben.
In plötzlicher Aufwallung küßte er die Hand seiner Frau. »Beate, ich danke dir,« sagte er gepreßt.
»Warum? ein guter Kamerad soll dem andern immer helfen.«
»Auch wenn der ein schlechter war?« fragte er leise.
»Ja, immer!« sagte sie einfach. Aber ihre Stimme klang traurig, und ihre Augen blickten trübe vor sich hin.
Ein trüber Novembertag. Es wollte nicht hell werden; grau und undurchdringlich hing der Himmel über der herbstlichen Erde, und ein feuchter Nebel ging nieder. Es war ein Wetter zum Traurigwerden, das sensible Naturen drückte und ängstigte.
Beate fröstelte. Ein unbestimmtes Gefühl der Angst und Sorge erfüllte sie; eine innere Unrast trieb sie von einem Zimmer ins andere, kaum, daß sie bei ihrem Kinde Ruhe fand. Sie konnte sich diesen Zustand nicht erklären, der ihr sonst fremd war. Vielleicht ließen die Ereignisse der letzten Tage sie so nervös sein.
»Herr Oberleutnant Haßler!« meldete der Diener, sie im Kinderzimmer aufsuchend. Verwundert blickte sie auf und ging ins Wohnzimmer, in dem der Bruder ihrer harrte. Er stand am Fenster und hatte ihr den Rücken zugedreht.
»Guten Morgen, Adolf. Was führt dich so früh schon zu mir?«
Langsam wandte er sich ihr zu, und sie blickte in ein tiefernstes Männerangesicht, aus dem jede Spur fröhlichen Humors hinweggewischt war. »Morgen, Bea!« Und er preßte fast heftig ihre Hand.
»Adolf!« rief sie da erschreckt, »du siehst aus wie jemand, der nichts Gutes bringt.«
»Du hast recht,« sagte er leise.
Ihr Herz begann heftig zu klopfen. Sie drückte beide Hände darauf und holte tief Atem. »Was? Was — ist’s? Etwas mit den Eltern? Nein? Dann mit Rolf? Schnell, schnell!«
Er faßte teilnehmend ihre Hand. »Fasse dich, Bea, sei stark! Man bringt dir deinen Gatten — verwundet ins Haus.«
»Verwundet? Wie kam das?« Dann in plötzlichem Verstehen: »Im Duell verwundet?«
Adolf nickte.
»Aber mit wem denn? Um Gottes willen!«
Angstvoll hingen ihre Augen an seinen Lippen.
»Mit Plessow.«
»Und um die Düsing?«
»Um die Düsing!«
Beate stöhnte auf. Daher auch sein verändertes weiches Wesen gestern, das sie an die erste Zeit ihrer jungen Ehe erinnerte!
»Man wird ihn sogleich bringen; ich bin vorausgeeilt. — Mut, meine starke Schwester!«
»Er ist tot!« schrie sie da auf. »Verhehle mir nichts!«
»Nein, nein, Beate, aber schwer verwundet. So hat es Plessow doch nicht gewollt.«
Sie raffte sich auf, und mit Adolfs Hilfe richtete sie schnell das Nötigste her zum Empfange des Kranken. Der Wagen hielt, der ihn brachte. Ganz behutsam trug man Rolf ins Haus und legte ihn auf sein Bett.
Er hatte die Augen geschlossen und röchelte leise. Mit Jammer im Herzen sah Beate auf den todwunden Gatten und beobachtete den Arzt, der sich um ihn bemühte. »Kann ich Ihnen helfen?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, nichts. Wenn wir nur die Kugel finden könnten.«
Sein Gesicht war tiefernst. Er wußte es, daß keine Hoffnung war, den Verwundeten am Leben zu erhalten, und auch Beate sah mit ihrem geübten Auge, daß er auf den Tod darniederlag. Für sie gab es nicht die tröstende Ungewißheit, es kann doch noch besser werden — ein Wunder kann kommen, sie mußte der grausamen Gewißheit ins Auge sehen: seine Stunden sind gezählt! Denn dieser Schuß durch die Brust mußte durchaus tödlich sein. Und sie konnte ihm nur noch sein Sterben erleichtern.
Fast übermenschlich bezwang sie sich. Klagen und Weinen hatten keinen Zweck. Die Augen brannten ihr von zurückgehaltenen Tränen, und das Mitleid, den so lebensvollen Mann so vor sich zu sehen, ein Bild des Jammers, drohte ihr das Herz zu brechen. Mit linder Hand schaffte sie ihm die Erleichterungen, die er noch haben konnte. Sie wischte ihm den Schweiß von der Stirn und achtete angstvoll auf jede Bewegung.
Der Stabsarzt sah, daß er hier überflüssig war. Sein Patient war ja in den besten Händen. »Ich gehe, gnädige Frau. Sollten Sie mich nötig haben, dann telephonieren Sie, bitte,« sagte er leise.
»Sie wissen doch genau, Herr Doktor, daß das nicht mehr der Fall sein wird.«
Ihre Stimme klang seltsam heiser und tonlos.
Er konnte nichts darauf erwidern, sondern drückte ihr nur stumm die Hand. Sie wich nicht von dem Lager des todwunden Mannes. Lange, bange Stunden vergingen. Sie sah die Veränderung in seinem Gesicht, wie die Schatten des Todes darüber fielen. Da öffnete er die Augen, und sie las darin wiederkehrendes Bewußtsein.
»Ich bin bei dir, Rolf. Kennst du mich, — deine Bea?« flüsterte sie mit weicher Stimme, die schon so vielen Kranken Beruhigung gebracht hatte.
Seine Lippen suchten einige Worte zu formen, sie neigte sich über ihn und hauchte einen Kuß auf seine Stirn. »Mein lieber Mann!« Wie der Schein eines Lächelns flog es über sein Gesicht; dankbar und groß blickte er sie noch einmal an, dann fielen die Lider wieder schwer über seine Augen.
Eine Stunde noch — und dann war alles vorbei. Weinend lag Beate an der Brust des Bruders, der im Nebenzimmer still gewartet.
Die Spannung der letzten Stunden legte sich jetzt in einem heftigen Weinkrampf, ihre Nerven versagten. Adolf ließ sie sich ausweinen, damit sie Erleichterung bekam. Mit sanften Worten suchte er die ihm so teure Schwester zu trösten. Er selbst stand tief erschüttert an dem Sterbelager seines liebsten Freundes und Schwagers, dessen junges Leben einem tückischen Verhängnis zum Opfer gefallen war — und der Laune eines koketten Weibes.
Beate hatte den Abschiedsbrief des Gatten gelesen, in dem er sie um Verzeihung für alles Ungemach gebeten und ihr zugleich für das gedankt, was sie ihm gewesen; jetzt, vielleicht an der Schwelle des Todes stehend, erkenne er alles und sehe, wie er in törichter Verblendung gefehlt. In rührenden Worten hatte er geschrieben, und sie war tief ergriffen davon. Sie kniete an seinem Bette, und ihr blonder Kopf lag auf seinen erkalteten Händen.
Was in ihr vorging, war unbeschreiblich. Sie wußte jetzt den Zusammenhang, aber vergab ihm alles, ohne Bitterkeit im Herzen. Mit seinem Tod hatte er gesühnt. Sie hätte wer weiß was gegeben, wäre es ihr gelungen, ihn dem Leben zu erhalten, das er so sehr geliebt. Nun hatte er die sonnigen Augen für immer geschlossen, und er hatte sie so früh zur Witwe gemacht, und ihr blieb nichts als ihr Sohn.
Mehr als zwei Jahre waren vergangen. Beate von Hagendorf hatte in dieser Zeit ganz zurückgezogen gelebt und sich nur ihrem Kinde gewidmet, an dem sie mit abgöttischer Liebe hing. Der kleine Karl Friedrich war ein bildhübscher Junge geworden; er sah seinem Vater sehr ähnlich. Martina Berthold verzog ihn auf die erdenklichste Weise, so daß Beate manchmal schelten mußte. Der Verkehr der beiden Frauen miteinander hatte noch an Innigkeit zugenommen, und selten verging ein Tag, an dem sie sich nicht sahen.
Viola Düsing war seit einem Jahr verheiratet. Plessow sowohl als auch Malten waren aber versetzt, nachdem ersterer seine Festungshaft abgebüßt hatte. Die beiden Damen waren wenig im Regiment beliebt; dazu kam noch der unglückselige Zwischenfall mit Hagendorf, dessen tragisches Geschick die allgemeinste, wärmste Teilnahme hervorgerufen — genug, es war ihnen selbst ungemütlich geworden, so daß sie um Versetzung eingekommen waren.
Martina suchte die junge Witwe langsam dem Leben zurückzugewinnen. Beate hatte den Gatten tief und innig betrauert; aber diese Trauer war jetzt einer stillen Wehmut gewichen; und sie kam den Bestrebungen der Freundin entgegen. Sie lehnte deren Einladung nicht mehr ab, wenn sie wußte, daß Gäste bei Bertholds waren. Ihr lebhafter Geist brauchte Anregung, die sie in jenem auserwählten Kreise in reichstem Maße fand. Sie gehörte jetzt mit zum Vorstand des Frauenvereins und hatte reichlich Gelegenheit, ihre werktätige Menschenliebe auszuüben. Allmählich war es gekommen, daß sie regelmäßig den Jugendfreund bei Bertholds traf, wenn sie die Mittwoch- und Sonntagabende dort zubrachte. Sie hatte sich daran gewöhnt und war ihm nicht mehr wie im Anfang scheu ausgewichen. Offen gestand sie sich sogar ein, daß sie sich freute. Er war von einer zarten Rücksichtnahme gegen sie, die sie tief rührte, und ihr Gefühl sagte ihr ganz richtig, daß er sie noch mit derselben Zuneigung wie früher liebte — er war eben beständig und treu!
Längst wußte ja Martina von Georg um seine früheren Beziehungen zu Beate, die aber, sonst nicht verschlossen, sich über diesen Punkt nie zur Freundin geäußert. Und Martina erwähnte auch nicht, daß sie etwas wußte; sie tat vollkommen arglos, um der Freundin nicht die Unbefangenheit zu rauben; sie wollte die zarten Fäden, die sich da unter ihren Augen anspannen, nicht zerstören. Kommt Zeit, kommt Rat, dachte die kluge Frau.
Es war Mittwoch abend — der Abend, an dem Beate und Georg Scharfenberg stets Gäste bei Bertholds waren. Der Professor war etwas enttäuscht, und man sah ihm das auch an, daß er Beate heute nicht traf. »Ja, lieber Freund,« sagte Martina lächelnd, die seinen suchenden Blick aufgefangen hatte, »ja, Sie müssen heute abend mit unserer Gesellschaft fürlieb nehmen; Frau Beate hat abgesagt.«
»Aber warum?« —
»Der Junge ist nicht wohl, und Sie wissen, sie ist sehr ängstlich. Er habe etwas Fieber, ließ sie sagen. Ich will morgen früh gleich nach ihm sehen.«
»Hoffentlich ist’s nichts Ernstliches. Frau von Hagendorf versteht ja als Dr. med. die Sache zu beurteilen,« lächelte er.
Nachdem man gegessen, begab man sich in das Wohnzimmer der Hausfrau, wie es sonst auch immer der Fall war. Es war aber, als fehle den dreien etwas, und schließlich sprach der Hauptmann das auch aus. »Weiß Gott, wie man sich an einen Menschen gewöhnen kann; ich vermisse wirklich Frau Beate, wir vier gehören einmal zusammen,« und seine Gattin stimmte ihm zu.
Der Professor saß stumm da und blickte gedankenvoll in die Glut des Kaminfeuers. Langsam strich er den sorgfältig gepflegten Bart, und unwillkürlich seufzte er ein wenig auf. »O, lieber Freund, das kam aber weit her — und ich wette, daß ich auch weiß, wohin es ging,« scherzte Berthold.
Georg errötete etwas.
»Nun? Doch sicher zu einer gewissen blonden Frau, die —«
»O nicht doch, Berthold.«
»Na, na, warum denn streiten, was wir längst wissen«, meinte er begütigend, »und warum sollen wir nicht davon sprechen, woran wir doch denken! Wäre es denn nicht das Gescheiteste, Sie heirateten, und zwar jene Frau, die uns allen heute so fehlt? Und für Sie ist es höchste Zeit, daß Sie heiraten; denn immer können Sie sich schließlich doch nicht an fremder Leute Kamine wärmen, womit ich aber durchaus nicht gesagt haben will, daß Sie uns etwa nicht mehr willkommen wären. Ich spreche nur in Ihrem Interesse; Sie müssen mich richtig verstehen, eigener Herd ist Goldes wert.«
Der Professor war aufgesprungen, und ging erregt im Zimmer auf und ab. Unablässig glitt seine Hand durch den Bart. Endlich blieb er vor den beiden stehen. »Berthold, lieber Freund, das alles habe ich mir schon hundertmal überlegt, aber wenn es nun wieder nichts ist — was dann?«
»Ach was, wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Und diesmal — ich wette — wird Frau Beate nicht wieder auf ihrem Trotzkopf beharren.«
»Mein Mann hat vollkommen recht, lieber Professor; nicht verzagt und kleinmütig sein! Zögern Sie nicht zu lange, sich Ihr Glück zu sichern. Keine andere paßt so gut zu Ihnen, wie Beate. Und sie sieht Sie gern und hört gern von Ihnen sprechen, das will ich Ihnen verraten. Sie hat in ihrer Ehe eine große Enttäuschung erlebt; es war nicht alles, wie es sein sollte. Wenn sie auch nie zu mir davon gesprochen hat, so weiß ich es dennoch,« so sagte die warmherzige Frau, ihm Mut und Vertrauen zusprechend.
Längst hatte er sich ja mit dem Gedanken getragen, um Beate zu werben, aber eine gewisse Scheu hatte ihn noch zurückgehalten; sie war ihm gegenüber stets von einer zu gleichmäßigen Freundlichkeit! Er hatte ihr auch einen Besuch gemacht und war sehr liebenswürdig aufgenommen worden; aber er glaubte die Wärme zu vermissen, die auf mehr als nur freundschaftliche Gefühle schließen läßt. Georg konnte ja nicht ahnen, daß sie seiner in Liebe und Sehnsucht gedachte, daß sie auf das erlösende Wort von ihm wartete, und so war er in einem Zwiespalt der Gedanken, der ihm manche schlaflose Nacht verursachte.
Gleich am anderen Morgen erkundigte sich Martina Berthold nach dem Befinden des kleinen Karl Friedrich. »Er gefällt mir gar nicht, Tina«, entgegnete Beate gedrückt, »die ganze Nacht habe ich bei ihm gewacht. Er fieberte stark und war sehr unruhig. Ich fürchte sehr — Diphtheritis.«
Martina tröstete, so gut es ihr möglich war; aber sie konnte die eigene Besorgnis nicht verbergen, als sie das Kind sah, das sie mit den großen, fieberglänzenden Augen so verständnislos anblickte. Als sie gegen Abend wiederkam, teilte ihr Beate mit, ihre Befürchtung sei eingetroffen — Karl Friedrich habe Diphtheritis.
Nun folgte eine schwere Zeit für Beate. Sie rieb sich fast auf in der Sorge um den Knaben, in dem Kampfe mit der tückischen Krankheit. Treu hielt Martina zu ihr; sie litt mit der Freundin und konnte es nicht mehr mit ansehen, wie sie sich aufopferte. »Du mußt noch einen Arzt nehmen — es geht so nicht weiter.«
»Er kann auch nichts anderes tun, als was ich tue! Es ist ja nur ein leichter Fall, aber doch sorge ich mich! Wieviel schlimm diphtheriekranke Kinder habe ich schon behandelt.«
»Aber nicht ein eigenes! Man ist doch ein schlechter Arzt, wenn die Muttergefühle in Betracht kommen! Und ich sage dir, der Professor kommt her«, bestimmte Tina kategorisch, »es ist nicht Mangel an Vertrauen zu deinen Kenntnissen, sondern Mitleid mit dir. Mein Mann will es auch. Wenn du uns nicht böse machen willst, bist du gehorsam.«
Und Beate war es auch. Sie war so müde von der Sorge und dem Herzeleid, wie sie ihr blühendes Kind so leiden sehen mußte.
Der Professor kam. Nach der Untersuchung des Knaben sagte er: »Ich kann Ihre Anordnungen nur gutheißen; mir bleibt nichts zu tun, gnädige Frau.«
»Ich darf Sie aber dennoch bitten, wiederzukommen; ich bin um vieles ruhiger, Herr Professor,« fügte sie leise, mit niedergeschlagenen Augen, hinzu. In tiefem Mitleid ruhten seine Blicke auf dem schmalen, blassen Frauengesicht, das so deutlich die Spuren durchwachter Nächte und banger Sorge trug. »Sie machen mich glücklich mit dieser Bitte — selbstverständlich werde ich Ihrem Wunsche nachkommen.«
Die leichte Besserung in Karl Friedrichs Befinden, die eingetreten war, hielt nicht lange an. Nach wenigen Tagen mußte Beate eine Verschlimmerung feststellen; das Kind kämpfte mit den heftigsten Erstickungsanfällen. Angstvoll telephonierte sie dem Professor, der sofort kam. Mit ernstem Gesicht hatte er die Untersuchung beendet. »Es bleibt uns nichts anderes übrig, als den Luftröhrenschnitt zu machen,« sagte er leise.
Sie erbleichte tief bei seinen Worten, und heiße Tränen drängten sich in ihre Augen. Aber sie bezwang sich; sie mußte ja tapfer sein, sein getreuer Assistent, wie er es verlangte. — — — —
Die Operation war glücklich verlaufen und Karl Friedrich gerettet; aber an seinem Bette saß jetzt eine Pflegeschwester. Beate hatte auf dringendes Anraten des Professors auch an sich denken müssen; ihre Kräfte waren vollständig erschöpft; sie war am Zusammenbrechen, so daß sie die Pflege des Kindes nicht mehr allein tragen konnte. Außerdem war nach menschlicher Voraussicht die Gefahr für den Knaben vorüber; so konnte sie sich wenigstens die langentbehrte Nachtruhe gönnen.
Gewissenhaft befolgte sie die Anordnungen, die Professor Scharfenberg ihr gab. Er kam noch fast täglich in ihr Haus, um nach seinen beiden Patienten zu sehen, und er konnte sehr energisch und bestimmt sein, wenn man nicht ganz gehorsam gewesen war. Das Kind hatte ihn schnell lieb gewonnen und freute sich, wenn der »Onkel Doktor« kam. Mit wehmütigen Gefühlen betrachtete Beate den Professor, wenn er so liebevolle Töne für Karl Friedrich fand und so kindlich mit ihm zu reden wußte. Ja, das war ganz der alte, treuherzige Georg, ihr geduldiger, stets hilfsbereiter Jugendfreund — und mehr als je erstand die vergangene Zeit vor ihr.
Sie konnte es sich nicht mehr verhehlen, daß sie auf sein Kommen wartete und glücklich darüber war, wenn sie ihn sah und seine beruhigende Stimme hörte! Und für ihn war es eine Feierstunde, wenn er bei Beate sein durfte. Er sah sie in ihrem hausfraulichen Walten, lernte sie in ihrer ganzen reichen Gemütstiefe kennen, und immer heißer wurde der Wunsch in ihm, sie die Seine zu nennen — die alte Jugendliebe schlug in hellen Flammen empor, nun kein Hindernis mehr war. — —
Manche Stunde verplauderte er bei ihr. Und jetzt konnte sie auch unbefangen von der früheren Zeit mit ihm reden, sie hatten ja so viele gemeinsame Berührungspunkte. Sie erzählte ihm von ihren Studienjahren, von ihrer Tätigkeit, ihrem Fleiß und gab ihm auch ihre Doktordissertation zu lesen, deren klare, lichtvolle Durcharbeitung er aus ehrlichem Herzen loben konnte, worüber sie sehr erfreut war. Und zuletzt sprach sie von ihrer Stellung als Assistenzärztin am Krankenhause in D., die sie mit vollster Befriedigung erfüllt habe. — —
»Und haben sie dennoch so leicht aufgegeben, um zu heiraten! Verzeihung, Beate, doch ich muß es Ihnen sagen, wie sehr ich damals über Ihre Verlobung verwundert war. Sie hatten mir damit sehr, sehr wehe getan,« fügte er leise hinzu. Sie errötete tief und neigte den Kopf auf die feine Stickerei, die sie in den Händen hielt. Wußte er denn, daß es ihr so leicht geworden, dem geliebten Beruf zu entsagen? Er konnte nicht wissen, wieviele Tränen es sie gekostet, mit welchem schweren Herzen sie in die Ehe getreten war! Konnte sie ihm denn sagen, daß es nur war, weil sie ihn gebunden glaubte? Daß da dem Ärger und dem Trotz über das Vergessensein ein flüchtiger Zufall zu Hilfe gekommen und sie einem anderen in die Arme getrieben hatte? — Er wartete auf Antwort.
Glücklicherweise wurde sie dem überhoben, denn Karl Friedrich klopfte sehr vernehmlich an die Tür, die ihm Georg öffnete. »Na, du kleiner Mann,« scherzte er, »bist du dem Fräulein wieder davongelaufen? Du siehst mir ganz so aus.« Liebevoll hatte er sich zu ihm geneigt. Da schlang Karl Friedrich seine Ärmchen um Georgs Hals. »Ja, Bubi will beim guten Onkel Doktor bleiben.«
Der hob ihn hoch empor und setzte ihn dann auf seine Knie. Beate sah lächelnd auf die beiden. Nach bescheidenem Anklopfen trat da das Kinderfräulein ein. »Gnädige Frau, ist Karl Friedrich hier? Er ist mir davongelaufen.«
»Das höre ich nicht gern, Bubi! Aber dennoch wollen wir ihm heute mal verzeihen.«
»Aber er hat seine Milch nicht trinken wollen!« warf das Fräulein ein.
Beates lächelnde Miene wurde ernsthaft. »Das ist allerdings schlimm! Wenn du nicht gehorsam bist und deine Milch sofort trinkst, darfst du nicht bei Onkel Doktor bleiben, Bubi! Geh sofort mit Fräulein. Onkel Doktor und Mutti mögen nur artige Kinder leiden.«
An der Mutter Gesicht sah der kleine Kerl, daß es nicht ratsam war, zu widersprechen. Betrübt, aber gehorsam trabte er mit dem Fräulein ab, doch nicht, ohne vorher wichtig zu versichern: »Bubi kommt aber gleich wieder.«
Lächelnd blickten ihm beide nach, und Beates Gesicht war förmlich vom Mutterglück verklärt. »Ein prächtiger Knabe,« sagte er, »und so gehorsam.«
»Ja, so klein er noch ist, merkt er doch, daß es Widerspruch bei mir nicht gibt,« entgegnete sie. »Wie froh bin ich, daß ich ihn so gesund wieder habe! Was hätte aus mir werden sollen, wenn ich ihn hätte hingeben müssen — mein Einziges, mein Kleinod« — und in einer leidenschaftlichen Aufwallung des Dankes streckte sie ihm beide Hände entgegen. »Ach, Georg, wie soll ich Ihnen das jemals danken können, daß Sie ihn mir neu geschenkt haben.«
Er sprang auf und faßte die schönen schlanken Hände fest mit den seinigen. Mit heißer Zärtlichkeit in seinen guten, klugen Augen sah er sie an, und bebend vor innerer Erregung sagte er: »Dadurch, Beate, daß Sie mir vergönnen, diese beiden Hände immer zu halten — für ein ganzes, reiches Leben!« Einen Augenblick war ihr, als stocke ihr der Herzschlag — hatte sie denn recht gehört?
Unter Lachen und Weinen stammelte sie: »Willst du mich denn noch?«
»Beate!« Wie ein Jubelschrei klang das. In tiefer Inbrunst küßte er erst die eine, dann die andere Hand, »Dank dir tausendmal! Du willst, Geliebte —«
»Ja, ich will, Georg! Ich will gutmachen, was ich einst an dir, du Guter, Treuer, gefehlt, mein ganzes Leben soll es dir zeigen, ich will dein guter Kamerad und dein seliges Weib sein,« sagte sie mit feierlicher Innigkeit.
»Und meine Frau Doktor,« setzte er leise lächelnd hinzu, »den Titel nicht von mir geschenkt, nein, vorher schon selbst erworben durch fleißige, ehrliche Arbeit.« Dann zog er sie fest an sich; sie legte die Arme um seinen Hals und lehnte den blonden Kopf an seine Brust — ein wonniges Gefühl des Geborgenseins erfüllte sie — »mein Georg, du Lieber, Getreuer«, flüsterte sie.
In innigem Kusse schloß er ihr da den Mund. »Meine Bea, mein geliebtes, heißersehntes Weib!«
So standen sie selige Minuten in dem Bewußtsein, sich nun doch für alle Zeit anzugehören! Das Trübe in ihrem Leben war ausgelöscht, und glückverheißend lag jetzt die Zukunft vor ihnen.
Ein Zusammenschaffen und Zusammenarbeiten mit dem geliebten Menschen — das Leben mit segensreicher Tätigkeit ausfüllen, von dem anderen Teil bis ins kleinste verstanden — was kann es denn Schöneres geben?
Und das Herz war ihnen voll heißen Dankgefühls, daß der Allmächtige ihr Geschick so wunderbar gelenkt und doch noch zu dem geführt hatte, was für sie beide das rechte Glück war.
Ende.
Vom Bearbeiter durchgeführte Korrekturen
Im Original wurden Versalumlaute uneinheitlich gehandhabt und nur zum Teil als »Ae«, »Oe« und »Ue« gedruckt. Diese sind hier als »Ä«, »Ö« und »Ü« wiedergegeben. Bei der Kapitelnumerierung wurde der teilweise fehlende Punkt ergänzt, die Kapitelnummern 7 bis 9 wurden wegen der im Original übersprungenen Nummer 6 durch 6 bis 8 ersetzt. Desweiteren wurden folgende Korrekturen vorgenommen:
Seite 13, "Ofenschirn" geändert in "Ofenschirm" (»dort in jener Ecke hinter dem Ofenschirm haben wir so oft gesessen)
Seite 37, Komma hinzugefügt (»Dann lebe wohl, Beate!)
Seite 37, Leerzeichen vor "—" hinzugefügt (und von jetzt an für sich allein bleiben — in angestrengter Arbeit)
Seite 38, "«" hinzugefügt (»niemand kann zween Herren dienen«, — entweder also die Wissenschaft oder die Liebe,)
Seite 43, "«" hinzugefügt (»Mädel, Bea, ich freue mich kolossal, dich wiederzusehen, und in deiner Würde als »FräuleinDoktor!«« —)
Seite 45, ".." geändert in "..." (»Na, und ob, Herr Ad..., Herr Oberleutnant«)
Seite 47, "ihr" ersetzt durch "Ihr" (»— Ihr habt doch gewiß auch gehört,« bemerkte da Adolf,)
Seite 57, "»" hinzugefügt (»Da hab’ ich Sie nun in Ihrem Vorhaben)
Seite 74, "«" am Ende der indirekten Rede entfernt (der sie, offen gesagt, solch’ hausfrauliches Talent gar nicht zugetraut habe.)
Seite 75, "." hinzugefügt (Gespräche hörte. Sie konnte sich aber nicht)
Seite 78, "ihre" ersetzt durch "ihr" (und das verlieh ihr eine gewisse Freudigkeit)
Seite 85, "umsympathisch" ersetzt durch "unsympathisch" (Aber gerade Frau von Malten ist mir direkt unsympathisch.)
Seite 93, "«" am Satzende entfernt (Vergaß das junge Mädchen so ganz seine gute Erziehung, um in einer solchen Weise einem Herrn entgegenzukommen?)
Seite 94, "tiefem" geändert in "tiefen" (und ihre Brust hob sich in tiefen Atemzügen)
Seite 114, "." hinzugefügt (meldete das Mädchen: »Herr Professor Scharfenberg.«)
Seite 118, "aus" ersetzt durch "auf" (legte sie ihre Hand auf seinen Arm.)
Seite 123, "ihr" ersetzt durch "Ihr" (der ihrer vornehmen Seele bisher fremd gewesen war. Ihr Gatte hatte)
Seite 158, "entgegnen" ersetzt durch "entgegen" (streckte sie ihm beide Hände entgegen.)