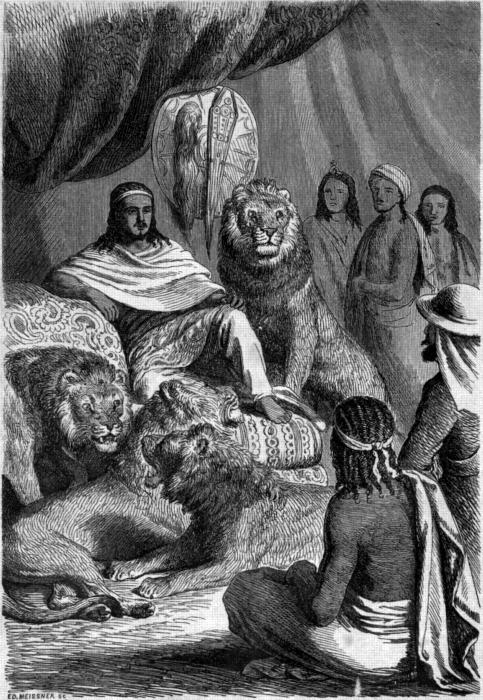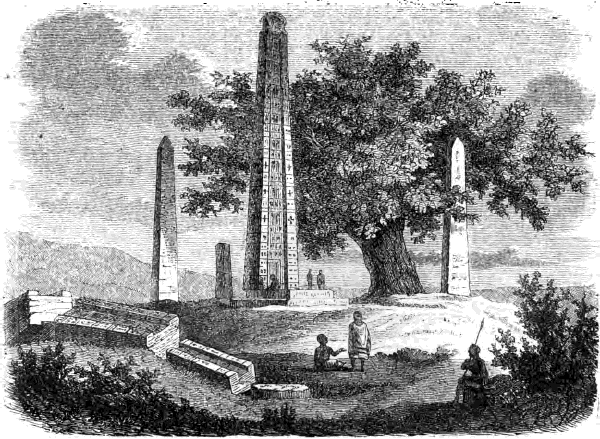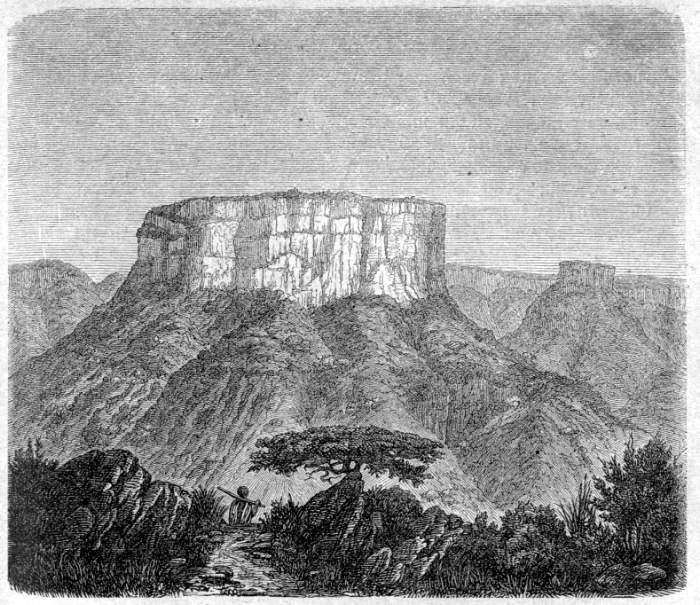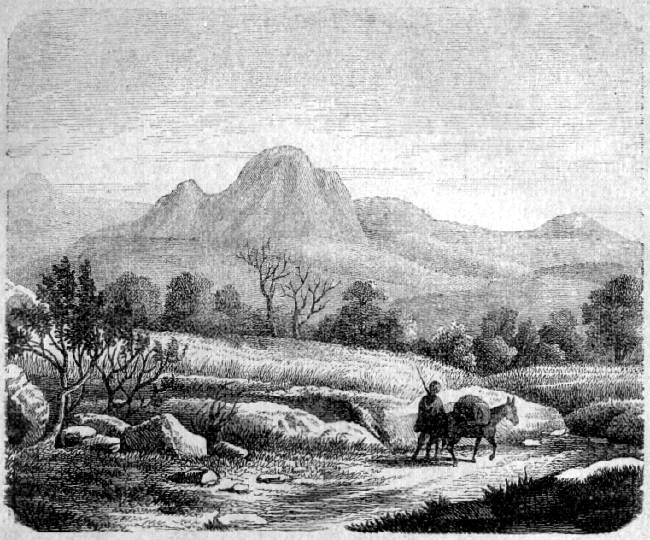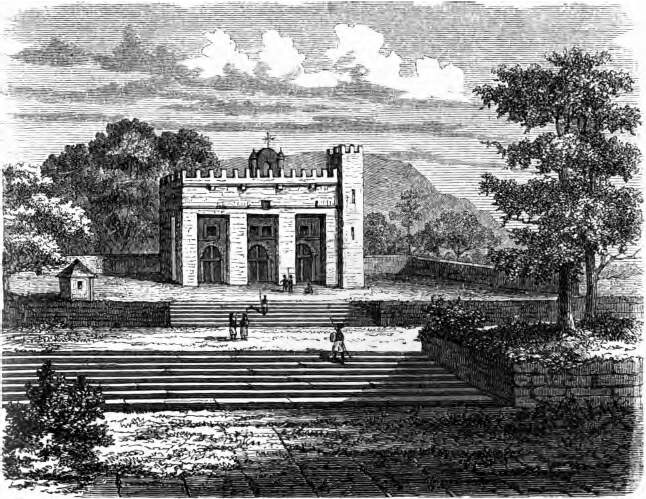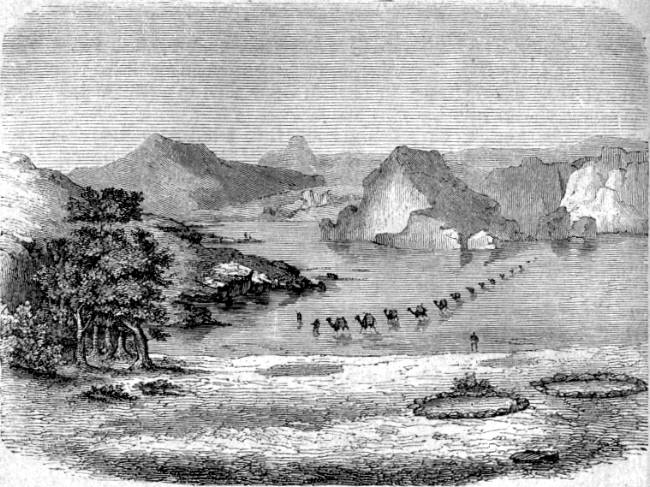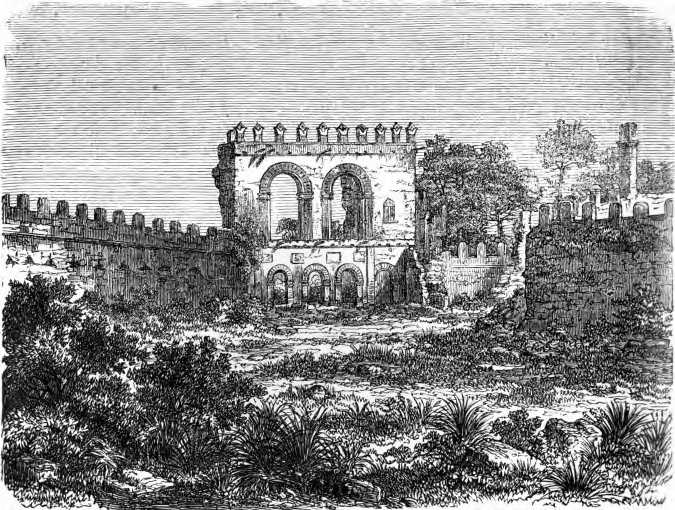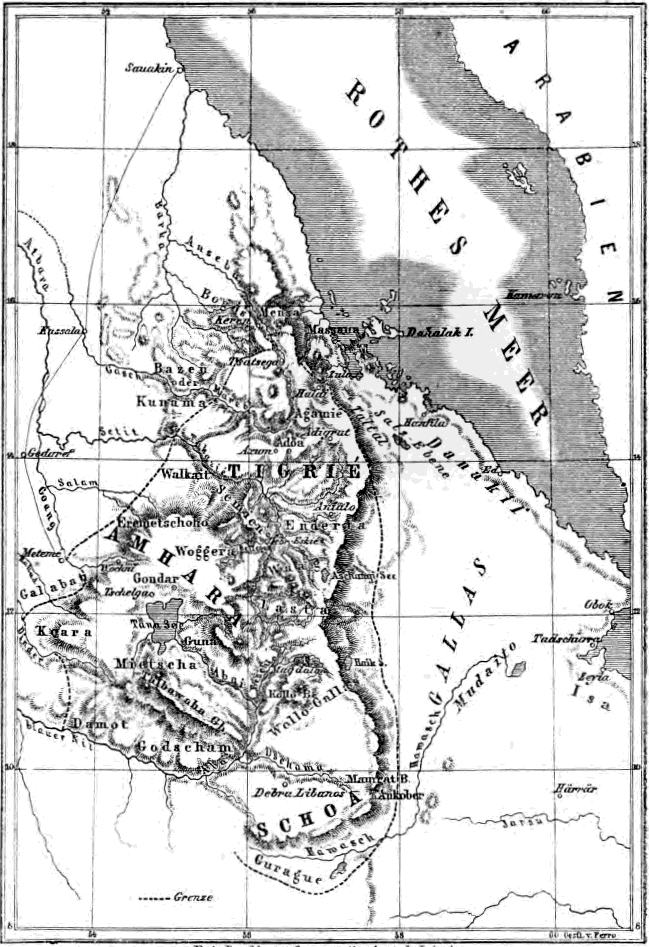The Project Gutenberg EBook of Abessinien, das Alpenland unter den Tropen und seine Grenzländer by Richard Andree
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license
Title: Abessinien, das Alpenland unter den Tropen und seine Grenzländer Author: Richard Andree Release Date: January 7, 2010 [Ebook #30883] Language: German Character set encoding: UTF-8 ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ABESSINIEN, DAS ALPENLAND UNTER DEN TROPEN UND SEINE GRENZLÄNDER***
Das
Buch der Reisen und Entdeckungen.
Afrika.
Abessinien,
das Alpenland unter den Tropen.
Malerische Feierstunden.
Das Buch der Reisen und Entdeckungen.
Neue illustrirte
Bibliothek der Länder- und Völkerkunde
zur
Erweiterung der Kenntniß der Fremde.
Afrika.
Abessinien, das Alpenland unter den Tropen.
Bearbeitet
von
Dr. Richard Andree.
Mit 80 in den Text gedruckten Abbildungen, sechs Tonbildern, sowie einer
Uebersichtskarte von Abessinien
Leipzig.
Verlag von Otto Spamer.
1869.
das Alpenland unter den Tropen
und
seine Grenzländer.
Schilderungen von Land und Volk vornehmlich unter
König Theodoros (1855–1868).
Mit 80 Text-Abbildungen, 6 Tonbildern nach Originalzeichnungen von E. Zander, R. Kretschmer, H. Leutemann u. A. nebst einer Uebersichtskarte von Abessinien.
Leipzig.
Verlag von Otto Spamer.
1869.
Verfasser und Verleger behalten sich das Recht der Uebersetzung vor.
Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.
Vorwort.
Ein afrikanisches Alpenland, überreich an Schönheiten und Wundern der Natur, bewohnt von einem begabten Volke, das gleich uns zum kaukasischen Stamme gehört und mit den Negern nichts zu schaffen hat, eine an fesselnden Abenteuern reiche Folge von Reisen in dieses Land, endlich der Feldzug Englands gegen den eisernen, blutigen Theodor, der mächtig über Abessinien geherrscht, wie noch kein dunkelfarbiger König vor ihm – das ist es, was wir in diesem Bande des „Buches der Reisen und Entdeckungen“ den Lesern vorführen wollen.
Abessinien hat von jeher der gebildeten Welt ein großes Interesse eingeflößt und nicht etwa erst die neueste romantische Episode seiner Geschichte uns diese „unter die Tropen gerückte Schweiz“ näher geführt. Dort, in der muthmaßlichen Heimat des schwarzhäutigen der durch die Bibel eingeführten heiligen drei Könige, besteht ja noch, abgeschieden und vergessen von den abendländischen Glaubensgenossen, inmitten heidnischer und muhamedanischer Völker, ein christliches Reich; dorthin verlegte das Mittelalter auch den Staat des fabelhaften Erzpriesters Johannes, dort entspannen sich Glaubenskämpfe gegen den Islam, die an Heftigkeit und blutigen Greueln ihresgleichen suchen, dort mühten sich endlich unsere Missionäre bis in die neueste Zeit erfolglos ab, die Bevölkerung zu einem reineren Glauben zurückzuführen. Staatsumwälzungen, Bürgerkriege folgen im bunten Wechsel einander.
So erhebt sich vor unserem geistigen Blicke auf dem farbenreichen Hintergrund, den die Natur bietet, ein interessantes geschichtliches Bild, beginnend mit der sagenhaften Königin von Saba, endigend mit dem blutigen Theodor, [pg VI]und fesselt unser Interesse an denselben afrikanischen Boden, der, wenn man von Aegypten und den durch die Araber begründeten Reichen absieht, im Grunde eine eigentliche Geschichte nicht hat.
Nachdem der Verfasser die Erforschung Abessiniens von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage herab geschildert hat, führt er in den ersten vier Abschnitten Land und Leute in einem gedrängten Bilde vor, alles Wesentliche zusammenfassend, was über Geologie und Oberflächengestaltung, über die natürlichen Felsenfestungen und periodisch anschwellenden Ströme, jene Grundursache der Nilüberschwemmungen, was über die klimatischen Verhältnisse und die Vegetationsgürtel, über die Thierwelt jenes interessanten Gebietes gesagt werden kann. Dabei wandert das Volk an uns vorüber mit seinen guten Anlagen und seinem tiefen sittlichen Verfall, seinen verschiedenen Stämmen und Sprachen, Sitten und Gebräuchen. Handel und Industrie finden gleichfalls gebührende Berücksichtigung, nicht minder die religiösen Verhältnisse, das afrikanisch gefärbte Christenthum des Landes mit seiner byzantinischen Scheinrechtgläubigkeit und lasterhaften Priesterschaft. Die Missionsgeschichte, reich an Enttäuschungen und arm an Erfolgen, wird unparteiisch berichtet und dann mit einer Abhandlung über den Landbau und die sozialen Verhältnisse des Landes der allgemeine Theil beschlossen.
Nachdem der Leser dergestalt orientirt ist, kann er an der Hand der neuesten Reisenden das weite Land durchwandern; er lernt den Norden wie den Süden kennen, die brennendheißen Küstenstriche und die fieberschwangere, feuchte Kollaregion, hinauf bis zu den schneegekrönten, majestätischen Alpengipfeln.
Geleitet von solchen Forschern, deren Schilderungen zu den farbenprächtigsten gehören, die wir über jene fernen Gegenden besitzen, gewinnt der Leser alsobald die vorgeführten Persönlichkeiten um so lieber, je fesselnder deren oft überaus romantische Fahrten sind. Während die älteren Reisenden bereits früher besprochen waren, bieten wir in diesem Abschnitte einen Einblick in das verdienstvolle Wirken der neueren Ländererforscher. Wir lernen den geistreichen und kühnen Franzosen Guillaume Lejean kennen, durchstreifen an der Hand Werner Munzinger’s und der Gefährten des Herzogs Ernst von Sachsen-Koburg die nördlichen Grenzgebiete, die Länder der Bogos und Kunama, begleiten den deutschen Fürsten selbst auf seinen Pürschgängen und [pg VII]Elefantenjagden und werden schließlich durch den englischen Major W. Cornwallis Harris in die fast märchenhaft erscheinende Welt von Schoa, diesen südlichen Theil Abessiniens, eingeführt, wo in malerischen Einzelschilderungen das Hof- und Kriegsleben des Negus Sahela Selassié an uns vorübergeht.
Naturgemäß gipfeln die Mittheilungen in der Darstellung des heutigen Abessinien. Verfallen und zerrissen durch nimmer ruhende Bürgerkriege, zuckend und verblutend liegt es da. Wüst liegen die fruchtbaren Aecker und das geplagte Volk verkommt: da scheint ein Hoffnungsstrahl aufzudämmern! Gleich einem glänzenden Meteor steigt der mächtige Theodor, der Sohn einer armen Kussohändlerin, am abessinischen Himmel auf. Noch einmal scheint es, als ob das altäthiopische Reich aus seinen Trümmern, aus Schutt und Moder wieder erstehen wolle. Doch der Glanz trügt, und nach Tagen blutiger Schrecken sinkt unter der überlegenen Macht der „rothhaarigen Barbaren“ auch der afrikanische Napoleon dahin, mit ihm sein Reich. Indessen nicht blos Schatten wirft die Regierungsgeschichte dieses unzweifelhaft bedeutenden Mannes; es sind Lichtpunkte genug in derselben zu finden, und der Verfasser hat sich bemüht, Licht und Schatten in gerechter Würdigung der Schwierigkeiten, die sich einem Reformator in der Eigenartigkeit von Land und Menschen jener fernen Gegenden entgegenstellen, billig zu vertheilen.
Was die Quellen, aus denen das vorliegende Buch geschöpft, betrifft, so wurde von Hiob Ludolf an bis auf Th. von Heuglin, sowie die Berichte der englischen Korrespondenten herab keine wichtige Publikation übersehen. Außer den angeführten Reisenden, deren Berichte im Auszuge wiedergegeben sind, wurden hauptsächlich James Bruce, Henry Salt, Eduard Rüppell, Karl Wilhelm Isenberg, Ludwig Krapf und (für den zoologischen Theil) A. E. Brehm benutzt.
Als ganz besonders werthvoll müssen wir die Originalabhandlung über die Agrikultur Abessiniens von Eduard Zander hier hervorheben. – Das Leben dieses deutschen Landsmannes haben wir im Texte geschildert. Für die Erlaubniß zur Veröffentlichung der genannten Arbeit ist der Herausgeber Sr. Hoheit dem Herzoge Leopold Friedrich von Anhalt, in dessen Besitze sich das Original-Manuskript befindet, zu tiefgefühltem Danke verpflichtet. Die Kundgebung dieser zu Magdala im Jahre 1859 verfaßten Arbeit erfolgt [pg VIII]hier, mit Weglassung einer allgemeinen Einleitung, vollständig. Da jedoch unserm wackern Landsmanne nach längerer Abwesenheit vom Heimatlande der flüssige Gebrauch der deutschen Sprache abhanden gekommen war, so erschienen stylistische Aenderungen in seiner Darstellung unerläßlich, wie denn auch die Schreibart der Eigennamen mit der in vorliegendem Werke befolgten in Uebereinstimmung gebracht werden mußte.
In der Orthographie abessinischer Namen herrscht bekanntlich die größte Anarchie, ganz entsprechend jener, welche das Land zerrüttet; um ihr womöglich zu entgehen, schloß sich der Verfasser in seiner Rechtschreibung an diejenigen deutschen Reisenden an, welche von allen die meiste Uebereinstimmung zeigen und diesen Gegenstand am eifrigsten ihrer Aufmerksamkeit gewürdigt haben, nämlich K. W. Isenberg und Th. von Heuglin.
Zur ganz besonderen Freude gereicht es uns, mittheilen zu können, daß der bei Weitem größere Theil der Illustrationen dieses Werkes nach an Ort und Stelle aufgenommenen Originalen gezeichnet ist. Zwei Künstler, die das Land bereisten, haben dieselben geliefert: Robert Kretschmer, der den Herzog von Koburg als Maler begleitete, und Eduard Zander, dessen werthvolle Federzeichnungen, weit über hundert an der Zahl, die landschaftlichen, architektonischen und ethnographischen Verhältnisse Abessiniens ungemein gut charakterisiren. Sie befinden sich gleichfalls im Besitze Sr. Hoheit des Herzogs von Anhalt und werden hier, mit dessen hoher Erlaubniß, als wesentlicher Schmuck unsres Buches, wiedergegeben. Die übrigen Illustrationen, bei denen die Quelle stets angegeben ist, wurden den Werken von H. Salt, E. Rüppell, W. C. Harris, Bernatz, G. Lejean u. a. entlehnt. Schon in dem uns hier entgegentretenden Reichthum an gelungenen Holzschnitten ist uns ein vollständiges Bild des afrikanischen Alpenlandes geliefert, das in keinem hier in Betracht kommenden andern Werke reicher illustrirt zur Anschauung kommen dürfte. Das am Schlusse mitgetheilte Kärtchen endlich wird zur allgemeinen Orientirung über das besprochene Gebiet willkommen geheißen werden.
Inhaltsverzeichniß.
| Seite | ||
| Einleitung. Historischer Ueberblick und Geschichte der Erforschung Abessiniens. Mit 11 Illustrationen | 1 | |
| Aethiops (2). – Die Königin von Saba (3). – Menilek und die salomonische Dynastie (3). Berührungen mit den Völkern des Alterthums (4). – Die Königsstadt Axum und ihre Ruinen (5). – Einführung des Christenthums (6). – Wechsel der Dynastie (8). – Die Invasion der Muhamedaner unter Granje (10). – Portugiesen und Jesuiten in Abessinien (11). – Ihre Vertreibung (12). – Zerfall des Reiches und Bürgerkriege (13). – Die Verfassung (18). – Erforschungsgeschichte (19). – Portugiesische Reisende (20). – Hiob Ludolf (21). – Bruce (22). – Salt und Pearce (23). – Hemprich und Ehrenberg (23). – Rüppell (23). – Tamisier und Combes (26). – v. Katte (26). – Schimper (26). – Aubert und Dufey (27). – Lefêbvre (27). – Gebrüder d’Abbadie (27). – Rochet d’Héricourt (28). – Beke (29). – Zander (30). – Sapeto (32). – Munzinger (32). – Lejean (33). – Die deutsche Expedition (33). | ||
| Das Land, seine Pflanzen- und Thierwelt. Mit 14 Illustrationen | 35 | |
| Begrenzung (35). – Das Hochland (36). – Geologie Abessiniens (36). – Der versteinerte Wald (39). – Heiße Quellen (40). – Oberflächengestaltung (40). – Natürliche Felsenfestungen (42). – Die Alpen Semiéns (42). – Charakter der Flüsse (46). – Ihr Anschwellen (46). – Ursachen der Nilüberschwemmungen (47). – Der Tanasee und der Abai (47). – Klimatische Verhältnisse (50). – Die Vegetationsgürtel (51). – Kola (51). – Woina Deka (56). – Deka (61). – Die niederen Thiere (62). – Vögel (65). – Säugethiere. Ihre Lebensweise, Nutzanwendung, Jagd (71). | ||
| Das Volk, seine Sitten und Gebräuche, Handel und Industrie. Mit 9 Illustrationen | 85 | |
| Physischer Charakter des Volks (85). – Die Juden oder Falaschas (86). – Muhamedaner (87). – Gamanten (88). – Heidnische Ueberreste (90). – Waito (90). – Die Sprachen Abessiniens (90). – Literatur und Malerei (93). – Charakter und Sittenlosigkeit der Abessinier (94). – Blutrache (95). – Justiz (96). – Aberglauben (97). – Das Verzehren von rohem Fleische (100). – Nahrungsweise (102). – Kleidung (103). – Krankheiten und Aerzte (103). – Industrie und Handel (106). | ||
| Religion, Kirche und Geistlichkeit. Das Missionswesen. Mit 8 Illustrationen | 111 | |
| Das Christenthum Abessiniens, dessen Lehren und Verwahrlosung (111). – Der Abuna (114). – Art des Gottesdienstes (120). – Die lasterhafte Geistlichkeit (122). – Mönche und Klöster (122). – Politische Asyle (123). – Zeitrechnung (123). – Feste (123). – Taufe, Ehe, Begräbniß (124). – Die Kirchen, ihre Einrichtung und Ausschmückung (126). – Die verschiedenen Missionsversuche in Abessinien, deren Mißlingen und Urtheile darüber (128). | ||
| Der Ackerbau und die Viehzucht Abessiniens. Mit 5 Illustrationen | 139 | |
| Die Kulturfläche Abessiniens (139). – Die Getreidearten, ihre Anpflanzung und Verwendung (141). – Gewürze, Gemüse, Wein, Baumwolle, Gescho (144). – Ernteertrag (146). – Nuk (146). – Einfelderwirthschaft (146). – Ackerwerkzeuge (147). – Regenzeit (148). – Bewässerung (148). – Soziale Stellung der Landleute (149). – Die Viehzucht (150). – Aussicht für europäische Ansiedelungen (153). – Die Regierung und der Grundbesitz (153). – Das Frohnwesen (153). – Steuern (153). – Wiesen und Moorgrund (154). – Bienenzucht (154). – Die Wohnungen der Landleute (155). – Die Mühlen Abessiniens (157). | ||
| Massaua und die abessinische Küstenlandschaft. Mit 5 Illustrationen | 158 | |
| Die Bedeutung des Rothen Meeres (158). – Der Dahlak-Archipel und die Perlenfischerei (160). – Die Stadt Massaua und ihre Bewohner (162). – Sklavenhandel (164). – Die Cisternen (166). – Der Markt (167). – Karawanenhandel mit Abessinien (167). – Die Bai von Adulis (168). – Schoho und Danakil (170). – Die Samhara (171). – Eine abessinische Karawane (172). – Der Tarantapaß und Halai (174). | ||
| G. Lejean’s Reise durch Abessinien. Mit 10 Illustrationen | 176 | |
| Metemmé (177). – Der Markt Wochni (178). – Grenzwächter (178). – Eine abessinische Festung (180). – Eine deutsche Familie (182). – Das Land am Tanasee (182). – Schnapphähne (184). – Missionsstation Gafat (185). – Gefangennahme Lejean’s durch König Theodor (187). – Theodor’s Löwen (187). – Gondar und seine Bauten (188). – Wasserfall des Reb (192). – In einem Kloster (194). – Besuch in Korata (195). – Binsenflöße (198). – Besteigung des hohen Guna (200). – Fünf Frauengenerationen (200). – Befreiung (202). – Hochebene Wogara (202). – Lamalmon-Paß (203). – Reise durch Tigrié nach Massaua (204). | ||
| Reisen in den nördlichen und nordwestlichen Grenzländern von Abessinien. Mit 4 Illustrationen | 207 | |
| Das Land der Mensa und Bogos (207). – Reise des Herzogs Ernst (208). – Monkullo (209). – Labathal (209). – Plateau von Mensa (210). – Das Volk der Mensa (211). – Ausflug nach Keren (212). – Elephantenjagd (214). – Rückkehr (216). – Munzinger über die Bogos (217). – Geschichtliches (217). – Ein aristokratisches Volk (218). – Rechtsverhältnisse (218). – Aberglauben (219). – Das Christenthum der Bogos (219). – Der Marebfluß (221). – Die demokratischen Bazen und Barea (220). | ||
| Schoa und die britische Gesandtschaft unter Major Harris. Mit 9 Illustrationen | 224 | |
| Begrenzung (224). – Englische Gesandtschaft unter Harris (225). – Tadschurra (225). – Zug durch die Adalwüste (226). – Salzsee (227). – Mord im Thale Gungunté (228). – Versammlung der Eingeborenen (230). – Sklavenkarawane (232). – Myrrhen (233). – Der Hawasch (234). – Der Grenzdistrikt (234). – Alio Amba, ein Marktort (236). – Empfang beim Könige Sahela Selassié (240). – Die Hauptstadt Ankober (242). – Debra Berhan, die Sommerresidenz (245). – Sklavendepot (246). – Truppenrevue (246). – Angollala (249). – Schlucht der Tschatscha (250). – Medoko, der Rebell (252). – Das Gallavolk (252). – Kriegszug gegen dasselbe (258). – Siegesfest (260). – Abschluß des Handelsvertrags (262). – Rückkehr (263). | ||
| Theodoros II., Negus von Aethiopien. Mit 6 Illustrationen | 264 | |
| Bewegte Jugend (264). – Der Emporkömmling (265). – Schlacht von Debela und Königskrönung (266). – Rebellenkriege (267). – Reformen (272). – Abessinische Heere und Kriegspraxis (275). – Verwickelungen mit den Missionären (280). – Gefangennahme Cameron’s und Streitigkeiten mit England (281). – Magdala (284). – Beginn der englischen Invasion (287). – Erstürmung von Magdala und Tod Theodor’s (293). – Rückzug der Engländer (297). |
| Die hierzu gehörigen Tonbilder sind einzuheften: | ||
| König Theodoros, Audienz ertheilend | Titelbild. | |
| Teiit, Partie von Totscha in Semién | Seite 43 | |
| Charakter des Hochgebirges Awirr in Semién | " 49 | |
| Herzog Ernst von Sachsen-Koburg-Gotha auf der Jagd in Mensa | " 215 | |
| Im Lager des Negus. Priester und Krieger | " 276 | |
| Innerer Theil der Bergfeste Magdala. Südliche Ansicht | " 286 |
Einleitung.
Historischer Ueberblick und Geschichte der Erforschung Abessiniens.
Aethiops. – Die Königin von Saba. – Menilek und die salomonische Dynastie. – Berührungen mit den Völkern des Alterthums. – Die Königsstadt Axum und ihre Ruinen. – Einführung des Christenthums. – Wechsel der Dynastie. – Die Invasion der Muhamedaner unter Granje. – Portugiesen und Jesuiten in Abessinien. – Ihre Vertreibung. – Zerfall des Reiches und Bürgerkriege. – Die Verfassung. – Erforschungsgeschichte. – Portugiesische Reisende. – Hiob Ludolf. – Bruce. – Salt und Pearce. – Hemprich und Ehrenberg. – Rüppell. – Tamisier und Combes. – v. Katte. – Schimper. – Aubert und Dufey. – Lefêbvre – Gebrüder d’Abbadie. – Rochet d’Héricourt. – Beke. – Zander. – Sapeto. – Munzinger. – Lejean. – Die deutsche Expedition.
„In den ersten Jahrhunderten unserer Aera stand Abessinien auf der Höhe der damaligen Kultur; das Christenthum, das ununterbrochen von Aegypten den Nil hinauf bis hierher reichte, schuf einen stetigen Verkehr mit dem römischen Reiche. In Glauben, Sitte, Recht und Feinheit des Lebens war es uns ähnlich; [pg 2]doch seit es von dem Abendlande durch die Fortschritte des Islam abgeschnitten ist, blieb seine Entwicklung stehen, und wie, wer steht, zurückgeht, so ist auch Abessinien zurückgegangen und ist verwildert, wenn es auch jetzt noch Europa viel näher steht als dem nachbarlichen Afrika. Es ist umringt von Feinden, wie die Rose von Dornen; im Norden, wo das Hochland in Stufen abfällt und endlich in unabsehbare Tiefebenen sich endet, wohnen muhamedanische Völker, meist rebellische Kinder des Hochlandes, die hellfarbigen Habab, die Leute von Barka; ihnen folgen noch nördlicher die altnomadischen fremdredenden Hadendoa. Im Westen begrenzt Abessinien das Nilland, türkischer Herrschaft unterworfen, im Süden das halb muhamedanische, halb teufelanbetende Volk der Galla. Wohl brauchte es Jahrhunderte, das Hochland vor allen diesen Feinden dem Christenthume zu wahren. Doch jetzt steht Abessinien gegen außen unabhängig da; es hat nur die inneren Feinde zu fürchten, die Anarchie, den freiwilligen Verfall seiner Religion und Sitte, den Selbstmord.“
So charakterisirt einer der besten Kenner des Landes, Werner Munzinger, die Lage der „afrikanischen Schweiz“, die von alters her das Interesse der europäischen Völker wach zu halten wußte, schon wegen der Gleichartigkeit der Religion, welche uns mit ihren Bewohnern verbindet. Dorthin verlegte man den Sitz des schwarzen Erzpriesters Johannes, dorthin zogen Glaubensboten und wissenschaftliche Forscher in großer Zahl und übermittelten uns Kunde von den Wundern des so verschiedenartig gestalteten Landes. Bald sind es die heißfeuchten Niederungen mit tödtlichem Klima, tropischem Pflanzenwuchs und belebt von den Riesen der Thierwelt, bald kahle, vom Winde gepeitschte Hochebenen, über denen die gezackten, kuppel- und domförmigen Bergriesen bis in die Eisregion hineinragen, dann wieder die verschiedenen Stämme des Landes, ausgezeichnet vor ihren Nachbarn durch leibliche und geistige Vorzüge, doch tief gesunken, die uns jene Berichte vorführen. Endlich aber ist es die mehr als tausendjährige, wol anfangs in den Schleier der Sage gehüllte Geschichte des Landes, die mit ihrem Dynastienwechsel, ihren blutigen Bürgerkriegen und Religionskämpfen uns unwillkürlich anzieht. Ja, Geschichte auf afrikanischem Boden! Welche Anomalie! Denn sehen wir ab von den muhamedanischen Staaten und den alten, vorübergehenden Kulturreichen im Norden des schwarzen Erdtheils, so bietet uns allein Abessinien eine Geschichte, ein Reich in Afrika dar. Staatenbildungen, Historie bei den Negervölkern zu suchen, wäre vergebliche Mühe; Abessinien aber hat beides, und der Grund dafür liegt in der Abstammung, der Begabung seiner Bewohner, die gleich uns zur kaukasischen Rasse gehören, denn sie sind äthiopische Semiten, Verwandte der Araber, Phönizier, Juden.
Nach der Ueberlieferung der Abessinier kam Kusch, ein Sohn Ham’s, in ihr Land, ließ sich dort nieder, gründete die Stadt Axum und bevölkerte weit und breit die Umgebung. Er hinterließ zwölf Söhne, unter welchen der älteste, Aethiops, dem ganzen Lande den Namen Aethiopia gab. So hieß es wenigstens bei den Griechen und heißt es heute noch offiziell. Der allgemein übliche [pg 3]Ausdruck Abessinien jedoch ist aus dem arabischen Habesch abgeleitet. Nach dieser dunklen Sage schweigt die Tradition wieder, und nur Erinnerungen an heidnische Gebräuche und Schlangenkultus füllen den Zeitraum aus, bis die Geschichte Abessiniens – wenn auch immer noch sagenhaft – mit derjenigen der schönen Königin Maketa von Scheba (Saba) zusammenfällt. Zu Axum hatte sie im 11. Jahrhundert vor Christus ihren Thron aufgeschlagen; dort herrschte sie, ihr Volk beglückend, voller Milde und Güte. Eines Tags erschienen Fremdlinge aus einem fernen nördlichen Lande bei ihr, die viel von dem weisen Könige Salomo zu Jerusalem berichteten, der alle übrigen Menschen an Klugheit weit übertraf. Ihn zu sehen, reiste die Königin nach Kanaan, und kaum hatte der Judenkönig sie erblickt, als er sich in sie verliebte und sie zur Frau nahm. Nachdem die äthiopische Fürstin dem Könige einen Sohn Namens Menilek Ebn Hakim, der später den Königsnamen David I. empfing, geboren hatte, riefen sie die Pflichten der Herrschaft wieder nach Abessinien zurück, während der Sohn beim Vater blieb, um dort in allen Tugenden erzogen zu werden. Er wuchs heran und nahm zu an Weisheit und Gnade, sodaß aller Menschen Augen mit Wohlgefallen auf ihm ruhten. Eines Nachts, berichtet die Tradition, erschien ihm der Herr im Traume, hieß ihn wieder in die Heimat zurückkehren und dort den Gottesdienst nach jüdischer Weise einrichten. Heimlich warb er zwölf Priester, unter denen Asarja obenan steht, nahm in der Nacht die alte Bundeslade aus dem Tempel zu Jerusalem und flüchtete mit ihr zu seiner Mutter nach Axum, wo das angebliche Heiligthum noch jetzt gezeigt wird. Von seinem Vater Salomo wurde Menilek lange Zeit verfolgt, allein Gottes Wundermacht schützte ihn und sicherte ihn vor allen Nachstellungen, so daß er 29 Jahre über Aethiopien regierte. Seit jener Zeit nun regiert nominell eine salomonische Dynastie in Abessinien, und der Glaube hieran ist unter dem ganzen Volke vom Höchsten bis zum Niedrigsten so fest gewurzelt und weit verbreitet, daß nichts sie von dieser Vorstellung abzubringen vermag.

1. Kupfermünze des Kaisers Armah (644 bis 658),
2. Goldmünze des Kaisers Aphidas (536 bis 542),
3. Goldmünze des Kaisers Gersemur (603 bis 614).
Die Bewohner Abessiniens scheinen in der vorchristlichen Zeit auf einer sehr niedrigen Kulturstufe gestanden zu haben. Mit den durch die Aegypter civilisirten Stämmen, welche in Aethiopien den Nilstrom entlang wohnten und das Reich [pg 4]Meroë gegründet hatten, scheinen sie durchaus keinen Verkehr gehabt zu haben, ja es ist ausgemacht, daß den alten Aegyptern das Land erst durch die Kriegszüge Alexander’s d. Gr. und durch die von ihm an die Küste verpflanzte Kolonie von Syrern (wahrscheinlich jüdischer Religion) bekannt wurde. Die Ptolemäer, welche ihre Handelsverbindungen mit dem Rothen Meere ausdehnten, errichteten Emporien und Stationen für die Elephantenjagd längs der „Küste der Troglodyten“ und Aethiopier, und der zweite Nachkomme des großen Soter gründete Adulis am Golf von Zula, nahe dem heutigen Massaua. Seine Truppen drangen, nach der von Kosmas Indikopleustes im 6. Jahrhundert aufgefundenen sogenannten adulitischen Inschrift, siegreich bis über den Takazziéfluß in die damals schon erwähnten Schneegebirge Semién’s und verpflanzten griechische Sprache und Gesittung in das Land. In Tigrié entstand das königliche Axum mit seinen hohen Obelisken, Inschrifttafeln und Königsgräbern, und die äthiopischen Fürsten schlugen Gold- und Kupfermünzen. – Doch griff diese Art hoher Kultur, deren Blüte in das 4. bis 7. Jahrhundert fällt, erst nach der Einführung des Christenthums um sich.
Laut predigen heute noch von der alten Herrlichkeit die Ruinen der einst mächtig blühenden Königsstadt in der Provinz Tigrié. Sie sind, wenige andere zerstreute Reste abgerechnet, das einzige, was an die alte Glanzzeit Abessiniens erinnert und der Zielpunkt aller Reisenden, welche das äthiopische Hochland aufsuchen. Noch zu Anfang des 16. Jahrhunderts, als der Portugiese Alvarez sich dort aufhielt, müssen manche merkwürdige Bauwerke daselbst vorhanden gewesen sein, die seitdem verschwunden sind. In einer alten deutschen Uebersetzung seines Reiseberichtes heißt es: „Chaxuma hat vieler schöner Wohnungen uff der Erde gebavet, da eine jede seinen springenden Brunnen hat, und das Wasser den Lewen zum Rachen herausspringet, welche aus gesprenkelten Marmelsteinen zierlich gemacht sind.... Man findet auch an den Häusern viel alter seltzamer Figuren, in gar reine und harte Steine gehawen, als Lewen, Hunde, Vogel u. s. w.“ Auch jetzt enthält Axum noch sehenswerthe Monumente, Obelisken, Stelen, Königsgräber, Opferaltäre, über die wir durch Salt, Rüppell und Heuglin genaue Auskunft erhalten haben.
Der Anblick der in einer Niederung zwischen vulkanischen Hügeln ausgebreiteten Stadt mit ihren zahlreichen Kirchen, Obelisken, Wachholder- und Feigenbäumen ist überraschend schön. Noch ehe man das Thal betritt, begegnet man von Osten kommend einem kleinen schlanken Obelisk, um den mehrere ähnliche umgestürzt in Trümmern liegen; etwas weiter sind Schutthügel mit Opfersteinen und einer 7 Fuß hohen Stele (Inschriftstein), deren eine Seite eine äthiopische, die andere eine griechische Inschrift vom Axumitenkönig Aizanas enthält. Von hier führt ein in den Fels gehauener Weg oder Wasserleitung in die Stadt. Ueber den geräumigen Marktplatz gehend, erreicht man bald ein niedriges Plateau mit einem riesigen Feigenbaum, dessen Stamm an 50 Fuß Umfang hat. Hier ist das eigentliche Obeliskenfeld. Einen sonderbaren Kontrast bilden diese schlanken, oft mit einfachen und zierlichen Ornamenten fast überladenen Mono[pg 5]lithe und Stelen zur bescheidenen Bauart der meist runden, mit Stroh gedeckten Steinhütten der heutigen Axumiten, die oft dicht gedrängt in einzelnen ummauerten Gehöften zusammenstehen, beschattet von immergrünen Wanzabäumen, deren dichtes Laubwerk Schneeflocken gleich mit Blüten übersäet ist. Das heutige Axum hat eine Länge von etwa einer halben Stunde, aber Häuser, Gehöfte und Gärten stehen nicht dicht beisammen und sind zuweilen durch Felder und mit Trümmern bedeckte Plätze unterbrochen. Die Einwohnerzahl veranschlagt Heuglin auf 2–3000. Sie treiben Ackerbau und Viehzucht und leben in verhältnißmäßig glänzenden Umständen, da die vielen kirchlichen Feste und Wallfahrten und namentlich das politische Asyl – ein von Mauern umgebener Platz beim Markte – zahlreiche Fremde nach Axum ziehen.
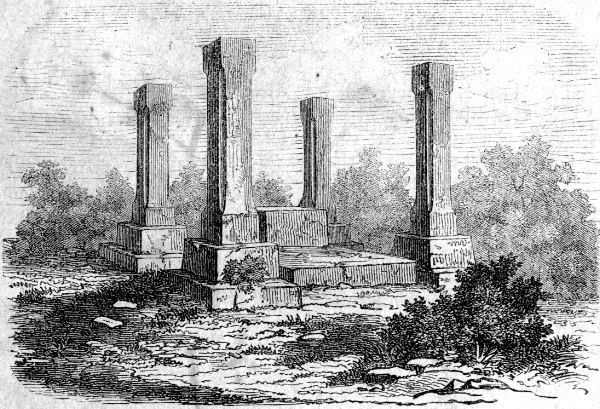
Die Obelisken, etwa 60 an der Zahl, bedecken eine niedrige Terrasse fast vollständig. Die meisten sind jetzt umgestürzt und alle scheinen aus in der Nähe gebrochenen vulkanischen Gesteinen zu bestehen. Einzelne sind nur rohe Steinmassen, die vollendetsten dagegen 60–70 Fuß hohe Monolithe, die schon in der Form von ähnlichen ägyptischen Monumenten abweichen, namentlich durch den oblongen Querschnitt, sowie durch Mangel der Inschriften und ganz abweichende Ornamentik. Das Ganze scheint einen (natürlich nicht hohlen) Thurm mit 8–10 Stockwerken darzustellen, an dem Fenster und Thor angedeutet sind. Die vor den Obelisken liegenden Platten umfassen dieselben theilweise; sie haben zwei Stufen, eine kleine Schwelle und vier runde Vertiefungen (Opferschalen). An verschiedenen Stellen der Stadt stößt man noch auf alte Baureste, [pg 6]namentlich auf kolossale Quadersteine. Allerlei Töpfergeschirre, Amphoren, Schalen, Löwenköpfe, die als Brunnenröhren dienten, sind in Trümmer zerstreut und es könnte hier sicher noch durch Nachgrabungen manches historisch wichtige Monument zu Tage gefördert werden. Der Eindruck, welchen die verschiedenen Monumente auf einzelne Reisende hervorbrachten, war ein sehr ungleicher. Während z. B. Rüppell, wol mit Recht, deren Kunstwerth nicht hoch schätzt, ist Salt von den Obelisken ganz entzückt. Ja, von dem 60 Fuß hohen Obelisk, der sich prächtig an dem alten Sykomorenbaum erhebt, sagt er sogar: „Nach Vergleichung mit vielen Spitzsäulen von ägyptischer, griechischer und römischer Arbeit scheint mir dieser Obelisk das bewundernswürdigste und vollkommenste Werk, wozu man schwerlich ein Gegenstück findet“.
Nahe bei dem Haupteingange der berühmten Kirche des Ortes stößt man auf elf in einer Reihe dicht nebeneinander stehende Altäre von eigenthümlicher Bauart, deren einen Salt als „Königssitz“ abbildet. Jeder derselben besteht aus drei sich auf den vier Seiten verkürzenden Stufen, von welchen die unterste etwa neun Fuß im Quadrat hat. Auf der zweiten Stufe befinden sich vier Würfel, die an den Eckkanten der dritten anliegen und von welchen jeder eine achteckige Säule trägt, aller Wahrscheinlichkeit nach zur Stütze der verschwundenen Deckplatte.
Eine Stunde nordöstlich von der Stadt liegen die sogenannten „Fuchslöcher“ oder Königsgräber auf einem Hügel mit herrlicher Aussicht. Auf dem schmalen Gebirgsrücken bemerkt man ein aus großen Quadern und Säulen bestehendes Fundament einer Art Grabkirche, in dessen Mitte ein Weg zum Eingange eines Felsengrabes führt, das wie sein einfaches Portal in den Fels gearbeitet und nachher mit künstlicher Mauerung aus großen Blöcken ausgekleidet worden ist. Aehnlich den Königsgräbern von Theben führt von da aus dann ein Gang schräg abwärts; dieser mündet in drei Kammern, deren mittlere mit einer Thür verschlossen werden konnte.
Erwähnen wir nun noch die aufgefundenen Münzen (eine kupferne des Königs Armah, der von 644 bis 658 regierte, zwei goldene der Könige Aphidas und Gersemur aus dem 6. und 7. Jahrhundert, theilt Rüppell mit), so haben wir so ziemlich alles erwähnt, was von dem königlichen Axum übrig blieb, das ums Jahr 1535 von dem muhamedanischen Stürmer Granje eingeäschert wurde.
Die Blütezeit der Stadt fällt mit der Einführung des Christenthums zusammen, das, lange bevor noch in Deutschland der heilige Bonifacius (725) dem Evangelium Eingang verschaffte, durch einen Zufall an die äthiopische Küste verpflanzt wurde. Ein christlicher Kaufmann, Meropius mit Namen, machte nämlich mit seinen beiden Gehülfen Frumentius und Aedisius im Jahre 330 eine Geschäftsreise längs den Küsten des Rothen Meeres, landete in der Gegend des heutigen Massaua und wurde hier nebst einem Theile seiner Schiffsmannschaft von den wilden Eingeborenen erschlagen. Nur den beiden Jünglingen schenkte die wüthende Bande das Leben. Man brachte sie an den königlichen Hof, [pg 7]wo sie gute Aufnahme fanden und bald vom Könige Sara-Din mit wichtigen Aemtern betraut wurden. Auf ihre Veranlassung kamen noch mehrere christliche Kaufleute nach Abessinien, die nun eine kleine Gemeinde bildeten und auch mehrere Einheimische bekehrten. Die beiden Jünglinge reisten dann später in ihr Vaterland zurück, zur Zeit als Athanasius Erzbischof von Alexandria war. Aedisius wurde Priester in Tyrus; Frumentius aber wandte sich mit der dringenden Bitte an den Erzbischof, der kleinen christlichen Gemeinde in Abessinien einen Hirten zu senden, damit sie nicht verwaise. Athanasius wußte hierzu aber keinen bessern zu finden, als den Bittsteller, gab dem ehemaligen Handlungsgehülfen die Weihe und sandte ihn nach Abessinien zurück. Hier angelangt führte er den Namen Abba Salama, Vater des Friedens, übersetzte das Neue Testament in die äthiopische Sprache und breitete das Christenthum weit über das Land aus, wenn auch noch ein großer Theil des Volkes bei der altheidnischen Religion verharrte. Die fernere Geschichte Abessiniens ist sehr dunkel und nur durch lange Reihen von Königsnamen ausgefüllt, an welche sich nur hier und da einzelne historische Thatsachen knüpfen.
Aus diesen entnehmen wir, daß zur Zeit des griechischen Kaisers Justinian (um 522) eine heftige Christenverfolgung durch die Juden im südlichen Arabien stattfand. Justinian wandte sich deshalb an den abessinischen König Kaleb; dieser eilte mit einer Armee über das Rothe Meer, schlug die Juden und unterwarf sich den größeren Theil des südlichen Arabiens, in dessen Besitz die Abessinier auch blieben, bis sie kurz vor Muhamed’s Auftreten durch die Blattern, die in ihrem Heere stark wütheten, gezwungen wurden, sich wieder in ihr Land zurückzuziehen. Im übrigen ist aus der langen Periode des äthiopischen Reiches bis ins 8. Jahrhundert nicht viel Erwähnenswerthes überliefert; das Volk vergeudete seine Kräfte in unfruchtbaren Religionsstreitigkeiten und kam mit seinen Nachbarn nicht aus dem Kriegszustande heraus.
Unterdessen trat, den ganzen Orient erschütternd, Muhamed mit seiner Lehre auf. Allein der Islam fand in Abessinien wenig Eingang, jedoch wurde das damals noch blühende Reich Adal für diese neue Lehre gewonnen, und dieses gab den zwischen beiden Ländern bestehenden Streitigkeiten bedeutende Nahrung, indem zu den politischen nun noch religiöse Kämpfe sich gesellten, welche das Land mit Blut überschwemmten. Doch bevor noch diese muhamedanischen Invasionen erfolgten, hatte Abessinien eine gewaltige Revolution durchzukämpfen und es war fraglich, ob die Juden oder die Christen die Oberhand erhalten sollten. Die ersteren erhoben sich nämlich unter dem Namen der Falaschas zu einer furchtbaren Macht. Durch Heirathsverbindung zwischen der Familie ihrer Häuptlinge und der abessinischen Königsfamilie brachten sie den Königsthron an sich und suchten nun die salomonische Linie ganz auszurotten. Es sind jetzt etwa 1000 Jahre darüber hingegangen, daß der letzte salomonische König, Delnaod, vom Throne seiner Väter gestoßen wurde, und zwar durch eine Jüdin aus Lasta Agau, welche die ganze königliche Familie, einen Knaben ausgenommen, der nach Schoa flüchtete, ermorden ließ. Sie hieß Judith, wie zu [pg 8]vermuthen steht, ein selbstbeigelegter Name mit dem beabsichtigten Hinweis auf die alttestamentliche Heldin. Drei Jahrhunderte später wurde die Judendynastie wieder durch einen christlichen Herrscher aus dem Hause Sagué vertrieben, dessen Nachkommen bis zum Jahre 1268 regierten, also zur selben Zeit, als in Deutschland die Hohenstaufen kraftvoll das Scepter führten. Elf Könige soll das Haus Sagué (Zagyé) den Abessiniern geliefert haben, die für das Christenthum eifrig wirkten, unter denen der später heilig gesprochene Lalibela durch die vielen kunstvoll in Felsen ausgehauenen Kirchen, die ägyptische Werkmeister aufführten, berühmt geworden ist.
Die meisten dieser Felsenkirchen sind zur Zeit der muhamedanischen Invasion im 16. Jahrhundert zerstört worden, doch haben sich einzelne derselben bis auf unsere Tage erhalten. Der englische Reisende Pearce schildert uns die Felsenkirche Dschumada Mariam nördlich von den Quellen des Takazzié, sein Landsmann Salt jene von Abba os Guma bei Schelicut, v. Heuglin die Felsenkirche von Tenta in Wollo. Die seltsamste dürfte aber wol jene sein, welche der Missionär Isenberg im Jahre 1838 bei dem Dorfe Hauazién in der Provinz Tembién besuchte, als er gerade im Begriff war, das Land nach dem Scheitern seines Missionswerkes zu verlassen. „Obgleich ich aus leicht erklärlichen Gründen nicht aufgelegt war, die Kirche dieses Ortes zu untersuchen, so konnte ich doch nicht umhin, ihre äußere Form anzustaunen. Sie scheint aus einem einzigen Granitblock zu bestehen, der zu dem Zwecke ausgehöhlt ist, kann aber, nach dem äußern Umfange des Steins zu urtheilen, nur sehr wenig Raum im Innern haben. Auch die äußere Form des Steines ist sehr auffallend. Er ist kaum 20 Fuß hoch und in der mittleren Höhe, wo er am breitesten ist, da er die Form eines stehenden Kreuzes anstrebt, mag er auch etwa 20 Fuß breit sein; seine Tiefe aber von vorn nach hinten ist geringer. Er hat einen engen Eingang, in jedem Seitenflügel des Kreuzes und über der Thüre eine Fensteröffnung; alles dieses in den Fels gehauen.“ Gewiß ist zu beklagen, daß Isenberg diese interessante Felsenkirche nicht auch im Innern untersuchte, da, wie es scheint, er der einzige europäische Reisende war, welcher sie zu Gesicht bekam.
Zu Ende des 13. Jahrhunderts lebte in Schoa der achte Nachkomme jenes zur Zeit der Judenherrschaft nach Schoa geflüchteten letzten Prinzen der salomonischen Dynastie. Sein Name war Tesfa Jesus oder Jekuno-Amlak. In Abessinien aber herrschte Nakwetolaab, der Sagué. Als eigentlicher Herrscher des Landes mußte aber der mächtige Abuna oder Erzbischof Tekla Haimanot angesehen werden, heute noch der berühmteste Heilige der abessinischen Kirche und Gründer des großen Klosters Debra Libanos in Schoa, durch dessen Eifer und Beistand die Wiedereinsetzung der alten Dynastie ermöglicht wurde. Aus freiem Willen, wenn auch auf dringendes Einreden dieses Erzbischofs, leistete Nakwetolaab Verzicht auf die Krone und stieg vom Throne herab, um jenem Nachkömmling der salomonischen Dynastie, nach abessinischer Vorstellung dem legitimen Sprossen Menilek’s, Platz zu machen.
Zum Entgelt für sich und seine Leibeserben wurde Nakwetolaab zum [pg 9]Herrscher in der Provinz Waag unter der Lehensoberhoheit des Königs bestellt und dazu der Vorbehalt ausbedungen, daß für den Fall des Aussterbens der Linie Menilek’s die Krone an die Linie Nakwetolaab’s zurückgelange, ein Uebereinkommen, welches solche Lebenskraft besitzt, daß es bis in die jüngste Zeit zurückwirkt. – Von dieser Zeit an bietet die politische Geschichte des Landes eine Reihe von kriegerischen Expeditionen dar, welche ihre Könige, zum Theil ausgezeichnete Helden, gegen auswärtige Völker unternahmen, während die muhamedanische Macht an der Grenze sich immer drohender entwickelte.
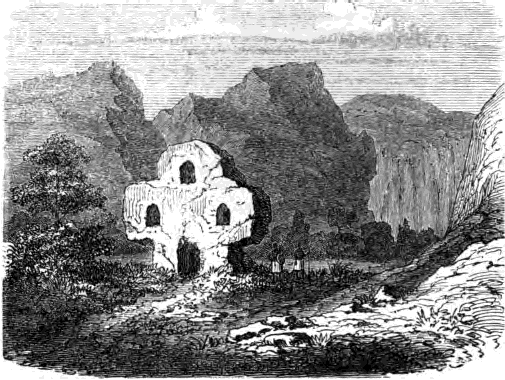
In dieser Noth fand eine nähere Verbindung zwischen Europa und Abessinien statt, ja es war die Rede von einer Verschmelzung der Landeskirche mit der römisch-katholischen, die durch Pilgerfahrten nach Jerusalem angeregt worden war. Dort hatten die frommen abessinischen Wallfahrer von dem aufstrebenden Glanze Portugals gehört, und die Berichte derselben erregten in König Jakob, der von 1421 bis 1470 regierte, den Wunsch, mit dem abendländischen Reiche in Verbindung zu treten. Eine Gesandtschaft wurde nach Lissabon geschickt, um dort vom Könige Alphons Hülfe gegen die Ungläubigen zu erbitten. Diesem, der damals mit kriegerischen Plänen gegen die Mauren Nordafrika’s umging, kam der Wunsch Jakob’s sehr gelegen, obgleich damals der Weg ums Kap der guten Hoffnung herum noch nicht entdeckt war; allein er konnte, ohne den mächtigen Papst gefragt zu haben, auf die Allianz mit Abessinien nicht eingehen, und dieser forderte als erste Bedingung eines Bündnisses die unbedingte Unterwerfung der getrennten äthiopischen Kirche unter den Stuhl Petri. Die abessinischen Gesandten mußten [pg 10]deshalb 1441 auf dem Florentiner Konzil erscheinen, wo eine vorläufige Ausgleichung zwischen beiden Kirchen stattfand. Schon im folgenden Jahre erschienen neue Bevollmächtigte auf dem lateranischen Konzil zu Rom, um den Ausgleich zu bestätigen und dringend aufs neue um Hülfe zu bitten. Diese jedoch verzögerte sich und an ihre Stelle trat nach langem Briefwechsel 1490 eine von König Johann II. an König Eskander von Abessinien geschickte Gesandtschaft, welche mit den größten Ehrenbezeugungen aufgenommen wurde. Dabei blieb es aber vor der Hand und die Muhamedaner rückten immer mehr gegen die Abessinier an. Im Jahre 1527 wurde der Hafenplatz Massaua von den Türken eingenommen und von diesen mit dem an der Küste herrschenden Dankali-Könige Muhamed Granje, dem „Linkshändigen“, ein Bündniß abgeschlossen, welches den Zweck hatte, Abessinien gänzlich zu unterwerfen und an die Stelle des Evangeliums den Koran zu setzen. Granje, dessen Väter von den abessinischen Königen mit dem Schwerte erschlagen worden waren, hatte blutige Rache geschworen und fiel gleich einem reißenden Strome mit einem zahlreichen Heere in das Land ein. Durch den gelben Sand der dürren Adalebenen und die glühend heißen Gestadeländer ziehend, stieg er hinauf in die kühleren, gesegneten Berglandschaften Schoa’s, alles vor sich niederwerfend, sengend und brennend. Weit und breit dampfte das Land vom Blute der Erschlagenen; nicht Weib noch Kind wurde geschont, die Kirchen und Städte, darunter der Königssitz Axum, wurden niedergebrannt, die königliche Familie aus ihrer Felsenburg Endoto verjagt und flüchtig von dannen getrieben. Damals war es, daß die nur mit Schwertern und Lanzen bewaffneten Abessinier zum ersten male den Feuerwaffen der Muhamedaner begegneten, vor deren ungewohntem Klange sie davoneilten, wie gescheuchte Rehe des Waldes. Die Muhamedaner aber ergossen sich über das wehrlose Land, verübten die größten Greuel und waren eben im Begriffe, sich dauernd dort niederzulassen, als die längst erwartete Hülfe aus Portugal eintraf.
Don Christoph da Gama, ein Verwandter des berühmten Vasco da Gama, kam mit einer kleinen portugiesischen Flotte in Massaua an und landete mit 400 wohlgerüsteten Kriegern, mit denen er rasch nach Tigrié eilte, sie dort mit den Resten der geschlagenen abessinischen Armee vereinigte und nun muthig den Streitern des Islams entgegenführte. Das erste größere Gefecht der Portugiesen gegen die Muhamedaner verlief unglücklich. Da Gama wurde verwundet und flüchtete in eine Höhle, wo ihn eine muhamedanische Sklavin von außerordentlicher Schönheit, welche er als Dienerin mit sich führte, ihren Glaubensgenossen verrieth. Er wurde vor Granje geführt, welcher ihm eigenhändig mit der linken Hand den Kopf abschlug, der nach Konstantinopel gesandt wurde, während die Stücke des geviertheilten Körpers nach verschiedenen Gegenden Arabiens wanderten. Die Portugiesen, anfangs durch den Verlust ihres Feldherrn bestürzt gemacht, rafften sich indessen von neuem auf, schlugen die Muhamedaner, tödteten Muhamed Granje und setzten den rechtmäßigen König Claudius (Galaudios) wieder in den Besitz seines Thrones.
[pg 11]Nichts umsonst! So lautete damals schon der Wahlspruch, und die Portugiesen, die ihr Blut nicht ohne Gewinn verspritzt haben wollten, traten nun mit zwei Forderungen auf. Zunächst verlangten sie den dritten Theil des Landes und dann unbedingte Unterwerfung der äthiopischen Kirche unter den römischen Papst. Die Abessinier sahen ein, daß sie einen Feind losgeworden, dafür aber einen andern, kaum minder schlimmen, aufs neue sich zugezogen hatten. Claudius, welcher sich in seinem Glauben nicht irre machen ließ, auch der Portugiesen jetzt nicht mehr zu bedürfen glaubte, verweigerte beide Forderungen kurzweg und holte einen neuen Abuna (Vorstand der äthiopischen Kirche) aus Alexandrien, während er den römischen Geistlichen, an deren Spitze Bermudez stand, befahl heimzukehren. Die Portugiesen waren aber weit davon entfernt, so ohne weiteres die Früchte ihres Sieges aufzugeben. Im Jahre 1555 kam eine Jesuitenmission in Abessinien an, welcher bald darauf eine zweite unter dem Bischofe Orviedo folgte, aber alle ihre Anstrengungen waren vergeblich, indem König Claudius selbst über Glaubenssachen mit Orviedo disputirte, ihn zu widerlegen suchte und, als dieser darauf die ganze abessinische Kirche in den Bann that, ihn mit seinen Genossen aus dem Lande verwies. Nur mit Widerstreben gehorchten die Patres, die nach Japan versetzt wurden, wo sie, anfangs zu Einfluß gelangend, auch später wieder, wegen ihrer Einmischung in die Regierung des Landes, vertrieben wurden. Von Indien aus versuchten es die Jünger Loyola’s nun zu wiederholten Malen, in Abessinien festen Fuß zu fassen, bis es ihnen endlich zur Zeit der Regierung des Königs Sosneos (Seltan Seggad) gelang, sich festzusetzen. Unter diesem Könige, der außerordentlich viel auf eine Verbindung mit Portugal gab, wurde auf Betreiben der Jesuiten die römische Kirche für die alleinseligmachende erklärt, die bisherigen abweichenden Lehren und Gebräuche abgeschafft und die Einführung des römischen Gottesdienstes und Glaubens im ganzen Reiche eifrig betrieben. Vergeblich warnten den König seine Freunde, flehten seine Geistlichen mit dem hundertjährigen Abuna Simeon an der Spitze, den Eingebungen der Jesuiten nicht zu folgen und treu am Glauben der Väter festzuhalten. Wer nicht wollte, mußte gehorchen oder des königlichen Mißfallens und schwerer Strafen gewärtig sein. Allein aufgestachelt von den Priestern ließ das Volk die Glaubenstyrannei sich nicht gefallen und griff zu den Waffen, um die alte Religion zu vertheidigen. Der König, durch die fanatischen Jesuiten immer mehr angefeuert, schickte den Scheftas (Rebellen) ein mächtiges Heer unter dem Oberbefehl seines Bruders entgegen, dem es auch bald gelang, die Revolution blutig niederzuwerfen. Dieser Sieg veranlaßte das Einströmen zahlreicher portugiesischer Geistlichen, die, den Erzbischof Mendez an der Spitze, nun mit dem größten Eifer für Ausbreitung des Katholizismus in Abessinien Sorge trugen. In einer feierlichen Versammlung wurde das alexandrinische Bekenntniß für abgeschafft erklärt und jeder mit dem Bannfluche belegt, der sich der neuen Ordnung nicht fügte.
Die Herrschaft der Jesuiten ruhte nun schwer auf dem Lande, und vor ihrem Fanatismus blieben nicht einmal die Gräber verschont. Einer der vornehmsten [pg 12]Priester, der sich der neuen Ordnung nicht gefügt hatte, starb und wurde auf dem Kirchhofe begraben; auf Befehl des Erzbischofs Mendez grub man jedoch die Leiche aus und warf sie den Hyänen vor. Diese und ähnliche Handlungen erweckten die Wuth des Volkes aufs neue, und wiederum brach eine Empörung aus, diesmal mit dem Zwecke, Melea Christos, einen Vetter des Königs, auf den Thron Abessiniens zu erheben. Die zahlreiche Armee des Sosneos wurde nun geschlagen und dieser zu einer Vermittelung zwischen dem alten und neuen Glauben gezwungen. Erzbischof Mendez gestattete, daß die alte Liturgie und die alten Festtage wiedereingeführt, sowie die Feier des Sonnabends neben dem Sonntage geduldet wurde. Mit Ausnahme der Einwohner der Provinz Lasta ergaben sich alle Abessinier hierein; jene aber, die konservativsten unter allen, zogen 20,000 Mann stark den Königlichen entgegen, wurden aber namentlich durch die aus Galla bestehende Reiterei des Sosneos geschlagen, sodaß 8000 tapfere Männer von Lasta mit ihren blutigen Leichen das weite Schlachtfeld deckten. Gegenüber diesem Anblick, bei den verstümmelten Körpern ihrer dahingeopferten Brüder, die für den alten Glauben gefallen waren, erweichte das Herz der Sieger und, den Kronprinzen Fasilides an der Spitze, ging – was wol einzig in der Kriegsgeschichte dastehen dürfte – der Sieger zu dem Besiegten über, dessen Sache zur seinigen machend und den König Sosneos zwingend, zur Religion der Väter zurückzukehren. Nach diesem Siege, der zur Niederlage des Katholizismus wurde, durchzog ein Herold das Land, welcher laut verkündigte: „Hört, hört! Früher haben wir euch den römischen Glauben empfohlen, in der Meinung, daß er der wahre sei. Da aber große Scharen unserer Unterthanen für den alten Glauben ihrer Väter das Leben geopfert haben, so soll auch die freie Ausübung desselben wieder gestattet sein. Eure Priester mögen ihre Kirchen wieder in Besitz nehmen und darin dem Gott ihrer Väter dienen.“
Damit war der Untergang des Katholizismus besiegelt; laut jubelnd strömten die Abessinier in die alten Gotteshäuser, und als im Jahre 1632, nach dem Tode des Königs Sosneos, dessen Sohn Fasilides an die Regierung kam, waren auch die Stunden der Jesuitenväter gezählt. Sie wurden zunächst in das Kloster Mai Goga bei Adoa verbannt, flüchteten aber von hier vor den Verfolgungen des Pöbels. Mendez selbst gerieth auf der Flucht zu Sauakin in die Sklaverei und statt seiner nahm wieder ein Abuna aus Alexandrien den höchsten Kirchensitz zu Gondar ein. Ist auch die Invasion der Portugiesen, die Herrschaft der Jesuiten über das Land nicht ohne Einfluß in kulturhistorischer Beziehung geblieben, so wurde doch ein guter Theil des Volks und Reiches in den inneren Zwisten dem Ruin zugeführt.
In der folgenden Periode regierten bis 1753 acht Könige, mehr oder minder kräftig, die aber alle nicht hindern konnten, daß die Macht der Häuptlinge wuchs, die Herrscherwürde im Ansehen immer mehr sank und das Reich sich unaufhaltsam in seine Theile auflöste, sodaß allmälig die drei Staaten Amhara in der Mitte, Tigrié im Norden, Schoa im Süden sich unter eigenen [pg 13]Fürsten herausbildeten, die den ohnmächtigen König im Palaste zu Gondar nur dem Scheine nach anerkannten. Unter König Joas (1753–1769) hatte der Statthalter von Tigrié, der furchtbare Ras Michael, als eine Art von Major Domus die ganze Macht an sich gerissen, den Kaiser umbringen lassen und dessen bejahrten Großoheim, Johannes, gleich einer Puppe auf den Thron erhoben, und als dieser fünf Monate später starb, dessen jungen Sohn Tekla Haimanot II. zu seinem Nachfolger ernannt. Jene Zeiten, die uns Bruce mit großer Anschaulichkeit als Augenzeuge schildert, bilden eines der blutigsten Blätter in der Geschichte Abessiniens.

Sturz und Erhebung, Bürgerkrieg und Mord wechseln miteinander ab und die Menge der auftretenden Namen, der unzufriedenen Häuptlinge, der ermordeten Statthalter ist geradezu verwirrend. Durch stete Treulosigkeit suchten sich die abessinischen Häuptlinge gegenseitig zu überlisten, wobei ihnen meist eheliche Verbindungen als Deckmantel dienten, um das unglückliche Land fortwährenden Verheerungskriegen preiszugeben, welche stets nur zur Befriedigung des individuellen Ehrgeizes, niemals aber im Interesse des Reiches geführt wurden. Durch so viele Veränderungen und durch die beständigen Bürgerkriege war die Herrschermacht so in Verfall gerathen, daß das Königthum [pg 14]nur noch in dem Palaste des jeweiligen Königs zu Gondar thatsächlich bestand, außerhalb desselben aber so wenig, daß die meisten der nominellen Unterthanen nicht einmal den Namen des Herrschers kannten. Die Existenz des Königs war nur eine Aegide für den Ras oder Protektor des Reiches, der nur durch Erhebung eines Königs auf seinen Thron und durch Beschützung desselben seine eigene Würde erhielt, sonst aber ganz nach seinem eigenen und seiner Großen Gutdünken schaltete. Unter ihm standen die vielen Reichsvasallen, die Provinzial-Gouverneure, deren Würde erblich ist, die aber ebenfalls so viel Unabhängigkeit zu erstreben suchten, als sie nur konnten. Jeder Gouverneur war verpflichtet, bei militärischen Expeditionen seinem Obern mit so vielen Soldaten zu Hülfe zu eilen, als er selbst unterhalten konnte, und sein bürgerlicher Rang im abessinischen Staatskörper wurde nach der Stelle bestimmt, die ihm im Heere, d. h. im königlichen Lager und auf dem Marsche angewiesen wurde.
Vorzüglich aber hatten diese Statthalter das Recht sich angemaßt, Gegenkaiser zu ernennen und die ihnen mißfälligen Thronbesitzer zur Abdankung zu zwingen. Da sie überdies noch die Tributzahlungen einstellten, wurde das Ansehen und die Macht der Könige so herabgewürdigt, daß sich das Einkommen derselben zu Anfang unseres Jahrhunderts auf dreihundert Thaler belief. Welche Civilliste für einen Herrscher Aethiopiens! Um sich aber von der Wandelbarkeit der abessinischen Königswürde eine rechte Vorstellung machen zu können, sei hier bemerkt, daß seit dem Abdanken des Königs Tekla Haimanot II. (1778) bis zum Jahre 1833 vierzehn verschiedene Fürsten zweiundzwanzigmal als Könige in Gondar auf dem Throne gesessen haben. Ein Nebenstück hierzu finden wir allerdings in den sogenannten Republiken Südamerika’s, wo der Präsidentenstuhl nicht minder häufig wechselt.
Nachdem der erwähnte Ras Michael durch den Statthalter der Provinz Lasta, Wend Bowosen, am 4. Juni 1771 besiegt und gefangen worden war, bemächtigte sich der Befehlshaber von Tembién, Kefla Jesus, der Provinz Tigrié. Derselbe bat, um sich in seinem Besitzthum möglichst zu befestigen, seinen Verbündeten, den Wend Bowosen, ihren gemeinschaftlichen Gegner, den furchtbaren Ras Michael, der zu Dobuko gefangen saß, aus der Welt zu schaffen; allein jener that das Gegentheil: er setzte den Gefangenen in Freiheit und machte ihn mit dem Plane des Kefla Jesus bekannt. Ergrimmt zog nun der alte tapfere Ras Michael mit wenigem Gefolge nach Tigrié, und fast die ganze Armee seines Gegners Kefla Jesus ging zu ihm, ihrem alten General, unter dem sie so oft gesiegt hatte, über. Jener wurde hierauf gefangen und von Ras Michael 1772 aufs grausamste ums Leben gebracht, der auch bis zu seinem 1779 erfolgten Tode über Tigrié herrschte und seinen Sohn Ras Walda Selassié zum Nachfolger erhielt; dieser Fürst, welcher aus den Erzählungen der englischen Reisenden Salt und Pearce bekannt geworden ist, regierte, wiewol keineswegs ungestört, bis zum Mai 1816 über Tigrié; nach seinem Tode war das Land sechs Jahre in einem höchst anarchischen Zustande, indem nicht weniger als vier Häuptlinge nacheinander um die Obergewalt kämpften. Im Jahre 1822 gelang [pg 15]es Sabagadis, dem Statthalter der Provinz Agamié, sich in der Obergewalt zu befestigen und über acht Jahre lang in Tigrié zu regieren. Er soll damals den kühnen Gedanken gefaßt haben, sich die Alleinherrschaft in Abessinien zu erringen, wozu er wahrscheinlich durch verschiedene bei ihm befindliche Europäer veranlaßt wurde. Allein auch er theilte das Schicksal seiner Vorgänger und erhielt in Ubié, einem talentvollen, kühnen und grausamen Manne, einen noch weit bedeutenderen Nachfolger. Ubié war der Schwiegersohn des Sabagadis und Detschasmatsch der gebirgigen Provinz Semién; das hinderte aber den Schwiegervater nicht, gegen ihn, dessen aufstrebende Macht er fürchtete, zu intriguiren. Vereinigt mit Ras Maria, dem Befehlshaber der Provinzen Begemeder und Dembea, rückte nun Ubié an den Takazzié, schlug dort am 15. Februar 1831 seinen Schwiegervater Sabagadis vollständig und ließ ihn am folgenden Tage hinrichten. Während nun Ubié von den Großen zu Axum als Herr Tigrié’s ausgerufen wurde, kämpfte der ältere Sohn des Sabagadis, Walda Michael, gegen ihn fort, doch ohne Erfolg; er wurde gleichfalls getödtet, und auch der zweite Sohn, Kassai, mußte sich Ubié ergeben. Aber Kassai blieb nicht treu, sondern versuchte abermals zu rebelliren. Um ihn fester an sich zu knüpfen, schenkte ihm Ubié im Spätjahre 1836 seine siebenjährige Tochter zur Frau, sowie ein bedeutendes Gebiet in Tembién zur Mitgift und ließ sich dabei alle Hauptanhänger Kassai’s nennen, die in Verwahrsam gebracht wurden. Als darauf Kassai 1838 wieder rebellirte, zog Ubié mit einer bedeutenden Armee gegen ihn, schlug ihn und setzte ihn in einer Bergveste gefangen, wo seine Frau nicht von ihm wich. Dann befestigte sich seine Macht immer mehr und erreichte ihren Gipfel durch den Fall Balgadaraia’s, eines mächtigen Fürsten in Ost-Tigrié, der zeitweise die Abwesenheit Ubié’s zu raschen Verheerungs- und Raubzügen bis nach Adoa und zum Takazzié benutzte. Im Jahre 1850 stellte sich Balgadaraia freiwillig dem Ubié und wurde von demselben mit Ländereien belehnt.
Im centralen Staate Abessiniens, in Amhara, regierte unterdessen nicht minder gewaltig, doch mit weniger Glück, Ras Ali, welcher die ganze Herrlichkeit an sich gerissen hatte und den König oder Kaiser Saglu Denghel noch mehr zur Unbedeutendheit herabdrückte, als dieses bisher mit den Herrschern geschehen war. Für seinen Lebensunterhalt waren diesem Herrscher über Abessinien nur 300 Maria-Theresia-Thaler jährlich geblieben, welche die in Gondar wohnenden Muhamedaner als eine Art Kopfsteuer zu entrichten hatten. Mit dieser unbedeutenden Summe und dem Betrage einiger wenigen zufällig eingehenden Strafgelder mußte die ganze Hofhaltung bestritten werden. Die hierdurch entstehende große finanzielle Bedrängniß, bei welcher der Titularkönig des Reiches kaum die nöthigsten Mittel zur Anschaffung seiner Nahrung hatte, war es wol, welche Saglu Denghel auf den Gedanken brachte, daß, da in Abessinien der Herrscher zugleich als das höchste Haupt der Landeskirche angesehen wird, er auch das Recht haben müsse, diejenigen Schenkungen, welche seine Vorfahren in glücklichen Zeiten der Kirche gemacht hatten, jetzt, da der Thron dieselbe zu seinem eigenen Bestehen nothwendig habe, wenigstens theilweise zurückzuverlangen. [pg 16]Er erklärte dieses im Anfange des Jahres 1833 den in Gondar anwesenden Geistlichen, brachte aber dadurch den ganzen Klerus gegen sich auf – also genau so wie bei uns, wenn z. B. ein König von Italien die Kirchengüter zum Besten des Landes einzieht, nur mit anderm Erfolge. Daß Soldaten sich der Einkünfte vieler Kirchengüter bemeisterten, hatte man freilich geschehen lassen müssen, weil es nicht verhindert werden konnte; aber in die Schmälerung der kirchlichen Revenuen als etwas Gesetzliches von freien Stücken einzuwilligen, dazu war die abessinische Geistlichkeit ebenso wenig zu bewegen, wie irgend ein Klerus Europa’s. Sämmtliche Geistliche von Gondar verfügten sich also zum Kaiser und protestirten energisch gegen die Neuerung, ja, sie fingen sogar an, die Kirchen zu schließen und jegliche geistliche Funktion einzustellen, worüber besonders die alten Frauen in Bestürzung geriethen. Am 19. Januar 1833 begab sich die ganze Geistlichkeit in feierlichem Aufzuge zum Protektor Ras Ali nach Fangia und bat denselben dringend, dem Saglu Denghel die Königswürde zu nehmen, weil er sich derselben durch die Einführung ketzerischer Neuerungen in dem zwischen Staat und Kirche bestehenden Verhältnisse unwürdig gemacht habe. Solche Versuche, fügten sie hinzu, würden ohne allen Zweifel den Ruin des Reiches nach sich ziehen und von jeher sei ja auch ein Angriff auf die geistlichen Rechte von allen Synoden als verdammenswerth anerkannt worden. Indem wir diese uns von Rüppell, der als Augenzeuge spricht, mitgetheilten Einzelheiten lesen, kommt es uns vor, als sei hier etwa von Oesterreich und dem Jahre 1867 die Rede, wo beim Streite über die Aufhebung des Konkordates der Klerus der Regierung gegenüber die nämliche Sprache, die nämlichen Argumente gebrauchte. So sehr gleicht sich die Geistlichkeit in allen Theilen unserer Erde.
Der Klerus erreichte seinen Zweck vollkommen, denn Ras Ali schickte sogleich einen seiner Offiziere mit dem Befehle nach Gondar, daß der König augenblicklich das Schloß verlasse und die Krone niederlege, für welche er bei seiner Rückkehr von einem Kriegszuge einen Würdigeren ernennen werde, und diesem Befehle wurde ohne die mindeste Widersetzlichkeit Folge geleistet. So endete die nominelle Herrschaft Saglu Denghel’s nach einer Dauer von nur vier und einem halben Monate und so gingen damals die Protektoren mit dem „Könige“ um. Ras Ali wies dem abgesetzten Herrscher ein kleines Dorf in der Nähe des Tanasees als zukünftigen Wohnsitz und die geringen Einkünfte desselben zu seinem ferneren Unterhalte an. Lange Zeit blieb der Thron unbesetzt, und die folgenden Könige sind auch nur von chronologischem Interesse, da eine Bedeutung ihnen nicht mehr zukam und das Land in der That aus drei gänzlich getrennten Staaten, aus Schoa unter König Sahela Selassié, Amhara unter Ras Ali und Tigrié unter Ubié bestand. Im Verfolge unseres Werkes werden wir noch oft Gelegenheit haben, diese drei Theilfürsten zu erwähnen, von welchen namentlich der erstere und der letztere unser Interesse um deswillen in Anspruch nehmen, weil sie mit den Europäern in nahe Verbindungen traten und von verschiedenen Reisenden aufgesucht wurden. Ubié, etwa im Jahre 1800 geboren, war, nach Rüppell’s Bericht, ein Mann von hagerer Statur und mittlerer Größe; in der [pg 17]Kopfform und Körperhaltung sprach sich ein gewisser Adel aus und seine schönen lebhaften Augen verriethen Geist und Gewandtheit; seine Gesichtsfarbe war gelbbraun; sein schöngelocktes Haar kurz verschnitten. Man rühmte ihm Tapferkeit, Großmuth, Freigebigkeit und Gerechtigkeitsliebe nach. „Die Art, wie er den Frieden in Tigrié herzustellen und zu befestigen suchte,“ sagt Rüppell, „giebt eine offene und loyale Handlungsweise zu erkennen, wie sie die jetzigen Abessinier leider nicht verdienen.“ Auch mit Hülfe der Geistlichkeit suchte er seine Macht zu befestigen. Denn schon seit vierzehn Jahren war der Sitz des Metropoliten von Abessinien verwaist, als Ubié im Jahre 1841 mehr aus politischem als kirchlichem Interesse in Abba Salama einen neuen Abuna (Erzbischof) aus Kairo holen ließ. Er hatte schon längst darauf gesonnen, Ras Ali zu stürzen und durch Einsetzung eines neuen Königs auf den Thron von Gondar sich selbst zum Ras oder Protektor des Reiches, also zum obersten Machthaber des ganzen Landes, zu erheben. Der Abuna sollte durch seinen Einfluß auf die Kirche seine Macht verstärken und wol auch den neuen König salben, zu welchem der Prinz Tekla Georgis bestimmt war, der jedoch bald starb.
Allein keiner von beiden Rivalen, weder Ubié noch Ras Ali, sollte auf den alten Thron Abessiniens gelangen, – die Herrschaft fiel einem dritten zu, der, vom Glücke begünstigt, mit Thatkraft ausgerüstet, wenigstens zeitweilig dem grauenhaften Zustande ein Ende machte, welcher seit langem das Land zerfleischte und Rüppell die Worte abdrängte: „Ich muß gestehen, daß bei dem jetzigen gesetzlosen Zustande des ganzen Landes nicht der geringste Hoffnungsstrahl einer sittlichen Regenerirung der Nation leuchtet und daß der vollkommene Mangel einer kräftigen Regierung das Haupthinderniß dabei ist und um so schwerer zu beseitigen sein wird, da gegenwärtig auch nicht eine einzige Fraktion des Volkes an die Herstellung einer solchen denkt. Der letzte Schatten eines gemeinsamen politischen Oberhauptes ist mit der Absetzung des Kaisers Saglu Denghel geschwunden. Die Geschichte der letzten sechzig Jahre zeigt eine vollkommene politische Auflösung des Landes und dreht sich blos um die Häuptlinge, welche in den verschiedenen Provinzen, als gleichsam voneinander unabhängigen Staaten, sich zu unumschränkten Herrschern aufwarfen, durch List und Kühnheit ihre Nebenbuhler verdrängten und dann meistens selber wieder durch Treulosigkeit ihrer Verbündeten gestürzt wurden. So herrschen denn fortwährend Bürgerkriege, welche in der Regel keinen andern Zweck haben, als einen durch Versprechungen und Eidschwüre eingeschläferten Gegner zu verdrängen, und die Bewohner einiger Distrikte, die in einem kurzen Frieden etwas Eigenthum erlangt haben, auszuplündern. Die nothwendige Folge davon ist eine stets zunehmende Verarmung; das Grundeigenthum hat beinahe gar keinen Werth mehr; der Ackerbau wird immer mehr vernachlässigt; die Viehherden sind ungemein zusammengeschmolzen und der Verkehr ist wegen der großen Unsicherheit oft ganz unterbrochen.“
Rüppell bezieht diese Worte auf das Jahr 1833; allein sie hatten noch Geltung in der Mitte dieses Jahrhunderts; der traurige Zustand des armen [pg 18]Landes und Volkes, das nach Erlösung aus diesen Uebeln jammerte, war bis dahin und ist auch noch heute derselbe.
Auf eine Hoffnung aber baute seit alten Zeiten jedermann in Abessinien. Nach der Tradition sollte ein König Theodoros erscheinen, um dem Lande den ewigen Frieden zu bringen. Dieser Theodoros regierte einst schon im 15. Jahrhundert und ward heilig gesprochen; aber wie unser Barbarossa wird er, so glaubt der Abessinier, wiederkehren zu seiner Zeit, um das Reich des ewigen Friedens in Aethiopien einzuführen. An der Spitze seiner Scharen wird er das heilige Grabmal den Händen der Ungläubigen entreißen, die Türken aus Europa in ihre ursprüngliche asiatische Wildniß zurücktreiben, Mekka und Medina zerstören und die ganze muhamedanische Religion von der Erde vertilgen. Wo er hinkommt, weilt der Friede, und Jerusalem wird der Hauptsitz der abessinischen Kirche, welche sich dann zu Glanz und unerhörter Blüte entfalten wird. – –
Wohl kam der Held, der den Thron bestieg, allein der ersehnte Friede blieb aus. Theodoros II., der Sohn einer armen Frau, vereinigte das Reich wieder in seiner starken Hand und hob es zu einer Stellung, wie zuvor nie.
Ueber die Verfassung Abessiniens können wir kurz berichten. Der Herrscher (Kaiser oder König) führt den Titel Negus oder Negus Nagast za Aitiopija, d. h. König der Könige von Aethiopien. Die Residenz war in der älteren Zeit zu Axum; gegen Ende des 13. Jahrhunderts, als die alte salomonische Dynastie wieder zur Regierung kam, eine Zeit lang zu Tegulet in Schoa, später zu Gondar, wenn auch das ehrwürdige Axum noch immer Krönungsort blieb. Allein der düstere Palast, den die Jesuiten zur Zeit des Königs Fasilides in Gondar errichtet hatten, behagte den Herrschern nicht, die lieber in ihrem rothen Zelte im freien Feldlager residirten und dort ihre Einkünfte an Herden, Getreide, Gold, Zeugen in Empfang nahmen, während sie die Zölle und Wegegelder den Verwaltern der Provinzen überließen. Im Grunde aber war der Negus Herr des ganzen Landes; er konnte nach Belieben jedem Verwalter seinen Grund und Boden nehmen, um denselben einem andern zu schenken, und von dieser Macht haben die Könige auch fortwährend reichlich Gebrauch gemacht. Ihre Macht war in der That unumschränkt, und nur über gewisse, durch Jahrhunderte alte Sitten und geheiligte Fundamentalordnungen wagten auch sie sich nicht wegzusetzen. Ein Adel existirte dem Namen nach; doch nur die Mitglieder des königlichen Geschlechtes erschienen bevorzugt, wenn auch die Brüder des Herrschers bis ins vorige Jahrhundert hinein in Staatsgefängnissen gehalten wurden, um keine Intriguen anzetteln zu können. Ein besonderes Ministerium gab es nicht, wohl aber zahlreiche Hof- und Staatsämter. Welche Rolle die Gouverneure und Majordomen (Ras) spielten, zu welchem Ansehen sie gelangten und wie sie ihre Gewalt an Stelle der Königsmacht setzten, wurde bereits gezeigt.
Nächst dem Ras war früher der mächtigste Gouverneur der von Tigrié, der den Titel Lika Kahenat (Hoherpriester) und Nabr Id als Hüter der Bundeslade [pg 19]in Axum führte. Der höchste Würdenträger ist gegenwärtig der Herzog oder Detschasmatsch (Dadjazmatsch, Djeaz, Djeatsch, Kasmati). Das Wort bedeutet eigentlich einen, „der an der Thüre kämpft“, um anzudeuten, daß im königlichen Heerlager dieser Würdenträger mit seinen Truppen die Stelle vor der Thüre des königlichen Zeltes hat und sich an die Leibgarde des Herrschers anschließt. Auf den Detschasmatsch folgt der Fit Auri, der Führer der Avantgarde. Er zieht mit seinen Truppen dem Heere rekognoscirend voran und lagert sich zwischen diesem und dem Feinde oder, wenn kein Feind da ist, in der Vorhut des Lagers. Niedere Würdenträger sind der Kanjasmatsch, der mit seinen Truppen zur Rechten des königlichen Zeltes lagert, und der Gerasmatsch zur Linken desselben. Neben diesen kriegerischen Würden gab es auch friedliche. Bei Hofe war eine Anzahl gelehrter Männer, Lik geheißen, die zusammen eine Art Gerichtshof bildeten und mit deren Hülfe schwierige Fälle entschieden wurden. Die Justiz war von der Verwaltung nicht geschieden und das Gesetzbuch Feta Negust, d. h. Richtschnur der Könige, umfaßte das weltliche und kanonische Recht.
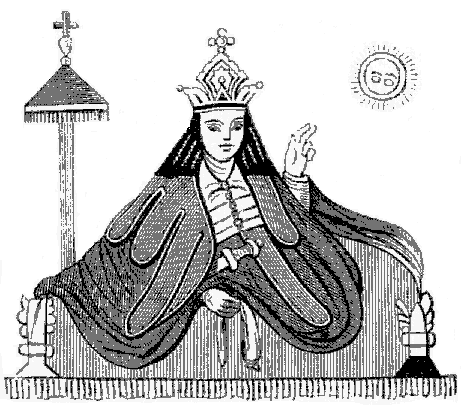
Dies ist in kurzen Umrissen die politische Geschichte Abessiniens, die zu derjenigen der europäischen Staaten nicht in der geringsten Beziehung stehen würde, wäre das Land nicht ein christliches Reich. Gerade aber dem Christenthum verdankt es das Interesse, welches für dasselbe stets im Abendlande wach war und welches eine Reihe ausgezeichneter Forscher und Missionäre nach jenem bergigen Lande in Nordostafrika wallfahrten ließ, um uns Kunde von seinen Wundern, seinen Naturschönheiten, seinen Bewohnern und deren Religion zu bringen.
Sehen wir ab von der schon erwähnten Fahrt des Kosmas Indikopleustes, eines christlichen Kaufherrn aus Alexandria, welcher im 6. Jahrhundert die Bai von Adulis besuchte und dort eine wichtige Inschrift kopirte, die er in seiner „Topographia christiana“ veröffentlichte, so treffen wir zunächst wieder im Dogenpalast zu Venedig in dem Weltbilde des Fra Mauro (15. Jahrhundert) auf ein Gemälde Abessiniens von wunderbarer Treue. Nicht blos kennt der Venetianer den rechten Nebenfluß des Nil, den Takazzié, unter seinem wahren Namen, sondern er zeigt uns auch den spiralförmig gekrümmten Lauf des Blauen Nil, den er mit seinem abessinischen Namen Abai bezeichnet. Mehrere [pg 20]abessinische Landschaften, wie Gozan, Bagamidre (Begemeder), Hamara (Amhara) und Saba (Schoa), kommen bereits bei ihm vor. Auch die Küstenstriche des Osthorns von Afrika waren ihm wohlbekannt. In die Nähe der Bab el Mandeb verlegt er die Sitze der Danakil, die Stadt Zeyla und den Landstrich Adal. Er zeichnet uns dann den Lauf des Awasi (Hawasch), in dessen Nähe er die Stadt Härrär setzt.
Im 13. Jahrhundert unterhielt man von Rom aus einen schriftlichen Verkehr mit dem christlichen Abessinien und seit 1243 hören wir auch von Missionen, die dorthin entsendet wurden. Marino Sanuto machte deshalb zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Christen Europa’s aufmerksam, wie nützlich ein Bündniß mit den Glaubensgenossen in Nubien oder Habesch bei einem Kreuzzuge gegen Aegypten sein müßte. Seit der Mitte jenes Jahrhunderts wurde auch auf die abessinischen Könige der Titel des Erzpriesters Johannes übertragen und die Kunde von einem angeblich mächtigen Christenreich im Morgenlande vom chinesischen Himmelsgebirge plötzlich nach den Alpenländern am Blauen Nil verlegt. Botschafter dieser Erzpriester erreichten nicht blos die römische Kurie, sondern auch andere europäische Höfe, und die von ihnen eingezogene Kunde wurde getreulich auf den Karten niedergelegt. Als daher die Portugiesen unter Prinz Heinrich dem Seefahrer im 15. Jahrhundert ihre afrikanischen Entdeckungsreisen antraten, war das ferne christliche Reich, das die Geographen jener Zeit das „dritte Indien“ nannten, das äußerste Ziel, welches sie anfänglich ins Auge faßten und auf dem Wege des fabelhaften „Goldflusses“, der ganz Afrika der Quere nach durchströmen sollte, zu erreichen hofften.
Später, als der Seeweg nach Ostindien gefunden war und die Portugiesen sich dort festgesetzt hatten, beschifften sie auch das Rothe Meer und gelangten am 16. April 1520 nach Massaua, dem Ausfuhrhafen der Abessinier. Dort erreichten sie also das ursprüngliche Ziel des Infanten Heinrich, des Seefahrers, das Reich des afrikanischen Erzpriesters Johannes. Statt einer mächtigen Herrschaft, wie sie erwartet hatten, fanden sie aber nur ein beschränktes, in ihren Augen ärmliches Gebiet, rohe Bewohner und ein verwahrlostes Christenthum.
Die bald darauf folgende portugiesische Invasion und die Bemühungen der Jesuiten, die Abessinier zur katholischen Kirche zu bekehren, wurden bereits oben erwähnt. Durch die Berichte der Jesuiten-Missionäre erhielt man dann die erste ausführliche Kunde von den Glaubensbrüdern im Innern Afrika’s und ihrem Lande. Viele wichtige Nachrichten gelangten namentlich durch die Reise des Alvarez (1520–1526) zu uns, der ganz Aethiopien durchpilgerte und südwärts in ferne, noch jetzt beinahe unerforschte Gegenden vor mehr als 300 Jahren gedrungen ist. Bermudez hat uns einen kurzen Bericht über seine Gesandtschaftsreise (1555) hinterlassen; ausführlicher sind die fast gleichzeitigen Barreto und A. Orviedo, ferner Paez (1618), Ameida, Mendez (1625) und endlich P. Lobo, der 1640 nach Europa zurückkehrte.
Nun sollten auch die Deutschen ihren Theil an der Erforschung oder vielmehr Bekanntmachung Abessiniens haben. Im Jahre 1681 erschien zu Frankfurt am [pg 21]Main ein glänzendes literarisches Meisterstück deutscher Gelehrsamkeit, Hiob Leutholf’s (Ludolf’s) klassische „Historia aethiopica, sive brevis et succincta descriptio regni Habessinorum, quod vulgo male Presbyteri Joannis vocatur“, welcher noch mehrere Kommentare und Anhänge folgten. Die Natur des Landes und seine Einwohner, die Geschichte, die Religion und kirchlichen Verhältnisse, die Literatur Abessiniens werden darin ausführlich behandelt. Große Hülfe bei der Ausarbeitung seiner Werke erhielt Leutholf von dem amharischen Patriarchen Abba Gregorius, der kurze Zeit am Hofe des Herzogs Ernst von Sachsen-Gotha weilte und dessen Porträt in dem Kommentar mitgetheilt ist. Die Kleidung der Einwohner, Abbildungen der Pflanzen und Thiere, der Alterthümer des Landes sind in einer für die damalige Zeit sehr treuen Wiedergabe in den Werken Leutholf’s enthalten, der uns auch die Korrespondenz der abessinischen Könige mit den Königen Spaniens, ein Verzeichniß äthiopischer Manuskripte, Gebete und Liturgien, den abessinischen Kalender u. s. w. übermittelt hat und dessen Werk fast ein Jahrhundert lang die vorzüglichste Quelle über Abessinien blieb. Kurz darauf, nachdem Leutholf seine äthiopische Historie veröffentlicht hatte, durchzog 1698 der französische Arzt Poncet das ganze Land, indem er, von Sennar ausgehend, über Amhara und Tigrié bis Massaua gelangte. Gründlicher als alle seine Vorgänger förderte aber 70 Jahre später, durch Leutholf’s Geschichte angeregt, der Schotte James Bruce unsere Kenntniß des Landes durch Sammlung geschichtlicher Urkunden und Quellen, sowie durch genaue astronomische Ortsbestimmungen.
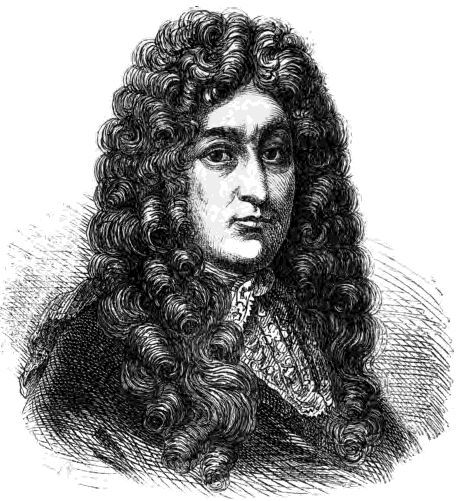
James Bruce, geboren den 14. Dezember 1730 zu Kinnaird in Schottland, wird für alle Zeiten als einer der bedeutendsten unter den abessinischen Reisenden dastehen. In Algier, wo er 1763 als englischer Konsul angestellt worden war, beschäftigte er sich eifrig mit dem Studium der morgenländischen Sprachen und machte von dort aus Reisen längs der Küste des Mittelmeers, den Nil aufwärts bis Syene und nach Baalbek und Palmyra in Asien, wo er die berühmten Alterthümer zeichnete. So vorbereitet trat er im Jahre 1769 seine große Reise an, auf der er von Massaua unter großen Mühen und Gefahren bis Gondar gelangte, wo er sich bei der hier ausgebrochenen Blatternseuche durch Anwendung europäischer Heilmittel sowol bei Hofe als im Volke großes Ansehen erwarb und Gelegenheit fand, in alle Einzelheiten des Volkslebens einzudringen, sowie mit dem furchtbaren Ras Michael freundlich zu verkehren. Er blieb über drei Jahre in Abessinien, fand die Quelle des Abai oder Blauen Nil im Südwesten des Tanasees und brachte ein ganzes Jahr damit zu, seine Reise nördlich durch das Land der wilden Schankela oder Schangalla (Heiden) und Nubien nach Alexandria fortzusetzen, das er im Mai 1773 glücklich erreichte. Seine Reisebeschreibung (Travels into Abyssinia) gab er in fünf Bänden erst 1790 zu Edinburg heraus, worauf er bald (16. April 1794) durch einen Sturz von der Treppe sein Leben endete. Er, der so vielen Gefahren getrotzt, so große Mühen und Beschwerden muthig ertragen, endete auf diese Weise! Die letzten vier Jahre seines Lebens waren ihm noch außerordentlich verbittert worden. Als er sein umfangreiches Werk veröffentlichte, fand das Publikum darin eine solche Menge von ungewöhnlichen Nachrichten, Uebertreibungen und Ungeheuerlichkeiten, daß man den Reisenden kurzweg für einen Lügner erklärte. Er wurde mit Zuschriften bestürmt, die weisen Kritiker behandelten ihn unbarmherzig, und namentlich konnte man sich über die Angabe, daß die Abessinier rohes Fleisch von lebenden Thieren genössen, nicht beruhigen, eine Angabe, auf die wir ausführlich zurückkommen. Man nannte ihn Mr. Mendax, Herr Lügner; aber die Zeit hat ihn gerechtfertigt, wenn er selbst auch nicht die Genugthuung erlebte, die Zweifler bekehrt zu sehen.
Drei Jahrzehnte waren seit Veröffentlichung von Bruce’s so oft angefochtener Beschreibung verflossen, als die englische Regierung den ersten Entschluß faßte, mit dem merkwürdigen abessinischen Volke in Verbindung zu treten. Lord Valentia wurde zu Anfang dieses Jahrhunderts beauftragt, eine Reise ums Kap der guten Hoffnung herum nach dem Rothen Meere zu machen, die ganze ostafrikanische Küste wissenschaftlich zu untersuchen, besonders die genauesten Nachrichten über Abessinien einzuziehen und die geeigneten Schritte zu thun, eine Verbindung mit diesem Lande anzuknüpfen. Diese Reise war von vielen wichtigen Resultaten für die genauere Bekanntschaft mit den hervorragendsten Punkten an der ostafrikanischen Küste, sowie für die Belebung des indischen Handels begleitet; jedoch hatte sie für Abessinien nicht den Erfolg, den sie hätte haben können, wenn die Unterhandlungen kräftiger betrieben worden wären. Valentia selbst blieb in Mocha an der arabischen Küste, während er seinen [pg 23]wissenschaftlich gebildeten, tüchtigen Sekretär Henry Salt mit der Sendung nach Abessinien betraute. Dieser machte die Reise über Massaua, Arkiko, Halai, Dixan nach der Provinz Enderta, wo er, da er nicht zum Könige selbst in Gondar gelangen konnte, mit dem Ras Walda Selassié unterhandelte. (Vergl. oben S. 14.) Es gelang dem gewandten Salt durch die glänzenden Geschenke, welche er dem Ras im Namen Georg’s III. von England überreichte, denselben vom Wohlwollen der englischen Regierung zu überzeugen und ihn zu einer Verbindung mit England zu bewegen. Er kehrte mit ausführlichen Nachrichten über das Land und seine Bewohner und mit der Ueberzeugung zurück, daß sich hier England für die Erweiterung seines Handels als auch der Kultur ein weites und günstiges Feld eröffne. Einer von Salt’s Begleitern, Pearce, blieb am Hofe des Ras zurück. Dieser ersten Reise folgte bald darauf, gegen das Jahr 1814, nachdem Salt’s Gönner, Lord Valentia, in den Pairsstand erhoben worden war, eine zweite Gesandtschaft unter Salt’s eigener Führerschaft. Diese hatte den Erfolg, daß das gute Vernehmen zwischen England und dem alten Ras gestärkt und durch Pearce’s längeren Aufenthalt die Bekanntschaft mit Abessinien vermehrt wurde. Wieder traten nun politische Wirren in Tigrié ein, welche England die Lust benahmen, weiter in die Angelegenheiten des Landes einzugreifen, bis im Jahre 1841 Kapitän Harris nach Schoa ging und jene politische Mission ausführte, von welcher wir eine ausführliche Schilderung weiter unten nach dessen 1844 zu London erschienenem dreibändigen Werke „The highlands of Aethiopia“ mittheilen.
Es konnte nicht fehlen, daß bei den merkwürdigen Sagen, die über Abessinien umgingen, und bei der Unbekanntschaft, die über dessen Volk und Natur noch herrschten, auch die Deutschen ihren Antheil an der näheren Erschließung des Landes nahmen, nachdem Ludolf mit so gutem Beispiele, wenn auch nur theoretisch, vorangegangen war. Den Reigen eröffneten zwei der besten deutschen Naturforscher: W. F. Hemprich und C. G. Ehrenberg, welche schon früher Nubien durchzogen hatten und nun, von der preußischen Regierung unterstützt, das Rothe Meer besuchten. Von Massaua aus durchwanderte Hemprich die Küstengebirge, während Ehrenberg nach den heißen Quellen von Eilat zog. Nach Massaua zurückgekehrt, traf ihn der harte Verlust, am 30. Juni 1825 seinen Begleiter Hemprich dem Fieber erliegen zu sehen. Trotzdem war die naturgeschichtliche Ausbeute der Expedition ungemein reich, da nicht nur eine Menge ganz neuer Thierformen entdeckt, sondern auch in den Oscillatorien, Wesen zwischen Thier und Pflanzen, die Farbe des Rothen Meeres erkannt worden war.
Die bedeutendste und ergebnißreichste Reise in Abessinien führte nach Bruce abermals ein Deutscher, Eduard Rüppell, geboren 20. November 1794 zu Frankfurt a. M., aus. Reich begütert und vortrefflich in naturwissenschaftlicher wie astronomischer Beziehung vorbereitet, hatte er nach einem kleineren Ausflug nach dem Orient, Nubien, Kordofan und das Peträische Arabien 1823–1825 besucht und sich dann Abessinien als Hauptziel seiner Forschungsthätigkeit erkoren. [pg 24]Am 17. September 1831 landete er auf Massaua an der abessinischen Küste, wo er den Rest des Jahres und den nächsten Frühling zu Ausflügen in die Umgebung, nach Arkiko, dem Thale Modat, den Dahalakinseln und nach den Ruinen von Adulis benutzte. Am 29. April 1832 trat er dann den Marsch nach dem inneren Hochlande an, welches vor ihm wissenschaftlich nur von Bruce und Salt beschrieben worden war. Wurde auch die ganze Reise glücklich zurückgelegt, so verlief sie doch nicht ohne große Gefahren, denn in Tigrié, wo gerade Ubié ans Ruder gelangt war, wütheten noch die grausamsten Bürgerkriege. Für diesen Herrscher hatte Rüppell ein sonderbares Geschenk, nämlich eine schwere Kirchenglocke bestimmt, deren Transport auf dem Rücken von Maulthieren viel Mühe verursachte, aber mit großer Freude angenommen wurde, da Glocken in Abessinien sehr selten sind. Um sich einen Schutz auf der Reise zu verschaffen, lieh Rüppell einem abessinischen Großhändler 600 Maria-Theresia-Thaler und zog nun durch den Tarantapaß auf Halai, die abessinische Grenzstation, zu. Schon hatte er sein Gepäck in Massaua zur Ueberfahrt nach dem Festlande zurechtgelegt, als ihm von einem betrunkenen türkischen Soldaten, der eine Pistole auf ihn abschoß, fast das Leben geraubt und die große, wohl vorbereitete Reise verhindert worden wäre. Von Halai wandte sich Rüppell in südlicher Richtung nach Atigrat am Fuße des hohen Alequa, kreuzte am 20. Juli das tiefe Thal des reißenden Bergstroms Takazzié und stieg hierauf in die hohen, oft von Schnee bedeckten, kühn geformten Alpen der Provinz Semién, wo er den fast 12,000 Fuß hohen Paß am Selkiberge überschritt und auf den Alpenwiesen in jener Region neben Ericabüschen jene seltsame, in ihrer Form an die Palmen erinnernde Pflanze, die Dschibarra, entdeckte, welcher Fresenius den Namen Rhynchopetalum montanum gegeben hat. Am 12. Oktober hielt er seinen Einzug in die Königsstadt Gondar, wo er der Absetzung des Königs Saglu Denghel beiwohnte und bis zum 18. Mai 1833 verweilte. Die Zwischenzeit benutzte er zu einem Ausfluge in die heißfeuchte Niederung (Kolla) von Workemeder und Ermetschoho, nördlich von Gondar, wo seine Elephantenjäger reichliche Beute fanden. Dann zog er dem Ostufer des Tanasees entlang, dessen Höhe über dem Meere er zum ersten male zu 5732 Fuß bestimmte. Weiterhin gelangte er dann zu der Stelle, wo unfern der berühmten Brücke von Deldei der Abai oder Blaue Nil dem Tanasee entströmt.
Am 18. Mai 1833 brach Rüppell von Gondar auf, um über die alte Krönungsstadt Axum, wo er eine wichtige altäthiopische Inschrift entdeckte, und über Adoa, die Hauptstadt Tigrié’s, wieder nach Massaua zurückzukehren, das er am 29. Juni glücklich erreichte. Seine Ausbeute, die er von dieser Reise mit heimbrachte, war eine ungemein reiche, denn nicht nur hatte er viele Orts- und Höhenbestimmungen vorgenommen, die der Karte Abessiniens ein wesentlich anderes Gepräge geben, sondern auch archäologische, historische und ethnographische Forschungen angestellt, vor allem aber die zoologische Kenntniß des Landes bereichert, wie seine „Neue Wirbelthiere zur Fauna Abyssiniens gehörig“ und seine „Uebersicht der Vögel Nordostafrika’s“ beweisen.
[pg 25]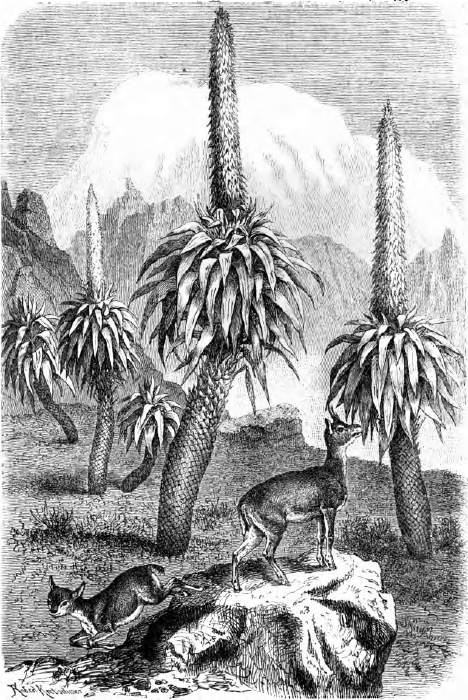
Originalzeichnung von Robert Kretschmer.
Seine „Reise in Abyssinien“ erschien 1840 zu Frankfurt a. M. Für alle seine Arbeiten wurde ihm denn auch die wohlverdiente Auszeichnung zu Theil, daß ihm die Londoner geographische Gesellschaft die große goldene Medaille verlieh. Seine reichen Sammlungen vermachte er seiner Vaterstadt Frankfurt, wofür diese ihm eine lebenslängliche Pension aussetzte.
Auf Rüppell folgten 1835 zwei Franzosen, die Stiefbrüder Tamisier und Combes, mit dem angeblichen Zwecke des einen, Menschenkenntnisse zu sammeln, des andern, sich für die Poesie zu begeistern. Sie kamen unter vielen Gefahren bis Schoa. Beide Herren waren Mitglieder der Sekte der Saint-Simonisten und haben nach ihrer Rückkehr 1846 zu Paris vier starke Bände („Voyage en Egypte, en Nubie etc.“) einer sehr romantischen und wenig glaubhaften Erzählung ihrer Erlebnisse und Abenteuer veröffentlicht. Mit nicht viel mehr Glück machte im Jahre 1836 Baron von Katte einen kurzen Ausflug nach Adoa in Tigrié, kehrte jedoch bald wieder zurück und beschenkte Deutschland mit einer Reiseschilderung, an deren Genauigkeit der gewissenhafte Rüppell gar manches auszusetzen hat. („Reise in Abyssinien im Jahre 1836“. Stuttgart und Tübingen 1838.)
Im Januar 1837 traf dann der deutsche Botaniker Schimper in Adoa, damals der Hauptstadt Ubié’s, ein. Wilhelm Schimper wurde im Jahre 1804 zu Mannheim geboren. Zuerst als Drechslerlehrling, dann als Unteroffizier, fand er keine Befriedigung seines Wissensdranges, weshalb er sich nach München wandte, um dort Botanik zu studiren. Nachdem er eine tüchtige Ausbildung erlangt, trat er größere Reisen nach dem Orient an; er besuchte, vom württembergischen Reiseverein unterstützt, Algerien, Aegypten, die Sinaihalbinsel und Arabien, von wo er überall reiche Sammlungen nach Hause brachte. Im Jahre 1835 ging er, um seine durch Fieber untergrabene Gesundheit wiederherzustellen, über Massaua in die abessinischen Hochlande, wo er bei Ubié in Adoa eine freundliche Aufnahme fand und seinen wissenschaftlichen Sammlungen nachgehen konnte. Sein Einfluß bei diesem Fürsten stieg immer mehr, sodaß Schimper als Statthalter zuerst einen Distrikt an der Gallagrenze, dann den Distrikt Antitscho in Tigrié zu verwalten hatte. Mit einem Worte, er wurde die rechte Hand Ubié’s, als dessen Baumeister und Minister er sich unentbehrlich zu machen wußte. Schimper war bereits früher in Rom zum Katholizismus übergetreten, weshalb er die Lazaristenmissionen unter de Jacobis in Abessinien unterstützte, was er um so leichter mit Einfluß auszuführen wußte, als er mit einer Tochter des Landes sich vermählt hatte. Auch begann er für Frankreich zu wirken, von wo aus er Unterstützungsgelder bezog, um dafür seine Sammlungen an den Jardin des plantes in Paris einzusenden. Nach dem Sturze Ubié’s hatte Schimper anfangs viel Ungemach auszustehen, doch kam er später bei Theodoros wieder in Gnade. Im Jahre 1861 schrieb Theodor von Heuglin über ihn: „Mein alter Freund Schimper wird bald wieder im Stande sein, seine botanischen und zoologischen Sammlungen fortzusetzen, die in den letzten fünf bis sechs Jahren ausschließlich nach Frankreich gegangen sind. Dr. Schimper zählt jetzt 57 Jahre, [pg 27]ist aber immer noch der alte rüstige und bewegliche Mann, voll unverwüstlichen Humors, als den ich ihn vor vielen Jahren hier kennen zu lernen das Vergnügen hatte.“
Bald nachdem Schimper in Abessinien sich niedergelassen hatte, beauftragte die französische Regierung die Aerzte Aubert und Dufey, wieder ein gutes Vernehmen mit den Eingeborenen herzustellen, das durch das Auftreten verschiedener französischer Abenteurer gestört worden war. Leider waren diese beiden Gesandten keineswegs die einer solchen Aufgabe gewachsenen Männer, denn durch eine Kette von Thorheiten und Schlechtigkeiten setzten sie den europäischen Charakter in der Achtung des Volks ganz herunter und vermehrten die Schwierigkeiten, die dem europäischen Verkehr im Lande schon im Wege standen. Dr. Aubert kehrte im Februar 1838 von Adoa nach Kairo zurück, während Dufey durch Schoa nach der Küste des Rothen Meeres ging und als der erste Europäer die gefährliche Straße von Ankober nach Tadschurra zurücklegte. Die Sendung dieser beiden Männer wurde, da das französische Interesse an Abessinien sich mehrte, die Vorläuferin einiger andern politischen und wissenschaftlichen Expeditionen von Frankreich aus, die vom Jahre 1839 an erfolgten. Zwei derselben waren 1839 und 1841 unter Lefêbvre’s, eine 1840 unter Combes’ Anführung (welcher zum zweiten male Abessinien besuchte) nach Tigrié und auch nach Amhara gegangen. Ubié, der damals noch in Tigrié herrschte, behandelte namentlich Lefêbvre sehr verächtlich, musterte die ihm vom Könige Ludwig Philipp übersandten Geschenke und sagte zu seinem Schatzmeister: „Nimm diesen Unrath in die Schatzkammer hinüber.“ Der Gesandte wurde trotzdem aufgefordert, am Essen mit theilzunehmen, wobei reichlich Honigwein kredenzt wurde, der den Herrscher bald trunken machte. In diesem Zustande forderte er den Herrn Gesandten auf, vor ihm zu tanzen, was nur durch das muthige Auftreten des Dolmetschers verhindert werden konnte. In Verbindung mit den französischen Gesandtschaften stand auch die Reise des belgischen Generalkonsuls in Kairo Blodell, im Jahre 1841, die um deswillen zu erwähnen ist, weil sie, von Massaua ausgehend, ganz Abessinien von Osten nach Westen durchkreuzte, indem Blodell über Sennar und Chartum nach Kairo zurückkehrte. Reiche wissenschaftliche Arbeiten lieferte um dieselbe Zeit die Expedition des Franzosen Galinier nach Tigrié, Semién und Amhara.
Combes war von Ubié gut aufgenommen worden, aber die freundschaftlichen Verhandlungen wurden bald abgebrochen durch die Ankunft der Gebrüder d’Abbadie, von denen der eine Ubié beleidigt hatte durch seinen Antheil an einem Streifzuge gegen seine Truppen. Die d’Abbadie’s wurden mit der Drohung verwiesen, daß, wenn sie je wieder ihre Füße in Ubié’s Gebiet tragen sollten, dieselben ihnen abgehauen würden. Ebenso mußten infolge dieses Vorfalles Combes und Lefêbvre das Land verlassen. Abgesehen von ihren politischen Intriguen waren die Gebrüder Anton und Michael d’Abbadie ausgezeichnete, mit tüchtigen Kenntnissen versehene und reich begüterte Männer, die nicht unwesentlich für die Erweiterung unserer Kunde Abessiniens thätig waren und sind, wenn sie [pg 28]auch ihr Hauptaugenmerk auf die Verbreitung des Katholizismus und auf die Förderung der Interessen Frankreichs gewandt haben mögen. Nach langen Vorbereitungen und einigen mißglückten Versuchen gelang es 1842 Anton d’Abbadie, über Tigrié in das Binnenland einzudringen, wo er sich mit der Erforschung Enarea’s, Kaffa’s und des Quellgebiets des Uma beschäftigte. Nach zehnjähriger Abwesenheit kehrten beide Brüder 1848 nach Frankreich zurück, wo sie die Resultate ihrer Arbeiten in einzelnen Abhandlungen veröffentlichten.
Politik und Religions- oder Missionsangelegenheiten begannen überhaupt allmälig bei den abessinischen Reisenden die Hauptsache, die Wissenschaft aber die Nebensache zu werden. Englische Reisende und protestantische Missionäre wirkten im Interesse Großbritanniens, katholische Sendboten und französische Reisende im Interesse Frankreichs. Kein Wunder also, daß die abessinischen Fürsten, welche die Plane bald durchschauten, mißtrauisch wurden und einzelne Reisende schlecht behandelten. Der abenteuerlichste unter allen war wohl Rochet d’Héricourt, nach Isenberg’s Bericht ein französischer Glücksritter, der sich mehrere Jahre hindurch in Kairo als Chemiker und Mineralog aufhielt und beständig mit dem Plane umging, nach Abessinien zu reisen, um sich dort Geld zu machen. Nachdem ihm mehrere Versuche mißlungen waren, setzte er endlich 1839 sein Vorhaben ins Werk, indem er den deutschen Missionären nach Schoa folgte. Als er dort jedoch nicht gleich zu großen Reichthümern gelangte, wurde er ungehalten und von dem Könige für halb verrückt angesehen. Bald sollte sich die Sache jedoch wenden und Rochet zu großem Ansehen gelangen. Da der König, dessen erste Frage an jeden ankommenden Europäer gewöhnlich die war, was er verstehe, Rochet’s chemische Fertigkeiten in Pulvermachen, Seifensieden, Zuckerfabriziren und andern Dingen bemerkte, stieg letzterer hoch in seiner Achtung. Außerdem versprach der Franzose, ihn von einer gewissen heimlichen Krankheit zu heilen, und als diese Kur zu gelingen schien, wurde er dem Könige unentbehrlich. Rochet benutzte nun, wie es die Franzosen gewöhnlich thun, die steigende Gunst beim Könige, sich politisch mächtig zu machen, indem er Schoa dem französischen Einflusse zu eröffnen und den Engländern entgegenzuwirken suchte. Als er nach neunmonatlichem Aufenthalte wieder in sein Vaterland zurückkehren wollte, bestimmte er den Negus dahin, ihm einen Brief und Geschenke an den König Ludwig Philipp von Frankreich mitzugeben und auf diese Weise eine politische Verbindung zwischen Frankreich und Schoa einzuleiten. Dieses einseitige Vorgehen suchten aber in Englands Interesse die deutschen Missionäre, namentlich Krapf, zu verhindern, indem sie den König bewogen, eine Botschaft nach Bombay zu senden, um einen Freundschafts- und Handelsvertrag mit England abzuschließen. Als Erwiederung dieser Botschaft erschien dann die glänzende Ambassade unter Kapitän Harris.
Inzwischen war Rochet in Paris angekommen und hatte die dortige Regierung seinem Wunsche, mit Schoa in Verbindung zu treten, geneigt gefunden. Nachdem er eine Beschreibung seiner Reise herausgegeben hatte („M. Rochet d’Héricourt, Voyage sur la côte occidentale de la Mer Rouge, dans le pays [pg 29]d’Adel et le Royaume de Choa.“ Paris 1841), kehrte er im Auftrage seiner Regierung und der Pariser Akademie der Wissenschaften wieder nach Schoa zurück. Kaum an der Küste angelangt, wußte er es durchzusetzen, daß der König von Schoa befahl, keinen andern Europäer, sei er Franzose oder Engländer, außer ihm nach Schoa kommen zu lassen, bei Verlust des Lebens. Infolge dessen mußten denn die deutschen Missionäre Krapf, Isenberg und Mühleisen von Zeyla aus, wohin sie sich 1842 zu einer zweiten Reise nach Schoa begeben hatten, unverrichteter Dinge umkehren. Rochet bereiste nun weit und breit das Innere des Landes und gab uns in einem zweiten Werke („Second voyage“, Paris 1846) neue werthvolle Nachrichten über Schoa.
Nach Isenberg erhielt Rochet nur durch ein listiges Vorgeben die Erlaubniß des Königs, in das Innere von Schoa vorzudringen. Er behauptete nämlich, nur dann den König heilen zu können, wenn er ein Präparat von einem ungeborenen Hippopotamus mache, das er aus einem fernen See holen müsse. Das nachtheiligste Licht auf Rochet’s Wahrheitsliebe und Glaubwürdigkeit wirft indessen wol, was der deutsche Missionär Ludwig Krapf über ihn berichtet. Beide befanden sich im November 1839 im Kriegslager des Königs Sahela Selassié von Schoa, der auf einem Feldzuge gegen die Galla begriffen war. Man war in der Nähe der Quellen des Hawaschflusses, allein beide Europäer bekamen sie nicht zu Gesicht, während Rochet sich in seinem Reisewerke für deren Entdecker ausgiebt. Der biedere Krapf giebt uns den nöthigen Kommentar zu dieser wissenschaftlichen Schwindelei. „Rochet“ so schreibt Krapf, „sagte zu mir im Verlaufe des Feldzuges, daß wir angeben müßten, die Quellen des Hawasch wirklich gesehen zu haben. Als ich ihm erwiederte, daß dieses ja nicht der Fall gewesen, antwortete er lächelnd: Oh, wir müssen Philosophen sein.“ – So erlauben sich gewissenlose Reisende Geographie zu machen oder vielmehr zu fälschen.
Die Anzahl der Reisenden, welche Abessinien besuchten, beginnt sich nun ungemein zu häufen, sodaß wir nur die wichtigsten unter ihnen hervorheben können.
Dr. Beke, früher englischer Konsul in Leipzig, reiste 1840 von London nach Aden, unterstützt von den Freunden Afrika’s, um in Schoa und den angrenzenden Ländern Nachrichten über das Innere und besonders über den geistigen Zustand der dasselbe bewohnenden Völker einzusammeln. Glücklich kam er über Tadschurra in Ankober an, wo der Missionär Krapf ihm Hülfe leistete und sich in den Verhandlungen zwischen Beke und dem Könige manche Beschwerden und Unannehmlichkeiten zuzog. Später, nach Ankunft der englischen Gesandtschaft und von dieser unterstützt, reiste er nach Godscham, von wo er durch die Provinzen Jedschau, Waag und Enderta nach Antalo ziehend, Tigrié erreichte. Die Frucht seines langen Aufenthalts waren verschiedene wissenschaftliche Werke; namentlich widmete er sein Augenmerk der politischen Rivalität der Franzosen und Engländer im Rothen Meere, welche die großen Fragen des Suezkanals und des ostindischen Ueberlandwegs einschließt und über welche er in seinem Werke „The French and the English in the Red Sea“ seine Ansichten niedergelegt hat.
[pg 30]
Mit Schimper’s Schicksal im engsten Zusammenhange steht ein anderer deutscher Landsmann, dem wir bei Abfassung dieses Werkes zu ganz besonderm Danke verpflichtet sind. Christoph Eduard Zander, von dem ein Theil der charakteristischen Illustrationen dieses Buches herrührt, ward am 22. Oktober 1813 in der kleinen anhaltischen Stadt Radegast geboren. In seiner Heimat, wo er noch immer den besten Ruf genießt, wird er als ein Mann von bescheidenem, anspruchslosem Wesen und tief religiösem Charakter geschildert, der eine ganz besondere Fertigkeit in den verschiedensten technischen Dingen besaß. Zander erlernte die Landwirthschaft, wandte sich dann aber zur Malerei und hielt sich zu seiner Ausbildung längere Zeit in München auf. Neben seiner Kunst interessirte er sich aber auch lebhaft für das Artilleriewesen, eine Neigung, die ihm später sehr zu statten kam. Da es ihm nicht gelang, als Maler und Zeichner seinen Unterhalt hinreichend zu erwerben, ging er auf den Rath einiger Freunde zu Dr. Schimper. Nach einer langen Fahrt durch das Rothe Meer, auf welcher er von Krankheit und Hunger geplagt wurde, warf seine Barke am 12. September 1847 bei Massaua Anker. Durch den Tarantapaß stieg er in das abessinische Hochland hinauf und schrieb in Halai einen Brief an Schimper, in welchem er diesen von seiner Ankunft in Kenntniß setzte. Trotz einer niederschlagenden, ihn zurückweisenden Antwort beschloß er dennoch, nach Antitscho, Schimper’s Distrikt, vorzudringen. Da aber ringsum das Land von Rebellen verwüstet wurde, konnte dies nicht ohne Lebensgefahr geschehen; doch gelangte er glücklich an sein Ziel, wo er von dem Landsmann gut aufgenommen wurde. Als Gehülfe Schimper’s bei dessen naturwissenschaftlichen Arbeiten durchstreifte er weit und breit das Land, sammelnd und zeichnend, bis er endlich zum Oberhofbaumeister des Regenten Ubié vorrückte, von diesem Ländereien und Vieh [pg 31]erhielt und den Auftrag bekam, die Kirche von Debr Eskié in Semién zu bauen, dieselbe, in welcher am 11. Februar 1855 Theodor II. vom Abuna zum Herrscher über Gesammt-Abessinien gekrönt wurde. In Ubié’s Gunst immer mehr steigend, wurde Zander in den Adel erhoben; auch verheirathete ihn dieser Fürst mit einem schönen Gallamädchen. In der großen Schlacht von Debela am 9. Februar 1855, in welcher der alte Ubié von dem Emporkömmling Theodor besiegt wurde, kommandirte Zander die Artillerie des ersteren. Als alles für Ubié verloren war, trat Zander in die Dienste Theodor’s und wurde Befehlshaber der befestigten Insel Gorgora im Tanasee, wo er die Schatzkammer und ein Zeughaus des Königs zu hüten hatte. Dieser, der den tüchtigen, in allen technischen Dingen erfahrenen Mann zu schätzen wußte, machte ihn zu seinem Vertrauten und höchsten militärischen Würdenträger. Als solcher stand Zander auch noch 1868 an der Seite Theodor’s. Seine werthvollen Arbeiten über Abessinien, die uns in vieler Beziehung neue Gesichtspunkte eröffnen, sind in dem vorliegenden Buche benutzt worden und gereichen demselben als Originalbeiträge zur besondern Zierde.
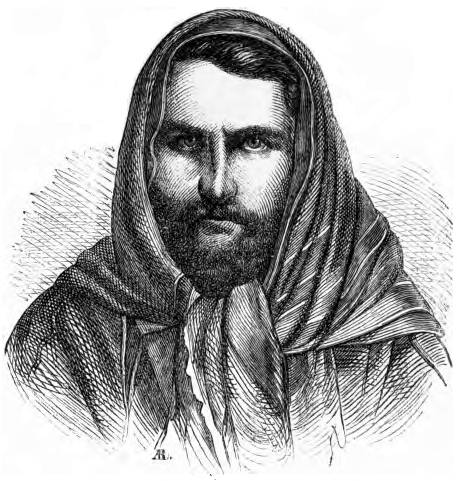
In jene Zeit, in welcher Abessinien gleichsam von europäischen Reisenden durchschwärmt war und ein Missionsversuch dem andern folgte, fallen auch die geographisch nicht unwichtigen Züge des italienischen Mönches Giuseppe Sapeto durch die nördlichen Grenzländer der Mensa, Bogos und Habab. Begleitet von den Brüdern d’Abbadie landete er im Jahre 1838 in Massaua und erreichte am 3. März desselben Jahres Adoa. Er wußte sich bei Ubié in Gunst zu setzen und gründete zu Adoa nach Vertreibung der protestantischen Geistlichen (siehe darüber weiter unten) eine katholische Mission, besuchte Gondar, sah sich aber nach fünfjährigem Aufenthalt – wie Isenberg angiebt, infolge liederlichen [pg 32]Lebens – durch Krankheit genöthigt, nach Aegypten zurückzukehren; aber 1850 begab er sich aufs neue nach Massaua, indem er längs der Westküste des Rothen Meeres hinaufreiste und nun mit dem Missionär Stella in die Länder der Bogos, Mensa und Habab vordrang, über die wir einen ausführlichen Bericht mittheilen werden. Es war dies gleichsam eine neue Entdeckung, denn in der That kannte man kaum den Namen der Habab, und die andern beiden Völker existirten bis dahin für uns nicht. Sapeto’s Werk erschien erst 1857 zu Rom und führt den Titel: „Viaggio e missione cattolica fra i Mensa, i Bogos e gli Hahab.“
Das in Rede stehende Gebiet ist wegen seiner leichten Zugängigkeit dann häufig das Ziel europäischer Reisenden geworden und uns nun fast so genau bekannt wie ein Land Europa’s. Am 13. Juli 1857 brach ein österreichischer Löwenjäger, Graf Ludwig Thürheim, nach Mensa auf, besuchte Keren, wo die katholischen Missionäre sich niedergelassen hatten, und gelangte glücklich durch Barka und Taka nach Chartum.
Die vorzüglichsten Nachrichten über jene Länder, werthvolle, bleibende Schätze der geographischen Literatur, verdanken wir indessen dem Schweizer Werner Munzinger. Dieser gelehrte, unternehmende Mann wurde 1832 zu Olten geboren. Er studirte in Bern und München Geschichte, Naturwissenschaften und orientalische Sprachen; in den letzteren vervollkommnete er seine Kenntnisse zu Paris. Schon im Jahre 1852, also im Alter von zwanzig Jahren, begab er sich nach Kairo, trat dort später in ein Handelsgeschäft, unternahm dann 1854 eine kaufmännische Reise nach dem Rothen Meere und benutzte die günstige Gelegenheit zu einem Ausfluge nach den Bogosländern. Es war schon damals sein Plan, sich dort niederzulassen, und er führte denselben unverweilt aus. Im Jahre 1855 ging er, mit Sämereien und Waffen wohl versehen, nach Keren, wo er dann längere Zeit gewohnt hat. Dort verfaßte er auch sein 1859 zu Winterthur erschienenes Werk „Ueber die Sitten und das Recht der Bogos“, dessen Vorrede aus Keren vom 31. November 1858 datirt ist. Er lebte wissenschaftlichen Forschungen, trieb dabei auch Handelsgeschäfte und machte sich bei dem Volke so beliebt, daß er oft das Richteramt ausübte und mit Regierungsgeschäften betraut wurde. Er fand aber auch Muße zur Ausarbeitung seiner Studien und schrieb nicht nur eine Grammatik des Belem, der Sprache der Bogos, sondern übersetzte in dieselbe einzelne Abschnitte der Bibel. Die inhaltreiche Arbeit über die Bogos war jedoch nur die Vorläuferin eines größeren Werkes: „Ostafrikanische Studien“ (Schaffhausen 1864), in welchem auch das Land der Marea, der Kunama oder Bazen und deren physikalische Verhältnisse in mustergiltiger Weise geschildert werden. Auf beide Arbeiten kommen wir später zurück; ebenso auf die Reise des Herzogs Ernst von Sachsen-Koburg-Gotha in jenen solchergestalt erschlossenen Gegenden im Jahre 1862.
Nicht unerwähnt darf hier bleiben, was die verschiedenen Missionäre, namentlich Isenberg und Krapf, für unsere Kenntniß Abessiniens gethan haben, deren Wirken bei der Schilderung der Missionsversuche die gebührende Würdigung erhält, während die Reise des vortrefflichen Franzosen Wilhelm [pg 33]Lejean im Jahre 1863, der in die Gefangenschaft des Königs Theodoros II. gerieth, gleich so vielen andern Europäern, in einem besondern Kapitel besprochen wird.
Hier soll nur noch die deutsche Expedition, oder wenigstens der Theil derselben, welche unter v. Heuglin und Steudner bis Etschebed in Dschama-Gala vordrang, als würdiger Schluß dieser Aufzählung der Reisen in Abessinien, ihre Erwähnung finden. Es handelte sich bekanntlich darum, das Schicksal des in Afrika verschollenen deutschen Reisenden Eduard Vogel aus Leipzig aufzuhellen, von dem man glaubte, daß ihn der Sultan von Wadaï zu Wara in Gefangenschaft halte. Zu dem Ende trat auf Anregung des Dr. August Petermann in Gotha ein Comité zusammen, welches in ganz Deutschland Sammlungen veranstaltete, eine Instruktion entwarf und mit der Leitung der Expedition Theodor v. Heuglin betraute. Ihm wurden als Botaniker beigegeben Dr. Hermann Steudner, geboren 1832 zu Greiffenberg in Schlesien, der Mechaniker Kinzelbach aus Stuttgart, welcher Positionsbestimmungen vornehmen sollte, M. L. Hansal, ein mit den Gegenden am oberen Weißen Nil schon vertrauter Mann, und endlich Werner Munzinger, der sich in Massaua an die Expedition anschließen sollte.

Theodor v. Heuglin, einer der bedeutendsten Reisenden der Gegenwart, geboren den 20. März 1824 zu Hirschlanden in Württemberg, unternahm bereits im Jahre 1850 eine Reise längs dem Rothen Meere, durchzog dann 1853 mit [pg 34]dem österreichischen Konsul Dr. Reitz von Galabat aus einen bedeutenden Theil Abessiniens, worüber er in seinen „Reisen in Nordostafrika“ (Gotha 1857) berichtete. Er wurde österreichischer Konsul in Chartum, erforschte die Somaliküste, sowie abermals das Rothe Meer, und trat schließlich an die Spitze der deutschen Expedition, die sich Glück zu wünschen hatte, einen so umsichtigen, thätigen und mit den Verhältnissen des Landes vertrauten Führer zu erhalten.
Am 17. Juni 1861 landeten die Mitglieder glücklich in Massaua, von wo sie sich nach Mensa und Keren in Bogos begaben, um sich auf die große Reise gehörig vorzubereiten. Mit Anfang Oktober, nachdem die eigentliche Sommerregenzeit zu Ende war, rüstete man sich zum Aufbruch, zog durch die bergige Provinz Hamasién und trennte sich zu Mai Scheka in Serawié. Munzinger und Kinzelbach reisten von hier aus am 11. November längs dem Mareb weiter nach Westen, um Nachrichten über Eduard Vogel einzuziehen, während Heuglin und Steudner einen höchst beschwerlichen, an Abenteuern, aber auch an Ausbeute reichen Zug nach Süden unternahmen, der sie bis ins Gallaland und das Feldlager des Königs Theodoros II. führte. Die Reisenden besuchten in Adoa den greisen Botaniker Schimper, machten mit ihm einen Ausflug nach den Ruinen von Axum, kreuzten den Takazzié, überstiegen die Alpen von Semién und zogen am 23. Januar 1862 in der Hauptstadt Gondar ein. Ihre Absicht, in westlicher Richtung weiter nach Westen vordringen zu dürfen, wurde vereitelt, denn aufs strengste hatte der Negus Befehl ertheilt, die Reisenden vor sich zu führen. Geleitet von deutschen Missionären begaben sie sich nun, am Nordufer des Tanasees hin, über Gafat und Magdala, das 15,000 Fuß hohe Kollogebirge durchziehend, in das Feldlager des Königs zu Etschebed im Lande der Dschama-Gala. Der Empfang war ein außerordentlich gnädiger, und reich beschenkt durften die Reisenden am 25. April den Rückweg antreten, auf welchem sie das 13,000 Fuß hohe Gunagebirge passirten, bei Wochni die abessinische Grenze erreichten und über Metéme und Gedaref nach Chartum gelangten, dessen Moschee ihnen am 7. Juli 1862 entgegenleuchtete. Die großen Reisen Heuglin’s und Steudner’s auf dem Weißen Nil und dem Gazellenfluß in Gemeinschaft mit den Damen Tinné, wobei Steudner im Dschurdorfe Wau am 10. April 1863 dem Klimafieber erlag, gehören nicht hierher. Außer in geographischer Beziehung war das Ergebniß der deutschen Expedition, welche allerdings das ursprüngliche Ziel, die Aufsuchung Eduard Vogel’s, aus den Augen verlor, namentlich für die Botanik und Zoologie von großem Werthe. Nachdem die Berichte derselben einzeln in den „Geographischen Mittheilungen“ und der Berliner „Zeitschrift für Erdkunde“ erfolgt, faßte sie Heuglin nochmals in seiner „Reise nach Abessinien“ (Jena 1868) zusammen.
Das Land, seine Pflanzen- und Thierwelt.
Begrenzung. – Das Hochland. – Geologie Abessiniens. – Der versteinerte Wald. – Heiße Quellen. – Oberflächengestaltung. – Natürliche Felsenfestungen. – Die Alpen Semiéns. – Charakter der Flüsse. – Ihr Anschwellen. – Ursachen der Nilüberschwemmungen. – Der Tanasee und der Abai. – Klimatische Verhältnisse. – Die Vegetationsgürtel. – Kola. – Woina Deka. – Deka. – Die niederen Thiere. – Vögel. – Säugethiere. Ihre Lebensweise, Nutzanwendung, Jagd.
Am südlichen Ende des Rothen Meeres, schroff gegen dessen Gestade abstürzend, aber langsam und allmälig gegen Ost-Sudan sich abstufend, liegt zwischen dem 16. und 8. Grade nördlicher Breite das afrikanische Alpenland Abessinien. Ringsum dehnen sich weite, ungesunde und glühende Sandwüsten aus, natürliche Grenzen, die den Verkehr erschweren und die ungeheure Bergfeste gegen feindliche Angriffe von außen zu schützen scheinen. Im Norden sind die [pg 36]Hochlande von Mensa, Bogos und die von den Beni-Amer am Barka bewohnten Gegenden die Grenze; im Westen das Gebiet der heidnischen Bazen, die wild- und steppenreichen, vom Setit und Salam durchflossenen Theile Ost-Sudans, der Neger-Freistaat Galabat und ein Gürtel von größtentheils unbewohnten, feuchten, mit Bambus und Waldregion bedeckten neutralen Gebiets, das sich gegen Ost-Senaar ausdehnt; im Süden bildet eine Strecke weit der Blaue Nil die Grenze, dann aber fast unbekannte, von den Gala bewohnte Distrikte; endlich im Osten, wo die Gebirgsmauern Abessiniens am steilsten abfallen, sind es die wasserlosen, von räuberischen muhamedanischen Hirtenvölkern bewohnten Küstenlandschaften, welche die Grenze ausmachen.
Ganz Abessinien ist im wesentlichen ein Hochland, das von allen Seiten mit steilen Rändern aus dem Flachlande aufsteigt. Wenn der Reisende diesen jähen Rand mühsam erklommen hat, während seine Füße von den scharfen Steinen geritzt, seine Kleider von den Stacheln der Mimosen zerrissen wurden, sieht er ein zweites und bald ein drittes Plateau vor sich, ebenso jäh wie das erste, ebenso rauh und zerklüftet. Wie an ein zerstörtes Titanenwerk erinnernd, drängen sich die Berge in den wunderbarsten Formen durcheinander. Hier Tafelberge gleich zertrümmerten Mauern, dort runde Massen in Gestalt von Domen, hier gerade oder geneigte, oder umgestürzte Kegel, spitz wie Kirchthürme, dort Säulenreihen in Gestalt ungeheurer Orgeln. In der Ferne verschmelzen sie mit Wolken und Himmel, und in der Dämmerung meint man ein aufgeregtes Meer vor sich zu sehen. Aber dieses Felsenmeer ist in seinem Innern keineswegs so starr und öde, als es der äußere Anblick erwarten läßt. Obgleich sich seine Berge in weiten Flächen oft zu einer Höhe von 10,000 Fuß erheben und ihre höchsten, sich in die Wolken verlierenden Gipfel über 15,000 Fuß hoch aufragen, birgt sich doch in seinen Thälern und Klüften manche Abwechselung, manche Landschaft voll tropischer Fülle.
Der geologische Charakter Abessiniens ist ziemlich einförmig und zeigt keineswegs große Abwechselung bezüglich der vorkommenden Formationen. Zander, der sich sehr eingehend mit der Bodenbeschaffenheit des Landes abgab, nimmt an, daß nur zwei allgemeine vulkanische Revolutionen und Hebungen des Landes stattfanden, daß dagegen partielle geologische Oberflächenveränderungen nicht vorhanden sind. Er bemerkt hierüber in dem erwähnten Manuskripte: „Die Uroberfläche des Landes war fast überall eben, und nur hier und da wurde dieselbe von Hügelketten durchzogen, deren höchste Spitzen bis zu 6000 Fuß über dem Meere anstiegen. Die allgemein herrschende Gebirgsart in jener Periode war Trachyt, dessen größte Mächtigkeit zwischen 6000 und 7000 Fuß beträgt und der oft von mächtigen Basalten durchsetzt ist, so in den Ländern Daunt, Woadla und Wollo, wo wir 70–100 Fuß mächtige Basalte antreffen.
„Diese „Uroberfläche“ Abessiniens wurde durch zwei nacheinander folgende vulkanische Revolutionen zerrissen, zerklüftet, zerspalten; es entstanden jene unzähligen größeren und kleineren Risse, von denen manche jetzt noch eine Tiefe von 4000–5000 Fuß haben, andere dagegen im Laufe der Zeit durch Erdbeben [pg 37]und Zersetzungen aller Art wieder verschüttet oder in sanfte Thäler umgewandelt wurden.
„Die erste dieser großen Umwälzungen hob das Land allgemein, nur waren ihre Wirkungen in den verschiedenen Theilen des Landes bald stärker, bald schwächer. Die höchsten Hebungen fanden statt in Semién, Woggera, Begemeder, Daunt, Woadla, Lasta, Talanta, Wollo und Schoa, während in Godscham die Hebungen bereits im Abnehmen sind, um sich in der Nähe des Nil ganz zu verlieren. Alle obengenannten Länder stehen in einem innigen Zusammenhange und zeigen durchweg den kräftigsten Verlauf der Hebung von Südost nach Nordwest. Zwischen der Wasserscheide des Rothen Meeres und des Nilgebietes im Osten und den Hochlanden von Semién im Westen war ein großes Becken entstanden, das die heutigen Länder Hamasién, Tigrié und Enderta umschloß. Hier, eingerahmt von den Hochlanden, breitete sich ein großer Süßwassersee aus, als dessen Ablagerungsprodukte und Zeugen seines einstigen Vorhandenseins der rothe Eisenthon, der Sandstein und die Grauwacke gelten müssen, welche hier in der ruhigen Periode zwischen der ersten und zweiten vulkanischen Umwälzung abgesetzt wurden. Neben diesen Flötzformationen treten als eigentliche Bildner des Landes folgende drei Gebirgsarten in Abessinien auf: zu oberst Trachyt, unter diesem Urthonschiefer von verschiedener, bis zu 1500 Fuß ansteigender Mächtigkeit, und zu unterst Granit, welcher oft mit Porphyr und Syenit wechselt.
„Die Wirkungen und Bewegungen der zweiten Umwälzung waren jenen der ersten ziemlich gleich. Die bedeutendsten Hebungen fanden jetzt auf der heutigen Wasserscheide des Rothen Meeres und Nilgebietes statt; die niedrigsten in den Ländern Semién, Woggera, Begemeder, Lasta und Wollo. Der große Süßwassersee im heutigen Tigrié verschwand, und sein horizontal gelagerter Absatz, das Eisenthongebirge und der Sandstein, erhielt eine sanfte Schrägung nach Westen hin, infolge der allgemeinen und überall gleichmäßigen Hebung; und in der That gewahren wir, wie heute das rothe Eisenthonplateau sich ununterbrochen und allmälig in westlicher Richtung bis Semién und von da noch nördlich bis Woggera und Wolkait absenkt. Die Gesammtsenkung beträgt ungefähr 2000 Fuß, denn die Eisenthone liegen an der Wasserscheide zwischen dem Rothen Meere und Nilgebiete 8000, an der Grenze von Wolkait und Semién dagegen nur 6000 Fuß hoch. So weit ausgebreitet dieses Eisenthonplateau auch ist, so wenig mächtig erscheint seine Lagerung; denn während es an der östlichen Grenze nur einige Zoll stark auftritt und im Innern Tigrié’s, seinem Centrum, eine Mächtigkeit von nahe an 12 Fuß erreicht, nimmt es am Fuße der Länder Semién, Woggera und Wolkait wieder bis zu 1 oder 2 Fuß Mächtigkeit ab.
„Unter diesem rothen Eisenthone folgt der Sandstein, dessen Oberfläche gleichfalls eben wie jene der Eisenthone verläuft, dessen Mächtigkeit aber von der Gestaltung der Urthonschiefer abhängig ist, welche seine Unterlage bilden. Risse und Spalten, welche die Eisenthone wie die Sandsteine (oder Grauwacke) durchziehen, zeigen einen äußerst wilden und romantischen Charakter, der selbst im Laufe der Jahrtausende, welche seit ihrer Bildung verflossen, nicht zerstört wurde.
[pg 38]„Auch durch die zweite gewaltsame Umwälzung entstanden viele neue größere und kleinere Risse, aus denen sich, wie bei der ersten Revolution, große Lavaströme auf die Oberfläche des Landes ergossen, namentlich auf der dem Rothen Meere zugekehrten Seite des östlichen Gebirgsabfalles. Wenn der Reisende von Massaua aus den Weg nach Halai einschlägt, so bieten sich seinem Auge am Fuße des Tarantagebirges und noch bis zur Hälfte an diesem hinauf in Rissen und Spalten große Lavaströme dar. So mündet ungefähr zwei Stunden oberhalb Hamhamo (im Tarantapaß) linker Hand ein Spalt in das große Thal, aus welchem sich ein etwa 40 Fuß hoher, gut erhaltener Lavastrom herabstürzt, und in vielen Spalten desselben Thales sind die Felswände noch hier und da mit Lava überzogen. Die hier stets herrschende heiße trockene Luft, die geringe Regenmenge waren der Erhaltung dieser Lavamassen besonders günstig, was vom Innern Abessiniens nicht behauptet werden kann, wo fortwährend starke Regen und feuchte Luft die Zersetzung der Laven begünstigen. Im Innern fanden überhaupt auch weniger Lavaergießungen statt und sind deren Spuren überhaupt äußerst selten. Einen merkwürdigen Lavaüberrest aus der Zeit der ersten Revolution fand ich am Flusse Mareb unterhalb der Ortschaft Gundet am Wege nach Hamasién. Er bildete die Spitze eines abgeplatteten Hügels, war fest auf den Trachyt gelagert, 2½–3 Fuß mächtig und bestand aus lauter Röhren von ½–1½ Zoll Durchmesser, die theils hohl, theils mit schmuziggelbem Eisenocker ausgefüllt waren.“
So viel berichtet Zander über die geologischen Verhältnisse des Landes. Zur weiteren Erläuterung fügen wir hier noch Rüppell’s kurze Bemerkungen bei: „Jenseit des flachen Meeresufers und in geringer Entfernung von der Küste erhebt sich ein mit diesem ziemlich paralleler Gebirgszug von imposanter Höhe, welcher zehn Stunden landeinwärts bereits durchschnittlich 8–9000 Fuß über die Fläche des Arabischen Busens hervorragt. Er besteht durchgehends aus Schiefer- und Gneisfelsen; an seiner östlichen Basis aber erblickt man mehrere Trachyt-Lava-Ströme; isolirte vulkanische Kegel tauchen aus der aufgeschwemmten Uferfläche des Annesleygolfs bei Afté und Zula hervor und das von Salt beobachtete Vorkommen des Obsidians zu Amphila ist ein Beweis für die Verbreitung einer früheren vulkanischen Thätigkeit längs der ganzen Küste hin. Westlich von dieser Küstengebirgskette bildet durchaus das nämliche Schiefergebilde den Kern der ganzen Landschaft und wird namentlich in allen tief eingewühlten Strombetten beobachtet. Diese Schieferformation ist mit einem weitverbreiteten, horizontal geschichteten Sandsteinplateau überdeckt, das aber durch spätere vulkanische Thätigkeit auf eine merkwürdige Weise theils senkrecht gespalten und verschoben, theils verschiedentlich emporgehoben wurde. An mehreren Orten, z. B. vermittelst der beiden Berge Alequa in den Provinzen Ategerat (Atigrat) und Schirié, durchbrach die Lavamasse die bereits sehr zerarbeitete Sandsteindecke und erhob sich, isolirte zugespitzte Kegelberge bildend, über dieselbe; anderwärts, wie in der Umgebung von Axum, entstanden durch diese Lavaergießungen zusammenhängende vulkanische Hügelzüge; stellenweise endlich senkte sich eine [pg 39]weite Strecke entlang die ganze Sandsteinformation und bildete die auf ihrer einen Seite durch steile Felswände begrenzte Verflachung der Landschaften von Geralta und Tembién, deren mittlere Erhebung über die Meeresfläche auf sechstausend Fuß anzuschlagen ist. Diese allgemeine Einförmigkeit in dem geognostischen Charakter des ganzen östlichen Abessinien sah ich nur durch zwei andere Gebirgsformationen unterbrochen. Die eine derselben sind die aus Kreide und Kalkmergel bestehenden Höhen, welche zu Sanafé (in Agamié) zu Tage kommen und die ich außerdem noch auf dem Wege von Adoa nach Halai zu Agometen und Gantuftufié sah. Die andere Ausnahme bilden die Granitmassen, welche theils als stark verwitterte kolossale Blöcke, theils als plumpe Massen etwas südlich von Amba Zion und unfern des Städtchens Magab sichtbar sind und die ich in Schirié, unter einem fast gleichen Breitengrade, als die Seitenwände der von dem Kamelo durchflossenen Thalausflötzung wiederfand.“
Spätere Reisende, namentlich Heuglin, haben dann noch einzelne andere geologische Gebilde angetroffen. So tertiäre Gesteine in Hamazién, und nach demselben Forscher zeigt sich dolomitischer Kalk überall lose in der Dammerde; dann, an einzelnen Stellen, wie in Dembea, Gyps und Mergel. Als Zersetzungsprodukte von Laven und Basalt erscheinen Thone und fette Dammerde von schwarzer und rother Farbe. Sehr beträchtliche Braunkohlenlager, die jedoch nicht ausgebeutet werden, finden sich im Goangthal zwischen Dembea und Tschelga; ebensowenig benutzt man andere mineralische Artikel, mit Ausnahme von Schwefel und Salz. Besonders hervorzuheben in geologischer Beziehung ist noch die Entdeckung einer Menge von versteinerten Baumstämmen bei Tenta, zwischen dem Kollogebirge und dem Beschlofluß durch Steudner und v. Heuglin. Sie sind verkieselt und zeigen deutlich die Jahresringe, Spuren von Rinde und Gänge von Insektenlarven. Offenbar sind diese Stämme durch den Einfluß heißer, kieselerdehaltiger Quellen versteinert worden; sie sollen sich auch auf den Hochebenen von Woadla, Talanta und im Galaland finden. Nach Professor Unger, welcher dieses Holz Nicolia aegyptiaca nannte, besteht der sogenannte „versteinerte Wald“ bei Kairo aus derselben Spezies; die ihn bildenden Stämme wurden durch Hochwasser aus den oberen Nilgebieten nach ihrer jetzigen Lagerstätte geführt und unter Verhältnissen begraben, die ihre Konservirung zur Folge hatten.
Trotz der großen vulkanischen Thätigkeit, welche in Abessinien geherrscht, zeigt keine der höheren Gebirgskuppen Spuren eines Kraters. Doch ganz unten im Schoadathale, sowie an einigen Stellen in der Fläche von Woggera und in Telemt, erheben sich einige isolirte Kegel mit deutlicher kraterförmiger Vertiefung, welche sicherlich Spätlinge der vulkanischen Thätigkeit waren. Jedenfalls sind in historischer Zeit nur vereinzelte Vulkanausbrüche bekannt geworden, zuletzt im Jahre 1861, als der Vulkan von Ed an der Danakilküste des Rothen Meeres zwei heftige Eruptionen hatte. Auch führt Rüppell nach den Landeschroniken einen heftigen Aschenregen an, der für ganz Abessinien ein unerhörtes Ereigniß war. Erdbeben sind dagegen ziemlich häufig.
[pg 40]Bei der vulkanischen Natur des Landes kann es nicht Wunder nehmen, daß heiße Quellen in demselben keineswegs selten vorkommen. Die berühmtesten Quellen sind in Begemeder, bei Ailat (Eilet) in der Nähe Massaua’s im Küstenlande und zu Filamba im nördlichen Schoa. Letztere, fünf an der Zahl, in einer lieblichen Gegend der Provinz Giddem gelegen, umgeben von prächtigen Bäumen, sind der Zufluchtsort aller Kranken und Siechen von weit und breit, die hier Heilung von den verschiedensten Uebeln suchen. Die heilkräftigste dieser Quellen führt den Namen Aragawi nach einem der neun griechischen Sendboten, welche das Christenthum in Abessinien ausbreiten halfen. Nahe dabei liegt der Quell „Heilige Dreieinigkeit“, dessen Temperatur 48° C. beträgt. Die Zulassung zu den Bädern muß mit einem Stück Salz im Werthe von etwa 2½ Groschen erkauft werden. Der Geschmack des klaren Wassers ist leicht nach Schwefelwasserstoffgas.
Oberflächengestaltung. Betrachten wir nun die Oberflächengestaltung des Landes und seine Gebirgsbildungen. Schroff gegen die Gestade des Rothen Meeres abstürzend, nur durch wenige Pässe durchbrochen, zieht sich an der ganzen Westgrenze des Landes eine lange Bergkette hin, die sich durchschnittlich 8000 bis 9000 Fuß über dem Meere erhebt. Westlich von dieser treffen wir im Herzen Tigrié’s auf theils isolirte, theils zusammenhängende Berge, die, namentlich in der Umgebung der Hauptstadt Adoa, unter dem Namen der Aukerkette zusammengefaßt werden. Alle die vielen Gipfel derselben gehen wenig über 9000 Fuß hinauf; die meisten erheben sich nur zwischen 7000 und 8000 Fuß. Der höchste unter ihnen, der Semajata im Osten Adoa’s, steigt bis zu 9518 Fuß. Von diesem Systeme verzweigt sich durch die Provinzen Agamié und Haramat eine andere Reihe von Gebirgen, die in Bezug auf groteske Formen alles hinter sich zurücklassen, was wir in den Alpen, den Cordilleren Amerika’s oder in den malerischen Gebilden der Sächsischen Schweiz zu sehen gewohnt sind, und die in der That einzig auf unsrer Erde dazustehen scheinen als Ausgeburten einer seltsamen Laune der Natur. Ihre höchste Erhebung finden sie in dem Tatsén oder Alequa bei Adigrat mit 10,390, und im Sanafé mit 10,242 Fuß. Die Reisenden, welche diese Gegenden durchwanderten, werden nicht müde, die seltsamsten Vergleiche heranzuziehen, um dem Leser einen Begriff von diesen wunderbaren Formen zu machen. Alle übrigen Berggestaltungen unsrer Erde, die verschiedensten Bauformen – Rüppell spricht sogar von ägyptischen Tempeln – werden angeführt, doch ist das geschriebene Wort nur wenig dazu geeignet, in uns eine lebhafte Vorstellung zu erwecken. Hier tritt der Griffel des Künstlers in sein volles Recht, und die Abbildungen, die wir glücklicherweise in dieser Beziehung vorführen können, sind vollkommen geeignet, eine klare Anschauung der betreffenden Gebirgsformationen herzustellen. Isenberg, der von Adoa aus einen Theil Haramats auf seinem Zuge in das Lager Ubié’s 1838 berührte, ist ganz entzückt über jene herrlichen Gestalten und schildert eine dieser Amben – so nennt man jene Bergformen – folgendermaßen: „Wir gelangten in ein Thal, ringsum von hohen steilen Felsen eingeschlossen, an dessen östlichem Ende auf [pg 41]der Spitze eines Granitfelsens – aus welchem überhaupt meistens diese Berge bestehen – über einem Engpasse ein Kloster Namens Debra Berberi (Pfefferberg) liegt. Dieses Thal durchschritten wir und bestiegen dann ein wellenförmiges Plateau, welches links von einer majestätischen von Norden nach Süden ziehenden Felswand begrenzt ist, welche einen unbeschreiblichen Eindruck auf mich machte. Dieser Amba oder Berg zieht sich mit meist senkrechten mächtigen Wänden fünf oder sechs Stunden weit hin und gleicht einem ungeheuren gothischen Naturgebäude in kolossalster Form und Vollendung.
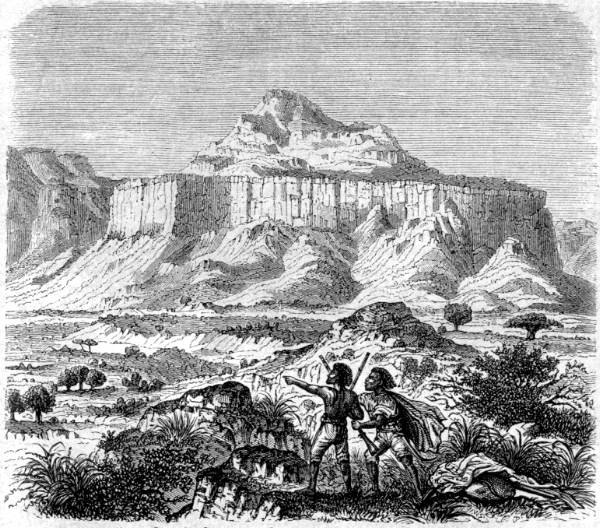
Die in regelmäßigen Dimensionen voneinander stehenden zahlreichen Säulen, womit die ganze ungeheure Wand besetzt ist, vermehren bedeutend den Anblick eines Kunstwerkes, und nicht minder einige fensterähnliche Oeffnungen, durch welche man, weil an diesen Stellen der Fels sehr dünn ist, hindurchschauen kann. Dieser Berg heißt Amba Saneïti. An seinem südlichen Ende steht ein großer isolirter konischer Fels, der einer höchst kolossalen alten Ritterburg ähnlich ist.
[pg 42]Diese und ähnliche Berge, an welchen besonders Agamié so reich ist, dienen häufig, da sie in der Regel von den meisten Stellen unzugänglich, und sehr häufig oben, wo sie meist platt sind, Wasser haben, Empörern und überhaupt kriegführenden Haufen als natürliche Festungen, wo sie, wenn sie sonst Vorräthe an Lebensmitteln haben, sich lange gegen den belagernden Feind vertheidigen und leicht Ausfälle auf ihn machen können.“ Prachtvoll ist auch der Anblick der Amba Zion, welche sich südlich von Atigrat in der Landschaft Haramat bis zu 9269 Fuß erhebt. Rüppell zog durch wiesenreiche Gründe am 1. Juni 1832 an dieser märchenhaften Felswand hin. „Die Sandsteinterrasse bildete zur Rechten unsres heutigen Weges ein schroffes Vorgebirge, das sich bei 1200 Fuß über die Thalebene erhob und einen ausgezeichneten Punkt zur geographischen Orientirung darbot; sein Name ist Amba Zion. Der Boden der Landschaft fing nun an, ziemlich eben zu werden (nach Süden zu) und bestand in einer nackten, unfruchtbaren und stellenweise mehrere Fuß breit auseinandergerissenen Sandsteinmasse, deren Spalten durchaus von emporgehobener Lava ausgefüllt waren.“
Von all den eben angeführten Gebirgen werden die noch höheren und majestätischeren Berge Semién’s durch den Takazziéstrom, eine der Hauptwasseradern Abessiniens, getrennt. Der Reisende, welcher auf dem hohen Plateau, das sich im Osten des Takazzié in Tigrié ausdehnt, dem Lande Semién zuschreitet, erblickt bald vor sich ein wunderbares Panorama. Die Thäler von Telemt und Semién liegen noch in Frühnebel eingehüllt, auf den dunkle Purpurschatten fallen. Wie ein Meer breiten sich die obern Flächen der Dünste horizontal und leicht vom Winde bewegt über dem tiefen Bette des Takazzié und andern unzähligen Rissen und Thälern aus, daraus ragen im Morgensonnengolde Zacken und Kegel wie Inseln und Burgen aus einem blauen Ozean und dahinter als hohe Mauer der hoch zum Himmel aufstrebende Gebirgsstock von Semién mit weit vorgeschobenen, Tausende von Fuß senkrecht abfallenden Massen. Diese Gebirge sind durchaus vulkanischer Natur, aber längs ihrer vom Takazzié bespülten Basis findet sich dieselbe Formation wie auf dem östlichen Ufer dieses Stromes, Schiefer in der Tiefe mit horizontalem Sandstein überdeckt und vulkanische Lavakegel, die den letztern durchbrochen haben. Die höchsten Spitzen von Semién reichen bis in die Eisregion und sind namentlich während der Regenzeit zuweilen auf mehrere tausend Fuß herab mit hagel- oder firnartigem, sehr körnigem Schnee bedeckt, der jedoch schnell schmilzt, und nur auf der Nordseite sieht man an sehr vor der Sonne geschützten Felsbänken und in Schluchten fast das ganze Jahr über Eis, d. h. gefrorene, in den Bergen entspringende Wasser, oft in ansehnlichen Massen, theilweise allerdings auch von etwas derber Textur; von Gletschern und ewigem Schnee kann aber hier nicht die Rede sein.
In der Tigriésprache heißt der Schnee Berit. Bruce, welcher nur über die niedrige Kette des Lamalmon in Semién gekommen war, glaubte nicht, daß jemals Schnee auf den Bergen gesehen werde, obgleich die Thatsache in der frühesten Nachricht vom Lande, in der adulitanischen Inschrift des Kosmas [pg 43]Indikopleustes, und später von den am besten unterrichteten Jesuiten, welche in Abessinien reisten, erwähnt wird. Rüppell fand im Juni das obere Viertheil der ganzen Gebirgskette mit Schnee bedeckt, eine Erscheinung, die im Kontrast mit dem dunklen Lazur des Himmels und den üppig grünen Pflanzen des Vordergrundes etwas in Afrika höchst Fremdartiges an sich hatte. Der durchaus aus vulkanischer Felsmasse bestehende schroffe Gebirgskamm, welcher die Provinz Semién von Ostsüdost nach Westnordwest zu begrenzt, umzieht in seinem weiteren Verlaufe in gewissermaßen ellipsoidischer Form den ganzen ungeheuren Dembeasee wie ein weiter Kesselrand, und der Buahat (Bachit), welcher die ganze Gruppe überragt, krönt gleichsam den Gebirgskreis mit seiner erhabenen Kuppe. Hier ist die echte „afrikanische Schweiz“, die unter die Tropen gerückte Alpenwelt, wie Munzinger in Erinnerung an seine Heimat Abessinien getauft hat. Und in der That, der Alpencharakter springt jedem, der es sah, in die Augen. „Unser Marsch am 26. Juni“, schreibt Rüppell, „brachte uns in eine Landschaft, welche ganz den Charakter der schöneren europäischen Hochgebirgspartien hatte. Coulissenartig springen auf den Seiten die Höhen mit Nebenthälern hervor, welche theils beholzt, theils mit einem grünen Teppich der schönsten Gerstensaat besäet sind. Das Ganze aber umgiebt amphitheatralisch ein Kranz von hohen Bergen, deren schneeige Gipfel über fette Alpenweiden emporragen. Bald erweitert sich das Hauptthal etwas nach Südwesten zu, und nun zeigt sich in pittoresker Gestalt der weit herab mit Eis bedeckte Berg Abba Jaret, einer der höchsten der ganzen Kette. Wasserreiche Kaskaden umgeben auf beiden Seiten den Ataba, um ihm den Tribut der Berge zu bringen, und hier und da schmückt eine ehrwürdige Baumgruppe die grasreichen Ufer desselben. Ueber der ganzen Landschaft aber schwebte das herrliche, ganz reine Lasurgewölbe des Himmels tropischer Hochgebirgsregionen. Kurz, alles vergegenwärtigt hier den Charakter der Hochalpen Europa’s, und es fehlten nur die malerisch gelegenen Sennhütten.“

Der Ataba ist ein sehr wasserreicher, dem Takazzié zuströmender Gebirgsfluß, dessen Bett mit Felsblöcken gleichsam durchsäet ist. An seinem Ufer erhebt sich der 11,500 Fuß hohe Dschinufra, dessen trachytische, mit Mandelsteinen und Basalten durchsetzte Gebirgsmassen hier 3000 Fuß jäh abfallen und namentlich in seinem Woikall genannten Zweige von Süden her einen imposanten Anblick gewähren. Ueberreich ist Semién an ähnlichen grotesken Fels- und Berggestaltungen, sodaß es schwer hält, aus der großen Zahl der herrlichen Partien nur einige der schönsten auszuwählen, um sie dem Leser vorzuführen. Da ist der Awirr, der sich nach Norden zu mit dem hohen Selki verbindet und der nach Osten zu ins Takazziéthal abfällt, während sich sein Westabhang ins Appenathal senkt; ferner treffen wir hier auf die malerische Felspartie Teiit, ein Theil des Totscha.
Unsere schwindelerregenden Alpenpässe mit ihren grausigen Schlünden, sie reichen in ihrer Gefährlichkeit nicht an die Berge Semiéns hinan. Der Weg windet sich oft an einer senkrechten Felswand neben furchtbaren Abgründen hin, [pg 44]sodaß auf ihm kaum ein unbeladenes Maulthier sicher hindurchkommen kann. An mehreren Stellen würde es sogar für Menschen unmöglich sein, vorbeizuklettern, wenn nicht an der ganz lothrechten Felsmasse auf künstlich angelegten Baumstämmen ein Pfad geschaffen wäre; aber auch dies ist mit so wenig Geschick gemacht, daß man oft in großer Lebensgefahr schwebt. Dazu gesellt sich das dornige Gesträuch, welches aus jedem Felsspalt dieser vulkanischen Massen wildwuchernd hervorstarrt und das Beschwerliche des Marsches im hohen Grade vermehrt. Diese Gefahren werden besonders von Heuglin in seiner Ueberschreitung des Amba-Ras in anschaulicher Weise geschildert. „Der Pfad, den kein Maulthier zu erklimmen im Stande ist, führt über zwei sehr enge, tiefe Schluchten hinweg von einem Felsgrat zum andern, übrigens häufig durch üppigen Baumschlag und grünes Gebüsch, an Quellen mit moosigem Gestein und blumigen Rasenplätzen hin, steiler und immer steiler aufwärts. Ueber schwindelnder Kluft liegt ein halbmorscher Baumstamm als Brücke, links erhebt sich eine starre Felswand; rechts herabzublicken in den Abgrund wagt keiner, ehe er die verhängnißvolle Passage hinter sich hat. An steilen Geländen windet man sich immer höher, zuweilen über weite Eisstrecken weg. Da scheint der höchste senkrechte Abfall des Amba-Ras wirklich jedes weitere Vordringen unmöglich zu machen, doch es öffnet sich eine Felsspalte von nur zwei bis drei Fuß Weite, wie in einem Schornstein klettert man vorsichtig, damit kein Stein lose wird, in alle möglichen Situationen übergehend, von Vorsprung zu Vorsprung und kommt zuletzt mit wunden Köpfen, Händen und Füßen auf der Plattform zwischen Bachit und Amba-Ras wieder zu Tage.“ So sind die Wege in Semién beschaffen und doch haben sie Armeen, aber abessinische Armeen, durchzogen und entscheidende Schlachten auf den Eisfeldern des Landes geliefert. Die meisten der angeführten Bergriesen Semiéns, außer denen wir hier noch den Walia-Kant, den Jotes-Saret, Barotschuha, Taffalesser und Ras-Tetschen nennen, erreichen eine Höhe von mehr als 14,000 Fuß über dem Meere und werden nur noch durch das Kollogebirge in den Galaländern übertroffen.
Südwestlich von Semién setzen sich die Gebirge in der Hochfläche von Woggera fort, einer Art von gestaffelter Terrasse, die in ihrer höchsten Ebene bis zu 9500 Fuß emporragt, sich allmälig aber nach Südosten verflacht, unfern von Gondar aber immer noch ziemlich steil nach dem kesselförmig von Höhen umgebenen großen Becken des Tanasees abfällt. Woggera und alle Bergzüge in der Umgebung dieses großen Binnensees bestehen ganz aus vulkanischen Felsmassen und der durch ihre Zersetzung höchst fruchtbar gewordene Boden bildet eine herrliche Weidelandschaft. Von Gondar aus wendet sich, an die Abfälle Woggera’s anschließend, ein schmaler Gebirgszug ohne Unterbrechung nach Südosten, der die Verbindung mit dem Hochlande Begemeder herstellt und bei Derita seine größte Höhe zwischen 9000 und 10,000 Fuß erreicht. In Begemeder selbst treffen wir auf das hohe, von Heuglin erstiegene Gunagebirge (13,000 Fuß). Die Gipfel bestehen aus kahlen Trachytmassen, die ein milchweißes, feldspathartiges Gestein einschließen; an einzelnen Stellen der Gehänge sieht man Wacken [pg 45]und Thone und der ganze Gebirgsstock hat einen ansehnlichen Umfang. Nach Süden und Osten fällt er steiler ab und verläuft nach Westen nach und nach gegen den Blauen Nil und den Tanasee. Nach Osten zu schließen sich wieder, zum Theil mit dem Beschlostrome parallel laufend, hohe Gebirge an die Guna an, deren eines sich unmittelbar mit den Hochebenen der Länder Woadla, Talanta, Daunt, Jedschu und Lasta verbindet.
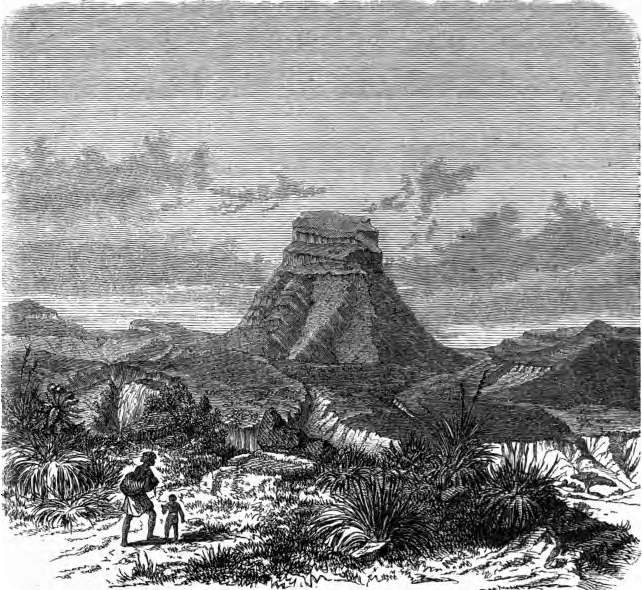
Originalzeichnung von Eduard Zander.
Die Plateaux der zuerst genannten Länder steigen bis 9000 Fuß über das Meer an, während die höchsten Spitzen von Lasta wieder in die Eisregion hineinragen. Jenseit des Beschlo aber, im Lande der Wollo-Gala, steigt Abessiniens höchstes Gebirge, die Kollo, bis über 15,000 Fuß an, und auch in dem benachbarten, nach Westen zu gelegenen Gischem treffen wir auf 10,000 Fuß hohe Gipfel.
[pg 46]Jenseit des Nil aber begegnen wir der durchschnittlich 8000 Fuß hohen Berglandschaft Godscham, die im Talbawaha mit 11,000 Fuß ihre größte Erhebung findet. Endlich im Süden steigen kühn und malerisch wie die Gebirge Semiéns die Felsmassen von Schoa auf, die in der „Mutter der Gnade“, dem Mamrat (13,000 Fuß), einen würdigen Abschluß finden.
Flüsse. Die nach Westen und Nordwesten geneigten Hochflächen Abessiniens werden von zahlreichen Bächen und Strömen durchschnitten, die nach kurzem Laufe auf dem Plateau plötzlich in tiefeingeschnittene Thäler fallen, in welchen sie oft sehr schnell eine Tiefe von 3000 bis 4000 Fuß unter der Fläche des Tafellandes erreichen. So behauptet das Hochland von Semién in seinem ziemlich gleichförmigen Rande eine Höhe von 10,000 Fuß. Aber das Bett des Bellegas im Schoadathale liegt nur etwa 5400 Fuß, das des Takazzié an der Nordostgrenze gar nur 3000 Fuß über dem Meere. Die größeren Flußthäler, z. B. des Takazzié und des Abai im Süden, sind ziemlich weit; das letztere hat eine Breite von wenigstens fünf deutschen Meilen. Deshalb stellen die Abessinier ihr Tafelland stets als eine aus dem umgebenden Tieflande emporragende Insel dar. Die Thäler sind außerordentlich wild und unregelmäßig, im ganzen aber von ziemlich übereinstimmendem Charakter. Die obere Hälfte des Abfalls ist immer ungemein steil, oft aus vielfach zerrissenen horizontalen Bänken von Lava, Trachyt und Basalttuff gebildet; dann folgen terrassenförmig übereinander liegende Plateaux mit sanfteren Abfällen, oft aus fest zusammengebackenen Brocken vulkanischer Gesteine der Nachbarschaft und Dammerde bestehend. Auf der Thalsohle dagegen erscheinen wieder die vulkanischen Massen in ihrer Urgestalt, und die dort hausenden Hochwasser haben sich in denselben tiefe, rinnenartige Betten mit meist senkrechten Wänden eingerissen. In der trockenen Jahreszeit sind die Ströme in diesen Thälern theilweise ohne Wasser, kaum schlammigen Bächen ähnlich; in der Regenzeit überfluten sie das ganze Flachland. Da, wo die Flüsse das Flachland verlassen, bilden sie meistens Katarakte von bedeutender Höhe, und in solchen Wasserfällen und Stromschnellen senkt sich ihr Bett auf eine Strecke von wenigen Meilen um mehrere tausend Fuß.
Prächtig hat vor allen andern Werner Munzinger dieses Anschwellen der abessinischen Ströme geschildert. Er führt uns in die tiefe Thalschlucht, in der es fast den ganzen Tag über dunkel ist, denn nur wenige Mittagsstunden dringt die Sonne in die schauerliche Tiefe. „Hier wird selbst der Vogel scheu und stumm und die am spärlichen Wasser sich labende Gazelle lauscht ängstlich auf bei jedem Geräusch in der fluchtwehrenden Enge. Da ist fast ewige Stille, nur unterbrochen von dem Murmeln des sich ins Freie drängenden Baches, selten gestört von dem Geheul der an den jähen Abgrund sich klammernden Affen.
„Weh dem, der hier weilt in der Regenzeit! Von langer Fahrt müde bettet sich der Wanderer in dem Thal. Er ist von der Hitze so erschöpft, selbst diese finstern Gründe laden ihn zur Ruhe. Im heißesten Mittag wiegt er sich in süße Träume; seiner harret das freundliche Heim – da dröhnt es dumpf im Hochgebirge; ein Schuß, ein zweiter, dann der schreckliche, den ganzen Himmel durchrasende Donner.
[pg 47]„Doch fürchtet er noch nichts, das Gewitter ist ja so fern. Er weilt und träumt, er sei schon bei den Lieben. Da erhebt sich von oben ein Rauschen, wie wenn der Wind durch die Blätter führe. Es wird lauter, gewaltiger, es zischt, es prasselt, es toset, es brüllt, als wenn die bösen Geister anführen – nun naht es, mauergleich, sich schäumend und überstürzend – es ist der Waldstrom. Der Bach, vom Regen angeschwollen, ist ein mächtiger Strom geworden, doch seines kurzen Lebens gedenk stürzt er wild und feurig in das Thal hinab. Die tiefgewurzelten Sykomoren sinken unter seiner Wucht und die grasige Ebene wird von Schutt überrollt; das Wasser füllt das ganze Thal und langt hoch an die Felsen hinauf. Wehe dir, du armer Mann! Wo solltest du hin entfliehen? Hast du die Flügel des Adlers, hast du die Krallen des Affen, der über dir schwebend deiner Noth höhnt? Bist du im Bunde mit den Geistern, daß sie dich forttrügen? Hier ist sie nicht dein Knecht die Natur, sie ist dein dich vernichtender Feind. Es sind wenige Jahre her, daß ein ganzes Zeltlager, in einem breiten, trockenen Strombette gelagert, die Beduinen mit ihren Herden und Zelten von dem ungeahnten Waldstrom überfallen und fortgerissen wurden. Hundert Menschen, Tausende von Ziegen wurden seine Beute.“
Tritt hier der abessinische Strom vernichtend auf, so erfüllt er andererseits eine hohe Aufgabe. Unser Landsmann Eduard Rüppell war der erste, welcher 1832 darauf hinwies, daß diese Ströme die Bildner des fruchtbaren Erdreichs in Aegypten und die Ursache der Nilüberschwemmungen sind. „Die aufgelösten vulkanischen Massen Abessiniens“, sagt er, „sind, indem sie von den zur Regenzeit anschwellenden Flüssen fortgeflößt werden, die Elemente jener befruchtenden Erdablagerungen, welche der Nilstrom längs seinem ganzen Laufe seit Jahrtausenden alljährlich absetzt. Bedenkt man die ungeheure Erstreckung des von diesem Flusse angeschwemmten Landes in Nubien und Aegypten, so wird man mit Erstaunen erfüllt über die Masse der nach und nach durch die Verwitterung zerstörten Vulkane Abessiniens.“ (Reise in Abyssinien, II, 319.)
Erst volle dreißig Jahre später widmete der Engländer Baker dieser Thätigkeit der abessinischen Ströme sein Augenmerk; ein ganzes Jahr lang zog er im Gebiete derselben umher und hielt sich dann schließlich für den Entdecker der schon früher von Rüppell aufgestellten Thatsache, die allerdings von ihm in vielen Stücken erläutert wurde. Der Atbara, der Takazzié oder Setit, der Salam, Angrab, Rahad, Dender und der Abai oder Blaue Nil sind die großen Entwässerungskanäle Abessiniens; sie haben alle einen gleichförmigen Lauf von Südost nach Nordwest und treffen den Hauptnil in zwei Mündungen, durch den Blauen Nil bei Chartum und durch den Atbara.
Alle die genannten Ströme gehören zum Gebiete des Nil. Als Hauptquelland des Abai (Blauer Fluß, Bahr el Asrek) muß das Becken des Tanasees (Zana, Tsana) betrachtet werden. In einem ungeheuren, vom Hochland umlagerten Becken sammeln sich ungefähr im Mittelpunkte von Amhara die meisten Gewässer von Godscham, Begemeder und Dembea und bilden in einer Meeres[pg 48]höhe von 5732 Fuß einen herrlichen Alpensee mit zahlreichen Inseln, eingesäumt von grünen Matten und reichen Kulturebenen, durch welche in Schlangenwindungen zahlreiche Bergwasser rinnen. Der Tanasee, welcher in elliptischer Form einen Raum von etwa einhundertfünfzig Quadratstunden einnimmt, war einst wol um die Hälfte größer, aber im Laufe der Jahrtausende haben die fortwährenden Schlammniederschläge von zersetzter Lava, welche die Gewässer während der Regenzeit von den vulkanischen Höhen abspülen, eine wagerechte Bodenfläche an vielen Stellen seiner Ufer gebildet und so nach und nach seinen Umkreis verengt. In einer mehr als 60 Fuß tiefen Felsschlucht, deren senkrecht abstürzende Seitenwände an mehreren Stellen kaum zwei Klaftern weit voneinander entfernt sind, rauscht der Nil in einer ununterbrochenen Reihe von Kaskaden aus dem See hervor. Während der Regenzeit ist nicht allein dieser ganze Felsenspalt mit Wasser ausgefüllt, sondern der Strom überflutet dann auch eine beträchtliche Strecke des südlichen Ufers, welche mit stark abgeschwemmten vulkanischen Geröllen von kolossaler Größe bedeckt ist. Hier wölbt sich über ihn die Brücke von Deldei, welche aus acht Bogen besteht, die alle untereinander von ungleicher Größe sind und von denen der nördlichste, über die Felsenschlucht selbst gesprengte und somit allein immer vom Strom durchflossene, bei weitem der größte von allen ist. Die Länge der Brücke beträgt neunzig Schritt und ihre Breite fünfzehn Fuß. Sie bildet in ihrer Längenerstreckung keine gerade Linie, indem sie an den drei nördlichen Bogen sich etwas nach Westen wendet. Die Wölbung der Bogen ist aus kleinen behauenen Sandsteinen erbaut, das Uebrige aber aus Lavafels. In der Mitte der Brücke befindet sich eine Quermauer mit einem Thore und an ihrem Nordende ist eine Art von Vertheidigungsthurm, der aber jetzt in Trümmern liegt. Von hier aus umfließt der Blaue Nil in spiralförmigem Laufe, sich den Grenzen Schoa’s nähernd, Godscham und Damot und nimmt erst in Fasogl und den Ebenen von Sennar nordwestlichen Lauf an, welchen er beibehält bis zu seiner Vereinigung mit dem Weißen Nil bei Chartum. Der Abai erhält noch reichliche Zuflüsse von Osten und Süden her, namentlich den Beschlo und die Dschama, und endlich in Sennar den Dinder und Rahad, welche den westlichen Rand von Abessinien zum Quellgebiet haben. Der Blaue Nil ist während der trockenen Jahreszeit so klein, daß er nicht Wasser genug für kleinere Fahrzeuge hat, die mit dem Transporte von Produkten von Sennar nach Chartum beschäftigt sind. In dieser Zeit ist das Wasser schön hell, und da es den wolkenlosen Himmel reflektirt, hat seine Farbe zu dem wohlbekannten Namen Bahr el Asrek oder Blauer Fluß Anlaß gegeben. Es giebt kein köstlicheres Wasser als das des Blauen Nil; es sticht ganz ab gegen das des Weißen Flusses, welches nie hell ist und einen unangenehmen Vegetationsgeschmack hat. Diese Verschiedenheit in der Beschaffenheit des Wassers ist ein unterscheidendes Merkmal der beiden Flüsse; der eine, der Blaue Nil, ist ein reißender Gebirgsstrom, der mit großer Schnelligkeit steigt und fällt; der andere entspringt im Mwutan Nzige und fließt durch ungeheure Marschen. Der Lauf des Blauen Nil geht durch fruchtbaren Boden; er erleidet daher nur einen geringen Verlust durch Absorption, [pg 49]und während der starken Regen liefern seine Wasser einen mächtigen Beitrag erdigen Stoffs von rother Farbe zu dem allgemein befruchtenden Niederschlag des Nil in Unterägypten.

Der Atbara entspringt ganz nahe am Nordrande des Tanasees in Dembea und ist, obgleich in der Regenzeit ein so bedeutender Strom, doch mehrere Monate des Jahres hindurch vollkommen trocken oder auf wenige Pfützen beschränkt, in welche sich Krokodile, Fische, Schildkröten und Flußpferde zusammendrängen, bis sie der Beginn der Regenzeit wieder in Freiheit setzt, indem eine frische Wassermasse dem Flusse zuströmt. Die Regenzeit beginnt in Abessinien im Juni; von da an bis zur Mitte des September sind die Gewitter furchtbar; jede Schlucht wird ein tobender Gießbach; Bäume werden von den über ihre Ufer geschwollenen Bergströmen entwurzelt, der Atbara wird ein ungeheurer Fluß, der mit einer alles überwältigenden Strömung den ganzen Ablauf von fünf großen Flüssen (des Takazzié, Salam, Dinder und Angrab nebst seiner eigenen ursprünglichen Wassermasse) herabbringt. Seine Fluten sind getrübt vom Erdreich, das von den fruchtbarsten Ländereien weit von seinem Vereinigungspunkte mit dem Nil abgewaschen wurde. Massen von Treibholz nebst großen Bäumen und häufig die Leichen von Elephanten und Büffeln werden von seinen schlammigen Wassern in wilder Verwirrung fortgeschleudert und bringen den an seinen Ufern wohnenden Arabern eine reiche Ernte an Brenn- und Nutzholz.
Der Blaue Nil und der Atbara, die fast den ganzen Wasserabfluß Abessiniens aufnehmen, ergießen ihre Hochwasser in der Mitte des Juni gleichzeitig in den Hauptnil. In dieser Zeit hat auch der Weiße Nil einen beträchtlich hohen, obwol nicht seinen höchsten Stand, und der plötzliche Wassersturz, der von Abessinien in den Hauptkanal herabkommt, welcher schon durch den Weißen Nil auf einen bedeutenden Stand gebracht worden ist, verursacht die jährliche Ueberschwemmung in Unterägypten.
Als Haupt- und Charakterstrom Abessiniens kann der Takazzié gelten, wenngleich er nur ein Nebenfluß des Atbara ist. Er entspringt östlich vom Tanasee zwischen Begemeder und Lasta aus drei kleinen Quellen, die bei den Eingeborenen Aïn (das Auge des) Takazzié heißen. Diese ergießen sich in einen Behälter, aus welchem das Wasser zuerst in einem vereinigten Bache herausfließt. Der Strom, die große Scheide zwischen den Landen Amhara in seinem Westen und Tigrié in seinem Osten, geht erst in nördlicher Richtung weiter und rauscht dann in schäumenden Kaskaden an den Alpen Semién’s am Awirr hin, durch welche er sich sein mit steilen Wänden eingefaßtes Bett wühlt. Hier, in diesem tiefen, nur 3000 Fuß über dem Meere liegenden Thale, neben dem sich die Berge bis in die Eisregion erheben, herrscht eine heiße ungesunde Luft und wohnen wenig Menschen. Selbst die Thiere meiden diesen Aufenthalt, und nur die unförmigen Köpfe der Nilpferde erscheinen über dem Spiegel des in Stromschnellen über Kiesgrund dahinschießenden Flusses. Von Semién an nimmt der Takazzié eine westliche Richtung an und tritt durch das heiße Land Wolkait auf ägyptisches Gebiet über, wo er den Rojan auf- und den Namen Setit annimmt. [pg 50]Durch das Land der Homranaraber und eine überaus wildreiche Gegend, das Paradies der Jagdfreunde, wälzt er endlich seine Wasser, die nie ganz austrocknen, dem Atbara zu. Als ein weiterer Zufluß desselben kann der in Hamasién entspringende, die Provinz Serawié in einem Bogen umfließende Mareb betrachtet werden, welcher durch das Land der wilden Kunama zieht, in der ägyptischen Provinz Taka den Namen Chor el Gasch erhält und jenseit Kassala entweder versandet oder bei Hochwasser den Atbara erreicht.
Die Wasser der nördlichen Grenzländer Abessiniens endlich sammelt der Barka, die er bei Tokar südlich von Sauakin dem Rothen Meere zuführt. Aber alle diese Flüsse, so große Gaben sie sonst für das Land sind, verlieren dadurch bedeutend an Werth, daß sie nicht als Kommunikationsmittel dienen können. Es fehlen die Ströme, die sich schiffbar in das Rothe Meer ergießen; es fehlen auch, um diesen Mangel zu ersetzen, die allmälig nach Osten sinkenden Ebenen, die, gegen die Küste auslaufend, den Kameeltransport ermöglichen. Mehr noch als das: die Flüsse verhindern sogar in der Regenzeit allen Verkehr, denn Brücken baut der Abessinier nicht und die alten, von den Portugiesen hergestellten zerfallen.
Schoa schließlich, der südliche Theil Abessiniens, sendet seine nach Westen gehenden Ströme dem Abai zu, im Osten zieht sich dagegen der aus Guragué kommende Hawasch um das Land, allein er erreicht das Rothe Meer nicht und versandet in den Salzebenen und Lagunen der Danakilküste.
Klimatische Verhältnisse. Unter den Tropen gelegen, von der Meeresküste bis zu 15,000 Fuß Höhe an die Grenze der Eisregion hinaufragend, die südliche Hitze und nordische Kälte vereinigend, bietet Abessinien auf seinem verhältnißmäßig beschränkten Raume alle Erscheinungen der ostafrikanischen Pflanzenwelt von der Flora der Wüste bis zu jener der Hochlande in seltener Fülle und unendlichem Reichthum dar. Aus dieser so verschiedenen Höhenlage ergiebt sich auch ein bedeutender Wechsel des Klimas, und in der That kann man an einigen Orten binnen wenigen Stunden aus der Region der Palmen bis auf die eisigen Hochebenen gelangen, wo die Vegetation ein Ende nimmt. Schließt man die heißen Küstenstriche, die tiefgelegenen Niederungen und die nicht minder tief in das Land eingerissenen Thäler, wie jenes des Takazzié, aus, so kann das Hochland als ein klimatisch sehr begünstigtes bezeichnet werden. Nach Rüppell sind die täglichen Abwechselungen in der Lufttemperatur von wenig Belang; starke Stürme sind eine große Seltenheit; die Feuchtigkeit der Regenzeit hat gar keinen nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit, ja während dieser Zeit ist sogar am Vormittag fast stets der Himmel heiter und nur zwischen zwei bis sechs Uhr bricht ein starkes Gewitter aus, welchem gewöhnlich eine bewölkte Nacht folgt. Die Witterung der Sommerzeit, d. h. der Monate November bis Juni, ist im westlichen Abessinien die angenehmste, die man sich denken kann, [pg 51]da in der Regel alle acht Tage ein leichter Regenschauer fällt und die Wärme der sonst heiteren Luft wegen der relativen Höhe des Landes nichts weniger als drückend ist. Welchen Gegensatz bietet dieses Klima zu demjenigen des größeren Theils von Afrika, das so viele Opfer fordert!
In dem uns zu Gebote stehenden Manuskripte Zander’s finden sich über den Wechsel der Temperatur in Abessinien von den höchsten Berggipfeln bis zu den tiefsten Thälern des Landes herab, also zwischen 14,000 und 3000 Fuß, folgende mittlere Werthe in Graden nach Réaumur angeführt. Zwischen 14,000 und 13,000 Fuß: früh und Abends im Sommer + 1 bis 3°; in den Wintermonaten zu derselben Zeit − 3 bis − 6°; des Mittags + 3 bis 4°.
Zwischen 13,000 und 12,000 Fuß: früh und Nachts 0° in den Wintermonaten; im November, Dezember, Januar, Februar − 1 bis 3°; Mittags + 5 bis 7°.
Zwischen 12,000 und 10,000 Fuß: Morgens und Nachts + 5 bis 7°; Mittags 10 bis 12°.
Zwischen 10,000 und 8000 Fuß: Morgens und Abends + 7 bis 9°; Mittags 12 bis 15°.
Zwischen 8000 und 6000 Fuß: früh und Abends + 14 bis 18°; Mittags 20 bis 23°.
Zwischen 5000 und 3000 Fuß: früh und Abends + 24 bis 28°; Mittags 30 bis 32°.
Nach v. Heuglin unterscheidet der Abessinier in seinem in klimatischer Beziehung so viele Abwechselung darbietenden Vaterlande zwei Hauptregionen oder Vegetationsgürtel, die Kola oder Kwola und die Deka, nebst einem vermittelnden Gliede für beide, Woina-Deka genannt. Hiernach läßt sich, wenn auch begreiflicherweise diese Regionen ineinander übergehen, die Flora des Landes in drei Abtheilungen zerlegen.
Die Kola. Kola heißt das Tiefland unter 5500 Fuß. Seine Vegetation zeichnet sich nach dem genannten Forscher dadurch aus, daß sie im Allgemeinen zur heißen Jahreszeit abfallendes Laub hat. Zu dieser Region gehören die Provinzen Wochni, Saragao, Ermetschoho, Walkait, Kola-Wogara, das Takazzié-, Mareb-, Hawasch-, Dschida- und Beschlothal. „Im September und Oktober herrschen in diesen Flußthälern äußerst gefährliche, meist todbringende Fieber. Zu dieser Zeit sind die Lüfte verpestet, theils durch die äußerst üppige Vegetation, welche dann abstirbt und abfault, theils durch die stagnirenden Gewässer, die nach der Regenzeit in Lachen und unzähligen Vertiefungen ohne Abfluß verdunsten müssen und in denen sich oft ungeheure Massen von zusammengeflutetem Laub, Gras und Reisig in hohen Schichten finden. Viele hundert Abessinier erliegen jährlich dieser Krankheit, die auch zugleich ansteckend ist, und oft ereignet es sich, daß der Getreidewächter, welcher dort unten krank wurde, sich in sein hoch und gesund gelegenes Heimatsdorf zurückbegiebt, wo er das Fieber den Bewohnern mittheilt, das sich nun von da über die nächsten Ortschaften weiter verbreitet. So kommt es denn manchmal vor, daß ganze Dörfer rein aussterben. [pg 52]Die beste Zeit in diesen tiefen Ländern fällt in die Monate Dezember, Januar, Februar; aber auch dann ist es dort nicht immer geheuer.“ (Zander’s Manuskript.)
Gern meidet der Europäer diese fieberschwangern Thäler und Niederungen, oder er eilt, wenn er sie auf seiner Reise unumgänglich berühren muß, wie z. B. das Takazziéthal, schnell hindurch, und nur wenige Forscher sind in die Kola eingedrungen, um dort längere Zeit zu weilen; so Munzinger in jene am Mareb, Rüppell in die von Eremetschoho. Letzterer brach von Gondar aus am 27. Dezember 1832 nach Norden hin auf und gelangte in einer Höhe von 8200 Fuß auf die Wasserscheide, welche die nach dem Tanasee und nach dem Atbara fließenden Gewässer trennt. Hier breitete sich vor seinen Blicken nach Nord und Nordost zu ein weites Amphitheater aus, gebildet durch wild zerrissene Berge, isolirte vulkanische Kegel und schroff aufgethürmte pyramidalische Felsmassen. Die ganze nach Norden zu gelegene Gegend erniedrigt sich allmälig und wird von mehreren beträchtlichen Gewässern durchflossen, welche sich insgesammt in einen Hauptstrom, den Angrab, vereinigen, welcher die Gefilde der Provinz Walkait durchschlängelt und sich in den Salam (Nebenfluß des Atbara) ergießt. In der Thalniederung angelangt, marschirte er über eine wellenförmige, mit schönen Baumgruppen bestandene Ebene, oft überragt von zehn Fuß hohem, schilfartigem Rohr. Hier war der Tummelplatz der wilden Thiere. Zahlreiche Herden furchtbarer Büffel, kleine Familien von Elephanten, einige menschenscheue Rhinozeros, blutdürstige Löwen und Leoparden, verschiedene Affen und Antilopen tummeln sich hier auf den großen gemeinschaftlichen Weideplätzen herum. Fast alle zehn Schritt finden sich die vertrockneten Spuren von Elephantenfußtritten, aber diese weite Thalniederung wird wegen ihrer verderblichen Luft von den Menschen gänzlich gemieden. Wenn während der Regenzeit bei abwechselnd heiterm Himmel in diesem Bereich einer üppig vegetirenden Pflanzenwelt die Feuchtigkeit von der Sonne etwas verdunstet wird, so verhindert das Rohrdickicht und die ganze Form der Gegend den Luftzug und somit die Zertheilung der Dünste, und schon derjenige, welcher nur durch die Landschaft flüchtigen Fußes dahineilt, wird vom bösartigen Fieber ergriffen. Eine Nacht daselbst zuzubringen, dazu ist in keiner Jahreszeit Jemand von den Anwohnern zu vermögen. Die in Rede stehende Kola schätzt Rüppell auf 4700 Fuß Höhe über dem Meeresspiegel.
Betrachten wir nun die einzelnen Repräsentanten der Pflanzenwelt in diesen Niederungen und den sich ihnen anschließenden bergigen Gegenden bis zur Höhe von 5500 Fuß. Aus dem heißen ungesunden Tieflande aufwärts steigend, gewahren wir große gewaltige Bäume nur in den Tiefen des Thales. Die Wände sind zwar üppig begrünt, doch nur von kleinen Bäumen bestanden; namentlich wuchert die Akazie empor und nur an den günstigsten Stellen treten andere Bäume zwischen sie hinein; im Thalgrunde dagegen erheben sich die Tamarinden mit ihren blaugrünlich schimmernden Kronen; die Kigelien mit dem herrlichen Laubgewölbe, aus welchem die großen, wurstförmigen, an langen, elastischen Stielen hängenden Früchte hervorschauen; der Baobab (Adansonia digitata), die Mimosen, welche hier zu hohen schönen Bäumen geworden sind, [pg 53]und viele andere herrliche Gewächse. Blumen aller Art, Gräser, Cacteen und Euphorbien, schmarotzende Loranthusarten und Parasiten ohne Zahl bemächtigen sich des von den Bäumen selbst nicht in Besitz genommenen Erdreichs und verleihen den Wänden auf große Strecken hin schmückende Farben. Je höher man im Thale aufwärts steigt, um so kräftiger und reicher erscheint die Pflanzenwelt. Von etwa 4000 Fuß über dem Meere an tritt die Sykomore, bald darauf der Oelbaum und mit ihm die prächtige Kronleuchter-Euphorbie auf. Gleich diesen tragen die Oelbäume wesentlich dazu bei, diesem Gürtel einen gewissen Charakter zu verleihen; doch kommen letztere an und für sich langweilige Pflanzen nie so zur Herrschaft, daß ihr Anblick unangenehm werden könnte. Ihr ungewisses Graugrün sticht prächtig ab von den auf große Strecken hin durch die blühende Aloë rothgelb erscheinenden Felspartien, von den Blättern und Blüten mancher Schlingpflanzen oder dem dunklen Laube anderer Bäume. Mit dem Wachholder und der Eibe bildet der Woira oder Oelbaum zwischen 5000 und 5500 Fuß den vorzüglichsten Waldbaum Abessiniens; ein ganz anderer Gesell, als sein kleiner südeuropäischer Verwandter, erreicht er eine durchschnittliche Höhe von sechzig bis achtzig Fuß und einen Durchmesser von vier Fuß. Die erbsengroßen fleischlosen Früchte werden nicht benutzt, dagegen liefert der Stamm ausgezeichnetes Zimmer- und Brennholz. Die Tamarinde (T. indica) erreicht eine majestätische Größe, wird aber von den Eingeborenen wenig beachtet; verschiedene Senna-Arten kommen vor. In den wüsten, sandigen und vulkanischen Grenzdistrikten werden die Akazien (A. eburnea, planifrons u. s. w.) und andere Kameeldornbäume von großer Wichtigkeit, da in ihrem Schatten sich Menschen und Vieh sammeln können. Einige liefern Gummi arabicum und die dornigen Zweige dienen den Kameelen als Futter.
Eine sehr eigenthümliche Erscheinung in der Kolaregion ist die papierrindige Boswellia (B. papyrifera). Sie ist ein stattlicher Baum mit großen ahornartigen Blättern und kleinen rothen Blütenbüscheln. Unmittelbar nach der Regenzeit zeigt der Stamm eine blaßgrüne glatte Rinde, die in der Trockenheit bald springt und sich in großen papierdünnen Blättern ablöst. Wo ein Einschnitt gemacht wird, entquillt in reichlicher Menge ein klebriger Milchsaft, der bald an der Luft erhärtet und klare Bernsteinfarbe annimmt.
Neben den genannten Pflanzen sind noch die Gattungen Zizyphus, Balanites, Dahlbergia, Sterculia, Salvadora, das stachelige Pterolobium und die langfrüchtige Baum-Cassia in der Kola vorzugsweise vertreten. Der graublätterige Uscher (Calotropis procera) überrascht durch seine ballonartigen, mit atlasglänzender Wolle gefüllten Früchte.
Mehrere Euphorbia-Arten kommen in außerordentlicher Größe vor. Unter denselben zeichnet sich als Charakterpflanze die schöne, armleuchterartige, oft bis vierzig Fuß hohe Kronleuchter-Euphorbie (E. abessinica), der Kolqual, besonders aus. Er gleicht einem Cactus, der zum Baum geworden ist, aber seine Regelmäßigkeit, sein eigenthümliches Wesen, die Fülle seiner Blätter, die gleichartige Verzweigung derselben beibehalten hat.
[pg 54]

Licht hebt er sich ab von dem dunklen Gelände und verleiht der Landschaft einen wunderbaren Schmuck. An dem Milchsafte dieser Pflanze ist schon mancher erblindet, während er andererseits als Arznei gegen Hautkrankheiten u. s. w. gebraucht wird. Das Holz des Kolqual wird zum Hausbau benutzt, um Querbalken zu belegen; aus der Kohle desselben fabrizirt man Schießpulver. Der Kolqual erreicht seine größte Verbreitung zwischen 4500 und 5000 Fuß Meereshöhe, allein er kommt selbst bis 11,000 Fuß Höhe vor. In den tiefer liegenden Gegenden ist die Sykomore sein Begleiter, der ihn aber bald verläßt. Diese Feigenart, welche von den Abessiniern Worka, die Goldene, genannt wird, steht bei den heidnischen Gallas in großer Verehrung. Oft hainartig gruppirt ragen die Sykomoren mit mächtigem Laubdach über ihre Umgebung hervor. Rüppell sah ein Exemplar, dessen Stamm einen Durchmesser von dreizehn Fuß hatte. Andere Exemplare von vielleicht tausendjährigem Alter und einer Größe, daß eine ganze Reisegesellschaft mit Thieren, Zelten und Gepäck in ihrem Schatten bequem ruhen können, sind gerade keine Seltenheit. Neben ihnen sieht man Sykomoren, die, eine ganze Welt für sich bildend, so von Schmarotzerpflanzen überdeckt sind, daß man nur Wände von diesen, selten aber ein Stückchen Stamm erblicken kann; so wandeln die Schlinger die von ihnen in Besitz genommenen Bäume in Lauben um, welche der Kunst jedes Gärtners zu spotten scheinen.
Die Botaniker haben gezeigt, daß kryptogamische Pflanzen in vielen ihrer Unterabtheilungen über die ganze Erde mit denselben Arten vertreten sind. Unter gleichen Umständen bedeckt dieselbe Flechte die Felsen in Europa wie in Abessinien, und derselbe Schwamm ist dort wie hier auf den Baumrinden zu entdecken. Auch in den heißeren, tiefer gelegenen Gegenden wundert man sich, daß selbst die ödesten, ärmsten Stellen des Gebirges begrünt und belebt sind; man begreift kaum, wie in dieser Sonnenglut, ungeachtet der Regen, eine ziemlich reichhaltige Flechtenwelt sich auf den Gesteinen festsetzen kann. Jede parasitische Pflanze wird von den Abessiniern mit einer Art von Mißtrauen betrachtet, namentlich die Gefäß-Kryptogamen, welche den Zauberern ihre hauptsächlichen Wundermittel liefern. Doch Pilze und Boviste werden für giftig angesehen und gemieden. Wo das Klima sehr feucht ist, erscheint der Schimmel, bekanntlich auch eine kryptogamische Pflanze, als eine wahre Landplage, die große Zerstörungen unter den Vorräthen anrichtet. Der Feuerschwamm, die phantastisch gleich Gewinden von den Bäumen herabhängende Bartflechte (Parmelia) sind in Abessinien häufig; selten dagegen die Moose. Unter den Farrnkräutern finden wir allerdings keine baumartigen, aber viele Gattungen, wie Aspidium, Polypodium, Asplenium, Adiantum, Scolopendrium, Ophioglossum und Pteris, die auch in Deutschland ihre Vertreter haben.
Die Woina-Deka oder vermittelnde Region, die von 5500 bis 7500 Fuß hinaufreicht, führt ihren Namen nach dem Weinstock. In ihr gedeihen die hauptsächlichsten Kulturpflanzen, die in einem besondern Abschnitte besprochen werden sollen. Die Weinrebe anlangend, so fand Rüppell noch 1832 eine große Menge Trauben zu äußerst billigen Preisen auf dem Markte bei der Kirche von [pg 57]Bada, südlich von der Hauptstadt Gondar. Man erhielt etwa zehn Pfund derselben für ein Stück Salz oder dritthalb Centner für einen Maria-Theresia-Thaler. Die großbeerigen, blauen und sehr süßen Trauben (Woin saf) wurden in den Distrikten Wochni und Wascha schon seit uralten Zeiten gezogen. Vermuthlich kam nämlich der Weinstock schon zur Zeit der axumitischen Könige aus Arabien nach Abessinien, wo ihm allerdings keine besondere Kultur zu Theil wurde. Von einer Veredelung und besondern Pflege der Pflanze beim Anbau weiß man nichts. Der größte Theil der Trauben wird frisch gegessen, und nur wenig verwendet man zur Gewinnung eines Weins, welcher feurig und kräftig ist. Durch Heuglin wissen wir, daß im Beginn der fünfziger Jahre diese Weinstöcke durch eine Traubenkrankheit alle zu Grunde gegangen sind.
Somit kann der Weinstock, obgleich er den Namen für diese Region hergab, keineswegs als Charakterpflanze für die Woina-Deka gelten. Statt seiner übernimmt diese Rolle eine Menge anderer Gewächse, die an Zahl, Ueppigkeit und Reichthum der Entfaltung selbst jene der Kola übertreffen. Dahin gehört zunächst der Wanzabaum (Cordia abessinica), der das beliebteste Bauholz liefert. Der Wanza wird ein großer, starker Baum, dessen Stamm oft vier Fuß im Durchmesser erreicht. Seine Früchte stehen in Büscheln und nehmen zur Zeit der Reife eine hochgelbe durchsichtige Farbe an. Der Geschmack derselben ist sehr süß und oft sind sie die einzige Nahrung der Armen, wenn Hungersnoth eintritt.
Der Kuaraf (Gunnera spec.), eine Artocarpee, gewinnt während der Fastenzeit an Bedeutung, weil dann die geschälten Blattrippen, die ähnlich unserm Sauerampher schmecken, gegessen werden. Er wächst in Sümpfen und an Bächen, ist eine jährige Pflanze, die aus einer perennirenden Wurzel entspringt und einen laublosen Stengel mit einem Büschel kleiner Blüten trägt. Auch die häufig bis zu fünf Fuß hoch werdende Nessel wird in der Fastenzeit als Gemüse verspeist. An diese Pflanzen schließen sich an die reich vertretenen Polygonum-Arten, ein Ampher (Rumex arifolius), dessen fleischige Wurzel zum Rothfärben der Butter benutzt wird. Als eine Nutzpflanze dieser Region muß hier ein uns allen bekanntes Gewächs besonders hervorgehoben werden.
Nach der Tradition sollen die südabessinischen Landschaften Enarea und Kaffa die Urheimat des Kaffees sein, wie denn auch der Name desselben mit dem letztgenannten Distrikte sicher in Zusammenhang steht. In Schoa war der Anbau und Genuß des Kaffees untersagt, weil er das Lieblingsgetränk der Muhamedaner ist, und auch in Amhara trinken die Christen denselben in der Regel nicht, wenn er auch bei Korata (Kiratza) am Tanasee gebaut wird und dort auf basaltischem Boden und gewissermaßen ohne Pflege gedeiht. Allein dort ist er fast nur Handelswaare. In Kaffa und Enarea dagegen wächst er wie Unkraut weit und breit im Lande, dessen Bewohner ihn als Lieblingsgetränk betrachten und fast nur einen nominellen Preis für ihn zahlen; nur dem Mangel an Verbindungswegen ist es zuzuschreiben, daß er von dort aus nicht ganz Europa überschwemmt und alle übrigen Sorten dort durch Güte und Billigkeit [pg 58]vom Markte verdrängt. Der kurz vor der Regenzeit gepflanzte Samen erscheint bald als Setzling über der Erde, wird verpflanzt, bewässert und mit Schafmist gedüngt, um nach sechs Jahren als erwachsenes Bäumchen während der Monate März und April dreißig bis vierzig Pfund Kaffee zu liefern. Namentlich auf zersetztem vulkanischen Gestein, in geschützten Thallagen gedeiht der acht bis zehn Fuß hohe, mit dunkelglänzendem Laube und fruchtbeladenen Zweigen versehene Baum vortrefflich. Die dunkelgrünen Beeren werden zur Reifezeit roth und umschließen mit milchweißem Fleische die Samen. Nachdem sie geschüttelt und gesammelt sind, werden sie in der Sonne getrocknet, worauf der Wind das Geschäft des Reinigens von den dürren Schalen übernimmt, das gewöhnlich im Laufe eines Monats vollendet ist. Diejenigen Samen jedoch, welche zur Fortpflanzung dienen sollen, behalten ihre Schale. Theuer wird das Produkt nur durch den weiten Transport, die schlechte Beschaffenheit und Unsicherheit der Straßen, die nach dem Meere führen, und durch die Abgaben, welche an alle kleinen Häuptlinge im Danakillande gezahlt werden müssen, ehe die Karawane die Seehäfen Zeyla oder Tadschurra erreicht. Was den Geschmack des südabessinischen Kaffees anbelangt, so versichern Kenner, daß er dem feinsten arabischen, selbst dem edlen Mocha, noch vorzuziehen sei. Aber so wie die Lage Abessiniens jetzt ist und namentlich wegen der Unsicherheit der Karawanenstraßen ist so leicht nicht daran zu denken, daß Kaffa-Kaffee die arabischen, ostasiatischen und amerikanischen Produkte auf unsern Märkten verdrängen wird.
Die Lilien, welche weite Gebirgswiesen mit einem lieblichen Blütenschmuck überziehen, gelten als vorzügliche Charakterpflanzen Abessiniens. Aber nur die eßbaren Arten werden kultivirt, da Ziergärten den Eingeborenen ein unbekanntes Ding sind. Während die Spargelarten und die Aloë trockene, wüste Stellen aufsuchen, erfreuen auf sumpfigen Wiesen Commelina africana und Tradescentia das Auge, deren „Vogeleier“ genannte Knollen von den Abessiniern gegessen werden. An sie schließen sich Ixia-, Haemanthus-, Amaryllis- und Gloriosa-Arten an. Mit saftigen, hellgrünen Blättern und schöngestalteten Blütenähren leuchtet aus den grünen Wiesen Obitus abessinica hervor, während unter den Spargeln der kletternde Asparagus retrofractus Erwähnung verdient, dessen in das Haar des Vorderhauptes gesteckte Zweige anzeigen, daß der Träger ein wildes Thier erfolgreich bekämpft hat.
Orchideen giebt es nur wenige in Abessinien; ihr hauptsächlichster Vertreter ist das auf der Rinde des wilden Oelbaums schmarotzende Epidendrum capense. Aus der Gruppe der Pisange sind die gemeine Banane (Musa paradisica) und die kultivirte Ensete, sowie zwei Urania-Arten zu erwähnen, aus deren Fasern Seile und Matten bereitet werden. Die Palmen haben in Abessinien keinen Boden; sie kommen nur in den Küstenlandschaften des Danakil und Adal vor und auch dort in keineswegs besonderer Ausdehnung. Vertreter dieser Familie sind namentlich die Dattel-, Dum- und Fächerpalme.
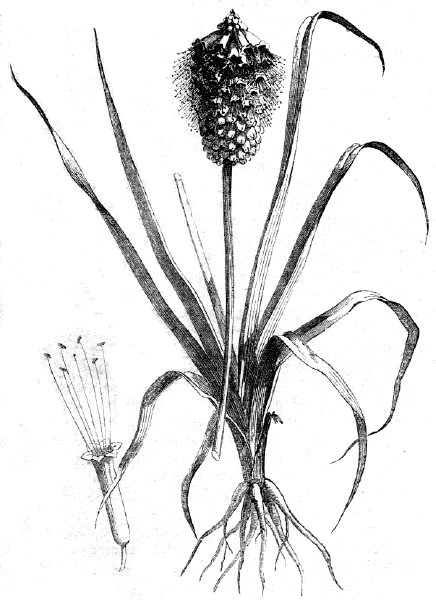
Die Teich- oder Seerosen sind spärlich vertreten; ebenso die Aristolochien, von denen A. bracteata gegen die Wunden vergifteter Pfeile angewandt wird. [pg 59]Reichlich auftretend bilden die Nadelhölzer den Stolz der abessinischen Wälder; in den nördlichen Hochlanden gedeiht die Cederfichte, während weiter landeinwärts schöne Ded- oder Wachholderbäume (Juniperus excelsa) die Kirchen und Friedhöfe mit ihren düstern, aber hochaufstrebenden Kronen beschatten. Kaum einem Gotteshaus im ganzen Lande fehlt der Schmuck dieser bis zu 100 Fuß hohen Bäume, deren Stamm am Fußende vier bis fünf Schuh im Durchmesser erreicht. Fast in der Form einer Pyramide wachsend, wirft dieser Baum stets die unteren Aeste ab, die im rechten Winkel vom Stamme [pg 60]ausgehen, sodaß etwa zwei Drittel desselben des grünen Schmuckes beraubt sind; die Krone ist immer pyramidenförmig, wenn auch nie dicht. Das Holz, wenn auch keineswegs gut und dauerhaft, wird doch zu Balken bei Kirchenbauten und in Ermangelung anderer Holzarten als Brennholz gebraucht. Das Harz wird nicht benutzt; mit den Zweigen schmückt man jedoch die Leichen, bevor sie in die Gruft gesenkt werden.
Die niedrige, in den Hochgebirgslandschaften herrschende Temperatur verhindert keineswegs die kräftige Entwicklung der Feigenarten, die in ihrem ganzen Habitus den strengsten Gegensatz zu den Nadelhölzern bilden. Der Schoala, eine Art von Banyane mit breiten, eiförmigen, zugespitzten und gesägten Blättern, mit Fruchttrauben, die nur am Stamme und den Hauptästen sitzen, erreicht oft einen Durchmesser von sieben Fuß, bei einer Höhe von 40 Fuß. Seine Wurzeln ragen über den Boden empor; doch fehlen ihm alle Zweigwurzeln. Da er bei seiner Ausdehnung keinen geringen Raum einnimmt, steht er gewöhnlich allein oder am Rande der Wälder, in seinem tiefen Schatten alle andern Gewächse erdrückend. Die braunen, taubeneigroßen Früchte werden vom Volke in Zeiten der Noth gegessen.
Unter den polypetalen Gymnoblasten, in welchen das Pflanzenreich in Gestalt und Farbe den höchsten Grad seiner Vollkommenheit erreicht hat, fehlen gerade einige der wichtigsten Familien in der abessinischen Flora. Aepfel, Birnen, Mandeln – überhaupt die Pomaceen und Amygdaleen sind so schwach vertreten, daß man in der That einen höchst auffallenden Mangel an Fruchtbäumen, wilden und kultivirten, dort empfindet. Die Berberitze liefert gelben Farbstoff zu Trauerkleidern; das Hirtentäschchen (Thlaspi bursa pastoris), dieses kosmopolitische Unkraut, folgt der Agrikultur in Abessinien so gut wie in Europa; der schwarze Senf wächst wild und dient als Zusatz zu den ohnehin scharfen Pfeffersaucen; Kürbisse, welche Flaschen liefern, afrikanische Gurken und Koloquinten wachsen an dürren Stellen, letztere namentlich in der Samhara und der heißen Küstenzone. Die Samen der Phytolacca abessinica (Septe oder Endott) dienen statt der Seife, und die getrockneten Blätter der Callanchoë verna werden von Schwindsüchtigen statt des Tabaks geraucht.
Wir fügen hier die Citronen an, die in den königlichen Fruchtgärten gebaut werden oder in den tieferen Lagen wild wachsen; die Brombeeren (Rubus pinnatus), welche die besten aller wildwachsenden Früchte liefern, und die gleichfalls als Nahrung dienende Hagebutte (Rosa abessinica).
Während der schwarze Pfeffer, die unentbehrliche Zuthat zu allen abessinischen Speisen, eingeführt und theuer bezahlt wird, kultivirt man den allerdings botanisch ihm fernstehenden rothen Pfeffer (Capsicum frutescens) in den Tieflanden sehr sorgfältig. Von den übrigen Solaneen wird der Tabak eingeführt; vom Umboistrauch (Solanum marginatum) benutzt man die Samen, um damit die Fische zu betäuben, welche nichtsdestoweniger eßbar bleiben; der rothe Saft einer Tollkirsche (Atropa arborea) dient zum Färben der Nägel bei den abessinischen Damen, und die narkotischen Eigenschaften des Stechapfels (Datura [pg 61]Strammonium) sind den Zauberern und Diebsentdeckern wohlbekannt, da sie durch Verbrennen des Laubes die Leute betäuben. Gefährlich für kleine Thiere ist eine giftige Asclepiadee (Kannahia laniflora), die an den Ufern der meisten abessinischen Gewässer vorkommt, nur mit dem Unterschiede, daß sie, je nach den verschiedenen Distrikten, in ganz entgegengesetzter Jahreszeit blüht. In den Küstenthälern unfern Massaua findet die Entwicklungsperiode ihrer vortrefflich duftenden Blume im Mai statt; bei Gondar dagegen blüht die Pflanze im Oktober. Merkwürdig ist die tödtlich-betäubende Eigenschaft, welche ihr verführerischer Geruch oder süßer Nektarsaft auf verschiedene Insekten ausübt; denn nur ihm kann man es zuschreiben, daß in dem Kelche der meisten Blüten sich todte Wespen, Käfer u. s. w. finden.
Durch zahlreiche Repräsentanten sind die Familien der Kontorten, Rubiaceen und Ligustrineen vertreten. Am hervorragendsten sind eine Aasblume (Stapelia pulvinata) und Calotropis gigantea. Die erstere hat einen fleischigen, viereckigen und zwei Fuß hohen Stengel, dem man, wenn er seine Blüten entfaltet, wegen des üblen Geruches jedoch nicht zu nahen vermag; die letztere liefert gute Kohle zu Schießpulver.
Die Deka nimmt ihrer Ausdehnung nach den größten Theil Abessiniens ein. Sie reicht von 7500 Fuß bis zur Vegetationsgrenze bei 13,000 Fuß. Bis zu 12,000 Fuß Höhe gedeihen noch mehrere Getreidearten und bis 11,000 Fuß findet man den Kussobaum (Brayera anthelmintica), der als Wahrzeichen des Landes gelten kann. Wegen der Schönheit seines Wuchses und seiner Brauchbarkeit wird er allgemein geschätzt; denn infolge des rohen Fleischgenusses sind die Abessinier sehr stark von Eingeweidewürmern (Taenia und Strongilus) geplagt, gegen welche sie sich regelmäßig und zwar meist allmonatlich einer Abkochung der Kussoblüten bedienen. Drei Loth der getrockneten Blüten mit Wasser gekocht und getrunken, reinigen den Körper auf eine merkwürdig schnelle und sichere Weise von den gefräßigen Schmarotzern; indessen ist die dadurch bewirkte Befreiung nur eine vorübergehende und keine Heilung des Uebels. Der Kussobaum erreicht eine Höhe von fünfzig bis sechzig Fuß und verleiht mit seinen weitausgedehnten und dichtbelaubten Zweigen dem Wanderer kühlen Schatten; jedoch soll es gefährlich sein, zur Blütezeit unter ihm zu schlafen; so berichtet wenigstens Isenberg.
In Schoa wird unter Kusso die Hagenia abessinica verstanden, die gleichfalls wurmtreibend wirkt. Als eine abessinische Charakterpflanze verdient die stachelige Kugeldistel (Echinops horridus), die bis zu zehn Fuß Höhe erreicht, hervorgehoben zu werden. Es ist eine stattliche Staude mit straff aufstehenden Stengeln, dornig gezähnten Blättern und runden Blütenköpfen, aus denen Dornen hervorragen. Neben ihr finden wir eine andere nicht minder auffällige Art, die riesige Kugeldistel (Echinops giganteus), deren kopfgroße Blüten auf 15 Fuß hohem Stengel stehen; beide Arten steigen bis zu 13,000 Fuß an.
Wir sind nun allmälig hinaufgelangt in die höchsten Regionen der Deka. Die Hochbäume erscheinen immer spärlicher und finden sich vorzüglich noch längs [pg 62]den Ufern der Wildbäche und Schluchten, die dornigen Akazien und Pterolobien sind verschwunden. Vor uns liegen Alpenmatten mit tausenden von kleinen, schön blühenden Alpenpflanzen bedeckt, unter denen sich blaublühende Salbeiarten besonders auszeichnen. Daneben stehen Senecionen und der fiebervertreibende Celastrus obscurus, die Primula semiensis. Ueber diesen erheben sich Sträucher, besonders Hypericum und Cytisus. Den europäischen Eindruck, welchen diese Pflanzen etwa hervorbringen können, vertreiben die baumartigen Eriken oder Zachdi (Erica arborea), die bis zu 30 Fuß heranwachsen und einen 1½ Fuß im Durchmesser haltenden Stamm besitzen, dessen Holz eine vorzügliche Schmiedekohle liefert, während die reiche weiße Blütenfülle den süßesten Honigseim den Bienen darbietet. Jetzt aber entwickelt sich vor unsern erstaunten Blicken in der Höhe von 12,000 Fuß ein neues, überraschendes Bild, eine Pflanze tritt auf, die für den Charakter ihres Bereichs bestimmend ist, die Dschibarra (Rhynchopetalum montanum). Diese Lobeliacee überrascht den Wanderer in den kalten Hochgebirgen an der äußersten Grenze der Vegetation mit einer dort gewiß von ihm nicht gesuchten Form: nämlich der der Palme. Auf einem hohlen, etwa acht bis zehn Fuß hohen benarbten und armdicken Markstengel mit einer Krone von großen, überhängenden, lanzettförmigen Blättern erhebt sich eine fünf Fuß lange Blütenähre, deren einzelne bläuliche Knospen der Blüte des Löwenmauls ähneln. Für Feuerung oder sonstigen technischen Gebrauch untauglich, dient der lange hohle Markstengel der Jugend zur Anfertigung von Schalmeien. Sobald die Dschibarra abgeblüht hat, knickt der Stengel um und die Pflanze stirbt. Auf ihren Blütenschossen wiegt sich paarweise die einzige Glanzdrossel (Oligomydrus tenuirostris), die in diesen Gegenden lebt und die feinen Dschibarrasamen allen übrigen vorzuziehen scheint. Drei bis vier Stunden Marsch führen uns aus dem tropischen Walde auf diese mit Dschibarra bewachsenen Alpenflächen, über denen nur noch wenige kahle Felsgipfel auf etwa 1000 Fuß relative Höhe in die Wolken ragen; drunten haust die flüchtige Gazelle, Meerkatzen necken sich in den Hochbäumen; hier aber setzt kühn der Springbock (Oreotragus saltatrix) über die Felsen, grast friedlich der Steinbock (Ibex Walia) und warnt durch einen gellenden Ruf seine Herde vor der herannahenden Gefahr; Alpenkrähen umschwärmen geschwätzig und in rauschendem Fluge die höchsten Felsen und drüber schwebt in weiten Kreisen der König der Alpen, der Lämmergeier. Auch die gefleckte Hyäne steigt bis in diese Höhen, seltener der Leopard und ein Fuchs (Canis semiensis), der ausschließlich von den äußerst zahlreich hier hausenden Ratten und Mäusen lebt. Auch Tauben (Columba albitorques) schwärmen in großen Flügen in diesen höchsten abessinischen Alpengegenden umher.
Die Fauna Abessiniens. Fast noch reicheren Stoff als die Pflanzenwelt bietet dem Beobachter die Thierwelt Abessiniens dar. Nicht genügend erforscht sind die niederen Thierklassen, unter denen auch wenige Mitglieder ein allgemeines Interesse in Anspruch nehmen. Von der Plage der Eingeweidewürmer und ihrer Vertreibung durch Kusso war bereits die Rede; die höher [pg 63]stehenden Insekten treten im Hochlande nur in der wärmeren Jahreszeit in großen Mengen auf, werden aber durch die kalten Regen wieder in die tiefer liegenden Gegenden getrieben. Die Heuschrecken, amharisch Anbasa, richten oft großen Schaden an, wie in den andern Nilländern auch.
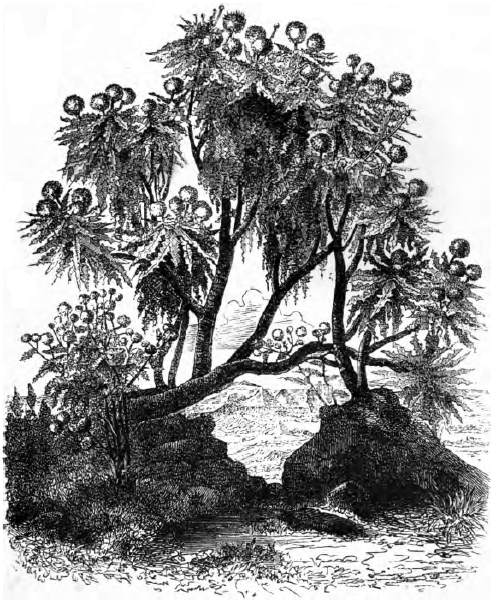
Ihr plötzliches Verschwinden wird in der Regel der gnädigen Fürsprache der Heiligen zugeschrieben und diesen daher ein Dankopfer gebracht. Die Wanderheuschrecke dehnt ihre Züge bis hoch in die Gebirgsgegenden aus. Rüppell fand das [pg 64]Land am Takazzié von Myriaden dieser Thiere geradezu abgefressen. Der Boden der ganzen Gegend war buchstäblich von ihnen bedeckt. Er fügt hinzu: „Wenn übrigens manche Reisende von einer Verdunkelung des Sonnenglanzes durch Heuschreckenzüge reden, so ist diese Erscheinung lediglich auf die gleichzeitige dunstige und staubige Atmosphäre zu beziehen und nicht der vermeintlich so ungeheuren Menge von Heuschrecken zuzuschreiben, deren Wandern allein durch schwülen südlichen Luftzug veranlaßt wird. Der ganze Boden schien mit diesen Thieren überdeckt zu sein, bei genauem Zählen aber fanden sich nur etwa 12 bis 30 Heuschrecken in dem Raume eines Quadratfußes“. Die christlichen Abessinier essen die Heuschrecken nicht; sie betrachten sie als verbotene Speise und unter den Muhamedanern bequemen sich nur arme Leute zu dieser Nahrung. Ein nützliches, allgemein gepflegtes und in Bienenkörben gezüchtetes Insekt ist die ägyptische Honigbiene, von der große Mengen des süßen Seims gewonnen und zu dem landesüblichen Meth benutzt werden. Es giebt auch eine kleinere wilde Biene, die in Erdlöchern ihre Baue aufschlägt und einen Dasma genannten Honig liefert, der als Medikament sehr geschätzt ist. Diese Dasma wirkt leicht abführend, hat eine röthlichere Farbe als gewöhnlicher Honig und einen bittern Nachgeschmack. In Gegenden, wo die Bienen viel Honig von Kronleuchtereuphorbien und andern giftigen Pflanzen sammeln, wirkt derselbe selbst im Meth sehr nachtheilig auf die Gesundheit, er erzeugt Schwindel, Kopfschmerzen, Erbrechen und andere Symptome einer leichten Vergiftung. Fliegen und Moskitos kommen wol in den kühlern Hochlanden vor, werden jedoch nicht zur Landplage, in der Weise wie die Flöhe. Die schwarze Ameise, welche sich wasserdichte Wohnungen gegen den Regen baut, wird dem Menschen oft lästig, während die Termiten nur selten in die Häuser dringen und meist unter losen Steinen ihre kleinen Kolonien anlegen. Käfer, amharisch Densissa, sind in großer Menge vorhanden, besonders die Koth- und Pillenkäfer, die man auch in Aegypten antrifft. Spinnen und Skorpione werden als unrein gemieden und vernichtet.
Fische sind im Hochlande Abessiniens nicht allzu häufig, um genügende Fastenspeise liefern zu können. Der Takazzié allein ist besonders reich an großschuppigen, olivengrauen Karpfenarten mit lebhaft wachsgelben Flossen und enthält einen Heterobranchus von enormer Größe, welcher mit der Angel gefangen oder mit abessinischem Fischgift betäubt wird. In Atbara kommt ein Wels vor, der schöne Hausenblase liefert, welche jedoch nicht eingesammelt wird.
Die Amphibien sind Gegenstände des Abscheus und des Aberglaubens. Die Schlangen der Hochlande sind klein und nicht giftig, doch sehr gefürchtet; in der Kola, sowie in den Küstengegenden fehlen jedoch große Pythonarten und giftige Exemplare keineswegs. In den Niederungen werden auch Schildkröten gefunden, unter denen die große Geochelone senegalensis hervorragt; im Anseba-Gebiet und in Schoa kommt eine Cinixys in vielen Sümpfen und Bächen vor, und die Pentonyx Gehafie steigt überall aus dem Tieflande bis zu 8000 Fuß empor. Neben diesen gepanzerten Amphibien sind die Krokodile (Aso) namentlich in der Kola sehr häufig; im Setit, Atbara und Mareb werden sie von den [pg 65]Eingeborenen harpunirt und ihr moschusduftendes Fleisch verzehrt. Fälschlich jedoch hat man ihr Vorkommen im Tanasee behauptet. Sonst sind unter den Sauriern noch zu nennen der Skink (Scincus officinalis), das Chamäleon, der Gekko und Stellio cyanogaster als Gesellschafter der Klippdachse. Die Warneidechse (Varanus niloticus) ist auch in Abessinien häufig und hat hier ihren einheimischen Namen, Angoba, auf viele Flüsse übertragen.
Schwer hält es, bei dem großen Reichthum der verschiedenen Arten abessinischer Vögel, welche sich dem Auge des Forschers zeigen, einen Ueberblick nur der wichtigsten zu geben und eine Auswahl aus der Menge dieser prachtvoll gefärbten, eigenthümlich gestalteten und hinsichtlich ihrer Lebensweise merkwürdigen Geschöpfe zu treffen. Aber gerade auf dem Gebiete der Ornithologie Abessiniens ist von Rüppell, Heuglin, Brehm Vorzügliches geleistet worden, sodaß man wohl behaupten darf, besser als das Pflanzenreich und die übrigen Klassen des Thierreichs sei die Vogelwelt der „afrikanischen Schweiz“ durchforscht.
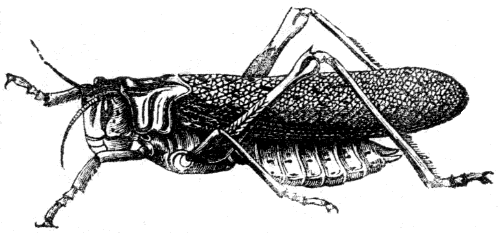
Es giebt wol kein zweites Land, das so reich an Tag-Raubvögeln ist wie Abessinien. Vermöge der höhern Lage der Plateaux bieten sich in den Felspartien günstige Lebensbedingungen für Adler, Geier und Falken, die hier ihre Horst- und Zufluchtsstätten finden. Die Vegetation prangt in außerordentlicher Fülle; in allen Thälern und Schluchten sprudeln Gebirgswasser; im dichten Gestrüpp und in den Gräsern hausen Reptilien in Menge, von der Pythonschlange und Naja bis zur kleinsten Baumschlange herab; Schildkröten weiden gemüthlich an Hecken und Teichen; an Säugethieren von der Größe der Feldmaus aufwärts ist Ueberfluß vorhanden, während schattige, fast undurchdringliche Waldpartien, abgelegene Schluchten, die selten eines Menschen Fuß betritt, und fast unersteigliche Felsen und kolossale Hochbäume den Raubvögeln jeden Schutz und Schirm gewähren. Da horstet denn der mächtige Gyps Rüppellii, der gemeine ostabessinische Mönchsgeier (Neophron pileatus), der Schmuzgeier (N. percnopterus), der Bartgeier (Gypaëtos meridionalis) und Schlangenadler (Gypogeranus serpentarius), die viele Schlangen verzehren und mäßig starke Wüstenschildkröten mit einem Schlag ihrer starken Fänge zerschmettern. Zahlreiche Weihen, Milane, Falken und Sperber machen den Beschluß der Tagraubvögel. Der unreinliche Mensch giebt den Schmuzgeiern tagtäglich neue Nahrung und damit neue Beschäftigung; deshalb vermißt man diese wohlthätigen Vögel an keinem Orte. Sie folgen den Herden wie den Handelszügen, umschweben die Dörfer und Schlachtplätze und räumen schnell allen Unrath auf. [pg 66]Der große, von Brehm zuerst genau beschriebene Rüppell’sche Aasgeier erscheint erst dann, wenn irgend ein Aas ihn heranlockt. In ungemessenen Höhen, wohin ihm des Menschen Auge nicht zu folgen vermag, zieht er dahin; aber sein Auge beherrscht ein weites Gebiet und die mächtigen Schwingen tragen ihn schnell nach dem Orte, wo ein Stück Wild verendet oder einem Schaf die Kehle durchschnitten wird. Kaum fließt das Blut, so ist auch der Aasgeier da; reiche Beute aber wird ihm zu Theil, wenn das Land weit und breit mit Menschenleichen übersäet ist, wenn die grausamen Bürgerkriege wüthen und den Zug der Heere gefallene Rinder und Schafe bezeichnen. Wo er erscheint, da fehlen auch selten seine kleineren Verwandten, der Schopf- und der Ohrengeier (Vultur occipitalis und V. auricularis). Unter den Adlern begleitet der Augur, ein naher Verwandter unsers Bussards, den Zug der Reisenden, während der „Himmelsaffe“ oder Gaukler (Helotarsus ecaudatus) sowol durch die Kühnheit seines Fluges, als durch die Schönheit seines Gefieders jeden Beschauer in Entzücken versetzt. Unter allen Raubvögeln ist er der stolzeste Flieger: er jagt förmlich durch die Luft. Nur während des Fluges zeigt er seine volle Schönheit. Sitzend bläht er die Federn auf, sträubt Kopffedern und Halskrause und gestaltet sich in einen Federklumpen um. Eine der häufigsten Erscheinungen ist der Schmarotzer-Milan (Milvus parasiticus), dessen scharfem Auge nichts entgeht und der durch seine Allgegenwart an den Schlachtplätzen, wo kein Stückchen Fleisch vor ihm sicher ist, sich lästig macht oder durch die größte Frechheit, mit welcher er dem Menschen das Fleisch fast unter den Händen wegzieht, diese in Erstaunen versetzt. Auch der Singhabicht (Melierax polyzonus) kommt südlich vom 17. Grade in allen Steppenwaldungen häufig vor; er verweilt am liebsten auf einzelnstehenden Bäumen, hat jedoch keinen besonders schönen Flug und giebt ein langgezogenes, eintöniges Pfeifen, keineswegs aber einen melodischen Gesang von sich. Seine Hauptnahrung besteht in Insekten, vorzugsweise aber in Heuschrecken, an denen Abessinien eben nicht arm ist. Unsere Weihen vertritt der in Nordostafrika häufige Steppenweih (Circus pallidus); er meidet jedoch das Gebirge und zieht die breiten Niederungen mit kurzem Gestrüpp vor, aus welchem er auf kluge Weise das kleine Geflügel aufscheucht.
Unter den Eulen finden wir unsere Schleiereule und den Kauz, die kurzöhrige Eule (Otus brachyotus) und die Zwergohreule (Ephialtes Scops). Im Gebirge haust ein Uhu (Bubo cinerascens), der zu den gemeinsten Eulen gehört. Dieser Uhu horstet am liebsten auf Bäumen und wird nicht wie unsere europäische Art von kleinern Vögeln verfolgt. In den Steppen wie im Gebirge trifft man auf die Ziegenmelker (Caprimulgusarten), jene unheimlichen Vögel mit leisem Fluge und eigenthümlichem Nachtgesange. Gleich großen Nachtfaltern umschweben sie die Wipfel der Bäume und die Dächer der Häuser, um ihrer Kerbthierjagd nachzugehen.
Reich vertreten sind die schwalbenartigen Vögel (Hirundo, Cypselus). Die meisten derselben sind auch hier Zugvögel und kommen vor Beginn der Regenzeit, im Mai und Juni, um zu brüten.
[pg 67]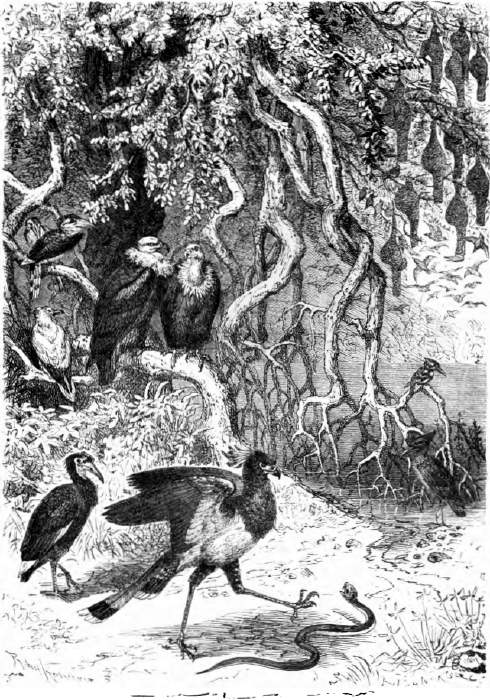
Hornvogel. Ohrengeier. Webervögel.
Schmuzgeier. Eisvogel.
Hornrabe. Schlangenadler. Schattenvogel.
Die Hausschwalbe ist Hirundo oder Cecrops rufifrons; sie erscheint kurz vor den Sommerregen und beginnt, sobald diese letzteren die Erde etwas erweicht haben, aus Lehm ein sehr solides, rundes Nest zu bauen, das sie mit der Basis auf Dachsparren aufsetzt, nicht seitwärts anklebt wie unsere Schwalbe. Sie macht zwei bis drei Bruten und verläßt die Höhen erst im Dezember. – Durch schönen Flug zeichnet sich der abessinische Segler (Cypselus abessinicus) aus, der in den Bäumen nistet; er ist ein ausgezeichneter Flieger, wie alle seines Geschlechtes. An manchen Stellen vertritt ihn die Felsenschwalbe (Cotyle obsoleta), die ihr Nest in den Ritzen und Spalten der Felsen baut, doch nur an solchen Orten, wo die räuberischen Affen nicht hingelangen können.
Prächtig gefärbte Bewohner Abessiniens sind neben der Mandelkrähe (Coracias abessinicus) und dem Eisvogel (Ispidina cyanotis) vor allen andern die Bienenfresser (Merops Lafrenayi) und die Narina (Trogon Narina), die lautlos über den Mimosenbüschen dahinschwebt, die Schmetterlinge oder andere Insekten fängt und durch ihr glänzendes Gefieder das Auge des Beobachters erfreut. Ihnen schließt sich der Wiedehopf (Upupa) an, der neben den Aasgeiern fleißig allen Unrath wegräumt und mit Recht in keinem guten Geruche steht. Seine Verwandten sind die Baumwiedehopfe (Promerops erythrorhynchus), die in Gesellschaften gleich Spechten auf den Bäumen umherklettern, die Ameisen aufsuchen und von dieser Nahrung einen durchdringenden Geruch annehmen. Den Kolibri vertreten in Abessinien die metallglänzenden Honigsauger (Nectarinia metallica, abessinica, affinis), welche von den Arabern „Abu Risch“, Federträger, genannt werden und als die ersten Tropenvögel in Nordostafrika auftreten, auf welche man, aus kälteren Gegenden kommend, stößt. Die reizenden Vögelchen leben meist paarweise auf den Mimosen und ziehen im brennenden Sonnenstrahle von Blüte zu Blüte, um dort Insekten zu fangen, zu singen, die Federn zu sträuben, den Schwanz zu heben und das glänzende Gefieder im Sonnenlichte glänzen zu lassen.
Keineswegs fehlt es Abessinien an Sang und Klang in der Vogelwelt; neben dem glänzenden Gefieder findet auch der melodische Schmelz der Töne seine Vertretung. Im Rohre schmettert fröhlich der Buschschlüpfer (Drymoica rufifrons) oder die Caricola (C. cisticola), an welche sich die abessinische Baumnachtigall (Aedon minor) anschließt, die schon dem Wanderer entgegenschlägt, wenn er, vom Rothen Meere kommend, bei Massaua seinen Fuß ans Gestade setzt. An Steinschmätzern (Saxicola-Arten), Vertretern unserer Drosseln (Thamnolaea), Bachstelzen (Motacilla alba und flava) ist kein Mangel. Zu letztern, uns aus der Heimat bekannten Arten gesellen sich die verwandten Schafstelzen (Budytes), niedliche Vögel, welche in großer Zahl den Herden folgen, deren treueste Begleiter sind und diesen das Ungeziefer ablesen. Im Hochgebirge, namentlich in Semién, lebt eine Drossel (Turdus simensis), welche unsrer Singdrossel sehr ähnelt, neben der als regelmäßige Wintergäste die Steindrosseln (Petrocincla saxatilis) erscheinen. Als guter Sänger wird der von Lichtenstein entdeckte Droßling (Picnonotus Arsinoë) bald der Liebling aller Reisenden, vor denen er [pg 69]sich durchaus nicht scheut. Anschließend hieran erwähnen wir aus der Familie der Fliegenfänger den Paradiesfänger (Tchitrea melanogastra), den Würgerschnäpper (Dicrourus), die zahlreich vertretenen Würger (Lanius) und unsre Nebelkrähe, die als Wintergast nach Abessinien kommt. Diese trifft als Verwandte hier den Wüstenraben (Corax umbrinus), ein Mittelglied zwischen Rabe und Krähe, der aber nicht blos in der Wüste vorkommt, sondern auch die Flecken und Dörfer besucht, wo er den Hunden und Geiern das Aas streitig macht, während er draußen nach Früchten, am Strande nach Muscheln sucht und eben Alles verschlingt, was sich ihm darbietet. Ein echter Gebirgsvogel ist der kurzschwänzige Rabe (Corvus affinis), der bis zu 11,000 Fuß aufsteigt und dort in großen Scharen weilt. Durch seinen kurzen Schwanz macht er sich vor allen Verwandten leicht kenntlich; er vertritt in Abessinien unsern Kolkraben, lebt nur paarweise und bedeckt Abends, wenn er zur Rast geht, oft große Felsblöcke. Die Staare sind durch mehrere Geschlechter, die dohlenartigen Felsenstaare (Ptilonorhynchus), Glanzdrosseln (Lamprocolius) und Glanzelstern (Lamprotornis) vertreten. Bei Weitem der interessanteste Vogel aus dieser Familie ist aber der afrikanische Madenhacker (Buphaga erythrorhyncha), der von der Südspitze Afrika’s an bis nach Abessinien hinein vorkommt und der treueste Begleiter der Herden ist, sodaß es scheint, als könnten Rinder, Kameele, Pferde kaum ohne ihn leben. Da wo diese wunde Stellen haben, in welche die Fliegen ihre Eier legen, aus denen die Maden entstehen, erscheint auch die Buphaga, klettert an dem Thiere herum, wie ein Specht am Baume und sucht ihm die Maden ab. Das Thier kennt seinen Wohlthäter recht gut, aber die Abessinier hassen den Madenhacker, weil sie glauben, daß er durch sein Picken die aufgeriebenen Stellen reize.
Die finkenartigen Vögel kommen gleichfalls in großer Menge vor. Reichlich treffen wir vorzüglich Amadina, Vidua, Estrelda, Serinus, alles gute Sänger, während der Weber (Textor alecto) nur einen drosselartigen Ruf und unschönes Gezwitscher ertönen läßt. Dafür baut er aber ein zusammenhängendes Nest, in dem ganze Gesellschaften brüten. Es besteht aus dürrem Reisig, von dem eine große Masse, oft von 5 bis 8 Fuß Länge und 3 bis 5 Fuß Breite und Höhe, zwischen tauglichen Astgabeln der Baobab-Bäume aufgehäuft wird. In einem solchen sind 3 bis 8 Nester tief im Innern angelegt und diese mit feinem Gras und Federn ausgefüttert. Die Farbe der Eier wechselt zwischen rein weiß, roth, grün, braun mit allen möglichen Zeichnungen, sodaß man glaubt, Eier verschiedener Arten vor sich zu haben. Der Eingang zu dem unordentlichen Neste ist im Anfange so groß, daß man bequem mit der Faust eindringen kann, verengert sich aber und geht in einen Kanal über, gerade für den Vogel passend. Durch prachtvollen Federschmuck sind die Witwen (Viduae) ausgezeichnet, und leicht unterscheidet man das Männchen durch seine langen, am Fluge hindernden Schwanzfedern von dem Weibchen. Hat es aber im Winter das prächtige Gefieder abgelegt, dann fliegt es leicht dahin, ähnlich wie unsere Ammern. Als Haussperling tritt, unserm Spatz das Recht streitig machend, in Nordostafrika [pg 70]der rothrückige Sperling (Passer rufidorsalis) auf, dessen Sitten und Lebensweise ganz die unseres Haussperlings sind, nur ist er schöner gefärbt. Gemein, wie bei uns, ist auch in Abessinien die Haubenlerche (Galerita abessinica), welcher sich als Verwandte die seltenere Wüstenammerlerche (Ammomanes deserti) anschließt.
Haben wir bisher viele, unsern europäischen Arten verwandte Vögel gefunden, so treffen wir in der folgenden Familie, jener der Pisangfresser, durchaus auf fremdartige Gestalten. Da sind zunächst die Mäusevögel (Colius), die in dichten Büschen leben, durch die schmalsten Oeffnungen der Verzweigungen sich zwängen und im Klettern eine große Geschicklichkeit entwickeln. Der von Rüppell entdeckte Helmvogel (Corythaix leucotis) tritt erst da auf, wo die Kronleuchter-Euphorbie beginnt; er ist ein prächtiger, rastloser, unsern Hehern im Betragen ähnlicher Geselle, der die Sykomoren, Tamarinden und Aloëpflanzen gern besucht und auf diesen sich in großer Anzahl sammelt. Der eigentliche Pisangfresser (Schizorhis zonurus), der sich durch ein affenartiges Geschrei auszeichnet, hat Vieles mit seinen Verwandten, den Nashornvögeln überein, von denen mehrere kleine Arten (Tockus erythrorhynchus und nasutus) häufige Bewohner der Steppen und des Urwaldes sind. Je mehr man in das Gebirge kommt, desto häufiger werden sie, desto öfter vernimmt man ihren charakteristischen Ruf. Weit größer als die nur anderthalb Fuß langen Nashornvögel, aber auch seltener sind die kräftigen, fast 4 Fuß langen, sehr scheuen Hornraben (Bucorax abessinicus).
Wenig ist aus der Ordnung der Klettervögel zu berichten. Die Papageien finden im abessinischen Gebirge keineswegs, wie in ganz Afrika, ergiebigen Boden, obgleich einige Arten von ihnen vorkommen. So liebt der Zwergpapagei (Psittacula Tarantae) die Kolkwal-Euphorbie, auf welcher er häufig anzutreffen ist, der Halsbandpapagei (Palaeornis torquatus) aber dichte Wälder, in welchen er in großen Familien und Flügen gewöhnlich mit den Affen zusammen erscheint. Die Bartvögel (Pogonias Saltii) kommen nur einzeln im dichtesten Gebüsche vor und sind still, bis auf den Perlvogel (Trachyphonus margaritatus), welcher im Verein mit dem Weibchen einen lustigen Gesang vorträgt und die Gärten der Dörfer belebt. Die Spechte treten nur als kleine Baumspechte (Dendropicus Hemprichii) auf.
Unter den Kukuksarten spielt der Honigvogel eine große Rolle in der Ornithologie der Abessinier; obgleich selten vorkommend, kennt ihn Jedermann, und schon die ältesten Nachrichten über das Land (so Ludolf in seiner „Historia aethiopica“) erwähnen der Eigenschaft dieses unscheinbaren Thierchens, den Menschen zu den Bienenstöcken zu führen. Die Honigvögel (Indicator) halten sich vorzüglich an baumreichen Bachufern auf, flattern von einem Baume zum andern und lassen dabei ihre starke, wohlklingende Stimme hören. Daß sie so rufend häufig zu Bienenschwärmen führen, weiß jeder Eingeborene Afrika’s vom Kap bis zum Senegal und von der Westküste bis nach Abessinien herüber, doch führt der Indicator den ihm folgenden Menschen ebenso häufig auf gefallene Thiere, die voller Insektenlarven sind; er verfolgt mit seinem Geschrei den Löwen und Leoparden, kurz Alles, was ihm auffällt; auch ist er dem Menschen gegenüber [pg 71]nichts weniger als scheu und trotz der unscheinbaren Größe und Färbung sind alle Arten an der eigenthümlichen Weise des Flugs leicht zu erkennen. In Nordostafrika giebt es vier Arten von Honigvögeln, von denen jedoch nur zwei (Indicator minor und albirostris) in Abessinien vorkommen.
Ueberall wo man in Abessinien Vögel findet, wird man auch Tauben wahrnehmen in den verschiedenartigsten schön gestalteten und gefärbten Formen. Die abessinische Taube (Treron abessinica) bewohnt in kleinen Familien die tieferen Gebirgsthäler, wo sie die Mimosen, Kizelien und Sykomoren sich zum schattigen Ruhesitz aussuchen, um ihre Liebesspiele zu treiben und gleich dem Papagei durch das Laub zu klettern. Unsere Felsentaube vertritt die blaurückige Taube (Columba glauconotos), als eigentliche Waldtaube tritt die Guineataube (Stictoenas guinea) auf; auch die Turteltaube (Turtur auritus), die Lachtaube (T. risorius) finden sich; eigenthümlich ist aber die Erscheinung der Erdtaube (Chalcopelia afra), die nicht über den 16. Grad nördlicher Breite hinaufgeht und friedlich das dichtverschlungenste Gebüsch an der Erde bewohnt, auf welcher sie auch, ihren Verwandten unähnlich, ihr Nest baut.
Von Hühnern tritt in zahlloser Menge das lautschreiende Perlhuhn (Numida ptilorhyncha), die Wachtel als Wintergast und an Stelle unserer Rebhühner die verschiedenen, schön gezeichneten und in Einweibigkeit lebenden Frankoline (Francolinus rubricollis, Erkelii u. s. w.) auf; auch die Flughühner (Pterocles) sind vertreten und die Laufvögel beginnen mit der in den Steppen häufigen Trappe (Otis arabs), die nicht die Größe unserer großen Trappe erreicht, aber weniger scheu ist und besonders von Insekten lebt. Kommt der Strauß (Struthio Camelus) auch nirgends im abessinischen Hochland vor, so umzieht er dasselbe doch ringsum in den Steppen und Wüsten.
Unter den Regenpfeifern und Kiebitzen fällt nur der Dickfuß (Oedicnemus affinis) wegen seiner nächtlichen, eulenartigen Lebensweise auf; an feuchten, fischreichen Stellen wimmelt es oft von Reihern, Storcharten, Schattenvögeln und Störchen und an den Küsten des Rothen Meeres sind Möven, Pelikane, Seeschwalben und Tölpel im Ueberfluß vorhanden. Reich an Wassergeflügel ist auch der Tanasee, dessen breite, mit Inseln durchzogene Fläche demselben einen günstigen Aufenthaltsort gewährt. Dort wimmelt es von Seeschwalben, Enten (Anas clypeata, sparsa u. s. w.), Strandläufern, Kiebitzen, Regenpfeifern; da stehen unbeweglich der Riesenreiher und der schwarzkehlige Fischreiher (Ardea Goliath und A. atricollis), auf Reptilien lauernd, da plätschern Wasserhühner, Gänse und Spornschwäne in der Flut.
Weil mehr mit dem Menschen im Verkehr und ihn als Raub-, Jagd- oder Hausthier meist näher angehend, fesselt auch das Reich der Säugethiere mehr unser Interesse als jenes der Vögel.
Abessinien mit seinen Grenzländern kennt etwa sechs bis acht Affenarten. Ruhig und gemüthlich verfließt das Leben der graugrünen Meerkatze (Cercopithecus griseo-viridis), eines echten Baumaffen, der in starken Banden gesellig zusammenlebt und von der Höhe seines Aufenthaltes selten auf den Boden [pg 72]herabkommt, gleichviel ob er dort in Dornen der Mimosen oder im Laub der Sykomore sitzt. Seine Behendigkeit ist unglaublich groß und mit Hülfe des steuernden Schwanzes führt er die kühnsten Sprünge aus. Als unumschränkter Herr und Gebieter steht der lustigen Herde ein altes, geprüftes Männchen vor, das alle jungen Nebenbuhler von den seiner Obhut unterstehenden Damen fernhält. Diese zeigen gegen ihre häßlichen Sprößlinge eine außerordentliche Mutterliebe, welche sie durch fortwährendes Reinigen und Liebkosen des Kindchens bethätigen. Nur nebenbei verzehrt diese Meerkatze Heuschrecken und andere Insekten; Früchte, Knospen und Getreide sind ihre Lieblingsgerichte und wehe dem Durrah- oder Maisfelde, in das die verschmitzte Bande lüstern eindringt! Das Wenigste wird nur verzehrt, das Meiste unbarmherzig verwüstet und dann auf der Stätte des Diebstahls ein Tummelplatz freudiger Spiele für Alt und Jung bereitet. Vor Menschen weniger, wohl aber vor Hunden, Schlangen, Fröschen und ihrem besondern Feinde, dem Habichtsadler, fürchtet sich die Meerkatze sehr. Weit würdevoller als die Meerkatzen treten die Paviane auf, unter denen der Silberpavian oder Hamadryas (Cynocephalus Hamadryas) der häufigste ist. Dieses merkwürdige Geschöpf, dem schon die alten Aegypter Achtung zollten und das man auf ihren Denkmalen abgebildet findet, lebt zwischen 1000 und 7000 Fuß Meereshöhe und findet sich um so häufiger, je pflanzenreicher das Gebirge ist. Jede Bande behauptet im Gebirge ein bestimmtes Gebiet und zählt etwa fünfzehn bis zwanzig erwachsene und kampftüchtige Männchen, wahre Ungeheuer mit einem Gebiß, welches fast mit dem eines Löwen wetteifern kann, dasjenige des Leoparden jedoch übertrifft. Schon von Weitem unterscheidet man die Männchen an ihrem langen graugrünlichen Mantel und der hervorragenden Gestalt von den bräunlicher gefärbten Weibchen, die vollauf mit ihren übermüthigen Jungen zu thun haben. Greift auch der Pavian so leicht einen Mann nicht an, so ist er doch den Frauen ein Gegenstand des Entsetzens, von welchen eine größere Anzahl von Pavianen als von Löwen und Leoparden umgebracht wird. Der ärgste Feind des Silberpavians ist der Leopard, der ihm Tag und Nacht nachschleicht und sich ebenso listig wie kühn auf jedes von der Herde isolirte Thier stürzt.
Auch mit ihren Verwandten leben diese Paviane nicht immer auf gutem Fuße, namentlich mit den Tscheladas (Cercopithecus Gelada), gegen welche sie in Semién oft förmliche Schlachten liefern. Letzterer Mantelpavian bewohnt einen Höhengürtel von 7–11,000 Fuß über dem Meere, während der Hamadryas mehr die Tiefen-Gegenden liebt; jedoch steigen die Tscheladas von ihren Bergen herab, um die unten liegenden Felder zu plündern, wobei dann die Schlachten mit den Silberpavianen stattfinden.
Der schwarze Pavian (Cercopithecus obscurus) wurde erst 1862 von Heuglin entdeckt. Dieser stattliche Affe lebt in großen Rudeln auf 6 bis 10,000 Fuß Höhe meist an felsigen Schluchten. Man sieht ihn selten auf Bäumen, gewöhnlich auf Weideplätzen oder Felsen, von denen herab er nicht selten gegen seine Verfolger Steine schleudert. Die Nacht verbringt er in Gesellschaft in Klüften und Höhlen, steigt in der Morgensonne auf Hügel, wo er zusammen[pg 73]gekauert sich erwärmt und zieht dann in die Thäler nach Nahrung, die aus Blättern zu bestehen scheint. Gewöhnlich führen zwei bis sechs alte Männchen gravitätischen Schrittes eine Herde von 20 bis 30 Weibchen und Jungen an, welche theils spielend um den Trupp sich tummeln, theils von den Müttern getragen und zuweilen tüchtig geohrfeigt werden. Naht Gefahr, so flüchtet auf ein leises Bellen des Warners die ganze Gesellschaft in Felsenschluchten. Der schönste Affe Abessiniens ist der von Rüppell entdeckte Colobus Gueraza, dessen durch den starken Kontrast von schwarz und weiß ausgezeichnetes Fell ein beliebtes Pelzwerk und eine Zierath für die Kriegsschilder liefert. Er lebt in der Waldregion der Kola auf den höchsten Bäumen.
Während Afrika im Allgemeinen reich an Flatterthieren ist, kommen dieselben in dem hier in Rede stehenden Gebiete weniger vor. Die Ursache davon hat Heuglin ergründet. Namentlich in den nördlichen Grenzländern Abessiniens, in Bogos u. s. w. wird starke Viehzucht getrieben, und die Herden kommen, wenn in ferneren Gegenden bessere Weide und mehr Trinkwasser sich finden, oft monatelang nicht zu den Wohnungen der Besitzer zurück. Die Rinder sind gewöhnlich mit Myriaden Fliegen bedeckt, die ihnen nachfolgen und wiederum die Fledermäuse, welche von letzteren leben, veranlassen, gleichfalls eine Wanderung zu unternehmen. Mit der letzten Rinderherde verschwinden auch die Fledermäuse spurlos, um mit dem Einrücken derselben in ihre alten Standquartiere auch wieder zu erscheinen. Die gemeinste Art der in Ostabessinien, namentlich um Massaua vorkommenden Fledermäuse ist der kleine von Rüppell entdeckte Nyctinomus pumilus. Auch häßliche Glattnasen (Phyllorina-Arten) kommen vor, die nicht nur in der Dämmerzeit, sondern die ganze Nacht hindurch fliegen. Der große Pteropus schoensis zeigt sich auch am Tage und lebt von den Früchten der Feigen und Bananen.
Abessinien beherbergt mehrere Mitglieder der Katzenfamilie: die kleinpfotige Katze, welche von Einigen für die Stammutter unsrer Hauskatze gehalten wird, den Gepard (Cynailurus guttatus), den Leoparden (Felis Leopardus) und den Löwen (Felis Leo), doch verdienen nur die beiden letzteren hier eingehendere Beachtung. Gehen sie auch in die Berglandschaften hinauf, so ist doch ihr Lieblingsaufenthalt in den tieferen Gegenden, in der Kola, den nördlichen Grenzländern, der Samhara. Der Löwe (amharisch Anbasa) ist gerade nicht selten, der Leopard geradezu gemein und oft genug hört man des Nachts die Stimme des Königs der Thiere erschallen. Doch fürchtet man ihn verhältnißmäßig wenig, denn sein Jagdgebiet ist so reich, daß ihn nur selten der Hunger treibt, sich am Menschen zu vergreifen. Es kommt häufig vor, daß junge, noch säugende Löwen von den Abessiniern gefangen und aufgezogen werden; doch verkaufen und verschenken diese die allmälig kostspielig werdenden Thiere bald an reiche Leute, und aus solcher Quelle stammen auch die berühmten Löwen des Königs Theodoros. Das Fell eines erlegten Löwen gehört dem Könige, der tapfere Krieger wird mit einem breiten Streifen davon beschenkt, der seinen Schild ziert. Weit häufiger und auch gefährlicher als der Löwe ist der [pg 74]Leopard (Nemr auf amharisch), den man nächst der Hyäne und dem Schakal als das gemeinste Raubthier Abessiniens ansehen kann. Von der Ebene an bis hoch in das Gebirge hinein, bei Tag und bei Nacht, überall ist dieser freche Raubmörder zu finden. Er scheut den Menschen gar nicht und kaum das allen Raubthieren so entsetzliche Feuer; frech dringt er in die Hütten der Eingeborenen, raubt ein Kind und zieht sich mit seiner Beute in das Dickicht zurück. Von der Antilope bis zur Maus bewältigt er alle Säugethiere. Brehm erzählt, daß im Dorfe Mensa ein einziger Leopard während eines Vierteljahrs nicht weniger als 8 Kinder, ungefähr 20 Ziegen und 4 Hunde wegschleppte. In ganz Abessinien kann man Hunde und Hühner kaum vor ihm sichern. Mit dem Feuergewehr jagen die Abessinier das ihnen so verhaßte Raubthier ebenso wenig wie den Löwen; bei Weitem die meisten Leoparden, welche man erlegt, werden erst in Fallen gelockt und in diesen gewöhnlich durch Lanzenstiche getödtet. Diese Fallen sind ganz nach dem Grundsatze starker Mausefallen gebaut, d. h. sie bestehen aus einem Pfahlgitterwerk mit Fallthür; ein lebendiges Thier, ein Stück Fleisch sind der Köder, mit dem der Leopard angelockt wird; häufig bringt man auch eine lebende, kläglich meckernde Ziege in die Falle. Mit großer Vorsicht umgeht der Räuber oft zwei oder drei Nächte lang den Käfig, bis er endlich sich hineinwagt und gefangen ist. Von der Meeresküste geht dieser kühne Räuber bis zu 12,000 Fuß Höhe an die Eisgrenze hinauf. Der Gepard findet sich ausschließlich in der Samhara und nicht im Gebirge; er ist ein Tagräuber und keine gemeine Katze; denn er ist nicht blutgierig und raubt niemals mehr als er zu seinem Unterhalte bedarf. Draußen in der freien Steppe betreibt er seine Jagd auf Antilopen, Hasen, Mäuse, Perlhühner. Gegen den Menschen vertheidigt er sich nicht, doch macht dieser meist auf ihn Jagd, um das bunte Fell zu verwerthen, das nur selten im Handel vorkommt. Aber zur Jagd wird er in Abessinien nicht abgerichtet, wenn auch einzelne gezähmte Thiere hier und da gehalten werden.
Bis zu den höchsten Spitzen der Berge Semiéns in die Region der Dschibarra streift der Walgie (Canis simensis), um den Ratten nachzustellen. Er ist eine häufige Erscheinung unter den hundeartigen Raubthieren; dagegen ist der Wolfshund (Canis Anthus) ziemlich selten, desto gemeiner aber wieder der Schakal (Canis mesomelas), der nicht mit dem weiter nördlich vorkommenden eigentlichen Schakal verwechselt werden darf. Der abessinische, schwarzrückige Schakal ist etwas größer als sein Verwandter und in der Samhara wie im Gebirge in jedem größeren Dickicht anzutreffen. Seine eigentliche Jagdzeit auf Hasen, Hühner, Perlhühner, Ziegen, ja selbst Mäuse und Heuschrecken ist in der Nacht; dann ist er ein frecher, regelmäßiger Gast in den Dörfern oder am Lagerplatz der Karawane, welcher er ohne Scheu, selbst wenn das Feuer hell lodert, sich nähert. Auch wo gefallene Thiere liegen, stellt er sich heulend ein und an solchen Plätzen trifft er mit der gefleckten Hyäne (Hyaena crocuta, amharisch Dschib) zusammen, einem der gemeinsten Raubthiere Abessiniens. Durch langgezogene Klagetöne kündigt sie ihren Wunsch nach irgendwelcher Nahrung an, [pg 75]um den ewig verlangenden Magen zu befriedigen. Auch sie wird von den Eingeborenen arg gehaßt, obgleich sie ihnen nicht gerade erheblichen Schaden zufügt, sondern als Landreiniger, Aas- und Auswurfvertilgerin eher nützlich wird. Die Eingeborenen fangen die Hyäne in Gruben, die in einem von Dorngebüsch umgebenen Gange ausgegraben werden, an dessen Ende ein blöckendes Zicklein angebracht wird. Die heißhungerige Bestie bricht, indem sie auf ihre Beute zueilt, in die mit Reisig und Sand sorgfältig überdeckte Grube ein, in welcher man sie möglichst bald tödten muß, weil sie sonst sich einen Ausweg wühlt. Es gelingt nicht leicht, in derselben Grube mehr als eine Hyäne zu fangen, da die Thiere durch ihr feines Geruchsorgan die Gefahr erkennen. Neben ihr kommt noch ein anderes hyänenartiges Raubthier, der „gemalte Hund“ (Lycaon pictus) truppweise vor; er überfällt die Herden und richtet unter ihnen große Verheerungen an. Die Steppenlandschaften sind die eigentliche Heimat dieses geselligen, rauf- und mordlustigen Geschöpfes, das niemals allein jagt. Seinen Namen führt es von den großen, dunkeln, auf dem hellen Felle stehenden Flecken, an denen es schon weithin leicht zu unterscheiden ist.
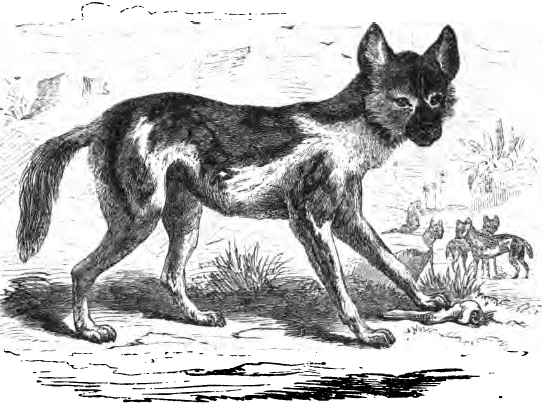
Von kleineren Raubthieren beherbergt Abessinien die gestreifte Manguste, einen weit verbreiteten, schlanken Mörder, der kleinen Säugethieren und Vögeln nachstellt, und den Honigdachs oder das Ratel (Ratelus capensis), ein in jeder Hinsicht merkwürdiges Thier, welches die Bienenstände plündert, Aas liebt und der kleinen Jagd mit Eifer obliegt, unangegriffen ruhig seine [pg 76]Straße zieht, angegriffen aber aus seinen Stinkdrüsen einen ekelhaften knoblauchartigen Gestank verbreitet, der weit und breit die Luft verpestet. Das Thier bewohnt Baue, welche es sich mit seinen gewaltigen Klauen leicht gräbt und in denen es den Tag über verborgen liegt, um Abends seiner Beute nachzugehen.
Die nordöstlich vom Tanasee gelegene Stadt Emfras, in welcher der König einen sogenannten Palast besitzt, ist nicht nur als Hauptsklavenmarkt, sondern auch wegen der Zucht von Zibethkatzen (Viverra Civetta) berühmt. Poncet berichtet, daß dort von diesen Thieren eine so große Menge vorhanden ist, daß manche Kaufleute deren mehr als 300 im Hause halten. Die Thiere werfen einen nicht geringen Nutzen ab. Die Zibethkatze bekommt als Futter dreimal in der Woche rohes Rindfleisch und viermal einen Milchbrei; sie wird dann und wann mit Wohlgerüchen beräuchert und in jeder Woche kratzt man ihr mit hölzernen Löffeln einmal eine salbenartige Materie ab, das Zibeth, welches in wohlverwahrte Ochsenhörner gethan wird und einen einträglichen Handelsartikel bildet. Ihr heimischer Name ist Dering. Ein dem Hausgeflügel, den Mäusen und Ratten sehr gefährliches Raubthier ist die Genettkatze (Viverra abessinica), ein schlankes, elegantes Thier mit langem Ringelschwanz. Sowol anatomisch, als durch den Mangel der Rückenmähne und andere Schwanzzeichnung unterscheidet sie sich von der vorigen, mit der sie sonst viel Aehnlichkeit hat. Auch ein Fischotter (Lutra inunguis) kommt, wiewol selten, in den abessinischen Gewässern vor. Derselbe ist so groß wie unsere Art und schön kaffeebraun.
Unter den Nagethieren ist zunächst zu erwähnen das bunte Eichhorn (Sciurus multicolor), ein keineswegs munteres Thierchen, vielmehr ein langweiliges scheues Geschöpf, das sich einzeln versteckt in den hohen Baumwipfeln aufhält und niemals kühne Sprünge wagt, sondern immer an den Aesten klebt. Viel häßlicher, aber anziehender und unterhaltender ist sein Verwandter, das rothe Erdhörnchen (Xerus rutilus), das Schillu der Abessinier. Leicht und beweglich treibt es sich nur auf der Erde, nie auf Bäumen umher, bald hier, bald da aus seiner Höhle hervorschauend, oder sich possirlich auf die Spitze eines Hügels setzend. Unter allen Nagethieren ist keines, selbst der Hamster nicht ausgenommen, welches im Verhältniß zu seiner Größe solchen Muth entwickelte, ja es wehrt sich sogar knurrend und fauchend gegen Hunde. Gleich ihm lebt auch das Filfil (Bathyergus splendens), das zu den Ratten gerechnet wird, in maulwurfsähnlichen Erdhöhlen, die es im dichten Gebüsch anlegt, während die Baue des Stachelschweins (Hystrix cristata), das bis zu 6000 Fuß Höhe hinaufgeht, meist in sandigen Ebenen stehen. Bei Tage verläßt das Stachelschwein seine Höhle nie, Abends jedoch zieht es in die Waldungen und Felder. Jedenfalls verdient unter den Nagethieren der abessinische Hase (Lepus aethiopicus) die meiste Beachtung, da er sich von unserm gewöhnlichen Hasen vielfach unterscheidet und im Hochgebirge wie in der Niederung zu den gewöhnlichsten Erscheinungen gehört.
Da der christliche Abessinier so gut wie der Muhamedaner ihn wegen der gespaltenen Klauen zu den unreinen Thieren rechnet, so wird er nicht verfolgt, [pg 77]und da er dieses weiß, so fällt es ihm gar nicht ein, vor dem Menschen zu flüchten, wie unser Lampe, von dem ihn schon das dunklere, schwarz, weiß, grau und ockerfarbig gefleckte Fell unterscheidet.

Aus der Ordnung der zahnlosen Thiere ist das Erdferkel (Orycteropus aethiopicus) zu erwähnen, das vom Tiefland bis in die Woina-Deka vorkommt. Das scheue Thier, mit seinem Geruch und Gehör, haust in selbstgegrabenen Höhlen, zeichnet sich durch lebhafte Sprünge und eine känguruartige Stellung aus, wobei es durch den kräftigen Schwanz unterstützt wird. Es geht häufig nur auf den Hinterfüßen und beschnuppert mit der langen, in steter Bewegung befindlichen, einem Schweinerüssel gleichenden Nase die Erde, um nach Ameisen zu suchen. Hat es eine solche Stelle entdeckt, so beginnt es sehr gewandt und kräftig mit den Vorderfüßen zu graben und die aufgewühlte Erde mit den [pg 78]Hinterfüßen zurückzustoßen. Ist der Ameisenbau erbrochen, so geht es hastig an die Mahlzeit; nach v. Heuglin fängt es die Ameisen mit den Lippen und diese fallen in Menge über den Ruhestörer her, dessen dicke Haut keineswegs vor den Bissen schützt. Für Urin und Mist gräbt das Erdferkel eine kleine Grube, die dann wieder sorgfältig verdeckt wird. Im Bau selbst schläft es zusammengerollt auf der Seite liegend. Verfolgt eilt es in raschen Sätzen davon und gräbt sich rasch ein, die Röhre hinter sich schließend. Das Fleisch ist fein, weiß und saftig.
Ueber Pferde, Maulthiere und Esel Abessiniens berichten wir später. Das Kameel, in den Küstengegenden reichlich als Lastthier vertreten, spielt im Hochgebirge eine traurige, unnütze Rolle, da sein Wirkungskreis die Wüste ist. Ebenso ist die Giraffe nur Bewohnerin der Tieflandsteppen, dort aber, in den Niederungen zwischen Setit und Atbara, auch in großer Menge vertreten und wegen des saftigen Fleisches der jungen Thiere als edles Wildpret hoch angesehen.
Am meisten Interesse unter den abessinischen Thieren flößen uns die Wiederkäuer ein. Antilopen, Ziegen, Schafe, Rinder sind da vertreten und alle in ihren schönsten Repräsentanten, namentlich sind die Antilopen herrliche Thiere, bei denen man nicht weiß, welcher man den Preis der Schönheit und Zierlichkeit zuerkennen soll. Die Tedal-Antilope (Antilope Sömmeringii) lebt namentlich in den breiten Niederungen und in der Samhara, kommt von da wol noch ins Hügelland, nie aber ins Hochgebirge hinauf. Nur am Tage zieht sie in kleinen Trupps umher, ruht des Mittags wiederkäuend im Schatten und ist gegen den Menschen sehr mißtrauisch. – Die Art, wie sie in der Samhara eingefangen werden, wird von Rüppell folgendermaßen geschildert. In der Mitte der Ebene, in einem Bezirk, wo diese Thiere regelmäßig gegen Sonnenuntergang ihren Wechsel haben, legen die Jäger viele an Pfähle befestigte Schlingen. Sobald nun die Antilopen kommen, laufen von verschiedenen Verstecken her einzelne Leute herbei, von denen Jeder eine Menge kleiner, mit einem Büschel Straußenfedern versehener Stöcke hat; diese werden mit großer Schnelligkeit so in die Erde gesteckt, daß sie lange nach der Gegend der Schlingen gerichtete Linien bilden; der Antilopen ganze Aufmerksamkeit wird von den im Winde wehenden Federn in Anspruch genommen, die sie mit scheuem Blick fixiren. Nun beginnt das Treibjagen; das Wild sieht zum Entkommen keine freie Strecke, als die Gegend, wo die Fallstricke liegen, und eilt dahin; gewöhnlich bleiben mehrere darin hängen und hier schlagen ihnen die Jäger mit Knüppeln die Beine entzwei, um sie dann zu schlachten. Auf dieselbe Weise werden auch die Strauße gejagt. Noch häufiger als der Tedal ist die Gazelle (Antilope Dorcas), die da, wo Mimosen stehen, von denen sie äst, fast nie in der Samhara fehlt. Sehr oft einzeln, meist aber in Trupps von drei bis acht Stück beieinander zieht sie nur am Tage in der Ebene, wie im Gebirge umher. Zur Tränke geht die Gazelle nicht, denn ihr genügt der Nachtthau auf den Blättern der Bäume, die sie alle Morgen eifrig ableckt, und diese Genügsamkeit macht sie zum echten Wüstenthier. Als die lebhafteste, behendeste und anmuthigste der Antilopen vermag sie Sätze von [pg 79]vier bis sechs Fuß Höhe auszuführen und ein flüchtiges Rudel gewährt einen wahrhaft prachtvollen Anblick.
Während die Gazelle alle dicht bewaldeten Stellen ängstlich meidet, sucht das „Judenkind“ oder die Zwerg-Antilope (A. Hemprichiana) gerade die verschlungensten und undurchdringlichsten Gebüsche zu ihrem Wohnsitze auf. Nur paarweise in zärtlicher Ehe und nicht wie die übrigen Antilopen es den Türken oder Mormonen gleich thuend, findet man die Zwerg-Antilope von der Küste bis zu 2000 Fuß Höhe im Gebirge sehr häufig.
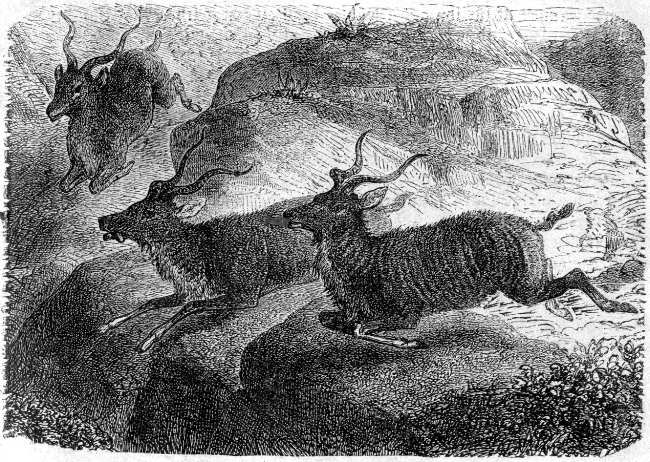
Die Färbung des weichen schönen Haars stimmt mit dem Blätterdunkel des niedern Gebüsches so vollkommen überein, daß es schwer hält, die zarte, kleine Gestalt inmitten des Gebüsches wahrzunehmen. Beim geringsten verdächtigen Geräusch erhebt sich der Bock vom Boden, stellt sich, nach der verdächtigen Gegend hin gerichtet, starr wie eine Bildsäule auf, wendet die Ohren vorwärts und lauscht nun regungslos. Der Lauf, welcher erhoben wurde, bleibt erhoben, Auge und Ohr haften an derselben Stelle und nur der Haarschopf zwischen den Hörnern deutet durch sein Senken oder Heben an, daß in dem Geschöpf Leben wohnt. Das Wildpret der Zwerg-Antilope ist nicht besonders zu empfehlen; es hat immer einen moschusartigen Geschmack und ist außerdem sehr zähe.
[pg 80]Sind Sömmerings-Antilope und Gazelle echte Wüstenthiere, so sucht der Klippspringer oder Sassa (Oreotragus saltatrix) nur felsige Gegenden auf. (Abbildung siehe S. 25.) Rüppell war der erste, der nachwies, daß diese vom Kap schon lange bekannte Antilope auch in Abessinien in den buschigen, felsigen Bergen lebe. Wie eine Gemse steht das schöne Thier mit zusammengehaltenen Hufen auf einem steilen Felsgrat, oft stundenlang in das Land hineinschauend. Auch der Klippspringer lebt paarweise, am gewöhnlichsten in einer Meereshöhe von 2000 bis zu 12,000 Fuß. Bei heiterem Wetter zieht er mehr in die Berge; bei Regen, Nebel, Kälte steigt er in die Thäler hinab. Die Bezeichnung „afrikanische Gemse“ ist für ihn gut gewählt, denn an den steilsten Felswänden entlang, neben Abgründen vorüber, welche jeden Fehltritt mit dem Tode bezahlen würden, eilt er mit Leichtigkeit und Zierlichkeit dahin, als ginge er auf ebenem Boden. Die geringste Unebenheit genügt ihm, um festen Fuß zu fassen; jeder Sprung schnellt ihn hoch in die Luft; bald zeigt er sich ganz frei den Blicken, bald ist er im Gebüsch verschwunden, und wenige Minuten genügen, ihn allen Verfolgungen zu entziehen. Die stolzeste und größte Antilope Abessiniens ist der Agaseen (Antilope strepsiceros), welcher die Gebirge in einer Höhe von 2000 bis 7000 Fuß bewohnt. Dieses stattliche, an unsern Edelhirsch erinnernde Thier, welches durch ein Paar 3 Fuß lange, prächtig gewundene Hörner ausgezeichnet ist, gehört einem großen Theil Mittel- und Südafrika’s an und ist am Kap unter dem Namen Kudu bekannt. Es lebt einzeln oder in kleinen Trupps, die, ungestört, majestätisch und langsam an den Bergwänden hinschreiten, aufgescheucht aber, unter Schnauben und Blöken davoneilen. Die Araber in den Steppen nördlich von Abessinien hetzen den Agaseen mit Pferden und tödten ihn mit Lanzenstichen, während er im Hochlande nur von denen verfolgt wird, die Flinten besitzen. Sein Fleisch ist vorzüglich, dem des Hirsches im Geschmack ähnlich und aus den großen gewundenen Hörnern verfertigen die Eingeborenen Füllhörner zum Aufbewahren des Salzes und Honigs. Auch die in Südafrika häufigere Oryx-Antilope (Antilope Beisa) findet sich in den das Land umgebenden Steppen und Niederungen. Stets trägt sie ihre schnurgeraden Hörner aufrecht, die von der Seite gesehen wegen ihres nahen Beieinanderstehens wie ein einziges aussehen und zu der Sage vom Einhorn Veranlassung gegeben haben können. Es würde uns zu weit führen, wollten wir alle Antilopen hier aufzählen, die in den Hochlanden oder den diese umgebenden Steppen leben. Nur noch zu erwähnen sind die große Marif-Antilope (Hippotragus Bakeri), die Defassa (Antilope defassa), der Bohor (A. redunca), Bubalis mauritanica, Antilope montana, madoqua, decula, leptoceros u. s. w. Die meisten dieser Thiere gehen bis zu 9000 Fuß Höhe in die Gebirge.
Das ist der Reichthum Abessiniens an Antilopen; weniger zahlreich sind die Ziegen vertreten, aber unter ihnen finden wir im Hochgebirge zunächst den stolzen Steinbock (Ibex Walia). Rüppell entdeckte dieses Thier auf den höchsten Bergen Semiéns, nachdem ihm die Eingeborenen eine wunderbare Geschichte über dasselbe aufgetischt hatten. Dieser Walié, so erzählten sie, ist [pg 81]im höchsten Grade scheu, hat sehr lange und krumme Hörner und einen Bart am Kinn, stellt sich oft auf zwei Beine und ist wegen der Erziehungsweise seiner Jungen sehr merkwürdig. Die Mutter hat nämlich, so fabeln die Abessinier, unter dem Bauch einen nach hinten zu geöffneten Sack, in welchem das Junge eine Zeit lang lebt und sich dadurch nährt, daß es von Zeit zu Zeit den Kopf aus dem Beutel heraussteckt und auf der Erde grast; doch ist es sehr scheu und zieht sich bei dem geringsten Geräusch in seinen Behälter zurück. So lebt es wochenlang, bis es zu groß geworden und in seinem lebendigen Kerker keinen Platz mehr findet; es springt heraus, läuft davon und sieht seine Mutter nie wieder. Europäische Reisende haben gefunden, daß der abessinische Steinbock in Lebensweise und Körperbildung nicht im mindesten von dem allgemeinen Charakter der Gattung abweicht. Von der Ziege (Hircus aethiopicus) wird in dem Abschnitte über die Viehzucht die Rede sein. Sie ist kleiner als unsere Ziege und kennzeichnet sich durch kurze Beine, lange, rückwärts niedergedrückte Hörner und sehr langen Bart. Ziegenherden sind durch das ganze Land in großer Zahl verbreitet und namentlich in der Steppe begegnet man ihnen an allen Brunnen. In Bezug auf Behendigkeit und Schnelligkeit steht die abessinische Ziege kaum der Gazelle nach. Von Schafen werden verschiedene Arten gezüchtet. An den Küsten und in den heißen Steppen findet man das arabische Fettschwanzschaf, mit schwarzem Kopf, ausgezeichnet durch den Mangel der Hörner und Wolle und einen dicken Fettklumpen statt des Schwanzes; das gemeine Schaf der Hochlande (Beg) hat bräunliche oder schwarze Wolle; die Galla züchten eine mit langen weißen Haaren versehene Art, deren schwarzgefärbte Felle eine Lieblingskleidung ihrer Häuptlinge ausmachen. Das Rind Abessiniens ist der afrikanische Buckelochse (Bos africanus), ausgezeichnet durch schlanken Bau und den kleinen Höcker. Der Berié, wie er in Amhara heißt, ist ein äußerst geschicktes, gewandtes und bewegliches, dabei gutmüthiges und lenksames Thier; er bildet den Reichthum des Hirten, dient als Pack- oder Reitthier, zieht den einfachen Pflug, drischt durch Austreten das Getreide und wird zum Danke für alle Liebesdienste schließlich oft bei lebendigem Leibe verzehrt, worüber weiter unten mehr gesagt wird. In einigen südlichen Provinzen lebt der Sanga, eine besondere Art, die sich durch gewaltige, weit geschwungene Hörner auszeichnet, aber von nur wenigen Reisenden beobachtet wurde. Die Hörner kommen in den Handel und gelten auch als schätzbares Geschenk. Salt erhielt drei dieser Thiere geschenkt, allein sie waren so wild, daß er sie erschießen lassen mußte. Das längste Horn hatte beinahe 4 Fuß und sein Umfang an der Basis betrug 21 Zoll. Stier und Kuh, beide tragen diesen Schmuck, sind aber trotz des kolossalen Gehörns nicht größer als anderes Rindvieh. In der Kolla haust der wilde Büffel (Bos Pegasus und Caffer), der Gosch der Abessinier, ein unzähmbarer, gefürchteter Geselle, dessen Jagd zu den gefährlichsten Beschäftigungen der Eingeborenen zählt. Seine Haut wird blos zur Bereitung von Schildern benutzt; ist das Thier bereits ausgewachsen und seine Haut durch Speere nicht sehr zerfetzt, so können aus einer Haut vier Schilde gemacht werden, welche einen Preis von [pg 82]je zwei bis drei Thalern haben. Aus den enormen Hörnern dieses Büffels verfertigt man Trinkbecher.
Aus der Ordnung der Dickhäuter oder Vielhufer haben wir ein Rhinozeros (Rh. africanus), das Worsisa, anzuführen, welches die Eigenschaften der asiatischen und afrikanischen Art, die Platten und Falten des ersteren mit den zwei Hörnern des letzteren vereinigt und aus den Sümpfen der Kolla bis in die Berge 8000 Fuß hoch aufsteigt. Der Hippopotamus fehlt weder in den Seen, noch in den größeren Flüssen des Landes. Im Allgemeinen meiden die Abessinier dieses für unrein gehaltene Thier, nur die am Tanasee angesiedelten heidnischen Waito beschäftigen sich mit der Jagd dieses „Gomari“, indem sie die Thiere mit hölzernen Lanzen zu verwunden suchen, deren Spitzen mit einem Pflanzengift bestrichen sind, durch welches jene gewöhnlich nach zwölf Stunden sterben. Das Fleisch trocknen sie großentheils, um es aufzubewahren, und aus der Haut verfertigen sie kleine Reitpeitschen. Eine wahre Landplage ist in Abessinien das häßliche, mit großen Hauern versehene Warzenschwein (Phacochoerus africanus), das die mit Gebüsch und Gras bewachsenen Ebenen bewohnt, kommt aber auch bis zu 9000 Fuß im Gebirge vor. Es lebt ähnlich wie unser europäisches Schwarzwild und geht seiner Nahrung erst nach Sonnenuntergang nach. Die Eingeborenen halten es natürlich für unrein und geben sich nicht mit der Jagd des Thieres ab, dessen Fleisch einen vortrefflichen Geschmack hat.
Abessinien beherbergt auch ein eigenthümliches Nachtschwein (Nyctochoerus Hassama), das nach Aussage der Eingeborenen sich vorzüglich gern von Aas nährt. Es hat die Größe unsrer Wildschweine, ist aber gedrungener von Figur, lebt in dichtem Gebüsch und Felsen in einem großen Theile des Landes von 4000 bis 9000 Fuß Meereshöhe, ist scheu, soll sich angegriffen wüthend zur Wehre setzen, ruht den Tag über in undurchdringlichen Verstecken und fällt Nachts verheerend in die Felder ein.
Jedenfalls ist unter den Vielhufern der kleinste der interessanteste, nämlich der Klippschliefer oder Klippdachs (Hyrax abessinicus). Schon Bruce erwähnt, daß dieser Aschkoko unmittelbar in der Nähe der Städte geeignete Felswände bewohnt und vor den Augen der Menschen sein possirliches, an Kaninchen und Murmelthiere erinnerndes Wesen treibt. Seine Bewegungen sind ungemein mannichfaltig und graziös; er versteht ausgezeichnet zu klettern, mit dem Kopfe nach oben und unten. Große Sanftmuth und Aengstlichkeit zeichnen ihn aus, und seine Feinde sind nur im Thierreich zu suchen, da er vom Menschen, der ihn gleichfalls für unrein hält, nicht verfolgt wird. Sie selbst sind sehr gefräßig und nähren sich von Gräsern, Kräutern und Tamarindenzweigen. Wahrscheinlich kommen zwei verschiedene Arten vor, die vom Tiefland bis zu 12,000 Fuß Meereshöhe aufsteigen.
Heuglin war der erste, welcher die Bemerkung machte, daß der Klippschliefer in bestem Einvernehmen mit einer Ichneumon-Art (Herpestes Zebra) und einer Eidechse (Stellio cyanogaster) auf seinen Felsen zusammen lebt. Nähert man sich einem solchen Felsen, so erblickt man zuerst einzeln oder gruppenweise [pg 83]vertheilt die munteren und possirlichen Klippschliefer auf Spitzen und Absätzen sich gemüthlich sonnend oder mit den zierlichen Pfötchen den Bart kratzend; dazwischen sitzt oder läuft ein behender Ichneumon und am steilen Gestein klettern oft fußlange Stellionen. Wird ein Feind der Gesellschaft von dem auf dem erhabensten Punkte des Felsbaues als Schildwache aufgestellten Klippdachs bemerkt, so richtet sich dieser auf und verwendet keinen Blick mehr von dem fremden Gegenstand, aller Augen richten sich nach und nach dahin, dann erfolgt plötzlich ein gellender Pfiff der Wache, und im Nu ist die ganze Gesellschaft in den Spalten des Gesteins verschwunden. Untersucht man letzteres genauer, so findet man Klippschliefer und Eidechsen vollständig in die tiefsten Ritzen zurückgezogen, der Ichneumon dagegen setzt sich in Vertheidigungszustand und kläfft zornig den Feind an. Hat dieser sich entfernt, so rekognoszirt zunächst die Eidechse das Terrain, ob Alles sicher sei, dann erscheint der Ichneumon und zuletzt, vorsichtig den Kopf hervorstreckend, der Klippschliefer. Der Ichneumon, obgleich ein arger Räuber, verkehrt mit ihm in der größten Eintracht; dagegen ist der Leopard sein Hauptfeind, der trotz aller Vorsicht dann und wann einen Klippschliefer fängt und mit Ausnahme von Wolle und Magen verspeist. Uebrigens werden diese Thiere durch Raben gewarnt, die unablässig schreiend auf den Leoparden stoßen, sobald sie seiner ansichtig werden.
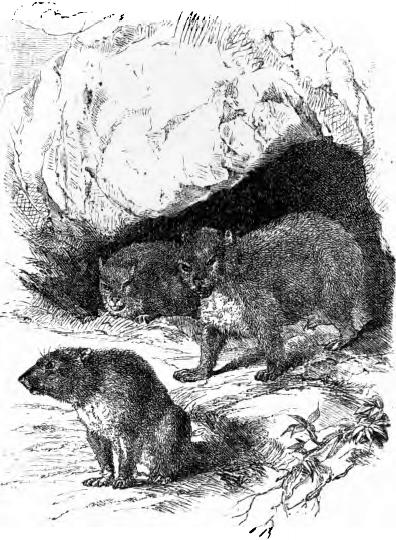
Den Beschluß unter den Säugethieren macht der Riese unter denselben, der Elephant (amharisch Sochen). Aus den heißfeuchten Niederungen steigt er auf seinen Wanderungen regelmäßig bis hoch ins Gebirge hinauf; Steilungen, welche einem Pferde unersteiglich sind, werden von ihm ohne Mühe überwunden; denn wie ein berechnender Straßenbaumeister geht er zu Werke, bedächtig und [pg 84]verständig wählt er den Weg. Vor allem in den nördlichen Grenzländern, in Kunama, Bogos, Mensa ist er häufig; dort jagt ihn der wilde Schankalla, indem er ihm die Flechsen der Hinterbeine durchsäbelt; aber Bogos und Mensa, welche das Feuergewehr noch nicht besitzen, lassen ihn ungestört seine Wanderungen machen. Die reiche Natur bietet ihm Alles, was er bedarf, in Fülle, und wenn oben in der Höhe die Nahrung knapp wird, wenn die Wasser sich unter der Thalsohle bergen und der zweimal im Jahre eintretende Frühling, d. h. die Regenzeit, noch fern ist, zieht sich das gewaltige Thier nach den wasserreichen Niederungen zurück. Wie der Elephant in Nordabessinien häufig den Feldern schädlich wird, so verwüstet er im Süden die Zuckerrohrpflanzungen; da er selten gejagt wird, so steht seiner Vermehrung nichts im Wege und der Handel Abessiniens mit Elfenbein ist gering.
Nach von Heuglin lebt im Tanasee auch ein manatiartiges Thier, über das wir jedoch noch keine nähere Kunde haben.

Das Volk, seine Sitten und Gebräuche, Handel und Industrie.
Physischer Charakter des Volks. – Die Juden oder Falaschas. – Muhamedaner. – Gamanten. – Heidnische Ueberreste. – Waito. – Die Sprachen Abessiniens. – Literatur und Malerei. – Charakter und Sittenlosigkeit der Abessinier. – Blutrache. – Justiz. – Aberglauben. – Das Verzehren von rohem Fleische. – Nahrungsweise. – Krankheiten und Aerzte. – Kleidung. – Industrie und Handel.
Abessinien, von der Natur zur Bühne eines einheitlichen Lebens geschaffen, durch seine Felsenwälle streng abgeschieden von den Nachbarländern, ist dennoch der Sitz verschiedener Völkerstämme und Nationalitäten, die keineswegs immer miteinander harmoniren und auch sprachlich voneinander geschieden sind. Einzelne versprengte, angesessene oder später eingedrungene Stämme abgerechnet, gehören die Abessinier dem äthiopischen Zweig der semitischen Rasse an. Die Mehrzahl der Bevölkerung ist ein schöngeformter, mittelgroßer Menschenschlag von hellbräunlicher bis dunkelschwarzbrauner Farbe. Das Charakteristische seines Aeußern besteht hauptsächlich in einem ovalen Gesicht, einer fein zugeschärften [pg 86]Nase, einem wohlproportionirten Munde mit regelmäßigen, nicht im geringsten aufgeworfenen Lippen, lebhaften schwarzen Augen, schön gestellten Zähnen, etwas gelocktem oder auch glattem Haupthaar und einem schwachen krausen Barte. Das weibliche Geschlecht zeichnet sich nicht selten durch reizende Gesichtszüge, schlanken Bau und äußerst zierliche und elegante Hände sowie Füße aus. Negerphysiognomien gewahrt man nur an den eingeführten Sklaven und deren Nachkommen.
Ehe wir uns jedoch zu dem eigentlichen, sich zum Christenthum bekennenden Hauptvolke wenden, müssen wir die verschiedenen, theils durch die Religion, theils auch durch ihre Nationalität von ihm abweichenden Völkersplitter des Landes betrachten.
Eine gewiß auffällige Erscheinung in Abessinien sind die dortigen Juden oder Falaschas, d. h. Wanderer oder Verbannte, die früher eine bedeutende Rolle spielten, aber von ihrer einstigen Höhe sehr herabgesunken sind. Fast alle Reisenden beschäftigten sich mit ihnen, und namentlich waren es die protestantischen Missionäre, die ihnen ihre Aufmerksamkeit zuwandten. Gobat gab zunächst einige Nachrichten von diesem Volke, doch bemerkt er, daß die Falaschas so von den Christen abgesondert lebten, daß letztere weder von ihrem Glauben noch von ihren Gebräuchen etwas wüßten. Sie haben sich hauptsächlich in der Gegend von Gondar, Tschelga und auf der nordwestlichen Seite des Tanasees niedergelassen. Die Falaschas behaupten, ihre Stammväter seien schon zur Zeit Salomo’s mit König Menilek, dem Sohne der Königin von Saba, ins Land eingewandert; andere unter ihnen meinen, sie seien erst nach dem Sturze Jerusalems von den Römern in die abessinischen Gebirge verjagt worden. Doch unterscheiden sie sich von den übrigen Juden durch ihre Unbekanntschaft mit der hebräischen Sprache und dadurch, daß die endliche Erscheinung des Messias für sie keinerlei Reiz hat; denn fragt man sie hierüber, so erwidern sie kalt, daß sie ihn in der Person eines Eroberers, Theodor genannt, dem auch die abessinischen Christen entgegenblicken, in kurzer Zeit erwarteten. Dieser Theodor war nun freilich gekommen, aber mit ihm kein Messias für die Juden. Alle reden die amharische Sprache, unter sich jedoch gebrauchen sie eine eigene Mundart (den Koara-Dialekt), welche vom Hebräischen und Abessinischen gleich weit entfernt ist. Gobat bemerkt: „In ihre Wohnungen kann kein Christ, ausgenommen mit Gewalt, hineintreten; auch haben die Christen nicht große Lust dazu, weil sie alle als Zauberer gefürchtet sind. Sie selbst tragen keine Waffen und bedienen sich derselben nicht einmal zur Vertheidigung. Für ihre Armen wird von ihnen gesorgt und diese dürfen nie betteln gehen.“
Der Missionär Stern, ein Hesse von Geburt und zum Christenthum übergetretener Israelit, versuchte mit seinem Collegen Rosenthal, die Falaschas zu bekehren, machte jedoch wenig Proselyten, veröffentlichte aber ein Buch („Wanderings among the Falashas“), in welchem wir die besten Nachrichten über das seltsame Volk finden. Nach ihm rühmen sich die Falaschas, unmittelbar von Abraham, Isaak und Jakob abzustammen und ihr altjüdisches Blut rein erhalten [pg 87]zu haben. Mischheirathen mit andern Stämmen sind durchaus verboten; ja es gilt schon für Sünde, das Haus eines Andersgläubigen zu betreten. Wer eine solche Sünde begeht, muß sich einer Reinigung unterwerfen und ganz frische Kleider anziehen; dann erst darf er wieder in seine Wohnung gehen. Diese Ausschließlichkeit hat übrigens gute Folgen gehabt, denn sie bewahrte die Falaschas vor der Ausschweifung und Sittenlosigkeit, welche sonst in Abessinien allgemein sind. Jedermann gesteht ein, daß die Falaschas, Frauen wie Männer, die zehn Gebote streng befolgen. Heirathen in früher Jugend sind bei ihnen nicht gestattet, da Männer erst zwischen dem zwanzigsten und dreißigsten, Mädchen zwischen dem fünfzehnten und zwanzigsten Jahre sich vermählen. Ehescheidungen kommen nicht vor; Vielweiberei, wie bei den abessinischen Christen, ist nicht erlaubt; Frauen und Mädchen gehen unverschleiert frei umher. Die Tempel haben wie die christlichen Kirchen drei Abtheilungen; der Eingang liegt nach Osten, und auf der Spitze des kegelförmigen Daches ist allemal ein rother Topf angebracht.
Barbarisch ist eine Sitte, welche mit den überstrengen Begriffen von Reinigung zusammenhängt. Neben jedem Falaschadorfe befindet sich eine „unreine Hütte“. Dorthin schafft man die Kranken, deren Tod für unabwendbar gilt und läßt sie verlassen liegen; kein Verwandter darf bei ihnen sein und nur Menschen, welche für unrein gelten, dürfen sich um sie kümmern. Merkwürdig erscheint die Thatsache, daß diese abessinischen Juden dem Handel äußerst abgeneigt sind und ihn geradezu verachten. Stern schreibt: „Diese Falaschas sind von exemplarischer Sittlichkeit, ungemein sauber, sehr andächtig und glaubensstreng und dabei sehr fleißig und thätig. Sie treiben Ackerbau und Viehzucht und auch einige Handwerke: man findet z. B. unter ihnen Weber, Töpfer und Schmiede. Der Handel gilt ihnen für unverträglich mit dem mosaischen Glauben, und man findet unter dieser Viertelmillion Menschen nicht einen einzigen Kaufmann.“ Es kann bei Leuten, welche so abgeschlossen leben, nicht befremden, daß sie alle andern Religionen verabscheuen; ohnehin sind sie zumeist von Götzendienern umgeben, und auch die christlich-abessinische Kirche hat in ihrem Verfall nichts Anlockendes. Im Aeußern und seinem Typus nach unterscheidet sich der Falaschas übrigens von den andern Abessiniern keineswegs.
Was die oft verfolgten Muhamedaner Abessiniens betrifft, so stehen sie in den meisten Beziehungen über den einheimischen Christen. Bei dem niedrigen Charakter der christlichen Abessinier ist die Regierung oft genöthigt gewesen, die verschiedenen Aemter, deren Verwaltung, Treue und Redlichkeit erfordert, namentlich Zollämter, durch Muhamedaner zu besetzen. Dieselben wohnen theils zerstreut, theils in ganzen Ortschaften angesessen. So besteht der Flecken Takeragiro in der Landschaft Tembién nur aus Muhamedanern, deren Frauen sich mit Landwirthschaft und Baumwollenspinnen beschäftigen. Die Männer sind meist Kaufleute, die im Lande umherziehen und eine gewisse praktische Gewandtheit erlangen. Arbeitsamkeit zeichnet alle aus und einen weiteren Vorzug vor den Christen haben sie dadurch, daß jeder Muhamedaner seine Söhne lesen und schreiben lernen läßt, während jene dieses nur dann lernen, wenn sie sich dem geistlichen [pg 88]Stande widmen wollen. Der Muhamedanismus nimmt fortwährend zu, was bei dem versunkenen Zustande des abessinischen Christenthums keineswegs zu verwundern ist. Muhamedaner und Christen leben auf gutem Fuße miteinander, wenn auch keine der beiden Parteien animalische Speise von der andern nimmt, weil die Muhamedaner beim Schlachten des Viehs sich der Formel bedienen: „Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen“, die Christen aber: „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Früher wohl, zu Muhamed Granje’s Zeiten, stürmten die Bekenner des Korans mit Waffengewalt gegen das christliche Abessinien und wurden zurückgeschlagen; jetzt aber breitet sich der Islam stillschweigend aus, da er den christlichen Abessiniern überlegen ist. „Er benutzt“, sagt Munzinger, „die Schwächen seines uneinigen Gegners, er erringt nur vereinzelte Erfolge und dennoch darf man nicht verschweigen, daß er einer steten Zunahme sich erfreut. Während er schon halb Afrika beherrscht und immer südlicher dringt, hat er sich wol den dritten Theil der Bevölkerung des eigentlichen Abessinien schon unterworfen und die Grenzen gegen alle Weltgegenden sind dem Christenthum jedenfalls für immer verloren. Die Galla werden in kurzer Zeit alle muhamedanisch sein, die Grenzvölker im Norden, die Habab und die Marea, sind erst in unserer Zeit dem Kreuz abtrünnig geworden und die Bogos selbst sind kaum zu retten.“
Außer den Muhamedanern und Juden giebt es in Abessinien noch besondere religiöse Sekten. Zu diesen gehören die Gamanten, die sich über mehrere Provinzen des südlichen und westlichen Abessinien und selbst über Schoa ausgebreitet haben und als Heiden verachtet werden. Sie glauben nur an einen Gott und die Unsterblichkeit; Moses ist ihr von Gott inspirirter Prophet, doch erkennen sie kein Religionsbuch an, haben keine Festtage, ruhen aber am Sonnabend vom Ackerbau aus. Nach Krapf und Isenberg verrichten sie ihre Religionsübungen im dichtesten Gebüsche, welches kein Sonnenstrahl durchdringt. Eine besondere Verehrung zollen sie verschiedenen Pflanzen, die zu beschädigen sie ängstlich vermeiden. Unter diesen nimmt die Aloë die erste Stelle ein und zwar deshalb, weil sie dieselbe als von einer menschlichen Seele belebt denken und für den Stammvater des menschlichen Geschlechtes halten. Da die Gamanten keine Fasten halten und das auf jede Art geschlachtete Fleisch essen, werden sie schon um deswillen von den Juden verachtet. Trotz der Verfolgungen, denen sie ausgesetzt sind, leben sie als ruhige, fleißige und bescheidene Ackerbauer, von ihren andersgläubigen Nachbarn durch mancherlei Sitten geschieden. So durchbohren z. B. die Frauen nach ihrer ersten Niederkunft das Ohr und zwängen in die Oeffnung nach und nach immer größere Holzpfropfen, die schließlich einen Durchmesser von drei Zoll und mehr erlangen, sodaß das Ohrläppchen oder jetzt der Ohrlappen bis auf die Schulter herabhängt, wie dies ähnlich bei südamerikanischen Völkern gefunden wird. Die Sprache der Gamanten, das Koara, ist mit jener der einheimischen Juden übereinstimmend, aus denen sie hervorgegangen sein sollen. Aeußerlich zeichnen sie sich durch hohen Wuchs, schlanken ovalen Kopf, eine etwas aufwärts gekrümmte Nase und einen kleinen Mund aus. [pg 90]Sie haben schöngelockte, etwas gekräuselte Haare und große lebhafte Augen. Die Hauptsitze der Gamanten sind in der Umgebung Gondars, dann in Tschelga, Koara und bei Wochni, wo sie speziell die Pflicht haben, die Bergpässe zu hüten. Ackerbau und Viehzucht sind ihre liebste Beschäftigung, gelegentlich auch Straßenräuberei.
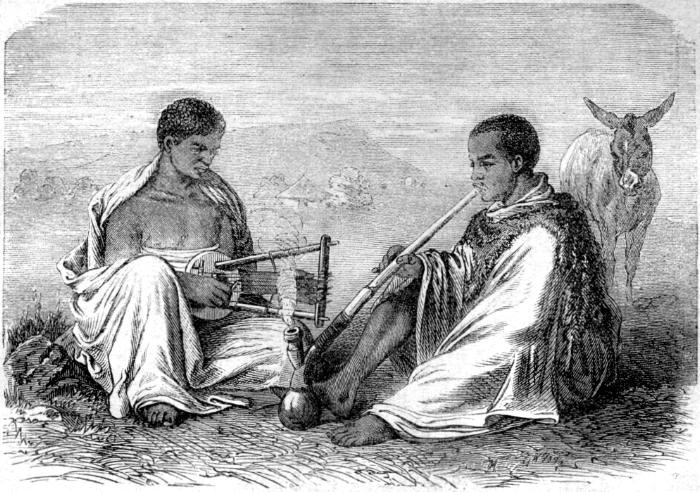
Spuren vom ehemaligen Heidenthum lassen sich bei den abessinischen Christen immer noch erkennen. Rüppell sah z. B., wie im Thale Saheta, in der Provinz Haramat, die Frauen der Umgegend sich in großer Anzahl an eine wasserreiche Quelle, welche unter einer schönen Baumgruppe hervorsprudelt, begaben, dort Hände und Füße wuschen und sich dann vor einem grobbehauenen, mit zwei eiförmigen Vertiefungen versehenen Sandsteinwürfel einige Mal auf die Erde niederwarfen. Rüppell hielt den Stein für einen Opferaltar, konnte jedoch über den Kultus nichts Näheres erfahren, obgleich seine Begleiter erklärten, es handle sich hier um einen Rest heidnischer Abgötterei.
Eine besondere Sekte, welche den allgemeinen Namen Waito führt und als heidnisch verschrieen ist, wohnt rings um den Tanasee. Von den Gamanten unterscheiden sie sich dadurch, daß sie keinerlei religiöse Ceremonie haben. Auch essen sie Wasservögel, Nilpferdfleisch, wilde Schweine u. s. w., was alles ihren Nachbarn als Gräuel erscheint. Sie haben keine eigene Sprache, sondern reden das Amharische, wie sie sich denn auch weder durch Gesichtszüge, noch durch andere körperliche Eigenschaften von den übrigen Abessiniern unterscheiden.
Als heidnisch ist noch die Schlangenverehrung zu nennen, die Pearce in der Provinz Enderta zu beobachten Gelegenheit hatte, und auch Bruce berichtet, daß die Agows (im westlichen Abessinien) in ihren Hütten zahme Schlangen aufziehen, denen sie göttliche Verehrung zollen. Ein Fremder bemerkt zwischen diesen eigenthümlichen Menschen und den echten Abessiniern keinen großen Unterschied, außer daß die Agows im ganzen vielleicht ein stärkerer, aber nicht so ruhiger Menschenschlag sind als jene. Ihre Sprache jedoch, wie bei den Falaschas und Gamanten das Koara, ist durchaus verschieden und klingt sanfter und weniger kräftig als die von Tigrié. Die Agows in der Provinz Avergale werden unter der Benennung der Tschertz unterschieden, und das Land, welches sie bewohnen, erstreckt sich von Lasta bis an die Grenzen von Schirié. Nach der Sage waren die Agows einst Verehrer des Nil, aber im 17. Jahrhundert wurden sie zur christlichen Religion bekehrt. Die Agows hegen eine sehr hohe Meinung von ihrer ehemaligen Wichtigkeit und behaupten, nur von den Bewohnern Tigrié’s, sonst niemals, unterjocht worden zu sein. Es ist leicht möglich, daß dieses Volk einen Theil der Urbevölkerung Abessiniens ausmacht.
Hier muß der Ausdruck Schangalla oder Schankela erwähnt werden, unter dem man sich fälschlicherweise einen besondern Volksstamm im Nordwesten Abessiniens vorstellte und worunter man namentlich die Bazen oder Kunama verstand. Allein es ist nur ein generischer Name, welcher auf die heidnischen, außerhalb Abessinien wohnenden Völker, namentlich die Neger und Negersklaven, angewandt wird.
Abessinien besitzt gegenwärtig zwei Hauptsprachen, die sich wieder in [pg 91]mehrere zum semitischen Stamme gehörige Dialekte trennen. Als ausgestorbene (seit wann ist unbekannt) Ursprache gilt die äthiopische oder das Geéz, das zur Zeit der Einführung des Christenthums geredet und in welchem alle Bücher abgefaßt wurden. Ueber dieselbe hat Hiob Ludolf, der sich um die ältere Kunde Aethiopiens die größten Verdienste erwarb, im Jahre 1691 eine noch heute vielfach mustergiltige Grammatik verfaßt. Denkmäler der alten äthiopischen Sprache, in Stein eingegraben, sind an verschiedenen Orten des Landes aufgefunden und entziffert worden; besonders aber in der alten Königsstadt Axum in Tigrié. Auf einem Schutthaufen daselbst entdeckte Rüppell drei gleichgroße Kalksteinplatten, jede über vier Fuß lang und mit ziemlich wohl erhaltenen äthiopischen Lettern bedeckt. Ein abessinischer Geistlicher entzifferte später diese Inschriften, und die von ihm veranstaltete Uebersetzung stimmt ziemlich mit jener des Professors Rödiger in Halle überein. Wir geben, um die altäthiopischen Schriftzeichen zu zeigen, hier den Anfang der einen Tafel wieder, welche von dem Kriegszuge des Königs La San nach Magasa handelt, von wo er mit großer Beute heimkehrte:
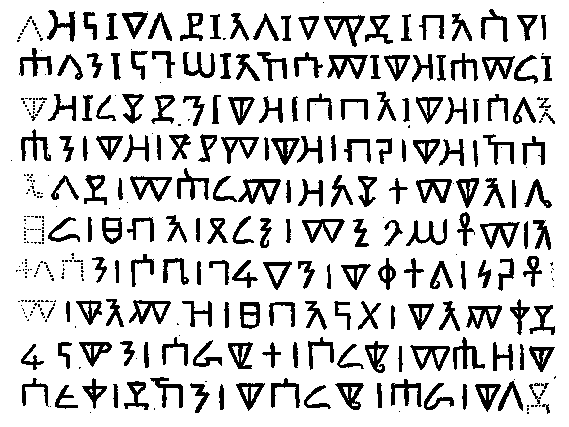
Die Uebersetzung lautet:
| 1. | La San, Sohn des Siegreichen, des Gottbefreundeten |
|---|---|
| 2. | Halen König von Axum und von Hamara |
| 3. | und von Raidan, und von Saba, und von Sala- |
| 4. | hen, und von Tiamo, und von Bega und von Kas. |
| 5. | Der Sohn des Ungläubigen bisher unbesiegt |
| 6. | bekämpfte als Feind; ihr Oberhaupt ward |
| 7. | verjagt, das uns ungünstig war, und ihre Tapfern erschlagen; |
| 8. | Darauf ergriffen sie die Flucht. Vorher |
| 9. | schickten sie aber das Heer; ihr Anführer, der Tapfere |
| 10. | zog aus mit Gezelt und dem Anführer der Vornehmsten. |
Das Geéz hat 26 einfache Buchstaben, denen 6 Vokalzeichen angehängt werden, wozu noch vier Doppellaute kommen. Man liest von links nach rechts und jedes Wort wurde vom nächstfolgenden früher durch einen vertikalen Strich, jetzt durch zwei übereinanderstehende Punkte getrennt. Wie bemerkt, ist die Sprache jetzt ausgestorben, doch gilt sie noch als Kirchensprache und wird von der Geistlichkeit aufrecht erhalten, welche die von Isenberg eingeführten, in die modernen Sprachen übersetzten Bibeln als Ketzerwerke erklärten. An die Stelle des ausgestorbenen Geéz traten zwei lebende Sprachen, das Amharische und Tigrische, von denen das erstere in den vom Takazzié südlich und westlich, das letztere in den von diesem Flusse östlich gelegenen Landschaften geredet wird. Das Amharische, das am meisten gesprochen wird, obgleich ein Dialekt des Aethiopischen und also semitischen Charakters, hat doch mehr Fremdartiges als seine Mutter- oder seine Schwestersprache, das Tigrische, angenommen, welches die größte Aehnlichkeit mit dem alten Geéz behalten hat. Das Tigrische ist reich an kräftigen Gutturalen und hat eine Abart in dem Dialekte von Guragué, einer südabessinischen Landschaft; das Amharische dagegen, zur Regierungssprache erhoben, hat in der Sprache von Härrär, östlich vom Hawaschflusse, eine Tochter.
Während die tigrische Sprache nicht geschrieben wird, hat die amharische sogar noch 6 Zeichen mehr als das Geéz mit sechserlei denselben angehängten Vokalzeichen, wozu noch 4 Diphthongformen kommen. Die Charaktere sind wie das ganze Alphabet syllabarisch, nämlich Schaat lautet in der Form [Äthiopisch: sha] scha. [Äthiopisch: shu] ist = schu u. s. w. Ebenso wird aus Tjawi in der Form [Äthiopisch: ca] (tja) durch Hinzufügung eines kleinen Zeichens in der Mitte rechts [Äthiopisch: cu] tju, [Äthiopisch: ci] ist tji, [Äthiopisch: caa] tjâ, [Äthiopisch: cee] tje u. s. w. Die andern fünf dem Amharischen eigenthümlichen Charaktere sind: Gnahas [Äthiopisch: nya] (gna; es ist also [Äthiopisch: nyu] gnu und [Äthiopisch: nyee] gne auszusprechen); Chaf [Äthiopisch: xwa], cha; Jai [Äthiopisch: zha], ja (französisch auszusprechen); Djent [Äthiopisch: ja], dja und Tschait [Äthiopisch: cha], tscha. Das Aethiopische und Amharische wird von der Linken zur Rechten gelesen. Wenn sakaja, anklagen, geschrieben wird [Äthiopisch: sa][Äthiopisch: xwa][Äthiopisch: ya], so bezeichnet also das dem großen P im Lateinischen gleichende Zeichen die Silbe ja und man wird sofort einsehen, daß [Äthiopisch: yu] wieder ju, [Äthiopisch: yaa] jâ ist.
Als untergeordnete Dialekte müssen noch erwähnt werden, das Baze-Tigré (nicht zu verwechseln mit dem Tigrischen oder Tigrenja), die in der Samhara und weiter nördlich herrschende Sprache, das erwähnte Idiom der Falascha oder Juden, der Gamanten und Agows, die den Koara-Dialekt (Hauaraza) sprechen, [pg 93]und die Sprache der Gallastämme im Süden von Habesch, über die weiter unten mehr gesagt wird.
Soviel über die Sprachen des Landes. Von einer Literatur, welche das ganze Volk durchdringt, kann keine Rede sein, zumal Lesen und Schreiben ein Privilegium der höher gestellten Klassen, namentlich der Geistlichkeit ist. In früheren Zeiten war die geistige Regsamkeit in Abessinien eine ungleich rührigere als heutzutage, und aus jenen Perioden stammen auch die meisten Bücher, Chroniken und Bibelabschriften, von denen aber viel im Laufe der Kriege verloren gegangen ist. Alle abessinischen Manuskripte sind auf Pergament geschrieben und zwar meistentheils recht sauber und elegant. Die Linien laufen ganz symmetrisch miteinander parallel und auf der ersten Seite, sowie am Anfange jedes Kapitels sind immer die Zeilen abwechselnd mit rother und schwarzer Tinte geschrieben. Zum Schreiben bedient man sich eines zugespitzten Rohrhalmes. Häufig sind kolorirte Vignetten in den Text angebracht, die in älterer Zeit weit schöner als jetzt gemalt wurden. Viel Sorgfalt verwendet man auf die Ledereinbände, in welche man mit heißen Eisen zierliche Arabesken einbrennt. Die Art und Weise, wie die Geistlichkeit mit den seltensten alten Werken umgeht, ist geradezu barbarisch; sie verschleudert sie oft um einen Spottpreis oder läßt sie verschimmeln. Durch die Bemühungen der deutschen Missionäre, namentlich des wackeren Isenberg, sind in London auch mehrere Bücher in amharischer Sprache gedruckt worden, darunter eine vollständige Bibelübersetzung, eine kleine Geographie und ein Abriß der Weltgeschichte. Obgleich man diese zu Tausenden verbreitet hat, so haben sie dennoch keinen Nutzen gestiftet, da die den Missionären feindlich gesinnte abessinische Geistlichkeit den Gebrauch hinderte und die Werke vernichtete. So liegen sie da als ein Werk deutschen Fleißes, ohne lebendige Anwendung zu finden.

Nach Krapf umfaßt die ganze abessinische Literatur 130 bis 150 Werke, von denen viele nur Uebersetzungen der griechischen Kirchenväter sind. Die sämmtlichen Bücher werden in vier Sektionen oder Gabaioch getheilt, deren erste das Alte, deren zweite das Neue Testament allein ausmacht. Die dritte enthält juristische Schriften, wie das Gesetzbuch, den Chrysostomus u. s. w., die vierte endlich besteht aus Mönchsschriften und dem Leben der Heiligen. Die großen Sammlungen von äthiopischen und amharischen Schriften, welche die Gebrüder d’Abbadie nach Frankreich, Rüppell nach Frankfurt, Krapf nach Tübingen brachten, lassen uns jetzt einen tiefen Einblick in das Schriftthum jenes abgelegenen christlichen Volks thun. Da finden wir „den Glauben der Väter“ (Haimanot Abau), eine Dogmensammlung der abessinischen Kirche, das Leben des [pg 94]Königs Lalibela (Gadela Lalibela), der im 13. Jahrhundert nach dem Untergange der Judendynastie lebte, die Biographie Tekla Haimanot’s, eine Menge wichtiger Chroniken u. s. w.
Die Art und Weise, wie die Abessinier ihre Gemälde entwerfen, die oft auch die Pergamentmanuskripte schmücken, beschreibt Salt. Der Maler machte zunächst einen genauen Entwurf seiner Zeichnung mit Kohle und überzog denselben dann mit Tusche. Der Gegenstand stellte zwei abessinische Reiter im Kampfe mit den Galla dar; die Kleider der Krieger, das Geschirr der Pferde, der Gesichtscharakter waren getreu nachgeahmt. Die Abessinier vergrößern in ihren Gemälden auf eine besondere Art das Auge und zeichnen die Figuren en face; nur Juden, Teufel u. s. w. werden im Profil gemalt. Die Farben sind äußerst grell: Grün, Roth, Blau und Gelb herrschen vor.
Wenden wir uns nun zur Betrachtung des Charakters der Abessinier, so treffen wir hier auf sehr widersprechende Urtheile, doch kann im allgemeinen behauptet werden, daß derselbe nach unsern europäischen Begriffen ein keineswegs vorzüglicher ist. Während z. B. Munzinger und Heuglin dem Volke mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen, sind die Urtheile von Bruce, Rüppell, Krapf, Isenberg sehr herbe, und auch im eigenen Lande giebt es Leute genug, welche in die Verdammung einstimmen. Dahin gehörten vor allem der König Theodoros II. selbst und der im Jahre 1867 gestorbene Abuna (Erzbischof). Einzelne vorzügliche, durch Liebenswürdigkeit, edlen Charakter und Gelehrsamkeit ausgezeichnete Persönlichkeiten hat es jedoch immer gegeben und sie beweisen, daß in dem befähigten Volke noch nicht alle besseren Eigenschaften eingeschlummert sind. Der höchste Kirchenfürst des Landes, allerdings ein Ausländer, von dem selbst kein sehr erfreuliches Bild entworfen wird, schrieb 1843 an Isenberg: „Die Abessinier sind ein Volk, das weder nach Erkenntniß verlangt, noch Liebe zum Lernen zeigt, noch auch begreifen kann, daß Sie sein Bestes suchen. Was es will, ist, daß Sie ihm von Ihrer Habe mittheilen, nichts anderes. Wie kurz oder wie lange Sie sich auch in Abessinien aufgehalten haben mögen – können Sie immer noch glauben, daß die Abessinier seien wie andere Menschen, welche lernbegierig sind und nach Erkenntniß verlangen?“ Isenberg selbst ist von dem Volke keineswegs erbaut und hatte bei der ihm widerfahrenen Behandlung auch wenig Ursache hierzu. Rüppell, ein sehr nüchterner Beobachter, faßt sein Urtheil folgendermaßen zusammen: „Die Hauptzüge des moralischen Charakters der Abessinier sind: Indolenz, Trunkenheit, Leichtsinn, ein hoher Grad von Ausschweifung, Treulosigkeit, Hang zum Diebstahl, Aberglaube, dummstolze Selbstsucht, große Gewandtheit im Verstellen, Undankbarkeit, Unverschämtheit im Fordern von Geschenken und eine des sprüchwörtlichen Gebrauches würdige Lügenhaftigkeit.“ Mildernd setzt er hinzu: „In der Regel ist ihnen übrigens ein leutseliges, ungezwungenes Betragen eigen, weshalb eine oberflächliche Beurtheilung zu ihren Gunsten ausfällt.“ Dann weiter: „Zur Erregung eines bessern moralischen [pg 95]Gefühls trägt gar nichts in ihrem Leben bei, und ich muß durchaus dem beistimmen, was der Missionär S. Gobat als das Resultat eines beinahe einjährigen Aufenthalts in Gondar über den sittlichen Zustand dieser Stadt ausspricht, nämlich: „Alle Abessinier, wenn sie keine Regierungsgewalt zu fürchten haben, treiben das Räuberhandwerk. Ich kenne die Abessinier zu gut, als daß ich einen großen Werth auf ihre süßen Worte legen sollte. Ich bin traurig und niedergeschlagen, weil es mir vorkommt, als sei jeder Rettungsversuch vergeblich.““ Rüppell führt eine Menge diese Aussprüche charakterisirende Einzelheiten an, welche allerdings schlagende Illustrationen bilden; allen Ständen schreibt er gleich große Rohheit zu. Auch die Trägheit der Abessinier ist unglaublich. Jeder Ackerbautreibende bestellt nicht mehr Feld, als für den Bedarf seiner Familie nöthig ist, und an ein Aufspeichern von Vorräthen ist nicht zu denken. Jede Art von Handarbeit halten sie für etwas Entehrendes, und daher kommt es denn, daß fast die ganze Industrie des Landes in den Händen der Muhamedaner und Juden ist. Betrug im Handel, Verfälschung der Waaren sind gang und gäbe.
Alledem gegenüber klingt als Lobrede, was Werner Munzinger, allerdings einer der ersten Kenner des Landes und Volkes, sagt: „Ueber dieses Land darf ich wohl reden, denn auch sein Mensch steht uns kaum so fern. Er denkt, er träumt, er liebt und haßt ja auch; er fühlt wie wir, nur roher und oft viel natürlicher und freimüthiger. Soll denn das schwarze Gesicht immer ein schwarzes Herz bergen? Auch dort findest du mitleidige Herzen! Wenn der schneidende Abendwind dichte Nebel auf die Hochebene hinabregnet, da kann der Wegfahrer getrost anklopfen und auch des erfrorenen Bettlers harrt ein freundlicher Gruß, ein fröhlich loderndes Feuer und ein warmes, in Milch eingebrocktes Brot. Auch dort giebt es Ritter, Beschützer der Frauen und Schwachen. Der Mißhandelte findet seinen Advokaten. Auch Freunde kannst du erwerben, wenn auch nicht schnell, die am Tage der Gefahr dich beschirmen. Treue Liebe, glückliche Gatten sind nicht selten, und wie oft folgt die trauernde Gattin ihrem Herrn freiwillig in den frühen Tod! Du siehst in Hungersnöthen die Mutter mit hohlen Wangen, die Kinder frisch und munter, denn das letzte Brot spart sie für ihre Lieben auf. Unermüdet wacht die Gattin bei ihrem kranken Manne. Brave Söhne opfern jahrelange Arbeit, um ihrem alten Vater sorgenfreie Tage zu bereiten, Gefühl fehlt nicht und auch nicht Muth und Frohsinn; sie singen und tanzen die sternenhelle Nacht durch; Rhapsodien loben den Helden, den Löwentödter, den Menschenbezwinger. Freude und Leid wird ausgesungen; das Lied dient auch der Klage, es begleitet die Arbeit, es bejubelt die Hochzeit.“ Im grellen Gegensatz steht – gegenüber fast allen andern Berichten – was Munzinger hier über die ehelichen Verhältnisse bemerkt, und es scheint uns fast, als sei wenigstens hier ein rosiger Schimmer über seine Darstellungen ausgebreitet.
Hier muß erwähnt werden, daß die Blutrache in ganz Abessinien allgemein herrscht und daß eine ausgebreitete und mächtige Verwandtschaft daher als ein sehr bedeutendes Schutzmittel gilt. Zu Isenberg kam einst eine Frau in der größten Angst gelaufen mit der Bitte, er möge für ihren Mann beten, der am [pg 96]Morgen ohne Begleitung und ohne Waffen ausgegangen sei; dies habe sein ihm feindlicher Vetter benutzt, um ihm bewaffnet zu folgen. „Wir erfuhren, daß diese Feindschaft zwischen den beiden Vettern von ihren Vätern herrührt, die einander in tödtlicher Feindschaft umgebracht haben sollen. Auch die Vettern haben in ihren Streitigkeiten schon zehn ihrer Leute verloren.“ Salt lernte einen jungen Häuptling (Schum) Namens Schelika Negusta kennen, der einen Feind im Zweikampfe erschlagen hatte. Mehrere mächtige Verwandte des Gebliebenen bemächtigten sich seiner Person und führten ihn vor den Ras, welcher ihn nach dem Gesetze zum Tode verdammte und zwar wurde er nach mosaischem Gebrauch den Verwandten des Ermordeten übergeben, damit diese nach Gefallen mit ihm umgehen möchten. Gewöhnlich wird bei solchen Gelegenheiten der Thäter nach dem Markte geführt und dort zu Tode gespeert, und so sollte es auch dem Schelika Negusta ergehen, als die Osoro’s (Prinzessinnen), von seiner Schönheit gerührt, sich hinter die Geistlichkeit steckten und durch deren Banndrohungen es vermochten, daß der der Blutrache Geweihte gegen eine hohe Geldsumme freigegeben wurde.
Die Justiz wird in Abessinien ungemein willkürlich gehandhabt. Ein oberster Gerichtshof hatte in der Residenz seinen Sitz und entschied in weltlichen Angelegenheiten als letzte Instanz. Bezüglich der Todesurtheile steht dem Könige die Entscheidung zu. Dieser hält wöchentlich mehrere Mal öffentliche Audienz in seinem Palaste, wobei Jedermann Zutritt hat. Hier läßt er sich Klagen und Vertheidigung vortragen, verhört die vorgeladenen Zeugen und giebt nach Berathung mit den Gerichtsbeisitzern seinen Spruch ab, dem jedoch die ausübende Kraft fehlt und der daher mehr als Gutachten angesehen werden muß. Ist der König verreist, so wählen sich die Parteien selbst ihren Schiedsrichter. In den Provinzen entscheidet der Gouverneur und zwar gleichfalls öffentlich, in der Regel auf einem Hügel in der Nähe der Stadt. Rüppell wohnte einer solchen Gerichtssitzung zu Angetkat in Semién bei. Der Gouverneur saß auf einem Flechtstuhle und ringsumher lagen die Zuhörer im feuchten Grase. Es handelte sich um eine Ehescheidung, bei der sowol Mann wie Frau ihre Sache persönlich vortrugen und zwar beide mit vieler natürlicher Beredsamkeit. Die Umstehenden sprachen fortwährend laut dazwischen und machten ihre Bemerkungen über den Gang der Unterhandlungen. Endlich ward Ruhe geboten und der Gouverneur verkündigte das Urtheil, worauf er beide Parteien mit einem „Marsch!“ entließ.
Bei diesen Verhandlungen wird das geschriebene Gesetzbuch Abessiniens, das Feta Negust (die Richtschnur des Königs) nur selten angewandt, da man es meist nur bei verwickelten Rechtsfällen zu Rathe zieht. Es soll angeblich unter Konstantin dem Großen durch die auf dem Konzil zu Nicäa versammelten Kirchenväter zusammengestellt worden sein. Das Feta Negust besteht aus zwei Abtheilungen, von welchen die eine das kanonische, die andere das bürgerliche Recht behandelt; beide zusammen haben 51 Unterabtheilungen. Die 22 Paragraphen des kanonischen Rechts handeln von der Rechtgläubigkeit, der Geistlichkeit, der Kirche, der Verwaltung von deren Eigenthum, vom Gottesdienst, den Feiertagen, der Ketzerei u. s. w.; die 29 Paragraphen des bürgerlichen Rechtes von der [pg 97]Dienstbarkeit, der Ehe, dem Wucher, Erbschaft, Kauf, Zeugnissen, gefundenen Sachen, Grundeigenthum, Todtschlag, Diebstahl, Strafen u. s. w. Interessant ist die von Rüppell nicht ohne Grund ausgesprochene Ansicht, daß als Verfasser dieses Gesetzbuches vielleicht der protestantische deutsche Missionär Pater Heyling von Lübeck anzusehen sei, der im Jahre 1634 nach Abessinien kam.
Alle Gesetze jedoch, so gut sie sein mögen, hindern das Volk nicht in seinem faulen, zügellosen und namentlich in geschlechtlicher Beziehung außerordentlich liederlichen Lebenswandel fortzufahren, und die zahlreiche Geistlichkeit thut nicht das Geringste, um dem wüsten Treiben Einhalt zu thun, ja sie geht mit schlechtem Beispiel voran. Da kann es denn, wo für Aufklärung und Schulen so gut wie gar nicht gesorgt wird, nicht Wunder nehmen, daß unter diesen Christen die abenteuerlichsten Vorstellungen und der seltsamste Aberglaube im Schwunge ist.
Nach den abergläubigen Ansichten der Abessinier hat jeder Mönch, jeder Einsiedler, jeder Zwerg die Fähigkeit, in die Zukunft schauen und weissagen zu können. Geschriebene Talismane werden unter die Saat gemischt, damit sie gut keime, und kein Abessinier besteigt sein Maulthier, ohne sich vorher mit einer solchen Papierrüstung versehen zu haben, die ihn angeblich stich- und kugelfest machen soll. Amulete spielen derart eine große Rolle und schützen den Inhaber gegen jede vorhergesehene oder unvorhergesehene Gefahr. Der Tulsim, ein Gürtel, an dem kleine Ledertäschchen hängen, enthält diese schützenden Papierschnitzel, welche Männer, Weiber, Kinder tragen und die selbst der König für unentbehrlich hält. Auch übt der Einfluß des bösen Auges eine große Macht auf alle Abessinier aus; böse Geister durchschwärmen nach ihrer Vorstellung die Erde und das Wasser. Häufig wendet man das Besa oder Krankenopfer an, indem man unter Singen und Schreien um das Lager des Patienten einen Ochsen treibt und denselben dann vor dem Hause schlachtet. Kein Abessinier wird an einem Sonnabend oder Sonntag eine Schlange zu tödten wagen, weil an diesen Tagen jene Thiere als ein glückverheißendes Omen erscheinen. Uebereinstimmend mit den heidnischen Galla bringen die Christen im Juni dem Sar (bösen Geiste) Dankopfer dar, obgleich dieser Götzendienst durch Verordnungen aufs strengste untersagt ist. Drei Männer und eine Frau, die mit dem Bösen in Verbindung stehen, versammeln sich dann, um in einem frisch ausgekehrten Hause die Ceremonie vorzunehmen; eine ingwerfarbige Henne, eine röthliche Gais oder ein Ziegenbock mit weißem Halsringe werden geopfert und das Blut der Thiere, mit Fett und Butter gemischt, während der Nacht auf einen engen Pfad gesprengt, damit alle Darübergehenden das Uebel des Kranken an sich nehmen, zu dessen Gunsten das Opfer dem Sar dargebracht wurde.
Das Aechzen der Wassernixen hört der abergläubige Abessinier in jedem Wasserfall, und der Unglückliche, welcher im plötzlich angeschwollenen Wildbache ertrinkt, wird als Speise der bösen Wassergeister angesehen. Verschiedene Pflanzen und Kräuter besitzen zauberische Eigenschaften, so ein Gras (Fegain), das, heimlich auf den Gegner geworfen, diesem Krankheit und schleunigen Tod bringt. Zauberer und Sterndeuter, durchaus keine seltenen Erscheinungen in Abessinien, [pg 98]erreichen nach der Volksmeinung das anständige Alter von vier- oder fünfhundert Jahren; sie fliegen mit der Windsbraut durch das ganze Land, erscheinen plötzlich und ungesehen in der schmausenden Gesellschaft und nehmen ihr die leckersten Fleischbissen vor der Nase weg.
Vor dem sterblichen Auge verborgen liegt irgendwo im Lande das zauberhafte Dorf Duka Stephanos, ein Paradies auf Erden, das, alle irdischen und himmlischen Freuden in sich vereinigend, die Sehnsucht des wunderliebenden Volkes im hohen Grade erregt. Seine grasigen Auen und prächtigen Wälder laden zum süßen Schlummer ein, und am heitern Ufer des Nil, der seine blauen Fluten durch die prächtige Landschaft rollt, wandern die schönsten Weiber. Dort fließen die köstlichsten Getränke in nimmer versiechendem Strome, und die Erde bringt saftige Früchte in unendlicher Fülle ohne Arbeit hervor. Doch in zauberische Nebel verhüllt, öffnet dieses Elysium seine Pforten nur Menschen von untadelhaft schönem Aeußern, die das Wohlgefallen der Bewohner von Duka Stephanos erregten.
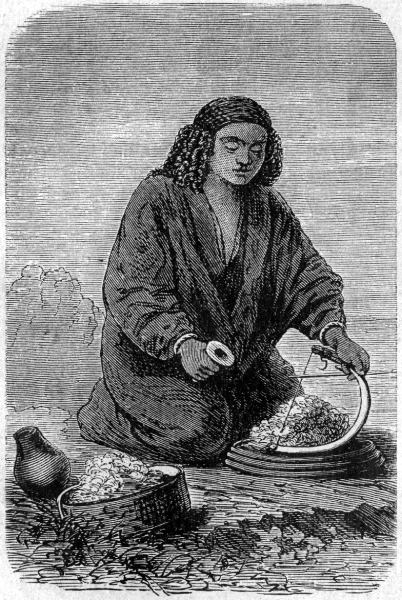
Zwerge werden mit einem gewissen Respekt behandelt und sind Gegenstände der Furcht; viele unter ihnen sind gerade die gelehrtesten Leute des Landes. So war der Beichtvater Sahela Selassié’s, des Königs von Schoa, ein wahrer Asmodeus in seiner Erscheinung, doch dabei ein liebenswürdiger und ungemein weiser Mann, der sich vor seinen Landsleuten in geistiger Beziehung bedeutend auszeichnete. Auch die Großen des Landes wählen sich gern mißgestaltete und zwerghafte Leute zu Sekretären.
Ganz besonders mit übernatürlichen Kräften ausgestattet erscheint aber der [pg 99]Grobschmied oder Budak, da er sich nach Belieben in einen Wolf oder eine Hyäne zu verwandeln und Menschenfleisch zu fressen vermag. Dem bösen Blicke eines Schmiedes wird gewöhnlich Krankheit und Unglück zugeschrieben. Hailo, der Vater Ubié’s, des früheren Herrschers von Tigrié, gab einst Befehl, alle Schmiede, die in seinem Reiche wohnten, niederzumachen, um weiteres Unglück zu verhüten. Ueberall bluteten die unschuldigen Opfer, dem Manne aber, der dieses abergläubige Werk vollbracht, jubelten dankbar die Herzen des Volkes zu, das sich von einem Alp befreit glaubte. Nicht weniger als 1300 der nützlichen Eisenarbeiter sollen damals (zu Anfang dieses Jahrhunderts) ihr Leben auf diese grausame Art verloren haben. So berichtet wenigstens Harris, dem wir hier gefolgt sind. Indessen genügt die Gegenwart irgend eines christlichen Emblems oder der Heiligen Schrift, um die üblen Wirkungen der Schmiede zu neutralisiren. Kein Metall kann in Gegenwart des Kreuzes geschweißt werden. Als die britische Gesandtschaft in Schoa war, mühten sich ein paar eingeborene Schmiede mit ihren kleinen Blasebälgen vergeblich ab, einen Reifen um das Rad einer Kanonenlaffete zu schmieden. Sie erklärten nun, daß die Gegenwart irgend eines Theils der Heiligen Schrift ihrem Geschäfte hinderlich sei. Schnell warfen alle Anwesenden ihre Amulete weg; die Blasebälge arbeiteten von Neuem, aber das Metall war nicht in Fluß zu bringen. Nun wurden englische Blasebälge gebracht, und als die Funken vor der Windröhre davon sprühten, war das Eisen in fünf Minuten weißglühend und der Reif aufgeschweißt. Die einheimischen Magier baten aber, dergleichen Proben in Zukunft zu unterlassen, da sonst ihr Ansehen verloren ginge!

Da der Handel großentheils in den Händen der Muhamedaner, die Gewerbthätigkeit meistens bei den Juden ist, so bleiben für den christlichen Abessinier das Kriegshandwerk, die Geistlichkeit, Jagd, Ackerbau und Viehzucht als Erwerbszweige übrig.
In der wildreichen Kola, die mit ihren grasreichen Niederungen den Elephanten, Büffeln und Antilopen ein willkommener Aufenthalt ist, tritt uns der Eingeborene oft als kühner Jäger entgegen. In den meisten Hütten der Kola von Eremetschoho fand Rüppell getrocknete Elephantenrüssel oder die Schweife von Büffeln, welche als Zeichen des persönlichen Muthes aufbewahrt wurden. Als einzige Waffe dient den Riesen der Wildniß gegenüber der Speer. Doch ist im Allgemeinen die Jagd nur ein nebensächlicher Erwerbszweig.
Der Abessinier der Hochlande dagegen ist vorzugsweise Ackerbauer und Viehzüchter, und nach den Produkten dieser Thätigkeit richtet sich auch seine Nahrungsweise. Die Nachricht, daß die Abessinier große Freunde rohen Fleisches (Brundo) seien, drang zuerst durch Bruce nach Europa. Man glaubte ihm jedoch nicht, bis dann spätere Reisende Alles bestätigten, was er erzählt hatte. Bruce berichtete, daß, wenn die Gesellschaft zum Essen versammelt gewesen sei, man eine Kuh oder einen Ochsen vor die Hütte geführt habe. Man bindet dem Thiere die Füße, macht unten am Halse in die Haut einen Einschnitt bis an das Fett und läßt fünf bis sechs Tropfen Blut auf die Erde fallen. Dieses geschieht, um das Gesetz zu beobachten. Dann fallen einige Leute über das Thier her, ziehen ihm die Haut vom Körper bis in die Mitte der Rippen ab und schneiden aus den Hintervierteln dicke viereckige Stücke Fleisch heraus. Das schreckliche Gebrüll des unglücklichen Thieres ist ein Zeichen für die Gesellschaft, sich zu Tische zu setzen. Statt der Teller legt man jedem Gaste runde Tiéfkuchen vor, die als Zuspeise und Serviette zugleich dienen. Herein treten zwei oder drei Diener mit viereckigen Stücken Rindfleisch, welches sie in den bloßen Händen tragen; sie legen dasselbe auf Tiéfkuchen; der Tisch ist ohne Tafeltuch. Die Gäste halten schon ihre Messer bereit. Jeder Mann schneidet mit seinem krummen Säbelmesser kleine Stücken Fleisch herunter, in welchen man noch die Bewegung der Fasern, das Leben, wahrnimmt. In Abessinien speist sich kein Mann selbst und rührt seine Kost nicht an. Die Frauenzimmer nehmen diese Stücken und schneiden sie erst in Streifen von der Dicke eines kleinen Fingers und dann in Würfel. Diese legt man auf ein Stück Tiéfbrot, das stark mit Pfeffer und Salz bestreut ist und wie eine Rolle zusammengewickelt wird. Dann steckt der Mann sein Messer ein, setzt beide Hände auf die Kniee seiner Nachbarinnen und wendet sich mit vorgebeugtem Leibe, gesenktem Kopfe und aufgesperrtem Maule zu derjenigen Nachbarin, welche die Rolle zuerst fertig hat. Diese stopft ihm das ganze Stück in den Mund, der davon so voll wird, daß der Mann in Gefahr geräth zu ersticken. Je vornehmer der Mann, um so größer ist das Stück, und es wird für sehr fein gehalten, wenn er beim Essen recht stark schmatzt.
Wie gesagt, dieses Verzehren von rohem Beefsteak erregte in England allgemeines Aufsehen und Bruce stand als Lügner gebrandmarkt da. Hören wir [pg 101]nun, was spätere Reisende über diesen Gegenstand berichten. Salt, der mehr als dreißig Jahre später in Abessinien war, bezüchtigte Bruce der Unwahrheit, indem er erzähle, es sei Gewohnheit bei den Abessiniern, sich am Fleische noch lebender Thiere nach Art des Polyphem zu ergötzen; doch stellt er keineswegs in Abrede, daß rohes Fleisch, je frischer, je lieber, ihr größter Leckerbissen sei. Rüppell (1832) berichtet an mehr als einer Stelle seines Reisewerkes, wie er gesehen habe, daß die Leute noch zuckendes Fleisch genossen hätten. Er sagt: „Dasjenige Fleisch, welches noch seine natürliche Wärme hat und bei dem die Muskelfasern noch unter dem Messerschnitte zucken, gilt für einen besondern Leckerbissen. Das Fleisch wird von den Abessiniern meistens roh verzehrt, wiewol in den von mir bereisten Provinzen jetzt nie anders, als nachdem das geschlachtete Thier ausgeblutet hat. Der barbarische Gebrauch, Stücke Fleisch von einem noch lebenden Thiere herauszuschneiden, welchen Bruce beschrieben hat, mag zur Zeit seines Aufenthaltes in Gondar stattgefunden haben, ist aber sicherlich dort in neuerer Zeit nicht mehr etwas Gewöhnliches. Daß derselbe indessen in andern Gegenden Abessiniens auch jetzt noch zuweilen vorkommt, behaupte ich trotz des Widerspruchs Salt’s und der ganz grundlosen Kritiken, welche die Franzosen Combes und Tamisier über Bruce veröffentlichten.“ Der Missionär Isenberg (1843) bezweifelt dagegen wieder die allgemeine Richtigkeit der Angabe von Bruce und stellt jene Thatsache als Aushülfe in Nothfällen hin, „wo z. B. auf einem Marsche befindliche Soldaten in gewisser Entfernung von ihrem Lagerplatz, wenn sie der Hunger ereile, dem Vieh, welches sie vor sich hertreiben, ein Stück Fleisch aus dem Hinterviertel herausschneiden und verzehren, die leere Stelle mit Heu oder anderm Material ausfüllen, die abgelöste Haut wieder darüberziehen und dann das Thier bis zu ihrem Lagerplatz treiben, wo seinem Leben ein Ende gemacht werde.“ Entscheidend möchte jedoch Folgendes sein.
Als der Reisende Apel im Januar 1865 zu Wochni gefangen genommen und nach Gondar geschleppt wurde, setzte man ihn auf ein Pferd, das vermittels eines Seiles von etwa 3 Ellen Länge an dasjenige eines ungeheuren Abessiniers befestigt war. „Auf diesem Ritt von Wochni nach Gondar habe ich mit eigenen Augen das gesehen, was von Bruce so standhaft behauptet und von der ungläubigen Civilisation bestritten wurde, – nämlich das Herausschneiden des Fleisches von noch lebenden Thieren und das Genießen desselben, während das Thier noch im Todeskampfe liegt. Es wurden ihm von den Christen die Füße gebunden, es fiel auf die Seite, und alsbald schnitt man ihm Stücke Fleisches aus dem Rumpfe, welche, noch zuckend von der Muskelbewegung, gierig von den Christen verschlungen wurden. Das Thier verblutete und blieb dann eine Beute der Schakale. Mir wurde ein blutiges zuckendes Stück Fleisch zugeworfen und ich habe, so widerwärtig mir das Ganze auch war, doch den größten Theil desselben verzehrt, so arg hatte mich der Hunger mitgenommen, denn seit zwei Tagen hatte ich nichts genossen. Dieselbe Kost wurde mir während der ganzen Reise angeboten.“ Krapf endlich sah in Schoa, wie Soldaten einem [pg 102]lebendigen Schafe ein Bein abschnitten, das Thier nicht tödteten und das rohe Fleisch vom Knochen sogleich abnagten!
Nicht viel weniger widerwärtig ist die Art und Weise, wie die Abessinier ihr übriges Fleisch zubereiten und überhaupt ihre Nahrung zu sich nehmen, sodaß man bei ihnen wol vom „Fressen“ sprechen kann.
Schafe und Ziegen werden in Gegenwart der Gäste geschlachtet und abgehäutet, dann die noch zuckenden Glieder etwa fünf Minuten über ein Flammenfeuer gehalten und die äußerste Lage Fleisch, die kaum durchröstet ist, mit Brotkuchen und reichlicher Pfeffersauce genossen. Salz wird in langen, gewundenen Antilopenhörnern umhergereicht. Während des Essens selbst wird nicht getrunken, unmittelbar nach demselben gehen jedoch Glasflaschen, sogenannte Berille, mit gegohrenem Honigwasser herum. Der Ueberbringer desselben gießt dabei, indem er eine Flasche darreicht, eine Kleinigkeit davon in die hohle Hand und trinkt sie vor dem Gaste aus, um demselben damit zu zeigen, daß der Trank nicht vergiftet sei. Auch die zubereiteten Speisen erscheinen für einen Europäer sehr widerlich, denn bei vielen wird ein Oel aus den Samenkörnern der Nukpflanze von sehr unangenehmem Geschmack zugesetzt.
Die Abessinier können ganz unglaubliche Portionen verschlingen und die Gefahr, dabei zu ersticken, welche Bruce scheinbar übertreibend anführt, wird auch von Rüppell hervorgehoben. Eine Hauptsache beim Essen ist jedoch, daß sie die Kauwerkzeuge unter lautem Geschmatze und Geschnalze bewegen müssen. Ländlich, sittlich! und diese „Sitte“ gilt nicht nur in den niederen Klassen, sondern auch bei Hofe, selbst in unsern Tagen bei Theodoros II. Dieser hatte den Missionär Stern zur Tafel geladen; die Mahlzeit bestand, da gerade Fasttag war, einfach aus Tiéfkuchen und Honigwasser. „Da machte ich“, erzählt Stern, „einen Verstoß gegen die Sitten des vornehmen Lebens. Nach abessinischen Begriffen muß jeder Mann aus der Aristokratie beim Essen schmatzen wie ein Schwein. Davon wußte ich leider nichts; ich aß so, wie wir in Europa es für schicklich halten, aber das trug mir den Tadel der Gesellschaft ein; die Leute raunten sich allerlei ins Ohr. Endlich fiel mir die Sache auf, und ich fragte den Engländer Bell, ob ich etwas Unangemessenes gethan habe. Bell entgegnete: Gewiß haben Sie das. Ihr Betragen ist so ungentlemanly, daß alle Gäste glauben müssen, Sie seien ein Mensch ohne alle Erziehung und Bildung und gar nicht gewohnt, sich in anständiger Gesellschaft zu bewegen. – Nun, wodurch habe ich denn eine so schmeichelhafte Meinung verdient? – Einfach durch die Art und Weise wie Sie essen. Wenn Sie ein Gentleman wären, so würden Sie das bei Tafel beweisen; Sie müssen recht laut und derb schmatzen und Keiner wird bezweifeln, daß Sie ein Mann von Stande seien. Da Sie aber nicht schmatzen und die Speisen lautlos kauen, so glaubt hier Jeder, daß Sie ein armer Tropf sind. – Ich erklärte dann den abessinischen Aristokraten, daß bei mir zu Lande, in Europa, eine andere Sitte herrsche, und damit brachte ich die Dinge wieder in richtigen Zug.“ –

In der Kleidung der Abessinier walten selbstgesponnene und gewebte Baumwollenstoffe vor. Wie im Orient noch immer, so spinnen auch die Frauen die gereinigte Baumwolle mit der Spindel aus freier Hand; mit dem Weben beschäftigen sich jedoch vorzugsweise die Muhamedaner. Die Kleidung der Männer besteht aus weiten Unterhosen, einem langen, um die Brust und den Leib geschlungenen Gürtel, der eine Ausdehnung von zuweilen 100 Ellen hat, und einem weiten faltigen Mantelüberwurf, welcher aus einem großen Stücke Zeug besteht, das bei Vornehmen mit einem faltigen Rande versehen ist. Mehr ist von der weiblichen Kleidung zu berichten. Sie besteht aus einem großen Hemde mit weiten, jedoch an der Handwurzel eng zulaufenden Aermeln. Darüber tragen sie den Umschlagmantel gleich den Männern. Außer einigen Seidenstickereien am Hemde zeichnet noch der Putz die abessinischen Schönen aus. Ohrringe oder Rosetten, welche eine Goldblume vorstellen, sind ein sehr beliebtes Schmuckmittel, desgleichen silberne Halsketten und dicke Ringe an den Fußknöcheln, beide öfter mit kleinen Silberglöckchen behängt. Das Haupthaar der Frauen ist gewöhnlich kurz abgeschnitten [pg 104]oder es wird, wenn es in seinem natürlichen Zustande bleibt, mit Anwendung von vieler Butter in dünne anliegende Zöpfchen geflochten. Auch hier ruft, wie bei unseren Damen, die Mode sehr häufig Aenderungen der Haartracht hervor, die genau befolgt werden. Stirnbänder oder Schuhe von rothem Leder kommen nur ausnahmsweise vor. Luxusartikel der männlichen Kleidung sind Arm- und Stirnbänder als Ehrendekorationen. Die blaue Schnur von Seide oder Baumwolle, welche als Zeichen des Christenthums gilt, wird allgemein getragen.
Diese allgemeine Tracht erleidet natürlich vielerlei Ausnahmen. In den Grenzländern findet man fast ganz nackte Leute, die nur den Leibschurz tragen; in Schoa hatte allein der König das Recht, sich mit goldenen Dingen zu schmücken. In Foggera, östlich vom Tanasee, tragen Frauen und Mädchen große gegerbte Lederhäute, welche zugleich Nachts als Schlafmatratze dienen. Beim Gehen verursacht dieser lederne Leibrock ein sonderbares Geräusch. In den hohen Alpengegenden der Provinz Semién schützen sich die Bewohner gegen das harte Klima durch eine Art von ambulantem, aus Rohrdecken zusammengeflochtenem Schutzdache (Gassa), welches sie beständig mit sich herumtragen, um ihre durch dürftige Lumpen nur zum Theil bedeckten Körper gegen plötzliche Regengüsse und Schneegestöber zu verwahren; ein anderes Schutzmittel gegen die schneidende Luft in den Hochlanden sind Kappen von Ziegenhaar, die bis über die Ohren gehen. Als Zeichen der Ehrerbietung zieht der Abessinier bei Begegnungen den die Schultern bedeckenden Theil seines Kleides (Schama) herab und vor dem Landesherrn erscheint er nur gegürtet, d. h. er schlägt die den Oberkörper bedeckenden Theile des Kleides über dem Gürtel um den Leib, während ein Hochgestellter in Gegenwart untergeordneter Personen sich das Gesicht vom Kinn bis über den Mund verhüllt.
Sauberkeit ist keine Tugend der Abessinier, und ihre Wohnungen wie ihre Körper zeigen oft den höchsten Grad von Schmuz. Merkwürdig ist, daß in ganz Abessinien das Waschen der Kleidungsstücke Sache der Männer und nicht der Frauen ist. Statt der Seife bedienen sie sich der getrockneten Samenkapseln des Septestrauches (Phytolacca abessinica), welche zwischen Steinen zu Mehl gerieben und dann auf einem Leder mit Wasser gemischt werden; das zu waschende Tuch wird hierauf in dieser Mischung mit den Füßen gestampft, worauf es, nachdem die Operation einige Male wiederholt wurde, von jedem Schmuze befreit ist. Die Bewohner der Küstengegend bei Massaua, wo es keine Septe giebt, bedienen sich statt der Seife beim Waschen getrockneten Kameelmistes.
Das sehr ungeregelte Leben der Abessinier ist auch die Ursache vieler Krankheiten, die große Verheerungen unter ihnen anrichten. Geschlechtliche Vergehen und Krankheiten sind allgemein verbreitet, ebenso Krätze und die arabische Gliederkrankheit; bei letzterer schnurrt die Haut an den Finger- oder Zehengelenken zusammen, das Glied stirbt nach und nach ab und löst sich endlich ganz vom Körper. So verliert der Kranke ein Glied der Finger und der Zehen nach dem andern, bis der nackte Stumpf der vier Gliedmaßen allein übrig geblieben [pg 105]ist und der sonst scheinbar gesunde Mensch zum hülflosen Geschöpf wird. Der Verlauf und die Unheilbarkeit dieser erblichen Krankheit ist in Abessinien sehr wohl bekannt, und den Kranken überfällt, wenn er die ersten Anzeichen spürt, natürlicherweise Schwermuth. Die Filaria oder der Medinawurm kommt ziemlich häufig vor, ist aber meistens nur eingeschleppt. Der Keim dieses Schmarotzers dringt in das Wadenfleisch der Menschen ein, bildet sich dort aus und verursacht die größten Schmerzen, gegen welche man mit Glück Zibethmoschus anwendet; Kröpfe und Kretinismus finden sich in einigen Gegenden; die Blattern richten periodisch große Verwüstungen an; Schwindsucht und Augenentzündungen sind häufig. Die einheimischen Aerzte (Tabib) können nur als Charlatans angesehen werden. Es existiren auch medizinische Werke, darunter eins mit dem Titel „El Falasfa“, dessen mitunter höchst lächerliche Vorschriften sympathetischer und mystischer Art sind. Auch die Geistlichkeit verlegt sich auf das Kuriren, und Rüppell sah, wie ein Knabe, der über und über mit Brandwunden bedeckt war, mit Honig und dem Blute eines schwarzen Huhns von einem Priester bestrichen wurde. Nach vier Stunden gab derselbe seinen Geist auf. Die „bösen Geister“ werden von den Priestern gleichfalls vertrieben, wie Isenberg selbst zu beobachten Gelegenheit hatte. Der Geistliche ließ sich einen Topf mit Wasser geben, las darauf schnell einige Gebete aus dem Buche Haimanot (Glaube) und spuckte dann mehrere Male in das Wasser. Isenberg machte ihm Vorwürfe hierüber, allein der Priester ließ sich nicht aus der Fassung bringen und besprengte mit der Flüssigkeit das Haus, welches solchergestalt von allen Unholden befreit wurde. Freilich ist dieses Verfahren von dem bei uns immer noch geübten Exorzismus nicht weit entfernt, und es steht uns daher wenig an, darüber viele Worte zu verlieren, so lange wir selbst nicht frei von ähnlichen Thorheiten sind.
Auch das Heilverfahren der abessinischen Wundärzte erinnert an die „gute alte Zeit“. Ein Zahn wird mittels Zange und Hammer von einem Schmiede ausgezogen, d. h. mit denselben Instrumenten, mit denen er sein Metall zu bearbeiten pflegt. Aderlaß wird mit einem Rasirmesser, Schröpfen mit einem Ziegenhorn vollzogen, dessen Luftinhalt durch Erhitzen verdünnt wurde. Schlecht geheilte Knochenbrüche, die verkürzte Glieder hinterließen, werden einfach nochmals gebrochen und so zu kuriren versucht. Indessen Amulete stehen in weit höherem Ansehen, als der Bala medanit oder Meister der Arzneien. Wahnsinn, Epilepsie, Delirium, Veitstanz und ähnliche oft unheilbare Uebel, für welche man keine Heilmittel kennt, werden einfach dem Einflusse von Dämonen zugeschrieben und der Patient hiernach behandelt. Blaue Papierstreifen sollen gegen Kopfweh helfen; gewisse Pflanzensamen, in Säckchen bei sich getragen, schützen gegen den Biß toller Hunde und gegen Unglück auf Reisen. Doch müssen diese Sämereien mit der linken Hand gepflückt werden zu einer günstigen Zeit, wenn die Sterne dem Pflückenden hold sind – sonst hilft das Mittel zu nichts. Wie wir schon aus Bruce wissen, verwüsten die Pocken oft das Land und fordern ihre Opfer. Eine Art Impfung, wobei die Lymphe mit Honig vermischt wird, findet dann von den menschlichen Pusteln statt, in deren Folge oft viele Leute [pg 106]sterben. In allen Fällen wendet man sich indessen, dem Aberglauben huldigend, lieber an den Priester als an den Quacksalber, was im Grunde genommen einerlei ist, da beide von der Medizin nach unsern Begriffen nichts verstehen.
Wenngleich es den Abessiniern nicht an der nöthigen Fähigkeit und Geschicklichkeit fehlt, so ist doch bei der allgemein herrschenden Indolenz die Industrie und Gewerbthätigkeit sehr gering entwickelt, ja, sie erhebt sich kaum über den allgemein afrikanischen Standpunkt, und manche Gewerbzweige werden in derselben primitiven Weise wie bei den benachbarten Negervölkern betrieben. Ein großer Theil der industriellen Thätigkeit liegt in den Händen der fleißigeren Juden und Muhamedaner.
Von den Schmieden war schon die Rede; das Verfahren, wie das Metall aus dem rothen Eisenthon in Tigrié bereitet wird, ist genau dasselbe wie es in Madagascar, am Zambesi oder in Westafrika stattfindet. Feinere Metallarbeiten liefern eingewanderte Armenier und Indier. Die Holzschnitzereien sind zum Theil prachtvoller Art. In der Kirche Lalibela in Gondar z. B. sind Flachreliefs an Thüren und Fenstern angebracht und theilweise bemalt. Außer den Arabesken, deren freie Erfindung und schöne Harmonie einen vorzüglichen Eindruck hervorbringt, sieht man Darstellungen aus dem Leben der Heiligen oder fabelhafte Ungeheuer, wie den Sebetat, der halb Mensch, halb Löwe ist. Sein Schwanz bestand aus zwei Schlangen; seine Waffen waren Pfeil und Bogen. Doch diese schützten ihn nicht gegen den Stier Meskitt, welcher ein silbernes und ein goldenes Horn trug und den Sebetat tödtete. Eine andere Holzschnitzerei zeigt uns den Kaiser Konstantin; dann – figürlich ausgedrückt – dessen Gewalt und schließlich die Fürstin Menene, die Mutter des Ras Ali und Erbauerin der Kirche.
Bei der oft herrschenden großen Kälte werden die sonst wenig industriösen Abessinier wenigstens mit Gewalt zur Weberei gezwungen. Die rohe Baumwolle, welche ungemein billig und ausgezeichnet im Lande ist, wird gegen einige Salzstücke eingehandelt und auf der einfachen, urthümlichen Spindel gesponnen. Zeit ist in Abessinien kein Geld, und so kommt es denn gar nicht darauf an, daß die Frauen recht lange mit dem Spinnen einer kleinen Partie Baumwolle zubringen. Das Garn kommt dann auf einen ganz gewöhnlichen, einfachen Webstuhl und wird mit Hülfe des Schiffchens in einen warmen, dauerhaften Mantel (Schama) umgewandelt. (Siehe die Abbildungen S. 98 und 99.)
Auch Schaf- und Ziegenwolle wird verwebt. Lederfabrikation zu Sattelzeug, Schilden, Riemen, Schuhen für die Priester ist ein weitverbreitetes Gewerbe. Töpferei und Pfeifenfabrikation treiben die Falaschas. Drechsler liefern aus den Hörnern des Sanga-Ochsen oder des Rhinozeros geschnitzte Becher (Wantscha). Zierliche Körbchen und Sonnenschirme aus Rohr, Binsen oder Stroh flechten die Frauen; Schneider giebt es dagegen nicht, da jeder Abessinier selbst für seinen Kleiderbedarf sorgt; ebenso mangeln Bäcker und Müller, und von größeren In[pg 107]dustriezweigen, die an einem Export ihrer Erzeugnisse arbeiteten, ist gar nicht die Rede, da nur Rohprodukte zur Ausfuhr gelangen.
Der Handel Abessiniens kann nach keiner Richtung hin ein bedeutender genannt werden, wenn er auch durch Massaua mit dem Rothen Meere in Verbindung steht. Die hohen, steil abfallenden Gebirgsketten mit den schwer zugängigen Pässen erschweren die Kommunikation ganz bedeutend, und die sämmtlichen Flüsse des Landes sind für die Schiffahrt nicht im geringsten geeignet. Dazu kommt vor Allem die geringe eigene Produktion von Handelswaaren, sodaß schließlich für den abessinischen Handel – von den Sklaven abgesehen – nur die aus den südwestlichen Ländern kommenden Erzeugnisse, wie Gold, Elfenbein u. s. w. als Durchgangswaaren in Betracht kommen. Hierdurch erklärt sich auch das geringe Interesse, welches man – Missionsfragen ausgenommen – in Europa an Abessinien vom praktischen Gesichtspunkte hatte und das erst durch König Theodoros und die Gefangenhaltung der Engländer wieder aufgefrischt wurde.
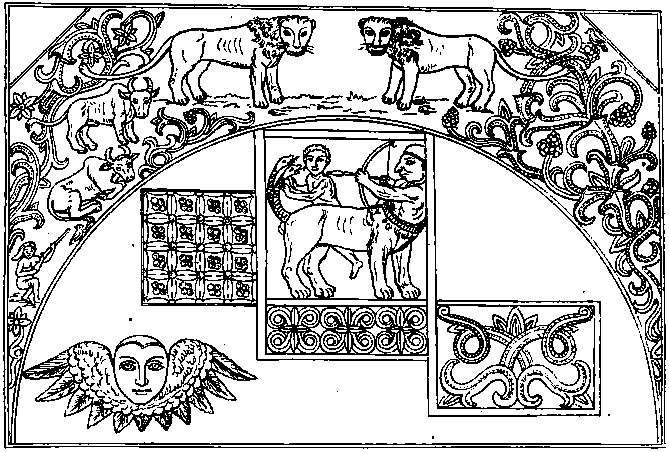
Für den Großhandel haben die Abessinier wenig Sinn, dem kleinen Schacher ist aber jeder zugethan und sucht auf alle mögliche Weise sein Geschäftchen zu machen. Auf den Messen und Märkten, die sich meist an die Kirchen knüpfen, geht es lebhaft zu, und große Menschenmengen sind dann versammelt. [pg 108]So traf Rüppell zu Ende Februar 1832 bei der Kirche von Bada, östlich vom Tanasee, gegen 10,000 Marktbesucher beisammen, von denen allerdings viele nur des Zuschauens wegen gekommen waren.
Der europäische Handel hat sich in Abessinien noch verhältnißmäßig wenig Einfluß verschaffen können. Die beständigen Kriege, die schlechten Kommunikationsmittel und Wege, endlich die Zollplackereien lassen ihn nicht recht aufkommen. Die Produktion des Landes selbst, Getreide, Hülsenfrüchte, Tabak, Kaffee, ist verhältnißmäßig viel zu gering, während doch alle Nutzpflanzen der Tropen und der gemäßigten Zone prächtig gedeihen würden. Dagegen werden Häute, Maulthiere und gute Gebirgspferde in großer Menge exportirt.
Honig und Wachs werden in sehr großer Menge ausgeführt. Der erstere, Mar genannt, wird in Töpfen zugleich mit dem Wachs feilgeboten, weil er nur so zur Bereitung des Honigwassers dienlich ist, wozu er beinahe ausschließlich verbraucht wird. Die betrügerischen Abessinier wenden ihre ganze Verschlagenheit beim Verkauf des Honigs an, indem sie die untern Schichten der Töpfe mit Mehl, Wachs oder andern Stoffen ausfüllen. Neben dem Honig kommt auch Butter (Tesmi) in pfundschweren Kugeln auf den Markt. Unter den Manufakturen spielen die Baumwollenwaaren (Schama) eine große Rolle; sie werden zu Leibbinden, Umschlagtüchern, Beinkleidern u. s. w. verarbeitet und sind entweder rein weiß oder mit blauen und rothen Seitenstreifen versehen; ganz blaue und ganz rothe Kattune kommen aus Indien über Massaua; die blaue Farbe hat in den meisten Fällen den Vorzug, und namentlich sind es blaue Seidenschnüre (Mareb), die sich stets eines großen Absatzes erfreuen. Jede Schnur muß ziemlich dick und fünf Fuß lang sein, sodaß sie bequem um den Hals getragen werden kann. Da kein abessinischer Christ ohne eine solche geht, so sind sie eine stets begehrte Handelswaare, die auch immer hoch im Preise steht. Andere gangbare, meist eingeführte Handelsartikel sind: Spießglanz, zum Färben der Augenlider, Weihrauch, zum Räuchern beim Gottesdienst, Zibethmoschus, um die als Pomade benutzte Butter damit zu parfumiren, „Tombak“ (indischer Tabak), entweder um Schnupftabak daraus zu machen, oder um ihn in Wasserpfeifen zu rauchen, schwarzer Pfeffer (Berberi), der auch zu Zollzahlungen dient; Nähnadeln mit großem Oehr; Glasperlen, Kaurimuscheln, Sandelholz zum Räuchern. Ein Handelsartikel, nach dem namentlich die abessinischen Frauen greifen, sind dünne silberne Ringe, die am kleinen, und Hornringe, die am Mittelfinger getragen werden. Gummi, das in großer Menge gewonnen werden könnte, kommt nicht auf die abessinischen Märkte, obwol es in Massaua gut bezahlt werden würde.
Bei der Schilderung des genannten Hafenortes werden wir sehen, wie bedeutend selbst heute noch dort die Ausfuhr von abessinischen Sklaven ist, die in der That noch immer, trotz aller zeitweiligen Verbote gegen den Sklavenhandel, einen wichtigen Artikel ausmachen. Adoa, Gondar und Massaua sind die großen abessinischen Sklavenmärkte, zu denen die lebende Waare von den verschiedensten Gegenden hergeschleppt wird. Die eingeborenen freien Abessinier können nur [pg 109]durch Kriegsgefangenschaft oder Raub in die Sklaverei gerathen; diese bilden den kleineren Theil, die meisten Sklaven stammen aus den Grenzlanden, sowol im Norden als im Süden; entweder sind es Schangalla vom Setit, Galla aus den Ländern südlich vom Blauen Nil, oder eigentliche Neger, die von den Aegyptern aus Fazogl oder Sennaar eingeführt werden. Da die Christen sich eigentlich mit dem Sklavenhandel nicht befassen sollen, so umgehen sie dieses dadurch, daß sie den Kauf oder Verkauf scheinbar durch Muhamedaner abschließen lassen. Die Behandlung der Sklaven ist in der Regel eine milde und ihr Verhältniß zu dem Herrn dem des freigeborenen Dieners gleich; die Züchtigungen sind selten hart und bestehen nur in vorübergehender Fesselung. „Wenn sich Völker auch bekämpfen“, schreibt Munzinger, „so sind die Opfer doch nur die Soldaten und die Güter; Weib und Kind sind respektirt. Kein freier Abessinier wird von seinem Mitbürger in die Sklaverei verkauft. Die Leibeigenschaft erstreckt sich nur auf die von außen eingeführten Schwarzen, die nur den kleinsten Theil der Bevölkerung ausmachen. Der Sklavenhandel ist den Christen (durch Theodor) bei Todesstrafe verboten. Die Frau ist unverletzlich und hat ihre bestimmten großen Rechte.“
Werthmesser in Abessinien sind das Salz und der österreichische Maria-Theresia-Thaler. Das Salz kommt aus den am Meeresufer liegenden natürlichen Seewasserlagunen und wird durch Austrocknung durch die Sonnenhitze gewonnen; man bringt es dann ins Gebirge, um es dort an bestimmten Plätzen gegen Getreide umzutauschen. Alles Salz, welches im nordöstlichen Abessinien verbraucht wird, ist solches Seesalz, während in den übrigen Theilen des Landes eine Art Steinsalz aus der östlich von der Provinz Agamié gelegenen Ebene Taltal benutzt wird. Viele Gesellschaften ärmerer Leute, von denen jeder nur über ein Kapital von einigen Thalern zu verfügen hat, ziehen regelmäßig mit ein paar Eseln aus dem Innern nach den östlichen Provinzen, um dort Salz einzukaufen, und machen dabei einen Gewinn, der zu ihrer und ihrer Familie Unterhaltung ausreicht. Verliert ein solcher Händler sein Kapital durch Plünderung, so muß er für wohlhabendere Leute die Reise machen und sich mit geringerem Gewinn begnügen. Das Salz wird in Taltal in regelmäßige Stücken von der Gestalt eines Wetzsteins ausgehauen, die dann als Scheidemünze in ganz Abessinien cirkuliren. Sie sind etwa 8⅛ Zoll lang, 1½ Zoll dick, an beiden Enden abgestutzt und wiegen durchschnittlich vierzig Loth. Ihr Verhältniß zu den Speziesthalern ist sehr verschieden und hängt theils von der Entfernung eines Ortes von der Salzebene, theils von den ruhigen oder unruhigen Zuständen der Gegenden ab, durch welche diese Stücken transportirt werden müssen. Sie schwanken also genau so wie unsere europäischen Werthpapiere je nach den politischen Verhältnissen, haben jedoch vor diesen den Vorzug, stets einen reellen Werth zu repräsentiren. In der Amharasprache heißt das Salz überhaupt Schau; als Scheidemünze in der beschriebenen Form benennt man es jedoch Amole oder Galep. Rüppell fand den Werth eines Maria-Theresia-Thalers in Gondar je nach den politischen Zuständen zwischen 20 und 32 Salzstücken [pg 110]schwankend, oder, dem Gewichte nach ausgedrückt, man erhielt etwa 27 bis 41 Pfund Salz für den Thaler. Dieser letztere selbst schwankt nicht etwa nach dem Silbergehalt, sondern nach dem Gepräge bedeutend im Werthe und ist der Agiotage unterworfen. Nach dem in ganz Ostsudan und Abessinien herrschenden Vorurtheile sind die mit dem Bilde der Kaiserin Maria Theresia versehenen Thaler die besten und allen übrigen Münzen vorzuziehen, und zwar muß bei ihnen das Diadem im Haare sieben wohlausgedrückte Perlen zeigen, der Schleier am Haupte sich deutlich abheben, der Stern auf der Schulter groß und der Avers mit den Münzbuchstaben S. F. deutlich versehen sein. Ohne diese Zeichen und die Jahreszahl 1780 sinkt der Thaler gleich bedeutend im Werthe, und selbst wenn der Kopf der Kaiserin unglücklicherweise Locken statt des Schleiers zeigt, ist es schwer, ein solches Münzstück anzubringen. Dieselben Vorurtheile herrschen in ganz Nordostafrika, wo ein der obigen Münzprägung entsprechender Maria-Theresia-Thaler dafür jedoch zum „Abu gnuchte“, zum „Vater der Zufriedenheit“ wird. Durchlöcherte Thaler oder solche, die mit dem Bilde des Kaisers Franz versehen sind, haben geringeren Werth und sind nur mit Verlust anzubringen; desgleichen spanische Säulenpiaster (Colonnaten) oder andere harte Silbermünzen. Noch für lange Zeit hinaus wird der Maria-Theresia-Thaler Werthmesser in Nordostafrika bleiben und das sonst an Silbergeld arme Oesterreich prägt für diesen afrikanischen Handel noch Jahr aus Jahr ein Thaler mit dem alten Stempel, ja es hat sich sogar in der Münzübereinkunft mit Frankreich (1867) vorbehalten, fortwährend Maria-Theresia-Thaler prägen zu dürfen.
Noch ist zu erwähnen, daß in der Umgebung von Adoa das dort gefertigte Baumwollenzeug an Zahlungsstatt gegeben wird. Es besteht aus Grans oder Stücken von 8 Ellen Länge und 1 Elle Breite, deren Werth sehr schwankend ist. Dieser Stoff dient blos zur Verfertigung von Beinkleidern, welche in Tigrié von Jedermann getragen werden. Einkäufe von geringem Betrag berichtigt man mit Getreide.
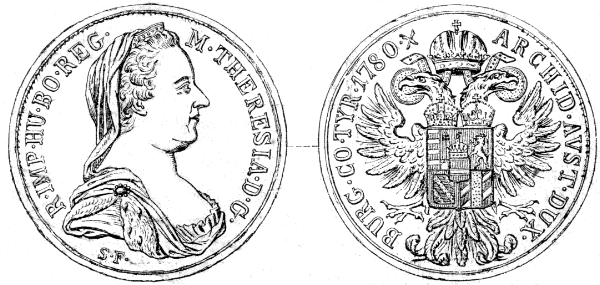
Religion, Kirche und Geistlichkeit Abessiniens. Das Missionswesen.
Das Christenthum Abessiniens, dessen Lehren und Verwahrlosung. – Der Abuna. – Art des Gottesdienstes. – Die lasterhafte Geistlichkeit. – Mönche und Klöster. – Politische Asyle. – Zeitrechnung. – Feste. – Taufe, Ehe, Begräbniß. – Die Kirchen, ihre Einrichtung und Ausschmückung. – Die verschiedenen Missionsversuche in Abessinien, deren Mißlingen und Urtheile darüber.
Unter den Sonderkirchen des Morgenlandes, die durch das Dogma der Dreieinigkeit mit der allgemein christlichen zusammenhängen, aber nach zwei verschiedenen Richtungen hin von ihr infolge der Bestimmungen sich lösten, denen im fünften Jahrhundert die Vorstellung von der Gottheit und Menschheit Christi unterworfen wurde, giebt es zwei Volkskirchen, die beide fast monophysitisch sind, beide von selbständigen Sprachen, Stiftungen und Ueberlieferungen getragen werden, die beide tief verfallen und entartet sind: die armenische und abessinische Kirche. Die letztere, die entlegenste, abgesperrteste, ist auch die entartetste, die am meisten von Heidenthum, Judenthum und Muhamedanismus durchsetzte und [pg 112]überhaupt dem Christenthum am fernsten stehende. Byzantinische Scheinrechtgläubigkeit hat diese Kirche in den Fanatismus der Formel versetzt, und die Waffen des Geistes werden vor dem priesterlichen Bann gestreckt; das Leben dieser Kirche basirt auf dem Anblasen und Handauflegen des Abuna, des obersten Bischofs, und leere Ceremonien gelten für Gottesverehrung. Dazu gesellt sich, daß die Träger dieser Kirche, vom höchsten Kirchenfürsten an bis zum niedrigsten Mönche herab, durch eine grenzenlose Sittenlosigkeit dem ganzen Volke mit üblem Beispiel vorangehen und daß sie die bedeutende Macht, welche sie ausüben, meistentheils zum eigenen Nutzen verwenden. Selbst die große Versunkenheit, in welche die europäische Geistlichkeit im Mittelalter zum Theil verfallen war, reicht noch lange nicht an jene der abessinischen Priester heran.
Von der Einführung des Christenthums war bereits die Rede, sehen wir nun, wie dasselbe heute beschaffen ist. Die Abessinier sind koptische Christen. Sie glauben an eine göttliche Offenbarung in der Heiligen Schrift, doch hat die kirchliche Tradition genau dieselbe Geltung wie die Bibel. Nach dem Missionär Isenberg haben sich bei ihnen die Hauptlehren des Christenthums von dem Dreieinigen Gott, dessen Wesen, Eigenschaften und Werken, von der Schöpfung der Welt, von den Engeln, von der Schöpfung, dem Fall, der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, von der Erlösung durch Christum, von dem Heiligen Geiste, der christlichen Kirche, den Sakramenten, von der Auferstehung und dem letzten Gericht erhalten; aber zum Theil durch allerlei Zuthaten so verändert, daß nur noch mit Mühe ein biblisches Moment darin zu erkennen ist. Den Heiligen Geist lassen sie nur vom Vater ausgehen, leugnen jedoch nicht, daß er nur durch Christus vermittelt ist. In Christus nehmen sie mit den übrigen Monophysiten nur eine Natur an, sind jedoch über die Art der Vereinigung des Göttlichen und Menschlichen in ihm verschiedener Meinung. Ihre Lehre von der Schöpfung und Regierung der Welt, sowie ihre Engellehre ist voll von heidnischen, jüdischen und muhamedanischen Vorstellungen. Sie glauben an das durch Christus vollbrachte Heilswerk, beschränken dasselbe jedoch durch Pelagianismus, d. h. sie leugnen die Verderbniß der menschlichen Natur durch die Folgen der Sünde Adam’s und erklären die natürlichen Anlagen und Kräfte des Menschen für hinreichend zur Erlangung der Seligkeit. Die Jungfrau Maria genießt unter den Abessiniern eine ganz besondere Verehrung; allgemein ist der Glaube unter ihnen verbreitet, daß sie für die Sünden der Welt starb und 144,000 Seelen dadurch errettete. Aus diesem Grunde sagte dem Volke auch die Lehre der katholischen Missionäre weit mehr zu als diejenige der Protestanten.
Viel zu schaffen machte den Abessiniern vor etwa 70 Jahren die Lehre von den drei Geburten Christi, ein Dogma, das von einem Mönche in Gondar aufgebracht wurde. Hiernach war Christus vor allem Weltanfang schon aus dem Vater hervorgegangen (erste Geburt), dann Mensch aus der Jungfrau Maria geworden (zweite Geburt) und durch die Taufe im Jordan durch den Heiligen Geist zum dritten Male geboren. Nach einem langen Kampfe mit der Gegenpartei, die nur zwei Geburten annahm, wurde 1840 durch Befehl Sahela [pg 113]Selassié’s, des Königs von Schoa, der Glaube an die drei Geburten als allein rechtgläubig durchgesetzt und die Anhänger der zwei Geburten mußten das Feld räumen. Sie flohen zum Abuna in Gondar, der sie in seinen Schutz nahm und vom Könige verlangte, daß er die Vertriebenen wieder aufnehme, da ihr Glaube, als mit demjenigen des heiligen Markus übereinstimmend, der einzig rechte sei. Als Sahela Selassié sich nicht fügen wollte, bedrohte ihn der Abuna mit Krieg, der jedoch erst 1856 unter König Theodoros gegen Sahela’s Sohn zur Ausführung kam. Dieser unterwarf Schoa und führte die Lehre von den zwei Geburten wieder ein, die nun allein herrschend ist, nichtsdestoweniger aber als „Karra-Haimanot“, d. h. Messer-Glauben bezeichnet wird, da sie die dritte Geburt Christi gleichsam „abschnitt“.
Sündentilgungsmittel der Abessinier sind strenge Fasten, Almosengeben, Kasteiungen, Mönchthum und Einsiedlerleben, nebst Lesen und Abbeten größerer oder kleinerer Abschnitte aus der Heiligen Schrift und andern Büchern. Der Priesterstand übernimmt für Geld ebenso wie in der katholischen Kirche diese Verrichtungen, daher Ablaß und eine Art von Seelenmessen auch hier stattfinden. Die Abessinier fasten in jeder Woche des Jahres, mit Ausnahme der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, zwei Tage, und zwar, gleichwie es in alten Zeiten bei den Juden Gebrauch war, am Mittwoch und Freitag. Außerdem enthalten sie sich noch an folgenden Tagen des Essens: an den drei letzten Tagen des Monats Ter, zum Andenken der Buße von Ninive’s Bewohnern; während der 55 Tage, die unmittelbar dem Osterfeste vorangehen, wovon 41 Tage dem Andenken an die Fasten Christi in der Wüste, 7 der Passionswoche und 7 andern Erinnerungen geweiht sind; die Fasten der Apostel sind von verschiedener Länge, je nachdem Pfingsten früher oder später fällt; die Fasten zu Ehren der Jungfrau Maria, wozu 15 Tage des August bestimmt sind, von ihrem Sterbetage bis zu ihrer Himmelfahrt; vierzigtägiges Fasten zur Vorbereitung auf das Fest der Geburt Christi vor Weihnachten. Man sieht aus diesem Verzeichniß der Fastenzeiten, von welchen die letzten beiden nicht von allen christlichen Abessiniern gehalten werden, daß ein diesen Enthaltungsvorschriften nachlebender Christ im Laufe des Jahres beiläufig 192 Tage, d. h. weit über die Hälfte des Jahres zu fasten hat. Rechnet man hierzu noch einzelne Straffasten, so kommt dreivierteljähriges Fasten heraus! Daß dieses nicht streng gehalten werden kann, liegt auf der Hand, aber vor Ostern, sowie den Mittwoch und Freitag, beobachtet man die Regeln unweigerlich. Aehnlich wie die Juden verachten die Abessinier das Nilpferd, den Hasen, die Gänse und Enten und meistens auch das Schwein als unreine Thiere.
Was den Heiligen Geist angeht, so kennt der Abessinier nur die Wunderkräfte, mit denen er Propheten und andere Heilige ausrüstete; auch glauben sie an eine Mittheilung des Heiligen Geistes durch die Taufe. Was die Kirche betrifft, so gelten hier die alten Ueberlieferungen von einer Verlosung der bewohnten Welt unter die Apostel, sie können aber nicht nachweisen, welchen Theil gerade jeder Apostel bekommen habe. Daß Petrus und Paulus Rom und [pg 114]Europa, Johannes Antiochien, Kleinasien und Syrien, Marcus Aegypten bekommen habe, steht ihnen fest; daher halten sie diese drei Kirchen für einander gleichstehend. Sie erkennen dem Papste als Nachfolger Petri einen gewissen Vorzug als dem Ersten unter Gleichgestellten zu. Ihre Kirchenverfassung ist episkopal. Der zu Kairo residirende koptische Patriarch von Alexandrien ist das Oberhaupt der abessinischen Kirche und von ihm erhalten sie ihren Bischof, den sie vorzugsweise Abuna, unser Vater, nennen. Als einziger Bischof des Landes, und zugleich in der Hauptstadt residirend, ist er zugleich Metropolitan. Seit Abuna Tekla Haimanot, der im 13. Jahrhundert die sogenannte salomonische Dynastie wieder herstellte, besteht die Verordnung, daß kein Abessinier mehr zu dieser Würde gelangen darf, sondern immer nur ein Kopte dieselbe bekleiden kann, um der Hoffnung Raum zu geben, immer einen neuen Zufluß theologischer Anregung von außen zu bekommen, da jener Heilige selbst, der letzte Abuna aus abessinischem Stamm, daran verzweifelte, tüchtiges theologisches Leben in der Geistlichkeit seines Landes zu erhalten. Dieser Tekla Haimanot (ums Jahr 1284) setzte ein Drittel des Bodens des ganzen Landes für kirchliches Einkommen fest, von welchem er den bedeutendsten Theil für seine Person erhielt. Der Abuna allein hat das Recht, Könige zu salben und Priester und Diakonen zu ordiniren; in andern theologischen und kirchlichen Angelegenheiten entscheidet er gemeinschaftlich mit dem Etschegé, dem Oberhaupte der Mönche.
Beim Amtsantritt des Abuna muß die abessinische Regierung dem Patriarchen ein Geschenk von 7000 Thalern einhändigen. Lejean erzählt, daß die stolze Fürstin Menene über den letzten im Herbste 1867 gestorbenen Abuna Abba Salama geäußert habe: „Dieser Sklav, den wir aus unserm Beutel bezahlt haben, benimmt sich sehr hochmüthig.“ Das kam dem Oberpriester zu Ohren und er antwortete: „Allerdings bin ich ein Sklave, aber einer, der viel werth ist. Hat man doch 7000 Thaler für mich gezahlt! Mit der Fürstin Menene verhält es sich freilich anders. Man könnte sie auf dem Markte zu Wochni ausstellen und bekäme nicht zehn Thaler für sie.“ Auf jenem Markte werden nämlich sehr schlechte Maulthiere feilgeboten. – Andraos (Abba Salama oder Frumentius ist sein Bischofname) war etwa 1815 geboren und kam 1841 unter Ubié zu seiner Stellung. Dem Kaiser Theodor gegenüber hatte er eine eigenthümliche wandelbare Stellung. Beide beobachteten einander, legten sich gegenseitig Hindernisse in den Weg, haßten und fürchteten sich und stellten sich doch, als ob sie gute Freunde seien. Sehr oft machte Theodoros gar keine Umstände mit dem Seelenhirten; er sperrte ihn in eine Feste und legte ihn in Ketten, worauf ihm Leute vom Hofgesinde auf den Knieen Speise reichen und die Füße küssen mußten. Salama, ein geborener Aegypter, galt für einen Freund der Engländer. Als er sich früher in Kairo der Studien halber aufhielt, besuchte er die protestantisch-englische Schule des deutschen Missionärs Lieder, der im Auftrage der anglikanischen Missionsgesellschaft arbeitete. Diese glaubte an ihm einen Proselyten gemacht zu haben, sah sich aber arg getäuscht, denn der Abuna erklärte später die Protestanten für Ketzer. Als er einmal auf das Aeußerste [pg 115]gebracht war, drohte er Theodor in den Bann zu thun, dieser aber ließ eine Hütte aus dürren Zweigen errichten, worin der Abuna verbrannt werden sollte. Dies that er, um sich nicht in „blutiger“ Weise an dem Gesalbten vergreifen zu müssen. Schleunig hob jedoch nach solchem Vorgange der Abuna den Bann auf.
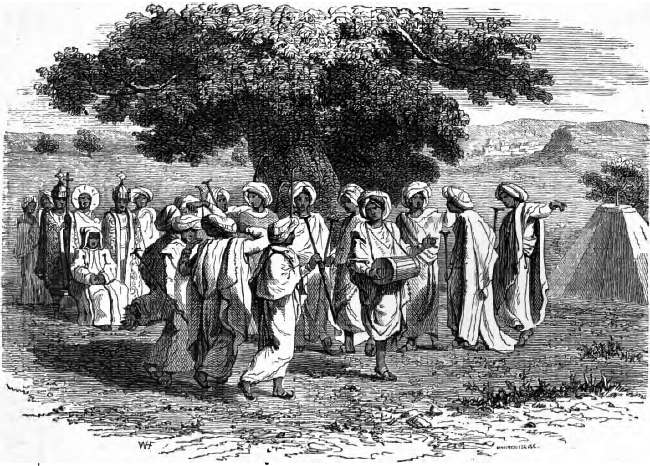
Bald nachdem Theodoros zur Macht gelangt war, fand sich David (Daud), der Patriarch von Alexandria, im Auftrage des ägyptischen Vizekönigs in Abessinien ein und benahm sich dort sehr hochfahrend, gleichsam als Herr und Gebieter. Theodoros seinerseits begegnete ihm mit Spott und Hohn und jener schleuderte ihm dafür mündlich den Bann ins Gesicht. Theodor blieb ruhig, spannte eine geladene Pistole, schlug auf den Patriarchen an und bat ganz sanft: „Bester Vater, gieb mir deinen Segen!“ David fiel auf die Kniee, stand wieder auf und ertheilte mit zitternden Händen den Segen.
Der Reisende Apel schildert den Abuna Salama folgendermaßen: „Er ist ein trauriges Bild des lasterhaften, ignoranten Zustandes der ganzen abessinischen Kirche. Stolz, unwissend, grausam, intrigant, sucht er auf jede Weise sich Gewalt und Reichthum zu erwerben. Er treibt sogar Sklavenhandel und nimmt nicht einmal Anstand, sich die Kirchengefäße anzueignen, sie nach Aegypten zu senden und dort zu verkaufen. Er ist der geschworene Feind aller Europäer.“ Der Empfang, welchen der Reisende bei diesem „Kirchenfürsten“ fand, war nichts weniger als erbaulich. Als er gefangen in Gondar eingebracht wurde, empfing ihn dort mit finsterer Miene ein Mann, der ihn italienisch anredete. Es war der Abuna. „Bist du wieder“, so begann er seine Schimpfrede, „einer von diesen vermaledeiten Ketzern, welche unsere Religion, die wir von den Heiligen Frumentius und Aedilius selbst empfangen haben, umstürzen wollen?“ Apel antwortete, daß er sich keineswegs hiermit befasse, und wurde nun weiter gefragt: „Hast du keine Bibel mitgebracht, das Volk irre zu führen und unsere heilige Kirche zu untergraben?“ Als nun der Fremdling sagte, er sei Arzt und kein Geistlicher, bemerkte der Abuna: „Ihr seid aber alle Räuber und Lügner, ihr Engländer! Ihr kommt zu uns als Werkleute verkleidet, gebt vor, euch mit der Arbeit zu beschäftigen, unterrichtet aber das ganze Volk und führt es zum Verderben.“ Schimpfreden gegen die Missionäre beschlossen den Sermon des Kirchenfürsten.
Günstiger urtheilt Heuglin von dem Manne, den er 1862 besuchte: „Er mag 45 Jahre alt sein, ist ein schöner Mann von kräftiger Statur, jedoch viel leidend und in Folge eines Katarakts auf dem linken Auge erblindet. Sein Schicksal, für Lebzeiten an dieses Land gebannt zu sein, trägt der Abuna mit mehr Humor als christlicher Ergebung. Auf die abessinische Geistlichkeit ist der Bischof sehr schlecht zu sprechen, er hält dieselbe für vollkommen unverbesserlich, auch spricht er sich unumwunden über die vielen Mängel und angestammten Krebsschäden der hiesigen Kirche aus; trotzdem ist er aber den europäischen Missionären höchst abhold und erklärt, er halte sich unter den obwaltenden Umständen für verpflichtet, jede Art von Propaganda zu unterdrücken.“ Abba Salama, der 27 Jahre über Abessinien als Kirchenfürst regierte, starb am 25. Oktober 1867.
So traurig steht es heute um den höchsten Kirchenfürsten Abessiniens, und ihn übertreffen die übrigen niedrigeren Geistlichen an Schlechtigkeit und Unwissenheit noch bedeutend. Diese sind an Rang und Würde zwar untereinander verschieden, allein außer dem Abuna hat keiner das Recht, zu ordiniren. Außer [pg 117]den Priestern und Diakonen besteht noch das Amt des kirchlichen Thürhüters und Brotbäckers. Jede Kirche hat noch ihren Aleka, dessen Geschäft darin besteht, die Geistlichen anzustellen, zu beaufsichtigen und zu besolden und die Verbindung zwischen Kirche und Staat zu vermitteln.
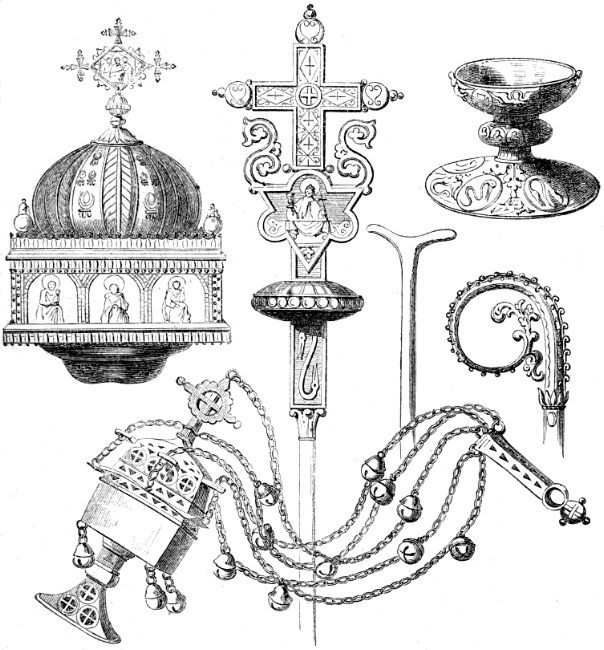
Die Kirche hat ferner diejenigen, welche sich ihrem Dienste widmen wollen, zu unterrichten. Zum Diakonenamte wird jeder ordinirt, der sich dazu meldet, wenn er nur lesen kann. Will sich darauf einer dem Priesterstande ganz widmen, so heirathet er in der Regel vorher, weil es ihm später nicht mehr erlaubt ist. [pg 118]Die Ordination ist sehr einfach: der Diakon sagt das Nicäische Glaubensbekenntniß her, bezahlt zwei Salzstücke an den Abuna, der ihm das Kruzifix entgegenhält und den Segen über ihn spricht. Unter dem Abuna Kyrillos, der vor etwa dreißig bis vierzig Jahren lebte, sollen Priester aus Kaffa nach Gondar gekommen sein und einen Ledersack mitgebracht haben, in welchen der Abuna Luft hauchen sollte, um mittels derselben diejenigen ihrer fernen Landsleute zu ordiniren, die sich dem Dienste der Kirche weihen wollten!
Die Thätigkeit der Priester besteht in täglichem drei- bis viermaligen Gottesdienst bei Tag und Nacht, wobei des Morgens früh die Priesterschaft mit Mönchen und Schülern zum Genusse des Abendmahls zusammenkommt. Außerdem fallen Taufen, Trauungen, Messelesen, Beichtehören in ihr Bereich. Der Kirchengesang ist, obgleich höchst unerbaulich, doch sehr künstlich und mit Mimik verbunden; das Studium desselben, sowie das Einlernen der langen Liturgie kostet den angehenden Priestern viele Jahre Zeit. Lächerlich erscheint uns auch die Art und Weise, wie die Priester aus ihren heiligen Büchern lesen, denn das Lesen an und für sich gilt schon als verdienstlich. Das Wort, mit dem sie dasselbe benennen, entspricht unserm „plappern“ und paßt daher gut, um das gedankenlose, überaus schnelle Lesen zu bezeichnen. Ein Priester, der seine oft ungemein lange Liturgie schnell zu Ende bringen will, liest oft mit solcher Behendigkeit, daß das Ohr in seinem Lesen die Artikulation der Stimme kaum besser unterscheiden kann, als das Auge die einzelnen Speichen eines schnell kreisenden Rades. – Was die Zahl der Sakramente betrifft, so scheinen sie nur zwei, Taufe und Abendmahl, anzunehmen. Zum letzteren bedienen sie sich gesäuerten Weizenbrotes, das von bestimmten Personen gebacken sein muß, und des Saftes ausgepreßter Weintrauben. Dieses wird im Abendmahlskelch zusammengemischt, etwas Wasser zugegossen, das Ganze geweiht und mit einem Löffel den Abendmahlsgenossen gegeben. Ihre Beichte übertrifft alles, was in dieser Art anderweitig noch vorkommt. Nach einem vorgeschriebenen Formulare (Nusasié) fragt der Priester den Beichtenden, ob er gewisse Sünden, die in einer ungeheuren Schandliste alle auseinandergesetzt sind, nicht begangen habe. Auf jeder Sünde steht nun eine vorgeschriebene kirchliche Strafe, die durch Fasten oder Bezahlung abgebüßt wird.
Diese Bezahlungen und andere zusammengebettelte Summen dienen dem Priester dazu, über Massaua und Kairo eine Wallfahrt nach Jerusalem zu machen, die überhaupt das höchste Ziel der Wünsche eines Abessiniers zu sein scheint, weil er dadurch nach seiner Rückkehr gleichsam das Recht erhält, seine wohlhabenderen Landsleute auf die unverschämteste Art um Geschenke zu bestürmen. Der Einfluß, welchen sich die Priester auf die Bevölkerung zu verschaffen wissen, ist trotz ihres offenbaren unsittlichen Lebenswandels ein außerordentlich großer. Wenn in der Hauptstadt Gondar eine Frau einem Priester ihrer Bekanntschaft auf der Straße begegnet, so küßt sie demselben ehrfurchtsvoll die innere Seite der Hand; Männer thun dies wohl auch, aber doch nicht in der Regel. Zwei sich begegnende Priester küssen zur Begrüßung einander gegenseitig [pg 119]die rechte Schulter. Schon durch die Tracht unterscheidet sich der Priester vor seinen Mitmenschen. Sie, sowie diejenigen, welche sich zur gebildeten Klasse zählen, tragen am Kinn einen kurzen Bart, rasiren sich das Haupt und umwinden es turbanartig mit einem weißen Tuche. Den Oberkörper deckt eine weiße Weste mit weiten Aermeln; außerdem haben sie weiße, weite Beinkleider, eine schmale Leibbinde und ein großes weißes Umschlagetuch mit farbigem Randstreifen. Große Schnabelschuhe vollenden den Anzug. Selten fehlt dem Priester ein Kruzifix, das die ihm begegnenden frommen Personen küssen, und ein bunter, aus Haaren verfertigter Fliegenwedel. Um den Hals tragen sie außer einer blauen Seidenschnur, ohne welche man nie einen abessinischen Christen sieht, meistens [pg 120]einen Rosenkranz, der aus Jerusalem stammt. Die Priester jeder Kirche (die normale Zahl derselben an einer Hauptkirche beträgt nicht weniger als einundzwanzig!) wohnen immer in kleinen Häusern, die sich innerhalb der Mauer befinden, welche die Kirche sammt den sie umschattenden Baumgruppen gewöhnlich umfaßt. Dieser abgeschlossene Raum wird oder wurde als ein heiliger Ort betrachtet, der gegen Plünderungen gesichert ist.

Originalzeichnung von Eduard Zander.
Auch den Bannfluch kennt die abessinische Kirche. Als Isenberg mit seinem Mitarbeiter 1843 nach Adoa kam, mußte er vor der versammelten Geistlichkeit der Stadt ein förmliches Examen über seinen Glauben ablegen. Man fragte ihn: ob er das Kreuz und die Kirche küsse? ob er an eine Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi beim Abendmahl glaube? und ob er glaube, daß die Jungfrau Maria und die Heiligen uns mit ihrer Fürbitte bei Christo vertreten? Vom protestantischen Standpunkt setzte er nun seine Ansichten lang und weitläufig auseinander, allein dieses genügte, um ihn als Ketzer erscheinen zu lassen. Kaum hatte er daher mit seinem Genossen der Versammlung den Rücken gewandt, als ein Priester feierlich über beide den Bannfluch aussprach, indem er ihre Seelen dem Satan, ihre Leiber den Hyänen, ihr Eigenthum den Dieben übergab und jeden, der ihnen nahe kommen oder sie bedienen würde, gleichfalls exkommunizirte.
Eine besondere Stellung in der abessinischen Kirche nehmen noch die Debteras ein. Debtera ist allgemeiner Gelehrtentitel, den Alle erhalten, die sich hauptsächlich mit Büchern beschäftigen, sobald sie eine gewisse Bekanntschaft mit denselben erhalten haben. Die eigentliche Bedeutung des Wortes ist nach Isenberg Zelt; es wird gebraucht von der Stiftshütte, und der zu Grunde liegende Gedanke dieses Titels ist wahrscheinlich der, daß die Gelehrten ebenso das Heilige in ihrem Lande einschließen sollen, wie es die Stiftshütte that. Ein Debtera wird nicht ordinirt; seine Beschäftigung besteht im Unterrichtertheilen, im Kopiren der heiligen Bücher auf Pergament und – wenn es nothwendig ist – im Assistiren in der Kirche. Unordinirt sind auch die Alekas, die Kirchensuperintendenten, die das Eigenthum der Kirche verwalten und die Vermittelung zwischen Geistlichkeit und Staat herstellen. Schon sehr frühzeitig widmen sich die Abessinier dem geistlichen Stande; die Kenntnisse, welche diese Studenten der Theologie zu erlangen haben, sind gering. Sie lernen die Kirchensprache, einige Geéz-Wörter, die Geheimnisse des abessinischen Gesanges und Tanzes. Das Anhauchen des Abuna und die Zahlung von zwei Salzstücken an denselben macht sie dann zu fertigen Priestern. Unsre Abbildung (S. 119) zeigt einen Studenten der Theologie aus Schoa, der in Schafpelz gekleidet ist und den Bettelstab und Bettelkorb – seine einzigen Lebensstützen – bei sich führt. Neben ihm sitzt ein Bursche aus Gondar mit einem Sonnenschirm aus Grasgeflecht (Eipras).
Die Art und Weise, wie der Gottesdienst, zumal bei großen Festen, abgehalten wird, erinnert in vieler Beziehung mehr an das heidnische Schamanenthum, als an christliche Ceremonien. Als Rüppell die Kirche von Koskam, etwa anderthalb Stunden nordwestlich von der Hauptstadt Gondar, besuchte, [pg 121]um dort dem Feste zum Andenken der Rückkehr Christi aus Aegypten beizuwohnen, fand er dieselbe außerordentlich mit Menschen angefüllt, sodaß er nur sehr schwierig einen Platz in derselben erhalten konnte. Vor dem Gebäude hatte man große Tücher von fußbreiten blauen, weißen und rothen Streifen aufgespannt, um der Menschenmenge Schutz gegen die Sonne zu gewähren. Die Aufmerksamkeit der Anwesenden war auf eine im Vordergrunde befindliche Gruppe von Priestern gerichtet, welche unter schrecklichem Geheul konvulsivische Bewegungen mit dem ganzen Körper machten und mitunter auch abwechselnd wild in die Höhe sprangen. Jeder Priester hatte in der einen Hand eine Rassel (Sanasel), in der andern einen langen krückenartigen Stab. Die Rassel hat die Form einer zweizinkigen Gabel, welche durch Querstäbchen oben geschlossen ist, und in ihr befinden sich mehrere Metallringe, welche hin und her bewegt durch ihren rasselnden Ton den singenden und tanzenden Priestern zum Taktschlagen dienen. Dieser Gebrauch muß ein sehr alter sein, denn schon unser Landsmann Christoph Fuhrer berichtet in seiner 1646 zu Nürnberg gedruckten „Reisbeschreibung in Egypten“: „Gegenüber unter den Armeniern haben die Abyssinier ihren Ort, welche gar seltsame Ceremonien halten. Wann sie Meß singen, brauchen sie wunderbarliche Instrumenta, als zwei Trummel, wie die Heerpauke, darauf sie unter dem Singen schlagen; einer hat ein Schlötterlein, welches voll Schellen hängt, daran er mit der andern Hand schlägt, daß es klingelt: ein andrer hat ein Instrument, wie es die Moren gebrauchen, einer halben Trummel gleich, auch mit Schellen behängt, die stehen beieinander, hüpfen und tanzen zugleich miteinander, singen viel Alleluja, welches lächerlich zuzusehen und zu hören ist, seynd aber dabei fromme und gottesfürchtige Leute.“ – Inmitten der Gruppe sich verzerrender Priester saß einer auf dem Boden und schlug eine große, von Silberblech gearbeitete türkische Trommel. Nachdem diese religiöse Belustigung einige Zeit gedauert hatte, hielten sämmtliche Priester innerhalb der Kirche singend einen Umzug um das die Bundeslade enthaltende Heiligthum. Zwei von ihnen trugen auf dem Kopfe sehr große Helme von Goldblech, mit getriebener Arbeit reich verziert. Dies waren die beiden Kronen, welche einst der Kaiser Joas und sein Vater, der Kaiser Jasu, bei großen Feierlichkeiten zu tragen pflegten und die später der Kirche [pg 122]geschenkt worden waren. Diese Kronen, welche von einem Griechen aus Smyrna gefertigt wurden, sind von Gold- und Silberblechen in getriebener Arbeit gemacht und mit farbigen Steinen oder Stücken Glasfluß verziert. Einige der Priester hatten eine Art Meßgewand von Brokat an, das jedoch sehr verschabt war; andere trugen Stäbe mit Bronzekreuzen und über dem vornehmsten wurde ein blauer, mit Goldfranzen besetzter Sammetschirm getragen. Die ganze Feierlichkeit entbehrte aller Ordnung und erregte in Rüppell mehr Neigung zum Lachen als religiöse Empfindung.
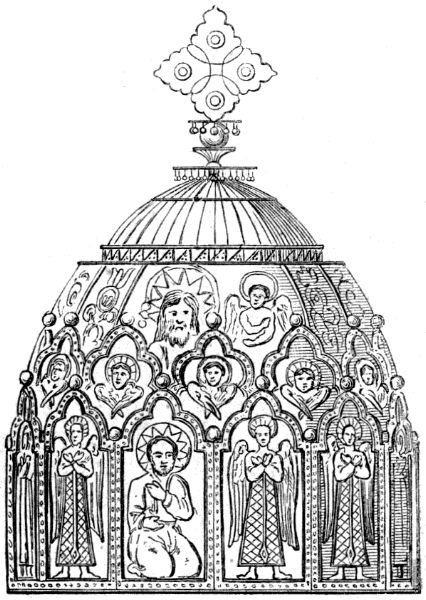
Nach Rüppell.
Neben dieser Weltgeistlichkeit, die sich mit sehr geringen Ausnahmen durch Hochmuth, Unwissenheit und lasterhaftes Leben wenig vortheilhaft auszeichnet, steht noch eine große Schar von Mönchen und Nonnen in Abessinien, die nach den uralten Regeln des Pachomius zusammen leben. Dieser, ein Schüler des heiligen Antonius, war der erste, der die Einsiedler ums Jahr 340 auf der Nilinsel Tabenna im Kloster zusammenführte und auch später das erste Nonnenkloster gründete. Seine keineswegs strengen Regeln eignen sich für die immer noch lebenslustigen abessinischen Mönche und Nonnen am besten, die aber oft genug dieselben überschreiten.
Abessinien ist überfüllt mit Mönchen und Einsiedlern, die sich in gelbe Gewänder, das Zeichen der Armuth, oder in gegerbte Antilopenfelle hüllen. Gewöhnlich führen diese Leute einen unsittlichen Lebenswandel, schwärmen durch das ganze Land und sind die Pest und Plage der Gegend, welche sie heimsuchen. Die Männer können in jeder Periode Mönche werden; die, welche mit schweren Krankheiten behaftet sind, thun das Gelübde, nach ihrer Heilung ins Kloster zu gehen, und vermachen diesem ihre ganze Habe. Reiche übergeben ihr Vermögen den Kindern, werden Mönch und lassen sich dann von ihren Erben bis ans Lebensende unterhalten; arme Mönche dagegen leben von der Gnade des Königs und der Gemeinde. Viele dieser Klostergeistlichen sehen aber niemals ihre Zellen, sondern leben gemüthlich mit Weib und Kind zu Hause und betteln auf Grund ihres gelben Gewandes oder der Agaseenhaut, die mit dem ungewaschenen Aeußern zusammen an die Legende von ihrem großen Ordensstifter Eustathius erinnert, welcher sich rühmte, niemals seinen Körper gewaschen zu haben, und wunderbarlich auf dem fettigen Mantel über die Fluten des Jordan schwamm, ohne daß ihn ein Tropfen Wasser feindlich, d. h. reinigend, berührte.
Eins der berühmtesten Klöster befindet sich auf dem Debra Damo in Tigrié, vier Stunden nordöstlich von Ade Pascha. (Siehe S. 35.) Dort oben leben gegen 300 Mönche in kleinen Hüttchen zusammen. Nach Zander’s Bericht führt kein Weg hinauf und Menschen wie Nahrung werden an der Nordseite des Felsens mit Seilen hinaufgezogen. Das Kloster ist stets auf viele Jahre hinaus mit Lebensmitteln versehen und gilt in unruhigen Zeiten als ein besonders sicherer Zufluchtsort. Oben findet man eine Quelle, die das ganze Jahr hindurch vorzügliches Trinkwasser liefert und niemals versiecht. An Handschriften und Büchern, die noch keinem europäischen Reisenden zugängig waren, ist es sehr reich. Der senkrechte Fels besteht aus Grauwacke und Sandstein, die Grundlage desselben [pg 123]ist Urthonschiefer, die Höhe über dem Meere 6800 Fuß. In früheren Zeiten galt Debra Damo als Gefängniß der jüngeren Zweige des herrschenden Geschlechts. Diese Sitte soll im Jahre 1260 durch den König Jakuno Amlak eingeführt und bis ins vorige Jahrhundert beobachtet worden sein. In Schoa vertrat die Festung Godscho dieselbe Stelle bis auf unsere Tage herab.
Zahlreiche Klosteranstalten finden sich auch in Walduba; berühmt sind noch die Klöster von Axum und Debra Libanos, wo der erwähnte Abuna Tekla Haimanot geboren wurde. Nie darf ein Frauenzimmer ein Mönchskloster betreten, allein das hält die Insassen keineswegs ab, einen liederlichen Lebenswandel zu führen. Die Nonnen zeichnen sich durch ein schwefelgelbes baumwollenes Hemd und ein Käppchen von derselben Farbe aus; sie haben alle das Keuschheitsgelübde abgelegt, befinden sich jedoch meist in vorgerückten Jahren. Wichtig werden die Klöster namentlich dadurch, daß viele derselben als politisches Asyl gelten, nach dem zur Zeit der Bürgerkriege viele Flüchtlinge sich retten. Dieser Umstand führte zu großen Mißbräuchen und gestaltete die Aufenthaltsorte der Mönche zu ewigen Sitzen der Unruhe um, zumal die Unantastbarkeit der Freistätte meistens streng eingehalten wurde, bis König Theodoros auch hier einen gewaltigen Schritt that und mit kühner Hand seine Feinde selbst aus den Asylen hervorholte.
Neben der Unsittlichkeit der Geistlichen, der frechen Simonie, der übermäßigen Bilderverehrung, dem Glauben an Weissagereien und Vorbedeutungen, der Auslegung von Träumen, Furcht vor Hexerei und bösen Künsten muß andererseits hervorgehoben werden, daß jedenfalls im Lande kein Unglauben und keine Gottesverachtung herrscht. Der Formengeist, der allen Semiten eigen ist, klebt auch den Abessiniern an, jene Wichtigmachung von Gebräuchen und äußern Werken, die Unterscheidung zwischen Rein und Unrein, die Beschneidung, das Hängen am Buchstaben. Für das Hauptübel Abessiniens aber erklärt Munzinger den Stolz, der, von dem kleinsten Erfolg aufgeblasen, sich überheilig und überweise wähnt und nur ungern von Fremden sich Raths erholt. Der Stolz, von dem kein Abessinier frei ist und eigentlich kein Semite, hat eine andere gefährliche Seite; der Messias ist ihm immer ebenso gut wie den Aposteln ein weltlicher Herr; die Herrschsucht der Eingeborenen wird dem fremden Missionär sehr gefährlich, da sie ihn, ohne daß er es ahnt, in die Landespolitik hineinzieht.
Die abessinische Zeitrechnung ist eine keineswegs christliche, da sie von der Erschaffung der Welt und nicht von der Geburt Christi an rechnen. Nach ihnen ist das Jahr 1868 das siebentausenddreihunderteinundsechzigste. Der Jahresanfang fällt auf den 10. September. Sie theilen das Jahr in zwölf Monate von je dreißig Tagen und zur Ausgleichung fügen sie denselben am Jahresschluß noch einen verkrüppelten dreizehnten Monat bei, der in drei Jahren fünf, in dem vierten aber sechs Tage hat. Im gewöhnlichen Leben und auch in ihren historischen Annalen werden die vier Jahre nach den Namen der Evangelisten bezeichnet und zwar in folgender Reihe: Johannes, Matthäus, Marcus und Lucas, [pg 124]letzteres hat am Schluß den eingeschalteten sechsten Tag des dreizehnten Monats. Es heißt oft in den Landeschroniken schlechtweg: Dieses ereignete sich in dem Jahre des Evangelisten Matthäus oder Lucas u. s. w. Die Namen der dreizehn Monate sind: Maskarem, Tekemt, Hedar, Tachsas, Ter, Jacatit, Magabit, Mijazia, Ginbot, Sene, Hamle, Nahasse, Paguemen. Kein einziger fällt natürlich ganz mit einem unserer Monate zusammen; so reicht der Maskarem vom 10. September bis 9. Oktober und so fort, bis endlich der verkrüppelte dreizehnte Monat, der Paguemen, vom 5. bis 10. September reicht. Die Abessinier setzen die Geburt Christi in das Jahr der Welt 5500; aber von dieser Periode bis zu unserer Zeit rechnen sie 7 Jahre und 122 Tage weniger als wir Europäer; die Ursache dieses Unterschieds ist die von den alexandrinischen Bischöfen befolgte Chronologie des Julius Africanus und später durch den Bischof Anatolius von Laodicea daran gemachte zehnjährige Abänderung.
Am 10. September, dem Neujahrstage, machen sich die Bewohner der Hauptstadt wie bei uns Gratulationsbesuche und die Frauen überreichen ihren Bekannten Blumensträuße, wobei sie ausrufen: „Glück bringe dir das neue Jahr“. Auch finden Tänze mit Gesang und Schmausereien statt. Das größte Fest in Abessinien feiert man jedoch am 16. Maskarem (26. September) zum Andenken an die infolge eines Traumgesichts der heiligen Helena stattgefundene Entdeckung des Kreuzes Christi. Um die Kunde dieses Ereignisses möglichst schnell nach Konstantinopel zu bringen, bediente man sich der Feuersignale, und die Versinnlichung dieses Ereignisses ist der Hauptzweck der Ceremonien des Maskalfestes. Am Vorabend lodern Freudenfeuer auf den Hügeln, Männer mit Rohrfackeln ziehen in Prozessionen auf und kriegerische Tänze werden abgehalten. Der Anblick der bronzefarbigen, halbnackten Gestalten, die in dunkler Nacht, vom Scheine der Brandfackeln beleuchtet, sich taktmäßig hin und her bewegen, ist ungemein malerisch. Die Hauptprozession findet jedoch erst am folgenden Tage statt. Dann ziehen alle waffenfähigen Männer zu Fuß oder zu Pferde nach einem nahen Hügel, auf welchem bei Sonnenaufgang ein Feuer angezündet wird. Dem Zuge voran gehen Musikanten mit Hörnern und Pauken; nachdem die Menge an dem Scheiterhaufen sich gewärmt, kehrt sie zurück, um mit Reiterspielen und kriegerischen Tänzen die Feierlichkeit zu beschließen. Der Gouverneur hält offene Tafel und ungeheuere Portionen rohen Fleisches werden verschlungen. Andere Feste sind Ledat (Weihnachten), Domkat (Taufe Christi), Fasaga (Ostern) und die verschiedenen Heiligenfeste.
Die Taufen finden in der Kirche statt und zwar bei den Knaben 40 Tage, bei den Mädchen 80 Tage nach der Geburt, weil nach der Tradition der Abessinier Adam erst 40 Tage nach der Schöpfung in das irdische Paradies eingeführt wurde und Eva ihm dahin 40 Tage später nachfolgte. Die Ceremonie selbst ist von der bei uns üblichen in vieler Hinsicht abweichend. Jedes Kind hat seinen Pathen; als Taufstein gilt eine thönerne Schüssel, deren Wasser erst beräuchert und dann mit dem Fuße des Geistlichen berührt wird, worauf dieses für geweiht gilt; Loblieder zu Ehren der Jungfrau Maria und das schnelle [pg 125]Ablesen eines Kapitels aus dem Evangelium Johannes vollenden die Vorbereitungen; dann werden die Täuflinge nach allen vier Himmelsgegenden geneigt und bis über den Kopf ins Wasser getaucht; schließlich wird dem Täuflinge eine in geweihtes Oel getauchte Schnur um den Hals gebunden und die Ceremonie ist vorüber. Vorher aber sind die Kinder beiderlei Geschlechts beschnitten worden.
Die Ehe ist in Abessinien, wo allgemeine Sittenlosigkeit und die allergrößte Freiheit im Umgang der Geschlechter herrscht, eine rein äußerliche und sehr lose. Die Trauungen werden nur selten kirchlich geschlossen, was einfach dadurch geschieht, daß die Brautleute das Abendmahl zusammen nehmen. Werden die Gatten einander untreu, so trennen sie sich einfach und haben dann das Recht, noch zweimal sich kirchlich trauen zu lassen. Da jedoch die meisten Ehen wild sind, so betrachtet man die kirchliche Trauung als Nebensache. Wie entsetzlich die Zustände in dieser Beziehung sind, geht aus der Bemerkung Isenberg’s hervor, daß er während der ganzen Zeit seines Aufenthaltes in Abessinien unter einer sehr großen Zahl kirchlich getrauter Leute kein einziges Paar kennen lernte, daß einander treu blieb. Das Gesetz, daß man sich nur dreimal trauen lassen darf, gilt jedoch nur in der Theorie. Rüppell traf zu Ategerat ein hübsches, erst siebzehnjähriges Frauenzimmer, welche bereits von sieben mit ihr ehelich vermählten Männern geschieden war und im Begriffe war, sich zum achten Male zu vermählen! Ehescheidungen sind bloße Privatangelegenheiten, welche nur dann vor die Behörden gebracht werden, wenn man in Betreff der Vermögenstheilung sich nicht miteinander verständigen kann. Sonst hat die Obrigkeit damit gar nichts zu thun, und die Ehe besteht nur so lange, als beide Theile damit zufrieden sind. Eifersucht ist in Abessinien ein unbekanntes Ding und eheliche Untreue das Gewöhnliche, besonders noch dadurch begünstigt, daß die Zahl der Frauen überwiegt. Dies mag auch ein Grund dafür sein, daß unter jenen Christen die Vielweiberei geduldet ist; aber nur die Reichen pflegen an dem nämlichen Orte mehrere Frauen zu haben, von denen jede einzelne in einem besonderen Hause wohnt. Diejenigen Abessinier, welche sich ihrer Geschäfte halber an verschiedenen Orten aufhalten, haben gewöhnlich an jedem derselben eine Frau. Im Allgemeinen benimmt sich die Frau sehr aufmerksam, dienstwillig und selbst demüthig unterwürfig gegen ihren Mann. Sie darf ihn nur als ihren Herrn und im Plural anreden, während der Gatte gegen sie das „Du“ gebraucht; sie muß ihm, wenn er es verlangt, die Füße waschen und ihm bei Tische häufig die Speisen in den Mund stopfen! Jenes Betragen der abessinischen Frauen geht jedoch nicht aus Liebe hervor, sondern ist berechnete Schmeichelei. Liebe in reinerem Sinne kennt man in jenem durch die größte Sittenverderbniß ausgezeichneten Lande gar nicht. Zum Heirathen genügt schon ein Vermögen von wenigen Thalern, ein baumwollenes Hemd für die Braut, etwas Geld für die Eltern sind die Geschenke bei Armen. Bei reichen Leuten werden große Gelage gehalten, welche mehrere Tage dauern. Gegen Ende derselben führt der Bräutigam, auf einem Maulthier reitend, die Braut scheinbar aus dem älterlichen Hause in das seinige. Die Mädchen werden in der Regel [pg 126]noch ungemein jung, zuweilen schon in ihrem neunten Jahre verheirathet; so erzählt Pearce, daß ein mehr als siebenzigjähriger Landesfürst die noch nicht zehnjährige Tochter des Kaisers heirathete!
Sieht ein Abessinier seine Todesstunde herannahen, so läßt er den Geistlichen rufen, dem er eine Beichte ablegt, um die Absolution zu empfangen. Der würdige Priester benutzt dann gewöhnlich diese Gelegenheit, um möglichst viel von dem weltlichen Gute des Sterbenden für sich und die Kirche zu erlangen, während er für das Begräbniß selbst keinen Heller nimmt. Dieses findet meistens noch am Todestage statt. Der Körper wird mit gekreuzten Armen in ein baumwollenes Tuch geschlagen, dann mit einer Lederhaut umwickelt, in der Kirche eingesegnet und in einer kleinen Grube bestattet. Nach der Beerdigung versammeln sich Freunde und Verwandte im Sterbehause, wo das Klagegeheul angestimmt und dann ein großes Mahl gehalten wird. Um tiefe Trauer wegen des Todes eines Verwandten auszudrücken, pflegt man sich das Haupthaar abzuscheren, den Kopf mit Asche zu bestreuen und die Schläfen zu zerkratzen, bis Blut fließt. Alles dieses ist jedoch blos äußerliche Heuchelei und fern von tiefgefühlter Betrübniß, denn grenzenloser Leichtsinn ist ein Hauptcharakterzug der Abessinier.
Abessinien ist reich an Kirchen, doch sind dieselben meistentheils nur klein. Viele stehen als Wallfahrtsorte in hohem Ansehen und werden von großen Scharen frommer Pilger besucht, die, oft aus weiter Ferne herziehend, häufig zugleich den bei der Kirche aufgeschlagenen Markt zu Einkäufen benutzen. So knüpfen sich auch hier die Messen an die Kirchen, wie in den meisten anderen Ländern der Erde gleichfalls. Gewöhnlich sind die Kirchen im Grundrisse rund und 20–24 Fuß hoch; viereckige gehören zu den seltenen Ausnahmen. Beinahe jede abessinische Kirche oder Kapelle hat an ihrer Façade zwei gleich große, dicht nebeneinander stehende Thüren und im Innern eine Art von großem hölzernen Sessel oder Thron, der die Bundeslade der Israeliten vorstellt. Dieser Sessel, auf welchem Brot und Wein für das Abendmahl eingesegnet werden, führt den Namen Manwer oder Tabot und ist überall in Abessinien der Gegenstand der größten Verehrung. Glocken befinden sich nur in wenigen Kirchen der größeren Städte; statt ihrer behelfen sich die Priester mit dünnen Steinplatten, die schwebend aufgehängt sind und durch deren Anschlagen die Gläubigen zusammenberufen werden. Die gewöhnlichen Kirchen auf dem Lande bestehen aus zwei Gemächern, deren Inneres beinahe ganz dunkel ist und welche durch eine Flügelthüre miteinander in Verbindung stehen. Sie sind mit einem gemeinschaftlichen kegelförmigen Strohdache überdeckt und fast immer von schönen Bäumen umgeben, welche den um die Kirche herumliegenden Friedhof beschatten, der jedoch keinerlei Grabsteine aufweist. Einige dabei befindliche kleine Hütten beherbergen die den Kirchendienst versehenden Priester. Das Ganze ist durch eine niedrige Mauer umschlossen. Wer Schuhe oder Sandalen trägt – übrigens eine Seltenheit in Abessinien – zieht dieselben beim Eingange des Kirchhofes aus. In der vorderen Abtheilung, der eigentlichen Kirche, versammeln [pg 127]sich die Leute, nachdem sie beim Eingange die mit schreckhaften kolossalen Engelsfiguren bemalten Thüren ehrfurchtsvoll geküßt haben. Gemalte Bilder werden in Abessinien verehrt, keineswegs jedoch geformte, und deshalb zeigt das abessinische Kreuz auch keinen Christusleib, weil dies nach Auffassung jener Kirche gegen das zweite Gebot verstoßen würde. Das Küssen der Kirche ist als Zeichen der Gottesverehrung üblich, sodaß der Ausdruck „die Kirche küssen“ gleichbedeutend mit unserem „in die Kirche gehen“ ist. Ueberhaupt werden alle für heilig gehaltenen Gegenstände, Kirchen, Kreuz, Bilder und Bücher geküßt. Die Eingetretenen setzen sich oder knieen auf den Boden hin. Durch die offene Flügelthür erblickt man im zweiten Gemache den Tabot, um den Priester in zerlumpten seidenen Kitteln umherstehen, jeder von ihnen hält eine brennende Wachskerze in der Hand, außerdem Schelle und Rauchfaß, die sie beim Heulen der Psalmen schwingen. Zuweilen liest einer eine kurze Phrase aus einem auf der Bundeslade liegenden Buche oder reicht den Anwesenden das Kreuz zum Küssen dar – von einer christlichen Erbauung gewahrt man jedoch bei diesen keine Spur; sie plappern zwar fortwährend mit den Lippen Gebete her, aber ihren Blicken nach zu urtheilen sind ihre Gedanken bei ganz anderen Gegenständen.
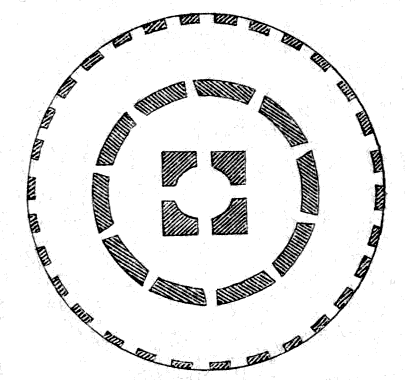
Nach E. Zander.
Besser sind die Kirchen in den großen Städten beschaffen, namentlich zu Gondar, wo es allein gegen fünfzig giebt. Die größte ist die Bada-Kirche, welche Kaiser Tekla Haimanot um das Jahr 1775 erbauen ließ. Mit ihrem hohen konischen Dache überragt sie alle anderen Gebäude der Stadt und zeichnet sich außerdem durch ein großes griechisches Kreuz von Messing auf dem Giebel aus. In ihr, sowie in anderen Kirchen Gondars zeigt man mehrere etwa fünf Fuß lange Kisten aus Sykomorenholz, welche ringsum mit Heiligenbildern und auf dem Deckel mit der Figur eines in ein Leichentuch gehüllten Menschen bemalt sind. Sie enthalten die Gebeine von Personen, welche in ganz besonderem Ansehen standen. Diese müssen jedoch erst herkömmlicher Weise fünfzig Jahre lang in der Erde geruht haben, ehe sie zu der Ehre gelangen, auf diese Art aufbewahrt zu werden. Die übrigen Kirchen sind gewöhnlich von Bogengängen umgeben, von denen aus mehrere große Thüren in das Innere führen. Wände, Thüren und Querbalken des Gebäudes sind mit Malereien bedeckt und die innere Seite der Thürgesimse mit kleinen Porzellanplatten ausgekleidet; Teppiche decken den Boden; doch Lampen sind eine seltene Erscheinung.
Vorzüglich schöne und geschmackvolle Holzschnitzereien, die, was die Arabesken betrifft, auch einem europäischen Künstler Ehre machen würden, enthält die Kirche Lalibela zu Gondar, ein Bauwerk der Fürstin Menene. Ihr Grundriß ist rund, das Dach, wie allgemein üblich, konisch und an der Spitze mit dem Kreuz geziert. Ihr Inneres besteht aus drei konzentrischen Abtheilungen. Der äußere, von Säulen getragene Kreis, ist der allgemeine Raum [pg 128]für die Kirchgänger; der zweite, mittlere Raum ist für die Abendmahlempfänger bestimmt; der innerste, viereckige, enthält die Bundeslade. Die erwähnten reichen Holzschnitzereien sind flachrelief an Thüren und Fenstern angebracht.
Wohl die berühmteste Kirche in ganz Abessinien ist jene zu Axum in Tigrié, in der ehemaligen Hauptstadt des den Griechen und Römern bekannten axumitischen Reiches. Sie liegt inmitten des politischen Asyls und wurde, wie schon ihre Bauart zeigt, unter portugiesischem Einfluß 1657 an der Stelle der 1535 von Muhamed Granjé zerstörten alten Kirche erbaut. Durch Größe, Reichthum und Heiligkeit übertrifft sie alle anderen Kirchen Tigrié’s. Auf einer mit Stufen versehenen, aus gut behauenen Quadern erbauten Terrasse schreitet man zu ihr hinauf. Vier dicke Pfeiler bilden eine Art Porticus, von welchem man durch drei Thüren in den inneren Raum gelangt. Dieser ist durch zwei Reihen plumper Pfeiler in drei Schiffe von gleicher Höhe abgetheilt, welche durch einige kleine und sehr schmale Fenster ein sehr spärliches Licht erhalten; die Decken bilden horizontal liegende Balken; die Wände sind mit geschmacklosen, stark beschädigten Malereien beklext, der Boden mit Teppichen belegt. (Rüppell fand ihn voller Schmuz.) Ein kleiner Thurm enthält eine Treppe, die zu dem flachen, mit Zinnen gekrönten Dache führt. Salt, welcher die Kirche gemessen hat, giebt ihre Länge zu 111, ihre Breite zu 51 Fuß an. In der Nähe steht ein kleines niedriges Haus, in welchem zwei sehr roh in Abessinien selbst gegossene Glocken hängen, und in einem anderen Gebäude werden die Pretiosen der Kirche, die Metallkronen, Kreuze und Manuskripte aufbewahrt. Nach der Ansicht der Abessinier ist die hier aufbewahrte Bundeslade die echte jüdische aus der Zeit des Königs Salomo, welche Menilek, der Sohn der Königin von Saba, in Jerusalem stahl und hierher brachte (vergl. S. 3). Der Name der Kirche ist Hedar Sion und ihr Hüter, der Gouverneur von Tigrié, führt den Titel Nabr Id (Hüter der Bundeslade). Die Abbildung zeigt unsere Anfangsvignette.
Die Missionen in Abessinien.
Schon bald nach Entstehung der englischen „Missionsgesellschaft für Afrika und den Osten“ wandte diese ihre Aufmerksamkeit auf Abessinien, in der Absicht, dem dortigen Christenthume frische Anregungen zuzuführen und dasselbe aus seiner Versunkenheit herauszuziehen, sowie vor dem Untergange im Muhamedanismus zu bewahren. Zu diesem Zwecke wurden nun Missionsstationen in Malta, Kairo, Smyrna u. s. w. angelegt, von denen aus man allmälig bis Abessinien vordringen wollte, und durch einen abessinischen, nach Jerusalem gepilgerten Mönch die ganze Bibel in die amharische Sprache übersetzt, welche die verbreitetste unter den abessinischen Mundarten ist. Die ersten Missionäre, welche nach Ategerat (Adigrat) in Tigrié im Jahre 1830 vordrangen, waren die beiden Deutschen Gobat und Kugler. Der Detschasmatsch Sabagadis empfing sie freundlich, indessen die politischen Verhältnisse, die immerwährenden Kriege zwischen Sabagadis und Ubié um die Herrschaft Tigrié (vergl. S. 107) waren ihrem Werke nicht günstig. Trotzdem drang Gobat bis nach der Hauptstadt Gondar [pg 129]vor, während Kugler in Tigrié zurückblieb, um bald an den Folgen einer Verwundung, welche er sich auf der Jagd zugezogen, zu sterben. Als nun zu derselben Zeit Sabagadis von Ubié geschlagen und getödtet wurde, brach auch für den wackern Gobat eine Zeit der Verfolgungen herein. Längere Zeit hielt er sich in den politischen Asylen, namentlich im Kloster Debra Damo, verborgen, mußte schließlich aber nach Aegypten fliehen. Die Erfahrungen, die er bezüglich seines Missionswerkes gemacht hatte, waren jedoch nur trauriger Art; er fand, „daß der Leichtsinn dieses Volkes nicht leicht die Wahrheit des Evangeliums auf Herz und Leben wirken läßt“. Der erste mißlungene Versuch.

In Karl Wilhelm Isenberg aus Barmen erhielt 1834 der zurückgekehrte Gobat einen treuen Freund und Unterstützer, der mit neuem Eifer das schwierige Geschäft anzugreifen begann. Nach langer Fahrt durch das Rothe Meer und dreimonatlichem Aufenthalte in Massaua kamen beide im April, begleitet von ihren Frauen, in Tigrié an, wo die Bürgerkriege immer noch fortwütheten. Ubié sicherte indessen den Missionären seinen Schutz zu, die nun mit der Verbreitung von Bibeln begannen. Gobat jedoch war infolge von Krankheit genöthigt, schon 1836 zurückzukehren und gegen den bleibenden Isenberg richtete sich nun der Haß der abessinischen Geistlichkeit, die ihren Einfluß durch seine [pg 130]Anwesenheit bedroht sah. Indessen Isenberg hielt wacker aus und fand in dem Deutschen C. H. Blumhardt einen Unterstützer in seiner aufreibenden Arbeit. Um auf die Jugend, die man zunächst im Auge hatte, besser wirken zu können, begann man mit dem Schulunterricht und baute ein großes Missionshaus in Adoa, das jedoch bald die Eifersucht und den Verdacht des Kirchenvorstehers wie des Herrschers Ubié erregte, da es für eine Festung angesehen wurde, von welcher unterirdische Gänge zum Waffen- und Truppentransport bis Massaua führen sollten! Als mit Ende des Jahres 1837 auch Ludwig Krapf aus Württemberg zu der kleinen Mission stieß, fand er schon große Schwierigkeiten, um zugelassen zu werden, und bereits im Sommer 1838 erhielten die Missionäre den Befehl, das Land wieder zu verlassen. Wie Isenberg bemerkt, geschah dieses nicht ohne Zuthun der mittlerweile gleichfalls nach Abessinien gekommenen katholischen Missionäre, namentlich Sapeto’s, dessen wir bereits oben S. 31 gedachten. Der zweite mißlungene Versuch.
Nachdem so im Norden Abessiniens keine Aussichten mehr für eine gedeihliche Wirksamkeit vorhanden schienen, beschloß man mit zäher Ausdauer im Süden, in Schoa, das Werk fortzusetzen.
Schon im Jahre 1837 kam zu den deutschen Missionären in Adoa ein Bote des Königs von Schoa, welcher einen in deutscher Sprache geschriebenen Brief überbrachte, der von Martin Bretzka, dem ehemaligen Jäger Rüppell’s, herrührte. Durch diesen ließ Sahela Selassié die Missionäre um Arznei und einen tüchtigen Mechaniker bitten, ja er verlangte, daß die Missionäre womöglich selbst zu ihm kommen möchten. Arznei wurde sofort nebst einem langen Briefe von Isenberg überschickt, ein Mechaniker aber war nicht vorhanden. In dem Schreiben fragte der Missionär, ob der König ihm sein Missionswerk in Schoa gestatten wolle. Wenn er diese Frage bejahe, würde er sammt seinem Kollegen Blumhardt kommen, sei dieses aber nicht der Fall, so müsse er von der Reise nach Schoa absehen. Da Blumhardt jedoch auf eine indische Station gesandt wurde, machten sich 1839 Krapf und Isenberg auf den Weg nach Schoa und kamen nach einer höchst beschwerlichen Reise auf einem bis dahin unbekannten Wege über Tadschurra und das Adal-Land am 6. Juni in Ankober beim Könige Sahela Selassié an, der sie mit der größten Freundschaft aufnahm und behandelte. „Hier nun gelang es unter sehr günstigen Umständen einen guten Anfang mit der Verkündigung des Evangeliums und dem Schulunterrichte zu machen.“ Da es jedoch an Büchern und Lehrmitteln fehlte, kehrte Isenberg nach freundlichem Abschiede im November 1839 nach Europa zurück, um das zur Fortführung der übernommenen Aufgabe Nöthige zu holen.
Krapf blieb nun längere Zeit allein in Schoa, fühlte sich aber wohl sehr einsam und beschloß, ehe er sein Werk weiter fortführte, seine Braut heimzuführen. Am 11. März 1842 unternahm er die äußerst gefahrvolle Reise von Ankober nach Massaua. Er hatte seine Richtung durch das nördliche Schoa und das Land der muhamedanischen Wollo-Galla genommen. Er wollte über Gondar gehen und dort die Bekanntschaft des neuen, erst ein Jahr vorher berufenen Abuna machen.
[pg 131]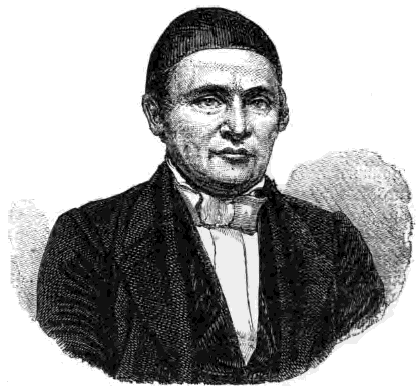
Vom Könige Sahela Selassié mit einem silbernen Schwerte beschenkt, welches ihm den Rang eines Gouverneurs ertheilte, und wohl versehen mit amharischen Bibeln, machte sich der muthige Glaubensbote, nachdem er vom Könige und der damals in Schoa weilenden britischen Gesandtschaft Abschied genommen, auf den gefahrvollen Weg. In Sella Dengai stattete er noch der einflußreichen Mutter des Königs, welche beinahe halb Schoa unabhängig beherrschte, einen Besuch ab. Sie empfing ihn, auf ihrem Lager sitzend und umgeben von Dienerinnen, sehr friedlich, ließ sich einen bunten Schal, einige Scheren, sowie ein Neues Testament in äthiopischer Sprache schenken, und entließ darauf unseren Landsmann, der in die hohen kalten Berge hinaufstieg, die sich an der Grenze der Provinzen Mans und Tegulet hinziehen. Mans ist die größte Provinz Schoa’s und wird als Gut der Königin-Witwe betrachtet; doch leben die Eingeborenen unabhängig und mit allen Nachbarn im ewigen Kampfe. Auch gegen Krapf waren sie höchst unfreundlich, der sich freute, ihr kaltes Land bald verlassen zu können. Er passirte verschiedene nach Westen fließende kleine Zuflüsse des Nil und stieg dann von den Höhen beim Dorfe Amad-Wascha in das Thal des Flusses Katscheni hinab, der die Grenze gegen die von den Wollo-Galla bewohnte Provinz Gesche ausmacht. Der Häuptling der Galla, Adara Bille, residirte damals im Distrikte Lagga Gora und stand mit Schoa in friedlichen Beziehungen; er empfing den Gast freundschaftlich und entließ ihn am nächsten Tage mit einem Führer versehen.
Am 23. März gelangte der Reisende an das Ufer des Flusses Beschlo und erstieg die Hochebene von Talanta. Hier kamen ihm zahlreiche Flüchtlinge [pg 132]entgegen, die mit Weib und Kind vor der Invasion eines Galla-Stammes davon flohen und auch Krapf veranlaßten, zu dem anscheinend freundlichen Adara Bille umzukehren, der auch noch immer die alten Sympathien für den Reisenden zu hegen schien. Als jedoch nach Verlauf von zwei Tagen das Land sich einigermaßen beruhigt hatte und Krapf seine Reise fortsetzen wollte, erklärte ihm Adara Bille, daß er ihn nach Schoa zurücksenden müsse, da er nur für einmal die Erlaubniß erhalten hätte, das Land zu verlassen. Vergebens war alles Protestiren. Man suchte Gold bei ihm, nahm ihm seine Maulthiere und Pferde und ließ ihn durch Soldaten bewachen. Als er nun trotzdem seine übrig gebliebene Habe zusammenpackte und aufzubrechen versuchte, wurde er ergriffen und in ein kleines Gemach abgeführt, wo man ihm, unter Androhung der Todesstrafe, sein ganzes Gut, sogar seinen Mantel wegnahm. Selbst die Taschen kehrte man ihm um und raubte ihm die letzten Kleinigkeiten. In diesem Zustande hielt man ihn mehrere Tage gefangen, und auf vieles Bitten gelang es ihm endlich sein Tagebuch, 3 Thaler und das schlechteste Maulthier wieder zu bekommen. Dagegen waren fünf Maulthiere, 140 Thaler, die Pistolen und Flinten, der Kompaß, die Uhr und viele andere werthvolle Dinge unwiderbringlich verloren. Gott war der einzige Trost des frommen Mannes in diesen Leiden, der nun, von sechs Soldaten begleitet, über die Grenze transportirt wurde.1
Bettelnd gelangte er in das schöne, vom Dscherado durchströmte Thal Totola, in dem ein lebhafter, aus allen Theilen Abessiniens besuchter Markt abgehalten wird. Zu beiden Seiten desselben erheben sich hohe mit Dörfern, Weilern und Wachholderbäumen bestandene Bergketten, die den gebeugten Krapf durch ihre wunderbare Schönheit entzückten. Allein die rohen Soldaten trieben ihn mit den Worten fort: „Du bist unser Vieh, wir können mit dir anfangen, was uns beliebt.“ Am Ufer des Flusses Berkona, der dem Hawasch zufließt, traf man auf einen Kaufmann, der nicht wenig erstaunt war, einen weißen Mann auf diese Art durch das Land geführt zu sehen. Dieser, in dessen Brust wol Mitleid rege wurde, ertheilte Krapf den Rath, er solle laut schreien, wenn er viele Leute in den Feldern bemerke; diese würden alsbald herbeieilen und ihn zum Gouverneur Amadié führen, der auf einem hohen Berge zu Mofa, in der Nähe des Sees Haik, residire. Krapf befolgte diese Weisung und sah sich bald von Landleuten umringt, die ihn trotz des Sträubens der Soldaten befreiten und zu Amadié führten, dem Häuptlinge der Tehulladarié-Galla. Dieser schickte die Soldaten Adara Bille’s augenblicklich zurück und ließ den geprüften Mann ruhig seine Straße ziehen. Auf mühevollem Wege wanderte Krapf nun von Station zu Station durch wilde ungastliche Völker von dem [pg 133]See Haik an der nordöstlichen Grenze von Schoa über Jedschau, Angot, Wafila, Lasta, Enderta und das östliche und nordöstliche Tigrié bettelnd bis Massaua, wo der französische Konsul de Goutin ihm die Heimreise möglich machte, die er am 4. Mai antrat. In Schoa aber befand sich keine Mission mehr. Der dritte mißlungene Versuch.
Wer jedoch glauben würde, die eifrigen Missionäre hätten sich durch solchen betrübenden Ausgang abhalten lassen, weiter zu wirken, würde arg irren. Mit einer Menge Lehrmittel, Bibelübersetzungen und Wörterbüchern versehen, preiswürdigen Zeugnissen echt deutschen Fleißes, gingen 1842 Isenberg, Krapf und Mühleisen abermals nach der Somaliküste, um über Zeyla nach Schoa vorzudringen, wo immer noch die britische Gesandtschaft unter Kapitän Harris weilte. Schon an der Küste stellten sich die größten Schwierigkeiten einem weiteren Vordringen nach Schoa entgegen und man traf auf Intriguen aller Art. Auch soll der französische Reisende Rochet seinen ganzen Einfluß bei Sahela Selassié angewandt haben, um den deutschen Männern den Eingang nach Schoa zu verschließen. (Vergl. S. 29.)
Krapf hatte einen Brief an Sahela Selassié geschrieben und angezeigt, daß er nach Ankober gehen würde. Nach der Ankunft des Schreibens wurden Versammlungen in allen Kirchen der Hauptstadt gehalten, und Deputationen der Geistlichkeit, Priester und Mönche verfügten sich geraden Weges zum Palaste, um den König anzuflehen, daß weder Krapf noch Isenberg zugelassen werden möchten. „Ihre Werke sind nicht die unserigen und ihr heiliges Buch ist verschieden von dem, was in unserem Lande als das wahre betrachtet worden ist. Erlaubt man ihnen zurückzukehren, so wird das Volk vom Glauben seiner Väter abfallen.“ Dergestalt gedrängt, entschied Sahela Selassié gegen Kapitän Harris, welcher sich für die Missionäre verwandte: „Isenberg und Krapf können nicht wieder in mein Land kommen, mein Volk will es ihnen nicht erlauben. Ich habe lange darüber nachgedacht und es ist besser, wenn sie wegbleiben; ich will keinem wieder erlauben, je wieder über den Hawasch zu kommen.“ Und dabei blieb es, die Missionäre zogen betrübt ab. Man kann sich vorstellen, wie dieses abermalige Scheitern aller Hoffnungen auf die glaubenseifrigen Priester zurückwirken mußte, welche durch ein Schreiben des Kapitän Harris von diesen Vorgängen in Schoa in Kenntniß gesetzt wurden. „Gern hätten wir unseren Augen und Ohren und ebenso dem Zeugnisse dieses Briefes nicht getraut, gern uns die Sache anders gedeutet und dargestellt; dazu fehlte uns aber alles Material, und wir mußten bei der ersten Thatsache stehen bleiben: die Mission in Schoa ist aufgehoben, sie ist nicht mehr.“ Der vierte mißlungene Versuch.
Waren dergestalt alle Aussichten im Süden benommen, so wollte man abermals das alte Feld im Norden, in Tigrié, aufsuchen und sehen, ob sich hier die Verhältnisse seit 1838 nicht etwa günstiger gestaltet hätten. Im April 1843 brachen Isenberg und Mühleisen, fortwährend große Massen von Bibeln verbreitend, von Massaua aus, die Provinz Hamasién durchziehend, nach Adoa, der [pg 134]Hauptstadt Tigrié’s, auf, wo sie ihr altes Haus zum Theil verwüstet fanden. Gleich nach ihrer Ankunft wurde die Priesterschaft und das Volk gegen sie aufgehetzt und ihre Lage gestaltete sich von allem Anfange an noch schwieriger als zuvor. Die Missionäre hatten ein förmliches theologisches Examen vor den abessinischen Geistlichen zu bestehen und wurden, als dieses nicht nach dem Wunsche der letzteren ausfiel, in Bann gethan. Auch soll der katholische Bischof de Jacobis, welcher damals in Adoa eine Mission leitete, gegen sie intriguirt haben. Isenberg reiste nun selbst in das Feldlager des Herrschers Ubié, wurde aber von diesem nicht vorgelassen, sondern mit dem Bescheid abgewiesen: „er habe die Abessinier lange genug durch Abendmahlhalten, Taufen, Trauen, Begraben in seinem Hause beleidigt, deshalb sei er früher aus dem Lande gewiesen; jetzt sei er wiedergekommen und verharre in seiner Hartnäckigkeit; er habe die Jungfrau Maria gelästert, ja, er sei soweit gegangen, daß er in den Schriften der Apostel unterrichten wolle. Er solle also in sein Land zurückkehren, denn in Tigrié dürfe er nicht bleiben.“ So mußten die Missionäre also auch jetzt wieder umkehren, und nun schien der letzte Hoffnungsstrahl vernichtet. Isenberg tröstete sich dann über das Scheitern seines Missionswerkes folgendermaßen: „Durch das ganze Land hindurch hat sich ein bestimmter Eindruck von dem Zwecke unserer Mission verbreitet, und was noch weit mehr ist, sie haben mehr als 8000 Exemplare verschiedener Theile der Heiligen Schrift in amharischer und äthiopischer Sprache, unter welchen sich eine Anzahl amharischer ganzer Bibeln befindet, erhalten, welche nun auch nicht müßig liegen, sondern gewiß eine stille Wirksamkeit auf manche ihrer Besitzer und Leser ausüben werden. Die Abessinier haben sich durch gleichgiltige Vernachlässigung und ungläubige Verachtung des Evangeliums, durch ihr starres Anhangen an ihren eingewurzelten Thorheiten und Sünden, durch ihre allgemeine Trägheit und Habsucht einer längeren Fortdauer der evangelischen Mission in ihrem Lande für unwerth erklärt, und dem Herrn hat es in seinem Wunderrathe gefallen, sie für die nächste Zukunft aufzuheben.“ Der fünfte mißlungene Versuch.
Ehe wir die ferneren Anstrengungen der protestantischen Missionäre hier schildern, die trotz Allem keineswegs gewillt waren, das unfruchtbare Feld aufzugeben, müssen wir hier die Thätigkeit der kaum minder eifrigen katholischen Glaubensboten anführen, die aber fast ebenso wenig Erfolge aufzuweisen haben, wie jene. Es ist eine betrübende Thatsache, daß überall katholische und protestantische Missionäre einander befeinden. Kaum ist ein Katholik auf irgendeinem neuen Gebiete erschienen, um für seinen Glauben Propaganda zu machen, so folgt ihm ein Protestant, macht ihm das Feld streitig und beginnt unter den braunen, schwarzen, gelben oder rothen Menschen für seine Sache zu wirken. Oder umgekehrt. Leicht wäre es, hierfür viele Beispiele anzuführen, denn in Afrika, Nordamerika, auf Madagascar, in der Südsee, überall wiederholt sich dasselbe Schauspiel, und die Eingeborenen sollen schließlich Richter sein zwischen den Lehren des Protestantismus und Katholizismus. Daß auf diese Weise die Sache nicht gefördert wird, ist nur zu natürlich. Jeder Theil schiebt indessen [pg 135]die Schuld auf den andern, und dem Unparteiischen fällt es schwer, anders zu entscheiden, als daß beide gefehlt. So auch in Abessinien.
Die katholische Kirche betrachtete das Land seit der Verjagung der Jesuiten im 17. Jahrhundert immer nur wie eine abgefallene, aber wieder zu erobernde Provinz und beschloß, auch diese Eroberung zu beginnen, kurz nachdem die Protestanten sich in Tigrié niedergelassen hatten. Der Anfang damit wurde im März 1838 gemacht, als der italienische Priester Giuseppe Sapeto zugleich mit dem Reisenden M. Abbadie in Adoa ankam. Bei Ubié stellte er sich als Eins mit den Abessiniern in der Religion dar und gewann bald Einfluß, den er, eingestandenermaßen, gegen die Ketzer Isenberg und Krapf verwandte, sodaß diese mit Recht seinem Einflusse ihre Verjagung aus Adoa zuschreiben. Sapeto besuchte nun die abessinischen Kirchen, schloß sich dem Gottesdienst an und geberdete sich in Allem als abessinischer Christ und arbeitete nicht ohne Erfolg. Er machte 22 Proselyten, die jedoch später wieder zu ihrer Landeskirche zurücktraten. Ehe er Abessinien verließ, bewog er den Etschegé, das Oberhaupt der abessinischen Mönche, einen Brief an den Papst zu schreiben, dessen Primat als Nachfolger Petri die Abessinier im Allgemeinen anerkennen, ohne ihm jedoch eine Macht über ihre Kirche einzuräumen. Die verschiedenen Sendungen der französischen Regierung trugen ohnehin dazu bei, das Werk der römischen Mission in Adoa zu fördern, und so entschloß sich denn der Papst, mit noch größerem Nachdrucke aufzutreten. Der Pater de Jacobis, ein Piemontese von Geburt und früher Beichtvater der Königin von Neapel, ein durch große Kenntnisse und geistige Gaben ausgezeichneter Mann, ging mit sechs Gefährten nach Adoa, wo er bei Ubié zu bedeutendem Einflusse gelangte und von diesem mit der Gesandtschaft betraut wurde, welche 1841 den neuen Abuna Abba Salama abholen sollte. Während de Jacobis weiter nach Rom ging, wo er einige junge Abessinier als „Gesandte des Königs von Aethiopien an den Papst“ vorstellte, agitirte der junge Abuna hinter seinem Rücken und griff zu allen möglichen Mitteln, um die katholischen Proselyten wieder zur Landeskirche zurückzubringen, was ihm auch gelang, sodaß Jacobis nach seiner Rückkehr in Adoa sich darauf beschränken mußte, seiner zahlreichen Dienerschaft im Missionshause Gottesdienst zu halten. Wie der Abuna über den katholischen Missionär dachte, sieht man aus einem Schreiben, welches er 1843 an Isenberg kurz vor dessen Abgang richtete und in welchem es heißt: „Wenn Sie selbst den „Jakob“ vertreiben können und dann in Ruhe hier bleiben, so wird Alles gut gehen; wenn Sie das aber nicht können, so werde ich auch ihm nicht erlauben, in unserm Lande zu bleiben. Wenn ich ihn aber vertreibe, so werden wir verhaßt werden, und man wird sagen, ich sei ein Freund der Engländer. Wenn Sie mir aber sagen, ich solle ihn vertreiben, so will ich ihn vertreiben.“ Die Katholiken hatten eine lange Zeit in Abessinien wirken können, denn erst im Frühjahr 1855, als Theodor über seinen Gegner Ubié siegte, wurden sie von ersterem, dem es an der Einheit der Staatskirche lag, verjagt. Justin de Jacobis sollte Anfangs getödtet werden, allein Theodoros ließ sich durch den Abuna bestimmen, ihn einfach über die [pg 136]Grenze zu weisen und mit 100 Stockstreichen zu bedrohen, wenn er wieder nach Habesch kommen sollte. Theodoros hielt sich zu diesem Schritte berechtigt, so lange der Papst in Rom anders lehrende Priester in seinem Gebiete und seiner Kirche nicht dulde und weil er neben seinem eigenen Papste (dem Abuna) einen fremden nicht zulassen könne. Die Anhänger der römisch-katholischen Kirche mußten zum abessinischen Glauben zurückkehren, und so war die siebzehnjährige Thätigkeit derselben mit einem Schlage vernichtet. Jacobis zog sich nach dem Grenzorte Halai zurück, wo er am 31. Juli 1860 starb. Indessen sollen noch mehrere Gemeinden in Okulekusai und das Hirtenvolk der Irop zu den eifrigen Anhängern der katholischen Mission zählen. Auch in der Provinz Agamié und Bogos (zu Keren) waren Jesuiten angesessen, und mehr als 30 eingeborene Priester, die für das Land sehr gebildet sind, breiteten den Glauben um so eifriger aus, da sie als Landeskinder nicht das Mißtrauen, das jeden Fremden empfängt, zu bekämpfen hatten. Die Kirchen wurden fleißiger besucht, die Ehen regelmäßiger geschlossen und das Volk darum schon eher für den Katholizismus gewonnen, weil die Jesuiten namentlich den Mariendienst stark kultivirten, der den Abessiniern zusagt. Allein gegen die Feindschaft Theodor’s und des Abuna konnten auch die Katholiken nicht aufkommen, und ihre Mission hatte ein Ende. Der sechste mißlungene Versuch.
Zu derselben Zeit nun, als die Katholiken aus Abessinien vertrieben wurden und dort die großen politischen Umwälzungen stattfanden, welche Theodor ans Ruder brachten, beschloß Bischof Gobat die protestantische Mission, die in Tigrié seit 1838 unterbrochen war, abermals zu erneuern und sandte zu diesem Zwecke Ludwig Krapf, den unermüdlichen Kämpfer, und Martin Flad, gleich jenem ein Württemberger, im Dezember 1854 nach Abessinien. Die Sendboten landeten am 20. Februar 1855 zu Massaua. Hier traf nun bald der flüchtige de Jacobis ein, dessen Stelle zu besetzen die protestantischen Missionäre sich schleunig anschickten. Alles stand für sie günstig; sie brachen ins Innere auf und fanden den König im Lager in der Nähe von Debra Tabor, der sich ungemein freundlich gegen die Missionäre benahm. Daß er die Protestanten schützen, die Katholiken aber keineswegs dulden wolle, war eine angenehme Nachricht für Krapf, der sofort seine Geschenke auspackte. Diese bestanden in einem ägyptischen Teppich, einem Revolver, einem silbernen Becher, einem Taschentuch, auf dem eine Flaggenkarte abgedruckt war, und aus einer Bibel in amharischer Sprache. Das Taschentuch freute den König sehr, und als er bemerkte, daß die Flagge von Jerusalem nicht in der Mitte stehe, fragte er nach der Ursache. Krapf theilte nun dem Könige mit, daß Bischof Gobat ihm eine Anzahl christlicher Handwerker, Büchsenmacher, Schmiede u. s. w. schicken wolle. Dieser Plan fand günstige Aufnahme, um so mehr als der König bereits die Absicht hatte, nach Deutschland, England und Frankreich zu schreiben, um sich von dort Arbeiter kommen zu lassen. Die Freiheit der Religion wurde diesen Leuten ausdrücklich gewährleistet, eine Missionsthätigkeit unter den christlichen Abessiniern ihnen jedoch nicht gestattet. Krapf und Flad zogen hierauf über Wochni, Metemmé [pg 137]und Sennar, den Nil abwärts nach Europa, wo sie Bericht über ihre Reise erstatteten. Schon im April 1856 gingen denn unter Flad’s Leitung mehrere Laienbrüder aus dem Chrischona-Institute bei Basel nach Abessinien. Sie wurden Anfangs gut aufgenommen und zu Dschenda bei Gondar und Gafat bei Debra Tabor angesiedelt. Ihre spätere Wirksamkeit fällt indessen mit der politischen Geschichte des Königs Theodoros zusammen, weshalb wir hier darauf verzichten, sie zu schildern. Wohl waren sie als Handwerker thätig, indessen konnten sie für die Ausbreitung des Protestantismus so gut wie gar nichts thun, und ihre Anwesenheit in Abessinien bezeichnet den siebenten mißlungenen Missionsversuch. Gleich ihnen waren auch die etwas später eintreffenden Judenmissionäre Stern und Rosenthal unglücklich, deren Beginnen als der achte mißglückte Versuch hier angeführt werden muß.
Wohl ist das Missionswerk ein preiswürdiges, wohl verdienen jene Männer wegen ihres Eifers, ihrer unermüdlichen Ausdauer unser Lob. Allein von Mißgriffen waren die wenigsten frei und das stete Einmischen in die politischen Verhältnisse des Landes ein arger Fehler. Auch ist ihr Blick selten vorurtheilsfrei den gegebenen Verhältnissen gegenüber gewesen und leere Hoffnungen traten stets an die Stelle wirklicher Erfolge. Reisende, die ungetrübten Blickes Land und Leute kennen lernten, waren deshalb auch ferne von den gleichen argen Täuschungen und stellten mit seltener Einmüthigkeit das Erfolglose der Missionsbestrebungen in Abessinien dar. Allein ihre klaren, für uns unumstößlichen Anschauungen und Beweise haben für die Missionäre nicht die geringste Geltung, die beim Buchstaben der Schrift stehen bleiben. Doch halten wir mit dem eigenen Urtheile zurück und lassen wir die Aussprüche einiger der bewährtesten Reisenden über die Missionen in Abessinien folgen.
Werner Munzinger ist mit der Handwerkermission, insofern dieselbe einfach Bildung verbreiten hilft, einverstanden. „Abessinien aber protestantisch machen zu wollen, fährt er fort, das wäre ein Beginnen, so radikal allem Hergebrachten ins Gesicht schlagend, daß die Leute, denen man plötzlich ihren frommen Glauben und besonders die Verehrung der Mutter Gottes rauben wollte, von allem Christenthum abwendig würden. Das rücksichtslose Abreißen würde sie so stutzig und verwirrt machen, daß sie das Kind mit dem Bade ausschütten und den Glauben allen zusammen, sogar an Gott, wegwerfen würden, und mit der Verkündigung einer Religion, die keine Verwandtschaft mit dem hat, was bis jetzt für schönes goldenes Christenthum galt, wird allein ein krasser, gedankenloser Unglaube gepflanzt, der dem Volke den moralischen Halt nimmt, den ihm sein alter Glaube verliehen hatte. Wo aber ein Volk einmal den Glauben der Apostel rein bewahrt zu haben glaubt, da darf man des Systemes halber nicht in ein Extrem fallen; man muß nur das Mögliche versuchen, nur das Mögliche ist gut.“
Weit unumwundener spricht sich Alfred Brehm aus. Er schreibt: „Die [pg 138]Bemühungen der Missionäre sind zeitweilig von großen Erfolgen gekrönt gewesen. Zeitweilig, sage ich, das heißt, so lange die Mission Geschenke der verschiedensten Art, namentlich Schnaps und Wein, zu verabreichen hatte. Je mehr aber der Vorrath an diesen beliebten Getränken abnahm, um so lauer wurden auch die Christen, und in den Zeiten der Dürre benahmen sie sich regelmäßig so, als wären sie niemals Christen gewesen. Es geht hier eben wie fast überall, wo christliche Missionäre wirken: sie gewinnen in kurzer Zeit eine Menge Leute, welche sich dazu verstehen, einige Gebräuche des Christenthums nachzuäffen! Daß man sich in der Lehre, wie in der Ausübung auf Aeußerlichkeiten beschränkt, versteht sich ganz von selbst. – – Es verdient endlich einmal gesagt zu werden, daß die christlichen Missionen in Afrika in Glaubenssachen eben nichts anderes bewirken, als überspannten oder glaubenskranken Europäern eine gewisse Genugthuung zu geben.“
Der klar blickende Baker, welcher in Galabat mit ein paar von den Chrischona-Missionären zusammentraf, unter denen sich ein Grobschmied befand, machte ihnen bemerklich, daß daheim in Europa ein sehr großes Feld für die Missionsthätigkeit offen liege und daß es sicherer und besser sei, dieses zu bebauen. „Ich konnte aber den Grobschmied, dessen Kopf so hart wie sein Amboß war, nicht überzeugen. Er hatte sich vollständig eingeredet, daß das Wort Gottes der Hammer sei, mit dem er, seinem Handwerk entsprechend, seine Ansichten von der Wahrheit den Leuten in die dicken Schädel treiben müsse. Ich rieth ihm wieder zu seinem Handwerk zu greifen, das ihm mehr Respekt verschaffen werde als sein Predigen. Er antwortete, das Wort Gottes müsse in allen Ländern gepredigt werden; der Apostel Paulus sei auch Gefahren und Schwierigkeiten begegnet, aber er habe nichtsdestoweniger gepredigt und die Heiden bekehrt. So oft ich einem übermäßig unwissenden Missionär begegnet bin, hat er sich immer mit dem Apostel Paulus verglichen.“
Endlich urtheilt der fromme und religiöse Zander, hart aber wahr, folgendermaßen: „Alle abessinischen Missionen, die bisher hier waren, haben ihre Aufgabe durchaus falsch angegriffen, indem sie sich an die Erwachsenen wandten. Das Volk könnte nur einzig und allein dadurch gehoben werden, daß man sich der Kinder von früh auf sorgfältig annähme und sie gut erzöge. Eine Mission, die sich ungehindert dieser Aufgabe hingeben würde, könnte unendlichen Segen und Nutzen stiften, allerdings nicht für die Gegenwart, wohl aber für die Zukunft. Doch die bisherigen Leiter aller Missionen sammt ihren Gehülfen waren rein unfähig, eine solche Aufgabe zu vollführen, und die Missionshäupter wurden stets von Eitelkeit, Hochmuth und grenzenloser Selbstsucht regiert. Sie schütteten stets das Kind mit dem Bade aus.“
Diese vorurtheilsfreien Stimmen, neben welchen leicht noch viele ähnlich lautende Aussprüche angeführt werden könnten, mögen zur Bildung eines Urtheils über das abessinische Missionswesen genügen.
Der Ackerbau und die Viehzucht Abessiniens.
Die Kulturfläche Abessiniens. – Die Getreidearten, ihre Anpflanzung und Verwendung. – Gewürze, Gemüse, Wein, Baumwolle, Gescho. – Ernteertrag. – Nuk. – Einfelderwirthschaft. – Ackerwerkzeuge. – Regenzeit. – Bewässerung. – Soziale Stellung der Landleute. – Die Viehzucht. – Die Regierung und der Grundbesitz. – Das Frohnwesen. – Steuern. – Wiesen und Moorgrund. – Bienenzucht. – Aussicht für europäische Ansiedelungen. – Die Wohnungen der Landleute. – Die Mühlen Abessiniens.
Abessinien besitzt sehr viel Land, welches sich vortrefflich zum Anbau eignet; jedoch kann man mit Sicherheit annehmen, daß von allem kultivirbaren Boden kaum die Hälfte benutzt wird, sodaß ungefähr von der gesammten Bodenoberfläche kaum ein Drittel bebaut erscheint.
[pg 140]Die zwischen 8000 und 10,000 Fuß über dem Meere gelegenen Hochländer, wie Semién, die Wasserscheide des Rothen Meeres und Nilgebietes, Begemeder, das Innere von Godscham, namentlich die Gebirge um die Quellen des Blauen Nil, Sebit, Woadla, Daunt, Talanta, Lasta, Jedschu Wollo und Schoa sind meist eben und abwechselnd mit sanften Hügeln und Höhen bedeckt, die eine zwei bis acht Fuß mächtige, sich nie erschöpfende Humusdecke tragen. In allen diesen Ländern wird, manchmal bis zu 11,000 Fuß hinaufreichend, die vierreihige Gerste kultivirt, während die zweireihige nur zwischen 7000 und 8000 Fuß Meereshöhe angebaut wird. Die verschiedenen Arten des Weizens, unter denen die Eidscha genannte die vorzüglichste ist, gedeihen nur zwischen 8000 und 9000 Fuß; in derselben Höhe kommt der Flachs am besten fort, obwol er bis zu 6000 Fuß hinabgeht. Die Flachsbereitung zu Webereien kennt der Abessinier nicht; er baut das nützliche Gewächs nur, um aus den Samen zur Fastenzeit ein Lieblingsgericht herzustellen. Die Bereitung desselben ist sehr einfach. Man röstet zunächst die Samen in einem flachen Tiegel über Feuer, doch nicht zu stark, und zerstößt sie hierauf in einem hölzernen Mörser sehr fein. So zubereitet läßt sich die gestoßene Masse in Kugeln formen und für lange Zeit aufbewahren. Um aus diesen ein Leingericht herzustellen, werden einige Kugeln in Wasser zu einer dicken Suppe zerrührt, und in diese taucht der Abessinier seine gesäuerten, dünn gebackenen Brote. Für weitere Reisen ist diese Speise außerordentlich praktisch, ja fast unschätzbar; ich selbst habe mich derselben häufig bedient und kann nur sagen, daß sie eine wohlschmeckende ist. Linsen und Saubohnen gehen bis zu einer Höhe von mehr als 9000 Fuß. Als Gemüse werden in dieser Höhe angebaut: Kohl, Senf und Knoblauch.
Zwischen 6000 und 8000 Fuß Meereshöhe finden wir auch ganz vortreffliche zum Ackerbau geeignete Landschaften: Hamasién und Serawié mit durchgängig urbarem Boden, liegen 7000–7500 Fuß über dem Meere; die Distrikte Dixan, Adigrat, Schumnesanié, Hausién, Faresmai, Adoa, Okulekusai, Adiarwate, Schirié, Tembién, Axum, Auker, Enderta u. s. w., die zu Tigrié gerechnet werden, und von Amhara: Bellesa, das niedere Woggera, ganz Dembea, das niedere Begemeder, Dakussa, Halefa, das niedere Lasta u. s. w. In den genannten Ländern auf einer Höhe von 7000 bis herab zu 5500 Fuß gedeihen vorzüglich folgende Getreidearten: Tiéf, das werthvollste und wohlschmeckendste Korn, von dem viele Abarten gebaut werden; Mais oder Maschilla, der gleichfalls in verschiedenen Varietäten vorkommt; Dakuscha, die besonders zur Bierbereitung dient; Nuk, dessen Samen ein vortreffliches Speiseöl liefert und der in großer Menge angebaut wird. Schimbera, eine Wickenart; Erbsenarten; Saubohnen; als Gemüse gelten: viele Melonensorten, spanischer Pfeffer, Zwiebeln, Kohl u. s. w.
Von 5000 Fuß bis zu 3000 Fuß über dem Meere werden noch besonders Mais und Dakuscha gebaut, die dort vorzüglich gedeihen. Dann Schimbera, spanischer Pfeffer und besonders Melonen. Auch kommt die Baumwolle gut fort.
[pg 141]Nach diesem flüchtigen Umriß, der nur dazu dient, die Kulturpflanzen nach der Höhe ihres Standpunktes und Vorkommens über dem Meere anzuführen, gehe ich ausführlicher auf deren Nutzbarkeit und Anwendung, deren Ertrag und Preis, sowie auf Saatzeit und Ernte einer jeden ein.
Gerste kommt zwei- und vierzeilig vor; letztere wird zwischen 8000 und 11,000 Fuß angebaut; da sie gegen Kälte und rauhe Witterung nicht so empfindlich ist wie die erstere, läßt sich ihre Kultur mit mehr Gewinn betreiben. Allein sie hat sehr dicke Hülsen und deshalb geben die Körner nicht viel Mehl, nämlich 16 Metzen Gerste nur 10 Metzen Mehl. Wenn, wie gewöhnlich, im März und April einiger Regen gefallen ist, findet die Aussaat statt. Ende Juni folgt dann eine – meist mißrathende – Nachsaat. Jedoch ist die Aussaat nicht überall gleichzeitig. So säet man im Hochlande von Wollo die Gerste fast zu jeder Zeit. Gewöhnlich fällt die Ernte Mitte Oktober bis Ende November; auf den Höhen über 11,000 Fuß aber in den Dezember. Unregelmäßige Aussaaten und Ernten sind von der Lage und Höhe des Feldes abhängig. Die gewonnene Gerste wird zur Bierbereitung und zum Brotbacken benutzt. Die Gerstenbrote sind 2–3 Linien dicke, anderthalb Fuß im Durchmesser haltende runde Kuchen. Der Teig zu denselben wird sehr dünnflüssig angestellt, einer zwölfstündigen Gährung überlassen und ist dann sofort zum Backen geeignet. Die flüssige Masse wird in eine flache, thönerne Schüssel gegossen, mit der Hand gleichmäßig vertheilt, mit einem gewölbten Deckel überdeckt und in einer Minute über freiem Feuer gar gebacken. Diese Art der Bereitung von gesäuertem Brote wird bei allen Getreidearten ohne Ausnahme angewandt.
Zur Bierbrauerei wird die Gerste ohne vorheriges Malzen schwach braun geröstet, dann grob gemahlen, das erhaltene Mehl in einen großen thönernen Krug geschüttet und unter stetem Umarbeiten so viel Wasser zugegossen, bis das Ganze in einen nicht zu dicken Brei verwandelt worden ist. Nun wird auf folgende Art die eigentliche Würze bereitet. Man quellt Gerste in einem Thonkruge 24 Stunden lang, schüttet das Wasser davon ab und schichtet das gequollene Getreide in einem spitzen Haufen auf, den man mit Gras oder Laub dicht zudeckt und mit Steinen beschwert. Dieser bleibt so lange in Ruhe, bis die Gerste 2–3 Zoll lange Keime getrieben hat; dann trocknet man diese schnell und bewahrt sie auf. Dieses Malz wird zur Bierbereitung nun auf folgende Art verwendet. Man nimmt auf 32 Metzen geröstetes Gerstenmehl ½ Metze Malz, das vorher zu Mehl zerrieben und, mit 3 Metzen geröstetem Gerstenmehl vermischt, zu Teig angerührt ist. Diese Masse läßt man kurze Zeit gähren und bäckt aus dem so erhaltenen Teige dünne brotartige Kuchen, die am Feuer hart getrocknet und in kleine Stückchen zerbröckelt werden. Die Quantität derselben und das geröstete Gerstenmehl stehen in einem genauen Verhältnisse. Die gemischte Masse wird in ein trichterförmiges Pferdehaarsieb, das auf einem Thonkruge steht, gestellt, dann Wasser darüber gegossen und nun unter fortwährendem Wasserzugießen so lange durchgerührt, bis aller Mehlstoff, mit Zurücklassung der Hülsen, in den Krug geflossen ist. Nach [pg 142]vier bis sechs Stunden tritt in dem mit Wasser noch verdünnten Inhalte des Kruges Gährung ein und das Bier ist zum Trinken fertig. Biere von anderen Getreidearten, wie Dakuscha oder Mais, werden auf dieselbe Weise bereitet. In Thonkrügen, deren Deckel mit Lehm und frischem Kuhmist verstrichen sind, hält sich das Gebräu oft geraume Zeit.
Der Weizen wird zwischen 7000 und 9000 Fuß über dem Meere angebaut. Die Saatzeit fällt mit jener der Gerste zusammen; die Ernte ist etwas später. Wie schon bemerkt wurde, kultivirt man verschiedene Sorten. Die gewöhnliche Benutzung des Weizens ist zur Bereitung von Hampascha-Brot, dessen Teig mit Bierhefe angestellt, dick und steif ausgewirkt und zu Broten von 1½ Zoll Dicke, aber beliebiger Größe, verbacken wird.
Dakuscha (Eleusine) wird zwischen 3500 und 6500 Fuß gebaut, ist aber besonders in den Höhen zwischen 4000 und 5000 Fuß sehr ergiebig. Dieses Getreide dient vorzüglich zur Bier-, weniger zur Brotbereitung; verbäckt man es jedoch, so sind die warmen Kuchen sehr wohlschmeckend und nährend. Die Saatzeit fällt Anfang März; die Ernte in den November und Dezember. Es giebt schwarze und weiße Dakuscha.
Tiéf oder Tef (Eragrostis), zwischen 5500 und 7500 Fuß gebaut, ist das beliebteste, in einer Menge Arten vorkommende Getreide Abessiniens und das aus diesem bereitete Brot das allerwohlschmeckendste im Lande, besonders das rein weiße. Die Saatzeit richtet sich nach den verschiedenen Sorten. Sie fällt von April bis Mitte Juni und danach die Ernte von Ende September bis Anfang November.
Mais oder Maschilla, in verschiedenen Sorten gebaut zwischen 3000 und 7000 Fuß, gedeiht am besten zwischen 3000 und 5000 Fuß, wo er oft zwei- und dreihundertfältigen Ertrag liefert. Man verwendet ihn zum Brotbacken und zur Bierbereitung. Die Aussaat beginnt im April, die Ernte fällt – je nach Sorte und Standort – in den November und Dezember; in Woro Haimano gar schon zu Anfang Oktober.
Schimbera (Lathyrus), eine Wickenart, zwischen 4000 und 7000 Fuß angebaut, wird vorzüglich zu Schiro, einem Lieblingsgerichte der Abessinier, verwendet. Man röstet hierzu die Samen, enthülst sie auf der Mühle, setzt spanischen Pfeffer, geröstete Zwiebeln und Salz zu und mahlt die ganze Masse zu Pulver. In siedendes Wasser nach und nach eingerührt, mit Schmalzbutter oder Oel gefettet, bildet es ein gutes Gericht. Auch backt man aus dem Mehle ungesäuerte Kuchen, die als Reiseprovision geschätzt sind. Die Saat beginnt gleich nach der Regenzeit – da die Pflanze trockene Luft und Sonne liebt – also Anfang September. Wo die Felder naß und sumpfig sind, beginnt die Aussaat erst im Oktober oder gar im November. Die Ernte erfolgt drei Monate später. Man unterscheidet eine weiße und eine gelbe Schimbera.
Zwei Arten Saubohnen und eine Erbse werden wie die vorige verwendet. Man baut sie zwischen 6000 und 9000 Fuß, sät zu Anfang Juli und erntet im Oktober.
[pg 143]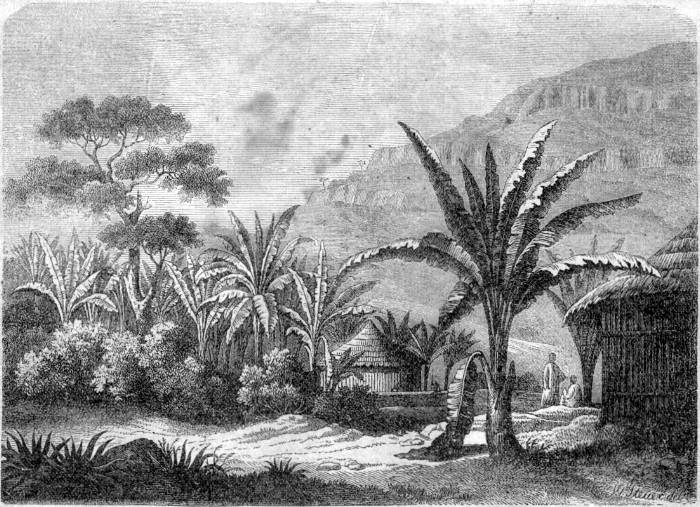
Die Linse kultivirt man zwischen 6000 und 9500 Fuß. Die Saat derselben erfolgt Anfang Juli, die Ernte Anfang Oktober. Gewöhnlich enthülst man die Linsen auf der Mühle, kocht sie, würzt sie mit Pfeffer, Salz und Butter und genießt sie auf diese Weise. Wo sie aber, wie in Woadla und Daunt, viel gebaut wird, bäckt man auch gesäuertes Brot daraus, das allerdings nicht sonderlich gut ist. Eiwisch, eine Bohnen- oder Kleeart, zwischen 6000 und 7000 Fuß, wird im August gesät und im Dezember geerntet. Die abgekochten und fein zerriebenen, dann so lange umgerührten Samen, bis sie einen kleisterartigen Brei liefern, der mit Knoblauch und Pfeffer gewürzt wird, sind die beliebteste Fastendelikatesse der Abessinier. Atunkere, eine Schlingbohne, zwischen 5000 und 6500 Fuß gebaut, im April gesät, Anfang November geerntet, wird wie die Linsen gegessen.
Der rothe oder spanische Pfeffer ist das hauptsächlichste und beliebteste Gewürz der Abessinier, das diesen so unentbehrlich geworden ist, daß sie es handvollweise den Speisen beimischen. Die abgekochten, aber fortwährend feuchtgehaltenen Früchte werden auf der Mühle zu feinem Pulver zerrieben, dann eine gleiche Quantität gerösteter, feingemahlener Zwiebeln zugesetzt, einige wohlriechende, pulverisirte Pflanzen und Salz beigemischt und die so bereitete Würze aufbewahrt. Manchmal reibt man den Pfeffer auch nur mit Salz und Wasser ab. Man baut den Pfeffer zwischen 4000 und 6500 Fuß und bewässert ihn wohl; in Dembea wird er ohne Bewässerung gezogen und Ende Oktober geerntet. Andere Gewürze sind Sinjewil, eine beliebte, dem Pfeffer beigemischte Kalmuswurzel; gleich dieser benutzt man noch Adees, eine Rubiacee, die Samen der Awoseda, einer Umbellifere, und Schenadam, eine Labiate. Die Samen des Föto, welches unserer Gartenkresse gleicht, werden gleichfalls gegessen; jene des Schuf, einer Compositee, wie Schiro zubereitet. Dinnitsch ist ein Convolvulus, dessen den Kartoffeln ähnliche Wurzelknollen eine wohlschmeckende Speise liefern.
Zu den Gemüsen übergehend, erwähne ich zunächst zwei sehr beliebte, wie unser Raps aussehende Kohlarten, deren Blätter wie Spinat gekocht werden. Im Tiefland gedeiht der Kohl nur in der Regenzeit bis zu Anfang Oktober; im Hochland aber bis zu 10,000 Fuß grünt er das ganze Jahr hindurch. Der reichliche, ölige Samen wird nur zur Aussaat und zum Einreiben der Backschüsseln benutzt, damit sich das Brot gut löse. Das einzige Gemüse, auf dessen Anbau die Abessinier neben dem rothen Pfeffer noch Fleiß verwenden, sind verschiedene Melonenarten, die nicht roh, wohl aber gekocht genossen werden. Die Samen legt man Anfang April; fehlen dann die Regen, so müssen die jungen Pflänzchen bis zum Eintritt der Regenzeit bewässert werden. Die Früchte beginnen Anfang September zu reifen. In einigen Gegenden baut man auch vortreffliche Gurken (Wuschisch). Das Gewürz Bello, eine Solanumart, dessen Samen ähnlich wie der rothe Pfeffer benutzt werden, kultivirt man besonders in Walduba bis zu 6000 Fuß Höhe. Man bedient sich seiner namentlich in den 60tägigen Osterfasten.
[pg 145]In der gleichen Zeit bildet auch der Knoblauch, der zwischen 7000 und 8500 Fuß häufig gebaut wird, einen beträchtlichen Handelsartikel. Er wird dann stark gegessen, und man sieht sehr oft, wie der Abessinier ganze Hände voll der rohen Zwiebeln hinabwürgt. Es kann nichts Unangenehmeres geben als die Berührung mit einem Knoblauchsfresser, dessen stinkender Athem unerträglich ist. Die Reife des Knoblauchs beginnt im Januar und Februar. Mit dem Ausgange der Regenzeit pflanzt man eine kleine, rothe, längliche Zwiebel; sie wird bewässert und reift zugleich mit dem Knoblauch. Ihre Verbreitungsregion ist zwischen 5500 und 8000 Fuß; der Handel damit sehr bedeutend.
Die Banane oder Mus (Musa paradisiaca) wird zwischen 5000 und 6500 Fuß kultivirt. Höher hinauf bis zu 7500 Fuß kommt eine zweite ihr ganz ähnliche Art, die Henset, vor. Ihre kleinen Früchte sind aber nicht eßbar, dagegen liefern der fleischige Stamm und die starken Blattrippen im gekochten Zustande eine nahrhafte, wohlschmeckende, den Kartoffeln ähnliche Speise. Diese Riesenpflanze liefert in manchen Gegenden die Hauptnahrung der Bewohner. Sie wird angebaut von 5500 bis zu 8000 Fuß über dem Meere.
Der Wein kommt zwischen 5000 und 7500 Fuß über dem Meere vor, ist aber nur sehr wenig in Abessinien verbreitet, doch von ganz vortrefflichem Geschmack; ja, ich kann behaupten, daß, wenn man denselben mit europäischer Umsicht, Geschicklichkeit und Pflege behandelte, er seines Gleichen nicht finden würde. Doch der Abessinier kennt weder Pflege noch Wartung des edlen Gewächses, dessen Verschneiden ihm ein unbekanntes Ding ist; er überläßt die Rebe ganz sich selbst. Aber es giebt ungemein viel Strecken im Lande, die unter verständigen Händen sich ganz vorzüglich zur Weinkultur eignen würden. Man baut nur eine Sorte mit großen, blaubeerigen Trauben, die je nach Stand und Ort von Anfang März bis Mitte April reifen. (Vergl. S. 57.)
Citronen, Pomeranzen, Pfirsiche gedeihen im verwilderten Zustande sehr gut, sind aber wenig verbreitet. Eine Citronensorte, Trunki genannt, erreicht die Größe eines Menschenkopfes; ihr angenehm schmeckendes Fleisch ist sehr beliebt. Hier und da finden sich auch saure Granatäpfel.
Die Baumwolle wird nicht in dem Maße gebaut, um die Bedürfnisse des Volkes decken zu können. Abermals ein trauriger Beweis von der Unbetriebsamkeit und dem Unfleiße der Abessinier! Und doch fehlt es nicht an geeigneten Ländereien. Man könnte sehr leicht den achten Theil Abessiniens mit der nützlichen Pflanze bestellen – leider überläßt man denselben lieber den wilden Bestien als Tummelplatz. Zwischen 3000 und 5000 Fuß gedeiht eine vorzügliche Qualität, und dabei bezieht man Baumwolle aus fremden Ländern!
Rauchtabak wird im Lande selbst gebaut und fabrizirt; Schnupftabak dagegen, den man nicht zu bereiten versteht, von Massaua bezogen. Die Summe, welche jährlich aus Abessinien nach Massaua wandert, ist sehr groß, und welchen Ersatz hat das Land für das viele ihm entgehende Geld? Antwort: keinen.
Die Blätter des Geschobaumes, die einen nicht unbeträchtlichen Handelsartikel bilden, vertreten in Abessinien die Stelle des Hopfens und werden [pg 146]beim Bierbrauen und bei der Herstellung des Honigweines benutzt. Letzteren bereitet man auf folgende Art. Auf ein Maß Honig giebt man fünf Maß Wasser, spült das Wachs aus und gießt die dünne Honigflüssigkeit in einen wohlgereinigten, sechs Maß fassenden Krug. Man fügt eine Hand voll Geschoblätter hinzu und läßt das Ganze bei mäßiger Wärme vier bis fünf Tage gähren. Nun ist der Wein fertig – allein trinken darf ihn nicht Jedermann, da er königliches Monopol ist und der Herrscher den Genuß desselben nur seinen vorzüglichsten Dienern und den Fremden gestattet.
Da der Abessinier weder Lust noch Liebe zur Arbeit und Thätigkeit hat, so läßt er all den genannten Kulturpflanzen nur wenig Pflege und Wartung angedeihen; seine Felder, seine Anpflanzungen gleichen fast immer einer Wildniß. Liebe, Sinn für die Natur und ihre Schönheiten sind ihm unbekannt; wie sein Feld, so ist auch sein Sinn und Herz stets eine Wildniß.
Folgendes sind die durchschnittlichen Ernteergebnisse, jedoch ist dabei zu bemerken, daß der Ertrag der Mais- und Dakuscha-Arten in den tiefer gelegenen Ländern am Mareb, Takazzié und Nil nicht als Norm anzunehmen ist, da hier der Ertrag, je nach der Bodengüte, oft drei- und vierhundertfältig ausfällt. Je ein Scheffel Tiéf giebt 30, Mais 150, Weizen 10, Dakuscha 20, Lein 24, Gerste 12, Linsen 6, Saubohnen 10, Schimbera 8 und Nuk 40 Scheffel Ernteerträgniß im Durchschnitt.
Nur eine einzige Oelfrucht, Nuk (Guizotia olifera) wird zwischen 5000 und 7000 Fuß angebaut. Die Aussaat beginnt mit dem Eintritte der Regenzeit zu Anfang Juli und 1 Scheffel liefert 30–40 Scheffel Ertrag. Das Nuköl ist sehr wohlschmeckend und dient in der Fastenzeit statt der dann verbotenen Butter. Um das Oel zu gewinnen, werden die Samen zuerst schwach geröstet, fein gestampft und unter Wasserzusatz bei stetem Umrühren unter Beibehaltung einer Wärme von etwa 50° R. über dem Feuer erhalten. Alsdann scheidet sich das Oel aus, von dem die Samen etwa 35 Prozent enthalten.
Der Abessinier hat durchschnittlich eine Einfelderwirthschaft und nur hier und da Zweifelderwirthschaft. Er düngt nicht, obgleich er den Nutzen der Felderdüngung sehr gut kennt. Allein seine Unlust zur Arbeit und sonstigen Thätigkeit, seine Stellung zur Regierung sind für ihn Hindernisse, die er niemals zu überwinden vermag. Diese Indolenz wird vorzüglich durch die Größe und durch den Reichthum seines Landbesitzes genährt, denn schon wenn der vierte Theil der Felder bestellt ist, sind die Lebensbedürfnisse des Besitzers gesichert. Gewöhnlich liegt der dritte Theil brach; wo der Boden sehr humusreich ist, bestellt man jedoch nur die Hälfte. Man muß die traurigen Zustände mit eigenen Augen gesehen haben, um einen Begriff von Brachfeldern zu erhalten, die drei Jahre, ohne vom Pfluge berührt zu werden, wüst liegen!
Ein solches „Ackerfeld“ gleicht gewissermaßen einer gut aufkeimenden Waldung, denn die wilde Vegetation wuchert in Abessinien ungemein schnell; [pg 147]man scheut auch das Ausroden der Strünke und Wurzeln und begnügt sich damit, die Baumstämme 1–2 Fuß über dem Boden abzuhauen. So sieht man die Felder mit großen und kleinen, oft Jahrhunderte alten Stämmen und Wurzeln bedeckt. Und nun erst die Steine, die groß und klein, oft so dicht, daß man kaum den Boden erkennt, über den Acker zerstreut liegen! Nicht einmal den kleinsten Stein entschließt sich der Abessinier auf die Seite zu schaffen. Wie viel gutes Ackerfeld geht also auch hierdurch verloren!
Naht die Zeit heran, daß diese Ackerwüste bestellt werden soll, so sendet der Eigenthümer oder Bauer seinen Knecht dorthin; hat er Lust dazu, so geht er auch wol selbst auf das Feld. Dort angelangt, besteht die einzige Arbeit darin, das aufgewucherte Gestrüpp, Strauchwerk und Holz niederzuhauen. Dies geschieht gewöhnlich gleich nach der Ernte im November, Dezember, Januar, und von dieser Periode bis zur Bestellzeit hat das abgehauene Reisig Zeit auszutrocknen; alsdann wird es in Brand gesetzt. Leicht und oft ereignet es sich nun hierbei, daß auch die benachbarten Wildnisse Feuer fangen und ein großer Brand über viele Meilen Landes sich verwüstend erstreckt. Die von dem verbrannten Holzwerk zurückgebliebene Asche macht die einzige Düngung des Landes aus. Stellen sich dann die ersten Regengüsse ein, so wird der Pflug angesetzt und der Boden hintereinander zweimal umgepflügt, einmal der Länge und einmal der Breite nach. Die Saat wird schon vorher ausgestreut und mit untergepflügt; eine nachherige Aussaat kennt der Abessinier nur bei Tiéf und Dakuscha, bei welchen die Hände der Weiber und Kinder dann das Geschäft des Eggens besorgen. Da, wo bei herrschender Zweifelderwirthschaft die Felder von Holz und Gestrüpp frei sind, werden dieselben zweimal gepflügt; einmal gleich nach der Regenzeit und das zweite Mal bei der Aussaat. In den Hochländern, wo Holzwuchs und Gestrüpp seltener, ja in vielen Gegenden gar nicht anzutreffen ist, hat der Bauer leichteres Spiel, namentlich beim Gerstenbau.
Das einzige Ackerwerkzeug ist der Pflug, aber was für ein Pflug! Ist die Umackerung und Einsaat vollendet, so gleicht die ehemalige Wüste einem Felde, das von einer Herde Schweine durchwühlt wurde. Lange Furchen zieht der Abessinier nicht; schon nach 20–30 Schritten lenkt er wieder um, vollendet so ein gewisses Stück und beginnt da, wo er abgesetzt, von Neuem. Man stelle sich vor, wie viel von dem bereits fertig gepflügten Lande von den Zugthieren wieder zertreten wird. Letztere sind Ochsen, die in einem gemeinschaftlichen Joche gehen und nur durch die Stimme oder Peitsche des Pflügers gelenkt werden. Da sie zügellos sind, so wenden sie sich bald rechts, bald links und ziehen demgemäß krumme Furchen.2 Egge und Walze sind in Abessinien unbekannte Dinge. Tritt nun die eigentliche Regenzeit ein, dann grünt das Feld lustig von Unkräutern und Schmarotzerungethümen, die von den Frauen und Kindern ausgejätet werden müssen.
[pg 148]Im Hochlande, namentlich auf den Plateaux, trifft man dagegen, weil auf diesen Punkten das Gestrüpp mangelt, ungeachtet des unbehülflichen Pfluges trefflich kultivirte und gereinigte Felder an.
Tritt die Erntezeit ein, so wird alles Getreide mit gezähnten Sicheln geschnitten und zwar nur eine Spanne lang unter der Aehre. Sensen sind in Abessinien unbekannt. Der Strohverlust kümmert den Abessinier nicht; er bindet das Getreide auch nicht in Garben, sondern wirft es auf Haufen, die an Ort und Stelle mit langen Stöcken ausgedroschen oder von Ochsen ausgetreten werden. Nachdem das meiste Stroh entfernt, reinigt man das Getreide durch Emporwerfen mittels hölzerner Gabeln; der Wind vertritt Wurfschippe und Sieb, doch bedient man sich in einzelnen Gegenden auch hölzerner Schaufeln. Um die mühsame Reinigung von 6–8 Scheffeln Getreide zu vollenden, braucht ein Mann einen ganzen Tag. Scheunen giebt es nicht und selbige sind auch weniger nothwendig, da nach Schluß der Regenzeit kein Regen mehr eintritt.
Die eigentliche Regenzeit beginnt nach europäischer Zeitrechnung am 24. Juni, nach abessinischer am 1. Juli und endigt mit dem 8. September. Während dieser Periode regnet es alltäglich im Tieflande. Vormittags herrscht meistens Sonnenschein, Nachmittags treten starke Regengüsse, begleitet von heftigen Gewittern unter Donner und Blitz ein; die Nächte sind heiter. Im Hochlande dagegen sind die Regen feiner, wie unsere Landregen, und ihr Eintreten ist sehr unregelmäßig. Bald regnet es früh, bald Mittags, bald Abends, oft die ganze Nacht oder den ganzen Tag ohne Aufhören hindurch. Gewitter sind im Juli selten, im August häufiger, besonders zu Ausgang der Regenzeit. Auf den Höhen zwischen 12,000 und 14,000 Fuß fällt gewöhnlich ein feiner Hagel; allein, wenn die Sonne einige Vormittage geschienen, so verschwindet derselbe bald wieder. Stellt sich, was gewöhnlich der Fall ist, in den Monaten Dezember, Januar, Februar einiger Regen ein, so schneit es im Hochlande. Auch das Tiefland kennt in der Regenzeit starken Hagel und ich sah daselbst Schloßen von der Größe eines Taubeneies.
Ist eine Ackerwüste nur einigermaßen fruchtbar, so erzielt man von Tiéf in zwei Jahren zwei Ernten, da dieses Getreide mit geringem Boden vorlieb nimmt. Außer der Regenzeit wendet man beim Getreidebau auch die Felderbewässerung an, doch sind nur wenige und mangelhafte Wasserleitungen vorhanden. Würden durch vaterländischen Fleiß, Geschicklichkeit und Verstand diese Wasserleitungen vermehrt und verbessert, was ohne bedeutende Kosten leicht geschehen könnte, welch unberechenbarer Nutzen ließe sich alsdann erzielen! Die Höhen zwischen 8000 und 11,000 Fuß eignen sich indessen für die Bewässerung nicht, da die Nächte in den Monaten Dezember bis März so kalt sind, daß das Wasser gefriert.
[pg 149]
Die Hauptursache der Unlust und Unthätigkeit der Abessinier zu jeder ackerbautreibenden Beschäftigung liegt in ihrer Stellung zur Regierung. Diese läßt es sich auch nicht im Geringsten angelegen sein, den Bauer zur Arbeit aufzumuntern, anzutreiben oder zu unterstützen. Der Regierung ist es vollkommen [pg 150]gleichgiltig, ob die Leute Ackerbau treiben und wie sie denselben treiben. Das Regiment war stets ein despotisches; erzielt der Bauer viel, so nimmt die Regierung viel, erntet er wenig, so nimmt sie trotzdem auch viel. Hierzu gesellen sich andere Lasten: stete Einquartierung und Frohndienste aller Art. In einer unbestimmten, willkürlichen Anzahl von Frohntagen muß der Landmann die Aecker der Regierung und der hohen Beamten bestellen; er muß Baufrohnen leisten, wenn ein hoher Herr bauen will, und dazu das nöthige Holz oft viele Tagereisen weit auf dem Rücken herbeischleppen. Es kommt vor, daß hundert Menschen an einem einzigen großen Balken tragen müssen. Man bedenke dabei aber, welche Wege zu überschreiten, welche Abgründe zu passiren, welche Höhen zu erklimmen sind! Gestrüpp, Dornen, Steine, Alles hindert den Transport. Gebahnte Wege und Straßen besitzt das Land nicht. Außer dem Holze muß der Bauer noch Steine, Stroh, Mörtel, Wasser und was sonst von Nöthen zum Bau herbeischaffen.
Eine Hauptlast, die schwer auf dem Volke drückt, ist der Adel. Es giebt einen niederen, Mosseso, und einen höheren, Mokunnen, genannt. An sie schließen sich drückend an die Dienerschaft des Regenten, die Heerführer, alle aus der Adelsklasse, endlich die Räthe und Minister. Alle diese Menschen sind nicht von der Regierung besoldet. Der Herrscher giebt ihnen, je nach Rang und Stellung, Ländereien, von denen sie gesetzliche Steuern zu beziehen haben; allein sie alle, groß und klein, erlauben sich Ausschreitungen und Bedrückungen, gegen die der Bauer wol klagt, doch die Klagen gelangen nicht an den Thron. Oft wird der Landmann von diesen liebenswürdigen Leuten bis auf die Haut ausgeplündert. Derjenige, welcher vom Herrscher mit einem Lande belehnt wird, ist unbeschränkter Herr über alle Bewohner desselben und die Gerichtsbarkeit liegt ganz in seinen Händen; diese weiß er vortrefflich in seinem Nutzen auszubeuten, und nur in halsnothpeinlichen Sachen ist der Regent Richter. Willkürlich darf der Lehnsherr keine Steuern erheben, von denen der Regent übrigens ein Drittheil zu beziehen hat. Erhebt nun der Regent seine Steuerquote, so kann jener in demselben Maße die seinigen einziehen. Sie bestehen in Geld, Getreide, Baumwollenzeug, Vieh, Butter, Honig, Pfeffer, Salz und Zwiebeln. Auch außerordentliche Steuern kennt Abessinien.
Werfen wir noch einen Blick auf die innere Wirthschaft des Abessiniers, die der äußeren vollkommen gleicht und Sorglosigkeit sowie Faulheit erkennen läßt. Betrachten wir zunächst den Viehstand. Man züchtet Pferde, Maulthiere, Esel, Rindvieh, Ziegen, Schafe, Hühner. Die Pferde und Maulthiere sind die einzigen Thiere, welche sich einiger Pflege zu erfreuen haben. Erstere sind kurz und gedrungen, doch meist von gut proportionirter Gestalt, kräftig und feurig. Der Preis eines guten Pferdes beträgt 40–50 Maria-Theresia-Thaler. Die Maulthiere sind stark, gedrungen, ausdauernd und in dem wildzerklüfteten, weg- und steglosen Lande für den Reisenden von sehr großem Nutzen; auch weiß der Abessinier die Vorzüge des Maulthieres vor dem Pferde wohl zu schätzen. Der Preis eines sehr guten Exemplares steigt oft bis zu [pg 151]100 Maria-Theresia-Thalern, während man geringere mit 10–25 Thalern bezahlt. Die Pferde werden eigentlich nur für die Kavallerie verwendet.
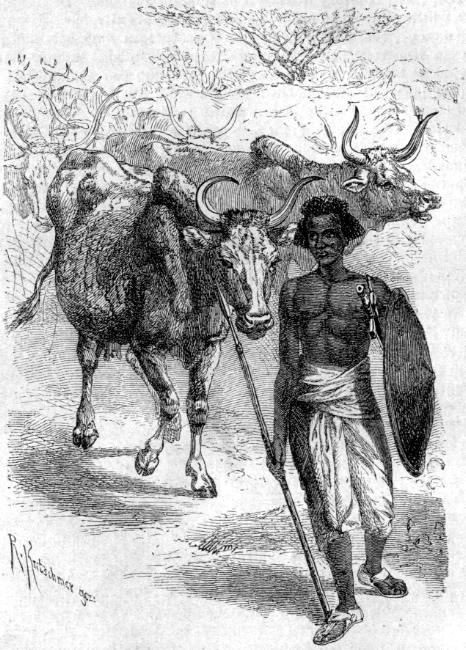
Der Esel gilt dem Abessinier als unreines Thier. Er erfreut sich weder der Pflege noch der Zucht und doch ist sein Nutzen als Lastträger ein ausgedehnter und bedeutender. Das Los des armen Geschöpfes ist ein recht beklagenswerthes, namentlich jenes der Kaufmanns-Esel, die oft 20 Tagereisen weit [pg 152]ohne Unterbrechung von früh bis Abends schwere Lasten schleppen müssen. Abends hat das Thier dann noch selbst für seine Nahrung zu sorgen. Der Preis ist gering, nämlich nur 2–3 Thaler.
Rindvieh kommt in großer Menge vor. Die Ochsen werden im gemeinsamen Joche vor dem Pfluge in den steinigen Feldern abgequält und erhalten für die mühsame Arbeit keinerlei Dank. Futterkräuter baut der Abessinier nicht, die Thiere sind gleich dem Esel gezwungen, selbst ihre Nahrung zu suchen, oder in der langen, trockenen Jahreszeit allein auf Stroh angewiesen. Im Allgemeinen geben die Kühe durch ihre Milch wenig Nutzen. Nur während der Regenzeit, wo Nahrung in Hülle und Fülle emporkeimt, fließt diese Quelle reichlicher; aber vom März bis oft in den Juni ist der Milchertrag äußerst gering, zumal die abessinische Kuh überhaupt keine gute Milchkuh ist. Und doch eignet sich das Land ganz vortrefflich zum Anbau der Futterkräuter, die dort nicht den schädlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind wie in meinem Vaterlande. Der Abessinier besitzt weder die nöthigen Kenntnisse noch die nöthigen Gefäße, um sein unvollkommenes Molkenwesen verbessern zu können; die Käsebereitung ist ihm ganz fremd. Indem man die Kälber ein ganzes Jahr und darüber säugen läßt, wird auch viele Milch nutzlos vergeudet; um aber das Kalb nach vier- oder sechswöchentlichem Säugen absetzen zu können, fehlt es wieder an Nahrung für dasselbe. Zur Sonnenzeit, in den Monaten November bis Juni, ist das Vieh von früh bis Abend den glühenden Strahlen ausgesetzt und leidet darunter sehr; auch das trägt dazu bei, die Rindviehzucht auf einer niedrigen Stufe zu erhalten. Trotzdem sind die Preise der Thiere nach unseren Begriffen niedrig. Ein guter Zugochse gilt 3 Maria-Theresia-Thaler; eine neumilchende Kuh nebst Kalb 3–4 Maria-Theresia-Thaler; eine Kuh zum Schlachten, je nachdem sie fett oder mager, 2–3 Maria-Theresia-Thaler. Das Rindvieh wird jeden Tag von früh bis Abend auf die Weide getrieben und dort meist von kleinen Knaben gehütet, die durchaus nicht darauf Acht geben, ob eine Kuh besprungen wird; so ereignet es sich häufig, daß trächtige Kühe geschlachtet werden; ja, ich habe gesehen, daß man Kühe geschlachtet hat, die nach zwei oder drei Tagen geworfen haben würden.
Von Ziegen und Schafen haben die Abessinier nur den Nutzen, welchen deren Fleisch und Felle liefern. Nur in den Hochländern kommt das Schaf gut fort, es gedeiht in den tiefen und heißen Gegenden nicht. Auf den Plateaux dagegen finden sich Tagereisen lange Hutungen, die einzig zur Schafzucht benutzt werden können. Die Wolle des abessinischen Schafes ist noch gröber als jene der lüneburger Heidschnucken; sie ist meistens schwarz, wird in einigen Gegenden gesponnen, gewebt und zu Kleidungsstücken verwendet. Nicht im Geringsten kümmert sich der Abessinier um die Veredelung der Schafzucht, er wählt keine Böcke und Mütter aus und läßt diese, nebst den Lämmern stets beisammen. Das Hämmeln der Böcke ist unbekannt; Pferde, außer den Gestüthengsten, Bullen und Ziegenböcke werden dagegen verschnitten. Wie die Schafe wild beisammen leben, so auch die Esel, das Rindvieh, die Ziegen. Der Preis der [pg 153]Schafe, je nach Größe und Qualität, beträgt für 6–8 Stück 1 Maria-Theresia-Thaler. Ihr Fleisch ist wohlschmeckend. Ziegen erhält man für denselben Preis nur 4–6 Stück, und zwei große und fette, verschnittene Ziegenböcke kosten auch 1 Maria-Theresia-Thaler. Aus ihren Häuten bereitet man Getreidesäcke ohne Naht, auch Pergament, das jedoch meist aus Schafleder gemacht wird. Rauh gegerbt dienen letztere auch als Kleidungsstücke.
Die Zucht der ägyptischen Hühner ist sehr im Schwange. Ein Huhn brütet jährlich fünf- bis sechsmal 15–17, also im günstigsten Falle 100 Eier aus. Anderes Geflügel, wie Gänse, Enten, Tauben u. s. w. ist unbekannt. Brächte man sie jedoch hierher, so würden sie besser gedeihen als in meinem Vaterlande. Der Preis für drei bis vier Hühner ist 1 Stück Salz oder für 90–100 Stück 1 Maria-Theresia-Thaler. Das Kapaunen der Hähne, wiewol von einigen Abessiniern verstanden, wird selten ausgeübt.
Der Abessinier ist fester Grundbesitzer, und die Regierung kann über den Grundbesitz ihrer Unterthanen nicht willkürlich verfügen oder denselben nach Gutdünken an sich ziehen, es sei denn durch rechtskräftigen Spruch. Dieser letztere kann nur dann eintreten, wenn der Eigenthümer kinderlos oder ohne Verwandte, nähere oder fernere, stirbt. Dann zieht die Regierung die Ländereien des Verstorbenen für ewige Zeiten an sich. Zeitweilig wird die Regierung Besitzerin eines Grundstückes, wenn dessen Eigenthümer die darauf lastenden Abgaben und Steuern nicht zu entrichten vermag. Sie behält dieselben so lange, bis diese bezahlt sind, oder übergiebt sie unterdessen einem anderen Wirthschafter, der die schuldige Summe vorstreckt, doch nur so lange, bis der rechtmäßige Eigenthümer wieder zahlungsfähig ist und die vollständigen Steuern entrichtet. Oft übernimmt die Gemeinde dieses Geschäft; Verkauf der Ländereien findet selten statt.
Hier wäre wohl der Ort, einige Worte über Ansiedelungen vom Vaterlande aus nach Abessinien einzuschalten. Unter der gegenwärtigen Regierung können dieselben niemals stattfinden. Der Auswanderer, er komme woher er wolle, kann wol hier in Abessinien Grundstücke käuflich erwerben, doch vermag er niemals sichere Garantie für deren dauernden Besitz zu erhalten, denn alle Regierungen des Landes waren bis zum heutigen Tage Willkürherrschaften. Beim Regierungswechsel ist der Ansiedler sicher zu Grunde gerichtet, am gewissesten dann, wenn er das Land von einem Einwohner kaufte, dessen Verwandte ihm seinen Erwerb bei der neuen Regierung streitig machen können. Dann stellt sich gewöhnlich heraus, daß der Verkäufer nur zeitweiliger Besitzer der Ländereien war, und das abessinische Recht giebt unter solchen Umständen den Verwandten das Land zurück. Etwas besser ist der Ansiedler daran, wenn er von der Regierung ein Grundstück erwirbt und den Kaufabschluß unter Zuziehung von Zeugen in das Kirchenbuch eintragen läßt. Aber wie lange ihm das Land gesichert bleibt, weiß Gott allein!
[pg 154]Gesetz und Gerechtigkeit waren in Abessinien nur dem Namen nach vorhanden. Doch die gegenwärtige Regierung des vortrefflichen Kaisers Theodoros läßt schöne Hoffnungen in meinem Herzen wach werden. Der liebe Gott wolle stets über meinem Kaiser, welchen ich von ganzer Seele lieb habe, seinen reichen Segen und Frieden walten lassen. Amen!
Zum Schluß noch einige Worte über Wiesen und Moorgrund Abessiniens. Besonders die Hochländer Semién und Woggera zeichnen sich durch schönen und reichen Wiesengrund aus. Dembea, ein Tiefland, hat am Tana-See unübersehbare Wiesenflächen, Begemeder im Hoch- und Tieflande; Sebit besteht ganz aus Wiesen; ähnlich verhält es sich mit Woadla, Daunt und Talanta. Am Fuße des Kollogebirges in Wollo ziehen sich gleichfalls große Wiesenflächen hin. Schoa, Lasta und Godscham sind stellenweise reich daran. Vergleichsweise mit diesen Hochländern sind die Tiefländer arm an Wiesenwuchs; doch ist ihr Gras nahrhafter und saftiger. Das Heumachen ist ein den Abessiniern unbekanntes Ding, auch besitzen sie keinerlei Werkzeuge zum Mähen der Wiesen. Steht im September das Gras hoch, so wird alles Hausvieh auf die Weide getrieben, die meistens zertreten wird und höchstens zwei Monate ausreicht. Sind so die reichen Weiden zerstört, so tritt bittere Noth und Hunger für den Viehstand ein, ohne daß die Menschen dadurch zum Nachdenken veranlaßt würden.
Auf fast allen Wiesen findet sich viel Moorgrund und Sumpf, die durch vaterländischen Fleiß und Geschicklichkeit leicht in Reisgefilde umgeschaffen werden könnten. Jetzt liegen sie alle wüst und nutzlos da. Vor allem wären die Moorgründe am Tanasee hierzu passend; sie könnten eine Quelle des Reichthums für das Land sein. Auch eine gute und verständige Bienenzucht würde bedeutenden Nutzen abwerfen, denn kein Land eignet sich so vortrefflich zu derselben als Abessinien. Die Art und Weise, wie sie bisher von den Eingeborenen betrieben wird, gleicht genau dem liederlichen Verfahren im Ackerbau; trotzdem wird viel Honig und Wachs gewonnen; letzteres wird meist ausgeführt, ersterer zu Honigwein benutzt. Die abessinische Biene ist kleiner als unsere europäische Art. Schwärmt ein Stock, oder wird der junge Schwarm ausgetrieben, so fliegt dieser oft drei bis vier Tage weit, bis die Königin in einem hohlen Baume oder einer Felsenhöhle einen passenden Ort zur Niederlassung ausfindig gemacht hat.
Hat der Zug seine Auswanderungsreise angetreten, so geht derselbe viele Stunden weit rasch vorwärts, bis Müdigkeit der Königin eintritt, die sich an irgendeiner Stelle niederläßt, welche dann als Rastepunkt der Schar bis zum nächsten Tage gilt, wo die Reise fortgesetzt wird, bis eine Behausung gefunden ist. Will der Abessinier einen solchen Schwarm in einen Stock oder Korb einschlagen, so muß er zunächst der Königin die Flügel verschneiden; unterläßt er dieses, so geht der Schwarm gewöhnlich wieder fort. Ich habe selbst den Versuch gemacht und einen solchen Schwarm dreimal eingesetzt; allein nach ein- bis [pg 155]dreitägigem Aufenthalte ging er stets wieder fort, weil ich der Königin die Flügel nicht verschnitten hatte. Die Form der Bienenstöcke ist walzenförmig; sie werden aus Rohrstäben zusammengesetzt, die man äußerlich mit frischem Kuhmist, dem etwas Lehm zugesetzt ist, einen halben Zoll dick überzieht. Häufig hängt man diese Körbe in große Bäume, doch halten die meisten Abessinier dieselben bei ihren Häusern. Die Bienenzucht wird in einer Meereshöhe von 5000–9000 Fuß betrieben. Der Preis für 50 Pfund Honig ist 1 Maria-Theresia-Thaler.
Vermöge der Verschiedenartigkeit seines Klimas dürfte sich Abessinien zum Anbau aller europäischen Kulturpflanzen eignen, die unter vaterländischer Geschicklichkeit herrlich gedeihen würden. Reis ist unbekannt, Kaffee wird so gut wie gar nicht und noch dazu recht ungeschickt angebaut; stark kultivirt wird er in den Gallaländern Limu, Enarea und Kaffa, und die von dort stammenden Sorten sind besser als der arabische Kaffee aus Mocha. 40 Pfund Kaffee gelten in Abessinien 1 Maria-Theresia-Thaler. Schwarzer Pfeffer, Baumwolle, Indigo könnten vorzüglich gebaut werden; einige Arten Indigo wachsen wild. Für Zuckerrohr und Runkelrüben findet sich geeigneter Boden. Ich selbst habe in Tigrié Runkelrüben kultivirt, die eine bedeutende Größe erreichten und viel zuckerhaltiger als die vaterländischen waren. Alle Gewürze der Gewürzinseln und die verschiedensten Oelpflanzen würden gedeihen; Oelgewinnung und die dazu nothwendigen Geräthe sind hier unbekannt. Desgleichen fehlt guter Hanf und Flachs zum Spinnen und Weben. Beeren, Früchte, Wein – sie alle finden hier zusagenden Boden.
Doch mit Schmerz muß ich bekennen, daß alles dieses, so lange der gegenwärtige Zustand des Landes dauert, so lange nicht eine radikal veränderte Regierungsweise eintritt, eitler Wunsch bleiben wird. Denn erst, wenn die Regierung eine unbeschränkte Kultivirung des Landes durch Deutsche, Engländer, Franzosen u. s. w. zuläßt und unterstützt, kann aus diesem etwas werden. Durch die Abessinier selbst kann eine nutzbringende Kultur niemals geschaffen werden, denn sie sind bitter arm; es fehlen ihnen alle Instrumente, welche den Anbau fördern könnten, oder die Arbeiter, die sie zu verfertigen verständen. Auch ist ihr geistiges Besitzthum arm, dürftig, auf niederer Stufe stehend; sie sind entblößt von allen guten Eigenschaften, Liebe und Lust zur Arbeit, Sinn für die Natur.
Ließe sich das Vaterland den gegenwärtigen Zustand Abessiniens angelegen sein, setzte dasselbe kräftige, wirksame und heilsame Hebel an den gegenwärtig verwahrlosten Agrikulturzustand Abessiniens, so würde reicher Segen seine Mühen und Opfer lohnen. Doch wie Hebel anlegen, daß sie nicht brechen? Oder will das Vaterland feste Gerechtsame in Abessinien erwerben, so können diese nur durch Waffengewalt aufrecht erhalten werden.
Wie der Zustand der Felder und des Viehstandes, so ist auch die Behausung des Abessiniers und deren Umgebung beschaffen. In und außer seinem Hause oder vielmehr seiner Strohhütte, ist alles voller Schmuz und Unrath. [pg 156]In der Regenzeit gleichen die Wohnungen einer Kloake, der man sich nicht nähern kann, ohne Gefahr zu laufen, in diesen Mistsümpfen zu versinken. Um eine Wohnung zu errichten, haut der Eingeborene krumme und gerade, dünne und dicke Holzstangen ab, die er in einem Kreise in den Boden pflanzt und wobei er einen schmalen Raum für die Eingangsthür freiläßt. Die Stangen werden nun mit Bast und dünnen Ruthen gleichwie mit Faßreifen umwunden und die Zwischenräume mit Reisig ausgefüllt. Im Innern wird diese Ringwand dann mit etwas Erdmörtel überzogen. Hierauf wird das Ganze mit einem pyramidenförmigen Dache, das gleichfalls aus Stangen, Reisig und Bast zusammengesetzt ist, gekrönt und mit einer 3 Fuß langen holzigen Grasart belegt. Nun ist die Wohnung vollendet und der Einzug kann stattfinden. Alle Familienmitglieder, nebst Knechten und Mägden, wohnen und schlafen hier beisammen; die Kühe, die Mühle, das Maulthier, falls ein solches vorhanden, die Hühner – sie alle finden hier ihren Platz. Auch das Getreide hat hier in großen aufrecht stehenden Erdtonnen oder wohl verdeckten Gruben seine Stelle. Der Hausherr ruht auf seiner Alga (oder Arat), einem hölzernen Bettgestell mit vier 2 Fuß hohen Beinen, über das schmale Riemen von ungegerbter Rindshaut gezogen sind. Die übrigen Bewohner legen Rindshäute auf den Boden, die ihnen zur gemeinschaftlichen Schlafstätte dienen. Selten wird eine solche Behausung ausgekehrt und unzählige Flöhe, Läuse und Wanzen sind die regelmäßigen Insassen, um welche der Bewohner sich wenig oder gar nicht kümmert. Der Küchenrauch, Asche, Staub und Unrath aller Art häufen sich im Verlaufe eines Jahres dermaßen an, daß man das Innere mit einem Schornstein vergleichen kann.
Uebrigens wendet man in Abessinien verschiedene Bauarten an. Oft bestehen die Wände aus Steinen, die mit Mörtel verbunden oder ohne diesen aneinander gefügt sind. Steinhäuser finden sich fast durchgängig im Hochlande, und da es hier in der Nacht sehr kalt ist, so findet auch Vieh aller Art in denselben seine Schlafstätte. Da, wo gute passende Erde vorkommt, baut man auch quadratische Häuser mit plattem Dache. Dieses ist namentlich in Tigrié häufig der Fall. Diese Decke wird dann durch starke Baumstämme und Balken getragen, die mit einer 1 Fuß dicken Lage Erde überdeckt sind, welche zur Regenzeit kein Wasser durchläßt. Hier sieht man auch oft große, auf diese Weise überdachte Säulenhallen aus rohen Baumstämmen, unter denen das Vieh zur Regenzeit Schutz und Obdach findet. Ueberhaupt herrscht im Lande Tigrié mehr Fleiß und Ordnung als in anderen Gegenden Abessiniens.
Das hier von den Wohnungen Gesagte gilt nur von den Behausungen des ackerbautreibenden Theiles der Bevölkerung. Die Häuser der Reichen und Großen des Landes sind besser gestaltet. Sie sind gewöhnlich gut mit Erdmörtel aufgeführt und auch die innere Wand mit Mörtel überzogen. Das Innere besteht oft aus Abtheilungen, von denen eine für Pferde und Maulthiere, eine als Speicher, eine dritte als Empfangszimmer, eine vierte für den Hausherrn und seine Familie bestimmt ist. Ist das Haus klein, so wird das [pg 157]Empfangszimmer besonders angebaut. Das Dach ist im Innern häufig schön mit zusammengesetzten Rohrstäben verziert, ja manchmal mit farbigen Baumwollstoffen künstlich dekorirt, die Eingänge mit Breterthüren, der Hof mit einer Mauer versehen. Doch herrscht im Innern derselbe Schmuz und das Ungeziefer wie bei den Landleuten.
Die Mühlen der Abessinier bestehen aus einem einzigen Stein, der 1 Fuß breit und 1¾ Fuß lang ist. Das Material besteht aus grobem Sandstein oder Trachyt; enthält der letztere viele kleine Blasenräume, so wird er sehr geschätzt. Die Mühle wird durch Klopfen mit einem harten kleinen Steine geschärft. Der Läufer, mit dem das Getreide zerrieben wird, ist ein ¾ Fuß langer, 4 Zoll breiter Stein. Das Mahlgeschäft wird nur von den Frauen besorgt. Eine Person zerreibt täglich etwa 6 Metzen (Berliner Maß). Das Mahlsieb besteht aus Grasgeflecht. Weizen und Gerste werden, bevor sie auf die Mühle kommen, enthülst; dieses geschieht in ausgehöhlten Baumstämmen, welche die Mörser vertreten; der Stößel ist ein 3 Fuß langer, 2–3 Zoll im Durchmesser haltender Knittel aus wildem Olivenholz. Die einzigen Instrumente, welche sonst noch bei der Agrikultur in Abessinien Dienste leisten, sind eine Axt, eine Erdhaue, eine gezähnte Sichel und ein Messer. In Schoa wurde unter der Regierung des Königs Sahela Selassié von einem Europäer eine Wassermühle errichtet, doch als diese anfing zu mahlen, empörte sich die Geistlichkeit gegen das Teufelswerk und bedrohte den König mit dem Bannfluche, wenn das Mahlen nicht eingestellt würde. Die Mühle ist heute gänzlich zerfallen.
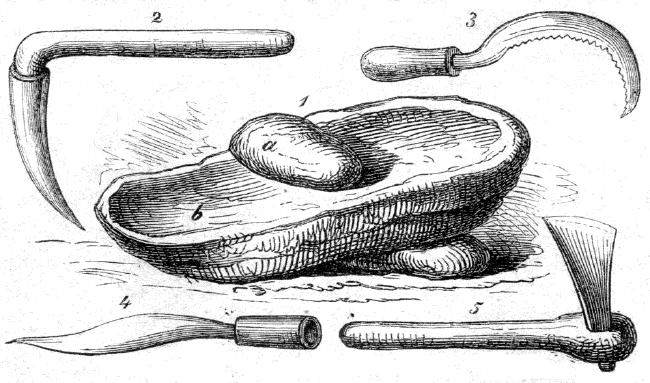
5. Axt der Abessinier. Originalzeichnung von E. Zander.
Massaua und die abessinische Küstenlandschaft.
Die Bedeutung des Rothen Meeres. – Der Dahlak-Archipel und die Perlenfischerei. – Die Stadt Massaua und ihre Bewohner. – Sklavenhandel. – Die Cisternen. – Der Markt. – Karawanenhandel mit Abessinien. – Die Bai von Adulis. – Schohos und Danakil. – Die Samhara. – Eine abessinische Karawane. – Der Tarantapaß und Halai.
Das Rothe Meer, lange Zeit für den großen Verkehr fast ohne Bedeutung, ist in unsern Tagen aus seiner Abgeschiedenheit hervorgetreten und nimmt lebhaften Antheil am Welthandel. In einer Länge von fast vierhundert Meilen erstreckt es sich gleich einem Arm von Suez bis zur Bab-el-Mandeb zwischen dem nordöstlichen Afrika und der westlichen Küste Arabiens. Regelmäßig wie bei uns die Eisenbahnen wird es fast tagtäglich von Riesendampfern seiner ganzen [pg 159]Länge nach durchkreuzt; Telegraphendrähte sind an seinen korallenreichen Gestaden hingelegt, und der Post- wie Handelsverkehr von Europa nach Indien nimmt jetzt seinen Weg zumeist über diese Straße. Noch größere Bedeutung wird das Rothe Meer jedoch erlangen, wenn einst der Suezkanal vollendet sein sollte, obgleich schon auf der von Alexandrien über Kairo nach Suez führenden Eisenbahn alljährlich viele Tausende von Vergnügungsreisenden zu ihm hingezogen kommen. Nach allen Seiten führen von seinen Küsten wichtige Handelsbahnen in die umliegenden Länder, die zum Theil, wie das Innere Ostafrika’s, ungemein produktenreich sind: Gummi und Straußenfedern, Droguen und Elfenbein, Wachs und Honig, nicht minder aber Sklaven werden in allen Hafenplätzen feil gehalten und finden regelmäßigen Absatz gegen europäische Produkte.
Sowie aber die kommerzielle Bedeutung des Rothen Meeres sich gehoben hat, ist auch nicht minder jetzt die politische in den Vordergrund gelangt, und wie in so vielen andern Weltgegenden sind auch hier England und Frankreich als eifersüchtige Rivalen aufgetreten, die einander den Rang streitig zu machen suchen. Beide wissen, daß im Rothen Meere der Schlüssel zu Indien liegt, und wenn auch Frankreich ein geringeres Interesse als England daran zeigt, denselben mit in Händen zu haben, so ist es doch schon des Wettbewerbes wegen bestrebt gewesen, es in Besitzergreifungen den Engländern gleichzuthun. Der Suezkanal, ein französisches Unternehmen, hat mindestens in demselben Grade politische Bedeutung, wie kommerzielle; denn wie die Engländer Aden und die Insel Perim am südöstlichen Ende des Rothen Meeres besetzten und so die Bab-el-Mandeb beherrschen, trachten die Franzosen danach, ihre Herrschaft am nordwestlichen Ausgang der Handelsstraße zu errichten. Und auch noch andere Küstenplätze sind nach und nach in die Hände der beiden Rivalen gefallen: die Briten haben sich auf der Insel Kamaran an der arabischen Seite, die Franzosen auf Dessi vor der wichtigen Bai von Adulis und zu Oboc niedergelassen. Von hier aus überwachen sie den Handel und spinnen Intriguen mit den unzufriedenen Elementen der Bevölkerung, um bei guter Gelegenheit sich überall in die Landesangelegenheiten mischen zu können. Europäische Konsularagenten haben in den meisten Hafenplätzen schon ihren Sitz, und mit dem arabischen oder banianischen (indischen) Handelsmann theilen sich jetzt europäische Kaufherren in den Gewinn des Handels am Rothen Meere. Eine Abschließung desselben ist jetzt nicht mehr denkbar, es wird mit allen seinen Gestadeländern – mag es wollen oder nicht – immer mehr in unsere Beziehungen hineingezwungen.
Freilich ein Hinderniß hat die Natur selbst geschaffen, welches die Bedeutung dieses Meerarmes für den Verkehr bedeutend abschwächt. Das Rothe Meer ist für Segelschiffe bei den jetzigen Anforderungen an die Schnelligkeit des Verkehrs fast so gut wie unbefahrbar, da ziemlich das halbe Jahr hindurch Windstille herrscht und Mangel an guten Häfen ist. Zudem machen die Korallenklippen die Fahrt äußerst gefährlich, und auch die Versorgung der Schiffe mit Wasser, Kohlen oder Lebensmitteln ist eine äußerst mangelhafte. Nur der Dampfer, der seine Kohlen in Suez oder Aden liegen hat, beherrscht diesen Meeresarm voll[pg 160]ständig und in vier bis fünf Tagen durchfahren sie denselben von einem Ende bis zum andern, um dann weiter die Fahrt nach Indien anzutreten.
Während die großen Dampfer der indischen Linie direkt das Rothe Meer durchkreuzen und nur selten den einen oder andern Hafenplatz an demselben besuchen, sind für letztere besondere Seitenlinien eingerichtet, die meist von einer türkischen Gesellschaft schlecht versehen werden. Von Suez, wo die Eisenbahn mündet, steuern wir zunächst nach Kosseïr, von wo eine Karawanenstraße nach Keneh am Nil führt, der in dieser Gegend einen weiten Bogen nach Osten macht und sich dem Rothen Meere nähert. Von Kosseïr fahren wir in südöstlicher Richtung nach der arabischen Küste hinüber und landen in Jembo, dem Eingangsthor der heiligen Stadt, nämlich Medina, für welches dieser Platz den Hafen bildet. Weiter an demselben Gestade fortsteuernd erreicht der Dampfer Dschidda, „die Ebene ohne Wasser“. Aber dieser Hafenplatz, das Seethor für Mekka, ist in vieler Beziehung wichtig und namentlich zur Zeit der Pilgerwanderungen sehr belebt. Wir verlassen auch diesen Ort, der schon Millionen Wallfahrer landen sah, und durchkreuzen abermals nach Südwesten hin das Rothe Meer, um Sauakin an der afrikanischen Küste zu erreichen, von wo aus die große Karawanenstraße nach dem östlichen Sudan und Chartum an der Vereinigung des Weißen und Blauen Nil führt.
Und nun geht nochmals der Anker in die Höhe, nach Süden ist der Bug des Dampfers gerichtet, die afrikanische Küste, das Land der nomadisirenden Beni-Amer und Habab bleibt zur Rechten liegen und die Dahlak-Inseln kommen in Sicht. Auf diesem Archipel erhalten wir durch die Sprache der Bewohner schon einen Vorgeschmack Abessiniens, vor dessen Küste, gegenüber dem Hafenplatze Massaua, die Gruppe liegt. Die drei Hauptinseln sind Groß-Dahlak, Nureh und Nakala. Die Großhandelsfahrzeuge legen dort nicht an, obwol das erste der genannten Eilande einen sehr guten Hafen hat. Viele Spuren, namentlich Ruinen, deuten darauf hin, daß einst die Abessinier und im 16. Jahrhundert die Portugiesen eine Niederlassung auf demselben hatten. Dahlak hat nur etwa 1600 Einwohner, auf die andern beiden bewohnten Inseln kommen zusammen nur 200 Köpfe. Alle sind Muhamedaner, friedliche Menschen, die unter einem Scheich stehen; dieser erhält seine Belehnung von dem ägyptischen Gouverneur in Massaua, welchem er jährlich 1000 Maria-Theresia-Thaler zahlt. Wasserläufe giebt es auf den Inseln nicht, aber das Brunnenwasser ist gesund.
Ueberaus reich ist hier das Meer an Fischen und Fischfang daher eine Hauptbeschäftigung der Bewohner. Doch noch andere Schätze bietet die salzige Flut, welchen die Dahlak-Inseln vorzüglich ihre Berühmtheit verdanken. Namentlich kommt die Perlenauster (Pintatina) in großer Menge, förmliche Bänke bildend, hier vor, und sie ist es, die vom Mai bis in den August eine große Anzahl der Bewohner mit Tauchen beschäftigt. Jeder kann sich an der Perlenfischerei nach Belieben betheiligen; Abgaben werden nicht erhoben und nicht selten kommen auch Taucher und Fischer von der gegenüberliegenden arabischen Küste. [pg 161]Man bedient sich zum Fange der gewöhnlichen Barken, der sogenannten Sambuks, welche gerudert werden und auch Mattensegel haben. Von den zwölf bis vierzehn Köpfen der Mannschaft sind sechs bis sieben Taucher. Mit einem Bismillah! (Im Namen Gottes!) stürzt der Mann in die Tiefe, wo er nicht viel länger als eine Minute bleibt, so viel Austern, als er kann, in einen Korb zusammenrafft und diesen durch die Gefährten an einem Seil in die Barke ziehen läßt. Mehr als dreißig, höchstens vierzig Mal kann er an einem und demselben Tage nicht untertauchen. Eine mit guten, recht erfahrenen Tauchern bemannte Barke wird im Laufe eines Tages bis 3500 Perlenaustern und etwa 500 Perlmutteraustern erbeuten. Die Muschel, welche man bei den Dahlak-Inseln fischt, ist im allgemeinen nur klein und beinahe rund; der Durchmesser beträgt 5 bis 6 Centimeter. Unter 20 bis 30 Austern hat immer nur eine einzige eine kleine Perle, die man als Samen bezeichnet. Es scheint als ob eigentliche, völlig ausgebildete Perlen nur in ganz ausgewachsenen Muscheln gefunden werden. Die Insulaner bezeichnen die Perlenauster als Bebela oder Bereber. Ihr Fleisch ist weiß und genießbar; man trocknet es an der Sonne und zieht es auf Fäden, worauf es dann einen Theil des Jahres hindurch die Hauptnahrung der Leute bildet.
Alljährlich bringen die Fischer ihre Ausbeute an Perlen und Perlmutter nach dem Dorfe Debeolo, wo vierzehn Tage lang Markt gehalten wird. Dort legen sie die Erzeugnisse des Meeres zum Verkauf aus. Regelmäßig finden sich fremde Kaufleute, besonders indische Banianen ein, die gegen Silber oder Tauschwaaren, Lebensmittel, Holz, Baumwollenstoffe die Perlen zu ziemlich niedrigem Preise einhandeln. Man schätzt diese nach ihrer Größe, Gestalt und Reinheit ab. Erstere wird durch ein Haarsieb ermittelt, das Oeffnungen von verschiedener Größe hat. Je nach den verschiedenen Gattungen wird der Preis bestimmt. Der Umsatz auf dem Markte von Debeolo beträgt im Durchschnitt an Geldwerth 50,000 bis 60,000 Thaler, ist also immerhin bedeutend. Zu den Ausfuhrgegenständen der Dahlak-Inseln gehört ferner das feine Schildpatt (Baga); das der Schildkrötenweibchen ist durchgehends schwerer und dicker als das der Männchen, und ein zwei Fuß langes Rückenschild des ersteren giebt zwei Pfund Schildpatt. Auch die Kauris oder Geldmuscheln, die in Afrika als Scheidemünze gelten, werden auf den Dahlak-Inseln in großer Menge gefischt. Seltener aber ist ein höchst interessantes Meersäugethier, der Dugong (Halicore Dugong), das wegen seiner starken Haut und perlmutterglänzenden Zähne sehr geschätzt war und ist. Es kommt auch an den arabischen und afrikanischen Küsten vor, an welcher letzteren es von den Danakil gefangen wird. Die Thiere leben paarweise und weiden auf den untermeerischen Tangwiesen, die ihre einzige Nahrung bilden. Das Land besuchen sie selten, meist schwimmen sie wie Meerjungfern mit erhobenem Oberkörper in der See. Sie sind über 12 Fuß lang und schwer mit Harpunen zu erreichen. Die dem Walroß ähnlichen Stoßzähne wurden früher als Handelsartikel gesucht und zu Rosenkränzen verarbeitet, während die marklosen Knochen Dolch- und Messergriffe von großer Dauerhaftigkeit liefern. Aus der Haut bereitet man Sandalen. Merkwürdig erscheint uns der Dugong noch [pg 162]dadurch, daß er dasjenige Thier ist, aus welchem die alten Juden den Ueberzug ihrer Bundeslade gemacht haben sollen.
Unsere Fahrt durch das Rothe Meer ist nun beendigt; von Dahlak wendet sich der Dampfer nach Westen, der abessinischen Küste zu, von der aus die kühnen und gewaltigen Bergmassen von Hamasién uns entgegenstarren. Wir nähern uns der Insel Massaua, deren Bucht, von Vorgebirgen eingeschlossen, nun in Sicht kommt.

Gleich darauf werden das kleine Vorwerk, die weißgetünchten Doppelthürme der Moschee, die türkischen Wachtschiffe und fremden hier ankernden Fahrzeuge sichtbar. Schon ehe man landet, erblickt man weit draußen auf der See eigenthümlich gestaltete Fischerflöße, die aus fünf zusammengebundenen Baumstämmen bestehen. In der Mitte sitzt ein Knabe, der mit einer beiderseits schaufelförmigen Ruderstange geschickt und schnell seine Fähre regiert. Auf diesem gebrechlichen Dinge angelt er an Klippen und Bänken, fängt eine große Anzahl Fische und tödtet sie jedesmal sogleich durch einen Nagelstich in den Kopf. Die Stadt Massaua oder Mesaueh ist der Hauptort für das Aegypten untergeordnete abessinische Küstenland nebst den Inseln des perlenreichen Dahlak-Archipels, Sitz eines Kaimakan, der einige Soldaten zur Verfügung hat. Außerdem [pg 163]residiren hier ägyptische Zollbeamte und verschiedene europäische Konsuln, denn Massaua ist die Pforte des Handels für fast ganz Abessinien und von größter politischer Wichtigkeit durch seine Lage gegenüber dem letztgenannten Reiche, wie durch seinen in jeder Beziehung vorzüglichen Hafen, der sich auch dadurch vor andern Häfen am Rothen Meere auszeichnet, daß man sich hier leicht mit Schiffsprovisionen, Wasser, Holz, Schlachtvieh u. s. w. versehen kann.
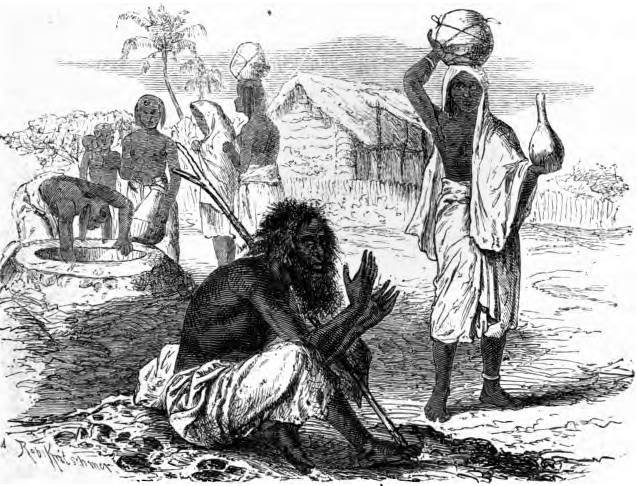
Der Golf von Arkiko, in welchem die Inselstadt Massaua liegt, ist mit verschiedenen kleinen Koralleneilanden bedeckt. Auf einem derselben befindet sich der christliche Friedhof und hier ist es, wo auch die Leiche unseres Landsmannes, des Reisenden Hemprich, ruht, den am 30. Juni 1825 der Tod ereilte. Auf einem andern Koralleneilande liegt ein Heiliger, Seid Scheik, begraben, der seinerzeit Massaua verlassen und diese kleine Insel bezogen haben soll, weil er glaubte, daß der Lebenswandel seiner Mitbürger allzu irreligiös sei. Vom Festlande sowol als von Massaua machen zahlreiche Gesellschaften nächtliche Ausflüge nach dem Grabe dieses Heiligen, wobei weniger religiöse Absichten die Pilger leiten sollen, als der Schmuggel mit Sklaven. Die Insel Massaua selbst hat eine halbe Meile Länge und beinahe eine Viertelmeile Breite. Die westliche Hälfte trägt die Stadt, die östliche halb verfallene, alte Cisternen aus besserer [pg 164]Zeit und ein kleines, schlecht armirtes Fort. Die Anlage der Stadt ist eine ganz unregelmäßige, wenig ältere Gebäude bestehen aus Stein, die meisten sind Strohhütten, die auf Pfählen im seichten Meerwasser ruhen. Unter ersteren zeichnen sich das Gouvernementsgebäude, eine zweikuppelige Moschee (Diamet Scheik Hamal) und das Zollhaus aus.
Im Ganzen hat Massaua etwa ein Dutzend religiöser Gebäude; darunter jene bemerkenswerthe Moschee, die früher eine christliche Kirche gewesen war und in welcher die Portugiesen 1520 Messe lasen, nachdem sie „Matzua“, so nannten sie die Stadt, den Muhamedanern abgenommen hatten. Was den Namen des heutigen Ortes betrifft, der auch Masua, Massawa geschrieben wird, so leitet ihn Munzinger aus der Tigriésprache ab, in welcher Mesaua den Raum bedeutet, über welchen hin man den Ruf einer Menschenstimme hören könne, und das trifft hier allerdings für die Meeresbreite zwischen Insel und Festland zu. Aber in der Landessprache der Eingeborenen heißt Stadt und Insel gar nicht Massaua, sondern Basé.
Die Bevölkerung ist fast ganz muhamedanisch; die Ureinwohner gehören der äthiopischen Rasse an und sprechen eine semitische Sprache. Die übrigen Bewohner, mit Ausnahme der türkischen Beamten und der Besatzung, sind Kaufleute aus Arabien, dann Somali, Danakil, Galla, Abessinier und Banianen (Indier). Die Massauaner selbst sind Fischer, Schiffsleute und Lastträger, welche das Trinkwasser herbeischleppen. Außer etwas Weberei, Gerberei und Schiffsbau werden wenig Gewerbe getrieben. Die Stärke der Bevölkerung schätzte Rüppell 1832 auf 1500, Heuglin 1857 auf 5000 Seelen, einschließlich des Militärs. Die Einkünfte der Provinz, meist aus den Zollabgaben des abessinischen Handels bezogen, betrugen nach beiden Reisenden 40,000–50,000 Thaler.
Die Massauaner sind ein in der Jugend durchweg sehr schöner Menschenschlag und haben eine kupferfarbige Haut, die mehr oder weniger dunkel ist. Die Mädchen zeichnen sich durch schlanken Wuchs, regelmäßige Züge des ovalen Gesichts, große, lebhafte Augen und feinen Mund mit schönen Zähnen aus. Wenn sich zwei Bewohner nach längerer Zeit wieder begegnen, küssen sie sich gegenseitig die Hände und erkundigen sich mit vielen Schmeichelworten nach dem Befinden. Was den Charakter der Massauaner anbetrifft, so lauten die Urtheile darüber sehr ungünstig. Dem bloßen Schacher ergeben, üben sie alle möglichen Verstellungskünste und erfüllen selbst die heiligsten Versprechungen nicht. Dazu kommt, daß der fortwährende Sklavenhandel ihre moralischen Sitten untergraben und ihr Herz gegen jede edlere Empfindung verstockt machen mußte. Diebereien und Einbruch sind gewöhnliche Verbrechen und gelten nicht als Schimpf. Die Anzahl der Bettler ist groß und die meisten derselben kommen durch Hunger und Elend ums Leben. Dankbarkeit ist den Massauanern nur dem Namen nach bekannt, und als Rüppell einst einen Mann von einer gefährlichen Schußwunde geheilt hatte, drückte dieser seine Freude darüber folgendermaßen aus: „Gott ist groß und wunderbar! Hat er doch diesen Hund von Ungläubigen hierhergeschickt, um mich zu heilen!“
[pg 165]Eine Eigenthümlichkeit der Massauaner besteht darin, daß sie Familiennamen haben, was bekanntlich sonst bei Muhamedanern nicht der Fall ist. So heißen einige Adulai, und diese stammen aus Adulis; andere Dankeli, Farsi (aus Persien), Yemeni (aus Yemen in Arabien). Unter den Kaufleuten spielen die Banianen eine wichtige Rolle. Diese Indier haben einen großen Theil des Verkehrs auf dem Rothen Meere in ihren Händen und bewohnen in Massaua ein eigenes Quartier. Dort sitzen die wohlbeleibten Männer nur halb bekleidet, mit geschorenem Kopfe, kleinem Schnauzbart und prächtigen schwarzen Augen in dem gelben, etwas weibischen Gesichte. Wer sie so sieht, glaubt sich in einen Bazar nach Delhi oder Bombay versetzt. Der Baniane trägt auf der Straße einen rothen, mit Gold oder gelber Seide verbrämten Turban und eine silberne Kette um den Leib. Diese Inder essen kein Fleisch und mögen solches nicht einmal anrühren. Beklagten sie sich doch einmal, wie Lejean berichtet, ernstlich darüber, daß die Hunde der katholischen Mission einmal in der Nähe ihrer, der Banianen, Cisterne Knochen abgenagt hätten! Dadurch könne das Wasser verunreinigt werden. Die Zahl der Europäer ist in Massaua nie beträchtlich gewesen und besteht nur aus ein paar Konsularagenten, einigen Kaufleuten und Missionären. Unter den Konsularagenten war der englische, vor wenigen Jahren erst verstorbene Raffaele Barroni den Türken besonders verhaßt, weil er den Muth hatte, eine unablässige Fehde gegen die Sklavenhändler zu führen. Um recht mit Nachdruck auftreten zu können, hatte er sich sogar eine eigene Polizei eingerichtet. Er wußte allemal, wieviel Sklaven eine im Küstenland aus Abessinien ankommende Kaflé (Karawane) mit sich führe, zog ihr an der Spitze seiner wohlbewaffneten Dienerschaft entgegen, nahm, wenn nöthig, mit offener Gewalt ihr alle Sklaven ab und verschaffte denselben die Freiheit. Die Kaufleute haßten ihn, sein Leben war oftmals bedroht, aber er hatte seine Vorkehrungen getroffen und sich eine Art von fester Burg gebaut, von welcher aus er mit seinen Kanonen und Büchsen die Umgegend bestreichen konnte. Im Nachlasse dieses muthigen Mannes fand der Reisende Lejean folgende Aufzeichnung: „Ich habe Sklaven befreit, nachdem der Konsul Plowden von hier abgereist war, im Jahre 1855: 2 Galla von Tehuladare, 1 aus Mensa, 158 aus Magatul, 1 von Atti Letta; 160, die man nach Dschidda schicken wollte, habe ich zurückgehalten. Im Jahre 1856: 240. Ich hielt eine ganze Karawane auf ottomanischem Gebiete an und schickte sie nach Abessinien zurück. Im Jahre 1857 befreit: 2 von Schoa, 2 von Mensa, 4 von mir unbekannter Herkunft“ u. s. w. Eine andere Notiz lautet: „Die Bewohner dieser Stadt und namentlich die Sklavenhändler sind hocherfreut, daß Abdul-Aziz den Thron bestiegen hat; sie hoffen unter ihm eine Wiederbelebung des Sklavenhandels im Rothen Meere.“ Wie die Engländer es übrigens mit der Unterdrückung des Sklavenhandels nicht immer ernst nehmen, dafür bringt Lejean ein Beispiel bei. Barroni stand unter dem Oberbefehl des englischen Residenten in Aden. Dieser wandte allerdings gegen das, was Barroni that, nichts ein, gab ihm aber zu bedenken, daß man es mit dem Einschreiten gegen den Sklavenhandel unter türkischer Flagge nicht zu ernsthaft nehmen dürfe [pg 166]„damit diese befreundete Flagge im Rothen Meere in ihrem Ansehen nicht geschwächt werde“.
Was Lejean sonst noch über einzelne Einwohner Massaua’s berichtet, ist zu charakteristisch für die dortigen Zustände, als daß wir es nicht hierher setzen sollten. Die türkische Regierung benahm sich gegen die Kapuziner, welche sich in Monkullo niederlassen wollten, sehr barsch. Ein Mönch machte aber dem Gouverneur zu schaffen und forderte ihn sogar zum Zweikampf auf Säbel; dann erklärte er, er werde den Gouverneur aus dem Fenster werfen und selbst regieren. Zuletzt wurde er Kaufmann und dann in Florenz Zeitungsredakteur.
Im Jahre 1854 war ein gewisser Ibrahim Pascha Kaimakan von Massaua. Dieser Würdenträger war stets durch Hanfrauchen benebelt und schwelgte in den wildesten Phantasien. Nach Konstantinopel berichtete er, daß er alles Land bis zu den Mondgebirgen erobert habe, während doch wenige Stunden landeinwärts seine Macht ein Ende hatte. Er wollte die Einwohner am Festlande besteuern, worauf diese aber keine Lebensmittel mehr nach der Insel brachten, sodaß in Massaua sich Hungersnoth einstellte. Gegen die Europäer erlaubte er sich allerlei Grobheiten; dieselben führten Klage, infolge deren er 1855 von der Pforte kassirt wurde. Er nahm seine Absetzung gleichmüthig auf, schloß sich in seinen Harem ein und erhing sich an einer Säbelschnur.
Was das Klima Massaua’s anbetrifft, so ist es nicht ungesunder als das der andern Hafenplätze am Rothen Meere. Das Sprüchwort sagt, es sei eine Hölle, wie Pondichery ein heißes Bad und Aden ein Backofen. Am empfindlichsten macht sich der Mangel an Trinkwasser auf der Insel selbst bemerkbar. Die Cisternen auf der Ostseite der Insel nehmen etwa ein Drittel dieser letzteren ein. Der Ueberlieferung zufolge sind sie von den Farsi (Persern) gebaut worden und das kann richtig sein, denn es ist wahrscheinlich, daß einige Zeit, bevor Muhamed seine Lehre verkündigte, der persische König Chosroes diese Küstengegend des Rothen Meeres beherrschte. Uebrigens bezeichnet man in Massaua alles, was nicht muselmännisch oder abessinisch ist, als „Farsi“, und so auch die Cisternen. Sie sind vortrefflich gearbeitet und haben eine Art gewölbten Deckel, der aus wunderbar fest gekitteten Korallenstücken besteht. Die inneren Wände der Cisternen sind meistens vollkommen glatt und von rosenrother Farbe.
Die ägyptische Regierung thut nichts, um diese so höchst nothwendigen und nützlichen Cisternen in gutem Zustande zu erhalten; was einfällt wird nicht ausgebessert. Die Türken bekommen ihr Wasser von Monkullo oder Arkiko, und ob die armen Leute Trinkwasser haben, ist ihnen ganz einerlei. Massaua selbst hat gar kein eigenes Trinkwasser, wenn nicht etwa einige dieser Cisternen Regenwasser enthalten. Alltäglich geht dagegen ein Regierungsschiff nach Arkiko, das viele Brunnen besitzt, deren Wasser indessen nicht besonders gut ist. Dasselbe wird dort in lederne, stark gethrante Schläuche gefüllt, dann mittels Lastthieren oder Trägern zum Gestade gebracht und nach der Stadt verschifft. Im August und September fallen nicht selten Regen, welche die Brunnen speisen. Das schon erwähnte Arkiko, das früher Dogen hieß, scheint wenigstens [pg 167]so alt wie Massaua zu sein, obgleich es keinen Hafen besitzt. Es ist von freundlichen Gärten umgeben und dient als Militärstation.
Seine Wichtigkeit verdankt Massaua dem abessinischen Zwischenhandel. Alle dort wohnenden Nationalitäten sind an demselben betheiligt. Es kommen bei günstigen politischen Verhältnissen im Innern gewöhnlich zweimal im Jahre große Karawanen (Kaflé) aus den Gallaländern und ganz Abessinien nach der Küste; der Gesammtwerth der durch sie abgesetzten Waaren wird von Heuglin auf eine Million Thaler, von Andern jedoch weit höher angegeben. Eine solche Karawane sammelt sich bei günstiger Jahreszeit und bewegt sich, von bewaffneter Macht eskortirt und immer wachsend an Mitgliedern, über Adoa dem Meere zu. Sie steht unter dem Befehle eines Schech el Kaflé und transportirt die Waaren auf Maulthieren und Eseln bis an den Abfall der Hochgebirge, wo dann die benachbarten Hirtenvölker, die viele Kameele zu diesem Zwecke halten, die Weiterbeförderung übernehmen und die Waaren bis zum Meere bringen. Der größte Theil der Verkaufsgeschäfte ist schon vor Ankunft der Karawane in Massaua durch Unterhändler abgeschlossen; die Hauptartikel sind Kaffee aus der Umgebung des Tanasees, Godscham und den Gallaländern, Elfenbein von den Galla- und Kolaländern, Nashorn, Moschus, Gold von Damot, Fazogl, Galla u. s. w., Wachs, Honig, Butter, Schlachtvieh, Häute, Maulthiere, Tabak, Straußenfedern und Sklaven. Der Schiffahrtsverkehr mit den Häfen am Rothen Meere, sowie mit Aden und Bombay, ist sehr lebhaft. Noch 1860 schrieb Moritz v. Beurmann: „Unter den von Massaua ausgeführten Handelsartikeln nehmen die Sklaven noch immer einen bedeutenden Posten ein, obgleich in der letzten Zeit auch dieser Handel bedeutend nachgelassen hat und die jährliche Ausfuhr in den letzten Jahren wol kaum auf 1000 Köpfe kommen möchte. Es war deshalb auch zu der Zeit, als ich in Massaua war, die Stimmung gegen die Europäer eingenommen, da man wohl weiß, einen wie schädlichen Einfluß dieselben auf diesen ergiebigen Handel haben.“ Nach Rüppell führte man 1838 etwa 2000 Sklaven beiderlei Geschlechts aus, zu einem Durchschnittspreis von je 60 Speziesthalern. Markt wird täglich in der Stadt abgehalten. Außer den gewöhnlichen Handelswaaren werden auch Lebensbedürfnisse, Fleisch, Brot, Holz und Trinkwasser, feilgeboten. Die beiden zuletzt genannten Bedürfnisse machen die Erwerbsquelle für die armen Landleute aus. Mit dem thönernen Topfe auf dem Haupte kommen die Wasserträgerinnen heran; schon am frühen Morgen stellen sich Hirten ein, welche kleine, mit Milch gefüllte Körbchen zum Verkauf bringen; diese Milch schmeckt sehr unangenehm, indem sie gleich nach dem Melken stark geräuchert wird, was, um das Gerinnen zu verhüten, unumgänglich nöthig sein soll. Andere Landleute bringen in der Winterjahreszeit Nabakfrüchte (Rhamnus Nabac) und kleine Citronen, die aus den verwilderten Klostergärten stammen, sowie frische Hennablätter (Lawsonia inermis), welche den Schönen der Stadt zum Rothfärben der Nägel und Handfläche unentbehrlich sind. Fischerknaben bringen die reiche Ausbeute des Meeres, und im Frühling verkauft man die Blütenstengel einer spargelähnlich schmeckenden Aloëart. Fast die ganze männliche Bevölkerung Massaua’s [pg 168]treibt sich den Tag über faullenzend unter den Marktbuden umher, wo neben dem feinen Stutzer der zerlumpte Derwisch und der halbnackte Hirt einherzieht.
Massaua, sowie Sauakin, gehörten einst zum abessinischen Reiche. Die Stadt wurde 1557 durch eine türkische Flotte erobert und mit einer bosnischen Besatzung versehen. Unter Mehemed Ali gehörte sie zu Aegypten, kam jedoch 1850 wieder unter türkische Oberhoheit und wurde 1865 abermals, nebst der ganzen Westküste des Rothen Meeres an Aegypten abgetreten.
Wendet man sich von Massaua gerade nach Süden, nach dem bis zu 5000 Fuß ansteigenden Gedemgebirge, so übersieht man von diesem den ganzen Meerbusen von Annesley oder die Bai von Adulis (jetzt bei den Eingeborenen Gubet Kafr genannt). Während im Westen das Vorgebirge Gedem die Bai abschließt, wird diese im Osten von der meist kahlen Halbinsel Buri begrenzt. Das Westufer, flach und durch Anschwemmungen entstanden, trägt eine üppige Vegetation von Schorabäumen, zwischen deren Wurzelgewirr Heuglin hier einen seltsamen Fisch (Periophthalmus Koehlreuteri) entdeckte, der, froschlarvenartig aussehend, im Schlamme, zwischen Steinen und sogar im Grase lebte und verfolgt in großen Sprüngen sich ins Wasser rettete. Die Bucht hat eine Länge von 20, bei einer Breite von 8 Meilen, ist tief genug, um selbst die größten Seeschiffe aufzunehmen, und besitzt den Vorzug, Trinkwasser wie auch Brennholz liefern zu können. Den Schluß der Bai bildet die den Franzosen gehörige Insel Dessi, welche ohne große Kosten leicht befestigt werden könnte, doch haben die Franzosen es bei der einfachen Besitzergreifung bewenden lassen. Sie hat gleichfalls gutes Wasser und Weide für etwa 600 Stück Rindvieh, die drei Rheden gewähren guten Schutz und können in vortreffliche Häfen umgeschaffen werden. Im Jahre 1859, als Agau Negussi Gebieter Tigrié’s und von den Franzosen als „Empereur“ anerkannt war, gab er die Insel dem französischen Agenten Russel und bot ihm außerdem noch die ganze Bai von Adulis an. Dagegen that die ottomanische Pforte Einsprache, da sie das ganze Küstenland für sich in Anspruch nimmt; indessen wurde darauf keine Rücksicht genommen, und der französische Konsul schloß auf der Halbinsel Buri mit den Häuptlingen der Hasorta, welchen Dessi gehörte, einen Vertrag. Die Schums (Häuptlinge) erklärten, daß sie nie der Pforte, sondern nur der abessinischen Krone unterthan gewesen seien. So ward Dessi französisch und bestimmt, der von den Engländern besetzten Insel Perim in der Bab-el-Mandeb Konkurrenz zu machen.
Am westlichen Ufer, doch eine Stunde vom Meere entfernt, liegen an einem breiten, trockenen Strombette die Ruinen der berühmten Stadt Adulis, Adule, Zula oder Asule. Sie wurde unter Ptolemäus Euergetes gegründet und war zur Zeit der Ptolemäer ein blühendes Emporium, dessen Bewohner lebhaften Handel, besonders mit Elfenbein, Rhinozeros, Schildpatt, mit Affen und Sklaven trieben. Eine zweite Blütezeit erlebte Adulis unter den Königen von Axum, für deren Staat es Hafenplatz bildete.
[pg 169]
Als im 6. Jahrhundert hier der Indienfahrer Kosmas landete, fand er das Monumentum adulitanum, dessen Inschriften über die alte Geographie jener Gegenden wichtige Auskunft geben. Jetzt sind von der Stadt nur elende Ruinen noch übrig, die zwei Meilen im Umfang haben. Schutthaufen von Wohnungen, die alle von kleinen unbehauenen Lavasteinen erbaut waren, in der Mitte die Trümmer einer ganz zerfallenen Kirche, dabei Säulenreste und Kapitäle, alles ziemlich plump aus Lava gearbeitet und mit Buschwerk überwachsen – das ist, [pg 170]was von Adulis übrig blieb. Keine Inschrift, kein Relief ist mehr zu sehen, aber die Begräbnißplätze der Muhamedaner haben sich zwischen diesen alten christlichen Resten angesiedelt, bei denen der Mangel größerer Gebäude nicht auffallen kann, wenn man bedenkt, daß Adulis einst dieselbe Rolle spielte, wie heute Massaua, in dem auch alle großen Gebäude fehlen.
Hier ist der Ort, einen kurzen Blick auf die Bewohner des Küstenlandes zu werfen. Diejenigen der Samhara, des schönen Thales von Modat, in welchem die heißen Mineralquellen von Ailet liegen, nennt man zusammenfassend Beduan. Sie sind gleich den Abessiniern Semiten und reden die Tigrésprache. Alle bekennen sich zum Islam, doch vor einem Menschenalter waren sie noch Christen, wie es ihre nächsten Nachbarn im Nordwesten, die Mensa und Bogos, noch heute – wenigstens dem Namen nach – sind. Sie sind alle Nomaden, die besonders Viehzucht treiben und Kameele, Rindvieh, Ziegen und Schafe halten. Letztere sind verschieden von den eigentlichen abessinischen Schafen; sie kommen vielmehr überein mit dem arabischen oder persischen Fettschwanzschafe und zeichnen sich durch einen schwarzen Kopf aus.
In der Umgebung des Golfs von Adulis bis zur eigentlichen Grenze Abessiniens wohnen Hirtenvölker, die Heuglin unter dem Namen Schoho zusammenfaßt und zu denen er auch die Hasorta oder Saorto rechnet. Sie reden eine eigene Sprache, haben eine eigenthümliche Gesichtsbildung, sind blos wilde Hirten, haben keine festen Wohnsitze und treiben keinen Ackerbau. Sie bekennen sich der Form nach allerdings zur muhamedanischen Religion, kümmern sich im Grunde genommen jedoch wenig darum. Ihre Lebensweise ist einfach, ja dürftig, ihr Charakter leidenschaftlich. Rüppell sah in Arkiko Schoho, die sich durch einige Eigenthümlichkeiten auszeichneten. Ihr Kopfhaar stand rund um den Kopf nach allen Seiten hin sechs Zoll weit steif ab und hatte durch die Menge des eingekneteten Hammelfettes eine graugelbe Farbe erhalten; mehrere bejahrte Männer hatten ihre grauen Bärte ziegelroth gefärbt; andere rochen bis in weite Ferne nach Zibethmoschus; dabei gingen sie in ganz zerlumpten Kleidern. Von den ihr Gebiet durchziehenden Fremden versuchen die Schohos auf alle mögliche Art Geld zu erpressen. So suchten sie Rüppell mehrere Schafe und Milch aufzudrängen; glücklicherweise hatten ihn aber seine Reisegefährten gewarnt, von ihnen anders als gegen bestimmte Zahlung etwas zu nehmen, da solche Schenkungen nur ein Kunstgriff seien, um den zehnfachen Werth dafür zu erzwingen. Uneingedenk dieser Warnung kostete er von einer freundlich dargebotenen Schale Milch, wofür er einen halben Maria-Theresia-Thaler zahlen mußte!
Die Begrüßungsart der Schoho ist das Darreichen der Hand; wenn sie ausruhen, nehmen sie eine Stellung an, die man unter den ostafrikanischen Negern (z. B. bei den Bari am Weißen Nil, bei den Leuten im Mondlande u. s. w.) wiederfindet. Sie setzen nämlich die linke Fußsohle an das rechte Knie, biegen dann, indem sie sich mit der Achselhöhle der rechten Schulter auf einen Stab stützen, den Körper auf die rechte Seite und stehen so oft Viertelstunden lang unbeweglich still, apathisch denselben Gegenstand anstarrend.
[pg 171]Folgt man in südöstlicher Richtung der Küste des Rothen Meeres, so trifft man abermals auf ein anderes Volk, auf die ohne ein gesetzliches Band, in kleinen Familien, ohne politisches Oberhaupt lebenden Danakil (in der Einzahl Dankali), welche bei den Arabern Tehmi oder Hetem heißen. Sie sind in den Küstenplätzen am Rothen Meere ansässige Fischer und Schiffer, die auch mit der gegenüberliegenden arabischen Küste Handel treiben. Obgleich sie nur kleine offene Schiffe haben, die hinten und vorn in einen Schnabel auslaufen und gewöhnlich nur durch ein viereckiges, aus Matten verfertigtes Segel in Bewegung gesetzt werden, so wagten sie sich doch von je muthig weit in die See hinaus und waren früher auch zuweilen kühne Seeräuber. In vieler Beziehung gleichen sie den Ostabessiniern, doch sind sie noch kräftiger und heller als diese, tragen aber deren rothgerändertes Umhängetuch und verhüllen sich beim Sprechen damit den Mund; andere bekleiden sich mit der dicken abessinischen Leibbinde, die so breit ist, daß sie bis fast unter die Arme reicht. Sie tragen lange, krause, von Fett triefende Haare, gehen stets bewaffnet mit Lanzen, runden Schilden aus Antilopenfell und einem zweischneidigen Säbelmesser, das aus indischem Eisen geschmiedet und in einer ledernen Scheide an der rechten Seite getragen wird. Die Danakil bekennen sich zum Muhamedanismus; sie werden übrigens von Heuglin, der sie in der Umgebung Ed’s kennen lernte, als feiges, diebisches Gesindel voll des schamlosesten Eigennutzes, dabei faul und mißtrauisch im höchsten Grade, beschrieben. In ihrer Sprache heißen sie Afer. Seit alten Zeiten bewohnen sie Ostafrika und beherrschten sogar einige Jahrzehnte hindurch unter dem Eroberer Muhamed Granjé ganz Abessinien. Jetzt sind die Danakil auf ein verhältnißmäßig kleines Terrain zurückgedrängt, von der Halbinsel Buri im Osten der Bai von Adulis bis Gubbet-Harab im Süden (11° 30′ nördl. Br.). Ihre Westgrenze bildet der Abfall der abessinischen Hochlande und ein Salzwüstenland, das sich längs deren Fuß von Norden nach Süden erstreckt und mit der Samhara oder Samher theilweise zusammenfällt.
Diese Samhara, wie der Araber den schmalen Streifen nennt, welcher östlich von den abessinischen Gebirgen zwischen diesen und dem Meere verläuft, ist ein höchst interessantes Wüstenland. Dem Gesetze zufolge, daß die Wüste überall da, wo es regnet, Wüste zu sein aufhört und Steppe zu werden anfängt, sollte auch die Ebene zwischen dem Gebirgswall Abessiniens und dem Rothen Meere Steppe sein, weil es dort regnet – allein dies ist nicht der Fall. Gerade da, wo man glauben könnte, daß das Wasser seinen ewigen Kreislauf ununterbrochen ausführen könne, an diesen Küsten nämlich, zeigt sich diese Samhara als Ausnahme, die höchstens als Mittelglied zwischen Steppe und Wüste angesehen werden kann. Auf große Strecken erinnert sie noch durchaus an die Wüste, nur in wenigen Thälern ähnelt sie der Steppe und blos da, wo das Wasser so recht eigentlich waltet, beweist sie, daß sie innerhalb des Regengürtels liegt. Aber nicht die Lage macht die Samhara zu dem, was sie ist, sondern die Beschaffenheit. Sie ist blos eine Fortsetzung des Gebirgsstockes selbst, obgleich sie, die Ebene, nur von wenigen und niederen Hügeln unterbrochen wird.
[pg 172]Sie gleicht gewissermaßen, wie Brehm treffend bemerkt, dem Schlackenfeld am Fuße eines gewaltigen Vulkans. Eine Menge konischer Hügel, zum guten Theil aus Lava bestehend, wechselt hier mit schmäleren oder breiteren Thälern ab und bildet ein Wirrsal von Niederungen, welche, dem Faden eines Netzes vergleichbar, zwischen den Hügeln und Bergen verlaufen. So niedrig diese Hügel auch sind, so schroff erheben sie sich, und deshalb verliert auf ihnen das Wasser seine Bedeutung; denn so schnell es gekommen, rauscht es wieder zur Tiefe hernieder und nur in der Mitte des Thales gewinnt es Zeit, das Erdreich zu tränken und ihm die Feuchtigkeit zu gewähren, welche zum Gedeihen der unter einer scheitelrecht strahlenden Sonne so wasserbedürftigen Pflanzen unerläßlich ist. Hier nun macht sich auch gleich ein reiches Leben bemerkbar. An den schwarzen Bergen klettern die Mimosen, so zu sagen, mühsam empor; an den schroffen Wänden finden sie kaum Nahrung genug zu ihrem Bestehen und können sich deshalb nur zu dürftigen Gesträuchen entwickeln. Nur in wenigen Niederungen, die zeitweilig von Regenbächen durchströmt sind, findet man dunkelgrüne Euphorbienbüsche, zu denen sich in noch besseren Lagen Tamarisken, Christusdorn, Balsamsträuche, Asklepiasbüsche, Capparis, Stapelien, Ricinus gesellen, während der Cissus überall an den Sträuchern umherklettert und reiche Guirlanden bildet. Hier erhält man einen Vorgeschmack jener reichen Natur, die im Gebirge herrscht, wo die Pracht der Tropen mit den Schönheiten der Bergwelt sich vereinigt, wo immer neue Zauberbilder vor dem Auge auftauchen und sich das Schatzkästlein ganz Afrika’s eröffnet. Dort im Westen winkt uns der hohe Gebirgswall des afrikanischen Alpenlandes, nach dem wir nun unsere Schritte lenken.
Massaua ist für die weißen Europäer die natürliche Eingangspforte nach Abessinien. Gewöhnlich schließen sie sich einer heimkehrenden Kaflé an, die immer mehr Sicherheit darbietet, als wenn der Reisende allein oder nur mit geringer Begleitung in das Innere einzudringen versucht. Bei den gesetzlosen Zuständen des Landes, den fast stets stattfindenden Bürgerkriegen, der Plünderung und Verheerung, ist ein Reisen in Abessinien außerordentlich gefährlich, und nur die Karawanen gewähren einige Sicherheit, wenn sie auch starken Erpressungen, Zollabgaben und den verschiedensten Plackereien ausgesetzt sind.
Als Lastthiere werden auf den steilen und schwer zugänglichen Wegen vorzüglich Maulthiere verwendet. Das Verpacken der Effekten nimmt viel Zeit in Anspruch, da selbige in gleich große und wo möglich gleich schwere Ballen zusammengeschnürt werden müssen. Eine große Anzahl Diener und Treiber ist deshalb nöthig, um das Gras für die Thiere, Holz und Wasser für die Reisenden herbeizuschaffen, ferner um das Gepäck jedesmal durch gehöriges Zusammenlegen gegen den Regen zu schützen und des Nachts gegen die Räuber und Raubthiere Wache zu halten. Die Karawane z. B., mit welcher Rüppell reiste, bestand aus 40 Kameelen, ebenso viel Maulthieren und über 200 Menschen. Man stelle sich vor, was diese allein an Wasser und Lebensmitteln in den unwegsamen Gebirgen brauchten, und man wird die Schwierigkeit, nach Abessinien einzudringen, schon hiernach beurtheilen können.
[pg 173]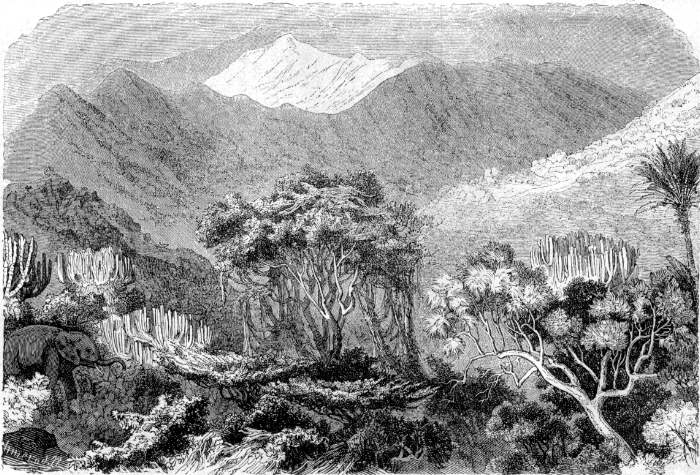
Nur die angesehensten Reisemitglieder reiten; alle anderen gehen zu Fuß. Jedes Mitglied der Gesellschaft ist bewaffnet; entweder mit einem langen krummen Säbelmesser, das stets an der rechten Seite getragen wird, oder mit einem Speer und runden Schilde. In neuerer Zeit sind die Gewehre mehr in Aufnahme gekommen. Viele tragen außerdem noch kleine, aus Rohr geflochtene Sonnenschirme, die äußerst nützlich sind, wenn man nach abessinischer Sitte keine Kopfbedeckung trägt. Am Abend macht die Karawane gewöhnlich unter einigen Bäumen in der Nähe von Brunnen Halt. Es ist kein leichtes Stück Arbeit, nach Abessinien einzudringen, wer es aber erreicht, der findet in der Natur auch Belohnung für seine Mühe, wenn auch die Menschen, welche jenes Paradies bewohnen, ihm desselben nicht werth erscheinen. Steigen auch wir nun hinauf in die Hochlande.
Hinter uns liegt der ungesunde Küstensaum und die Samhara, die wir in wenigen Tagemärschen durchschritten, vor uns aber, am westlichen Rande derselben, steigt jäh in einer Höhe von durchschnittlich 8000 Fuß das Taranta-Gebirge, der natürliche östliche Grenzwall Abessiniens an, über dem zackige Gipfel in die Höhe starren. Im Lichte der südlichen Sonne spielt es in den prächtigsten Farben, die uns in Entzücken versetzen; ein ewiger Wechsel von Licht und Schatten, Helle und Dunkel ist bemerkbar. Es wird Einem wohler in der Seele, wenn man dem Gebirge näher und näher kommt; man treibt das Maulthier zu schnellerem Laufe an, um bald die Luft der Gebirgsthäler genießen zu können. Die Pässe und Saumwege sind häufig so eng, daß nur ein Lastthier hinter dem andern zu gehen vermag; stürzt eines, so versperrt es den Weg und die Karawane muß Halt machen. Der am meisten begangene Paß ist jener von Halai, durch den zur Regenzeit ein wild angeschwollenes Gebirgswasser dem Rothen Meere zustürzt. Schroffe Bergmassen, welche aus senkrechten Schichten von Schiefer bestehen, begrenzen den Weg. Das Ganze macht den Eindruck einer wilden Einöde: Bergwände mit fast ganz nacktem Gestein ohne frischen Graswuchs erheben sich zu beiden Seiten, während die Thalniederung nur hier und da Baumgruppen zeigt. In Zickzacklinien führt der Weg weiter; es treten nun verschiedene Pflanzen auf: man bemerkt die ersten Tamarisken, dann die Kronleuchter-Euphorbien (Kolqual), die mit der Höhe des Gebirges an Häufigkeit zunehmen und äußerst charakteristisch sind; vorherrschend ist jedoch die Mimose. Jetzt sind wir oben in der erfrischenden Bergeshöhe; in der Nacht ist kalter Tau gefallen und der kühle Wind streicht über die Gipfel, von denen wir noch einen Blick rückwärts auf das Rothe Meer – gleichsam zum Abschied – werfen. Der nächste Fluß senkt sich schon westlich ab – er gehört zum Gebiete des Nil. Abessiniens Grenze, die allerdings nicht so scharf gezogen erscheint, wie die Grenze eines europäischen Staates, ist überschritten und das Dorf Halai, das erste des Landes, ist erreicht. Es schmiegt sich terrassenförmig erbaut an die Kuppe eines Hügels an; die Wohnungen sind kaum mannshoch und mit flachen Dächern versehen. Diese haben einen bodenlosen Topf in der Mitte, durch welchen das Tageslicht in die Hütte dringt und der Rauch hinauszieht.
[pg 175]Diese Töpfe – Schornsteine kann man sie nicht nennen – werden mit einem Steine bedeckt, wodurch dann, da die Hütte außer einer kleinen Thür keine andere Oeffnung hat, das Innere derselben ganz finster wird. Wir treten ein, um einen Vorgeschmack abessinischer Behausungen zu erhalten. Um ein nie verlöschendes Feuer gekauert, dessen Rauch nur mühsam Abzug findet und die Wände mit dickem Ruß überzieht, lagern die halbnackten Insassen, zu denen sich Ziegen, Schafe und Esel gesellt haben, welche in einer Ecke des Gemachs Unterkunft fanden. Ermüdet werfen wir uns auf eine der mit Ledergeflecht überzogenen Ruhebänke, reiben die thränenden Augen, welche von dem beißenden Qualm zu leiden haben, und gedenken uns durch einen Schlaf von der anstrengenden Gebirgswanderung zu erholen – aber auch dieser wird uns verleidet, denn aus den Rohrmatten, die auf der Ruhebank liegen, stürzen blutgierig Hunderte von Flöhen über uns her, denen europäisches Blut ein ganz besonderer Genuß zu sein scheint. Wir möchten hinaus ins Freie – aber auch das ist uns benommen, denn strömender Regen gießt auf die Erde herab, und wir sind gezwungen, in dem ekelhaften Quartier auszuhalten.
So gestaltet sich das Vordringen nach Abessinien von der Seite des Rothen Meeres her. Anders und mit noch größeren Schwierigkeiten gelangt man längs dem Nil oder längs dessen Zuflüssen in die Hochlande. Hier ist der Reisende genöthigt, bis nach der Metropole des östlichen Sudan, Chartum am Zusammenflusse des Weißen und Blauen Nil, vorzudringen. Von hier aus kann er entweder am Blauen Fluß stromaufwärts bis nach der zerfallenen Stadt Sennar reisen und dann nach dem östlich liegenden Sklaven- und Gummimarkte El Gedaref ziehen, oder er verläßt den Blauen Nil schon früher bei Abu-Haras und gelangt durch das Gebiet der Schukerié-Araber nach dem genannten Marktplatze. Von hier aus geht nun in südöstlicher Richtung die vielbesuchte Karawanenstraße am Elephantengebirge oder Ras el Fil vorbei in die Negerrepublik Galabat. Dieser merkwürdige Grenzstaat, der von sehr fleißigen Schwarzen – Takruri – bewohnt wird, die aus Darfur und Wadaï stammen und auf den Mekka-Wallfahrten hier sitzen blieben, hat sich unter einem Oberhaupte – Schum – eine Art von Selbständigkeit zu bewahren gewußt, die er allerdings durch gleichzeitige Abgaben an Aegypten und Abessinien theuer erkauft. Die Hauptstadt Metemmé ist ein bedeutender Marktort, unfern vom Atbara. Auch haben die Baseler Missionäre hier eine Station errichtet, die indessen ganz erfolglos blieb.
Metemmé, nur wenige Meilen von der abessinischen Grenze gelegen, ist in der letzten Zeit ungemein häufig von europäischen Reisenden besucht worden, so von Baker, Schweinfurth, Graf Krockow, v. Heuglin. Das Hinaufsteigen in die Hochlande ist hier nicht sehr schwierig, keinenfalls so mühevoll wie von Massaua aus. Auch wir wollen hier in das Land eindringen und zwar unter der Führung G. Lejean’s, eines französischen Reisenden, der sich um die Wissenschaft schon bedeutende Verdienste erworben hat.
G. Lejean’s Reise durch Abessinien.
Metemmé. – Der Markt Wochni. – Grenzwächter. – Eine abessinische Festung. – Eine deutsche Familie. – Das Land am Tanasee. – Schnapphähne. – Missionsstation Gafat. – Gefangennahme Lejean’s durch König Theodor. – Theodors Löwen. – Gondar und seine Bauten. – Wasserfall des Reb. – In einem Kloster. – Besuch in Korata. – Binsenflöße. – Der Tanasee. – Besteigung des hohen Guna. – Fünf Frauengenerationen. – Befreiung. – Hochebene Woggara. – Lamalmonpaß. – Reise durch Tigrié nach Massaua.
Guillaume Lejean ist ein vortrefflicher Mann. Er verbindet mit der Leichtigkeit und Liebenswürdigkeit echt französischen Wesens eine deutsche Gründlichkeit. Dabei ist er kühn, praktisch und vor keiner Gefahr zurückschreckend. Diese hervorragenden Eigenschaften machten ihn zum Forschungsreisenden besonders geeignet, wozu noch sein offizieller Charakter als französischer Konsul ihm mancherlei Erleichterungen verschaffte. Bekannter wurde er zuerst durch eine Abhandlung über die verwickelte Ethnographie der europäischen Türkei, die er nach allen Seiten hin bereist hatte. Als die große Zeit der Nilquellenentdeckungen war und Speke, Grant, Baker ihre Erfolge errangen, beschloß auch Lejean sein Theil zur Lösung des Problems beizutragen; er ging den Weißen Nil hinauf, untersuchte dessen Nebenfluß, den Gazellenstrom, und kam bis Gondokoro. Hier warf ihn jedoch das klimatische Fieber dergestalt nieder, daß er umkehren mußte. Nun wandte er sich nach Nubien, besuchte Kassala, eine der bedeutendsten Städte [pg 177]im östlichen Sudan, und durchstreifte die Bogosländer. Von der französischen Regierung zum Konsul in Massaua ernannt und mit einer Mission an den König Theodor von Abessinien betraut, ging er abermals nach dem Sudan. Im Dezember 1862 finden wir ihn dann zu Metemmé in Galabat, um weiter nach Abessinien vorzudringen. Von hier ab lassen wir ihn seine an persönlichen Abenteuern reiche Reise auszugsweise selbst erzählen.
Von dem deutschen Missionär Eperlein, einem Badenser, wurde ich sehr freundlich aufgenommen. Bei ihm befand sich ein junger Engländer, Namens Dufton, der, gleichfalls vom Missionseifer getrieben, aus freien Stücken sich hierher begeben hatte, um ein Noviziat durchzumachen und dann als Glaubensbote weiter zu ziehen. Er war ein gutes Exemplar jenes frostigen Enthusiasmus, welcher seine Landsleute in religiösen Dingen auszeichnet und zu so originellen Thaten treibt. Obgleich er als der Sohn eines reichen Fabrikanten in Leeds gemüthlich zu Hause hätte leben können, beschloß er dennoch, gleich Krapf oder Livingstone Missionsreisen anzutreten. Nur mit acht Guineen in der Tasche wanderte er nach Schwaben, wo ihm Krapf anrieth, die Galla zum Christenthum zu bekehren. Er ging dann nach Aegypten, den Nil aufwärts nach Chartum, lud dort sein winziges Gepäck auf einen Esel, den er vor sich hertrieb, erlitt in Gedaref einen heftigen Fieberanfall und langte mit drei Thalern in der Tasche in Metemmé an. Ich schlug ihm vor, sich meiner kleinen Karawane anzuschließen; er würde so als mein Sekretär angesehen werden und ohne Schwierigkeit die abessinische Grenze passiren können. Gern ging er auf meinen Vorschlag ein, und ich gewann einen tüchtigen, sehr gebildeten Reisegefährten, welcher sich in schwierigen Lagen voller Muthes erzeigte.
Auf dem wohlversorgten Markte von Metemmé kaufte ich zwei abessinische Maulesel, zu 9 Thaler das Stück, und miethete außerdem ein Kameel, welches mein Gepäck bis Wochni bringen sollte, wo die steilen Bergabfälle beginnen und Lastesel an die Stelle des Schiffs der Wüste treten. Nach viertägigem Aufenthalt in Metemmé sagten wir endlich dem braven Eperlein Lebewohl, traten die Reise nach Abessinien an und gelangten zunächst in einen dichten Wald, der sich drei Tagereisen weit bis an den Fluß Gandova (Nebenfluß des Atbara) hin erstreckt. Dies ist der Grenzstreifen oder Border, wie man in Schottland sagen würde, der von den Aegyptern und Abessiniern als neutrales Land betrachtet wird, den aber beide Theile schon häufig mit ihrem Blute getränkt haben. Am dritten Tage passirte ich die noch stark angeschwollene Gandova, an der Stelle, wo die kleine Insel Kaokib den Karawanen den Durchgang erleichtert; mitten auf derselben erhebt sich ein prachtvoller Tamarindenbaum, welcher die Reisenden zur Rast in seinem kühlen Schatten auffordert.
Gegen Abend gelangten wir an die erste jener stufenförmigen Terrassen, welche ringsum fast ganz Abessinien begrenzen. Wir erklommen sie mit einiger Schwierigkeit und fanden auf dem Gipfel ein schönes Plateau, auf welchem man gerade das dürre Gras und Kraut behufs der Bestellung der Felder abbrannte. Hier wurde das Nachtlager aufgeschlagen, das Gepäck abgeladen, schnell zu [pg 178]Abend gegessen und der müde Körper auf dem Boden zum Schlafe ausgestreckt. Wir hatten nur kurze Zeit geruht, als sich ein wüster Lärm erhob; die Maulthiere begannen auszuschlagen und eins derselben riß sich los. Unser Diener schoß aufs Gerathewohl in die Finsterniß hinein. Wahrscheinlich hatte eine freche Hyäne einen Ueberfall versucht, war dabei aber gestört worden. Das freigewordene Maulthier lief nach Metemmé zurück, wo es mit einem tiefen Biß in der Weiche bei Eperlein ankam.
Schnell erhoben wir uns beim Morgengrauen von diesem unangenehmen Orte und gelangten nach vierstündigem Marsche in Wochni, dem ersten abessinischen Orte an, der wegen seines Wochenmarktes, wo die Baumwolle von Gallabat und Sennar verkauft wird, berühmt ist. (Abbildung siehe S. 85.) Ein für allemal muß ich hier bemerken, daß wir wegen unserer europäischen Kleidung oder wegen unseres fremdartigen Aussehens von den Eingeborenen keineswegs belästigt wurden.
Wochni liegt tief in einem dunklen feuchten Walde. Hierher kommen die südlichen Gallastämme und Leute aus Tigrié, um Goldstaub und Elfenbein gegen Pulver, Tuch und Leinen einzutauschen; die Beduinen aus Ostsudan bringen ihre Pferde und aus Chartum langt Salz an, das in dem Reiche des Negus als Geld unentbehrlich ist. Die Wohnungen bestehen aus runden Hütten mit kegelförmigem Dache; außer Teppichen und Decken, welche als Divan dienen, sind darin keine Möbeln vorhanden.
Wir lagerten uns unter einem Baum, und unser Führer ging, um den Nagadras oder Zollwächter aufzusuchen. Unterdessen blätterte ich in einem illustrirten Buche, während Dufton die hohe steile Basaltterrasse des Maschelagebirges zeichnete, die sich nördlich von Wochni mit senkrechten Rändern 1800 Fuß hoch erhebt. Neugierig, doch ohne uns gerade zu belästigen, kamen die Leute des Ortes heran. Ein junges Mädchen fragte mich, ob ich ein Christ sei, und als ich ihre Frage bejahte, zeigte sie mir ihre blaue seidene Halsschnur und forschte dann weiter, ob ich auch die Denghel Mariam verehre? „Ja wohl, die Jungfrau Maria, die Mutter Christi!“ lautete meine Antwort. Nichts kommt der Verehrung gleich, mit welcher die Abessinier der Mutter Maria ergeben sind; hierin liegt einer der zahlreichen Punkte, in welchen die Religion der Abessinier mit jener der romanischen Völker übereinstimmt. Die deutschen und englischen Missionäre mit ihrer kalten und schwerfälligen Logik haben ungeschickterweise gegen dieses Nationalgefühl, eine der schönsten Formen des Frauenkultus, geeifert und aus diesem Grunde, glaube ich, sind auch alle ihre Missionsbestrebungen erfolglos geblieben.
Der Nagadras kam an. Nach einigem Wortwechsel bedeutete er uns, daß er über unsere Zulassung in das Reich erst mit dem Bel-Amba-Ras Gilmo, dem Markgrafen oder Grenzwächter der vier Grenzprovinzen Tschelga, Sarago, Dagossa und Ermetschoho unterhandeln müsse. Bel-Amba-Ras Gilmo bestellte uns nach seinem Aufenthaltsort, dem Dorfe Kamauchela, welches auf dem Gipfel eines steilen, fast unzugänglichen Berges liegt, einer Amba, wie derselbe [pg 179]in Abessinien genannt wird. Vier Tage brachten wir noch in Wochni zu, worauf wir dann auf Gilmo’s Befehl, geführt von einem Diener des Zollwächters, nach Tschelga aufbrachen.

Der Weg führt durch das Bel-Wocha-Thal, das der Kolla Abessiniens angehört. An einzelnen Stellen zeigt dasselbe einen breiten Bambusgürtel, der über die Hügel sich hinzieht und fast alle übrige Baum- und Strauchvegetation erdrückt hat. Andere Stellen zeigen prächtigen Blumenflor. Weiße Schwertwurz (Gladiolus) und Asphodelusarten, Muscari, Arum und düster erscheinende Takka; im Grase steht häufig die Kämpferia, deren breite gelbe Blüte sich mitten zwischen vier großen, platt auf der Erde liegenden, hellgrünen, rothgesäumten Blättern, die in einigen Gegenden als Salat genossen [pg 180]werden, erhebt. Dazu gesellen sich Orchideen, großblütige Amaryllis und Haemanthus mit scharlachrothen Blütenknöpfen. Prächtig leuchtet vor allen andern Pflanzen der Oenanthus multiflorus uns entgegen. Ueber Gestrüpp und Gestein führt in Zickzacklinien an steilem Gehänge fort durch enge Tiefthäler der Weg aufwärts; dann folgt eine Ebene, von der man zum ersten Male einen weiten Blick in das gesegnete Land Abessinien hat. Von hier aus genießt man eine herrliche Aussicht auf die Ebene von Tschelga und Dembea, auf den weiten Spiegel des Tanasees mit seinen Inseln und die hohen Berge jenseit desselben, die Guna und südöstlich auf die Alpen Godschams.
Unter strömendem Regen langten wir in Tschelga an, und dort wollten die ungastlichen Eingeborenen, da wir keinen Mursal oder Paß besaßen, uns zwingen, unter einem Baume zu kampiren, bis unsere Angelegenheit geordnet sei. Ich miethete jedoch zu dem mäßigen Preise von einem Stück Salz täglich ein Haus, das zu beziehen unser Führer, der Diener des Nagadras, uns jedoch verhindern wollte. Dufton, hierüber aufgebracht, stellte sich in nationale Boxerposition und schrie den Diener an: „Also du willst uns auch ein trockenes Obdach verwehren? Piff, paff, da hast du eins!“ Nun drehte sich der Diener im Kreise, aber ein baumstarker Abessinier hielt Dufton fest, und die Lokalpolizei intervenirte. Nach langem Streiten erreichten wir dennoch unsern Zweck fürs erste: ein schützendes Gemach.
Ich will die Leser nicht damit langweilen, wie der Bel-Amba-Ras uns volle 19 Tage in Tschelga aufhielt, unter dem Vorwande, erst Befehle vom Negus Theodor einholen zu müssen. Ich argwöhne nur, daß er mich für einen Missionär hielt und auspressen wollte. Zuletzt ungeduldig geworden, beschloß ich, ihn in seiner luftigen Felsenfestung aufzusuchen. Gefolgt von Dufton, einem Takruri-Dolmetscher und einem Soldaten, der uns als Wache beigegeben war, machte ich mich nach der Amba auf den Weg, die nordnordöstlich von Tschelga liegt. Am ersten Abend schliefen wir, vier Stunden von der Stadt entfernt, in einem muhamedanischen Dorfe, dessen Einwohner in dem christlichen Abessinien dieselbe gedrückte Stellung einnehmen, wie die Christen in der muhamedanischen Türkei. Mit dem Morgengrauen brachen wir wieder auf und erklommen eine Terrasse, von der aus wir den ersten Blick auf die Amba werfen konnten. Vor Verwunderung über das herrliche Naturgebilde standen wir beide ganz überrascht still. Man stelle sich am Ende einer mit grünenden Hügeln überzogenen Terrasse einen jäh und steil abfallenden Felsenberg von 700 bis 800 Fuß Höhe vor, also doppelt so hoch als unsere höchsten Thürme und fast ebenso gerade aufschießend wie diese, begrenzt von den bewaldeten Thälern, die sich nach dem Goang, wie man hier den Atbara nennt, hinziehen. Ein Felsen, der in eine Plattform endigt, etwa von der Größe der Place de la Concorde in Paris, und der weit und breit die umliegende Ebene beherrscht, verbindet sich wie eine Art von Vorwerk mit der Festung. Ein Felsgrat, so eng, daß zwei Personen nebeneinander ihn nicht passiren können, führt zu dieser, und der Fußgänger, welcher auf ihm hingeht, hat keinerlei Schutz zur Seite, [pg 181]welcher seinen Fall in den gähnenden Schlund rechts oder links verhinderte. In diesem wilden Gibraltar wohnte der abessinische Feudalherr, dessen kleiner pomphafter Hof lebhaft an die merovingischen Herzöge zur Zeit Gregor’s von Tours erinnert. Doch war es hier nicht das erste Mal, daß ich jene Sitten noch in voller Ausübung fand, welche in meinem Vaterlande vor acht oder zehn Jahrhunderten herrschten, und manche dunklen Verhältnisse unsrer Geschichte wurden mir erst durch den Augenschein im heutigen Abessinien klar vor Augen geführt.
Wir schritten ohne Zögern die schwindlige Brücke entlang, die jener gleicht, welche in den muhamedanischen Legenden aus dem Paradiese in die Hölle führt, und nachdem wir ein Thor erreicht hatten, das von halb entblößten Lanzenträgern bewacht war, kletterten wir langsam einen abschüssigen Abhang hinan, passirten ein zweites Thor und standen nun auf einer Plattform, wo uns Gilmo’s Leute in eine Art Wartesaal führten, indem sie uns bedeuteten, daß der Bel-Amba-Ras gerade mit einem Botschafter des Negus verhandle, daß wir aber nach dessen Abfertigung sofort eingelassen werden sollten.
Nach Verlauf von zwei Stunden führte man uns in einen weiten, mit Dienern, Vasallen und Leibwächtern angefüllten Raum, in welchem der Festungskommandant auf einer Alga ruhte. Seine dunkeln Gesichtszüge zeigten zur Genüge an, daß er von Ursprung ein Gamante (vergl. S. 88) sei, welches Volk in diesen Grenzprovinzen sehr zahlreich wohnt und die großen Sykomoren verehrt. Er hielt eine „Berille“, weitbauchige Flasche von antiker Form mit langem Halse in der Hand und war schon angetrunken. Uns zutrinkend wünschte er nichts sehnlicher, als uns in den gleichen Zustand versetzt zu sehen. Ich trug ihm meine Bitte vor, das Weihnachtsfest bei meinen „europäischen Brüdern“ in Dschenda zubringen zu dürfen. So nannte ich nämlich die dort wohnenden Missionäre, von denen ich in der Folge manche Unterstützung zu erhalten hoffte, und mit großer Genugthuung vernahm ich alsdann seinen Ausspruch: „Etsche! Ich willige ein“. Durch diesen guten Anfang kühner gemacht, bat ich ihn um die Erlaubniß, seine Festung abzeichnen zu dürfen, die ich für ein Weltwunder erklärte. Er wurde ernst und sagte: „Hast du in unserm Lande etwas verloren? Hat man dich bestohlen? Sprich, und ich will dir Gerechtigkeit widerfahren lassen!“ Nichts dergleichen, antwortete ich. „Dann“, nahm er das Wort, „hast du auch nichts zu verlangen, und aus welchem Grunde willst du diesen Ort „abschreiben“, um dich später seiner zu erinnern?“ Sein Mißtrauen lag klar auf der Hand, ich schwieg weislich still und nahm dankend Abschied. Kaum in mein Quartier zurückgekehrt, erhielt ich vom Bel-Amba-Ras einen Hammel, einen Krug mit Honigwein, sowie Brot zugeschickt und hielt mit Dufton eine köstliche Mahlzeit. So war die Audienz gut abgelaufen und wir kehrten nach Tschelga zurück, um uns zur Abreise vorzubereiten.
Vor uns leuchtete der herrliche Tanasee, wie ein von Smaragden eingefaßter Saphir. Er ist ein großes vulkanisches Becken von außerordentlicher Tiefe, auf dem die Stürme heftig hausen. Zwanzig Ströme und Bäche speisen [pg 182]ihn, führen aber auch zur Zeit der Sommerregengüsse ihm große Mengen von Schlamm zu und ändern dadurch stets seine Grenzen. Reizende Inseln, auf welchen Kirchen und Klöster sich im Grün der Bäume verstecken, unterbrechen anmuthig seine Fläche und verleihen dem lieblichen Bilde Abwechselung.
Die Reise von Tschelga nach Dschenda wurde in drei Stunden ohne bemerkenswerthen Vorfall zurückgelegt. Eine halbe Stunde hinter Tschelga passirten wir den Goang, welcher an seiner nahen Quelle, dem Gesetze aller abessinischen Ströme folgend, eine Spirale um den Berg Anker herumzieht. Die Braunkohlen, auf welche 1855 bereits Krapf aufmerksam machte, wurden auch von mir in dieser Gegend gesehen. Später ließ König Theodor diese Lager durchforschen, um seine Werkstätten in Gafat damit versehen zu können. In Dschenda wurde ich von einem großen jungen Manne empfangen, der mit der abessinischen Schama, türkischen Pantoffeln und einer europäischen Mütze bekleidet erschien. Es war der deutsche Missionär Martin Flad, welcher sich mit der Bekehrung der in dieser Gegend sehr zahlreichen Juden befassen darf. Er stellte uns seine Frau vor, welche Diakonissin im Institute des Bischofs Gobat zu Jerusalem gewesen war. Diese deutsche Familie erschien mir in jeder Beziehung musterhaft und außerordentlich gastfrei, ein Lob, das ihr alle jene Reisenden ertheilen müssen, welche auf dem Wege über Dschenda nach Abessinien eindrangen. Ich blieb vier Tage in Dschenda und unterhielt mich mit Flad viel über den König Theodor II., der ihm große Gunst bezeugte und ihn ganz anders behandelte als seine Kollegen Stern und Rosenthal (Flad gehörte jedoch sammt seiner Frau auch zu den Gefangenen in Magdala). Er erzählte mir, daß vor der Thronbesteigung Theodor’s in Dschenda kein Markttag verging, ohne daß einige Mordthaten vorkamen, daß aber unter der neuen kräftigen Regierung dieselben fast ganz aufgehört hätten.
Am 1. Januar 1863, nachdem ich meinem liebenswürdigen Wirthe ein glückliches neues Jahr gewünscht, verließ ich ihn und seine drei Kollegen Steiger, Brandeis und Cornelius, um nach Debra Tabor zum Negus Theodorus II. zu reisen. Wir durchzogen eine weite, fruchtbare, von vielen Bächen durchschnittene Ebene, in der zahlreiche Dorfschaften zwischen Getreidefeldern und Gärten mit rothem Pfeffer zerstreut lagen. Hier ist das Eden Abessiniens, die Provinz Dembea mit der Hauptstadt Gondar, der reichste und am besten bebaute Boden des ganzen Kaiserstaates. Ich passirte die Nordostecke des Tana-Sees und gelangte in die schöne Ebene Arno-Garno, wie sie nach dem vorzüglichsten, sie durchschneidenden Flusse heißt. Mir zur Rechten lag der glänzende Spiegel des Sees, zur Linken eine hohe Reihe Berge, die in der Amba Mariam, dem Marienberge, bei Emfras ihren malerischesten Gipfel zeigten. Anderthalb Meilen von Emfras erhebt sich auf einem Hügel am Ufer des Arno ein unter der Regierung des Negus Fasilides von den Portugiesen erbautes Schloß Qusara Giorgis, dessen malerische Ruinen in diesem Lande der Strohhütten plötzlich eine ganz europäische Staffage hervorzaubern, sodaß man eine alte Burg am Rhein vor sich zu sehen glaubt.
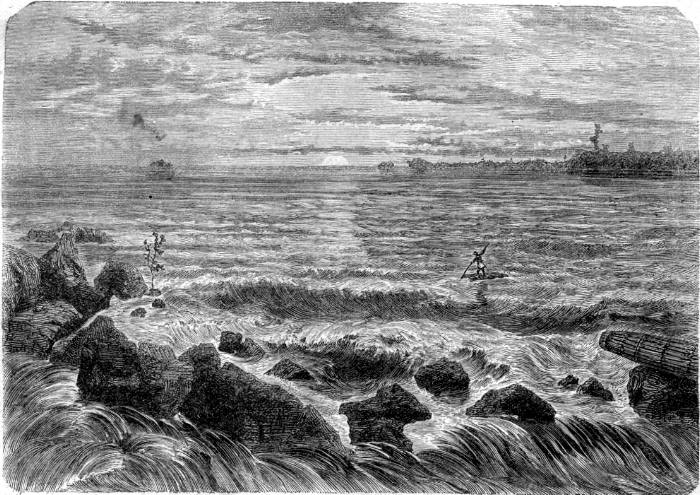
Zwei tüchtige Stunden jenseit des Arno führt der Weg durch das wilde und meist unfruchtbare Hügelland von Tisba, das nichtsdestoweniger stark bevölkert ist; jetzt sind die Einwohner friedliche Leute, vor nicht zu langer Zeit waren sie jedoch räuberisches Gesindel; aber König Theodor II. hat ihnen die Lust zum Straßenraube benommen. Als er 1855 den Thron bestieg, erließ er eine Proklamation, in welcher er sagte, daß Jedermann wieder zu der Beschäftigung seiner Väter zurückkehren möge; der Soldat zum Pflug, der Kaufmann zu seinen Waarenballen. Die Leute von Tisba, welchen dieser Befehl mißfiel, kamen remonstrirend und bis an die Zähne bewaffnet in das Lager des Königs. „Lang lebe Se. Majestät! riefen sie aus. Wir erscheinen hier nur, um besondere Erlaubniß zu erhalten, zum Geschäfte unserer Väter zurückkehren zu dürfen!“
„Und was war dies für ein Geschäft?“
„Schnapphähne und Straßenräuber waren alle, Väter und Kinder.“
„Wollt ihr nicht lieber“, antwortete ihnen der Negus, „friedliche Bürger werden? Ich will euch die Mittel dazu an die Hand geben. Das Vergangene ist euch verziehen; ihr erhaltet Grund und Boden, das nöthige Vieh und Ackerpflüge. Nehmt ihr dieses an?“
„Niemals! Wir berufen uns auf das Edikt...“
„Das ist euer letztes Wort?“
„Ja wohl!“
„Gut; kehrt heim.“
Vergnügt reisten die Schnapphähne nach Tisba zurück, indem sie den Negus eingeschüchtert zu haben glaubten. Doch sie kannten diesen Mann noch nicht. Kaum waren sie zurückgekehrt, als ein berittenes Corps in Tisba anlangte, dessen Kommandant folgendermaßen zu ihnen sprach: „Meine Lieben! Es ist möglich, daß euch der Kaiser Lalibela die Erlaubniß gab, Straßenraub zu treiben, aber Kaiser Claudius, der gleichfalls heilig gesprochen wurde, hat die Gensdarmerie (Neftenja) autorisirt, alle Strauchdiebe niederzumachen. Neftenjas, gebt Feuer!“
Die Ueberlebenden nahmen sich die ihnen ertheilte Lektion aufrichtig zu Herzen, und die Leute von Tisba, die heutzutage die Felder bebauen, sind ganz brave Menschen geworden.
Von Tisba an steigt der Pfad längs den östlichen Vorbergen an und wird dann eben bis zu dem Marktflecken Eifag an der Kirche Bada oder Bata (d. h. Empfängniß). Jene ganze Gegend war einst berühmt wegen der vor Alters eingeführten Weinkultur, die allerdings jetzt gänzlich darniederliegt. Eifag ist keine eigentliche Stadt, sondern besteht aus vielen zerstreuten Dörfern und Kirchen. Um die Kirche Bada zieht sich ein prächtiger Juniperus-Hain. Der Marktplatz ist sehr ausgedehnt; der Nagadras (Zollbeamte) erhebt von jeder Waare hier eine gewisse Abgabe. An jedem Mittwoch versammeln sich an diesem wichtigen Stapelplatze, von dem aus der Handel zwischen dem Süden und Norden Abessiniens von Godscham bis Massaua vermittelt wird, die Händler [pg 185]von weit und breit mit Vieh, Tabak, Kaffee, Baumwolle, Baumwollenstoffen, Glasperlen, Wachs, Salz, Honig, Häuten, Hülsenfrüchten, Getreide, Butter, Schwefel, Salpeter, Honigwein und Bier.
In Eifag hatte ich eine herrliche Aussicht auf die schöne Ebene von Fogara, welche sich bis an den Berg Dungurs erstreckt. Der östliche Theil derselben ist durchaus flach und wird vom Hirtenvolke der Sellan durchschweift. Im Westen dagegen steigt das Terrain an, dort erheben sich, bewaldet, mit Dörfern und Kirchen besäet, die Berge von Begemeder. Nach dreistündigem Marsche langen wir am Flusse Reb an, den wir auf einer immer mehr zerfallenden Brücke von sieben Bogen passiren, deren Bau noch unter dem Kaiser Fasilides vor mehr als 200 Jahren stattfand. Die Pfeiler haben dem Zahne der Zeit gut widerstanden, allein die Bogen werden bald von der wüthenden Flut hinweggerissen werden, da der Reb in der Regenzeit große Massen von Schlamm mit sich führt, immer mehr sein Bett erhöht und so der Wassermenge nur ein geringer Ausweg bleibt. Der Reb, welchen ich im April vollkommen ausgetrocknet sah, ist zwei Monate später ein prächtiger Strom, größer als die Seine bei Paris. Die Abessinier, obwol sie vortreffliche Schwimmer sind, hüten sich dann, ihn zu passiren, da sie fürchten, daß gewisse Wassergeister sie in den Abgrund ziehen könnten. Unter den Pflanzen, die ich in dieser Ebene bemerkte, nenne ich die schöne Methonica superba, welche von den Abessiniern Marienkelch genannt wird. Sie gehört zu den Lilien und gleicht in ihrer Farbenpracht einer Flamme im dunklen Laubgrün.
Die Nacht brachten wir in einem Dorfe in der Nähe der Brücke zu; am Morgen brachen wir dann nach Debra Tabor auf. Rechts von uns blieb ein einzelner, steiler und kahler Felsen, Amora Gedel, d. h. Geierfelsen, liegen, dessen Spitze ganz mit Raubvögeln bedeckt ist. Durch einen malerischen Schlund und sumpfige Wiesen führt ein Fußpfad zu dem Plateau von Debra Tabor hinauf. Als wir oben angelangt waren, blieben wir vor Verwunderung stehen. Vor uns lag ein leicht wellenförmiges Land, dicht besäet mit Dörfern, zwischen lachenden Kulturflächen und Weiden, auf denen zahlloses Vieh sich befand. Als Franzose wurde ich an die Bourgogne erinnert, während Dufton eine Landschaft Yorkshire’s vor sich zu sehen glaubte, und unwillkürlich rief ich aus: „Hier ist gut Hütten bauen!“ Rechts von uns blieb der Hügel von Debra Tabor mit seinen 500 oder 600 Häusern und dem königlichen Lager liegen. Denn Theodor II. hat hier große Getreidemagazine errichtet, die seine Armee in Kriegszeiten, d. h. so ziemlich immer, zu versorgen haben. Gondar, „die Stadt der Pfaffen und Schauspieler“, wie der König sich ausdrückt, ist ihm zuwider. Endlich erreichte ich den Hügel von Gafat, nordöstlich von Debra Tabor, das provisorische Ziel meiner Reise. Der deutsche Missionär Waldmeier, an den ich empfohlen war, nahm mich sehr freundlich auf; auch seine Kollegen, fast lauter Badenser und Württemberger kamen herbei. Der einzige Franzose der kleinen Kolonie, Franz Bourgaud aus Saint-Etienne, ist der Waffenschmied des Negus und bei diesem sehr beliebt. Er giebt vor, sich recht unglücklich zu [pg 186]befinden, und verlangte schon mehrere Male in seine Heimat zurückkehren zu dürfen, aber Theodor antwortete ihm auf sein Gesuch: „Mein Sohn Bourgaud, deine Kinder sind noch zu jung, um die weite Reise überstehen zu können; bleib noch ein paar Jahre hier.“ Und Bourgaud blieb. Seine Kinder sprechen vorzüglich die Amharasprache, er selbst und seine Frau haben sich ein Mischmasch aus dieser und der französischen zurecht gemacht, das nur ihnen verständlich ist. Eigenthümer Gafats ist ein alter General außer Dienst von noblem Aussehen. Um sein Haus herum haben sich die Deutschen Waldmeier, Kinzle, Bender, Mayer, Salmüller und Hall angesiedelt. Alle haben Abessinierinnen heirathen müssen; Bender eine Tochter Schimper’s. Am zurückhaltendsten war der junge, hübsche Salmüller, welcher schließlich eine Tochter des Irländers Bell nahm. (Von letzterem wird weiter unten ausführlich die Rede sein).
Noch hatte ich den Negus nicht gesehen, als am 25. Januar plötzlich Waldmeier auf mich zukam und ausrief: „Dort kommt Se. Majestät!“ Ich ging mit ihm vorwärts und traf bald auf ein großes Gefolge hoher Offiziere, welche alle den Margef, die bordirte weiße Tunica, trugen. Mitten unter ihnen stand ein Mann, barhaupt und barfuß, in eine gemeine Soldatenschama gekleidet, welche keineswegs noch ganz weiß war; in der Hand hielt er eine Lanze, an der Seite hatte er einen gekrümmten Säbel. Wer mit den abessinischen Gebräuchen vertraut war, mußte sofort den Rang dieser Persönlichkeit erkennen; es war der einzige, welcher beide Schultern bedeckt hatte, und Niemand anders als König Theodor II.
Gut gelaunt redete er mich mit „Na deratscho (Wie geht es dir?)“ an. Die Etikette erfordert, daß man hierauf nicht antwortet und sich nur tief verneigt. So that auch ich. Theodor zog sich darauf zurück, setzte sich auf einen Teppich und fing an, mit dem kleinen Bourgaud zu spielen. Dieser sonderbare Mensch, dessen Leben so blutig verlief, beschäftigte sich gern mit Kindern, für die er eine große Zuneigung besaß. Nachdem er dann einige Höflichkeitsworte gewechselt, fragte er mich sehr verbindlich, wann ich offiziell empfangen sein wollte? Ich erwiederte, daß ich ganz zu seinen Befehlen stehe, worauf er den nächsten Tag zur Audienz in Debra Tabor bestimmte. Ich ward abermals gut von ihm aufgenommen, machte den ganzen Feldzug in Godscham mit, der nicht besonders glücklich ausfiel, und kehrte dann mit ihm in das Lager von Debra Mai in Mietscha zurück. Unterdessen waren verschiedene Umstände vorgekommen, welche meine Anwesenheit auf dem Konsulatsposten dringend erforderten; ich begab mich deshalb in voller Uniform zum Negus, um ihn um eine Abschiedsaudienz zu bitten. Er ließ drei Europäer herbeirufen, welche die Amharasprache redeten, und fragte dann, was ich wolle. Ich antwortete: „Ich wünsche, dringender Angelegenheiten wegen, nach Massaua abzureisen, und dann will ich von dort zwei Kisten mit Geschenken für Ew. Majestät von meinem Souverän abholen, welche bereits angelangt sein dürften. Ich möchte auch gern gleich abreisen, damit ich vor Eintritt der Regenzeit wieder zurück sein kann.“
Um zu verstehen, was nun folgt, muß man wissen, daß Theodor durch [pg 187]den unglücklichen Feldzug in Godscham gedemüthigt war, daß die Aegypter damals gerade die Grenzprovinz Galabat besetzt hielten und daß er infolge des Genusses von schlechtem Cognac betrunken war. Kaum hatten die Dolmetscher ausgeredet, als der Negus in höchster Wuth rief: „Ich behalte ihn auf jeden Fall zurück. Nehmt ihn, legt ihn in Ketten, und wenn er entweichen will, so tödtet ihn!“
Der Oberst, welcher zunächst stand, winkte ein halbes Bataillon herbei.
„Wozu das, fragte Theodor, 500 Mann, um einen Menschen zu fesseln?“
„Ew. Majestät sehen, erwiderte der Oberst, daß er ein merkwürdig funkelndes Ding unter dem Arme trägt – es war mein goldbesetzter Konsulatshut –, das vielleicht eine Höllenmaschine ist, die uns alle tödten kann.“
„Donkoro, Dummkopf! Glaubst du nicht auch, daß er dich mit seinen Augenbrauen tödten kann. Sechs Mann her und nicht mehr.“
Nun wurde ich, wie mein treuer Diener Achmed, an Händen und Füßen gefesselt, obgleich ich in großer Uniform war, und in mein Zelt zurückgeführt, wo ich streng bewacht wurde. Indessen schrieb ich, auf einen Umschlag der Gemüthsverfassung des Königs bauend, an ihn einen englischen kurzen Brief, in welchem ich um Erklärungen bat. Am 3. März schon erschienen die Europäer wieder, welche mir anzeigten, daß ich frei sei, unter der Bedingung, daß ich in Gafat internirt bliebe. Ich zögerte anfangs, doch ging ich auf Kinzle’s Zureden, der meinte, es sei besser in Gafat als in Eisen weilen, auf diesen Vorschlag ein. Ueber den Negus selbst will ich hier nur wenige Worte sagen.
In den Audienzen, welche er gab, entfaltete er allen möglichen barbarischen Pomp. So liebte er es, dabei von vier zahmen Löwen umgeben zu sein, die sehr wild und grimmig drein schauten. Ich hatte Gelegenheit, mit denselben nähere Bekanntschaft zu machen. An einem hohen Festtage wurden sie von ihren Wärtern in mein Zimmer geführt, um ihre Aufwartung zu machen. Ein paar blanke Thaler verfehlten die Wirkung nicht, und ich konnte meine Gäste ruhig abzeichnen, wobei ich nur durch deren aufdringliche Zutraulichkeit gestört wurde. Der eine Löwe war von dem genannten Salmüller abgerichtet und dann an den Kaiser verkauft worden. Alle vier Löwen hatten ihre Namen; der Liebling des Kaisers hieß Kuara (der Stürmische). Dieses Halten und Züchten von Löwen steht übrigens bei den abessinischen Herrschern keineswegs als eine Ausnahme da und kam auch früher vor, wol deshalb, weil der Löwe als Sinnbild Aethiopiens angesehen wird. Als Salt 1810 beim Ras Wolda Selassié in Antalo eine Abschiedsvisite machte, bot dieser ihm zwei Löwen als Geschenk für den König von England an; „allein der weite Weg machte es unmöglich, sie fortzubringen. Eins dieser Thiere ward von seinem Wärter bisweilen in das Zimmer gebracht, wo wir saßen: aber während meines Aufenthaltes wurde es so wild und unlenkbar, daß man es einsperren mußte.“
Da mir der Negus Gafat zum Aufenthaltsorte angewiesen hatte, mit der Erlaubniß, im Innern des Reiches Ausflüge nach Belieben machen zu können, so zögerte ich nicht, dieses auszuführen, und stattete zunächst der Hauptstadt [pg 188]Gondar meinen Besuch ab. Von Gafat bis Ferka reiste ich zunächst den Weg, welchen ich auf meiner ersten Tour bereits beschrieb. Im genannten Orte trennt sich die Straße; links führt sie nach Tschelga, rechts nach Gondar. Ungeachtet des königlichen Befehls, daß ich in den Dörfern, wo ich übernachtete, gut beherbergt werden sollte, hatte ich mancherlei Verdrießlichkeiten zu bestehen, ja man bedrohte mich einmal sogar, und meine Leute flüchteten in Angst davon. Auf einer von den Portugiesen erbauten Brücke passirte ich den Fluß Magetsch, ohne welche zur Regenzeit die Verbindung zwischen Nord- und Südabessinien auf mehrere Monate im Jahre vollkommen gestört sein würde.
An Juniperusbäumen vorbei gelangte ich auf einen Hügel, der verschiedene Häusergruppen trug, zwischen denen sich wüste Plätze hinzogen. Ich war jetzt schon mitten in Gondar, ohne daß ich eigentlich die Stadt bemerkt hätte, und war nicht wenig verwundert über diese Kapitale der Kaiser Sosneos und Fasilides, von der ich mir eine durchaus andere Vorstellung gemacht hatte. Von welcher Seite aus man sich auch der Stadt nähert, fallen die vielen hohen Warten und Thürme, Zinnen und Mauern des in mittelalterlich-portugiesischem Styl erbauten Königspalastes und einzelne Kirchen mit großen kegelförmigen Dächern unter malerischen Baumgruppen zuerst in die Augen: ein heimisches Bild für den Wanderer, der sich plötzlich dem Innern des tropischen Afrika entrückt und in eine mitteleuropäische Landschaft versetzt glaubt. Ueber üppigen Wiesengrund an schmalblätterigen Weidenbäumen mit überhängender Krone hin rauschen klare Gebirgsbäche zu Thal und schlängeln sich, Silberfaden gleich, in der Ferne durch das grüne, flache Dembra, dem Tanasee zu. Das nördlichste Quartier der Stadt ist das Abun-Bed mit der Wohnung des Bischofs. Ein nach Westen fließendes Bächlein, kahle Flächen und Ruinenfelder trennen es von der politischen Freistelle, dem Etschege-Bed, mit dem Sitze des Vorstandes der Mönche, Etschege genannt. Auf einem freien, erhabenen Punkt, östlich von beiden, steht von einer runden Mauer umgeben, unter herrlichen Baumgruppen eine Kirche mit zwei von den Holländern dem Kaiser Jasu geschenkten Glocken. Südlich und östlich davon ist der Stadtbezirk Debra Berhan, Kirche des Lichts, mit gleichnamiger Kirche; westlich daran schließt sich der Gempscha-Bed oder Schloßbezirk. Von einer weitläufigen, unregelmäßigen Mauer, mit Zinnen und Wartthürmen und mit verwilderten Gärten und Kiosken umgeben, erhebt sich der große, leider mehr und mehr zerfallende Gemp oder das Schloß selbst, das neben den armseligen, mit Stroh gedeckten Häusern einen wahrhaft großartigen Eindruck macht durch seine massive Bauart, seine vielen Thürme, hohen Bogenfenster und weiten Höfe. Die Façade des Hauptgebäudes ist gegen Westen gekehrt und drei Thürme mit großen Thorbogen bilden die Eingänge zu dem einst gepflasterten, jetzt halb in Schutt und Gestrüpp begrabenen Vorhof. Der Hauptbau ist viereckig, zweistockig, mit flachem Dach und steinerner Brustwehr; auf jeder Ecke erhebt sich ein Thurm mit Cement-Kuppel, ein höherer viereckiger steht in der Mitte. Das Material ist ziemlich roher Basalt, die Einfassungen der Thore und Fenster bestehen aus rothem Sandstein. [pg 190]An das Hauptgebäude lehnen sich noch verschiedene Hallen, Galerien, Säle, Kapellen, Brücken und Thorwege an, Alles jetzt mehr oder weniger zerfallen und mit Schlingpflanzen überwuchert.
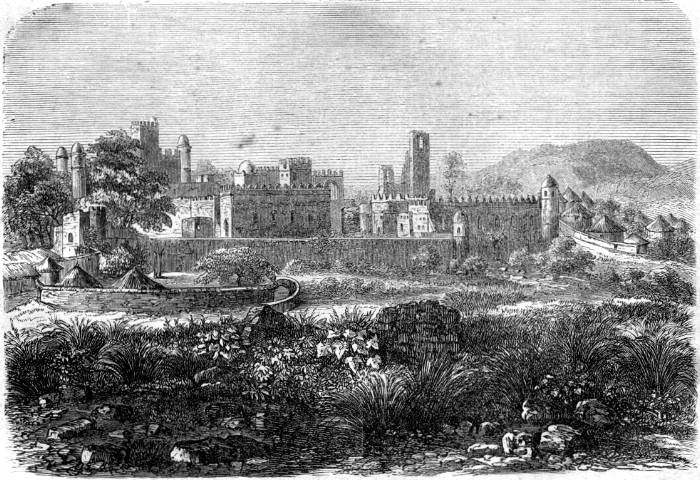
Südwestlich vom Gempscha-Bed breitet sich, von verschiedenen Quartieren umgeben, der große Marktplatz aus. Am Abhange und Fuße des Hügels liegt das Quartier der Muhamedaner, Islam-Bed, und südwestlich, jenseit des Kacha-Flusses, die Judenvorstadt, Falascha-Bed. Die Straßen Gondars sind eng und krumm, theils mit natürlichen Basaltplatten gedeckt, theils durch Schmuz und Schutt unwegsam gemacht. Die Einwohnerzahl dürfte 6000–7000 nicht übersteigen; doch war die Stadt einst volkreicher. König Theodor vernachlässigt sie „als Pfaffenstadt“ gänzlich, ja er hat einmal zur Strafe sein Heer gegen sie losgelassen, ihr enorme Geldbußen auferlegt und das Quartier der Muhamedaner zerstören lassen. Nicht weniger als 44 Kirchen, darunter sehr prächtige, bestehen in Gondar, und die Zahl der darin angestellten Geistlichen beträgt 1200, mithin ist jeder sechste Mensch ein Priester.
Nach außen hin ist Gondar offen, nur die Freistätte und verschiedene Kirchen sind mit größeren, halb verfallenen Mauern umgeben. An Trinkwasser ist großer Mangel, sodaß man in der trockenen Jahreszeit sich oft genöthigt sieht, aus dem Angrab- oder Kachaflusse das nöthige Wasser zu holen und das Vieh zur Tränke dahin zu führen. Ueber den letzteren Fluß führt nicht weit vor der Stadt eine alte, sehr malerische Brücke, die noch aus der Zeit der Portugiesen stammt, jetzt aber sehr im Verfalle begriffen ist. Am östlichen Ufer des genannten Flusses liegt nordwestlich von der Stadt auf einer grünen Wiesenfläche die Kirche Fasilides inmitten eines herrlichen Juniperuswaldes und umgeben von niedrigen Mauern mit runden Wartthürmen und Zinnen. Die viereckige steinerne Kirche ruht auf Schwebebogen in einem tiefen Bassin, über welches eine mit Eckthürmen befestigte Brücke führt. Eine großartige steinerne Wasserleitung auf hochgesprengten Rundbogen an der Westseite des Haines versorgte den Platz mit Wasser, das wahrscheinlich in ein Reservoir im südwestlichen Eckthurme geleitet wurde und dort Wasserwerke speisen mußte. Seines Zweckes wegen ist ein dicht bei dieser Kirche gelegener Tempel mit runder Kuppel merkwürdig. Es ist das Grabmal eines königlichen Streitrosses, man sagt von Negus Kaleb. Auch an Bädern mit Wasserleitungen und Nischen, sowie an anderen Zeugen einer ehemals regeren Baukunst und Baulust ist in der Nachbarschaft kein Mangel; doch die geringe Sorgfalt, die jetzt auf die verschiedenen Werke gewandt wird, droht sie dem gänzlichen Ruin zuzuführen.
Geht man von der Kacha weiter westwärts, so gelangt man in ein Seitenthal, in welchem an einem Bergabhange die malerischen Ruinen von Koskam liegen. Ziemlich gut erhalten ist noch das dortige Lustschloß mit zwei Thürmen, deren einer ein Kuppeldach trägt, während das des anderen einem niedrigen, umgelegten halben Cylinder gleicht. Zwischen beiden führt ein hohes Bogenthor in eine lange steinerne Halle mit großen Bogenfenstern und Thüren; das Dach fehlt; Balken zeigen noch die Spuren von Altanen oder Galerien. [pg 191]Das ganze Gebäude besteht wie der Gemp aus ziemlich rohen Basaltsteinen, die Thür- und Fensterpfeiler aber aus gut gearbeitetem rothen Sandstein. Zwischen reizenden Baumgruppen ragen die Reste eines anderen Prachtgebäudes, in dem, wie es scheint, eine Halle mit schön gearbeiteten Säulen hinführte, Alles ist aber verfallen und mit Gestrüpp und Schlingpflanzen überwachsen.
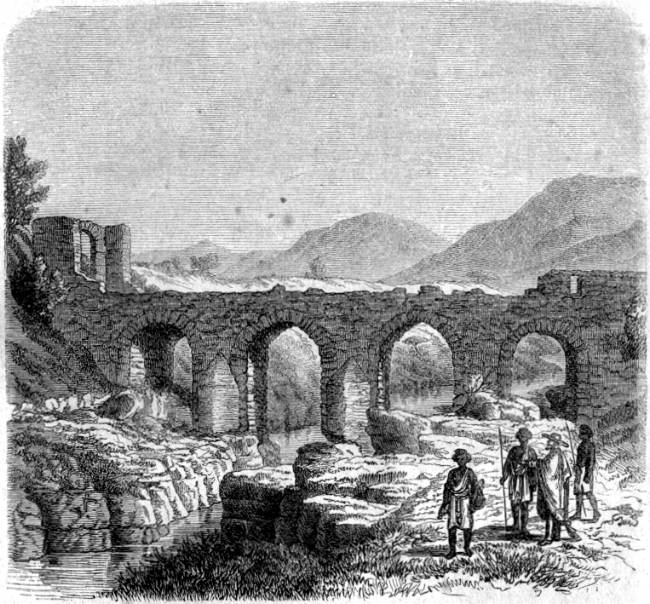
Noch weiter westlich, von hohen Mauern mit Zinnen und Thürmen umschlossen, ist die Kirche, eine Rotunde mit Strohdach und vielen Wandgemälden, die namentlich Reiterfiguren darstellen.
So ist das heutige Gondar und seine Umgebung beschaffen; überall auf Schritt und Tritt begegnet dem Reisenden Verfall, und doch könnte diese Stadt bei ihrer prächtigen Lage in der gesunden, fruchtbaren Gegend im Mittelpunkte Amhara’s zu einer großen Blüte gelangen – wenn nur ihre Bewohner anders beschaffen wären.
[pg 192]Man hatte mir viel von der kleinen Kirche Towari erzählt, die eine Stunde von meinem Aufenthaltsorte entfernt liegt, in welcher man die abessinische Malerei am besten studiren könne. Ich begab mich dorthin und fand auch dieses Gotteshaus, wie alle Landeskirchen, in einem dichten Hain von Juniperusbäumen versteckt. Die Gemälde, so berühmt in Abessinien, machten auf mich, der ich sie mit europäischen Augen ansah, im allgemeinen einen schauderhaften Eindruck. Indessen fesselte ein Bild des Abendmahls doch sehr meine Aufmerksamkeit, da auf demselben der Künstler hieratische Traditionen, byzantinische Malerei und Details des abessinischen Lebens merkwürdig miteinander verschmolzen hatte. Christus, die Jungfrau und die Abendmahlsgenossen sind nach der Tradition gekleidet und mit großem Kunstverständniß rings um einen Tisch gruppirt, der nach der feinsten abessinischen Art gedeckt ist. Vor jeder Person liegen Tiéfbrote, die zugleich die Schüsseln vertreten, zur Seite derselben die Messer zum Zerschneiden des Brundo (rohes Fleisch). Ein Major Domus, offenbar aus guter Familie, bietet zu trinken an; außerdem gehen Jünglinge mit Honigweinkrügen umher. Ein Theil der Jünger wendet die Gesichter gegen Christus, ein anderer gegen Maria. Die Züge dieser Hauptpersonen aber sind verfehlt; namentlich die der Maria. Abgesehen hiervon verdient das Bild jedoch alles Lob.
Als Begleiter auf meinen Ausflügen in die Umgebung Gafats diente mir ein junger Priester, der einige Zeit in der Propaganda zu Rom gewesen, dort aber nicht allzuviel gelernt hatte. Heimgekehrt, wollte er sich die Stelle eines Aleka bei einer reichen Kirche unrechtmäßig anmaßen; allein König Theodor nahm die Sache krumm und verurtheilte Michael, so hieß der civilisirte Geistliche, zu drei Jahren Kettenstrafe. Mir gegenüber wollte er sich nun als Glaubensmärtyrer darstellen, was mir ziemlich einerlei war; dagegen war er mir unschätzbar wegen seiner vortrefflichen Landeskenntniß.
Als er jedoch einige Monate später einen Salzdiebstahl beging, mußte ich ihn vor die Thüre setzen; anfänglich ging es ihm nun schlecht – dann begegnete er mir wohlgenährt und gut gekleidet wieder. Gott weiß, wie er zu Gelde gekommen sein mag; indessen dieser Art von Leuten geht es in Abessinien wie in Europa: sie fallen wie die Katzen stets wieder auf die Füße.
Eine meiner Exkursionen führte mich zur Fafatié oder dem Wasserfall des Rebflusses, der seine Quelle am Abhange des hohen Gunagebirges hat. Ich bestieg mein Maulthier, wandte mich nach Südosten und ließ zur Linken die große und fruchtbare Ebene von Gafat mit ihrem ausgetrockneten Strome liegen. Mit einiger Schwierigkeit wand ich mich durch das bewaldete Thal des Davezout und kam dann, einem schattigen Fußsteige folgend, zum Reb, der leise über ein mit dunkelblauen Steinen besäetes Bett dahinfloß. Der Wasserfall war nur fünf Schritt von mir entfernt: ich sah ihn nicht, aber ein schauderhafter Schlund und ein betäubendes Brüllen zeigten mir seine Gegenwart zur Genüge an. Um ihn von vorne zu erblicken, mußte ich auf einem Zickzackstege den Felsen hinabsteigen, der mit Buschwerk überzogen und von Affen belebt war. [pg 194]Unten angelangt, stand ich vor einem hübschen grünen See, in den von steiler Felswand eine senkrechte Wassersäule von 24 Fuß Höhe herabfiel. Ringsum zeigen sich die entzückendsten Landschaftsbilder, welche jeden Maler begeistern können.

Vier Monate später gewahrte ich dann den Wasserfall wieder zur Zeit seines höchsten Glanzes, als die Fluten hoch geschwollen waren. Er übertraf so die herrlichsten Kaskaden der Schweiz bedeutend. Die dreitausend oder viertausend Wasserfälle Abessiniens sind die schönsten, die man sich denken kann, und ihnen fehlt weiter nichts als der Ruf, den andere Kaskaden durch Künstler und Touristen sich erringen. Ich habe den zehnten Theil davon, etwa 300 oder 400 selbst gesehen und etwa zwanzig abgezeichnet – alle prächtige Naturerscheinungen, von denen eine einzige hinreichte, eine Gegend in Europa berühmt und zum Ziele der Touristenschwärme zu machen.
Ich riß mich von den Wundern dieser Fafatié los, um meinen Fuß in östlicher Richtung weiter zu setzen über eine Ebene, die ganz mit Mimosen bestanden war. Diese an und für sich langweiligen Bäume erhielten durch die reichlich von ihnen herabhängenden Schlingpflanzen ein ungemein malerisches Ansehen; namentlich zeichnete sich ein Loranthus mit schönen orangefarbenen und rothen Kelchblüten aus. Bald gelangte ich in das malerische Thal des Makar, eines Nebenflusses des Reb, in dem ich bis zu den Atkanafelsen vordrang, deren trapezoidale Form man von allen hochliegenden Punkten des Distrikts Debra Tabor aus zu übersehen vermag. Dieser Felsen ist eine wirkliche Amba, welche in Kriegszeiten oft genug als Zufluchtsort gedient hat. Am Fuße derselben fand ich zum ersten Male die Henset-Banane (vergl. S. 45) mit ihren kolossalen Blättern und rothen Rippen. Samen der nützlichen Pflanze habe ich der Akklimatisations-Gesellschaft in Paris überbracht; die Schößlinge, welche ich gleichfalls eingepackt hatte, wurden mir jedoch in Massaua kurz vor meiner Rückkehr von den Hühnern vernichtet. Hinter dem Atkana traf ich in wundervoller Gegend auf das Kloster Guref, das mir durch seine romantische Lage deutlich sagte, wie die Mönche es in Abessinien gleichwie in Europa verstanden, die schönsten Orte zur Anlage ihrer Klöster auszuwählen. Nach der Regel des heiligen Tekla Haimanot leben in prächtiger Einsamkeit diese Mönche inmitten eines schönen Haines, den der klare Waldbach durchfließt. Freilich der Anblick einer europäischen Abtei und derjenigen des abessinischen Klosters sind grundverschieden. Man stelle sich einen weiten Raum, von einer lebendigen Hecke umschlossen, vor, der wiederum durch Hecken in 12–15 kleinere Abtheilungen geschieden ist, deren jede eine Mönchshütte enthält und die durch ein Labyrinth von Straßen verbunden sind, welche schließlich im Mittelpunkte nach der spitzdachigen runden Kirche führen – und das abessinische Kloster ist fertig. Dazwischen liegen grüne freundliche Gärtchen, ringsum ein lachender Hain. Ich fand sogleich den Abt – wenn ich so sagen darf –, einen ernsten, mageren Mann von 45 Jahren, der die weiße Tunica und darüber eine Art von gelbem Pallium, das Zeichen seiner Würde, trug. Gastfreundschaft wurde mir im vollsten Maße zu Theil, allein mein Maulthier mußte ich außerhalb des Klosters [pg 195]lassen – weil es eine Stute war, wobei ich mich der lächerlichen Sitte erinnerte, daß auch in die griechischen Klöster auf dem Berge Athos kein weibliches Thier hinein darf. Ich wohnte dann bei den guten Mönchen und aß mit ihnen die einfache, aus Hülsenfrüchten bestehende Mahlzeit. In der Nacht erweckte mich Psalmengesang, jene Melodie, welche der alte Portugiese Alvarez „eine erbärmliche Harmonie“ nennt; indessen muß ich gestehen, daß dieser abessinische Gesang mindestens so gut klang, wie das Singen in unseren Landkirchen. Im Gedem oder geheiligten Asyle stand außerhalb des Klosters die Gemeindekirche, welche für beide Geschlechter zugänglich war; ihr Gründer war Ras Ali, der sie jedoch nicht vollenden konnte, da er von Theodor II. gestürzt wurde. Dieser that nichts weniger als Kirchen bauen; im Gegentheil er zerstörte und beraubte noch ein- oder zweihundert und zeigte sich als der echte abessinische „Pfaffenfeind“. Nach dem Besuche dieser Kirche kehrte ich nach Gafat zurück.
Um gute Samen der Henset-Banane zu erhalten, wollte ich einen Ausflug nach der Stadt Korata machen, welche Rüppell fälschlich Kiratza nennt. Es ist eine kleine Stadt am südöstlichen Ufer des Tanasees, die wegen ihres starken Handels und der zahlreichen Geistlichkeit berühmt geworden ist. Da die Regen erst im Beginnen waren, so konnte ich darauf rechnen, daß der Fluß Gomara noch durch irgendeine Furt zu passiren sei, und ich beschloß deshalb in gerader Linie, an den heißen Quellen von Wanzagié vorbei, nach Korata vorzudringen. Debra Tabor blieb zur Linken liegen. Das niedrige Hügelland, durch das mein Weg ging, war im Jahre 1841 der Schauplatz einer Schlacht zwischen dem Detschas Ubié von Tigrié und dem Ras Ali. Letzterer wurde glänzend geschlagen und einige seiner Offiziere begaben sich, um sich zu unterwerfen, zu dem Sieger Ubié, der, in seinem Zelte sitzend, ruhig sich in Honigwein betrank. Als Ubié die Feinde erblickte, wurde er ängstlich, da er keine seiner eigenen Soldaten bei sich hatte; erstere aber benutzten diesen Umstand, banden Ubié und machten ihn zum Gefangenen. Auf diese Nachricht kehrte der geschlagene Ras Ali zurück; doch mußte er Ubié, um der Volksstimme zu genügen, wieder freigeben. Die Vegetation auf dem einst blutigen Schlachtfelde war eine prächtige; namentlich fielen mir weiße Lilien (Amaryllis vittata) von lieblicher Form auf, welche die daran gewöhnten Abessinier gar nicht beachteten, während ich jede dieser Blumen bedauerte, welche mein Maulthier niedertrat.
Am Ufer eines frischen Baches wurde Mittagsrast gemacht. Was mich hier am meisten überraschte, war eine lange, in Ruinen liegende Mauer von europäischer Konstruktion. Ich folgte derselben und fand, daß sie einst als Einschließung eines Parkes gedient hatte, welcher der Lieblingsaufenthalt verschiedener Kaiser gewesen sein soll. Man nannte den Ort Arengo. Seine Lage ist reizend – aber da, wo einst die Erben der Königin von Saba thronten, findet man nun Ruinen, zwischen denen lärmende Affen hausen. Theodor II., welcher seine Vorgänger im Kaiseramte gründlich verachtet und sie „Schauspieler“ nennt, behauptet, daß die jetzigen Gäste in Arengo, eben jene Affen, mehr werth sind als die alten, die Kaiser! Vor 170 Jahren, zur Zeit des [pg 196]Reisenden Poncet, war das Schloß noch nicht zerstört, ja nach dem Hörensagen sollte es größer als der Gemp in Gondar sein! Sicher hatten die Abessinier dem Franzosen gegenüber aufgeschnitten, denn sie verstehen dieses Geschäft so gut wie die Yankees. Ein abessinischer Gesandter, welcher 1860 in Paris war und dort sich überall umgesehen hatte, antwortete seinen Landsleuten, die ihn nach jener Stadt fragten: „Paris ist etwa so groß wie Gondar; vielleicht ein klein wenig größer.“
Im Dorfe Schumagina wurde meiner Reise plötzlich ein Ziel gesetzt.
Die reichen und stark bevölkerten Distrikte Wanzagié, Fogara Dera, Korata bildeten das Land, welches ich zu durchreisen hatte. In einem dieser Distrikte hatten sich Rebellen aus Godscham zu verbergen gewußt, indem sie die Wachsamkeit der am Abaï aufgestellten Leute Theodor’s zu täuschen wußten. Für dieses Vergehen, an dem doch die ganze Einwohnerschaft der vier Distrikte keineswegs schuld war, wurden dieselben von Theodor der Armee zur Plünderung überwiesen, worauf die ruinirten Bauern mit ihrer Habe in die Berge und Wälder flüchteten. Als der Negus dies sah, verordnete er, daß nur die Schuldigen bestraft werden, die übrigen aber frei ausgehen sollten. Kaum hatten die letzteren, den Worten vertrauend, sich wieder in ihre Quartiere begeben, als ein General hinterlistig über sie herfiel und ihnen Alles raubte. Die Nachricht von dieser That gelangte nach Schumagina, gerade als ich von dort aufbrechen wollte, um in die beraubten Gegenden vorzudringen. Unter so bewandten Umständen weigerten sich meine Leute ganz entschieden weiter vorzugehen, da auch sie fürchteten, jenem braven General in die Hände zu fallen. So blieb mir nichts übrig als umzukehren; doch hielt ich mich keineswegs für besiegt, und als nach einiger Zeit der Lärm verstummt war, brach ich in den ersten Tagen des Juli 1863 abermals nach Korata auf. Die Gomara, welche jetzt hoch angeschwollen war, mußte hier an einer Stelle überschritten werden, wo sie sich in drei Arme trennt. An demselben Abend erreichte ich noch Madera Mariam, d. h. Ruheplatz der Maria, eine hübsche kleine Stadt, die ähnlich wie Emfras an einem Hügel liegt. Derselbe fällt nach drei Seiten hin senkrecht ab, ist aber von der vierten leicht zugänglich. Das nächste Nachtquartier war das Dorf Wanzagié, welches seinen Namen von den hier stehenden schönen Wanzabäumen führt; dann wurde die Goanta erreicht. Diesen Fluß in einer Furt zu durchwaten, war ganz unmöglich, und ich mußte deshalb in einem abessinischen Mittel – ich sage nicht Fahrzeug – der Hokumada übersetzen. Dies ist eine an den Rändern in Nachenform aufwärts gekrümmte steife Ochsenhaut; ein Mann durchschwimmt den Fluß mit einem Seile, dessen eines Ende an der Hokumada, dessen anderes am jenseitigen Ufer befestigt ist. Der Passagier setzt sich in den Lederschlauch, kauert sich zusammen und hütet sich wohl, nach der einen oder andern Seite sich überzubeugen. So wird er, während noch ein Schwimmer die Hokumada schiebt, am Seile an das jenseitige Ufer hinübergezogen. So kam auch ich über die Goanta, um bald an der geschwollenen Gomara auf ein neues Hinderniß zu stoßen, das dieses Mal mittels einer Tankoa überwunden wurde.
[pg 198]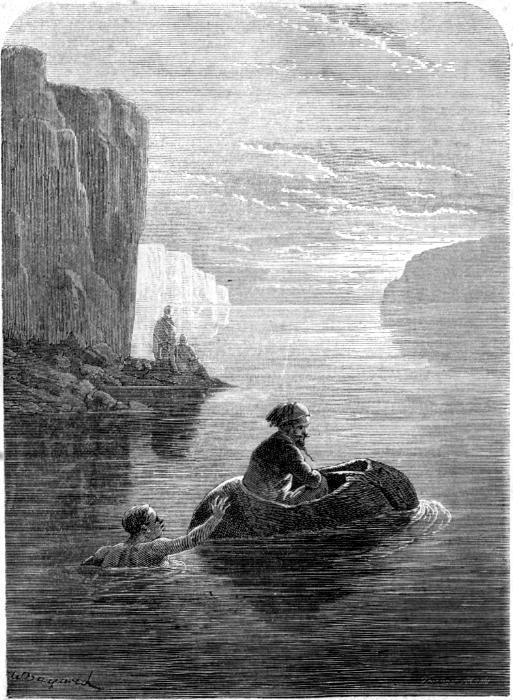
Die Tankoa ist ein rechteckiges Floß, welches sechs bis acht Personen tragen kann und aus einer Reihenfolge von dicht aufeinander gelegten Stroh- oder Binsenschichten besteht, die fest miteinander verbunden sind. Das Binsen- oder Rohrfloß taucht ziemlich tief unter und kann niemals untergehen, desto leichter jedoch umschlagen. Da aber die Abessinier fast alle sehr gute Schwimmer sind, so entstehen selten Unglücksfälle. Das Gepäck, Kleider, Waffen, ein Ledersack, welcher Mehl enthält, liegen hinten; vorn sitzt der Lenker des Ganzen, welcher mit einem Ruderstock versehen ist, denn die Tiefe des Wassers gestattet nicht, das Floß mit einer Stange durch Stoßen auf den Grund fortzubringen. Die Tankoa ist das sprechendste Zeichen, wie starr die Abessinier an ihren Gebräuchen hangen. Dieses Volk mit offenem und hellem Verstande hat nach Verlauf von Jahrhunderten noch nicht einmal zu schließen gelernt, daß, wenn ein simpler Stock, durch den Widerstand, welchen seine Oberfläche dem Wasser darbietet, ein Floß fortzubewegen vermag, eine an das Stockende angebrachte Schaufel eine vermehrte, zehnfache Oberfläche darbieten und also auch die Fortbewegungs-Geschwindigkeit verzehnfachen muß, denn der Abessinier besitzt nicht einmal die Ruderschaufel, welche den Wilden am Weißen Flusse wohlbekannt ist.
Uebrigens ist nichts ermüdender als eine Reise per Tankoa. Die Maulthiere wurden ins Wasser gestoßen und von einem Schwimmer durch die reißenden Fluten gelenkt. So kamen wir wohlbehalten zu einem kleinen, von Wanderhirten bewohnten Weiler, wo wir übernachteten, um am nächsten Morgen, quer über die Hügel und das Flüßchen Izuri hinweg, unsere Reise nach Korata anzutreten, dessen herrlichen Anblick wir bald genießen sollten. Es ist die hübscheste Stadt Abessiniens und war das äußerste Ziel meiner Reise.
Korata liegt auf einem basaltischen Landrücken, welcher sich in den Tanasee vorschiebt. Die spitzdachigen Häuser liegen zerstreut um die Kirche gruppirt, und bei jedem befindet sich ein baumreicher Garten, der von der Wohlhabenheit der Bewohner Zeugniß ablegt. Es war gerade Markt, welcher dicht bei der Stadt abgehalten wird. Besonders wird hier viel rohe oder zu Zeugen verarbeitete Baumwolle verkauft; letztere kommen sämmtlich aus der westabessinischen Provinz Koara, woher sie theils auf Eseln, theils auf dem See gebracht werden. Die rohe Baumwolle wird mit den Samenkörnern verkauft, meistens gegen das gleiche Gewicht Salz. Das Ausscheiden der Samenkörner mittels eines eisernen Stäbchens, welches auf einem flachen Steine mit den Händen hin- und hergerollt wird, ist eine langsame und ermüdende Arbeit; zum Aufschlagen derselben bedient man sich eines elastischen Bogens und zum Spinnen der Handspindel. Eine fleißige Frau kann so viel Gespinnst fertigen, als für zwölf vollständige Umhängetücher erforderlich ist. Auf dem Marktplatze selbst erregte meine Erscheinung keinerlei Aufmerksamkeit; etwas Anderes war es jedoch an einer nur 50 Schritte weiter entfernten Stelle. Ein großer Baum breitete dort seine gigantischen Aeste über den Weg, unter dem in weißen Gewändern, mit [pg 199]riesigen Turbanen auf dem Haupte, den heiligen Fliegenwedel in der Hand, die Geistlichkeit von Korata saß. Als ich mich ihnen näherte, stießen sie ein unwilliges Geschrei aus und verlangten, daß ich vom Maulthiere absteigen solle. Ich weigerte mich, und nun entstand auf dem Markte eine allgemeine, gegen meine Person gerichtete Bewegung, der ich durch Absteigen auszuweichen mich gemüßigt fand. Hierauf konnte ich ungehindert zu Fuß in die Stadt gehen. Später erfuhr ich, daß die Pfaffenstadt Korata das Privilegium besitzt, Niemand zu Pferd oder zu Maulthier durch ihre Straßen reiten zu lassen.
Nachdem ich mich in der unteren Stadt einquartiert und dem Ortsvorstand den üblichen Besuch abgestattet, fing ich an, die Straßen oder vielmehr die Alleen zu durchwandern. Diese Straßen sind in der That nur von Hecken eingefaßte Fußpfade, hinter denen sich hübsche Gärten hinziehen. Blumen sieht man in diesen selten, dagegen prächtige Granatbäume, Pfirsiche, Kaffeesträucher, Bananen, Citronen, aus denen die Strohdächer der Hütten hervorlugen. Von dem funkelnden Spiegel des Tanasees herüber wehte ein kühlendes Lüftchen, das mir den Spaziergang in den Straßen zu einer wahren Erquickung machte. Wie schon der Markt zeigt, ist Korata ein bedeutendes Handelscentrum. Seine Kaufleute, lauter Christen, stehen mit Basso in Godscham, mit Gondar und Massaua in Verbindung. Ich habe Korata nur den Vorwurf zu machen, daß die Küche dort schlecht bestellt ist, denn während meines viertägigen Aufenthaltes bekam ich nicht 1 Loth Fleisch zu Gesicht, obgleich in der Umgebung zahlreiche Herden weiden. Die Einwohner leben von Brot und rother Pfeffersauce, der sie zuweilen einen welsartigen Fisch aus dem Tanasee beigesellen.
Die Aussicht auf dieses Binnengewässer ist von Korata aus eine prächtige. Weit in der Ferne, im Norden sieht man die blauen Vorgebirge von Gorgora, die südlich von Tschelga und Gondar liegen; rechts zieht sich der Bergabfall von Begemeder hin, während mitten im Seespiegel die dunkle Masse der Inseln Dek und Daka auftaucht. Eine Eigenthümlichkeit des Sees aber sind ein Dutzend winziger Eilande, wie Bet-Manso, Kibran, Metraha u. s. w., die, vom Festland aus betrachtet, gleich schwimmenden Blumenkörbchen auf der Flut erscheinen. In der Nähe betrachtet, sind diese Blumenkörbchen jedoch bewaldete Inseln, die in ihrem Innern eine Kirche oder ein Kloster bergen.
Auch eine Flotte besitzt die Seestadt Korata, die aus einer großen Anzahl von Tankoa besteht, welche am Ufer trocknen und die Verbindung zwischen der Stadt und den südlichen und westlichen Ufern, namentlich mit Zegrié, unterhalten. Sie sind schmäler als die oben beschriebene Tankoa, bis 15 Fuß lang und führen Mattensegel. Ich wollte ein solches Fahrzeug miethen, um nach Zegrié überzufahren, allein da dieses in der Gewalt der Rebellen von Godscham war, wurde mir die Erlaubniß verweigert. – Bei Korata wohnen viele Waito, jene eigenthümlichen Menschen, die sich mit der Flußpferdjagd beschäftigen (vergl. S. 90). Während dieser Dickhäuter sehr häufig im See ist, fehlen darin Krokodile gänzlich; dagegen verhält es sich mit dem Abai, dem Abfluß des Sees, umgekehrt.
[pg 200]Das Flußpferd heißt im Amharaschen Gomari, und hiervon stammen wol auch die vielen ähnlich klingenden Flußnamen Gomara u. s. w. Nach viertägigem Aufenthalte verließ ich Korata wieder und kehrte in mein altes Standquartier Gafat zurück.
Die letzte größere Exkursion, welche ich in der Umgebung meines Aufenthaltsortes unternahm, war eine Besteigung der 13,000 Fuß hohen Guna. Ich folgte erst dem Reb, kam dann in das schöne Makarthal und stieg bis zu einem kleinen Dorfe empor, dessen Name lieblich in mein französisches Ohr tönte. Es heißt Maginta. Hier verbrachte ich die Nacht; als ich am nächsten Morgen weiter aufbrechen wollte, kamen zwei Reiter im vollsten Galopp zu mir, mit der Botschaft, daß der Negus mich in Gafat erwarte. Schon am Nachmittage langte ich wieder in meiner Wohnung an, wo ich Waldmeier fragte, was vorgefallen sei. Er antwortete ausweichend. Kurz darauf langte ein Brief in amharischer Sprache vom Könige bei mir an, welchen mir Kinzle übersetzte. Der Negus befand sich in seinem Lager zu Isti, drei Tagereisen von Gafat. Da ich bemerkt hatte, daß er guter Laune war, so wollte ich diese benutzen und bat um seine Erlaubniß zur Heimkehr nach Massaua. Bei Empfang meines Briefes gerieth er indessen in solche Wuth, daß zwei Tage lang Niemand mit ihm zu reden wagte. Sofort ließ er mir einen heftigen Brief schreiben, aus dem ich Folgendes hervorhebe: „Als du hierher kamst, hast du dich mir als Freund vorgestellt; oder bist du etwa gekommen, um mit den Scheftas (Rebellen) gegen mich zu konspiriren? Sind deine Gefühle aber loyal, so schreibe mir; bist du mein Feind, so schreibe mir auch, damit ich weiß woran ich bin.“ Sogleich antwortete ich in einem kurzen, aber respektvollen Schreiben, welches die gefährliche Korrespondenz zu einem guten Ende führte, denn die schleunig darauf erfolgende Antwort lautete: „Habe nur einige Geduld und durch die Gnade der Dreieinigkeit wird Alles gut ablaufen. Ich habe dich aus wichtigen Gründen zurückbehalten müssen; allein wenn mein Agent wieder heimkehrt, will ich dich mit allen gebührenden Ehren entlassen.“ Ich folgte dem mir ertheilten weisen Rath, verhielt mich geduldig und nahm zunächst meinen unterbrochenen Ausflug nach der Guna wieder auf.
In Maginta war ich an die Familie des Irländers Bell empfohlen, der einst eine große Rolle bei Theodor II. gespielt und für diesen sein Leben gelassen hatte. Hier traf ich auf ein Beispiel der abessinischen Langlebigkeit, nämlich auf fünf Frauengenerationen beieinander: die abessinische Witwe Bell’s, deren Mutter, Großmutter, Tochter (die Frau Waldmeier’s) und Enkelin! Die Urgroßmutter war die einzige, welche man als Greisin bezeichnen konnte; denn die Großmutter, eine feine Frau von 55 Jahren war noch sehr lebhaft und thätig in der Hauswirthschaft; die Mutter, Bell’s Witwe, war 35 Jahre alt, zierlich und hübsch; deren Tochter war an den Missionär Waldmeier verheirathet, welchen sie wieder mit einem Töchterchen beschenkt hatte.
Maginta liegt bereits im Gebirge. Von da aus hatte ich, von Plateau zu Plateau ansteigend, nur vier Stunden bis zum Gipfel zurückzulegen.
[pg 202]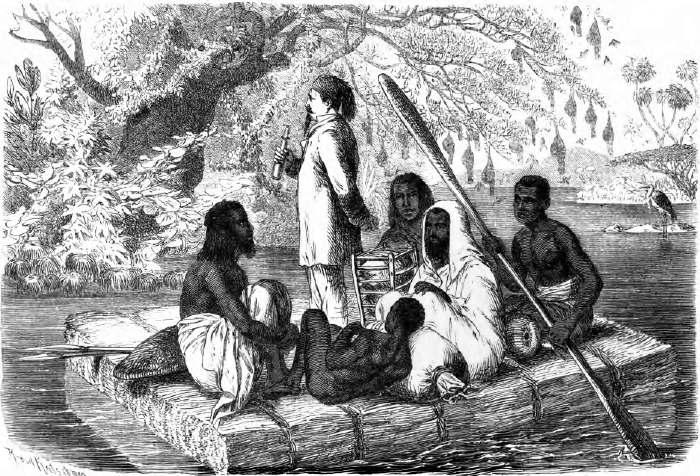
Der Weg führte vorbei an Kosso- und Ericabäumen, Hypericumstämmen, prächtigen aloeartigen Lilien bis zur Region der seltsamen Dschibarra (Rhynchopetalum).
Letztere gedeiht hier bis zu einer Höhe von fünfzehn Fuß. Der Gipfel der Guna, Ras-Guna genannt, besteht aus Trachyt. Von da aus umfaßte mein Auge eine prachtvolle Rundsicht. Zur Rechten brach der Reb aus einem tiefen Thale hervor; vor mir lag das pittoreske Massiv des Zoramba und weiter hin die Kollo, das mächtigste abessinische Gebirge. Zur Linken endlich Plateau an Plateau, durchrieselt von Bächen, die sich zum Tanasee hinzogen, auf dem die Inseln gleich dunklen Punkten zu schwimmen schienen.
Als ich wieder in Gafat angelangt war, fand ich eine Einladung des Negus vor, ihn in Gondar, wohin er sich begeben hatte, zu besuchen. Sofort brach ich auf. Dort angekommen, hatte ich noch einige Schwierigkeiten, empfing aber am 30. September 1863 den Befehl, Abessinien auf dem kürzesten Wege zu verlassen. Mit mir ging Dr. Lagarde, der den Aufenthalt in Abessinien satt bekommen hatte. Nach der feierlichen Abschiedsaudienz bei Theodor nahmen wir ein Frühstück bei dem englischen Konsul Cameron ein, das von dessen Koch, einem Elsässer Kind, sehr gut zubereitet war. Dieser, früher ein französischer Kürassier, hatte sich die Gunst des Königs zu erwerben gewußt. Als die Missionäre einst einen Wagen für Theodor hergestellt, fragte dieser den Elsässer, wie ihm die Maschine gefiele. „Pfui! sagte der Rheinländer, bei uns in Mühlhausen fährt man in solchen Dingen den Mist aufs Feld!“ (Den berühmten blau angestrichenen Wagen erwähnen auch Heuglin und Steudner.) Beim Frühstück war auch der Judenmissionär Dr. Stern zugegen, welcher zuerst Photographien in Abessinien aufnahm und in seinem Werke „Wanderungen unter den Falaschas“ veröffentlichte. Einst schenkte dieser dem Negus einen Stereoskopenkasten mit einer Ansicht Jerusalems.
„Was ist das für ein Gebäude?“ fragte Theodor.
„Die Moschee Omar’s“, antwortete Stern. – Sogleich warf der König den Apparat auf die Erde, indem er wüthend ausrief: „Und dieses Europa, das vorgiebt christlich zu sein, duldet eine Moschee beim heiligen Grabe!“
Als endlich die Stunde schlug, um Gondar den Rücken zu kehren, kam Achmed, mein Diener, mit der Nachricht zu mir, daß alle meine Leute sich heimlich entfernt hätten, aus Furcht, von mir in Massaua als Sklaven verkauft zu werden!
Mir blieb nichts anderes übrig, als neue Diener und Lastthiere zu miethen, wobei sich Salmüller besonders gefällig erwies. Ich überschritt den Angerab, wandte mich dem Magetsch zu, erstieg die Hochebene von Wogara, auf der Straße, die vor mir Bruce, Lefêbvre, Ferret und Galinier, Rüppell, Krapf, v. Heuglin u. a. gewandert waren, und gelangte in vier Tagemärschen bis Dobarek.
Am ersten Tage bivouakirten wir in Kossogié, einem Dorfe, welches von den hier häufigen Kossobäumen seinen Namen führt; durch gut bebaute Ebenen gelangte ich am zweiten Tage nach Isak-Dews, dem Isakberge, welcher Ort [pg 203]1420 vom Kaiser Isak zur Erinnerung an einen hier über die Juden (Falaschas) erfochtenen Sieg gegründet wurde. Die dritte Station Dokoa war ein reizender Flecken auf einer Anhöhe mit einer dem Heiligen Kitane Machrit geweihten großen steinernen Kirche, die vom Kaiser von Jasu im portugiesischen Stile erbaut ist. Hier theilt sich die Straße; rechts, nach Osten zu, führt sie ins Alpenland von Semién. Links, in nördlicher Richtung über den Lamalmon-Paß, und die Kolla von Wogara nach Adoa. Am nächsten Morgen, als ich nach Dobarek aufbrach, zeigte man mir zur Rechten, schon in Semién gelegen, das Dorf Debr-Eskié, in dessen Nähe am 9. Februar 1855 das Schicksal Abessiniens entschieden und Theodor Sieger über Ubié wurde. Als ich den Abhang erstieg, an welchem Dobarek erbaut ist, wurde meine Aufmerksamkeit durch eine traurige Erscheinung gefesselt; der Boden war ringsum mit gebleichten Menschenschädeln besät, die unter den Füßen meines Maulthiers dahin rollten. Ein Schlachtfeld konnte hier nicht gewesen sein, denn andere Knochen als eben nur Schädel waren nicht vorhanden. Aber was war hier geschehen? Eine entsetzliche Katastrophe. Vor gerade drei Jahren (1860) hatte Theodor über seinen rebellischen Neffen Garet bei Tschober einen Sieg erfochten und etwa 1700 Gefangene hierher abgeführt. Man enthauptete sie und warf ihre Schädel aufs Feld.
Am nächsten Tage begann ich den Lamalmon hinabzusteigen. Sein südlicher Abfall ist eine schöne, kaum wellenförmige Ebene; sein nördlicher dagegen eine steile, einige tausend Fuß hohe Lehne, von welcher ein steiler Zickzackfußpfad hinabführt, den wir nicht ohne Lebensgefahr passirten. Auf einer kleinen Terrasse, die alle Karawanen als Ruhepunkt benutzen, machte auch ich Halt. Vor mir lag, wie auf einer Reliefkarte ausgebreitet, die Kolla bis zum Takazzié – eine Aussicht, die sich über dreißig Meilen erstreckte. Von allen Seiten sah ich die Flüsse durch die grünen Wälder und gesägten Berge brechen, um sich dem Takazzié zuzuwälzen, hinter dem, eingehüllt in Nebeldämpfe, das Hochland von Schirié emporstieg. Ich nahm meinen Weg nach der Zarima, einem Nebenflusse des Takazzié, zu, nicht ohne von meinen Leuten vor dem Rebellen Terso Gobazye gewarnt zu sein, der diese Gegend unsicher machte. Wie ich später erfuhr, war die Rebellion dieses Mannes mein Glück, denn Theodor hatte plötzlich drei Tage nach meiner Abreise aus Gondar eine Kavallerieabtheilung hinter mir hergeschickt, welche mich zurückbringen sollte. Kurz nach meinem Aufbruche von Dobarek kam sie dort an, wagte sich aber aus Furcht vor dem Rebellen nicht weiter und kehrte, ohne ihren Auftrag erfüllt zu haben, zurück. Der Negus wurde wüthend und rief aus: „Welches Unglück! Der erste Mensch, der von hier abreiste, ohne genau zu wissen, ob ich sein Freund oder Feind bin!“
Sire! Sie täuschen sich. Ich bin unterrichtet! Aber, ohne Sie zu beleidigen, füge ich hinzu, daß ich mich lieber Ihrer Gunst in Paris als in Gondar erfreue!
Meine erste Station jenseit der Zarima war Tschober, wo Theodor gegen die Gebrüder Garet focht und sein Liebling, der Irländer Bell, getödtet wurde, worauf die Katastrophe folgte, die ich bei Dobarek schilderte. Ich befand mich nun so recht mitten im abessinischen Kirchenlande, in Waldubba, das förmlich [pg 204]von Mönchen strotzt. Auch die Menschen waren hier schon andere; die jungen Mädchen sangen in einer Sprache, welche ich noch nicht gehört hatte und die weit gutturaler als das Amhara klang. Auch vernahm ich, daß ich mich schon im Gebiete des Volks von Tigrié befand. Wie die Amharas ernst, schweigsam und würdig auftreten, so erscheinen im Gegensatz die Leute von Tigrié fröhlich, lustig, mit einem Worte als „gute Kinder“. Frankreich stand in den Bürgerkriegen 1856–1860 auf Seiten der letzteren; England begünstigte die Amharas, und ohne gesuchten Vergleich kann man sagen, daß diese Sympathien dem beiderseitigen Nationalcharakter entsprachen.
Drei Tage später gelangte ich an das Ufer des Takazzié, den ich bei niedrigem Wasserstande traf. Sein dunkles, vom abgefallenen Laube getrübtes Wasser rollte zwischen dicken Wäldern dahin, die an die Urwälder Südamerika’s erinnerten. Hier war echte, tiefe Kollaregion. Am jenseitigen Ufer, wo das Land wieder bergig wurde, gelangte ich in die Deka der reichen und wohlbevölkerten Provinz Schirié, die sich nach dem Mareb hin erstreckt. Ich verließ nun die nördliche Richtung und wandte mich mehr nach Nordosten, einer schönen sumpfigen Prärie zu, welche links von bizarren Bergen begrenzt wurde. Da, wo sie endigt, liegt Axum, die alte heilige Stadt Abessiniens, die jedoch bereits so oft von den verschiedensten Reisenden geschildert worden ist, daß ich die Leser mit Aufzählung ihrer Alterthümer hier nicht ermüden will. (Vergl. oben S. 4.)
In vier und einer halben Stunde gelangte ich weiter nach der gegenwärtigen Hauptstadt Tigrié’s, Adoa. Die Stadt liegt zwischen dem südlichen Fuße des Scholada am linken Ufer eines kleinen Baches, der sich mit dem Asam vereinigt. Die südlichen, weniger zusammenhängenden Quartiere sind über mehrere Anhöhen zerstreut und theilweise sehr im Verfall begriffen. Viele Kirchen, wie gewöhnlich in kleinen Hainen, erheben sich in und um Adoa, unter denen sich die von Metchimialem auszeichnet. Sie ist von Detschas Sabagadis erbaut, der eine große Glocke hierher stiftete. Die Straßen sind eng, krumm und schmuzig, die Häuser meist aus Stein gebaut; viele haben Dächer von Thonschieferplatten, andere von Stroh; auch solche von zwei Stockwerken sind keine Seltenheit. Der Hofraum ist immer mit einer hohen Feldsteinmauer umgeben, in welcher sich Gärtchen hinziehen und Cordiabäume stehen. An der nordöstlichen Ecke auf einer steinigen Ebene am Bach ist der Marktplatz, wo an mehreren Tagen der Woche Markt gehalten und geschlachtet wird. Seit Jahrhunderten und namentlich seit dem Verfall von Axum ist Adoa die Haupt- und erste Handelsstadt Tigrié’s, deren Einwohnerzahl, fast lauter Christen, etwa 6000 Seelen beträgt. Die industriellen Produkte sind von geringer Bedeutung.
Da meine in Gondar gemietheten Leute nicht weiter gehen wollten, mußte ich hier frische Diener miethen. Dies hielt mich 14 Tage in Adoa auf, und diese Zeit benutzte ich zu Exkursionen in die Umgegend. Leider versäumte ich, die Ruinen der Jesuitenresidenz Fremona bei Mai Goga in der Nähe zu besuchen. Bruce, der sie gesehen hat, giebt an, daß zu seiner Zeit die Mauern noch 27 Fuß hoch gewesen seien, ein von Thürmen flankirtes Viereck, das als [pg 205]Festung gedient hatte. Doch das verhinderte die Vertreibung der Patres nicht, die vor zwei Jahrhunderten eine fürchterliche Qual Abessiniens waren. Man erzählte mir, daß die Ruinen heute ein Gegenstand der Furcht bei den Landleuten seien, welche das alte Gemäuer von bösen Geistern bevölkert glauben.
Am 29. Oktober 1863 verließ ich mit fünf Lastträgern, die ich bis Massaua zu dem billigen Preise von anderthalb Thaler pro Mann gemiethet hatte, Adoa. Am Abend kampirte ich schon in dem äußerst ungesunden Hamedo-Tieflande am Mareb. Diese granitische Ebene bildet für den Botaniker und Zoologen ein wahres Paradies, sie ist aber, wenige Monate im Jahre ausgenommen, furchtbar ungesund, ja geradezu tödtlich. Hier mußte auch mein Landsmann Dr. Dillon, der Freund Lefêbvre’s, nach der Regenzeit sein Leben lassen, als er, ungeachtet der Warnungen seiner Leute in die Kolla hinabstieg. „Vorwärts, ihr Feiglinge“, rief er ihnen unklugerweise zu. Die Abessinier zauderten, sagten aber dann: „Dieser Fremdling geht in den gewissen Tod und wir auch, wenn wir ihm folgen. Ist es aber recht, denjenigen zu verlassen, dessen Brot wir so lange gegessen? Vorwärts denn mit Gott!“

Fünf Tage darauf war Dillon todt und fünf seiner Diener gleichfalls. Ich könnte noch viele ähnliche Thatsachen anführen. Habe ich nun recht, wenn ich die Abessinier ein edles Volk nenne? (Man sieht, wie sehr sich die Urtheile gegenüber stehen, allein dieser eine edelmüthige Zug möchte doch das lasterhafte Volk nicht rein waschen). Was man jedoch noch weniger verneinen kann, ist die äußere Schönheit der Abessinier, Beweis dessen ich hier auf gut Glück das Porträt eines Landmanns aus dem Distrikt Antitscho in Tigrié hersetze.
Die ungesunde Ebene von Hamedo lag nun hinter mir und ich passirte den Mareb in einer Furth. Zu meinem Erstaunen fand ich ein sehr klares breites Wasser, das jedoch nur einen Fuß Tiefe hatte und zwischen belaubten Abhängen, wie zwischen zwei Hecken hinfloß. Jenseit desselben stiegen wieder Berge an, auf denen der Marktflecken Gundet liegt und die gesunde Deka beginnt.
Meine nächste Station war Asmara, die gegenwärtige Residenz des Bahar[pg 206]negasch oder Beherrscher der Meeresküste. Diesen stolzen Titel führte ein einfacher Schum (Ortsvorstand), der vom Statthalter der Provinz Hamasién eingesetzt wird. Der Mann empfing mich mit vieler Freundlichkeit und schenkte meinen ausgehungerten Leuten einen Hammel, ohne etwas dagegen zu verlangen. Er war ein vollendeter Gentleman, welcher bei meiner Abreise mich merken ließ, daß es ihm an Zündhütchen fehle. Da ich leider keine bei mir hatte, schickte ich ihm nach meiner Ankunft in Massaua eine größere Partie. Asmara ist keineswegs die Hauptstadt von Hamasién; als solche galt in alter Zeit Debaroa und heute Tzazega, wo der Detschas Hailu, ein Liebling Theodor’s II., residirte. Der Ort liegt malerisch zerstreut auf einem Hügel und zählt etwa 2000 Einwohner, die etwas Handel und namentlich Maulthierzucht treiben.
Das Gebiet des Nils lag schon hinter mir und ich befand mich hier in demjenigen des Anseba, der durch den Barka seine Wasser dem Rothen Meere zusendet. Bald war auch die Grenze Abessiniens erreicht und die Terrassen lagen vor mir, die sich nach der kahlen, brennend heißen Samhara hinabsenken. Erst jetzt fühlte mein Herz eine Erleichterung; das Damoklesschwert hing nicht mehr über meinem Haupte, ich war der Gewalt Theodor’s gänzlich entrückt.
Schnell war auch das Küstenland durchzogen, und in Massaua begrüßten mich nach langer Irrfahrt zuerst wieder die Spuren europäischer Civilisation.
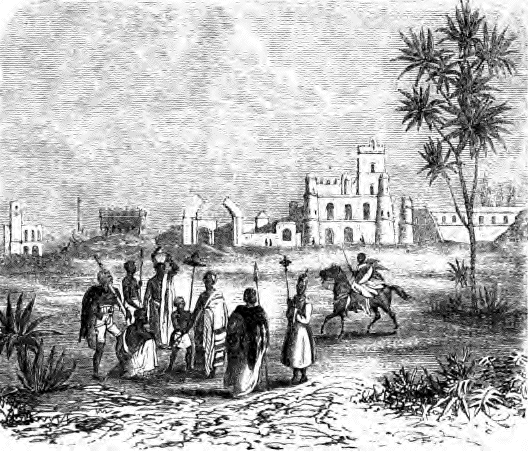
Reisen in den nördlichen und nordwestlichen Grenzländern Abessiniens.
Das Land der Mensa und Bogos. – Reise des Herzogs Ernst. – Monkullo. – Labathal. – Plateau von Mensa. – Das Volk der Mensa. – Ausflug nach Keren. – Elephantenjagd. – Rückkehr. – Munzinger über die Bogos. – Geschichtliches. – Ein aristokratisches Volk. – Rechtsverhältnisse. – Aberglauben. – Das Christenthum der Bogos. – Der Marebfluß. – Die demokratischen Bazen und Barea.
1. Reise des Herzogs von Koburg nach Mensa und Bogos.
Da, wo die Terrassen des nördlichsten Distrikts von Abessinien, der Provinz Hamasién, die natürliche geographische und politische Grenze des Landes ausmachen, hören die vulkanischen Wackengebilde, die rothen Eisenthone und [pg 208]ebenen Basaltplateaux auf und die Urgebirge, die Granite, Gneise, Glimmerschiefer erhalten die Herrschaft. Sie bilden ein Gebirge, das, nach Osten hin zum Rothen Meere, nach Westen gegen das Tiefland des Barka abfallend, von zahllosen Wasserrinnen durchflossen ist, welche während der heißen Jahreszeit vertrocknen. Der namhafteste dieser Gebirgsbäche ist der Anseba, welcher sich mit dem Barka vereinigt. Noch vor zwanzig Jahren war dieses Gebiet den Geographen fast gänzlich unbekannt – jetzt gehört es zu einem derjenigen Theile Afrika’s, dessen Kenntniß am meisten gefördert ist. Die Völkerschaften, die dort wohnen, die Bogos mit den Mensa, die Bedschuk, Takul und Marea sind theilweise Christen, werden aber in nicht allzuferner Zeit dem Islam anheimfallen. Auch in ihrer Sprache unterscheiden sich die Bogos und Bedschuk von ihren Nachbarn; erstere ist ein Agau-(Agow)Dialekt, welcher aber mehr und mehr dem Tigré Platz macht. (Vergl. S. 92.)
Vor Allem aber hat die Natur dies „Alpenland unter den Tropen“ mit dem herrlichsten landschaftlichen Charakter gesegnet, mit vielfach gegliederten Hochebenen und kühnen Felsgestalten. Zur Regenzeit entwickelt sich dort eine höchst mannichfaltige und reiche Vegetation, und das Thierreich ist so überaus wohl vertreten, daß Bogos sammt Mensa dem Waidmann als ein Paradies erscheinen müssen.
Die Berichte, welche die deutsche Expedition unter von Heuglin über diese gesegneten Landstriche in die Heimat sandte, das Interesse welches sie an und für sich erwecken mußten, endlich die vergleichsweise leichte Zugänglichkeit, die nahe Lage an der Küste – man kann von Triest aus, wenn Alles ineinander greift, jetzt in ungefähr vierzehn Tagen nach Mensa gelangen – machten auch in einem deutschen Souverän den Wunsch rege, jene Gegenden zu besuchen, um dort der edlen Jagd obzuliegen. In Schottlands Hochbergen hatte Herzog Ernst II. von Sachsen-Koburg-Gotha schon den Edelhirsch gejagt, er hatte Gemsen am Fuße der Alpengletscher erlegt und nun entschied er sich auch dahin, auf Elephanten, Löwen, Leoparden, Gazellen und Antilopen in ihrer tropischen Heimat zu pürschen. Doch die Wissenschaft sollte bei diesem Unternehmen keineswegs leer ausgehen, und so versah sich der Herzog mit einem Stabe tüchtiger Männer, die vollkommen geeignet waren, das Erlebte und Gesehene in Wort und Zeichnung aufzubewahren.
Die Reisegesellschaft bestand aus dem Herzoge und seiner Gemahlin, dem Fürsten Hermann Hohenlohe und dem Prinzen Eduard Leiningen, dem Major von Reuter nebst Frau, dem Arzte Dr. Hassenstein, dem Maler Robert Kretschmer – dem wir einen Theil der prächtigen, naturwahren Illustrationen zu diesem Werke verdanken – dem Naturforscher Dr. Brehm, Friedrich Gerstäcker und einigen Anderen. Dr. Brehm, der Afrika aus eigener Anschauung bereits kannte, wurde als Pionier vorausgesandt, um die besten Wege ins Mensagebirge zu erforschen, und am 28. Februar 1862 verließ die Expedition selbst Triest. Nach sechstägiger Fahrt wurde Alexandrien erreicht, Kairo besucht und den Nil stromaufwärts bis zu den Ruinen von Luxor gedampft, endlich mit einem Extrazug [pg 209]durch die Wüste nach Suez gefahren, wo die hohen Herrschaften nebst ihrem Gefolge sich am 24. März einschifften. Fünf Tage dauerte die Fahrt durch das Rothe Meer, und am 29. warf der Dampfer bei Massaua Anker, wo eine englische Fregatte bereit lag, um der herzoglichen Expedition während ihres Aufenthalts an der entlegenen Küste Schutz angedeihen zu lassen.
Jener wichtige Hafenplatz wurde der Ausgangspunkt zur Reise in das Hochland, welche die Frau Herzogin jedoch nicht mitzumachen gedachte. Sie blieb vielmehr in dem westlich von Massaua gelegenen Dorfe Monkullo (Umkullu, M’Kullu) zurück, das man als eine Art Vorstadt von Massaua bezeichnen kann, weil viele Massauer Familien hier ihre Hütten und die meisten Geschäftsleute eine Frau mit Kindern und Sklavinnen wohnen haben, von denen sie täglich Milch und Holz sich bringen lassen. Ein besonderer Vorzug des Ortes sind seine Brunnen mit klarem süßen Wasser, das bis Massaua geführt wird. Monkullo wird von mehreren Hügeln überragt, von deren Hochfläche man einen Blick auf das Rothe Meer hat. Man sieht zwei lange Streifen, welche sich von dem blauen Gewässer abheben; der längere, zur Hälfte gelb, zur anderen grün, ist die Insel Tan-el-hut, wo Hemprich begraben liegt; der andere Streifen ist Massaua. Die gelbe Farbe rührt von Korallen, die grüne von einem dichten Gebüsch her, dessen immergrüne, fettglänzende Blätter denen des Kirschlorbers ähnlich sind; diese Pflanze, der Schorawurzelträger (Avicennia tomentosa), heißt zu Massaua Sackerib und wächst nur an solchen Stellen, welche täglich bei der Flut vom Meereswasser bespült werden. Aus der Ferne gesehen, gewähren die Wurzelträger einen anmuthigen Eindruck; ihr sanftes Grün thut dem Auge wohl; sie strecken ihre ziemlich dünnen Aeste in das Meer, und das Ganze lockt fast unwiderstehlich an, weil es zu dem nackten gelben Strande einen angenehmen Gegensatz bildet. Aber die Atmosphäre ist hier feucht, man kann wohl sagen giftig, und die Hitze oft so arg, daß es gewissermaßen als eine Erquickung erscheint, wenn man aus solch einem Avicenniengewirr heraustritt und wieder von den glühenden Strahlen der äthiopischen Sonne beschienen wird.
Schnell eilten die Mitglieder der Gesellschaft aus der ungesunden Küstenlandschaft dem Innern zu. Im Anfang war die Gegend der Samhara, welche sie durchritten, sehr öde und arm; die sandigen, aus grobkörnigem Kies bestehenden Berge glichen ganz jenen der Wüste. Das thierische Leben der Samhara wird zuerst bei den Regenströmen bemerklich, die nach kurzem Lauf hier dem Rothen Meere zueilen. Großartig wird die Natur erst da, wo das Labathal mit frisch sprudelndem Flüßchen aus dem Gebirge hervortritt. Im hellsten Grün prangten die Gehänge des Thals bis hoch zu den Bergen hinauf; alle Bäume standen im Blätterschmuck, viele von ihnen waren gerade mit den köstlichsten Blüten bedeckt und leuchteten von den Felswänden herunter. Gesicht, Gehör, Geruch schwelgten zu gleicher Zeit. Der Farbenreichthum blendete das Auge, Wohlgeruch erfüllte das Thal und wie ein Gruß tönte der Flötenruf des äthiopischen Würgers den Fremdlingen ins Ohr. Auf den Zweigen wiegten sich Vögel aller Art von den kleinsten Honigsaugern (Nectarinia) bis zum riesigen [pg 210]Ohrengeier. Auch sah man Leoparden, Gazellen, Antilopen, Rudel von Affen, namentlich Hamadryaspaviane eilten mit lautem Geschrei die Abhänge hinauf und muntere Klippschliefer belebten die Felsen, die sogar Spuren des riesigen Elephanten trugen, der bis in die hohen Berge hinaufsteigt.
Ganz oben verwandelte sich das Thal in eine enge Felsschlucht, und unter unsagbaren Mühen wurde am 7. April die Hochebene erklommen, welche wiederum von riesigen Alpen umgeben die Hüttengruppen des Hirtenvolkes der Mensa trägt. Das Gebirge selbst besteht aus einem sehr grobkörnigen Granit, welcher jedoch nur an den höchsten Spitzen durchbricht, und aus Thon- und Glimmerschiefer, der sich wie ein Mantel um den innern Granitkern gelegt hat. In den tiefern Thälern finden sich steile Wände, welche jedoch fast überall zugänglich sind und es noch viel leichter sein würden, wenn nicht die Pflanzenwelt dies verhinderte. Alle Felsen sind grün bis oben hinauf, und wo nur ein geeignetes Plätzchen sich findet, da hat die Pflanzenwelt sicher Fuß gefaßt. Doch bestimmt die Armuth an Dammerde das Gepräge der Vegetation. Große gewaltige Bäume giebt es nur im Thale, und hier zeigen sich am Bache die charakteristischen Gewächse der Kollaregion: schirmförmige Mimosen, prächtige Tamarinden, Kigelien mit ihren großen Früchten, Adansonien, Akazien, Oelbäume, die Kronleuchter-Euphorbie und eine niedrige Palme.
Der stattliche Gebirgszug, in dessen Gipfel das Plateau von Mensa gleichsam eingekeilt liegt, mag sich in den Theilen, welche von der herzoglichen Expedition berührt wurden, zu einer Höhe von 8000 bis 9000 Fuß erheben. Die Hochebene selbst soll gegen 6000 Fuß über der Meeresfläche liegen und wird durch einen niedrigen Hügelrücken in zwei Theile geschieden. Der eine bildet eine wilde, mit Büschen bewachsene, sandige Fläche, die oft von Schluchten durchzogen ist. Der andere zeigt besseren Boden und wird bebaut.
Das Dorf Mensa bildet zwei Gruppen von Niederlassungen mit zusammen etwa 100 Hütten, die sich an die beiden Ränder der Hochebene anlehnen. Dicht hinter denselben steigen die bewaldeten Felsgehänge noch kühn empor und tritt zwischen riesigen Granitblöcken ein klarer Quell hervor, und ringsum entfaltet das Gebirge seine ganze Pracht. Die Stelle war zu Ausflügen gut gewählt, aber leider wurde die Freude theuer bezahlt, denn ein großer Theil der Gesellschaft wurde vom Fieber gepackt. Die Gesunden ließen sich jedoch dadurch nicht abhalten, tüchtig der ergiebigen Jagd nachzuspüren und die Sitten der Eingeborenen zu studiren.
Nirgends wol in Afrika trifft man auf so elende Behausungen als in Mensa. Die Hütten bestehen aus Stangen oder Zweigen, über die man einfach Reisig wirft, das nicht einmal gegen den strömenden Regen gedichtet wird. Eine kleine niedrige Thür führt in das Innere des hohlen Reiserhaufens. Dort gewahrt man dieselbe Unfertigkeit: einige aneinander gereihte Stäbe, welche auf Querhölzern ruhen und von gegabelten Pfählen getragen werden, bilden den Schlafplatz. Diese Bettstätte ist außerdem mit einem laubenähnlichen Bau überdacht, der immer noch den Regen durchläßt. Außer einigen irdenen Töpfen, dem [pg 211]unentbehrlichen Reibstein, auf dem das Getreide zerkleinert wird, einem Topfe, in dem man das Korn aufbewahrt, und einigen Schläuchen sieht man keine Geräthschaften im Innern. Eine Dornumzäunung schließt die Wohnung ein, und innerhalb derselben liegt der kleine Tabakgarten, denn das starke Kraut wird von den Männern leidenschaftlich aus großen Wasserpfeifen geraucht, deren Wasserbehälter durch einen Kürbiß gebildet wird.
Die Mensa sind schöne, wohlgebaute Menschen von gelblicher bis dunkelbrauner Hautfarbe. Ihre Sprache ist das Tigré. Das Haar ist eigenthümlich frisirt, wie es die Abbildungen zeigen, und mit einer Nadel versehen, welche die Ruhe unter den lästigen Insassen herzustellen hat. Kurze baumwollene Hosen und weite Umschlagmäntel machen die Kleidung der Männer aus; eine lederne, in viele Streifen zerspaltene Schürze bildet die einzige Bekleidung der unverheiratheten Mädchen, welche am Tage der Verheirathung mit einem Umschlagetuche vertauscht wird. Das Leben des Volkes hängt von den Herden ab; Getreidebau wird wenig betrieben. Die Erhaltung und Vermehrung der Herden macht die ganze Wissenschaft ihres Lebens aus. Der Mensa hält sich um so verständiger, je besser er mit dem Vieh umzugehen versteht, und er achtet sich um so glücklicher, je zahlreicher seine Herde von Buckelrindern ist. Manche von den Leuten, welche in einer der beschriebenen erbärmlichen Hütten leben, nennen 5000 bis 6000 Rinder ihr Eigenthum. Um überall die Weide gut ausnutzen zu können, wandern die Mensa zweimal im Jahre von der Höhe ihres Gebirges zur Tiefe der Samhara hinab, wenn dort die Regengüsse ein frisches Grün hervorgezaubert haben. Die Milch der Kühe ist ihr vornehmstes Nahrungsmittel, und bei festlichen Gelegenheiten wird ein Ochse geschlachtet, dessen halbgeröstetes Fleisch gierig verschlungen wird. Als geistiges Getränk dient der Honigwein. Ganz so schlimm wie die Abessinier sind die Mensa beim Einnehmen ihrer Nahrung nicht, allein auch nicht sehr verschieden von diesen.
Das Christenthum der Mensa ist genau so, wie wir es bei ihren Vettern, den Bogos, weiter unten schildern. Das häusliche und eheliche Leben unterscheidet sich kaum von dem der Abessinier. Mit Sonnenuntergang sammeln sich die Mädchen auf den öffentlichen Plätzen und beginnen zu tanzen, wobei die Zuschauer laut brüllen. Dieses Vergnügen währt bis tief in die Nacht, jedoch nur wenn der Mond scheint und die Raubthiere nicht zu fürchten sind. An Festtagen hört man noch eine andere Musik, dann geben die Flötenbläser ihre Künste zum besten. Die abessinischen Flöten sind hohle Röhren mit verschiedenen kleinen Schallöchern, welche nach Art der Mundharmonika geblasen werden. Einzelne Künstler verstehen auch eine Art Geige zu spielen, d. h. eine Fiedel im Urzustande mit einer Saite von Pferdehaaren, die mit einem einfachen Bogen gestrichen wird. Eine Handtrommel mit Schellen unterstützt gewöhnlich dieses Konzert aufs wirksamste.
Eigenthümlich sind die Grabhügel der Mensa. In weitem Kreise um das Grab herum baut man eine senkrechte Ringmauer auf; den von ihr umschlossenen Raum füllt man alsdann mit großen und kleinen Steinen aus. [pg 212]Die Steine schichtet man in einem Haufen hoch auf und überlegt sie endlich mit blendenden Quarzstücken, welche weit und breit zusammengetragen werden. Die tropische Erzeugungsfähigkeit sorgt bald für grüne Umrankung und Umlaubung, und dann heben sich diese Gräber um so heller von dem dunklen Hintergrunde ab.
Hier nun, unter diesem Volke, schlug man die Zelte auf und verweilte einige Zeit. Als die Gewitterregen nachgelassen, trat der Herzog, von seinen beiden Neffen begleitet, einen Ausflug nach Keren im Bogoslande an. Am 12. April setzte sich der Zug in Bewegung, durcheilte in nordwestlicher Richtung die Mensa-Hochebenen und gelangte am nächsten Tage bereits in eine sehr veränderte Gegend. Die reiche Vegetation des Mensathales war fast ganz verschwunden, die Bergrücken waren kahl und nur an den Abhängen zeigten sich Mimosen und verkrüppelte Oelbäume. In den tiefern Thaleinschnitten wuchsen riesige Adansonien und Euphorbien. Nach einem Ritt von mehreren Stunden wurde das Dorf Gabei Alabu auf einem felsigen Plateau erreicht, wo die Einwohner nach einigem Parlamentiren Milch und eine Kuh zum Geschenke brachten. „In keiner Weise konnten wir,“ erzählt Herzog Ernst, „auf der ganzen Reise zwischen diesen Völkerschaften auch nur über die geringste Unbill klagen, und ich muß lobend erwähnen, daß uns überall mit aufrichtiger Freundlichkeit und Gastfreundschaft begegnet wurde.“ Nachdem man zwei Stunden weiter geritten, gelangte man an das malerische Ufer des Anseba (Ainsaba). Der Strom hielt noch dritthalb Fuß Wasser und floß silberhell und reißend dahin. In unendlichen Windungen sendet er seine klaren Fluten, die unfern von Tzazega in Hamasién entspringen, durch das Gebirgsland und erquickt mit seinen zweimal im Jahre austretenden Gewässern die durstige Ebene. Soweit dies der Fall ist, zeigt auch der Boden die ganze Fülle der Tropenvegetation; wunderbar geformte Bäume, dicht mit Lianen überzogen, wechseln malerisch mit haushohem Schilf. Tausende von Vögeln aller Art bevölkern diesen schmalen Streifen Erde, der gleich einer Oase meilenweit den Strom begrenzt, welcher später seine Wasser mit denen des Barka vereinigt, also nicht dem Gebiete des Nil, wol aber jenem des Rothen Meeres angehört.
Die gehoffte Jagd fand leider hier nicht statt, dafür stattete man dem jenseit des Flusses liegenden Dorfe Keren, dem Hauptorte von Bogos, einen Besuch ab. Der Herzog schildert Keren als ein elendes, auf einer Hochebene gelegenes Dorf, das außer den Hütten der Eingeborenen nur zwei größere Gebäude, die Wohnung des weit und breit bekannten Missionärs Stella, aufweist. „Stella ist ein kleiner untersetzter Mann mit stechenden klugen Augen, aber sonst wohlwollenden Zügen. Er gehört zum Orden der Lazaristen. Unstreitig ist er, nach Allem, was ich über ihn gehört und gelesen, zu den wenigen intelligenten Europäern zu rechnen, welche seit einer Reihe von Jahren das Innere Afrika’s bewohnten. Durch seinen Charakter, seinen Muth und sein kluges Benehmen ist er zu einer bedeutenden Person geworden. Er ist nicht nur bei den Bogos höchst angesehen, sondern steht auch in einer gewissen Verbindung mit dem Kaiser Theodor und den ganzen politischen Verhältnissen Abessiniens. [pg 214]Die Ausbreitung der katholischen Religion scheint ihm hier nicht allein am Herzen zu liegen. Er schien vorzugsweise Rathgeber und Vermittler zwischen obwaltenden Streitigkeiten der Stämme zu sein. Ein Gehalt, der ihm regelmäßig ausgezahlt wird, und eine ausgesuchte Herde machen ihm bei geringen Bedürfnissen ein angenehmes Leben möglich.“
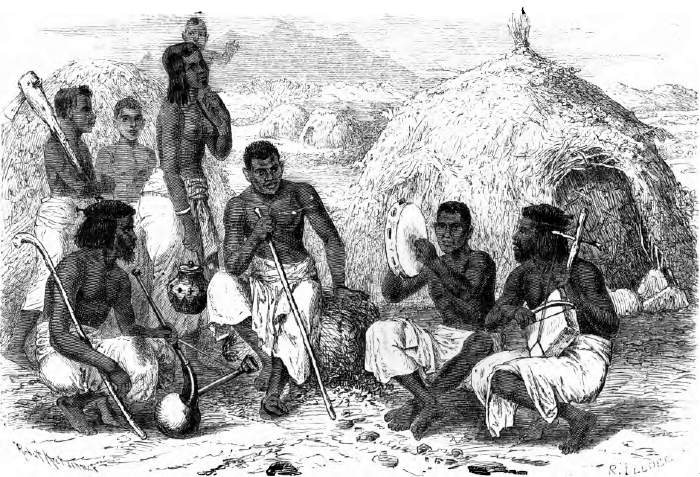
Der Boden bei Keren, das 4469 Fuß über dem Meere liegt, ist fruchtbar, aber nur ab und zu mit Durrah, etwas Tabak und dem gewöhnlichen Seifenkraut bepflanzt. Nach Osten und Süden steigen rauhe Gebirge in die Höhe, während sich die im Norden liegenden Ketten mehr und mehr abflachen. Nach Westen zu sieht man den Bergen deutlich an, daß sie aus einer Ebene emporsteigen, denn unmittelbar hinter ihnen beginnt die unabsehbare Barka-Steppe. Wasser enthält die Hochebene so gut wie gar nicht.
Keren war der fernste Punkt, bis zu welchem der hohe Reisende gelangte. Er zog nach kurzem Aufenthalte von da nach Mensa zurück, wo er am 16. April wieder anlangte. Schon am zweiten Tage darauf fand eine glückliche Elephantenjagd statt, und mit nicht geringer Anstrengung gelang es, auf den 8000 Fuß hohen Felsenhöhen des Beit-Schakhan einen alten und einen jungen Elephanten zu erlegen.
Mit folgenden Worten schildert der Herzog das Abenteuer selbst: „Es mochte wol zwischen 2 und 3 Uhr sein, als ein für uns kaum hörbarer Ton das Ohr des uns begleitenden jungen Eingeborenen traf. Wie eine Schlange schnellte die schwarze nackte Gestalt aus dem Grase empor, und die heftigste sich in den wunderlichsten Gesten kundgebende Aufregung bewies uns, daß ein Zeichen von unten gegeben sei. Wie durch einen Zauberschlag berührt, sprangen wir jetzt auf die Füße und griffen zu unseren Büchsen. Die reizende Aussicht war, wie Müdigkeit für uns verschwunden, die Sonnenstrahlen erschienen nicht mehr heiß, und ohne weiter zu überlegen, was eigentlich das Zeichen bedeute, trabte die ganze Gesellschaft über Steinblöcke durch Dick und Dünn der Tiefe zu, aus der in abwechselnden Zwischenräumen das schon vorher erwähnte Zeichen wiederholt wurde.
„Der junge Mensaner mit Schild und Speer an der Spitze, führte den Zug, und da ihn weder Kleidung noch Korpulenz am Laufen hinderten, so fiel er in ein wahrhaft gefährliches Tempo, für das nur die jüngsten Beine geschaffen schienen. Erst nach anderthalb Stunden trafen wir die beiden Elephantenjäger. Nur einige hundert Schritt folgten wir ihnen und sahen schon zum allgemeinen Entzücken, auf der gegenüberliegenden Bergwand, zwischen dem Gestrüpp und alten Euphorbienbäumen, Elephanten ruhig ihr Diner verspeisen.

(Originalzeichnung von R. Kretschmer.)
„Hier hätte nun ein Kriegsrath gehalten werden müssen, um, wie vorher verabredet, die Jagd zu besprechen. Hierzu ließen uns die aufgeregten Eingeborenen aber keine Zeit. Sagudo ergriff mich beim Arm, schüttelte mich, als ob es gälte, Aepfel von einem Baume zu schütteln, wies mit grimmigen Geberden auf die unten äsenden Elephanten und riß mich mit sich fort. Vorwärts ging es nun wieder in vollem Laufe durch Aloë, Cactus und Mimosen. Bald [pg 215]waren die ohnehin defekten Hemden und Beinkleider zerrissen, und die glühende Sonnenhitze badete uns im Schweiß. Mit einem Male hielt der Jäger an, schnitt mir ein wüthendes Gesicht und klopfte mit dem Laufe seiner riesigen Muskete auf meine Schuhe. Sein Wunsch war augenscheinlich der, daß ich von jetzt ab die Pürsche barfuß – wie er ging – fortsetzen solle. Aus meinen ebenso grimmigen Mienen und bezeichnenden Gestikulationen mochte er jedoch wol entnehmen, daß die Sohlen unserer Füße nicht, wie die seinen, für Dornen und scharfe Steine geschaffen seien, und weiter ging es, eine Lehne hinab, durch einen ausgetrockneten Sturzbach hindurch und drüben einen steilen Graben hinauf. Wir folgten genau in dem sonst undurchdringlichen Dickicht den Windungen der kleinen Pfade, welche die Ungethüme, sich vor uns äsend, erst im Augenblicke getreten hatten. Noch eine Weile und wiederum ging es einen Strand hinab, und in langen Sätzen wollten wir eben die Felsen eines zweiten Sturzbaches überschreiten, als wir auf 50 Schritt vier Elephanten unter uns denselben Bach kreuzen sahen.
„Athemlos hielt Alles still. Ich riß meine Büchse an den Backen und wollte eben den größten Elephanten aufs Korn nehmen. Da fiel mir der Jäger in den Arm und machte solche furchtbare Grimassen, daß ich nicht anders glauben konnte, als er halte es noch für zu weit. Die Elephanten, welche schlecht äugen, gingen unter uns vorüber. Kaum waren sie aber auf der entgegengesetzten Wand verschwunden, als das Rennen unmittelbar auf ihrer Fährte wieder begann. Hiernach schien es die Absicht des Jägers zu sein, die Thiere einzuholen und mit den letztern auf wenige Schritte zusammen zu kommen.
„Die Leidenschaft hatte uns alle erfaßt und jeglicher Ueberlegung der drohenden Gefahr, in der wir uns befanden, beraubt. Kaum mögen acht Minuten vergangen gewesen sein, als wir, der vermeintlichen abwärts führenden Spur in langen Sprüngen von Fels zu Fels folgend, mit dem vordersten der Elephanten auf drei Schritte zusammentrafen. Die Thiere hatten einen auf uns zurückführenden Pfad eingeschlagen. Noch einen Schritt weiter und wir wären sämmtlich verloren und zu Brei getreten gewesen.
„Mit kühner Geistesgegenwart erfaßte der Jäger den Augenblick, und indem er einen gellenden Schrei ausstieß, stürzte er sich – gleichwie der Schwimmer von einem Springbret in das Wasser – von dem erhöhten Standpunkte etwa zehn Fuß tief in ein wildes Cactusdickicht hinein. Zum Besinnen hatten wir auch keine Zeit und ahmten, fast instinktmäßig, den sicheren Tod vor Augen, das Manöver nach. Auf das furchtbarste zugerichtet, drückten wir uns, wie ein Kitt Hühner unter eine Krautstaude, hinter einen Granitblock. Die Elephanten hatten, durch die wunderbare Erscheinung erschreckt, selber eine Bewegung halb rechts gemacht, dergestalt, daß sie uns schräg abwärts in einer Entfernung von vielleicht 10 bis 15 Schritt, jedoch ohne im geringsten flüchtig zu sein, die Flanken zeigten.
„Der Augenblick zum Handeln war gekommen. Der Jäger, Hermann (Fürst Hohenlohe) und ich waren mit einem Sprunge beinahe zu gleicher Zeit auf dem Felsen, der uns gerettet, die Büchsen flogen in die Höhe und vier Spitz[pg 216]kugeln bohrten sich hinter das riesige Gehör des Ungethüms. Der Elephant war tödtlich getroffen. Er hielt an und stieß jenen durch Gordon Cumming so wohl beschriebenen Schmerzenston aus, und wäre unsere Lage nicht so mißlich gewesen, so hätten wir ruhig sein Verenden abwarten können. Hier galt es aber augenblickliche Vernichtung und mit Büchsen à la Lefaucheux bewaffnet, ward es uns eine Leichtigkeit, in wenigen Minuten gegen vierzehn Kugeln dem schon wankenden Koloß hinter Blatt und Gehör zu senden. Ein zweiter Elephant, durch das Schießen beunruhigt, kreuzte den Verwundeten. Auch er erhielt von Hermann eine Kugel auf das Blatt, welche ihm jedenfalls jenen Schmerzensschrei entlockte, aber nur dazu zu dienen schien, seine Flucht zu beschleunigen. Unser erstes Opfer schwankte noch einige Male, indem es sich langsam umdrehte, hin und her. Da erhielt er aus der Muskete unsers Jägers den letzten Gnadenschuß durchs Herz. Das Thier stürzte mit einem furchtbaren Getöse und rollte, wie ein Hase auf einem gefrorenen Abhang, die Bergwand wol 500 Schritt hinunter, Bäume und Felsen vor sich her wälzend. Die Straße, die sein Körper beschrieben hatte, glich einem jener Lawinenstreifen, die man so oft im Hochgebirge auf der Gemsjagd antrifft. Mit einem Freudengeschrei jagten wir dem verendeten riesigen Thiere in den Abgrund nach, wo wir es tief unten, zwischen zwei Granitblöcken eingeklemmt, noch gewaltig mit seinen Füßen arbeitend, liegen sahen.“
Noch ein zweiter junger Elephant, der gleichsam um die Mutter zu rächen, wüthend herbeigeschnaubt kam, wurde erlegt, die Jagd war vollendet, und beleuchtet von den Strahlen der glühend untergehenden Sonne standen die Sieger auf den kolossalen Leichen ihrer Jagdbeute. Die Landschaft, in welcher die gefahrvolle Jagd stattfand, schildert der Herzog folgendermaßen: „Ein Panorama lag vor uns, wie ich es nur an wenigen Orten Tyrols und der Schweiz getroffen habe. Ein unabsehbares Meer grüner und brauner Berge, hier in den schönsten und reichsten Formen gelagert, dort wieder scharfgezeichnete Felsspitzen in pittoresken Gestalten vorstreckend, bot sich unsern Blicken. In weiter Ferne bezeichnete ein goldener Streif die Fluten des Rothen Meeres, nach allen übrigen Himmelsgegenden reihten sich Gebirge an Gebirge. Das schwierige Besteigen jener Alpen wäre schon hinreichend durch die unbeschreibliche Aussicht belohnt gewesen, deren wir uns hier zu erfreuen hatten. Die Sonne war glühend, dennoch erfrischte uns ein kühler Luftzug und ausgestreckt im hohen Grase schwelgten wir in den Genüssen der Natur.“
Bald darauf brach, nach verschiedenen neuen Jagdabenteuern, die Gesellschaft auf und langte am 23. April in Monkullu, bei der Frau Herzogin wieder an. Ueber ihren Aufenthalt daselbst schrieb die hohe Dame folgende Worte in ihr Tagebuch: „Die Tage, welche wir hier verlebten, waren keine Idylle in der Weise der lieben Heimat, es war für uns verwöhnte Kulturkinder Manches recht schwer zu überwinden; aber es war doch ein Stilleben voll von großen Eindrücken, und die Erinnerung daran möchte wohl keiner von uns missen. Wer einmal im Schein der tropischen Sonne auf Himmel, Land und Meer geblickt [pg 217]hat, der wird die Farbenpracht der Natur und die gehobene Stimmung, welche sie dem Menschen verleiht, nie mehr vergessen. Was Licht heißt und glühende Farbenschönheit, das erfährt man erst im Süden. Und die Einwirkung dieser Fülle von Licht und Farbe, die großen Gegensätze, welche ohne Dämmerung, ohne das Nebelgrau der Heimat, wie unvermittelt nebeneinander stehen und doch Bilder von der wundervollen Schönheit geben, werden immer mächtiger, je länger man weilt, und umgeben das Leben des Tages mit einer Poesie, die märchenhaft und fast bewältigend ist. Und in diesem Zauberlichte glänzt eine fremde Erdenwelt, denn Menschen, Thiere, Pflanzenformen, jeder Gegenstand, der an den Reisenden herantritt, trägt dazu bei, die Stimmung, welche die Landschaft hervorruft, zu erhöhen. Ungeachtet der Unsicherheit, welche der Europäer in dieser Wildniß empfindet, ist die Grundstimmung, welche dieses tropische Leben verleiht, doch eine erhebende Ruhe. Alles sieht großartiger und einfacher aus, und ohne Mühe kann man sich hier um Jahrtausende zurückdenken, in denen dasselbe Hirten- und Wanderleben war, dasselbe Geschrei der Thiere, dieselben Pflanzen an derselben Stelle, dasselbe Leuchten der Farben, ebenso der Sand mit den Steintrümmern und dem weißen Gebein der gefallenen Thiere. Der Mensch vermag in der großartigen Beständigkeit dieser Welt nur wenig.“
Am 26. April sagte endlich die Reisegesellschaft dem abessinischen Gestade Lebewohl und trat die Fahrt durch das Rothe Meer nach Suez an. Leider hielten gefährliche Fieber die Reisenden einige Zeit in Kairo zurück, und erst am 30. Mai wurde in Triest wieder der europäische Boden betreten. Die fürstliche Reise war auch für die Wissenschaft nicht ohne Ergebnisse, denn abgesehen von dem Werke des Dr. Brehm, der die zoologischen Resultate verarbeitete, veröffentlichte der Herzog selbst einen Reisebericht, der mit den herrlichsten Abbildungen in Farbendruck von Robert Kretschmer’s Meisterhand geschmückt wurde.
Der Aufenthalt des Herzogs im Bogoslande war jedoch viel zu flüchtig gewesen, als daß derselbe unsere Kenntnisse von den Bewohnern desselben hätte eingehend fördern können. Diese aber, durch Sitten, Abkunft und Rechtsverhältnisse ein höchst interessantes Volk, lernen wir am besten durch Werner Munzinger kennen, der sich viele Jahre unter ihnen aufhielt und gleich Stella eine bedeutende Stellung einnahm.
Ueber das Bogosland sind viele Stürme hinweggebraust. Die ganze Nordgrenze Abessiniens von Massaua bis zum Mareb war, der Sage zufolge, in alten Tagen von den Rom bewohnt, einem riesenhaften, übermenschlichen Geschlechte. Der letzte desselben verfeindete sich mit Gott, schleuderte eine Lanze gen Himmel und zur Strafe zerfraß ihm ein von Gott gesandter Adler den Kopf. Die Rom werden noch in Liedern besungen und spitzige Steinhaufen für ihre Gräber ausgegeben. Nach den Rom kamen die Kelau, ein äthiopischer Stamm aus Abessinien, von dem nur wenig Reste blieben; dann wanderten die Barea von Hamasién her ein und schließlich die Bogos.
[pg 218]Ihr Stammvater Gebre Terke ist vom Volke der Lasta-Agows (vgl. S. 90). Aus Furcht vor der Blutrache verließ er seine Heimat, stieg hinab in die Kolla und baute zu Mogarech im Bogoslande die Giorgiskirche; das mag 1530 gewesen sein, zur Zeit der muhamedanischen Kämpfe gegen das christliche Abessinien. Vor dem zu Aschra befindlichen Grabsteine des Stammvaters geht auch heute noch kein Bogos vorüber, ohne ihn zu küssen.
Bei den Bogos ist das Stammverhältniß stark ausgeprägt und die einzelnen Abtheilungen sind derart durch Heirathen verschwägert, daß innere Fehden zur Unmöglichkeit werden. Früher standen sie direkt unter Abessinien und sandten alljährlich 60 Ochsen als Tribut an den König in Gondar. Sie bildeten eine Aristokratie, die sich selbst nach eigenem Rechte regierte, eine gewisse Kultur besaß, jedoch durch Kriege und Berührungen mit den Nachbarn allmälig in Barbarei versank. Abessinier sowol als die Aegypter von Ostsudan aus machten Verheerungszüge in das Bogosland und es kam 1854 so weit, daß die Bogos endlich um Frieden flehten und den Aegyptern versprachen, den Islam anzunehmen. Da erschien bei ihnen der erwähnte Missionär Johannes Stella und sammelte die Leute wieder, und der englische Konsul Plowden erwirkte im Namen Großbritanniens, daß das christliche Gebiet für unverletzlich erklärt wurde. Doch noch immer nicht hatten die Bogos Ruhe. Neue Raubzüge fanden gegen sie statt, man führte viele in die Sklaverei. Wie wir aus Graf Krockow’s Reise wissen, erschien im November 1864 Pater Stella, begleitet von Werner Munzinger, in Kassala, um beim ägyptischen Gouverneur darüber Klage zu führen, daß die Barea außer vielem Vieh 104 Weiber und Kinder aus dem Bogoslande entführt hätten.
Noch immer zahlen die Bogos an Abessinien Tribut. Ihre Gesammtzahl beträgt etwa 8000 Köpfe, von welchen zwei Drittel Unterthanen, sogenannte Tigrés sind, und ein Drittel aus Schmagillis oder wirklichen Bogos besteht. Das Gesammtvolk hat nach Munzinger 2100 Häuser und etwa 10,000 Stück Rindvieh. Von höchstem Interesse sind die durch den genannten Forscher uns bekannt gewordenen Rechtsverhältnisse des Völkchens. Das Recht ist ein patriarchalisch-aristokratisches. Die Familie ist Staat, Souverän und Gesetzgeber, hat Recht über Leben und Tod der einzelnen Glieder. Wer nicht Schmagilli, echter Bogos ist, wählt sich einen Schutzherrn und wird nun dessen Dienstmann, Tigré. Eigentlich gilt jeder Fremde als Feind. Der Patriarch (Sim) ist geheiligt; er ist gleichsam König ohne Königsgewalt. Stirbt der Sim, so folgt ihm der Erstgeborene, nachdem er sich den ganzen Leib mit dem Wasser gewaschen, in welchem die Leiche des Vaters gewaschen wurde. Mit verhülltem Kopfe fastet er nun drei Tage; dann wird er, immer noch mit verbundenen Augen, vor die Hütte geführt und ihm Kuhdünger, Dornen und Sand vorgelegt. Greift er nach den Dornen, so bedeutet dies Krieg; Sand läßt auf gesegnete Ernten hoffen, Kuhdünger auf Gedeihen der Heerden.
Für die kleinere Familie ist der Vater Richter; zweite Instanz bildet der öffentlich versammelte Dorfrath (Mohäber). Trotz des Christenthums herrscht [pg 219]unter den Bogos noch viel Barbarei. Niemand kann lesen und schreiben; ein uneheliches Kind wird erstickt, und die eigenen Kinder verkaufte man früher oft für weniger als einen Thaler. Unter den vielen eigenthümlichen Sitten und Bräuchen heben wir folgende hervor. Kein Weib wird melken oder Getreide schneiden. Kein Schwiegersohn sieht das Antlitz seiner Schwiegermutter an. Die Frau steht im Allgemeinen niedrig; sie kann jeden Tag fortgejagt werden und besitzt kein Klagerecht. Es kommt nicht gerade selten vor, daß ein Mann nach dem Ableben des Vaters die Stiefmutter heirathet, und Munzinger kennt ein Beispiel, daß ein Mann die Frau seines gestorbenen Sohnes zum Weibe nahm. Scheidungen sind häufig, die Vielweiberei ist jedoch ziemlich selten, wenn auch erlaubt.

Früher bauten die Bogos Häuser aus Stein – jetzt Zweighütten wie die Mensa. Das Innere trennt man durch eine Matte in zwei Hälften. Auch in den häuslichen Einrichtungen herrscht allerlei Aberglauben. So wird z. B. Feuer und Wasser nach Sonnenuntergang niemals aus dem Hause gegeben und um diese Zeit kein verliehenes Beil zurückgenommen. So lange eine Leiche sich im Hause befindet, wird kein Feuer angezündet, und frische Butter zu essen, gilt für eine Schande.
[pg 220]Die Bogos haben schöne, regelmäßige Gesichtszüge und nicht das leiseste Negergepräge. Die Hautfarbe wechselt zwischen Gelb und Schwarz. Die Augen sind lebendig, schwarz und braun, der Haarwuchs weich und vollständig, doch grob.
Die Bogos sind mehr Hirten als Ackerbauer. Die Herden ziehen fast das ganze Jahr hindurch im Freien umher, und wol ein Drittel der Bewohner wandelt nomadisch mit denselben. Weib und Kind, das nöthige Gepäck wird aufgeladen und der Weideplatz ausgesucht. Dann wohnt Alles unter Palmenmatten, die bei einer Platzveränderung leicht abgebrochen und auf Ochsen geladen werden. Milch ist die beliebteste Nahrung, und jede Kuh hat ihren Namen. Der Hirt lenkt seine Herde mit guten Worten, ohne Hunde.
Unter diesem Volke gilt, wie im eigentlichen Abessinien, das Blutrecht. Die Nachkommen eines Vaters bis auf sieben Grade bilden die Blutsverwandtschaft. Dieselbe wird des Bluts theilhaftig, wenn ein Familienmitglied einen Mord begangen hat, und ist solch ein Glied getödtet worden, so hat jene gesammte Verwandtschaft das Recht und die Pflicht der Blutrache (Merbat). So lange die im Blut stehenden Familien sich eigenmächtig untereinander der Rache hingeben, hat das Recht nichts zu sagen; der Zwist wird den Blutfeinden überlassen. Sobald dieselben aber zur Versöhnung bereit sind, wenden sie sich an einen Mittelsmann, welcher jeder ihr Recht giebt; die Parteien zählen ihre Todten, und der Ueberschuß wird mit dem Blutpreis gesühnt.
Munzinger schildert, wie es mit dem Christenthum stand, als er und der Lazarist Stella 1855 in das Land kamen. Die Bogos nannten sich Kostan, Christen; zum Beweise, daß sie es seien, berührten sie niemals Fleisch, das ein Muhamedaner geschlachtet hatte, und aßen weder Elephanten, noch Hasen oder Strauße. Der Sonntag hieß großer Sabbath, allein die Sabbathruhe wurde am Sonnabend beobachtet. Die Bogos haben zwei Kirchen; bei denselben sind eingeborene erbliche Priester angestellt. Ihr Amt besteht darin, an den Hauptfesten die Schiefersteine, welche die Glocken vorstellen, anzuschlagen. Von Priesterweihe oder irgend einer religiösen Kenntniß ist bei ihnen keine Rede. Munzinger kann nicht einmal dafür einstehen, ob die 1858 lebenden Priester getauft waren. „Der alte Stammpriester von Keren ist ein vermögender Mann, der sich nie niedersetzt, ohne die heilige Dreieinigkeit anzurufen, aber er kennt nicht einmal das Vaterunser.“ Von der Bedeutung der Festtage hat man keine Vorstellung. Gott, Petrus, Dreieinigkeit sind gleichbedeutende Ausdrücke für die Gottheit, aber über den besondern Sinn der Wörter ist man sich nicht klar. Die heilige Jungfrau genießt die größte Verehrung, aber daß sie Mutter des Heilandes sei, weiß Niemand. „Im Ganzen ist das Christenthum ein Name, erhalten durch die Anhänglichkeit dieser Völker an das Althergebrachte. Ueberhaupt ist den Landeskindern Religion die letzte Sorge, und der Aberglauben überwuchert.“ Daß Munzinger die Befürchtung ausspricht, der Islam werde auch dieses Völkchen erobern, wurde früher schon hervorgehoben. Allein was ist an einem solchen Christenthum, das noch unter jenem Abessiniens steht, gelegen?
2. Werner Munzinger bei den Barea und Kunama.
Es wurde früher bei Erwähnung der deutschen Expedition gesagt, daß W. Munzinger sich in Mai Scheka von Heuglin trennte und eine mehr westliche Route einschlug, während Heuglin nach Süden in das eigentliche Abessinien eindrang. Die Reise des ersteren, welche in die Tage vom 16. November bis 22. Dezember 1861 fällt, führte ihn längs des Marebflusses in Regionen und zu Völkern, die bisher noch kein Europäer kennen zu lernen Gelegenheit hatte. Das in Rede stehende Gebiet liegt jenseit des Barkaflusses im Südwesten des Bogoslandes an der abessinischen Grenze und wird vom Mareb durchströmt.
Dieser Strom ist vermöge seines Charakters einer der eigenthümlichsten der ganzen Erde. Seine Quelle liegt oberhalb des Dorfes Ad Gebrai in Hamasién, dann bildet er, südlich fließend, eine Spirale, die von Gundet ab nach Westen sich wendet und in die Kolla von Serawié eintritt. Bis hierher gehörte er zu Abessinien, jetzt aber, wo er sich dem Lande der Kunama nähert, verändert er seinen Gebirgscharakter; er sucht das Niederland und heißt nun Sona. Hier ist er kein Waldstrom mehr und auch kein Torrent. Wo nämlich der Boden das Wasser nicht an der Oberfläche halten kann, wo es durchsickernd erst später auf einer festen Schicht Widerstand findet, da zeigt sich der Strom als Torrent, d. h. es erscheint ein Sandbett, welches nur zur Regenzeit überflutet wird und das ganze übrige Jahr scheinbar trocken daliegt, weil der Wasserstrom unterirdisch sich fortzieht. Der Mareb nun erscheint als Mittelding zwischen Fluß und Torrent und verliert diesen Charakter erst im Unterlauf. In der Regenzeit, Juli bis September, wird er regelmäßiger Fluß; in den übrigen Monaten zeigt er sich als Torrent, aber so, daß sein Sandbett hier und da von Teichen unterbrochen wird, wo das Wasser für kurze Zeit an die Oberfläche hervortritt. In der Ebene von Takka, bei der Stadt Kassala, heißt der Fluß Gasch oder Chor el Gasch. Hier, im Gebiete der Hadendoa-Araber, wird er zur Bewässerung des Landes benutzt und hat eine Menge künstlicher Stromwehren, vermittelst deren man ihn aufstaut und die Felder überschwemmt. So verliert er sich meistens, aber in Jahren, wo sehr viel Regen fällt, wird es ihm möglich, sich bis zum Atbara Bahn zu brechen, den er dann bei Gasch-Da, d. h. Mund des Gasch, erreicht.
Die Völker nun, am unmittelbaren Lauf des Stromes, unterscheiden sich von den Bogos, einem aristokratischen Volke, durch ihr ganz demokratisches Wesen. „Die Natur,“ sagt Munzinger, „ist hier einförmig, kein Berg ragt empor, keine scharfe Form zeichnet sich aus, kein entschiedener Gebirgszug und keine großartige Ebene giebt dem Ganzen Charakter und Einheit; selbst der Baumwuchs ist nur mittelmäßig; Gesträuch ist vorherrschend – und so der Mensch und seine Verfassung; nichts strebt, nichts beherrscht; lose zusammengeworfene Gemeinden entbehren der staatlichen Einheit und der bürgerlichen Verschiedenheiten.“
Die Kunama oder Bazen und die Barea, welche hier wohnen, sind sich ihrer Sprache und Tradition nach durchaus nicht verwandt und dennoch stimmen [pg 222]ihre Rechtsbegriffe miteinander überein. Die Bazen bewohnten früher Tigrié, bis sie von den Geézvölkern hinausgedrängt wurden. Die Barea entsinnen sich nicht ihres Ursprungs, doch ist das Land der Bogos voller Zeugnisse ihrer früheren Anwesenheit. Die Religion beider Völker ist ein gleichgiltiger Deismus, eine Idee von Gott, aber ohne Kultus oder christliche Reminiscenz. Wochen und Tage verlaufen ohne Festtage; religiös ist die Sorgfalt, die man auf die Gräber wendet, die aus Höhlen bestehen, in welche der Leichnam beigesetzt wird; religiös die unbegrenzte Ehrfurcht vor dem Alter, das allein regiert. Aberglauben hat das erbliche Amt des Regenmachers gestiftet, des Alfai, der allein wohnt, Regen bringt und, fehlt dieser, hingerichtet wird. Beschneidung war von jeher üblich, und der Islam hat unter ihnen große Fortschritte gemacht.
Beide Völker charakterisirt die radikale Gleichheit der Individuen, die Abwesenheit des Staates; so leben die Dörfer zusammen friedlich und ruhig, Verbrechen sind selten. Dem Auslande gegenüber aber fehlt der staatliche Zusammenhang, die gegenseitige Hülfe. Beiden eigenthümlich ist die Bevorzugung des Schwestersohnes, der Blut und Habe von seinem Onkel erbt mit Ausschluß der Kinder; eine Familie in unserem Sinne existirt also nicht, der Begriff von Vater und Sohn fehlt, dagegen hängen Neffe und mütterlicher Onkel eng zusammen. Recht sprechen die Aeltesten des Dorfes, und keine Aristokratie lehnt sich gegen die Beschlüsse der Gemeinde auf. Selbst der Fremde wird nach kurzem Aufenthalt den alten Insassen gleich.
Die Leute leben von heute auf morgen und dafür genügt der Ackerbau, den sie fleißig treiben. Grund und Boden kann bei der Ausdehnung des Landes nur wenig Werth haben, eine konsequente Viehzucht verbietet das Klima. Blutrache ist natürlich überall nothwendig, wo der Staat sie nicht besorgt, doch hat sie bei den Barea und Bazen nicht den ausgebildeten Charakter, wie bei den Abessiniern. Der Mörder muß sich dem Tode durch ein mehrjähriges freiwilliges Exil entziehen, wonach er um ein geringes Blutgeld ausgesöhnt wird.
Das Land der Bazen ist reich an wildem Honig, den sie stark genießen, während die Barea sich vorzugsweise von Bier nähren. Dieser Lebensweise schreibt Munzinger es zu, daß die Bazen volle muskulöse Gestalten haben, während die Barea klein und hager sind. Die Wohnungen beider Völker sind runde, glockenförmige, bis zum Boden mit Stroh sehr zierlich bedeckte Hütten; ihre Kleidung ist der Lederschurz, der erst allmälig den eingeführten Baumwollenzeugen Platz macht. Das Haupthaar tragen sie wie alle uns schon bekannten Völker von Nordabessinien; der Bart ist meist sehr dünn. Die Nase haben sie selten sehr stumpf, oft aber, besonders bei den Barea, adlerartig gebogen. Der Mund ist groß, jedoch nicht aufgeworfen. Was die Farbe anbelangt, so findet man alle Abstufungen von Gelb bis Schwarz, doch herrscht die dunkle Farbe vor.
Die Bazen und die Barea unterscheiden sich im Temperament; die ersteren sind ruhig, gesetzt und reden leise; die letzteren sind lebhaft lärmend, schnell aufbrausend. Die Eheverhältnisse bei den Bazen scheinen sehr lose zu sein, während [pg 223]die Bareafrauen wegen ihrer Treue auch im Auslande berühmt sind. Beide Völker sind zu Hause sehr friedfertig, während mit dem Auslande ein ewiger Krieg geführt wird. Barea und Bazen stehen nicht in völkerrechtlicher Verbindung und heirathen selten untereinander.
Die Bazen müssen ein sehr zahlreiches Volk sein. Ihre Hauptsitze ziehen sich den großen Strömen Mareb und Takazzié nach; ersterer heißt bei ihnen Sona, letzterer Dika. Alle treiben Ackerbau mit dem Pflug und nur theilweise Viehzucht. Ihre Waffe ist die Lanze. Als Typus kann der Zither spielende „Schangalla“ vom Mareb nach Zander’s Zeichnung angesehen werden (S. 89).
Die Wohnsitze der Barea liegen im Norden der Bazen. Die Thäler, welche sie bewohnen, gehören schon dem Hochlande des Barka an, wie ihre Wasser und ihre Vegetation; die sie begleitenden Berge sind die letzten Ausläufer des Hochlandes der Bazen und werden zur Weide benutzt, Fieber sind häufig und die Regen fallen dort meist in der Nacht.
So sind die Völker beschaffen, welche die nördlichen Vorlande Abessiniens bewohnen. Aber auch im Süden, zwischen Amhara und Schoa und wieder über Schoa hinaus, treffen wir auf ein eigenes höchst interessantes Volk, das der Galla. Mit ihm werden wir uns im folgenden Abschnitte beschäftigen, der uns das Königreich Schoa vorführt, welches von Amhara sich seit langem unabhängig zu machen wünscht und nur zeitweilig mit ihm zusammenfiel; schon daß der Herrscher daselbst den Titel „Negus“ führt, deutet darauf hin, daß wir es hier mit einem besonderen Staate zu thun haben.
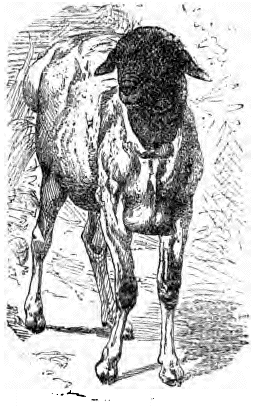
Schoa und die britische Gesandtschaft unter Major Harris.
Begrenzung. – Englische Gesandtschaft unter Harris. – Tadschurra. – Zug durch die Adalwüste. – Salzsee. – Mord im Thale Gungunté. – Versammlung der Eingeborenen. – Sklavenkarawane. – Myrrhen. – Der Hawasch. – Der Grenzdistrikt. – Alio Amba, ein Marktort. – Empfang beim Könige Sahela Selassié. – Die Hauptstadt Ankober. – Debra Berhan, die Sommerresidenz. – Sklavendepot. – Truppenrevue. – Angollala. – Schlucht der Tschatscha. – Medoko, der Rebell. – Das Gallavolk. – Kriegszug gegen dasselbe. – Siegesfest. – Abschluß des Handelsvertrags. – Rückkehr.
Schoa im weiteren Sinne umfaßt den Theil der abessinischen Hochlande, welcher im Osten von der Adalwüste, im Süden vom Hawaschflusse und im Westen vom Abai oder Blauen Nil begrenzt wird. Die unbestimmte Nordgrenze machen muhamedanische Gallastämme aus. Im engeren Sinne versteht man darunter jedoch nur den westlichen Theil dieser Hochlande, nämlich die Distrikte Tegulet, Schoa Meda, Morabiétié, Mans und Gesche. Die östliche, im allgemeinen als Ifat bezeichnete Abtheilung des Berglandes umfaßt dagegen die Provinzen Bulga, Fatigar, Mentschar im Süden, Argobba im Osten und Efra im Norden. [pg 225]Beide Theile sind infolge des fruchtbaren Bodens ziemlich stark bevölkert, wozu noch das gesunde Klima und eine vergleichsweise politische Ruhe beigetragen haben. Krapf schätzt die Bevölkerung mit Einschluß der im Süden unterjochten Galla auf eine Million Seelen. Quellen, Bäche, Flüsse und Seen sind zahlreich im Lande vorhanden, das in Bezug auf seine Bodenbeschaffenheit mit dem übereinstimmt, was wir im allgemeinen über Abessinien bemerkten.
In der Zeit, die wir in diesem Abschnitte schildern wollen, herrschte Sahela Selassié als Negus über Schoa. Er hatte den protestantischen Missionär Krapf wie dessen Mitarbeiter Isenberg freundlich aufgenommen und von Beiden viel über Englands Macht und Größe gehört, wodurch sich in ihm der Wunsch regte, zunächst mit der Ostindischen Compagnie in ein Freundschaftsverhältniß zu treten, so daß er schon am 6. Juli 1840 einen Brief an den englischen Gouverneur in Aden sandte, in welchem er um die Absendung einer Gesandtschaft an seinen Hof bat. Infolge dessen entschloß sich die ostindische Regierung, seinem Wunsche zu willfahren und eine ständige Gesandtschaft an ihn zu schicken, an deren Spitze Kapitän W. Cornwallis Harris stand, ein vorzüglicher Offizier, der sich bereits durch seine Reisen in Südafrika, wo er bis in das Reich des Mosilikatse vorgedrungen war, einen Namen gemacht hatte. Als erster Stellvertreter wurde ihm Kapitän Graham, als Arzt Dr. Kirk, als Naturforscher Dr. Roth, als Maler der Deutsche Martin Bernatz, außerdem fünf andere Europäer, zwei Apotheker, ein Zimmermann, ein Schmied, zwei Sergeanten und fünfzehn freiwillige Soldaten beigegeben. Mit reichen Geschenken für König Sahela Selassié versehen, worunter sich auch eine Kanone und 300 Flinten befanden, verließ die zahlreiche Gesandtschaft am 27. April 1841 Bombay, besuchte zunächst Aden, das Gibraltar des Ostens, in Arabien, und schiffte dann nach der afrikanischen Küste hinüber, um in der Bucht von Tadschurra Anker zu werfen. Die Bucht, in welcher die Schiffe lagen, wurde ihrer Ruhe und Sicherheit wegen Bar el Banatin, der See der zwei Nymphen, genannt. Sie reicht tief ins Land hinein, ist ziemlich eng und von hohen Bergen umgeben, die ihr vulkanisches Gepräge deutlich zur Schau tragen. Zugleich hat diese Bucht ethnographische Bedeutung als Scheide der Danakil und Somalvölkerschaften. Am 18. Mai landete die Gesandtschaft und empfing sofort den Besuch des Sultans der Stadt, des alten Muhamed Ibn Muhamed. Eine häßlichere Erscheinung als diesen alten, magern, schmuzigen Fürsten kann man sich kaum vorstellen; der Reihe nach bot er einem Jeden seine mit ekelhaften Klauen versehenen Hände und ließ sich dann zum Gespräch nieder. Er war in einen groben Baumwollenmantel, der einmal blau gewesen war, eingehüllt, trug an einem Riemen den Koran um die Schulter gebunden und war außerdem mit einem Säbel gegen seine leiblichen und mit Amuleten gegen seine überirdischen Feinde versehen. Sein braunes, durchfurchtes Gesicht zeigte eine Politur gleich Ebenholz und war von einem weißen Bart umrahmt. Von ihm wurde zunächst die Erlaubniß erlangt, nach Schoa vordringen zu dürfen, eine Erlaubniß, die gegenüber den Kanonen der britischen Kriegsschiffe nicht gut verweigert werden konnte.
[pg 226]Der elende Ort Tadschurra war einige Jahre lang in den Händen der Türken, nachdem diese Massaua (1527) erobert hatten, und aus ihrer Zeit stammt auch noch eine zerfallene Moschee am Meeresstrande. Jetzt ist es eine selbständige Stadt unter einem Sultan, der zeitweilig von den Sultanen der gegenüberliegenden arabischen Küste abhängig ist. Fanatische Muhamedaner, meist Danakil, bewohnen den Platz, welcher nur als Sklavenmarkt einige Bedeutung hat. Ackerbau besteht nirgends in der Umgegend; jedermann ist Krämer oder Händler und wird mit der Zeit durch den Sklavenhandel wohlhabend. Der bedeutendste Handel findet mit Südabessinien statt, wohin jahraus jahrein die Karawanen ziehen. Indische und arabische Manufakturen, Zink, Kupfer und Messingdraht, Perlen und namentlich viel Salz werden dort gegen Sklaven, Korn, Elfenbein und einige andere Erzeugnisse ausgetauscht; allein Menschen und Salz bilden die Hauptartikel. Als Werthmesser gilt auch hier der Maria-Theresia-Thaler vom Jahre 1780, als Scheidemünze Lederstreifen, die zu Sandalen benutzt werden können. Außerdem nimmt man im Handel Schnupf- und Rauchtabak, leere Flaschen, Spiegel, Knöpfe und Perlen als Scheidegeld an.
Die gewöhnliche Klage der afrikanischen Reisenden, daß bei ihren Unternehmungen die Abreise das Schwierigste sei, sollte sich auch bei der britischen Expedition nach Schoa wieder als wahr zeigen. Das Verpacken der Geschenke für den König, das Engagiren von Kameeltreibern, endlich aber die Hindernisse, welche der Sultan von Tadschurra in den Weg legte, waren schwer zu beseitigen und zeitraubend. Als dies jedoch Alles mühselig überwunden, war das Jahr so vorgeschritten, daß man die Wüste gerade durchreisen mußte, als in den Monaten Juni und Juli der feurige und ungesunde Wind über die wasserlose Ebene von Südwesten her den Reisenden entgegenblies. Unterdessen herrschte im Lager von Dullul, wo die Gesandtschaft ihre Zelte am sandigen Seegestade aufgeschlagen hatte, große Regsamkeit, um Alles vorzubereiten und das Gepäck zu ordnen und zu vertheilen. Endlich waren 170 Kameele, welche die Karawane bildeten, beisammen; Wasserschläuche und Maulthiere wurden für die Europäer gekauft, und mit den Gefühlen, mit denen man eine Räuberhöhle verläßt, setzte sich der Zug in Bewegung, um Tadschurra den Rücken zu kehren, dessen Bewohner Harris die abscheulichsten und niederträchtigsten Menschen nennt, welche die Erde bewohnen. Als Ras el Kafila oder Karawanenführer fungirte Isaak, ein Bruder des Sultans von Tadschurra, der sich aber keineswegs als zuverlässiger und tüchtiger Mann bewies. Der Zug ging anfangs längs dem Meere bei Dullul hin durch das schroffe, zerrissene und wilde Gebirge, welches die Bucht auf der Nordwestseite umgiebt. Der gähnende Paß der Isa war zunächst zu durchschreiten, welcher seinen Namen von dem räuberischen Somalstamme der Isa empfangen hat, die in seinen Tiefen manchen Mord ausführten. Ein Zickzackriß, hervorgebracht durch die plutonischen Aeußerungen des Erdinnern, windet sich hier gleich einem mythologischen Drachenleib durch die Eingeweide der Erde. Ungeheure schwarze oder braune, vegetationslose Basaltklippen stehen senkrecht zu beiden Seiten wie Mauern in die Höhe, bei deren Bau die [pg 227]Cyklopen thätig waren, und durch diese wilde Scenerie eilte nun in wolkenloser heller Mondscheinnacht die Karawane hindurch. Kein Ton außer den Zurufen der Kameeltreiber war zu hören; schauerliches Dunkel lag auf dem Abgrund und nur die Lanzenspitzen der Eingeborenen, die den Zug begleiteten, glitzerten hier und da im Scheine des fahlen Mondlichtes – geisterhaft bewegte sich die Karawane dahin; Schauder lag auf allen Gemüthern, und erst als die Frühlichtstrahlen die gebrochenen Felsklippen vergoldeten, wich die Pein von den bangen Gemüthern.
Weiter ging der Zug durch einsame Thäler, deren Boden mit zertrümmertem basaltischen Gestein bedeckt war und die durch tiefe Schluchten und Spalten die Gewalt der vulkanischen Kräfte bezeugten, welche hier einst sich äußerten. Dann kam man zum Assalsee, dessen Ufer eine tänzelnde Fata Morgana umgab. Der erste Blick auf dieses seltsame Phänomen war keineswegs angenehm. Das elliptische Becken von etwa zwei deutschen Meilen Länge war zur Hälfte mit ruhigem, tiefblauem Wasser, zur andern Hälfte mit einer blendendweißen, glitzernden Salzkruste bedeckt, die durch Verdampfung entstanden war. Von drei Seiten umgürteten hohe, brennendheiße Berge dieses Seebecken, während auf der vierten Lavatrümmer und tiefe Schlünde sich hinzogen. Alles Pflanzen- und Thierlebens beraubt, war die Erscheinung dieser Wildniß von Land und stagnirendem Wasser, über dem ein dumpfes Schweigen ruhte, ganz dazu geeignet, das Gemüth niederzudrücken. Nicht ein Laut tönte an das Ohr, keine Welle spielte auf der Wasserfläche, nur die brennendheiße Sonne setzte am wolkenlosen Himmel ihren Lauf fort und sandte glühende Strahlen auf das todte vulkanische Land hernieder, über dem kein kühlendes Lüftchen wehte.
In diesem höllischen Schlunde hatten Mensch und Thier in gleicher Weise zu leiden. Nicht ein Tropfen Trinkwasser war weit und breit zu entdecken, während das Thermometer selbst im Schatten der Mäntel und Schirme eine Temperatur von 126 Grad Fahrenheit, d. i. 52 Grad Celsius oder 42 Grad Réaumur zeigte! Fünfhundert und siebzig Fuß liegt das Becken des Assalsees unter dem Spiegel des Meeres; kein Lüftchen weht dort, kein Obdach ist zu entdecken, nur der weiße Widerschein der Salzkruste blendet das Auge. Die lechzende Zunge hängt am Gaumen und empfängt keinerlei Labung von dem warmen Wasser, das die Schläuche darbieten, jeder Schritt vorwärts ermüdet Mensch und Thier noch mehr und zwölf lange Stunden dauert die Reise durch das Seebecken – sie müssen zurückgelegt werden, wenn nicht der Tod über den Wanderer kommen soll.
In einer Bucht des Sees waren Salzgräber damit beschäftigt, ihre Kameele für die Märkte in Aussa und Abessinien zu beladen, wo das Salz einen bedeutenden Tauschartikel ausmacht. Die Danakil betrachten die Ausbeutung dieses Salzlagers als ihr unbestrittenes Monopol und verwehren jedem andern Volke den Eingriff in dasselbe. In lange, schmale Säcke aus Dattelpalmblättern verpackt, wird das Salz von hier nach Abessinien gebracht.
Nachdem die traurige Einöde am Assal durchzogen war, überstieg man [pg 228]einen aus Gyps bestehenden Hügelzug und gelangte in ein Thal, in dem man sich in eine ganz andere Welt versetzt fühlte. Allerdings fehlte hier noch Pflanzen- und Thierleben, aber ein kleiner Bach mit klarem Wasser ließ diesen Ort wie ein Paradies erscheinen, und mit dankbarem Herzen ruhten die ermüdeten Wanderer unter überhängenden Basaltklippen aus, die ihnen Schatten spendeten. Hier am Flüßchen Gungunté endigte der erste Abschnitt der Wüstenreise. Der Zug durch die Einöde ist im Stande, die Gesundheit des kräftigsten Europäers zu untergraben; von der herrschenden Hitze bekommt man jedoch einen Begriff, wenn man hört, daß 50 Pfund gut verpackte Stearinkerzen auf der kurzen Reise von Tadschurra bis Gungunté so vollständig aus der sie bergenden Büchse herausgeschmolzen waren, daß sich in derselben schließlich nur noch Dochte vorfanden! Selbst die Danakil, welche doch von Jugend auf diese Gegenden kennen und an die brennendheiße Lava dieser Tehama-Wüste gewohnt sind, bezeichnen die Gegend am Assal-Salzsee nur als „Feuer“.
Jetzt nahten andere Gefahren, denn man war in dem Gebiete der über alle Begriffe nichtswürdigen, mörderischen und räuberischen Stämme der Isa und Mudaïto, deren ganzes Sinnen nur auf Mord und Plünderung geht. So vorsichtig man auch das Nachtlager im Thale Gungunté eingerichtet hatte, ein Mord durch jene Scheusale in Menschengestalt konnte nicht verhindert werden. Eine Stunde vor Mitternacht stellte sich plötzlich ein heftiger Wüstenwind ein, der Alles mit Sand und Staub überdeckte. Einige schwere Regentropfen fielen, dann aber war wieder Alles still. Diese Ruhe sollte jedoch nicht lange anhalten. Ein wilder Schrei ertönte vom äußersten Ende des Lagers her, panischer Schrecken ergriff die gesammte Mannschaft und in wilder Flucht stürzten die Männer, die sonst keine Furcht kannten, durch das Thal nach der Stelle hin, wo die Gesandten schliefen. Nur mit Mühe gelang es, alle zu sammeln und dann nach der Ursache des Schreckens zu forschen. Ein trauriger Anblick bot sich nun den Suchenden dar. Ein Sergeant und ein Korporal von der indischen Armee, welche die Expedition begleiteten, wälzten sich in Todeszuckungen in ihrem Blute. Dem einen war die Halspulsader durchschnitten, dem anderen ein Stich in das Herz versetzt worden, während nicht fern von ihnen ein Portugiese lag, der eine fürchterliche Wunde quer über den Leib hatte, sodaß die Eingeweide hervorquollen. Im Augenblick als der Alarm entstanden war, hatte man im hellen Mondlichte zwei dunkle Gestalten an den das Thal einschließenden Bergen in die Höhe klimmen und verschwinden sehen; trotz der Verfolgung konnte man ihrer nicht mehr habhaft werden. Wahrscheinlich waren dieses Isa-Somal, die das satanische Verbrechen aus reiner Mordlust begangen hatten. Denn jedes Schlachtopfer, das wachend oder schlafend in die Hände dieser Teufel in Menschengestalt fällt, giebt diesen das Recht, als Ehrenzeichen eine weiße Straußenfeder in den fettigen schwarzen Haaren, einen Kupferring am Arm und einen neuen Silberknopf am Heft des Säbelmessers zu tragen. Jeder Mord ruft nach dem Gesetze der Blutrache wieder einen Mord hervor, und so nimmt das Blutvergießen unter den Stämmen der Danakil und Somal kein Ende.

Am nächsten Morgen bestattete man unter Gebet und Flintensalven die Opfer dieses schändlichen Mordes und zog dann auf der gefährlichen Straße weiter. Drei Jahre lang war schon dieser Weg von Abessinien nach der Seeküste durch solche Schurken förmlich geschlossen, die jeden Durchziehenden kaltblütig abschlachteten, bis der junge Häuptling der Debeni die Banditen ausrottete und die Straße wieder öffnete; jedoch ist es nicht zu verhindern, daß einzelne Gegenden immer noch unsicher bleiben. Viele Leute, welche die Karawane begleiteten, zeigten an ihrem Körper Spuren großer, von den Wegelagerern empfangener Wunden.
Von nun an befestigte man das Lager des Nachts und stellte zahlreiche Posten aus, die alle Herannahenden zurückweisen mußten. Im Thale Alluli schien man den vorhergehenden Stationen gegenüber in ein Paradies gelangt zu sein, denn hier traf man Bäume, Gazellen, Tauben und Ziegenhirten. Die ersten menschlichen Wohnungen fand man jedoch erst weiter südwestlich in Suggadera, das zum Lande der Debeni-Danakil gehört. Diese Leute sind Hirtennomaden, die von Palmwein und der Milch ihrer zahlreichen Ziegen- und Schafherden leben oder Kameele züchten und mit diesen Salz vom Assalsee nach Aussa, der Stadt der Mudaïto, führen. Große Architekten sind sie freilich nicht, aber die auf einer Basis von unbehauenen Steinen aus Dattelpalmblättern erbauten Hütten erfreuten dennoch das Auge der Wanderer als die ersten Wohnstätten, die sie seit ihrer Abreise sahen.
Wegen der großen Hitze zog man in der Nacht weiter, immer über schwarze Lavafelder oder gelbe Sandflächen – ein trauriger Anblick, der noch melancholischer durch die vielen zerstreuten Steinhügel wird, die über den kaltblütig ermordeten Opfern der Isa von den Vorüberziehenden aufgethürmt werden. Tamarisken, Kappersträuche und anderes mit Schmarotzerpflanzen überzogenes Gestrüpp, in dem Vögel nisteten, unterbrach hier und da die Einöde; auch Strauße ließen sich sehen; dann kamen Grasflächen, Wasserplätze, Herden und Hirten, darauf Lavafelder, Bergzüge, ausgetrocknete Thäler, Herden wilder Esel (Equus Onager), Schwefelquellen als Zeugen der vulkanischen Thätigkeit des Bodens.
Im Thale Amadu machte die Karawane bei einem großen Regenwassersumpfe Halt, dessen grünes, von einer Legion Esel, Ziegen, Schafe und Rindvieh verunreinigtes Wasser nichtsdestoweniger recht trinkbar erschien. Hier hatten Leute vom Mudaïtostamme ihr Lager aufgeschlagen – ganz nichtswürdige Schurken. Mit finstern Blicken schauten sie die weißen Eindringlinge an und trieben ihre Fettschwanzschafe in die kühlende Flut, in der die jungen Damen der Horde, nachdem sie sich selbst gewaschen, ihre alten Lederschläuche reinigten, während eine alte magere Hexe ihrem Hunde den Pelz in der Flut wusch. Alle diese Hirten gingen mit Speer und Schild bewaffnet und kamen zum Zelte der Gesandtschaft heran, wo sie versuchten, dies oder jenes Ding sich zuzueignen. Durch ihre Ueberzahl kühn gemacht, begannen sie, den Karawanenführer Isaak zu fragen, mit welchem Rechte er die Fremdlinge durch dieses Land führe, wo sie „Herren des Bodens“ seien – doch als sie sahen, wie auf 250 Ellen Entfernung ein Stein von einer Flintenkugel zersplittert wurde, fingen sie an, bescheiden zu werden.

Ueber ein steiniges Tafelland, das mit nie enden wollenden Basaltblöcken überstreut und mit Rissen durchzogen war, die Wasserpfützen bargen, zog man weiter ins Land der Woéma, eines Danakilstammes. Wo Wasserläufe die Einöde unterbrachen, zeigte sich der Klippschliefer (Hyrax) und ein Baum, in der Form der Casuarina ähnlich. Im Killulluthale war der halbe Weg von der Küste bis nach Abessinien zurückgelegt. Bewaffnete Eingeborene der verschiedensten Stämme waren hier versammelt, um Berathung darüber zu halten, ob man einer so großen Anzahl fremder Leute gestatten dürfe, bis nach Abessinien vorzudringen, und die Mehrzahl war der Meinung, daß man sie entweder zurückjagen oder umbringen müsse. Zugleich wurde die Gelegenheit ergriffen, um über alte Streitigkeiten und Fehden zu unterhandeln. Hunderte dieser Schurken saßen so von Sonnenaufgang bis zum Untergang und wieder die liebe lange Nacht hindurch in größeren und kleineren Kreisen beisammen, um zu berathschlagen. Während der langen Unterhandlungen hockten sie bewaffnet mit aufrecht gehaltenen Speeren da, senkten diese gemeinsam, wenn ein Entschluß gefaßt war, und schlossen, nachdem ein Spruch aus dem Koran gebetet war, mit einem Amen die Versammlung. Noch lebhafter gestaltete sich das Bild durch die Ankunft einer Sklavenkarawane aus Schoa. Es waren einige hundert Kinder von verschiedenem Alter, die unter den dünnbelaubten Bäumen oder unter Felsvorsprüngen Schutz vor den brennenden Strahlen der Sonne suchten. Jedes hatte eine thönerne Wasserflasche bei sich und obgleich sie meist bei guter Laune waren, konnten doch die Europäer, welche die heiße Wüste jetzt durchzogen hatten, sich eine Vorstellung von den Qualen machen, welche die armen Geschöpfe auf dem vor ihnen liegenden Wege auszustehen hatten. Da jedoch die Behandlung in ihrer eigenen Heimat eine keineswegs bessere war, so fanden die Sklaven ihre Lage ganz erträglich und begannen, nachdem sie sich etwas von der Reise erholt, zu tanzen und zu singen. Die meisten waren Christenkinder aus Guragué, von wo die so hoch gepriesenen „rothen Aethiopier“ nach Arabien geliefert werden. Fast alle hatten bereits, wenigstens der Form nach, den muhamedanischen Glauben angenommen und schwuren beim Propheten.
Während der Zeit, daß die Expedition hier einen unfreiwilligen Aufenthalt hatte, stand das Thermometer auf 112 Grad Fahrenheit (35½° R.) und die zudringlichen, nach ranzigem Fett riechenden Eingeborenen drängten sich mit großer Unverschämtheit in das Zelt der Gesandten, um dort die Luft noch unerträglicher zu machen. Muhamedaner von der bigottesten Sorte, verschmähten sie jedoch weder den Zwieback, noch den Kaffee der „Christenhunde“ und bettelten bald um diese, bald um jene Kleinigkeit. Unter den verschiedenen Stämmen, die an diesem vielbesuchten Wasserplatze versammelt waren, befanden sich die Adâl mit breitspitzigem Speer und uralten Schilden, die Küsten-Somal mit leichter Lanze und Buckelschild, nicht viel größer als ein Schiffszwieback, ihre gefürchteten Stammesbrüder, die mörderischen Isa, mit langem starken Bogen von antiker Form und versehen mit einem Köcher voll vergifteter Pfeile. Sie waren unter allen die malerischsten Gestalten; kühn hatten sie den wallenden [pg 233]Mantel umgeworfen und lange rabenschwarze Locken wallten auf die Schulter herab. Sie können als ein Räuber- und Jägervolk bezeichnet werden. Viele unter ihnen besitzen gezähmte Strauße, die mit den Herden zusammen weiden und des Nachts an den Lenden gefesselt werden. Diese gigantischen Vögel werden mit viel Erfolg bei der Jagd auf wilde Thiere benutzt; auch reiten die Isa auf Eseln, von denen der Jäger seine mit Euphorbiasaft vergifteten Pfeile abschießt. Die Schilde, welche die Danakil tragen, werden von den Isa aus dem Fell der Oryx-Antilope verfertigt; auch handeln sie mit Straußenfedern. Die Art und Weise, wie sie die erlegten Vögel zubereiten, ist sehr originell; sie schneiden dem Vogel die Füße ab, wickeln dann das ganze Thier sammt Eingeweiden und Federn in feuchten Thon und backen diesen in heißem Feuer; nachdem die Thondecke entfernt ist, bleibt der saftige Braten zurück.
Nicht ohne große Mühe und Gefahr konnte nach einwöchentlichem Aufenthalt die Gesandtschaft sich von den barbarischen Nomaden und dem traurigen Orte losmachen, um ihren Weg fortzusetzen. Ueber kahle, steinige, von Schluchten zerrissene Berge ging der Weg in südwestlicher Richtung weiter. Lange Züge von Kameelen, Hornvieh, Schafen und Ziegen begegneten ihnen. Alle Bürde trugen die Weiber und Kinder der herumziehenden Stämme, während der faule Ehemann nur leicht mit Speer und Schild bewaffnet dahinschritt. Der Myrrhenbaum (Balsamodendron Myrrha) kam in der Nähe der bienenkorbförmigen Hütten, auf die man jetzt öfter traf, häufig vor; seine aromatischen Zweige liefern den Eingeborenen Zahnbürsten, welche sie in der Säbelscheide tragen. Häufige Regen traten in der Nacht ein und durchweichten die Reisenden bis auf die Haut; dann brausten wieder Wüstenwinde daher, waren wasserlose Flächen oder mit vulkanischem, scharfem Gestein übersäete Ebenen zu durchziehen – mit einem Worte, der Weg war aufreibend, mühsam und beschwerlich im höchsten Grade. Selten nur unterbrach eine Oase die Einöde, um dann gleich wieder vulkanischen Gebilden Platz zu machen. Bei Saltelli traf man auf ein Feld erloschener Vulkane, die, umgeben von Lavafeldern, in kegelförmiger Gestalt hier aus den Eingeweiden der Erde hervorgebrochen waren. Einer dieser alten Vulkane, der über 3000 Fuß hohe Aiullo, gilt als die alte Landesgrenze des nun zerfallenen äthiopischen Reichs. Wüst und traurig war die todte Umgebung dieser Berge – aber eine freudige Ueberraschung wurde den Reisenden hier doch zu Theil, denn zum ersten Male erblickten sie an diesem Orte in weiter, nebelhafter Ferne die blauen Gebirgsketten Abessiniens. Ihren Weg verfolgend trafen die Gesandten immer mehr auf Myrrhenbäume, und zwar auf zwei Arten. Diejenige, welche das beste Harz liefert, ist ein zwerghafter Strauch mit dunklen, krausen, sägeförmigen Blättern, während die andere, welche ein mehr balsamartiges Produkt liefert, zehn Fuß hoch wird und helle, glänzende Blätter hat. Nach der geringsten Verletzung fließt der milchige Saft in reicher Menge heraus und erstarrt an der Oberfläche; wenn die Masse oft vom Stamme entfernt wird, kann man im Januar und wieder im März große Mengen von einer Pflanze gewinnen. Mehrere Loth der feinsten Myrrhe erhält man auf diese Art im Vorbeipassiren leicht; [pg 234]dieselbe wird von den Vorübergehenden in einer Höhlung im Schilde aufbewahrt und an den ersten besten Sklavenhändler gegen Tabak vertauscht. Die Danakil geben die Myrrhe auch als Arznei ihren Pferden ein, wenn diese infolge der Hitze an Erschöpfung leiden. In der europäischen Medizin findet sie heutzutage nur noch geringe Anwendung; ihr Ruf aber ist groß und alt; befand sich doch die Myrrhe unter den Geschenken, welche die Weisen aus dem Morgenlande dem Christkinde brachten!
Von dem Gipfel eines Hügels herab hatten die Reisenden endlich den freudigen Anblick des Hawasch, des abessinischen Grenzflusses, dessen Lauf durch einen dichten Baumgürtel bezeichnet wurde. Jenseit desselben ragten kühn die Hochgebirge von Schoa in die Luft, und nach langen Leiden winkte nun das Ziel. Das Schlimmste war überwunden.
Der Hawasch ist der zweitgrößte Strom Abessiniens. Er entspringt im Herzen des Landes in einer Höhe von 8000 Fuß, wird von einer großen Anzahl kleiner Ströme gespeist und fließt gleich einer belebenden Ader grün und längs seiner Ufer bewaldet durch die brennend heißen Adâl-Ebenen, bis er in den Lagunen von Aussa sein Ende findet und versandet. Je näher man dem Strome kam, desto kräftiger wurde die Vegetation. Gummiausschwitzende Akazien, Tamarisken zeigten sich und laut schreiende Perlhühner stoben bei dem Heranziehen der Karawane auseinander; man mußte sich schließlich durch das Dickicht förmlich durchwinden und stand nun, nachdem man so lange durch wilde Einöden gezogen, vor einem großen, mächtig dahinrauschenden Strome, der seine vom Regen getrübten Wasser wild dahinwälzte.
Die Stelle, an welcher die Reisenden den Fluß zu überschreiten hatten, liegt mehr als 2000 Fuß über dem Ozean. Nach Art einer fliegenden Brücke wurden zehn Flöße zusammengefügt und auf diesen die Kameele, das große Gepäck und die zahlreichen Menschen übergesetzt. – Man war nun im Königreich Schoa, doch immer noch im Lande wilder Muhamedaner, da die christliche Bevölkerung erst weiter westlich beginnt.
Weil das Wasser des Stromes dick und schlammig aussah, begab man sich zur Tränke nach einem nahegelegenen Weiher, der von hohen Bäumen umgeben war. Inmitten desselben trieben Nilpferde ihr unheimliches Wesen; eins derselben steckte seinen ungeheuren Kopf aus dem Wasser, sperrte den mächtigen Rachen auf und brüllte, daß man es auf eine halbe Stunde Wegs hören konnte; zum Lohn wurde ihm eine vier Loth schwere Kugel in den Kopf gejagt, deren Einschlagen in den Schädel man deutlich vernahm. Das Thier sank unter, wurde jedoch erst am nächsten Tage aufgefunden und von den benachbarten Nomaden zerstückelt und verzehrt.
Mit leichtem Herzen sagte man den trüben Fluten des Hawasch Lebewohl und zog der Hauptstadt entgegen. Diesseit des Flusses war das einzige vorkommende Schaf das fettschwänzige, wolllose, nur mit Haaren bedeckte Thier gewesen. Statt dessen traten nun die großen, fetten abessinischen Schafe auf. Ziegen mit langen gewundenen Hörnern zeigten sich, von kleinen fuchsartigen [pg 235]Hunden bewacht, in großen Herden. Große Flüge von Heuschrecken, welche das Land kahl gefressen hatten, nahmen ihre Richtung gegen Abessinien zu. Sie verdunkelten förmlich den Himmel und zogen gleich einer finstern Wolke mit großer Schnelligkeit durch die Lüfte hin. In den Wäldern waren Perl- und Rebhühner häufig, zusammen mit der Zwergantilope, und die langentbehrte Jagd brachte in die Küche und die Lebensweise der Europäer einige Abwechselung. Am Abend des zweiten Tages, nachdem der Hawasch überschritten war, kam ein Reiter in das Lager der Gesandtschaft, sah sich überall genau um, sprach dabei kein Wort und verschwand wieder wie er gekommen. Es war ein Spion des Grenzhüters der Provinz Ifat, der seinem Herrn Nachricht über die Fremdlinge bringen sollte. Diese Erscheinung versetzte die begleitenden mißtrauischen Danakil in Aufregung, denn sie argwöhnten sofort, der Herrscher von Schoa werde die Europäer nicht empfangen.
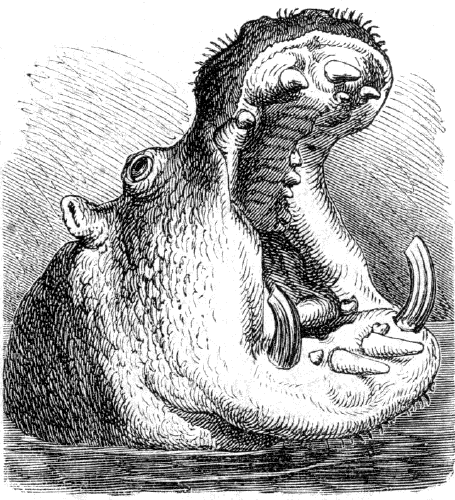
Ungeachtet ihres Abmahnens setzte man den Weg fort. Der Mamrat, „die Mutter der Gnade“, mit seinem kuppelförmigen mächtigen Berghaupte, das weit über die Wolken emporragte, erhob sich gleich einem gigantischen Schlosse aus der Ebene und galt als Ziel, auf das man lossteuerte. Man befand sich jetzt schon 3000 Fuß über dem Meere und stand am Eingange des hauptsächlichsten, nach Südabessinien führenden Passes. Eine erfrischende Brise wehte den Engländern entgegen, der Himmel war mit Wolken bedeckt und das Klima so beschaffen, daß sie sich eher in der Heimat als unter die Tropen versetzt glaubten. Berg über Berg, bedeckt mit herrlicher, üppiger Vegetation erhob sich vor ihnen. Einer thürmte sich unordentlich über dem andern empor; bis schließlich die letzten, mit einem glänzend weißen Schneemantel bedeckten Spitzen sich in den azurblauen Lüften zu verlieren schienen. Dörfer und Weiler schauten aus den grünen Baumgruppen hervor; reiche Saatfelder erglänzten in der Sonne und zeugten von dem Fleiße eines Theils der Bewohner.
Später erfuhr man, daß der Negus angeordnet hatte, eine Ehrenwache von dreihundert Luntengewehrträgern solle die Gäste am westlichen Ufer des Hawasch empfangen, allein der Wulasma Muhamed, d. h. der höchste dem Grenzdistrikte vorstehende muhamedanische Beamte, der sich so gut wie der König selbst dünkte, hatte die Garde zurückgeschickt, da ja die Ehre Ungläubigen erwiesen werden sollte. Auch sonst legte dieser Beamte den Fremdlingen allerlei Schwierigkeiten [pg 236]in den Weg, um sie vom Vordringen abzuhalten, konnte schließlich jedoch bei der Festigkeit, mit welcher man gegen ihn auftrat, nichts erreichen. Zum letzten Male waren die Kameele beladen, um am 16. Juli 1842 in Farri, der Grenzstadt der Provinz Ifat, einzuziehen. Haufen kegelförmig gedeckter Häuser, welche auf zwei Hügeln zerstreut lagen, zwischen denen die Zollgebühren erhoben wurden, waren die ersten permanenten Wohnstätten, welche die Wanderer seit ihrem Abmarsch von der Küste als ein Zeichen des Fortschrittes begrüßten, denn bisher waren sie nur auf Nomadenhütten getroffen. Sowol wegen der nun beginnenden Hochlande, als wegen des kühleren Klimas wird hier das „Schiff der Wüste“, das für die brennendheißen wasserlosen Ebenen geschaffen ist, als Lastthier vollkommen unnütz und muß zurückgelassen werden. Damit lag aber auch die Wüste nun zugleich hinter den Reisenden, und als die Danakil, welche sie bisher begleitet, umgekehrt waren, waren auch die Leiden und Schrecken des durchzogenen Terrains verschwunden. Menschen, Klima, Boden, Thiere, Pflanzen – Alles war anders. Wie wenn ein Zauberer seine Ruthe ausgestreckt und die Landschaft mit einem Schlage verändert hätte, so sah man die Hochlande Abessiniens jetzt, überall nur Kultur bedeckte Flächen statt der brennenden Wüsteneien. Jede fruchtbare Bodenerhebung war mit einem friedlichen Weiler gekrönt, durch jedes Thal strömte rauschend ein krystallheller Bach, schwärmten Herden. Die kühlenden Bergwinde wehten den aromatischen Geruch von Jasminen und wilden Rosen herab, und im schwellenden Rasen blühten Tausendschönchen und Butterblumen. Das Gepäck schleppten jetzt 600 kräftige Muhamedaner, die auf königlichen Befehl von den benachbarten Dörfern gestellt worden waren. Der König, so vernahm man, war vor Ungeduld außer sich, die Gesandtschaft zu empfangen und die schönen Geschenke zu besichtigen, welche sie mitbrachte.
Am Morgen des 17. Juli begann der Marsch in den Hochlanden. Frischer, kühlender Wind wehte von den Bergen herab, die, nur zehn Grade vom Aequator entfernt, dennoch eine Vegetation tragen, welche an nordische Klimate erinnert. Steil führte der steinige Pfad bergan über Schlünde, Thäler und Gipfel, eingefaßt von Farrnkraut, Hagebutten und Geisblatt; am Abhange der Berge zogen sich Terrassen hin, die mit gut bebauten Feldern bedeckt waren, und auf jedem Vorsprung stand ein Dörfchen, dessen Bewohner herbeigestürzt kamen, um die neue Prozession, die Gäste des Königs zu sehen, denen Freudenrufe entgegentönten. Die Frauen waren hier in rothe Baumwollmäntel gehüllt, die einen angenehmen Gegensatz zu den ledernen Schurzfellen der Damen in der Wüste darboten. In der 3000 Fuß über dem Grenzorte Farri oder 5200 Fuß über dem Meeresspiegel gelegenen Marktstadt Alio Amba, die auf einem scharfen Bergrücken sich erhebt, mußte wieder ein längerer Halt gemacht werden. Der Ort besteht aus 250 Häusern mit 1000 muhamedanischen Einwohnern, die sich aus sehr verschiedenen Völkerschaften rekrutirt haben. Der Berg, auf welchem Alio Amba liegt, ist nur einer von den vielen tausend jähen Erhebungen, in welche das ganze Gebirge nach der Seite der Ebene hin zerbrochen ist. Gleich schmalen Silberfäden strömen durch die Schluchten zwischen grünen Gesträuchen [pg 237]und Feldern die Bäche hin, und wo ein Fleckchen dem Pflug einzugreifen erlaubt, da stehen Weizen, Gerste, Mais, Bohnen, Erbsen, Baumwollen- und Oelpflanzen angebaut, ringsum liebliche Weiler, die hoch in die Berge hinaufragen und sich allmälig am Mamrat, „der Mutter der Gnade“, verlieren. Dieser die Gegend beherrschende Pik, der noch in Wolken verborgen war, als unten schon Alles in Sonnenschein lag, ist mit einem dichten Walde von Nutzholz bedeckt und erhebt sich bis gegen 13,000 Fuß über dem Meeresspiegel. Der interessanteste Punkt in dieser Landschaft ist jedoch ein kegelförmiger Berg, der mit dunklen Wachholderbäumen bestanden ist und ganz vereinsamt sich erhebt. Auf ihm steht die Feste Gontscho, die Residenz des Wulasma Muhamed, in welcher die drei jüngern Brüder des christlichen Königs – Opfer eines barbarischen Gesetzes – zeitlebens gefangen gehalten wurden.
Die Gesandten waren gezwungen, in Alio Amba einen längeren Aufenthalt zu nehmen, da der Negus verreist war; doch kam ein sehr liebenswürdiger Brief von demselben an, welcher verhieß, die Fremden bald zu empfangen. Unterdessen hatten die Europäer Zeit, den Ort und sein reges Marktleben kennen zu lernen. An einem bestimmten Tage strömten schon kurz vor Tagesanbruch scharenweise die Landleute in die Stadt, um Honig, Baumwolle, Korn und Lebensmittel der verschiedensten Art zum Verkauf oder Tausch zu bringen. Die Dankali-Kaufleute stellen Perlen, Metalle, gefärbte Garne und Glaswaaren aus. Der wilde Galla kauert neben den Erzeugnissen seiner Herde, während der muhamedanische Händler aus dem Innern Straußenfedern oder andere Artikel bringt, die aus weit entfernten Gegenden stammen. Baumwollen- und Zeugballen, Kaffeesäcke von Kaffa und Enarea liegen überall umher. Zahlreiche Pferde und Maulthiere vermehren das Getümmel der verschiedenen Völkerschaften, die hier durcheinander wogen. Fettig und in ein schmuziges Baumwollengewand gleich einer ägyptischen Mumie eingehüllt schreitet der Bauer aus der Umgegend zu dem Marktbeamten hin und bezahlt sein Marktgeld, das in die königliche Kasse fließt. Hier geht lässig ein Luntengewehrmann von der königlichen Garde umher; doch die Eifersucht des Monarchen verbietet ihm, die primitive Waffe mit sich zu führen und sie wo anders als in der königlichen Gegenwart zu tragen. Der Adal, der Räuber aus den Küstenstrichen, tritt in die niedrige Hütte des Sklavenhändlers aus dem Sudan, um dort die zum Verkaufe ausgebotenen Frauen und Mädchen anzusehen; im rabenschwarzen Haare wogt die weiße Straußenfeder, das Zeichen eines begangenen Mordes, und das Volk staunt das gekrümmte Säbelmesser des Mannes an, der so kühn ist, keine sklavische Verehrung für den großen Monarchen von Schoa zu zeigen. Mit Eiern und Geflügel drängt sich ein Christenweib durch die Menge. Die Häßlichkeit ihres Antlitzes wird durch das Ausreißen der Augenbraunen und das fetttriefende Haar noch gehoben. Die freie, stattliche Miene der Orientalin, wie deren leichtes graziöses Gewand fehlen ihr gänzlich, denn die Natur scheint sie absichtlich vernachlässigt zu haben. Die Männer der abessinischen Grenzprovinzen Argobba und Ifat, Muhamedaner dem Glauben nach, unterscheiden sich durch verschiedene Sprache von [pg 238]den echten Abessiniern, denen sie im Aeußern sonst gleichen, während ihre Frauen wie arabische Zigeunerinnen aussehen; sie sind schöner, schlanker als ihre christlichen Schwestern aus den Berggegenden und weniger fettig. Die Menge stäubt auseinander vor einem christlichen Gouverneur, der, umgeben von zahlreicher Dienerschaft, barfuß durch den dicken Straßenschmuz dahinschreitet. Der dicke Bauch und das silberbeschlagene Schwert zeigen zur Genüge seine Würde an, die durch den weißen, mit karminrothen Streifen eingefaßten Baumwollenmantel überdies kenntlich ist. Die Anordnung seines Haares hat den ganzen Morgen in Anspruch genommen und der üble Geruch der ranzigen Butter, welche aus all den kleinen Löckchen hervorglitzert, verpestet ringsum die Luft. Bis über das Kinn verhüllt, sieht man nur seine Nase und die blutunterlaufenen, von nächtlichen Orgien zeugenden Augen, aus denen er einen verwunderten Blick auf die weißen Ankömmlinge richtet. Im blauen Gewande, mit fliegenden Locken kommt endlich auf ziegendürrem Klepper der wilde Galla zu Markte; er bringt Honig und Butter aus den grasreichen Ebenen seiner Heimat in die wild zerklüfteten Berge.
Der Schrecken und der Abscheu, welchen die Abessinier vor den von Mördern heimgesuchten Küstenstrichen haben, sind die Ursache, daß fast der ganze Handel von Alio Amba in den Händen der Danakil liegt, die vom Könige mit aller möglichen Nachsicht behandelt werden. In jedem Monate langen Karawanen von Aussa und Tadschurra an, die den Handel unterhalten und gute Geschäfte machen – namentlich auch in Menschenfleisch, denn auch hier im Süden des christlichen Reiches blüht der Sklavenhandel so gut wie im Norden, und die Ausfuhr über Tadschurra ist noch bedeutender als jene über Massaua.
Vierzehn Tage lang mußte die Gesandtschaft in Alio Amba zubringen, dann war die Erscheinung des Oberkommandanten der königlichen Leibgarde das erste Zeichen, daß sie weiter vordringen durfte. Die Zusammenkunft mit dem Könige sollte an einem der nächsten Tage stattfinden, wenn die Kusso- oder Bandwurmkur Seiner Majestät vorüber sein würde. Denn da gleich allen Abessiniern auch der König ein Liebhaber von rohem Fleisch war, so litt er infolge dessen stark an Eingeweidewürmern, von denen er sich durch regelmäßig wiederholte Kusso-Kuren zu befreien suchte.
Nachdem das zahlreiche Gepäck auf die Träger vertheilt war, konnte man der Marktstadt den Rücken wenden und die Reise im Hochlande fortsetzen. Die gütige Natur hatte in verschwenderischer Fülle und Mannichfaltigkeit ihre Gaben über das Land zerstreut und dadurch den lässigen Bewohnern die meiste Arbeit abgenommen. Reiche Kornfelder längs des Weges wechselten mit stillen Dörfern, blumigen Kleewiesen und krystallklaren, in Kaskaden herabschießenden Bächen.
Das südliche Abessinien beginnt mit dem Distrikte Ifat am Fuße der ersten Hügelkette, welche allmälig an Fruchtbarkeit und Höhe zunimmt. Heftige Gewitterstürme, welche in der Regenzeit daherbrausen, werden in diesen Gegenden oft zur Landplage; doch selbst unter den mächtigen Wasserfluten lächelt noch [pg 239]das Land, und so entschieden steht es im Gegensatz zu dem klimatischen und allgemeinen Charakter der heißen Zone, daß der entzückte Wanderer sich in seine nördliche Heimat versetzt fühlen kann.
Langsam zogen die Reisenden fürbaß, der königlichen Sommerresidenz Matschal-wans zu, wo der Herrscher sie empfangen wollte. An einer Stelle, wo der Weg eine Biegung machte, schoß die begleitende Garde plötzlich ihre Luntenflinten ab, deren Donner ein freudiges Echo in den Zurufen der erwartungsvoll zusammengeeilten, unten im Thale stehenden Menge fand. Als der Pulverdampf sich verzog, fiel der Blick der Reisenden auf die lieblich gelegene königliche Residenz, deren kegelförmige weiße Dächer ihnen aus dunklen Cypressen und Wachholderbäumen entgegenleuchteten.

Durch grüne, blumenbedeckte Auen rauschte ein angeschwollener Strom, während die majestätischen Bergriesen mit nebelumhüllten Gipfeln den Hintergrund des prächtigen Bildes ausmachten. Vereinzelte Bauernhäuser waren über die grüne Landschaft zerstreut, reiche Felder glänzten im reifen Korn und donnernd, kleine Wasserfälle bildend, stürzten die geschwollenen Wildbäche von den Felsen herab. Nach Verlauf einer Stunde war Matschal-wans erreicht, wo eine zahlreiche Menschenmenge die Gäste erwartete. Wild und ungestüm drängten sie sich heran, Alles war ihnen neu, und gleich Menageriethieren starrten sie die weißen Leute an, die weit über das Meer hergekommen waren, um dem großen Könige von Schoa Geschenke darzubringen. Nachdem noch einige Förmlichkeiten erledigt waren, konnte die Vorstellung stattfinden.
[pg 240]Endlich stand die britische Gesandtschaft auf der Schwelle des königlichen Palastes und vor ihr öffnete sich die Empfangshalle. Rund in der Form und ohne den gewöhnlichen abessinischen Pfeiler in der Mitte erhoben sich die hohen, massiven Lehmwände des Gemaches, überdeckt mit Silberzierathen, Doppelgewehren, runden Schilden und Luntenflinten. Persische Teppiche von den verschiedensten Größen, Farben und Mustern deckten die Flur und Scharen von Höflingen, Beamten und hohen Würdenträgern standen, bis zum Gürtel entblößt, in respektvoller Haltung und Feiertagskleidung ringsumher. In der Wand waren zwei Nischen angebracht: in der einen loderte ein Feuer, während in der andern auf einer geblümten Atlasottomane, umgeben von alten Eunuchen und jugendlichen Pagen, gestützt auf hellfarbige Sammetpolster, Seine christlich-äthiopische Majestät Sahela Selassié hingelagert war. Der Thürhüter (zugleich Zeremonienmeister) stand mit einem Büschel Binsen in der Hand vor dem Könige, um damit die genaue Entfernung anzudeuten, bis zu welcher man sich der Majestät nahen durfte. Die Gesandtschaft trat ein, machte ihre Verbeugungen vor dem Throne und ließ sich auf eben hereingebrachten Stühlen nieder.
Der König war mit einer grünseidenen arabischen Brokatweste bekleidet, die zum Theil von einem weiten, faltigen abessinischen Baumwollmantel mit karminrothen Streifen bedeckt war. Vierzig Jahre, von denen achtundzwanzig unter den Sorgen der Regierung verlebt waren, hatten seine dunkle Stirn leicht gefurcht und das in hohe Löckchen frisirte reiche Haar etwas ergrauen gemacht. Obgleich durch den Verlust des einen Auges etwas entstellt, war der Ausdruck seiner männlichen Gesichtszüge doch offen, angenehm und gebietend; aus dem ganzen Gesichte leuchtete jedoch jene weit und breit anerkannte Unparteilichkeit des Herrschers hervor, die ihm selbst unter den Danakil den Beinamen der „feinen Goldwage“ eingebracht hatte.
Der Gesandte überreichte nun, in Goldbrokat und Musselin eingewickelt, sein Beglaubigungsschreiben, worauf, nachdem dieses gelesen und anerkannt war, die reichen Geschenke der britischen Regierung eines nach dem anderen hereingetragen und vor dem Könige und den erstaunten Blicken der Höflinge ausgebreitet wurden. Der schöne Brüsseler Teppich, der die ganze Empfangshalle deckte, die Kaschmirschals und buntfarbigen gestickten indischen Schärpen erregten allgemeine Bewunderung und wurden von den Eunuchen dem König zur näheren Beschauung in den Alkoven gereicht. Allgemeine Heiterkeit entstand bei der Produzirung einer Gruppe tanzender chinesischer Figuren, und als dann die europäische Eskorte in voller Uniform mit einem Sergeanten an der Spitze in der Halle aufmarschirte, sich vor den Thron stellte, dort ihre Handgriffe machte und die Musikdosen „God save the Queen“ spielten, erreichte die Freude und das Erstaunen des Königs ihren Höhepunkt und er erklärte, nicht Worte finden zu können, um seine Dankbarkeit auszudrücken. Hell leuchtete dann sein Gesicht, als ihm dreihundert mit blitzenden Bajonneten versehene Flinten überreicht wurden. Vor Verwunderung überfließend sagte er nur: „Euch wird Gott belohnen – ich kann es nicht.“
[pg 241]Noch waren die Ueberraschungen jedoch nicht zu Ende. Auf einem freien Platze am Fuße eines Hügels wurde eine große Scheibe aufgestellt und nach dieser eine der mitgebrachten kleinen Kanonen gerichtet. Das grüne Thal hallte von dem ungewohnten Artillerie-Kommandorufe wieder, und als nun der Donner erschallte, als Vollkugeln und Kartätschen die Scheibe und die Felsen zersplitterten, da brach lauter Jubelruf aus dem Munde des Königs und tosendes Geschrei aus der Brust der gaffenden Menge hervor.
Schöne Komplimente von Seiten des Königs, Beglückwünschungen durch die Höflinge und Beamten beschlossen an diesem Abend das ungewohnte Schauspiel. Eine riesige, starkgepfefferte Fleischpastete, begleitet von dem Wunsche, daß „des Königs Kinder es sich wohl sein lassen möchten“, war der nächste Dank. Unerhört große Ehre geschah der Gesandtschaft jedoch durch einen Besuch des königlichen Beichtvaters, eines Zwerges, so klein, daß er ohne Schwierigkeit in der Pastete sich hätte verbergen können. In faltige Gewandung und einen Turban eingehüllt, mit dem silbernen Kreuze geschmückt, ließ sich der zwerghafte Priester, dessen ganzes Leben darin bestanden, seinen Nächsten Gutes zu erweisen, in einem Sessel nieder und hob an folgendermaßen zu reden: „Vierzig Jahre sind verflossen, daß Asfa Wusen, der Großvater unsres geliebten Monarchen – sein Andenken ruhe in Frieden – in einem Traume sah, wie rothe Männer aus Ländern von jenseit der See gar merkwürdige und schöne Dinge in dieses Königreich brachten. Die Astrologen, denen man befahl, diesen Traum zu deuten, erklärten einstimmig, daß Fremdlinge aus dem Lande Aegypten während der erhabenen Regierung Seiner Majestät nach Abessinien kommen würden und daß noch mächtigere Fremdlinge zur Zeit der Regierung seines Enkels folgen würden. Gott sei Preis und Dank, die Traumdeutung ist in Erfüllung gegangen. Meine alten Augen haben nie solche Wunder als am heutigen Tage geschaut, und während Schoa von sieben Königen regiert wurde, sind niemals solche Mirakel in das Land gebracht worden.“
Der König verbrachte den größten Theil der folgenden Nacht inmitten seiner Schätze, die so unerwartet sich vor ihm aufgehäuft hatten. Jeder neue Gegenstand wurde mit der Wißbegierde eines Kindes untersucht und die königlichen Schreiber hatten vollauf damit zu thun, auf Pergament ein Verzeichniß all der schönen Dinge aufzunehmen, das dann im Staatsarchiv aufbewahrt wurde. Die Gewehre, Munition und Kanonen wurden in das große Arsenal geschafft, die Teppiche und Kuriositäten mit Inschriften versehen, auf denen für künftige Geschlechter verzeichnet stand, daß diese Schätze ein Geschenk rother Männer seien, die man „Gyptzis“ nannte und die „von ferne“ gekommen seien. Am frühen Morgen erschien ein Hofpage, um nachzufragen, wie die Gäste geruht hätten. Die Etikette erforderte zu sagen, daß sie sehr gut geruht hätten; allein leider war das Gegentheil der Fall, denn der Regen war in Strömen durch das Zeltdach gedrungen und hatte die Schläfer arg belästigt. Noch schlimmer hatten die 600 requirirten Lastträger geruht. Ohne Nahrung und Obdach war der nasse, durchweichte Boden ihre Lagerstätte gewesen. Als der Morgen graute, schrieen [pg 242]sie laut nach Speise und sofort wurden ihnen einige Ochsen überliefert. In wenigen Minuten waren die Thiere geschlachtet und abgeledert; die Messer der wilden Menge wühlten in dem blutigen Fleische, das Streifen auf Streifen verschwand, um nach echt abessinischer Art roh verschlungen zu werden. Selbst die Eingeweide wurden nicht vergessen, und in einer Viertelstunde war außer Hörnern, Hufen und Knochen von den Ochsen nichts mehr übrig, sodaß selbst die Geier nicht einmal mehr einen Bissen fanden.
Hierauf brach die Gesandtschaft auf, um nach der nahen Hauptstadt Ankober zu reisen. Zuvor jedoch fand noch eine Audienz beim Könige statt. „Meine Kinder“, sagte Seine Majestät, „alle meine Flintenträger sollen euch begleiten, damit ihr in Sicherheit von dannen zieht. Was euer Herz nur wünschen mag, sollt ihr erhalten; mich ausgenommen habt ihr keinen Freund in diesem weiten Lande und ihr seid meinetwegen weit gereist. Doch will ich euch geben, soviel ich kann. Aber auf mein Volk hört nicht, denn das ist schlecht.“
Froh verließ man das feuchte Lager und zog, von den Soldaten begleitet, durch lachende Kulturlandschaften dem nur anderthalb Stunden entfernten Ankober zu. Auf die Felder und Wiesen folgte ein Wald von alten Bäumen, voller Wachholder, die schon Jahrhunderte gesehen und deren düstere, cedernartige Kronen mystisch im Winde rauschten. Wie in Europa, so verstanden es auch die Abessinier, die schönsten Plätze zur Anlage von Klöstern auszuwählen, und so traf man denn auch hier auf ein dem heiligen Tekla Haimanot (13. Jahrh.) gewidmetes Kloster. Dreimal im Jahre, an seinem Geburts-, Sterbe- und Himmelfahrtstage werden hier große Festlichkeiten unterhalten.
Nachdem der Wald durchschritten war, erblickte man, auf einem grünen Hügel erbaut, die 8200 Fuß über dem Meere gelegene Hauptstadt Schoa’s. Unregelmäßig, bald groß, bald klein, wie Heuschober oder wie Scheunen gestaltet, von grünen Einfassungen oder Staketen umgeben, zogen sich die Häuser auf dem Scheitel oder am Abhange und in den Spalten des Hügels hin. Diese Wohnungen beherbergten nach Harris’ Schätzung 12,000–15,000 Menschen. Auf dem höchsten, abgesonderten Theile des Hügels liegt der unschöne, mit vielen thönernen Schornsteinen versehene und von Palissaden umgebene Palast des Königs. An ihn schließen sich zahlreiche Hütten für die Sklaven, Küchen, Keller, Vorrathshäuser und Kornmagazine. Bäume, Büsche und zerklüftete Felspartien bildeten den Hintergrund, aus dem unter Wachholderbäumen das Bronzekreuz der Kirche „Unsrer lieben Frau“ hervorleuchtete.
Anko war eine Königin des Gallavolkes, welche diese Berggegenden nach dem Einfall Granje’s bevölkerte und ihren Namen dem engen gewundenen Pfade hinterließ, welcher das „Ber“ oder Thor zu den Vorstädten bildet. Daher bedeutet Ankober „Thor der Anko“. Am Abgrunde hinziehend und kaum breit genug für den Fuß des Maulthiers, kann man diesen Paß nur mit dem Gefühle der Unsicherheit passiren, und wenige Stunden würden genügen, um ihn zu verrammeln und die Stadt für jeden Feind unzugängig zu machen. Laute Jubelrufe des versammelten Volkes begrüßten die Gäste, denen nun ein [pg 243]sehr elendes Haus, das eher einem Heuschober als einer Wohnung für Europäer glich, als Aufenthaltsort angewiesen wurde. Der Fußboden war so, wie ihn Mutter Natur geschaffen und vom Regen durchweicht, und es bedurfte erst vieler Arbeit, um die Hütte, über der man stolz die Flagge Großbritanniens aufzog, bewohnbar zu machen. Als man die Thüre mit einem Teppich verhangen hatte und die Nacht hereinbrach, regierte Finsterniß in dem Raume: die Lichter waren unterwegs zerschmolzen und so bildeten denn die sparsam aus den königlichen Vorräthen dargereichten, mit Wachs getränkten Dochte das einzige Beleuchtungsmaterial der Gäste. Und diese elenden Kerzen waren ein Handelsmonopol des Fürsten, gleich so vielen anderen guten Dingen. Um den Aufenthalt recht ungemüthlich zu machen, stürzten Tausende von blutdürstigen Flöhen über die Reisenden, die jetzt, nachdem sie die Schönheit der Natur bewundert und vom Könige freundlich empfangen worden waren, auch die Schattenseiten des Lebens in Schoa kennen lernen sollten.
In der Nacht brach unter Donner, Blitz und strömendem Regen ein gewaltiger Sturm über Ankober los, der die Erde mit einer wahren Sündflut überschüttete; jeder Fluß stieg, jede Gasse wurde zu einem rauschenden Bache und tausendfältig hallte der Donner von den nahen Bergen wieder. Als am nächsten Morgen die Sonne ihre Strahlen auf die Erde niedersandte, entwickelte sich ein seltsames Schauspiel vor den Augen der Europäer. Tief unten lag, wie ein Schneeschleier, eine undurchdringliche Dampfwolke in den Thälern. Man stand über diesen Wasserdämpfen, aus denen nur die Bergspitzen gleich schwimmenden Inseln hervorragten. Als diese Nebelbank in die Höhe stieg, bedeckte sie Alles mit Feuchtigkeit und drang durch Kleider und Mauern hindurch.
Abgesehen von den Unannehmlichkeiten, denen jeder sich aussetzen muß, der in afrikanischen Landen reist, trafen die Gesandtschaft noch manche speziell abessinische Uebelstände. Die nothwendigsten Lebensmittel waren trotz der Fruchtbarkeit des Bodens nur schwierig zu erlangen; die gemietheten Dienstboten taugten nichts, da jeder, der nur irgend kann, sich Sklaven hält; Maulthiere waren gleichfalls kaum gegen die höchsten Preise zu miethen, und für das kleinste Geschäft mußte eine Menge kostbarer Zeit vergeudet werden, da diese selbst für die Abessinier keinerlei Werth hat. Mit der Zeit wurde den aus Indien mitgebrachten muhamedanischen Dienern der Aufenthalt zu langweilig; sie nahmen ihre Entlassung und kehrten durch das heiße Küstenland nach Tadschurra zurück, wobei die Hälfte von ihnen das Leben verlor. Die statt ihrer angenommenen Abessinier zeichneten sich nur dadurch aus, daß sie unermeßliche Portionen rohen Fleisches (Brundo) verschlangen und alle Monate einen Tag frei verlangten, um mittels Kusso ihre Bandwurmkuren vollführen zu können. Außerdem war ein besonderer Afero oder Janitschar ernannt worden, welcher alle Schritte und Tritte der Fremden ausspioniren und darüber an den Hof berichten mußte. Am gefährlichsten wurde den Gästen jedoch die Feindschaft der unduldsamen Geistlichkeit, die mit eiserner Hand das Volk knechtete und die Briten schlimmer als die Heiden ansah, zumal weil sie die langen und strengen Fasten nicht hielten. [pg 244]Der Bischof von Schoa zeigte diese Feindschaft ganz offen. Er sprengte das Gerücht aus, die Engländer seien als Spione einer großen, jenseit des Meeres wohnenden Frau gekommen, welche ihre Soldaten nach Schoa schicken wolle, um das Königreich zu erobern und den abessinischen Glauben zu zerstören.
Während alle Klassen des Volks in Erinnerung an die Himmelfahrt der Jungfrau Maria die strengen Fasten hielten, blieb inzwischen der König in seiner Residenz Matschal-wans. Dort verzehrte er rohe Fische, die mit Pflanzenöl und Pfeffer zubereitet waren, als Fastenspeise. Der Palast in Ankober dagegen wurde von ihm zur Regenzeit gemieden, weil wegen dessen hoher isolirter Lage die Blitze dort leicht einschlagen. Kamen die Engländer mit Sr. Majestät zusammen, so pflegte er zu sagen: „Es giebt in meinem Lande sehr schöne Dinge, welche in dem eurigen nicht sind, und wieder umgekehrt habt ihr Dinge, welche wir nicht besitzen.“ Fortwährend waren die Fremden mit allerlei Aufträgen des Königs beschäftigt: bald mußten sie Luntenflinten repariren, Spieldosen ausbessern, bald Kleidungsstücke oder Staatsregenschirme wieder herstellen, und das Alles wurde zur Zufriedenheit des Hofes ausgeführt. Auch als der König einmal unwohl war, wurden die Gesandten zu ihm berufen; er erhielt Medizin, doch mußte diese zuvor in seiner Gegenwart gekostet werden, da er in beständiger Angst vor Vergiftung schwebte. Obgleich er sich niemals ohne Waffen zeigte und stets solche unter seinen Kleidern verborgen trug, fürchtete er sich doch keineswegs vor seinen Gästen, die selbst mit geladenen Flinten in seiner Nähe stehen durften, auch wenn keine Diener bei ihm waren; bei diesen Zusammenkünften ließ er Porträts zeichnen, Pläne zu Bauten entwerfen und Vorbereitungen zu Affenjagden machen. Magazine wurden mit Granatschüssen in die Luft gesprengt, siebenläufige Pistolen zuerst bei Hofe eingeführt und ihm ein großer Respekt vor den Windbüchsen eingeflößt, deren Wirkung er für das Merkwürdigste erklärte, was er all sein Lebtag gesehen hatte.
Wieder einmal waren die Engländer zum König beschieden, der mit ihnen über einen Feldzug gegen die wilden Galla sprechen wollte. Schmiede und Silberarbeiter saßen unter der Veranda der Residenz, Künstler malten Miniaturen in die auf Pergament geschriebenen Psalmen, Sättel und allerlei Kriegsgeräth wurden unter den Augen des Fürsten reparirt, Speere und Flinten gereinigt – doch alle diese Handwerker wurden vom Könige schleunig entlassen, um mit Harris einen Kriegsplan verabreden zu können, der schließlich nicht ausgeführt wurde. So schlich der traurige Winter hin. Unterdessen begannen die Händler, welche sich durch die Ankunft der Engländer beeinträchtigt glaubten, gegen diese zu konspiriren. Allerlei abenteuerliche Gerüchte gingen um. Die Gyptzis, so hieß es, verzehrten Schlangen, Mäuse, Spinnen und ähnliche Thiere, und wären im Begriff, durch magische Mittel das Land zu erobern. Die astronomischen Instrumente erregten gleichfalls Argwohn; doch der König hörte nicht auf diese Verdächtigungen, ja er drohte, den Verleumdern die Zungen ausreißen zu lassen, und kümmerte sich auch nicht darum, als die Geistlichkeit ihn mit dem Banne bedrohte. Die Zauberer Schoa’s glaubten dem gegenüber im vollsten [pg 245]Rechte zu sein, wenn sie verkündigten, Sahela Selassié würde wegen seiner Freundschaft gegen die Fremden noch Thron und Leben verlieren.
Als der Winter vorüber war, brach der König nach Debra Berhan auf, einer Sommerresidenz, die jenseit der Bergkette im Westen liegt. Dorthin folgte ihm auch die Gesandtschaft nach. Es war eine herrliche Gegend, die man wieder durchzog, voller Sturzbäche, Klippen und schöner Bäume. An einem Flüßchen traf man das einzige Maschinenwerk des Königreichs – eine rohe Wassermühle, die ein durchreisender Albanese erbaut hatte; doch die Priester erklärten dieselbe für ein Werk des Teufels, und nachdem die Mühle drei Tage gegangen, wurde der Betrieb untersagt. So verfiel denn die Teufelsmühle. (Vergl. S. 157.) Hinter derselben wurde der Weg rauher und steiler; man gelangte auf den Kamm der Tschakaberge, welche die Zuflüsse des Nil von jenen des Hawasch, das Stromgebiet des Mittelmeers und des Indischen Ozeans trennen. Noch volle drei- bis viertausend Fuß ragte der hohe Mamrat über diese Wasserscheide empor; doch Schnee lag auf seinem 13,000 Fuß hohen Gipfel nicht, wie denn ein Wort für denselben südlich von den kalten Bergen Semiéns in der Sprache der Eingeborenen fehlt. Wie verschieden ist doch das Schicksal der Gewässer, die von dieser Bergkette nach Osten und nach Westen zu eilen! Der Regentropfen, welcher auf die nach Ankober zu gelegene Seite fällt, wendet sich nach kurzem Laufe dem Hawasch zu, um mit ihm durch die durstige Adalwüste der Aussalagune zuzurinnen. Ganz anders dagegen gestaltet sich die Pilgerschaft der Gewässer im Westen. Dort finden viele kleine Bäche ihren Weg zur Dschumma, die sich in den Abai, den Blauen Nil, ergießt, der, durch den Goldsand von Fazogl ziehend, bei Chartum sich mit dem Weißen Flusse vereinigt, bei Meroë, Theben und den stattlichen Pyramiden vorüberfließt und seinen Beitrag zur Bewässerung Aegyptens oder der blauen Fluten des Mittelmeers liefert!
Wiesen, auf denen Vieh weidete, kleine Ströme, über deren einen eine rohe Steinbrücke, das hochgepriesene Werk eines Armeniers führte, folgten nun; dann kam man in eine unwirthliche Gegend, eine Hochebene, die einst von Galla bewohnt war. Nicht ein Baum oder Strauch, selten als Ausnahme ein Kusso, war zu erblicken; doch sind spärliche christliche Ansiedelungen hier entstanden, die von Hirten bewohnt werden. Dann ging es bergab, die Gegend wurde wieder etwas freundlicher, und zwischen einigen grünen Bäumen leuchteten die weißen Gebäude von Debra Berhan hervor. „Willkommen meine Kinder, wie geht’s euch? Habt ihr eine sichere Reise gehabt?“ so lautete der Empfangsgruß, und am Abend erquickte Brot, Honigwasser und saures Bier die Gäste. Beim Schein der Lichter fand Abends Gesang und Tanz statt, und mancher hohe Beamte legte sich berauscht zur Nachtruhe nieder.
Keine andere fürstliche Residenz kann in jämmerlicherem Zustande sich befinden als Debra Berhan, „der Hügel des Ruhms“. Es besteht aus elenden Gebäuden, deren ohne Mörtel zusammengefügte Mauern einzustürzen drohen. Palissaden umgeben das Ganze und schließen den mit Rasen überzogenen Audienzraum ein, der jedoch auch zugleich einigem Vieh zum Aufenthalt dient. Hier hat [pg 246]der König eins seiner bedeutendsten Sklavendepots, in welchem dem Besucher ein wahres Babel von verschiedenen Sprachen entgegenklingt; auch die Gesichtszüge deuten auf verschiedene Rassen, und nur die abessinische Kleidung ist allen gemeinsam. Da geht der riesige heidnische Neger mit aufgeworfenen Lippen und blutunterlaufenen Augen gleich einem schwarzen Herkules umher. Stark wie drei Gäule, trägt er eine ungeheure Holzlast, welche zwei Abessinier nur mit Mühe bewältigen könnten. Fünfzehn Maria-Theresia-Thaler hat der König für dies ausgezeichnete Exemplar gezahlt, das fern vom Nil hierher verhandelt wurde. Er hat hier ein ganz gemächliches Leben, vollauf zu essen und dient als Holzhauer im Walde; in seine Lage hat er sich stumpfsinnig gefunden. Anders der feurige Galla, der ihm folgt und in dessen Gemüth noch nicht der Geist der Unabhängigkeit erloschen ist. Seine schlanke Figur und gekrümmten Beine verrathen den wilden Reiter der grasigen Ebene. Schwermüthig, mit gebeugtem Sinn, schleppt er seine Bürde und denkt an die Savannen am Hawasch, seine Heimat. Unter der Aufsicht eines alten Eunuchen nimmt eine Schar brauner Sklavinnen ihren Weg zum Flusse. Sie tragen schwere irdene Wasserkrüge auf dem Rücken und singen leise ein trauriges Lied, das wol von der Heimat erzählt, von Guragué. Es sind Christinnen, alles schöne, schlanke Mädchen, weit schöner als ihre Tyrannen, das rabenschwarze Haar ist mit gelben Blumen geschmückt und in den langen Augenwimpern hängt eine Thräne der Wehmuth. – Hinter ihnen folgen einige bevorzugte Damen, in Staatsgewändern mit rothem Rande – sie haben längst das Andenken an ihr Land und ihre Verwandtschaft vergessen. Das sind die königlichen Braugesellen; silberne Knöpfe in den Ohren, zu ungeheurem Umfang auffrisirte Haare zeichnen sie aus; sie können plappern und schwatzen soviel sie wollen, aber über einen gewissen Raum dürfen sie nicht hinaus, das verbietet ihnen der begleitende Eunuch. Der eine traurig, der andere froh – so leben die Menschen im Sklavenraume des Königs. –
Ein Monat war in dem kühlen, aber angenehmen Klima zu Debra Berhan verflossen, als der König beschloß, seine jährliche Truppenmusterung abzuhalten, und zwar am Maskalfeste, dessen Bedeutung wir schon kennen lernten. (Siehe S. 124.) Viehherden, vor Kälte sich schüttelnde Kameele, die in das ihnen ungewohnte Bergland versetzt waren, lange Sklavenzüge waren zusammengetrieben worden, um theils zur Nahrung, theils zur Bedienung verwendet zu werden. Am Vorabend rückten mit Fackeln in den Händen die königlichen Garden vor das Zelt Sr. Majestät, um dort zu Ehren der Gesandtschaft einen Kriegstanz aufzuführen. Prächtig nahmen sich die mit reichem silberbeschlagenen Reitzeug versehenen Rosse der Offiziere unter den dunklen wilden Kriegern aus, die den amharischen Kriegsgesang anstimmten und sich dann zur Ruhe begaben. Sehr unköniglich war das Aussehen des Palastes beim Tagesanbruch und höchst unfürstlich die bei Hofe herrschende Verwirrung. Unsauberkeit und knöcheltiefer Schmuz herrschte ringsum; der Thürhüter zerschlug einen Stock nach dem andern auf den Köpfen des herbeidrängenden heftigen Volkes, das nicht einmal still wurde, als Seine Majestät sich in der Thür des Banketsaales niederließ. [pg 248]Vor dem Throne verrichtete ein Schmied seine Arbeit weiter, ohne darauf zu achten, daß ein Hagel von Staub und Kohlenasche auf den König niederfiel. Zwanzig bleiche Eunuchen, die als Zeremonienmeister wirkten, führten die Scharen der Vasallen, der Priester, Mönche, Weiber, Sklaven und Ackerbauer zum Fürsten, der von jedem ein Geschenk empfing, sodaß Honig, Butter, Perlen u. s. w. bald in großer Menge aufgestapelt waren. Die Scenen der Unordnung wichen der höher steigenden Sonne und vor dem Erscheinen der britischen Gesandtschaft, die in voller Uniform vor dem Könige aufzog, der in Staatskleidung, von den Generalen der Reiterei, der Leibgarde und der höheren Geistlichkeit umgeben, auf einem beweglichen Thronsessel dasaß. Zunächst rückten nun dreihundert Mann auf den Schauplatz, die hoch über ihrem Haupte Bündel abgeschälter und mit Binsen zusammengebundener Ruthen trugen. Sie begrüßten die Rückkehr der Blütenzeit, „wenn die Flöhe wiederkommen und die Fliegen erscheinen“, mit Gesang, der lauter und lauter zum Kriegsrufe anschwoll. Die Bündel wurden dann auf einen Haufen vor dem Throne niedergelegt, während die in Thierfelle gekleideten Führer dieser Truppe einen Kriegstanz begannen, ihre Leute zum Gefecht aufforderten und mit einem schrecklichen Geheul diese Exerzitien schlossen.
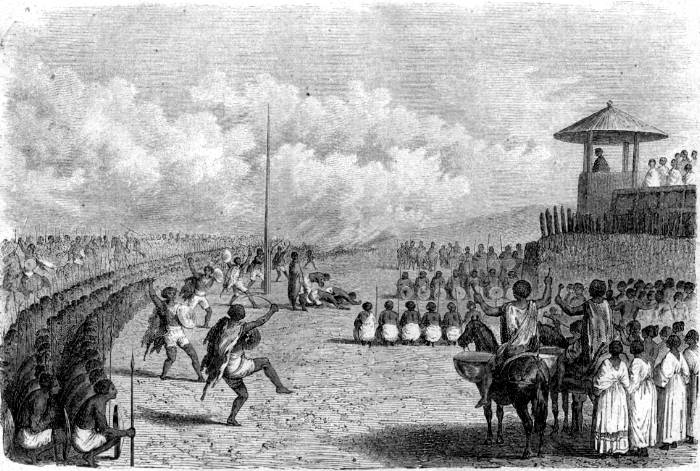
Hierauf wurden die englischen Gäste zu einem mit bunten Teppichen ausgekleideten Pavillon geführt, von dem aus der König mit seinen Würdenträgern der Revue beiwohnen wollte. Im Hintergrunde standen dichte Reitermassen, während in einer Entfernung von etwa 100 Schritten ein großer Scheiterhaufen blattloser Weidenruthen auf dem grünen Rasen aufgestapelt lag. Um denselben hockten unter ihren Schilden, gleich Schildkröten unter ihrer Schale, lange Reihen Krieger; je drei hatten große Feldschlangen von ungewöhnlichen Dimensionen mit Zündkraut und Lunte zu bedienen. Nun begann die Revue mit dem Aufmarsch der Leibgarde zu Fuß, von der drei Viertel mit den geschenkten englischen Musketen bewaffnet war. In vier Compagnien marschirte sie unter dem Gebrüll des Kriegsgesanges auf, nicht wenig stolz auf die blitzenden, bisher in Abessinien unbekannten Bajonette. Nachdem sie das Feld durchmessen, kauerten die Krieger auf dem Grunde nieder, als wären sie in Bereitschaft, anrückende Reiterei zu empfangen, während ein grauköpfiger Veteran tanzend vor der Front ein Geheul zum Besten gab, das aus einer Wolfsschlucht zu stammen schien und mit einer Salve beantwortet wurde.
Nachdem diese Truppe abgetreten war, rückte die glänzende Schwadron der berittenen Lanzenträger, die Blüte der schoanischen Kavallerie, heran. Kühn sprengte an der Spitze, auf schönem Roß, mit einem rothen Fell über der Schulter, der Führer und hinter ihm, in einer Linie von fast einer Viertelstunde Breite, die Schwadron. Nachdem er eine Anrede gehalten, sprengten die stattlichen Reiter im Galopp vorüber nach dem Scheiterhaufen zu, wo die großen Kesselpauken ertönten und die Feldschlangen losgebrannt wurden. Jetzt aber wandte sich das Erstaunen der Versammlung den Engländern zu, deren Artilleristen den bronzenen Dreipfünder, welcher von Ochsen hierhergeschleppt worden war, bedienten. Als der Donner desselben erschallte und weiße Rauchwolken in die Luft [pg 249]stiegen, wie man sie bisher nur von brennenden Dörfern gesehen – da kannte die Verwunderung der wilden, hier versammelten Galla keine Grenzen. Dreizehn in Löwen- oder Leopardenfelle gekleidete Gouverneure führten nach und nach ihre Truppen vor. Dann war die Revue beendigt und die ausgehungerten Offiziere, Edlen, Höflinge und Geistlichen begannen mit wahrer Wuth über das rohe Ochsenfleisch herzufallen und es in unglaublichen Mengen zu vertilgen.
Acht- bis zehntausend Reiter waren versammelt gewesen, und das Schauspiel, das von Morgens 9 Uhr bis Nachmittags 5 Uhr währte, hinterließ einen wilden und ungewöhnlichen Eindruck. Die Bewaffnung und das Reiten der Leute war vorzüglich und unter guter Führung von ihnen Tüchtiges zu erwarten. Als dann die Nacht herniedersank, da wurde dem Könige wie dem Volke von Seiten der Engländer noch ein Schauspiel geboten, von dem jene sich nichts träumen ließen. Prächtige Raketen stiegen zum tiefschwarzen Himmel empor und zerplatzten, Leuchtkugeln entsendend, mit herrlichem Lichte. Menschen und Thiere, Alles wurde rebellisch, und die Achtung vor den Gästen, welche Kometen an den Himmel zaubern konnten, wuchs mehr und mehr. Schließlich wurde der Scheiterhaufen aus Weidenruthen angezündet, und die Fackelträger führten zu Ehren der Auffindung des heiligen Kreuzes einen Tanz auf.
Angollala, an der Gallagrenze, wurde etwa im Jahre 1830 gegründet und vom Könige zur Hauptstadt des westlichen Theils von Schoa erhoben. Hierhin begab man sich, nachdem das Maskalfest vorbei war, und 3000 Reiter bildeten das Geleit des Negus, der auf einem reich gezäumten Maulthiere ritt. Vier- bis fünfhundert runde Hütten mit rohen Steinmauern und Strohdächern bedecken die Abhänge einer Anzahl flacher Hügel, die ein großes Viereck einfassen. Auf der Spitze des höchsten Hügels steht der von sechs Reihen Palissaden beschützte königliche Palast, aus dessen Mitte ein zweistöckiges, finstres Gebäude hervorragt, das ein Albanese erbaute und welches trotz seiner Mangelhaftigkeit in Bezug auf Architektur alle übrigen Gebäude Schoa’s überragt. Doch hat es von Erdbeben gelitten, und „Erdbeben“, so meinte Se. Majestät, „sind ein übles Ding, denn sie werfen Häuser und Menschen um“.
Vor dem Palaste, zu welchem ein steiler Weg hinaufführte, begrüßte eine dichtgedrängte Menschenmenge den König und seine Gäste mit lautem Jubelgeschrei. Küchen, Vorrathshäuser und Brauereien lagen rings um das Gebäude, das mit dem langen Banketsaale, der Audienzhalle, den Frauengemächern und einzelnen Zellen ein merkwürdiges, aber keineswegs imponirendes Ganze ausmachte. Der Despot führte seine Gäste in den ersten Stock, zu welchem man auf einer Leiter gelangte. Auf dem Fußboden, der mit frischem Gras bestreut war, brannte in einem eisernen Ofen ein Feuer, an welchem sich behaglich mehrere Katzen wärmten, die in keinem königlichen Palaste fehlen. Im Alkoven befand sich ein schmuziges Lager, und wenige Flinten machten den einzigen Schmuck der kahlen, weißgetünchten Wände aus. „Ich habe euch“, hub der König an, „hier[pg 250]hergeführt, um euch zu zeigen, was mir fehlt. Diese Gemächer müssen ausgeschmückt werden, und ich wünsche, daß euer Maler (Herr Bernatz) sie mit Elephanten, Soldaten und sonderbaren Darstellungen aus eurem Lande verziere. Jetzt können meine Kinder sich entfernen.“
Die Nächte, welche die Gesandten hier verbrachten, waren keineswegs angenehm; sie froren ungemein und wußten sich kaum vor der Kälte zu schützen; in der Frühe hatte regelmäßig weißer Reif die Wiesen überzogen. Auch am Tage bot sich ihren Augen gerade kein liebliches Bild. Rings um den Palast lag Schmuz, Asche und Kehricht knöcheltief oder in großen Haufen. Halbwilde Hunde fallen am Tage die Menschen an und lassen in der Nacht wegen ihres grauenhaften Gebells Niemand schlafen. Kurz vor Sonnenaufgang weckt das Gekräh von tausend Hähnen die dennoch etwa sich im Schlummer Wiegenden, und wer trotzdem noch nicht erwacht sein sollte, wird durch das Gebrüll des um alle möglichen Dinge petitionirenden Volkes aufgestört, welches unter dem Rufe „Abiet! Abiet! Meister! Meister!“ mit dem Frühgrauen sich zum Palaste drängt. Lernten Harris und seine Gefährten auch in Angollala manches Interessante kennen, so war der Aufenthalt daselbst doch keineswegs angenehm zu nennen.
In der Umgebung Angollala’s befindet sich das Naturwunder Schoa’s, die Schlucht der Tschatscha, zu welcher der König eines Tags seine Gäste hinführte, doch war der Monarch an diesem Tage gerade schlechter Laune, da sein Lieblingsroß, das er in der Schlacht einem mächtigen Galla-Häuptling abgenommen hatte und das seinen Stall in der königlichen Bettkammer hatte, durch die Unvorsichtigkeit eines Pagen umgekommen war. „Was denkt ihr von meinem Galla-Graben? Habt ihr etwas Aehnliches in eurem Lande?“ so redete der Herrscher seine Gäste an, als er sie an Ort und Stelle geführt hatte, und in der That ließ sich schwerlich eine großartigere und schauerlichere Naturscenerie denken, als sie die Schlucht der Tschatscha zeigte. Die grünen Wiesen des Distriktes Daggi sind hier auf eine seltsame Weise durch niedrige, kahle Hügelketten durchsetzt, zwischen denen kleine Bäche dem tief unten gähnenden Erdriß zuströmen, welcher den Boden gleich einem gewaltigen Spalt durchzieht. Felsig, zerrissen und scharfkantig sinkt dieser Schlund plötzlich 1000 bis 1500 Fuß tief und über eine Viertelstunde breit urplötzlich in der Ebene nieder. Seine aus felsigem Gestein bestehenden Seitenwände sind dünn mit zartem Moose und süßduftendem Thymian überzogen, und nur wenige armselige Hütten sind auf einzelnen vorspringenden Terrassen der Wände angebracht, die sonst in ihren düstern Höhlen den Wölfen und Hyänen Schlupfwinkel darbieten, während hoch oben über dem gähnenden Abgrunde Geier und Adler ihre Kreise in weiten Bogen ziehen. Der Aberglaube des Volks bevölkert aber den Spalt mit allerlei Unholden, während der König nicht mit Unrecht in ihm die beste Schutzwehr gegen die jenseit desselben wohnenden Galla sieht. Tief unten auf dem Boden, nur mit Schwindeln anzusehen, murmelt in tausend kleinen Wasserfällen gleich einem Silberfaden die Tschatscha hin, um ihren Tribut dem mächtigen Nil darzubringen. Da, wo die Schlucht sich etwas erweitert, liegen die königlichen Eisenwerke von Gurejo. [pg 252]Hier wird auf rohe, echt afrikanische Art durch ein einfaches Ausschmelzen ein ziemlich gutes Eisen gewonnen.
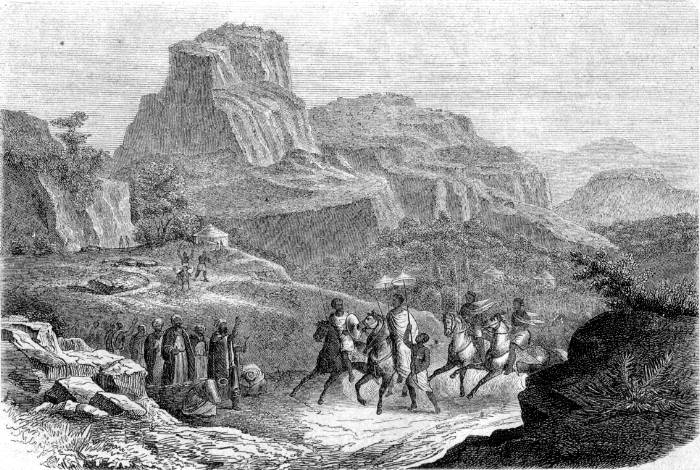
In einen dunkelgrünen Wachholderhain eingehüllt, erhebt sich auf einem Hügel am jenseitigen Ufer das stille Städtchen Tscherkos, dessen Einwohner einst alle, Mann, Weib und Kind, über tausend an der Zahl, in einer einzigen Nacht von den wilden heidnischen Galla unter Führung des Rebellen Medoko hingeschlachtet wurden, zur Rache für eine ihm am Hofe zu Ankober widerfahrene Beleidigung. Der stolze schöne Mann, auf den alle Frauen des Landes mit nicht geringer Bewunderung schauten, trat einst vor den König hin, brachte ihm 10 herrliche Streitrosse, 500 Ochsen, 20 Sklaven und zwei große Körbe voll Silberthaler, die gnädig angenommen wurden. Aber die Hand der Prinzessin Worka Ferri, um die er darauf bat, wurde ihm abgeschlagen und er selbst schnöde mißhandelt; der Beichtvater des Königs trat ihm in das Gesicht, daß das Blut herunterlief, und die Staatsfestung Gontscho nahm ihn auf. Wie durch ein Wunder entkam er wieder zu seinen Galla, die, seinem Rufe folgend, in hellen Haufen herbeieilten und Tscherkos nebst seinen Einwohnern verbrannten. Unter der Führung ihres Königs rückten nun die Schoaner aus, und bei Angollala kam es zur blutigen, lange schwankenden Schlacht. Medoko unterlag und floh in die geheiligten Asylräume des Klosters Affaf Woira, wo er sich sicher wähnte. Da erschien dort eine feierliche Prozession, welche dem Rebellen die Verzeihung des Königs überbrachte und ihn wieder zu Hofe kommen hieß. Medoko folgte der Stimme zu seinem Unglück. Neuer Verrath wurde gegen ihn gesponnen, und eines Nachts traten sechs Verschworene an sein Lager, um ihn mit ihren Schwertern zu durchbohren. Noch einmal sprang der verwundete, riesenkräftige Löwe auf, ein Blutbad unter seinen Mördern anrichtend, dann sank er zusammen. Seinem Volke, das um ihn lange Jahre trauerte, erschien er aber als Heros und Märtyrer, und die Fehden zwischen Abessiniern und Galla nahmen mit erneuter Wuth ihren Fortgang.
Die Galla.
Die Galla sind ein schöner Menschenschlag, dessen Physiognomie kaukasisch ist. Ihre Sprache weicht bedeutend von den echt semitischen Sprachen ab, aber in Konjugation, den Fürwörtern und vielen anderen Wörtern verräth sie doch einen semitischen Charakter und bildet mit den Sprachen der Danakil und Somalen eine eigene Familie des semitischen Sprachstammes. Von ihren zahlreichen Unterabtheilungen haben Krapf und Isenberg über fünfzig herausgefunden, welche fast alle voneinander unabhängig sind, hier und da in Feindschaft miteinander leben, aber dieselbe Sprache reden und ursprünglich dieselbe heidnische Religion hatten. Ueber ihre Herkunft bestehen verschiedene Sagen. Die Muhamedaner aus Argobba, östlich von Schoa, wollen sie aus Arabien herleiten; doch ist dies sehr unwahrscheinlich. Dagegen bemerkt eine abessinische Schrift, welche Krapf in Schoa zu sehen bekam, Folgendes: „Eine königliche Prinzessin von Abessinien heirathete zur Zeit Nebla Denjel’s im 14. Jahrhundert, als die [pg 253]Königsfamilie noch auf dem Berge Endoto residirte, einen Sklaven, der ein Hirte war aus dem Süden von Guragué, und gebar ihm sieben Söhne, die alle das Geschäft ihres Vaters trieben und dessen Sprache redeten. Als sie erwachsen waren, sammelten sie viel Volks um sich und gaben sich der Raub- und Plünderungssucht hin, sodaß sie zuletzt die Abessinier beunruhigten.“ Von einer Schlacht, die sie den letzteren in Guragué am Flusse Galla lieferten, sollen sie den Namen erhalten haben, mit dem die Abessinier und andere umwohnende Völker sie benennen. Sie selbst aber heißen sich Ilmorma, Menschenkinder. Später, nachdem Granje mit seinen muhamedanischen Horden Abessinien verwüstet hatte, ließen sich mehrere Stämme von ihnen in Schoa nieder. Späterhin wiesen die neuen Könige von Schoa den Wollo-Stämmen, die entweder damals schon den Muhamedanismus angenommen hatten oder dasselbe später thaten, die Nordgrenze von Schoa an, wo sie bis 1856 eine Schranke bildeten, welche die Verbindung zwischen diesem Lande und Abessinien erschwerte, bis König Theodoros II. Schoa und mit ihm die Wollo-Galla unterwarf. Diese nördlichen Galla sind fanatische Muhamedaner geworden, während es den christlichen Abessiniern nicht gelungen ist, unter ihnen viel Proselyten zu machen. Auch diesen heidnischen Galla gegenüber bewährt sich wieder die afrikanische Regel: Der Islam siegt über das Kreuz.
Die ursprüngliche Religion der Galla ist eine Naturreligion. Sie verehren ein höchstes, unsichtbares Wesen, welches sie Wak (Himmel) nennen. Ihn betrachten sie als den Urheber aller Dinge und Geber aller Gaben, daher richten sie ihre Gebete hauptsächlich an ihn. Obgleich sie keine bestimmte Idee von ihm haben, so schreiben sie ihm doch Persönlichkeit zu und glauben, daß er sich ihren Priestern im Traume offenbare, daß er zu ihnen rede im rollenden Donner, sich ihnen zeige im leuchtenden Blitze, daß er über Krieg und Frieden, Fruchtbarkeit und Theuerung entscheide. Jedoch steht Wak nicht allein, sondern hat zwei Untergottheiten zu Gehülfen, deren eine Oglia, männlich, deren andere Atete, weiblich ist. Letzteren beiden feiern sie gewisse Feste im Jahre, an welchen sie ihnen Opferthiere, Ziegen und Hühner schlachten, sich ihre Gunst erbitten und ihren Willen durch Besichtigung der Eingeweide der Opferthiere zu erfahren suchen. Die Feste des Oglia werden im Januar und April, das der Atete im September gefeiert. Dem Wak ist jeder Sonntag geweiht, den sie großen Sabbat nennen, zum Unterschiede vom Sonnabend, welchen sie den kleinen Sabbat heißen. Gewisse Bäume sind den Galla heilig; unter diesen opfern sie und verehren ihre Götter. In besonders großer Achtung steht ein großer Maulbeerfeigenbaum an den Ufern des Hawasch im südlichen Schoa. Hier versammeln sich jährlich ihre Priester und Großen von mehreren Stämmen, um Wak zu verehren und ihre Bitten an ihn zu richten. Dieser Baum heißt Wadanabe und ist Sammlungsort der Galla von den verschiedensten Stämmen; nur Weiber dürfen ihm nicht nahen. Ein anderer Baum, unter welchem dem Wak jährliche Opfer gebracht werden, heißt Riltu. Während sie opfern beten sie: „O Wak, gieb uns Tabak, Schafe und Ochsen, hilf uns, unsere Feinde zu tödten. O Wak, führe uns zu dir, führe uns zum Paradiese und führe uns nicht zum Satan“. [pg 254]Auch der Ahorn und der Wanzabaum werden für heilig gehalten. Die Besichtigung der Eingeweide der Opferthiere wird namentlich zur Entscheidung von Krieg und Frieden angewandt. Sie nehmen das Fett aus der Bauchhöhle, legen es auseinander und bestimmen die eine Seite für die Galla, die andere für ihre Feinde; die Seite nun, auf welcher das meiste Blut in den Adern sich befindet, erhält den Sieg. Die beiden Untergottheiten Oglia und Atete gebieten wieder über eine Menge unsichtbarer Wesen, die sie Zaren nennen und denen sie gute und böse Eigenschaften zuschreiben; daher werden auch diesen Verehrung und Opfer dargebracht. Zur Ausübung des Dienstes haben sie Priester (Kalitscha) und Zauberer (Luba). Der Priester hat die Leitung der Gottesverehrung, die Wahrsagung, Segen und Fluch u. s. w. zu besorgen. Er trocknet die zum Wahrsagen gebrauchten Eingeweide, legt sich dieselben um den Hals und zieht damit im Lande herum. Merkwürdig ist, daß ein ganzer Stamm der Galla für heilig gehalten wird, und zwar sind dieses die Watos, die überall frei umhergehen, segnen oder fluchen dürfen, ohne daß ihnen Jemand ein Hinderniß in den Weg legte. Dieser Stamm behauptet im Besitze ursprünglich reiner Galla-Natur zu sein, und seine Angehörigen heirathen nur unter sich. Sie kennen kein anderes Geschäft als Segnen und Fluchen, und weil Alles in dem Glauben steht, daß, was sie sagen, eintreffen müsse, so sind diese Leute sehr respektirt. Kein Galla läßt einen Wato zu sich ins Haus kommen, aber Lebensmittel in Menge werden ihnen, wo sie sich zeigen, vor die Häuser gebracht, weil man im Unterlassungsfalle ihren Fluch fürchtet. Sie lieben, wie die Waitos (vergl. S. 90), das Fleisch des Flußpferdes, welches in großer Menge im Hawasch vorkommt.
Ueber den Ursprung der Menschheit haben die Galla einen dunklen entstellten Begriff, jedoch scheinen sie nicht zu glauben, „daß alle von einem Blute herkommen“. Sie sagen, ihr erster Stammvater habe Wolab geheißen; Wak habe ihn aus Thon gebildet, ihm dann eine lebende Seele gegeben und ihn am Hawasch angesiedelt. Ihre Eidschwüre verrichten die Galla auf eine sonderbare Weise. Eine tiefe, enge Grube wird in den Erdboden gegraben und in dieselbe steckt man einige Lanzen. Dann wird sie mit einer Thierhaut bedeckt, und die Betheiligten schwören nun, daß, falls sie ihr Versprechen nicht hielten, sie in eine solche Grube stürzen, ihre Leiber mit Lanzen durchbohrt werden und ungerächt und unbegraben liegen bleiben mögen. Einmal geschlossene Freundschaft soll heilig gehalten werden, wenn sie auch unter den verschiedenen Stämmen selten zu sein scheint, da diese sich stets untereinander befehden. Heirathet ein Galla, so bekommt die Frau ihre Mitgift vom Vater; scheidet sie sich aber von ihrem Manne, so behält der Mann das Heirathsgeschenk. Gewöhnlich heirathen sie drei Frauen. Stirbt der Mann, so ist sein Bruder verpflichtet, die Witwe oder Witwen zu heirathen. Die Sanktion der Heirathen erfolgt allemal durch den Abadula oder Vorgesetzten mehrerer Dörfer. Tödtet ein Galla einen Fremden, der nicht von seiner Nation ist, so erwirbt er sich dadurch viel Ruhm, tödtet er einen Stammverwandten, so hat er, ist der Getödtete ein Mann, 100 Ochsen, ist es eine Frau, 50 Ochsen zu bezahlen. Da abessinische Christen nebst [pg 255]den sie umgebenden Muhamedanern keine Mühe, keine Schlechtigkeiten scheuen, Galla-Söhne und Töchter als profitable Menschenwaare in den abscheulichen Sklavenhandel zu ziehen, so ist’s natürlich, daß sie alle Fremden als Feinde betrachten. Abessinische Fürsten wollten ihnen das elende Christenthum, welches sie selbst hatten, mit dem Schwerte aufdringen; abessinische Mönche wagten ihr Leben selbst daran, ihnen den Genuß des Kaffees und Tabaks nebst anderen, von den Abessiniern für unrein gehaltenen Speisen und Getränken, abzuschneiden, und dafür nicht das Evangelium, sondern strenge Fastengesetze und andere Observanzen aufzubürden; kein Wunder, daß sie sich gegen Beides mit aller Macht wehrten. Sie haben die Idee, daß sie sicher bald sterben müssen, wenn sie Christen werden, und daher sehen sie auch die ihnen vorgesetzten Christen mit Abscheu an. Tritt ein solcher Gouverneur seine Stellung an, dann ruft das Volk einstimmig: „Möge er bald sterben, möge er bald sterben.“

Originalzeichnung von E. Zander.
Die Kriege zwischen Abessiniern und Galla haben eigentlich nie recht aufgehört. So oft auch letztere unterlagen, so erhoben sie sich doch immer wieder. Zu Tausenden verkaufen dann die biederen Christen die armen Heiden und füllen sich die Taschen mit blanken Maria-Theresia-Thalern, welche sie für die Menschenwaare erhalten.
Ein Hauptsklavenmarkt ist Metemmé, die Hauptstadt des Gebietes Gallabat, an der Grenze zwischen Abessinien und dem ägyptischen Sudan. Baker besuchte dort 1862 die Sklavenhändler. Sie wohnten in großen Mattenzelten und besaßen viele junge Mädchen von außerordentlicher Schönheit, deren Alter [pg 256]zwischen neun und siebzehn Jahren wechselte. Diese liebenswürdigen Gefangenen mit einer schönen braunen Farbe, zart geformten Zügen und Gazellenaugen waren Gallamädchen, welche aus ihrem Vaterlande an den abessinischen Grenzen von abessinischen Händlern hierher geführt wurden, um in die türkischen Harems verkauft zu werden. So schön diese Mädchen sind, taugen sie zu keiner schweren Arbeit und kränkeln und sterben bald, wenn man sie nicht freundlich behandelt. Man sieht mehr als eine Venus unter ihnen, und nicht genug, daß ihr Gesicht und ihr Wuchs vollendet schön sind, beweisen sie denen, welche sie gut behandeln, die größte Anhänglichkeit und werden sehr brave und treue Frauen. Es liegt etwas eigenthümlich Gewinnendes in der natürlichen Anmuth und Milde dieser jungen Schönheiten, deren Herz jenen tieferen Liebesgefühlen, welche unter rohen und rauhen Stämmen selten bekannt sind, eine rasche Antwort geben. Ihre Formen sind auffallend elegant und anmuthig, die Hände und Füße namentlich außerordentlich zart. Die Nase ist gewöhnlich leicht gebogen und mit großen und schöngeformten Oeffnungen versehen. Das schwarze und glänzende, aber ziemlich grobe Haar, reicht etwa bis zum halben Nacken hinunter. Obgleich diese Mädchen aus den Gallaländern sind, bezeichnen sie sich stets als Abessinierinnen und sind unter diesem Namen allgemein bekannt. Sie sind außerordentlich stolz und hochgesinnt und lernen merkwürdig schnell. In Chartum haben sich mehrere der angesehensten Europäer mit solchen reizenden Damen verheirathet, welche ihren Männern ohne Ausnahme große Liebe und Ergebenheit bewahren. In Gallabat betrug der Preis für eine dieser Schönheiten zwischen 25 und 40 Thalern. Einige Jahre nach Baker’s Aufenthalt (März 1865) scheint aber der Handel mit Gallamädchen in Metemmé fast erloschen zu sein und der schlechteren Waare vom Weißen Flusse Platz gemacht zu haben, denn Graf Krockow, welcher damals dort war, bemerkt: „Die in früheren Zeiten massenhaft für die Harems der Reichen exportirten jungen, feurigen, abessinischen Mädchen kommen jetzt nur selten auf den Markt, denn in ihrer Heimat hat das abscheuliche Treiben fast ganz aufgehört“ (?).
Jedenfalls stehen die Gallamädchen weit über den lasterhaften Abessinierinnen und vermögen nach Umständen wohl auch einen Europäer zu beglücken. Lassen wir darüber einen Brief Eduard Zander’s vom 27. Juni 1854 reden: „Seit einem Jahre und einem Monat bin ich auf Befehl des Regenten Ubié verheirathet, und vor zwei Monaten ist mir unter Gottes Beistand auch ein Töchterlein geboren worden. Es ist ganz deutschen Charakters, weiß und blond, sehr wohlgestaltet und schön und erhielt in der Taufe nach abessinischem Ritus die Namen Maria Sophia. – Zwanzig Monate sind jetzt verflossen, da veranstaltete Ubié eine großartige Schmauserei, zu der an einem Tage nicht weniger als 300 Kühe abgeschlachtet wurden; Alles war guter Dinge und der Honigwein floß in Strömen. Auch ich war besonders von Ubié eingeladen worden; bei ihm angelangt, befahl er sofort, daß ich mich neben ihn auf seine Alga setzen sollte. Das Weilen auf diesem Platze gilt für die größte Auszeichnung bei Hofe, welche nur den Mitgliedern des höchsten Adels zu Theil wird. Ubié hatte mich im Laufe der [pg 257]Zeit genau kennen gelernt und sehr lieb gewonnen, sodaß ich schon vor zwei Jahren in den hohen Adel erhoben wurde und zu jeder Zeit ungehinderten Eintritt bei ihm hatte. An diesem Tage war er ganz besonders heiterer Laune, er sprach viel mit mir und fragte mich nach allen möglichen Dingen, unter anderm, warum ich nicht verheirathet sei? Offen und rund heraus erklärte ich ihm denn, daß die Töchter seines Landes mir keineswegs gefielen, da ihnen das, was wir an den Frauen vor Allem schätzten, fehle, nämlich Ehrbarkeit und Tugend. Du hast Recht, entgegnete mir Ubié, sie taugen alle nicht für dich, denn du bist ein ordentlicher Mann. Ich werde selbst für dich sorgen und dir eine passende Frau aussuchen. Kaum waren fünf Monate vergangen, so erfüllte Ubié bereits sein Wort. Während dieser Zeit hatte er nach allen Richtungen des Landes Boten ausgesandt, die für mich eine geeignete Frau suchen sollten; keiner aber hatte eine schickliche gefunden. Da langten eines Tages muhamedanische Kaufleute hier an, unter denen sich ein Sklavenhändler befand, welcher sieben schöne Sklavinnen feil hatte. Ubié ließ sich die Mädchen vorführen und suchte unter allen sieben die schönste aus, um sie mir zum Weibe zu schenken. Das Vaterland meiner Frau ist Lima; die Bewohner sind Galla, der Regent oder Oberhäuptling des Landes heißt Ababokiwo. Meine Frau zählt jetzt 16 Jahre. Sie hat mich lieb gewonnen, ist mir treu ergeben und von Charakter sanft, ihr Verstand ist scharf und hell. Was sie aber besonders auszeichnet, ist Sittsamkeit und Tugend.“
In seiner Heimat, wo das Schwert des abessinischen Eroberers noch nicht eindrang, ist der Galla ein freier, unabhängiger Mann, dem nur der Distriktsvorsteher oder Abadula und der oberste Häuptling oder Heiu zu befehlen hat. Der Heiu regiert nur acht Jahre, alsdann tritt er ins Privatleben zurück, weil dann ein anderer Heiu, ein Mann von kriegerischem Muthe und Talent, gewählt wird. Sein Geschäft besteht darin, daß er durch den ganzen Stamm zieht, alle Hauptangelegenheiten seines Staates schlichtet und unterstützt und namentlich über Krieg und Frieden entscheidet. Dabei ist der Ort, in welchem er sich gerade aufhält, verpflichtet, ihn zu unterhalten.
Stirbt ein Galla, so erhebt sich, wie fast im ganzen Oriente, allgemeine bittere Klage. Ist der Verstorbene ein Hausvater, so rasiren sich, zum Zeichen der Trauer, die Kinder am ganzen Leibe. Der Todte wird anständig begraben, das Grab mit schönen Steinen bedeckt und eine Aloe darauf gepflanzt; dann wird eine Kuh geschlachtet und von den Verwandten verzehrt. Sobald die Aloe ausschlägt, glauben sie, die Seele des Verstorbenen sei zu Wak ins Paradies gekommen. Jedoch meinen sie, daß auch in jener Welt alle Nationen und Religionen ebenso geschieden sein werden wie hier. Galla, Muhamedaner und Christen kommen jede Partei an ihren besonderen Ort, um die guten oder üblen Folgen ihres Verhaltens in dieser Welt zu genießen. Die Lüge scheint bei ihnen verpönter zu sein als bei ihren abessinischen Nachbarn. Wird ein Galla als Lügner ertappt, so verliert er Sitz und Stimme in den öffentlichen Versammlungen und wird der Verachtung preisgegeben.
[pg 258]Was im Vorstehenden über die Galla mitgetheilt wurde, ist vorzugsweise den Berichten Krapf’s und Isenberg’s entlehnt. Das Volk erscheint uns nach diesen Mittheilungen weit liebenswürdiger und besser als seine abessinischen Bedrücker. Ueber die Art und Weise, wie die letzteren gegen die Galla verfahren, wie sie Land und Volk dieses Stammes auf das Schmählichste verwüsten, darüber können wir uns am besten unterrichten, wenn wir abermals der Erzählung des Major Harris folgen.
Wie die meisten anderen afrikanischen Potentaten, unternahm auch Sahela Selassié keinen Krieg wegen des nationalen Ruhmes oder wegen der öffentlichen Wohlfahrt; seine Kriege waren entweder Raubzüge oder auf die Unterdrückung von Rebellen gerichtet, und das war auch jetzt wieder der Fall, als er gegen die Galla auszog, wobei er den dringenden Wunsch aussprach, von der Gesandtschaft begleitet zu werden; die Gegenwart derselben sollte ihm Kraft, seinen Völkern neuen Muth verleihen. Nur für 20 Tage wurde die Armee mit Lebensmitteln versehen, woraus man schließen wollte, daß das Ziel des Feldzuges kein allzufernes war. Angollala war in großer Aufregung und alle Handwerker damit beschäftigt, die Waffen in Stand zu richten, während im königlichen Arsenale Tag und Nacht große Thätigkeit herrschte. Bei dem abergläubischen Charakter der Abessinier war vorauszusehen, daß erst das Schicksal befragt und nach guten oder bösen Vorzeichen geforscht werden müßte. Priester und Mönche hatten in dieser Beziehung alle Hände voll zu thun. Das Herabfallen eines Schildes vom Sattelknopf, die Erscheinung eines weißen Falken sind ungünstige Zeichen, während ein paar Raben Glück verheißen. Auch das Heulen der Hunde während der Nacht wurde beobachtet, um daraus Schlüsse zu ziehen. Endlich brach man auf und zwar in der größten Unordnung, um aber bald wieder Halt zu machen, damit die zahlreichen Nachzügler sich sammeln konnten. Vor der Armee wurde unter einem Baldachin von Scharlachtuch die Bibel und die Bundeslade aus der Michael-Kathedrale in Ankober auf dem Rücken eines Maulthieres vorangetragen, welche den sicheren Sieg gegen den heidnischen Feind verleihen sollten; dann folgte auf reich gezäumtem Maulthiere der König, umgeben von seinen Luntengewehrträgern und den Musikanten mit Kesselpauken und Trompeten. An ihn schlossen sich an Gouverneure, Offiziere, Mönche, Priester und zuletzt – das Sonderbarste von allen: 40 Frauen und Fräulein, welche die königliche Küche zu versorgen hatten. Soweit das königliche Gefolge, dem sich unter einer ungeheuren Staubwolke, soweit das Auge reichte, Reiter, Krieger zu Fuße, Saumrosse, Esel, Maulthiere, mit Zelten und Lebensmitteln beladen, sowie große Scharen Weiber anschlossen, die mächtige Töpfe mit Bier und Honigwein auf dem Rücken trugen. Alles in Unordnung malerisch durcheinander. Wenn diese Masse sich niederließ, nahm das Lager einen Raum von anderthalb Stunden im Durchmesser ein, in dessen Mitte das königliche Zelt und dabei die Küche stand. Von Vorposten oder sonstigen Sicherheitsmaßregeln war aber, selbst als man schon des Feindes Land betreten hatte, gar keine Rede. Nicht wenig Aufsehen erregten die Bajonnetflinten, die bei diesem Zuge zum ersten Male in praktischen [pg 259]Gebrauch kommen sollten, und die Raketen, welche auf des Königs Wunsch die Engländer allabendlich steigen ließen, um die Galla durch den Feuerregen derselben zu schrecken.
Früh am Morgen erschallten die Nugarits oder Trommeln, um die Mannschaften in den Sattel zu rufen, und in einer halben Stunde war die Armee, die mittlerweile auf 15,000 Mann angeschwollen war, wieder auf den Beinen. Das militärische System Schoa’s ist ein rein feudales, da jeder Gouverneur des Reiches im Verhältniß zu dem ihm unterstehenden Lande ein Kontingent zu stellen gezwungen ist. Außer den Pferden, Waffen und Lebensmitteln erhalten die Soldaten nichts und nur 400 Garden des Königs bekommen Zahlung, nämlich 8 Amolen (Salzstücken) im Jahre, etwa 18 Groschen im Werthe, außer der Beköstigung, wie sie jeder königliche Sklave auch erhält. Daß in einer so zusammengesetzten Armee wenig Disziplin herrscht, läßt sich denken. Ohne Rücksicht für die der Reife entgegengehende Ernte, die niedergetreten wurde, wälzte sich die Schar, einem Heuschreckenschwarme gleich, Alles vor sich aufzehrend, in südwestlicher Richtung weiter, ohne daß die Einzelnen wußten, wohin der Raubzug eigentlich gehe, denn der König bewahrte das Geheimniß seines Zieles so streng, daß nicht einmal seine höheren Offiziere davon unterrichtet waren.
Nichts konnte einförmiger sein als der Landstrich, den man zuerst durchzog. Weite, grasige, wellenförmige, mit Feldern durchsetzte Ebenen, ohne einen einzigen Baum dehnten sich vor dem Heere aus. Verschiedene kleine Bäche und Flüsse, die dem Nile zuströmen, wurden überschritten, und Se. Maj., dem es zu viel wurde, immer zu reiten, wollte zur Abwechselung einmal gehen, stieg ab und ließ sich ein paar Pantoffeln reichen, die aber bald im Kothe stecken blieben, sodaß der König schließlich vorzog, gleich seinen Unterthanen barfuß einherzuschreiten. In der weiten, von Hügeln umschlossenen Ebene Abai Deggar wurde plötzlich der Befehl ertheilt, das Lager aufzuschlagen und die Umgebung auszuplündern. Sogleich rückten im vollen Galopp die Reiterbanden nach allen Richtungen aus, brannten die Dörfer nieder, zertraten das Getreide und trieben das Vieh ins Lager. Fortwährend herrschte die größte Unordnung im Heere, das nur in losen Haufen, weit zerstreut marschirte, und so eher den Anblick einer geschlagenen als einer vordringenden Armee darbot. In ihren kurzen, weiten Beinkleidern, den Leib mit der langen Binde umwickelt, mit dem Leoparden- oder Löwenfell auf der Schulter, mit Speer und Schild bewaffnet, setzten die Reiter durch den schlammigen Boden, der auch des Nachts ihr einziges Lager war; viele blieben aber liegen und gingen an den Strapazen zu Grunde, da es in der Nacht gewöhnlich fror.
An der 1200 Fuß hohen Gebirgskette Garra Gorfu war endlich das Ziel erreicht. Langsam zog die Armee zum Rücken der Berge hinauf, während rechts und links Scharen abschwenkten, um den Feind zu umgehen. In einer Breite von vier bis fünf und einer Länge von etwa zwölf Stunden bilden die mit Feldern bestandenen Garra-Gorfu-Berge eine Wasserscheide zwischen Nil [pg 260]und Hawasch; an ihnen wohnen die Sertie-Galla, die sich seit langer Zeit schon in offenem Aufstande gegen den König befanden, d. h. sie hatten die verlangten Steuern nicht bezahlt und sogar eine zur Eintreibung derselben abgesandte Reiterschar von 800 Mann erschlagen. Jetzt nahte der Tag der Rache für den verweigerten Gehorsam.
Gleich einem angeschwollenen Strome ergoß sich das Heer über die friedliche Landschaft, deren Bewohner nichts Böses ahnten, und nun rückten 15,000 blutgierige Barbaren gegen sie heran. Ruhig bestellte noch der friedliche Landmann sein Feld, die Weiber gingen ihrer Beschäftigung nach und auf den blumigen Wiesen weidete das Vieh. „Möge der Gott, welcher der Gott meiner Väter ist, uns stärken und verzeihen!“ sprach wuthfunkelnden Blickes der christliche König und gab damit das Zeichen zur Verwüstung. Dorf auf Dorf wurde niedergebrannt, bis die Luft durch den Rauch verfinstert war, der Speer des Kriegers durchsuchte jeden Busch nach Flüchtigen. Weiber und Kinder wurden in hoffnungslose Sklaverei abgeführt; alte und junge Männer erbarmungslos erschlagen und die Herden weggetrieben. Jeder Krieger wollte es dem andern an Blutdurst und Grausamkeit noch zuvorthun. Ganze Familien wurden umringt und niedergespeert; Unglückliche, die auf die offene Ebene sich flüchteten, gleich einem Wild verfolgt und zusammengehauen; drei- oder vierjährige Kinder, welche auf Bäume geklettert waren, herabgeschossen, wie man Vögel vom Baume schießt. Nach Verlauf von zwei Stunden verließ das Heer wieder, mit Beute beladen, das verwüstete Thal. Da, wo die Stätte eines friedlichen Ackerbaus gewesen, wo glückliche Menschen gewohnt, hörte man nur das Knistern der zusammenbrechenden, niedergebrannten Balken und das Schreien der Geier, die, vom Leichengeruch angelockt, aus weiter Ferne herbeigezogen kamen. Das ist der abessinische Krieg, so war er einst, so war er bis heute unter Theodoros: Ueberfall, Mord, Raub, Schlächterei – selten eine offene Feldschlacht kennzeichnen ihn.
Das Nachtlager der siegreichen Armee bot einen teuflischen Anblick dar. Ueberall flammten die Feuer, bluteten die geschlachteten Schafe, wieherten laut die Rosse, brüllten siegestrunken die Krieger oder weinten leise die gefangenen Gallamädchen. Die Speere und Schilde der grimmigen Krieger, welche ihre Hände in das Blut unschuldiger Kinder getaucht hatten, funkelten durch die Nacht; erst allmälig erstarb der wüste Lärm, und die Nacht deckte ihren dunklen Schleier über die barbarischen Scenen des Tages.
Nach dieser blutigen Fehde hielt der König seinen triumphirenden Einzug erst in Angollala, dann später in der Landeshauptstadt Ankober, welche er seit der Ankunft der britischen Gesandtschaft in Schoa nicht besucht hatte. Erwartet von der gesammten Priesterschaft und den Einwohnern, von den königlichen Pauken und den Staats-Sonnenschirmen, seinen Kriegern, Generalen und der britischen Gesandtschaft geleitet, zog er in die jubelnde Stadt ein, deren Dächer, Palissadenzäune und Straßen mit einer dichten Menschenmasse erfüllt waren. Der Lärm und die Musik dauerten so lange an, bis der König und sein Gefolge [pg 261]den steilen, gewundenen Pfad zum Palaste hinaufgestiegen, die neun Thorwege passirt und im innersten Hofraume Platz genommen hatte. Hier ließ sich Se. Maj. in einem erhöhten Alkoven, seinem Throne, nieder; dann ertönte wieder die große Pauke und dreihundert im Hofe sitzende Kebsweiber begannen in die Hände zu klatschen, während eine Tänzerin vor dem Herrscher ihre Sprünge machte und ein selbst gedichtetes Lied zu dessen Lobe sang. Wenn sie einen Vers geendigt und z. B. gesagt, daß der Fürst, der stets über seine Feinde triumphirt hatte, niemals seine königliche Stirn mit einem schöneren Siegeskranze geschmückt hätte als gerade jetzt, wandte sie sich nach der Menge um. Mit lautem Geschrei fiel diese als Chorus in ihren Vers ein. Die Krieger heulten dann laut vor Freuden, die Großen des Reichs, die Häuptlinge, Gouverneure und Generale klatschten in die Hände und die vor dem Palaste versammelte Menge erwiderte mit lautem Jubelgeschrei diesen Siegesjubel, während, um die Freude voll zu machen, die britischen Artilleristen ihr Geschütz abbrannten.

Am Tage des Erzengels Michael, dessen Kirche unmittelbar neben dem Palaste steht, nahm um Mitternacht Sahela Selassié das heilige Abendmahl und stattete Gott ein Dankgebet für den errungenen Sieg ab. Die Bundeslade, die ihm im Kriege Glück gebracht, wurde wieder in feierlicher Prozession an ihre [pg 262]alte Stelle in der Michaelskirche gesetzt und den Armen reichlich Almosen gespendet. So schloß das Siegesfest.
Mit Erlaubniß des Königs unternahm die britische Gesandtschaft verschiedene Streifzüge durch das Land, namentlich in die nördlichen Galladistrikte. Heimgekehrt nach Angollala kam sie ihrem Ziele, dem Abschlusse eines Handelsvertrages mit Schoa, immer näher, gegen den der König sich anfangs sehr gesträubt hatte. Die Artikel wurden sauber auf Pergament aufgesetzt und ein Tag zu dessen Unterzeichnung bestimmt.
Zur bestimmten Stunde lagerte Se. Maj. im Alkoven, umgeben von den Würdenträgern seines Reiches. Das künstlerisch ausgestattete Dokument, auf dem die heilige Dreieinigkeit als Schoa’s Wappen und das königlich englische Siegel angebracht waren, wurde vor Sahela Selassié in englischer und amharischer Sprache verlesen. Unter den 16 Artikeln befanden sich auch solche, welche eine förmliche Umwälzung in vielen der bisher in Schoa geltenden Anschauungen hervorbrachten. So wurde das Recht der Krone, das Eigenthum fremder im Lande verstorbener Personen ohne Weiteres sich aneignen zu können, aufgehoben, viele Monopole beseitigt und den Fremden gestattet, wieder nach dem Besuche des Landes in ihre Heimat zurückkehren zu dürfen, was vorher nicht der Fall war. Tekla Mariam, der königliche Notar, kniete mit dem aufgerollten Dokumente vor dem Lager Sahela Selassié’s, dem er die Feder zum Unterschreiben der Stelle darreichte, welche lautet: „So geschehen und beschlossen zu Angollala, der Galla-Hauptstadt Schoa’s, zum Zeichen dessen wir unsere Unterschrift und Siegel hier beisetzen, Sahela Selassié, Negus von Schoa, Ifat und der Galla.“ In Gegenwart hoher Beamten drückte dann der Schreiber noch das königliche Siegel – ein Kreuz, um welches das Wort Jesus geschrieben ist – unter den Handelsvertrag, der dem Kapitän Harris vom Könige mit folgenden Worten eingehändigt wurde: „Ihr habt mich mit köstlichen Geschenken erfreut. Das Gewand, welches ich trage, der Thron, auf dem ich sitze, die vielen Merkwürdigkeiten in meinen Magazinen, die Flinten, welche in der großen Halle hängen, sie stammen alle aus eurem Lande. Was kann ich euch dagegen bieten? Mein Königreich ist so viel wie Nichts.“
Kurze Zeit darauf wurde der König, dessen Lebenswandel nicht der solideste war, wieder einmal sehr krank und ließ die englischen Aerzte rufen, um ihn zu kuriren. Jammer und Elend mochten sein Herz erweichen und er faßte, gleichsam um die Vorsehung mit sich zu versöhnen, den Entschluß, alle seine männlichen Verwandten, die er bisher im Staatsgefängniß zu Gontscho bei Ankober gefangen hielt, zu befreien und auf diese Weise einen Damm zu durchbrechen, den eine barbarische Sitte seiner Vorfahren um den Thron errichtet hatte. Die Könige von Schoa nämlich hatten, nach erlangter Unabhängigkeit von den übrigen Abessiniern, es zur Gewohnheit gemacht, daß Jeder von ihnen bei seiner Thronbesteigung alle seine Brüder in ein Staatsgefängniß einsperrte, und nur die Schwestern, von denen keine Mitbewerbung um den Thron zu fürchten war, behielten ihre Freiheit. Daß in einem despotischen Staate wie [pg 263]Schoa sich allerdings eine solche Maßregel empfehlen konnte, geht aus der früheren Regierungsgeschichte des Königs Sahela Selassié hervor, da einer seiner Brüder, der die Freiheit behalten und sich dem Klosterleben gewidmet hatte, selbst das Mönchsgewand dazu benutzte, um hier und da im Lande Revolutionen anzustiften. Die Könige von Schoa nahmen bei jener barbarischen Sitte nur das Verfahren der sogenannten salomonischen Dynastie in Abessinien im Allgemeinen sich zum Muster, und erst im vorigen Jahrhundert wurde diese Sitte in Amhara und Tigrié abgeschafft. Seitdem herrschte aber dort auch beständiger Bürgerkrieg.
Das war das letzte bemerkenswerthe Ereigniß, welches die britische Gesandtschaft während ihres Aufenthaltes in Schoa niederzuschreiben hatte, denn bald darauf erfolgte ihre Abberufung.
Durch einen in England eingetretenen Ministerwechsel war die Gesandtschaft in Schoa unfreundlich berührt worden, indem die neue Tory-Regierung einer Fortsetzung der Verbindung mit Schoa ungünstig war und die Gesandtschaft zurückberief. Kapitän Harris hatte jedoch sich gegen die Zurückberufung gesträubt und sich angeboten, ohne seinen Gehalt als Gesandter mit seiner bloßen Pension als Kapitän der Artillerie in Ankober zu bleiben. Da keine Antwort hierauf eintraf und die Gesandtschaft an allen Mitteln Mangel litt, mußte Kapitän Harris sich endlich im Februar 1843, nachdem er 18 Monate in Schoa verweilt, zur Umkehr entschließen. Erst in der Grenzstation Farri erhielt er von der Regierung in Bombay Gegenbefehl; allein es war nun zu spät, da keiner außer Harris selbst Lust zur Umkehr spürte. In Erwiederung auf jene glänzenden Gaben, die der König von Schoa von England erhalten, schickte dieser nun der Königin Viktoria ein hübsches Maulthier, einige naturhistorische Merkwürdigkeiten und einige Gold- und Silberarbeiten als Industrieerzeugnisse seines Landes zu Gegengeschenken. Auf Verlangen der Gesandtschaft hatte Sahela Selassié derselben auch zwei seiner Soldaten als Boten mitgegeben, um die freundschaftlichen Gesinnungen, die man von ihm erwartete, der britischen Regierung auszudrücken.
Noch einige Jahre lebte Sahela Selassié, dessen Ruf durch verschiedene Reisende durch ganz Europa drang; dann segnete er das Zeitliche und erhielt in Hailu Melekot einen weit weniger energischen Nachfolger. Nicht allein, daß die Galla gegen diesen mit erneuerter Macht auftraten und seinen Thron erschütterten – sondern die Selbständigkeit Schoa’s ging unter ihm zeitweilig verloren, indem im Jahre 1856 die neu aufgegangene Sonne, Theodoros II., den Staat mit Gesammtabessinien vereinigte. Erst als dieser in den Krieg mit England verwickelt wurde, gelang es dem Enkel Sahela Selassié’s, dem jungen Menilek, seine Krone wieder zu erlangen. Der folgende Abschnitt, welcher die so merkwürdige neueste Geschichtsepoche Abessiniens behandelt, giebt darüber Auskunft.
Theodoros II., Negus von Aethiopien.
Bewegte Jugend. – Der Emporkömmling. – Schlacht von Debela und Königskrönung. – Rebellenkriege. – Reformen. – Abessinische Heere und Kriegspraxis. – Verwicklungen mit den Missionären. – Gefangennahme Cameron’s und Streitigkeiten mit England. – Magdala. – Beginn der englischen Invasion. – Erstürmung von Magdala und Tod Theodor’s. – Rückzug der Engländer.
Im äußersten Westen Abessiniens, angrenzend an das den Aegyptern unterthane Gebiet, liegt die Provinz Koara, bekannt durch die besondere Sprache, welche, abweichend von derjenigen des übrigen Landes, ihre Bewohner reden. Dort sowol als in dem benachbarten Fürstenthum Sana regierte seit alten Zeiten eine adlige Familie, die im Beginn dieses Jahrhunderts durch den Detschas Hailu Mariam repräsentirt wurde. Seine Frau, die sich rühmen konnte, aus noch vornehmerem Geschlechte abzustammen, da sie mit der „salomonischen Dynastie“ verwandt war, gebar ihm im Jahre 1820 einen Sohn, der Kasa genannt wurde. Gewiß war es dem Knaben, der später den Namen Theodor II. führte, [pg 265]nicht an der Wiege gesungen, daß er einst über ganz Aethiopien als Negus herrschen und seine Widersacher niederwerfen werde; denn obgleich aus herzoglichem Geschlecht, bezeichneten seine frühesten Jahre doch das Elend und die Noth. Beim Tode seines Vaters theilten die Verwandten das Erbtheil Kasa’s unter sich und zwangen die aus königlichem Blute entsprossene Mutter, sich durch den Verkauf von Heiltränkchen und Kusso (dem Mittel gegen den Bandwurm) zu ernähren. Der Knabe aber fand im Kloster Tschankar am Tanasee, südlich von Gondar, Aufnahme, um sich dort zum Debtera heranzubilden. Daß er dort den Studien fleißig obgelegen und erlernt hatte, was man in Abessinien erlernen kann, dafür zeugt seine spätere Laufbahn, in welche der arme Student der Gottesgelahrtheit durch einen Zufall hineingeführt wurde. Es war zu Anfang der vierziger Jahre, als wieder einmal ein Rebell die Provinz Dembea heimsuchte und sengend und brennend von Ort zu Ort zog. Auch das Kloster Tschankar wurde überfallen und dort ein Blutbad angerichtet, dem der junge Kasa nur mit Mühe entkam. Mit einem Haufen Abenteurer durch das Land ziehend, führte er ein Räuberleben und schwang sich bald zum Befehlshaber derselben empor. Durch glückliche Erfolge kühn gemacht, beschloß er, sich eine Provinz zu erobern, und fiel zunächst über Dembea her, wo damals die kluge und grausame Fürstin Menene, die Mutter des Ras Ali, herrschte. An der Spitze ihrer Truppen stellte sich die beherzte Frau dem jungen Rebellen entgegen; doch das Schicksal entschied gegen sie. Geschlagen wußte sie doch dem Unheil noch die beste Seite abzugewinnen und den Kasa an sich zu fesseln, indem sie ihm ihre Enkelin Tsubedsche, die Tochter des Ras Ali, zur Frau gab. Dem Muthigen hilft das Glück! dachte Kasa, in dessen Kopf nun großartige Pläne sich zu entwickeln begannen; die Aegypter hatten Galabat erobert und gegen die Hauptstadt dieser Provinz, Metemmé, richtete er nun seinen ersten Angriff. Es war gerade Markttag, als er heranrückte und mit seinen Gefährten den Ort überfiel, ausplünderte und mit großer Beute sich zurückzog. Indessen die Rache folgte auf dem Fuße. Kasa gerieth am Flusse Rahad zwischen zwei Compagnien regulärer ägyptischer Infanterie und wurde gründlich geschlagen. Seine Bande zerstreute sich und er selbst flüchtete mit einer Kugel in der Schulter in das Innere des Landes. Von Allen verlassen, hülflos und ohne die geringsten Mittel wandte er sich nun an die Fürstin Menene; allein diese wies ihn spöttisch zurück und ihr General, der Detschas Underad, wagte es sogar, ihn wegen seiner Herkunft als Sohn einer Kussoverkäuferin zu verspotten. Da ergrimmte Kasa, sammelte Anhänger und schlug Menene sammt ihrem General, die gefangen wurden. Als man sie vor ihn führte, redete er sie folgendermaßen an: „Liebe Leute! Wie ihr ganz richtig bemerkt habt, bin ich der Sohn einer Kussoverkäuferin und ihr erinnert mich, daß meine Mutter heute noch Nichts abgesetzt hat. Macht diesen Fehler gut und trinkt gefälligst diese Flasche aus.“ Und damit zwang er sie, das abscheulich schmeckende, kräftig wirkende Abführungsmittel zu verschlucken.
Nun war Kasa Herr von Dembea und Gondar, wo sein Einfluß von Tag zu Tag wuchs. Als darauf, um ihn niederzuwerfen, sein eigener Schwiegervater, [pg 266]Ras Ali, gegen ihn auszog, wurde auch dieser besiegt und mußte 1852 nach Debra Tabor, später zu den Galla fliehen. Kaum war dieser aus dem Felde geschlagen, so rückte der Detschasmatsch Goschu aus Godscham gegen Kasa vor, um den Emporkömmling zu züchtigen. Wieder wandte sich das Geschick und Kasa, an den Ufern des Tanasees geschlagen, flüchtete in ein Maisfeld. Ihm nach sprengte Goschu, laut ausrufend: „Wer fängt mir diesen Vagabunden ein?“ Kaum hatte er die Worte gesprochen, als ein wohlgezielter Schuß Kasa’s ihn niederstreckte, der nun, aus seinem Verstecke hervorspringend, Goschu’s Truppen zurief: „Schaut, euer Fürst ist hin, und ihr seid Hunde, was wollt ihr machen?“ Entmuthigt durch den Tod ihres Führers streckten die meisten die Waffen und der Rest fiel unter dem Schwerte der wieder gesammelten Truppen Kasa’s. Mit dem Falle dieses letzten Häuptlings hatte Kasa das ganze centrale Abessinien sich unterworfen und nur noch Schoa und Tigrié waren unbesiegt. In ersterem Staate herrschte unabhängig Hailu Melekot, der Sohn Sahela Selassié’s, in letzterem der alte Ubié. Der nächste, welchen das Schicksal betreffen sollte, war Ubié, doch mußte Kasa mit diesem alten schlauen Greise anders zu Werke gehen, als mit den übrigen Gegnern. In Adoa, Ubié’s Hauptstadt, spielten damals die katholischen Missionäre, namentlich de Jacobis, eine große Rolle, welche den alten Ubié ganz für sich eingenommen hatten und ihm Frankreichs Schutz zusagten, während sie den Abuna Abba Salama zu verdrängen suchten. Hierauf baute Kasa seinen Plan. Um den Kirchenfürsten, der durch die Katholiken seine Macht immer mehr geschmälert sah, auf seiner Seite zu haben, ließ er ihn von Adoa nach Gondar kommen und versprach ihm, wenn er ihn zum Könige krönen wolle, die Katholiken zu vertreiben. Der Vertrag wurde geschlossen, die Katholiken zuerst aus Amhara verjagt und Ubié aufgefordert, sich zu unterwerfen und Tribut zu bezahlen. Allein dieser, der 25 Jahre lang im Schoße des Glücks gesessen und an sein Ende nicht glauben mochte, ließ es auf eine Entscheidung durch die Waffen ankommen.
Groß und bedeutend waren die Vorbereitungen, die von beiden Seiten zum Feldzuge getroffen wurden, denn der Tag, welcher über Abessiniens Zukunft entscheiden sollte, war gekommen.
Ueber die Hochebene von Woggara rückte im Januar 1855 das Heer des Emporkömmlings nach Semién vor; ihm entgegen zog von der Enderta her der alte Ubié. Immer höher winden sich die Truppen in die Alpenpässe hinauf, immer schneidender wird die Luft dort oben und der Schnee läßt seine weißen Flocken auf die braunen, leichtgekleideten Krieger herniederfallen, die in gedeckter Stellung am Fuße des mächtigen Bachit sich treffen und zögernd einander beobachten. Hier das Alter, die Erfahrung und eine erprobte Macht; dort die Jugend, die Thatkraft und die Siegesgewißheit, welche rasche Erfolge und Glück verliehen haben. Schon zaudert man wochenlang – da bricht mit einem Male – es war am 9. Februar – Ubié mit seiner gesammten Streitmacht auf. Beim Dorfe Debela kommt es zur entscheidenden Schlacht, in der Ubié’s Heer vernichtet, er selbst gefangen, einer seiner Söhne getödtet wurde. 7000 Flinten [pg 267]und zwei vom Könige Ludwig Philipp geschenkte Kanonen nebst einem Schatz von 60,000 Thalern fielen mit der kurz darauf folgenden Einnahme der Festung Amba Hai in die Hände des glücklichen Kasa, der nun am Ziele seiner Wünsche angelangt war.
Nicht fern von der Wahlstatt steht die von unserm Landsmann Eduard Zander erbaute Kirche Debr Eskié. Dorthin begab sich schon zwei Tage nach der Schlacht, umringt von seinen Generalen und geführt vom Abuna, der siegreiche Sohn der armen Kussohändlerin. Sein Stern war glänzend aufgegangen und dem glücklichen Krieger fuhr der Gedanke durch die Seele, daß er berufen sei, das große äthiopische Reich wieder aufzurichten. Er glaubte sich zu hohen Dingen auserkoren. Ging doch unter den abessinischen Christen die alte Sage, es werde einst ein Kaiser Tadros (Theodoros) erstehen, um den Glanz Aethiopiens wieder herzustellen, das Land groß, das Volk frei und glücklich zu machen; er sei vom Himmel dazu bestimmt, die Muhamedaner zu überwältigen und Mekka sammt Medina zu zerstören. Daran anknüpfend, ließ sich nun Kasa vom Abuna Salama in der Kirche zu Debr Eskié am 11. Februar 1855 zum Negus über Aethiopien krönen, wobei er den Thronnamen Theodor II. annahm. De Jacobis und die Katholiken mußten nun unter Androhung der Todesstrafe schleunig das Land räumen.
Nachdem Theodor nothdürftig durch Einsetzung eines Statthalters sein Ansehen in dem noch keineswegs ganz unterworfenen Tigrié hergestellt, beschloß er, zunächst Schoa zu unterjochen, wozu theologische Spitzfindigkeiten, nämlich die Frage von den zwei oder drei Geburten Christi (vergl. S. 112) den Vorwand hergeben mußten. Durch Wollo-Galla zog er auf Schoa zu, dessen schwacher König, Hailu Melekot, an einem entscheidenden Tage die Krone verlor und bald darauf starb. Nachdem noch die Provinz Godscham von Rebellen gesäubert war, hielt der siegreiche Fürst im Mai 1856 seinen feierlichen Einzug in die alte Kaiserburg zu Gondar. Nominell reichte jetzt sein Land, das den Kern des alten äthiopischen Reichs umfaßte, vom Hawaschflusse bis zur Samhara. Aber es hätte nicht Abessinien heißen müssen, um Ruhe zu haben: von allen Seiten regte es sich, um den König wieder niederzuwerfen, und der Bürgerkrieg brach mit seiner ganzen Wuth von Neuem in Tigrié aus.
Ein Neffe des entthronten Ubié, Agau Negusi, setzte sich im nordwestlichen Tigrié fest und vertrieb den Statthalter Theodor’s. Negusi war ein gutmüthiger, löwenherziger Jüngling, dem es nur an festem Willen fehlte. Fünf Jahre lang war er Herrscher über Tigrié an der Spitze einer glänzenden Armee, weil Theodor von Ahmed Beschir, der sich an die Spitze der räuberischen Galla gestellt, nicht loskommen konnte. Unterdessen knüpfte Negusi mit Frankreich Verbindungen an, stand in nächster Beziehung zu den französischen Agenten in Massaua und zu dem Bischof de Jacobis, welchem, wie wir gesehen haben, das Betreten des abessinischen Territoriums bei Todesstrafe verboten war. Ein Brief Negusi’s an Herrn von Lesseps, in welchem er anbietet, sich Frankreich unterwerfen zu wollen, wurde in Massaua verfaßt, und Negusi soll kaum soviel [pg 268]Kunde davon gehabt haben, als von der Abschickung einer Gesandtschaft nach Frankreich, durch welche den Franzosen unter der Bedingung, daß sie ihn beim Umsturz der jetzigen Dynastie begünstigen wollten, die Bai von Adulis und die Insel Dessi geschenkt wurden. Ein Kapitän Russel mit einigem Gefolge wurde sofort von Paris nach Massaua geschickt, um mit dem „Empereur Negousi“ zu verhandeln, der stündlich auf die versprochenen französischen Hülfstruppen sammt Waffen wartete. Diese erschienen jedoch nicht. Nachdem Russel’s Ankunft bekannt geworden, ging er nach Halai, dem Grenzorte zwischen Abessinien und dem Küstenlande, wo Jacobis seit seiner Vertreibung wohnte. Allein die Anhänger Theodor’s setzten ihn, da mittlerweile Negusi geschlagen war, gefangen, und nur auf Jacobis’ Garantie wurde er freigelassen, allein unter der Bedingung, daß er dessen Haus nicht verlasse. Doch Russel entfloh in der Nacht des 5. Februar 1860, wodurch Jacobis in große Verlegenheiten gerieth. Dieser blieb einen Monat in schmählicher Gefangenschaft, mußte ein Lösegeld bezahlen und starb kurz nach seiner Rückkehr nach Massaua infolge der Strapazen. Damit hatte die glänzende französische Intervention ihr Ende.
Der Untergang und Fall Negusi’s selbst war ein höchst tragischer. Als Theodoros Zeit fand, nach Tigrié zurückzukehren, entzog sich Anfangs Negusi durch eine kühn ausgeführte Bewegung seiner Verfolgung; er nahm den Rückzug, weil er wußte, daß seine Soldaten sich nie gegen Theodoros schlagen würden. Im folgenden Jahre, 1861, kam der König abermals über den Takazzié und diesmal erwartete ihn Negusi mit einem an Tüchtigkeit überlegenen Heere; er erklärte als ein guter Ritter auf seinem Rosse siegen oder sterben zu wollen. Aber sein Heer, das fünf Jahre mit ihm gezecht hatte, ließ ihn im Stich. Ein panischer Schrecken ging durch das Lager; Theodor erließ eine Proklamation, worin er jedem Soldaten Pardon anbot. Auf dieses hin zerstreute sich das Heer und Negusi wurde sammt seinem Bruder Tesama auf der Flucht gefangen genommen. Theodoros ließ sie vorführen und beiden die linke Hand und den rechten Fuß abhauen, und um die Schmerzen noch qualvoller zu machen, verbot er, ihren brennenden Durst zu löschen. Tesama starb noch an demselben Tage. Negusi lebte bis zum dritten Tage und man machte seinen Leiden durch einen Lanzenstich ein Ende. Die Kirchen strömten vom Blute der Hingerichteten und als eine Deputation der Geistlichen in Axum vor Theodor erschien, äußerte dieser: „Ich habe einen Bund mit Gott abgeschlossen, er hat versprochen mich auf Erden nicht zu schlagen; ich dagegen habe gelobt, nicht in den Himmel zu steigen und ihn zu bekämpfen!“
Nachfolger Negusi’s als Gegenkönig und Rebell wurde ein gewisser Marit, der jedoch im Oktober 1861 durch den alter ego des Kaisers Theodor, den Detschas Salu von Tigrié gefangen und in Ketten gelegt wurde. Die Waffen erhielten diese Rebellen durch einige Oesterreicher über Aegypten und Massaua.
Doch diese ganze Empörung ist ein gewöhnliches Stück abessinischer Geschichte, wobei nur die dem Negusi zugeschriebene Bedeutung auffällt, während dieses doch nicht der Mann war, um einem Theodor, dessen Namen allein ein [pg 269]Heer in die Flucht jagte, gegenüber gestellt werden zu dürfen. Von großer Wichtigkeit und erheblichen Folgen wurden jedoch einige Episoden dieses Empörungskrieges, der Theodor seiner besten europäischen Freunde beraubte.
Kurz vor dem Emporkommen Theodor’s errichtete die britische Regierung ein Konsulat in Massaua, und um den Verkehr mit Abessinien in regelrechten Gang zu bringen, knüpfte der Konsul Walther Plowden freundschaftliche Beziehungen mit dem mittlerweile ans Ruder gelangten Theodoros an, wodurch er hoch in des neuen Herrschers Gunst stieg. Er begab sich an seinen Hof und trug dazu bei, Theodor’s Vorliebe für europäische Sitten und europäisch aussehende Reformen zu nähren. Auf vielen seiner zahllosen Kriegszüge begleitete ihn der englische Konsul ebenso getreu, wie auf seinen Jagdzügen und bewies sich, sehr verschieden von der reservirten Haltung britischer Diplomaten an anderen Höfen, als der wärmste und thätigste Parteigänger des Königs. Fünf Jahre lang war er der intimste Freund Theodor’s, bis ihn, zum Schmerze des Fürsten, im Beginne des Jahres 1860 die Kugel eines aufständischen Soldaten, der dem Rebellencorps der Gebrüder Garet angehörte, niederstreckte. Noch näher ging dem Könige der Tod des Irländers John Bell, der ein Jägerleben am Blauen Nil geführt und eine schwärmerische Zuneigung zu Theodor gefaßt hatte, sodaß er gleich einem Hunde des Nachts vor dessen Zeltthür schlief. Gern hörte ihn der Fürst über das Finanzwesen und die Regierungsform der verschiedenen europäischen Staaten sprechen, um Lehren für sich daraus zu ziehen. Bell wurde zum Likamankuas, d. h. zum Träger des königlichen Kleides in der Schlacht gemacht, eine Ehre, die nur vier Offizieren widerfährt, die sich ganz wie der König kleiden müssen, damit der Feind den wirklichen König nicht unterscheiden könne. Bei der Verfolgung der Rebellen, welche Plowden ermordet hatten, befand sich auch Bell an der Seite Theodor’s, der die feindlichen Gebrüder Garet in der Nähe von Dobarek, da, wo die Hochebenen von Wogara sich an Semién anschließen, einholte.
Garet, der sich auf keine andere Weise zu retten wußte, rief seinen Bruder und einige Begleiter zu sich und ritt in gestrecktem Galopp auf Theodor zu, der von Bell und einigen Offizieren umgeben, der Truppe vorausgeeilt war. Als Garet sich in Schußweite befand, hielt er an, zielte und feuerte. Der Negus wurde unbedeutend an der Schulter verwundet. In diesem Augenblick gab Bell Feuer und jagte dem verwegenen Garet eine Kugel durch den Kopf, erhielt aber gleichzeitig einen Lanzenstich durch die Lunge, infolge dessen er todt zusammenbrach. Nun gab auch Theodor Feuer und streckte den jüngeren Garet nieder. Die Wuth und der Schmerz des Königs über den Verlust seines getreuen Dieners überstieg alle Grenzen und Garet’s ganzes gegen 1700 Mann starkes Corps, das sofort die Waffen streckte, wurde enthauptet. Der Reisende, der heute über die Ebene von Wogara bei Dobarek zieht, sieht dort das Feld noch weit und breit mit Menschengebeinen übersät, den Zeugnissen der schauderhaften Rache, welche Theodor an den Mördern seines Lieblings genommen (vergl. oben S. 203). Und doch war dieser Akt noch weit weniger grausam, als [pg 270]die früher übliche Bestrafung der Kriegsgefangenen, die man entmannte. Hochverräther wurden nach Isenberg’s Zeugniß früher öffentlich bei lebendem Leibe geschunden, das Fleisch dann in kleine Stücken zerhackt und den Hunden vorgeworfen; die Haut aber gerbte man und machte Trommelfelle daraus. Alle diese barbarischen Strafen schaffte Theodoros Anfangs ab, aber die fortwährenden Unruhen zwangen ihn, später wieder darauf zurückzukommen, und das Blut floß auch unter Theodor in Strömen.
Die inneren Feinde waren so allmälig niedergeworfen, dafür trat jedoch von außen ein weit mächtigerer Widersacher, England, auf. Ehe wir jedoch hierzu übergehen, ist es nothwendig, noch einen Blick auf Charakter und Persönlichkeit, wie auf die reformatorischen Bestrebungen des Negus zu werfen, der jedenfalls ein ganz bedeutender Mensch in seiner Weise war, eine seltene und großartige Erscheinung in Abessinien, die allerdings mit europäischem Maßstabe nicht gemessen werden darf.
„Theodoros“, so schrieb 1862 Lejean, „mag etwa 46 Jahre alt sein. Er ist von mittlerem Wuchs und wohlgestaltet, hat einen offenen sympathischen Gesichtsausdruck, gut entwickelte Stirn, kleine, lebhafte Augen und eine fast schwarze Gesichtsfarbe. Nase und Kinn erinnern an den jüdischen Typus. Er ist aus Koara gebürtig und ich halte ihn für einen Agow oder Gamanten; für einen Aethiopier von reinem Blute ist Theodoros zu dunkelfarbig. Seine äußere Erscheinung imponirt, sie zeigt, daß er in der That ein Mann von großer geistiger Regsamkeit und unermüdlicher Kraftentwicklung ist, und er bildet sich auch hierauf etwas ein. Er vertreibt sich gern die Zeit damit, an steilen Hügeln herab- und heraufzuklimmen und dann erfordert die Etikette, daß seine Umgebung ein Gleiches thue. Auf dem Pferde bewegt er sich wie ein argentinischer Gaucho und seine Rosse zittern buchstäblich, wenn sie ihn kommen sehen. Sein Kriegsruf ist wie bei allen abessinischen Häuptlingen: Abba Senghia, d. h. Vater der Pferde. Für gewöhnlich trägt er sich höchst nachlässig; als tüchtiger Soldat verachtet er ein geschniegeltes Wesen, kleidet sich wie ein gewöhnlicher Offizier, Kopf und Füße sind unbedeckt. Aber auf einen Schmuck der Krieger legt er Werth; er läßt das Haar in drei lange Flechten legen, welche auf die Schulter herabfallen, und trägt ein weißes Stirnband.“ Ausgenommen seine erste Frau, Tsubedsche, hat nie ein Weib Einfluß auf sein Leben gehabt. Diese aber, die Tochter seines Widersachers Ras Ali, liebte er leidenschaftlich, und als er sie im Jahre 1858 verlor, war er kaum zu trösten. Ganz anders ging es seiner zweiten Frau, Toronesch, einer Tochter Ubié’s, die er geheirathet, um sich mit der Familie dieses einst mächtigen Fürsten auszusöhnen. Er verstieß sie einmal, und Bell, der interveniren wollte, um Skandal zu verhüten, erhielt eine gehörige Ohrfeige. Der Fortbestand seiner Dynastie lag dem König Theodoros nicht minder am Herzen als einem europäischen Fürsten, und er behauptete, daß wenigstens einer seiner Söhne ans Ruder kommen müsse, „denn die Propheten hätten nicht gelogen“. Sein älterer Sohn, von der Tsubedsche, war ein durchaus verkommener, mißrathener Mensch, den der Vater eines [pg 271]schönen Tages in einen Eselstall sperren ließ, damit er dort „en famille“ sei. Der zweite jedoch, Detschas Maschescha, wurde 1862 zum Gouverneur von Dembea ernannt, wo er sich durch sein mildes Wesen so beliebt machte, daß Theodor es für gerathen hielt, ihn abzuberufen. „Was soll dies Buhlen um die Volksgunst? fragte er ihn. Willst du die Rolle des Absalon spielen und den Vater vom Throne verdrängen?“
Das Auftreten Theodor’s war meist theatralisch oder, wie die Abessinier sagen, fakerer, d. h. ruhmredig. Gesten und Stimme waren berechnet und Niemand wußte besser als er den Präsidentensitz bei einer Versammlung auszufüllen. Seine brillante Beredtsamkeit verfehlte selten ihr Ziel und seine Briefe sind Muster der amharischen Sprache. Die halb klösterliche Erziehung, die er in Tschankar erhalten, hatte noch Spuren hinterlassen, und so galt der König für einen sehr gebildeten Mann. Er war in der Nationalliteratur bewandert und kannte die europäischen Zustände. Als Probe seines Stils möge folgende von ihm eigenhändig niedergeschriebene Proklamation gelten: „Von Menilek bis auf die jüngste Zeit herab sind alle Negus dieses Landes nur Histrionen gewesen, welche Gott weder um Geist noch um Beistand baten, das Reich wieder aufzurichten. Als Gott mich, seinen Diener, zum Könige erwählte, sagten meine Landsleute: Der Fluß ist ausgetrocknet, es giebt kein Wasser mehr in seinem Bett. Und sie beleidigten mich, weil meine Mutter arm war und nannten mich ein Bettlerkind. Aber den Ruhm meines Vaters, den kennen die Türken, da er sie von den Landesgrenzen bis in ihre Städte zurückgejagt. Mein Vater und meine Mutter stammen von David und Salomo, ja von Abraham, dem Knechte Gottes, ab. Diejenigen aber, welche mich Bettlerkind schimpften, sie betteln heute selbst um ihr tägliches Brot. Ohne den Willen Gottes können weder Kraft noch Weisheit vor dem Untergange schützen. Viele Große dieser Erde haben Bomben und Kanonen im Ueberflusse und sind doch unterlegen. Napoleon hatte tausende und er ist besiegt worden. Nikolaus, der Negus der Moskowiter, ist von Franzosen und Türken besiegt worden; er starb, ohne daß seines Herzens Wunsch in Erfüllung ging.“
Von der europäischen Civilisation hatte Theodor eine hohe Meinung, von der Moral der Europäer jedoch nur eine sehr geringe, was auch nicht gut anders der Fall sein konnte, da die meisten Europäer, mit denen er zu verkehren hatte, verdorbenes, hochmüthiges Gesindel waren. So wild der König auch im Kriege war, an sanfteren Regungen fehlte es ihm keineswegs. Er nahm sich der Waisen an, sorgte für sie durchs ganze Leben, verheirathete sie und ließ sie niemals aus dem Auge. Er liebte die Kinder außerordentlich und kehrte sich, wie er sagte, von den falschen Höflingen ab, um sich an der Unschuld jener zu weiden. Dabei war er freigebig im höchsten Grade, großmüthig und gerecht, aber auch unerbittlich streng, wo es darauf ankam. „Ich selbst war Zeuge,“ schreibt Krapf 1856, „wie schon Nachts 2 Uhr Scharen von Beschwerde führenden Leuten aus allen Theilen Abessiniens das königliche Lager umstanden und Dschan hoi! (o Majestät) riefen. Ich glaube kein König in der Welt thut es [pg 272]ihm in dieser Beziehung gleich, und mußte mich nur wundern, wenn er es bei einer solchen angestrengten Thätigkeit bei Tag und Nacht, in Sachen des Kriegs sowol, wie des Friedens aushalten kann. Die Abessinier haben ihn aber auch bereits so lieb, daß sie ihn mit dem König David im alten Bunde vergleichen, und sie glauben, daß die alte Weissagung, wonach ein König Theodorus kommen und Abessinien groß und glücklich machen, auch Mekka und Medina zerstören werde, sich zu erfüllen anfange.“
Obgleich der Negus sein eigenes Volk verachtete und dessen Fehler recht wohl kannte, so hat er nichtsdestoweniger redlich an der Verbesserung der Lage desselben zu arbeiten versucht und, soweit den eingewurzelten Mißbräuchen gegenüber seine Kraft reichte, eine reformatorische Thätigkeit entwickelt, die allerdings durch die fortdauernden Rebellionen auf große Hindernisse stoßen mußte. Durch die lange Anarchie waren alle Gesetze nur todte Buchstaben geworden und die Kirche in die größten Mißbräuche gerathen. Alle üblen Folgen der todten Hand lasteten auf den Bauern und Besitzern der Kirchengüter. Gegen diese Mißbräuche trat nun Theodor mit eisernem Willen auf; er erklärte die todte Hand als ein nationales Uebel und annektirte alle Kirchengüter der Krone, indem er der Geistlichkeit ein gewisses Einkommen und den Klöstern genug Land ließ, um sich zu ernähren. Auf die Einheit der Kirche hielt er dabei große Stücke; doch war er Fanatiker und befahl allen Muhamedanern in seinem Reiche, binnen zwei Jahren Christen zu werden. Mit den Missionären, protestantischen wie katholischen, die sich doch in die politischen Verhältnisse mischten, wollte er nichts zu thun haben – er untersagte ihnen jegliche Thätigkeit. Den Handel zu heben, hatte Theodor gleich nach seinem Regierungsantritte alle die unzähligen Zollstätten von Gondar bis nach Halai aufgehoben, zwei Plätze ausgenommen. Auch der Sklavenhandel und die Vielweiberei wurden verboten, freilich ohne großen praktischen Erfolg. Sein Hauptplan war aber immer, das große äthiopische Reich phönixartig aus der modernden Asche wieder erstehen zu lassen. Hierzu brauchte er die Hülfe der Europäer, und darum verlangte er nach jenen Handwerkern, die ihm auch durch Krapf’s Vermittlung zugeschickt wurden. Jedenfalls war überall ein Fortschritt, auch in der Justiz zu erkennen, sodaß 1862 Heuglin aus Abessinien in die Heimat schreiben konnte:
„Die Zustände in Abessinien im Allgemeinen lassen Manches zu wünschen übrig. Der König stößt auf tausend Schwierigkeiten bei Einführung seiner Reformen und muß mit eiserner Strenge verfahren, um nur einigermaßen Ordnung erhalten zu können, doch ist trotzdem, daß ihm seine Kriegszüge keine Zeit lassen, viel für Administration zu thun, auch manches sehr Erfreuliche hier geschehen. Namentlich ist für bessere Kommunikation wirklich mit Erfolg an Straßenbauten gearbeitet und dem Schreiber- und Pfaffenunwesen mit einer Kraft Einhalt gethan worden, an der sich mancher andere Herrscher ein Exempel nehmen dürfte.“
Soviel wie Theodor hatte vor ihm kein abessinischer Herrscher für Land und Volk gethan, keiner war aber auch mit so außerordentlichen Gaben des [pg 273]Geistes ausgerüstet, wie dieser bedeutende Mann, an dem andererseits Jähzorn und Trunksucht sehr zu beklagen sind, da beide ihn oft zu gewaltsamen, unüberlegten Handlungen hinrissen. Wild und grausam blieb er auch in seinem Lager- und Kriegsleben, das wir am besten kennen lernen, wenn wir mit dem deutschen Reisenden Steudner, dem Begleiter Heuglin’s, einen Besuch im Lager des Königs abstatten, der sich auf einem Feldzuge gegen die Galla im Lande jenseit des hohen Kollogebirges befand.
Spät am Abend des 4. April 1862 erschien ein Bote bei Herrn von Heuglin, um diesen einzuladen, beim Könige zu erscheinen. Der Geladene warf sich in eine große Uniform und wanderte, von Steudner begleitet, unter Fackelschein über Sturzäcker zu dem kaiserlichen Zelte. In dem mit Wachen umstellten engeren Lagerbezirke wurden die Reisenden aufgehalten, da im Zelte des Negus erst eine längere Berathung darüber stattfand, ob Heuglin auch mit dem Säbel an der Seite eintreten dürfe. Nachdem dies bewilligt war, wurden die Fremden feierlich in das Zelt eingeführt, in welchem sie Seine schwärzliche Majestät mit halb untergeschlagenen Beinen auf einem alten auf der Erde ausgebreiteten Teppich sitzend fanden; neben ihm kauerte sein Beichtvater, der Etschegé. Se. Majestät trug ein weißes abessinisches Gewand, dem man die Spuren langen Lagerlebens deutlich ansah; er grüßte sehr artig, besonders Herrn von Heuglin, fand es jedoch nicht für nöthig, sich zu erheben; dann lud er die Gäste ein, neben ihm Platz zu nehmen. Das Zelt war von großen Würdenträgern und Eunuchen überfüllt; zur Linken des Königs saß dessen Sohn Maschescha, und der Sohn des gestürzten Königs von Schoa, der zugleich mit Maschescha erzogen wurde, der zweite Ras des Landes, Ras Engeda, und der Lagerkommandant Bascha Negusi. Vor ihnen stand ein mit rothem Tuch bedeckter Meseb oder Eßkorb, aus welchem sie mit unvergleichlichem Appetite die Fastenspeise verzehrten. Se. Majestät ließ durch seinen Af sich erkundigen, was die Reisenden essen wollten, Brundo (rohes Fleisch), Teps (halbgeröstetes) oder Fastenspeise. Der Af, d. h. der Mund, ist eine vertraute Person des Königs, zu welcher dieser spricht, um die Worte den Fremden zu wiederholen, selbst wenn derjenige, an den sie gerichtet sind, sie vernimmt. Man stellte es der Weisheit Theodor’s anheim, mit was er seine Gäste bedienen wolle, und auf ein Zeichen erschien ein Meseb mit schönem Tiéfbrot gefüllt, um den die beiden Europäer sich lagerten, während zwei hohe Würdenträger beordert wurden, sie zu füttern, d. h. abgerissene Stücke Tiéfbrot in die rothe Pfeffersauce zu tauchen und ihnen diese in den Mund zu praktiziren. Die Leute entledigten sich dieser Pflicht in höchst liebenswürdiger Weise, indem sie möglichst große Brotballen mit möglichst viel brennender rother Pfeffersauce den Gästen in den Mund steckten, welche das abessinische Gericht krampfhaft hinabwürgten. Nach der Mahlzeit bediente sich Se. Maj. nicht mehr des Af, sondern wandte sich unmittelbar an die Fremden und zwar in arabischer Sprache. Während der Unterhaltung wurde Honigwein in schönen Punschgläsern aus einer Bowle servirt, die vom Gouverneur von Indien geschenkt war.
[pg 274]Theodor war damals sehr mit Regierungsgeschäften überhäuft und ließ sich mehrmals entschuldigen, daß er die Reisenden nicht gleich offiziell empfangen könne. Schon vor Sonnenaufgang begann vor dem königlichen Zelte das Dschan-hoi-Geschrei derjenigen, die Streitsachen vortragen und Gerechtigkeit erflehen wollten. Hierauf folgten von Sonnenaufgang an die Gerichtssitzungen, wobei das klatschende Geräusch der großen Knuten und Stöcke das Ergebniß verkündigte, welches nicht selten in die frische Morgenluft hinein hallte. Mehre Tage hindurch war der Negus damit beschäftigt, die im Lager mitgeführten Herden zu zählen. Nachdem dieses königliche Geschäft, wobei 20,000 Rinder die Revue binnen zwei Tagen passirten, vollendet war, erhielten die beiden Reisenden eine feierliche Audienz zur Uebergabe der mitgebrachten Geschenke. Der Negus empfing sie am Abhange eines Hügels, welcher das Centrum des Lagers bildete. Er saß auf einer Alga, die mit einem prachtvollen, sehr großen Kaschmir bedeckt war; darüber lag noch ein mit indischer Goldstickerei überladener Teppich ausgebreitet. Auf der Sonnenseite, sowie hinter dem Könige standen zwei Schirmträger, welche beide ungeheuer große bunte Schirme auf 10 Fuß hohen Stäben über dem Haupte des Erlauchten hielten. Der Negus selbst war in einen sehr feinen Margef gehüllt und lehnte nachlässig auf der Alga, vor welcher für die beiden Europäer gute Teppiche zum Niedersitzen ausgebreitet waren. Diese befanden sich allein mit dem Fürsten und seinen schirmtragenden Kammerherren, während im Umkreise von 30 Schritt Halbmesser andere dienstthuende Hofchargen standen, z. B. die Peitschenträger mit langen Stöcken in der Hand, um das neugierige Publikum abzuhalten.
Nachdem Se. Maj. sehr bereitwillig Erlaubniß zur Ueberreichung der Geschenke ertheilt, wurden die Diener der beiden Reisenden herangerufen, die mit gänzlich entblößtem Oberkörper, die Gewänder um den Leib gegürtet, mit den Gegenständen erschienen. Jedes einzelne Stück mußte dem Negus gezeigt und dann vor ihm auf den Boden niedergelegt werden. Die Geschenke bestanden aus mehreren Sammetteppichen, einem Revolvergewehr, einem sehr schönen Revolver nach abessinischem Geschmack mit recht großem Kaliber, zwei sehr guten langen gezogenen Pistolen, welche man mit angeschraubtem Kolben auch als Pürschbüchsen benutzen konnte, einem Hirschfänger mit vergoldetem und einem andern mit silbernem Griffe, einigen schön gearbeiteten Dolchen mit vergoldeten Scheiden u. s. w. Se. Maj. geruhten hierauf sich dankend über die Geschenke auszusprechen. Im Laufe der Unterhaltung sprach er seine Verwunderung darüber aus, daß die Türkei bisher noch nicht von den christlichen Mächten erobert sei, ja daß einige derselben sie sogar gegen eine andere christliche Macht geschützt hätten, wobei er bemerkte: „ein Reich, das sich nicht selbst regieren könne, habe keinen Anspruch darauf, selbständig zu existiren“. Uebrigens erschien der König sehr ermüdet, war es doch der dritte Tag, an welchem er sich mit dem anstrengenden Rinderzählen beschäftigt hatte, kein Wunder also, daß seine Nerven angegriffen waren. Abgesehen von dieser Mattigkeit erschien König Theodor, ein Mann von etwa 40 Jahren, kräftig, schlank, wenn auch nicht groß. Seine [pg 275]Gesichtszüge waren frei; in der Tracht unterschied er sich kaum von seinen Unterthanen; wie diese ging er barhaupt und barfuß in dieselbe Schama gekleidet. Das Haar trug er als Krieger in mehrere, dicht am Kopfe anliegende Zöpfe geflochten.
So war der Mann beschaffen, der als Mittelpunkt des ganzen Lagers dastand, welches sehr leicht aufgeschlagen wird. Will der Negus, der stets an der Spitze seines Heeres marschirt, Halt machen, so läßt er an einem passenden Platze ein kleines scharlachrothes Zelt aufstellen, welches dann als Mittelpunkt für das ganze Lager dient. Dicht vor diesem, auf dem höchsten Punkte wird das Kirchenzelt, welches niemals fehlen darf, errichtet. In einiger Entfernung von diesem und stets – angeblich aus Demuth – tiefer stehend, wird das sehr große, aus dickem dunkelbraunem Mack bestehende Zelt des Negus aufgebaut; zu beiden Seiten desselben standen zwei ähnliche für die beiden Königinnen; auf dem linken Flügel dann ein sehr großes Zelt für den königlichen Marstall und die vier zahmen Löwen, diesem entsprechend auf dem rechten Flügel gleichfalls ein großes Zelt für die königliche Küche, dann das Zelt des Abuna Salama, durch eine stets vor der Zeltthür errichtete Windwand kenntlich. Die Zelte der Anführer sind aus weißem Baumwollenstoff in verschiedenen Formen gearbeitet; um diese herum bildet sich ein weiter Kreis kleiner Hütten, Gotscho, in welchen die Leute eng zusammengepreßt liegen, um sich gegenseitig zu erwärmen. Eine bestimmte und sehr praktische Form haben die Zelte der Schoaner; sie sind aus starkem braunem Mack gefertigt, haben ein Rechteck zur Basis und zwei Zeltstangen halten das Ganze an den beiden schmalen Ecken, während kurze Schlingen am unteren Rande des Zeltes dazu dienen, die Pflöcke einzuschlagen. Auf diese Weise halten sie sich sehr gut, ohne daß sie die wegen der vielen herumlaufenden Thiere höchst unangenehmen Zeltstricke nöthig haben; auch im Innern bieten sie vielen Raum. Ueberall vor den Zelten lodern Feuer, an denen die Frauen der Soldaten beschäftigt sind, für diese Tiéfbrote oder rothe Pfefferbrühe zu kochen; zu anderen Zeiten sieht man die Zeltstricke dicht mit großen Mengen in lange dünne Streifen geschnittenen Fleisches behangen, welches an der Luft und der Sonne trocknen soll. Reihen von Mägden und Dienern durchziehen von der königlichen Küche aus nach allen Richtungen das Lager, um große, mit rothem Tuch überdeckte Meseb oder Körbe voller Tiéfbrot und mächtige Krüge voll Honigwein nach den verschiedenen Zelten der Großen zu bringen, die aus den königlichen Vorräthen mit Trank und Speise versehen werden.
Noch bunter und lebendiger gestaltet sich das Bild, wenn das Lager aufbricht. Zunächst werden die kleinen Gras- und Reisighütten (Gotscho) niedergebrannt, und hoch zum Himmel auf strebt der Rauch, die Stätte des abgebrochenen Lagers bezeichnend. In den meisten Fällen führt der Negus, von Kavallerie umgeben, den Zug an, dem in mehreren Heersäulen das Gros der Armee folgt. Lange Reihen von schwer beladenen Pferden, Maulthieren und Eseln, die in dem futterarmen Hochlande Tag und Nacht der Kälte und Nässe ausgesetzt sind, ziehen, zu Skeletten abgemagert, dahin. Ohne die geringste Ordnung schreiten [pg 276]Leute einher, die vorsichtigerweise während des Tagemarsches eine Last Holz mitschleppen, um sich damit am Abend ein wärmendes Feuer machen zu können; ihnen folgen Krieger in der einst weißen, jetzt schmuzigen Schama mit rothem Randstreifen und umwickelt mit dem dicken abessinischen Leibgurt, in welchem der Schotel, d. h. der große krumme abessinische Säbel mit Nashorngriff in rother Scheide steckt; in der Hand führen sie die scharfgeschliffene Lanze oder ein Luntenflintengewehr mit viereckigem Kolben. Dann ziehen munter plaudernd, an dem Kochlöffel erkenntlich, mit dem flachen Gilgit oder Proviantkorbe auf dem Rücken, die Köchinnen, echte Löffelgarde, einher. Die königlichen Küchendamen sind an dem Messingknopfe kenntlich, der auf dem Kopfwirbel in das Haar mit eingeflochten ist. Neben ihnen traben Esel, unter der Last von Grasbündeln völlig begraben. An jedes der langen Ohren dieser philosophischen Geschöpfe ist eine Ziege oder ein Schaf vorgespannt, damit das interessante Kleeblatt beisammen bleibe.
Von einer Anzahl Pfaffen mit großen Turbanen umgeben, reitet auf schönem Maulthiere im violetten Gewande der höchste Kirchenfürst, Abuna Abba Salama auch im Zuge mit. Neben ihm und seiner wohlgenährten in Gott vergnügten Schar schleppt sich mühsam auf skelettartig abgemagertem Maulthiere ein früherer Häuptling hin, dem mit oder ohne Ursache eine Hand und ein Fuß abgehauen ist. Er hat den Stumpf seines Fußes in ein Trinkgefäß aus Horn gesteckt, den verstümmelten unbrauchbaren Arm trägt er im faltigen Gewande verborgen. Dann folgen Gefangene in schweren Ketten, jeder mit seinem Führer zusammengeschlossen, den der Unglückliche noch für diese Gefälligkeit ernähren und bezahlen muß. Viele dieser Gefangenen tragen, um das Entweichen zu verhindern, den fünf bis sieben Fuß langen Monkos am Halse, dessen dicke Gabel durch ein Querholz geschlossen ist und der dem Gefangenen selbst beim Schlafen nicht abgenommen wird. Kaum ein Lumpen deckt diese Unglücklichen. Nicht weit von ihnen trifft der Blick wieder auf ein anderes Bild, und zwar auf ein heiliges, das mit allem Aufwande von abessinischem Prunk angezogen kommt. Es ist der Etschegé, das Oberhaupt der Mönche, zugleich Beichtvater des Königs, dem er als steter Begleiter und Rathgeber allüberall hinfolgt. Er reitet ein prachtvolles Maulthier und schützt sein theures, mit einem ungeheuren weißen Turban umhülltes Haupt durch einen großen buntseidenen Regenschirm, dessen abwechselnd goldgelbe und violette Fächerfelder weithin sichtbar sind. Ihm folgt eine große Anzahl schmuziger Mönche in einstens weiß gewesene Gewänder gehüllt oder in gelbes Leder gekleidet; alle tragen das Zeichen ihres Standes, den Fliegenwedel oder Kuhschwanz. Unter ihren weißen oder gelben Kappen erblickt man die niederträchtigsten Gaunerphysiognomien, sowie die ausdrucklosesten Gesichter, die Abessinien erzeugen kann. Plötzlich scheut das Maulthier des Etschegé und springt zur Seite: es ist ein aller Kleider beraubter Todter, der, auf der Straße liegend, das Thier beunruhigt. Dem Etschegé mit seinen frommen Begleitern folgt eine Reihe Tabots, für deren wunderthätigsten ein mit rothen Lappen und Lumpen bedeckter Armsessel aus lackirtem, mit bunten Blumen bemaltem Holz bestimmt ist. [pg 277]Diese Tabots, deren oft zehn oder zwanzig aufeinander folgen, sind Holztafeln mit den zehn Geboten oder frommen Sprüchen beschrieben. Jede dieser Platten ist sorgfältig mit rothem Baumwollstoff bedeckt und alle werden in einer langen Reihe hintereinander getragen. Dem ganzen kirchlichen Prachtzuge geht ein schmuziger Mönch voran, welcher fortwährend eine Glocke schwingt, damit Jeder, der da sitzen sollte, vor den Heiligthümern aufstehe und ihnen seine Ehrfurcht bezeuge.

Im vollen Galopp auf guten Maulthieren, die mit klingelnden Glöckchen behängt sind, kommt ein Trupp Schoaner angesprengt; es sind lauter kräftige Gestalten, in dunkelbraunen Mack gekleidet, mit dem kurzen, stark gekrümmten Messer im dicken, die Brust bedeckenden Gürtel und mit der schön gearbeiteten Lanze auf der Schulter. Wieder andere Bilder! Hier Lastthiere, schwer bepackt mit Lederschläuchen; dort Weiber, die das Doppelte ihres eigenen Volumens an leeren oder gefüllten Kürbisschalen (Gerra) schleppen, welche zum Transport von Butter, Honig, rothem Pfeffer u. s. w. dienen. Alle schreien und schwatzen, dazwischen klappern die vielen getrockneten Kürbisschalen. Keiner dieser Schönen fehlt indessen das nöthige hölzerne Kopfkissen in der Form eines fünf bis sechs Zoll hohen Leuchters mit einem ausgehöhlten Holzbügel zum Hineinlegen des Nackens beim Schlafen. Der Fuß dieses Instrumentes ist oft hübsch gedrechselt.
Neben dieser bunten Gesellschaft reitet eine der zwei Königinnen, denn zu jener Zeit hatte der christliche Monarch zwei Damen zu Ehegemahlinnen. Die eine rechtmäßig mit dem Negus verbundene war die schon erwähnte Tochter des entthronten Detschasmatsch Ubié von Tigrié; die zweite ein Fräulein aus dem Jedschu-Galla-Lande. Beide jedoch sind gleich gekleidet in blaue Mäntel, die mit Gold- und Silberglöckchen behangen sind. Beide haben, wie alle großen Damen, ihr Gesicht verhüllt, nur die schwarzen Augensterne funkeln und leuchten bei beiden gleichmäßig aus der weißen Umhüllung. Das einzige Unterscheidungszeichen zwischen beiden war nur stets ein in Silber gestickter türkischer Halbmond mit daranstehendem Venusgestirn, das auf dem Gewande der einen Königin auf dem untersten Theile ihres Rückens erglänzte. Diese jetzt die schlanken Formen zweier Königinnen umhüllenden Mäntel waren wol einst Schabracken eines ägyptischen Marstalls gewesen. Beide Majestäten sind von einigen Bewaffneten und Eunuchen begleitet und reiten stets in der Entfernung einer halben Stunde voneinander, um etwa möglichen Konflikten vorzubeugen, sowie sie auch zwei gänzlich getrennte Hofhaltungen in zwei verschiedenen Zelten zu beiden Seiten des königlichen Zeltes haben.
Oft sitzt oder liegt mitten in dem durch die Hufe der zahlreichen Thiere aufgewühlten Schmuze ein nur wenige Monate oder ein bis zwei Jahre altes Kind schreiend im Wege, jeden Augenblick in Gefahr, durch Reit- oder Lastthiere zertreten zu werden, die sich oft dicht zusammendrängen, um einer Leiche aus dem Wege zu gehen. Todte Thiere, halbverweste Pferde, Maulthiere, Esel, Schafe und Ziegen bezeichnen zu tausenden die Straße, welche das Heer zieht. Dort wird ein Kranker getragen, es muß ein Vornehmer sein, denn man trägt [pg 278]ihn behutsam auf bequemer Tragbahre, über welcher aus weißer Schama ein leichtes Zelt errichtet ist; wäre es nur ein armer Mann, so hätte man ihn einfach auf zwei lange Holzstücke gebunden.
Nahe bei dem Kranken sehen wir einen anderen Zug: eine ganz weiß gekleidete Dame, die Frau eines Großen, reitet dicht verhüllt dahin; ihr Maulthier wird sorglich von einem Diener geführt. Gestern erst hat sie die Welt mit einem neuen Bürger beschenkt, der schreiend und quiekend in einem weiß bedeckten Brotkorbe von einem Diener auf dem Kopfe nachgetragen wird. Der kaum einige Tage ältere Sprößling einer anderen Frau giebt ebenfalls durch Schreien Zeichen einer gesunden, kräftigen Lunge, sein Lager aber ist nicht so sorgsam gegen Sonne und Kälte geschützt. Mit Riemen ist er völlig nackt zwischen Körbe und Kürbisflaschen auf den Rücken oder die Hüfte seiner schwer tragenden Mutter geschnürt oder auf das Gepäck eines magern Pferdes gebunden. Kleine Kinder von drei bis fünf Jahren, völlig nackt oder nur mit einem Stückchen Schaf- oder Ziegenfell über den Schultern, laufen neben ihren schwer bepackten Müttern, ja sie tragen selbst einen Theil von den Kürbisflaschen, Eisenblechen zum Brotbacken, hölzernen Schüsseln zum Anrühren des Brotteiges u. s. w. Andere Weiber rauchen gemüthlich aus einer großen Tabakspfeife, deren Abguß aus einem kleinen wassergefüllten Kürbis besteht; neben ihnen schleppen sich einige unbepackte Maulthiere hin, deren aufgedrückter Rücken eine einzige Wundfläche bildet. Am Wege sitzt ein Künstler von Fach auf einem Bunde Stroh, aus welchem er sich am Abend einen Gotscho zu bauen gedenkt, und singt zu dem eintönigen Geklimper seiner Kirra, der abessinischen Lyra, mit scharfer näselnder Stimme, packt dann Stroh und Lyra auf den Kopf und wandelt als zweiter Apollo seinen kothigen Weg. Zwischen diesen Scharen bepackter Menschen und Thiere ziehen brüllend Herden schöner Rinder, Schafe und Ziegen; auch bricht, Geschrei und Unordnung verursachend, gelegentlich ein kräftiger Stier durch die Massen.
Die vier zahmen Löwen des Negus (vergl. S. 187), schöne, große Thiere, laufen völlig frei mitten im Troß, ohne auch nur am Stricke geführt zu werden. Steudner bemerkte zu seinem Erstaunen, daß in unmittelbarer Nähe der Löwen das Vieh, Kühe, Schafe, Ziegen, Maulthiere, ruhig graste, ohne die geringste Furcht vor dem Könige der Wildniß zu haben. Wie Hunde liefen sie mitten im Gewühl und gehorchten der Stimme ihres Begleiters, hinter welchem sie oft in geschlossener Phalanx dicht auf den Fersen hermarschirten.
Mitten zwischen dem Troß reitet ein Großer des Landes stolz durch all das Gedränge. Vor ihm her schreitet sein Speerträger, ein Diener mit langer, haarscharfspitziger Lanze, deren von Schoanern gearbeitete Eisenspitze in rothledernem Futteral geborgen ist. Sein mit Gold und Silber beschlagenes Büffelhautschild, sein Gewehr und seinen in rothlederner Scheide steckenden Säbel mit Rhinozerosgriff tragen andere Diener vor und neben ihm. Vor ihm führt sein Lieblingsknappe ein Staatsmaulthier, auf welchem der gleich dem Schilde mit Gold- und Silberplatten und Filigranarbeit bedeckte Staatssattel liegt. Wie der Sattel ist auch das übrige Geschirr und Zaumzeug des Maulthiers mit Gold und Silber [pg 279]überladen. All dieser Schmuck aber ist mit rothen Lumpen bedeckt. Unbekümmert reitet der Häuptling barhaupt durch das Troßgedränge an den Leichen von Menschen und Thieren oder verwüsteten Saatfeldern vorüber. Seine Thiere sind gegen den „bösen Blick“ durch Dutzende um den Hals hängender Amulete geschützt. Männer mit aus Stroh geflochtenen Regendächern aus Begemeder, Sklaven, die oft nur die Schultern mit einem kleinen ungegerbten Schaffell bedeckt haben, gehen ihm demüthig aus dem Wege, wenn er, mit dem Sonnenschirme das Haupt schützend, stolz dahinreitet. Nicht weit von ihm zieht eine andere Gruppe schwer bepackter Männer. Landleute, zu diesem Frohndienste gepreßt, tragen den in seine Theile zerlegten Erntewagen, welchen die Missionäre in Gafat gebaut – weil der Weg zum Fahren nicht geeignet ist. Andere schleppen die Laffeten schwerer Geschütze und die dazu gehörigen Vollkugeln – allein die Geschützrohre hat man in Magdala gelassen! Soldaten, mit den Sätteln ihrer gefallenen Pferde auf dem Kopfe, mit Speer und Sonnenschirm in der Hand, hoffen bei der nächsten Plünderung eines Dorfes neue Thiere zu ihren Sätteln zu bekommen. Das Wiehern der Pferde, das Geschrei und Gebrüll der übrigen Thiere [pg 280]wird nur manchmal von der dröhnenden, donnerähnlichen Baßstimme des einen oder andern Löwen unterbrochen.
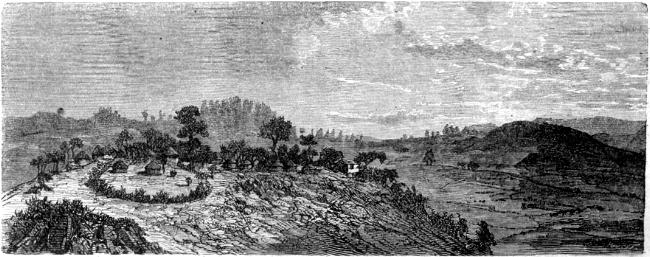
So wechseln die bunten Bilder, die ein abessinischer Heereszug dicht nebeneinander gedrängt erkennen läßt – Bilder zum Weinen und Bilder zum Lachen. Neben dem Kirraspieler, der lustige Weisen singt, sehen wir den Tod: zahlreiche Leichen, aufgedunsen und von Raubthieren angefressen, Sterbende und von Müttern verlassene Kinder – neben fröhlich lachenden, aber gefühllos vorüberziehenden Menschen.
In jene Zeit, als Theodor so verwüstend, Tod und Verderben verbreitend mit seinem Heere durch das Land zog, fällt auch der Beginn jener Mißhelligkeiten, die schließlich zum Kriege mit England führten. Wer sich auf einen vorurtheilsfreien Standpunkt stellt und nicht durch die trübe, befangene Brille anmaßender Judenmissionäre schaut, dem wird in diesem Falle das Auftreten des Königs von Abessinien nicht so gar schrecklich erscheinen, zumal wenn man – was ungerecht wäre – diesen nicht mit europäischem Maßstabe mißt.
Die deutschen Handwerker und Missionäre (vergl. S. 136) fingen an, im Lande Straßen zu bauen; sie besorgten die Reparaturen des königlichen Zeughausmaterials, fertigten Mörser und konstruirten einen Wagen. Letztere beiden Gegenstände machten dem Könige viel Spaß, namentlich der blau angestrichene Wagen, der, in Stücke zerlegt, auf den Schultern von Lastträgern weiter transportirt werden mußte, da es an einer fahrbaren Straße fehlte. Reibereien und Zerwürfnisse mit den Distriktsbeamten hatten zur Folge, daß die Handwerker 1861 in Gafat, drei Viertelstunden von Debra Tabor auf einem isolirten Hügel, unter Aufsicht eines Offiziers internirt wurden. Der König berief einen oder den andern an sein Hoflager und behandelte sie nach wie vor gut. Sie erhielten Ackerland und vom Gouverneur in Debra Tabor Getreide, Vieh, Honig. „Diese Europäer“, schreibt v. Heuglin, „wollen sich in manchen Verhältnissen über gewisse Formen und Landessitten wegsetzen, was zu vielen Unannehmlichkeiten Anlaß gegeben hat.“ Daß man aber dergleichen in Abessinien so wenig duldet, wie in Europa, ist vollkommen in der Ordnung. Noch mehr Anlaß zur Unzufriedenheit gaben die beiden zum Protestantismus übergetretenen Juden Heinrich Stern und Rosenthal. Beide waren nur unter der Bedingung zugelassen worden, sich mit der Bekehrung der Falaschas abgeben zu wollen, allein sie begannen amharische Bibeln unter den Christen zu vertheilen und diese zum Abfall von der abessinischen Kirche aufzufordern. Wüthend hierüber ließ der Negus Stern vor sich schleppen, der sich in ziemlich freier Weise vertheidigte und dabei nachdenklich in den Daumen biß. Diese unschuldige Geste bedeutet jedoch in Abessinien, daß man ewige Rache gegen die Person schwört, in deren Gegenwart man sich befindet. Anfangs fiel dies dem Könige nicht auf, als aber Stern, um sich über eine Mißhandlung zu beklagen, aufs neue zum Negus kam, die Wachen mit einem Revolver bedrohend bei Seite schob und den Herrscher aus dem Schlafe störend, mit Reiterstiefeln und Hetzpeitsche zu diesem eindrang, erinnerte sich Theodor jener Geste und ließ den Eindringling aufs grausamste [pg 281]in Ketten werfen und nur mit rohem Fleisch traktiren. Rosenthal hatte sich schon früher durch das Geschenk eines Teppichs mißliebig gemacht, auf dem der Löwenjäger Jules Gérard, mit einem Fez auf dem Kopfe, dargestellt ist, wie er einen Löwen erschießt. Theodor sah in dem feztragenden Jäger einen Aegypter, in dem Löwen aber das Sinnbild Abessiniens und wähnte sich verspottet. Als man dann noch Papiere bei Rosenthal fand, in denen das Stückchen von der Kussohändlerin, der Mutter des Königs, wieder aufgetischt war, wurde auch Rosenthal in den Kerker geworfen und seine Frau, die ihn vertheidigen wollte, ihm beigesellt. Der Gerichtshof sprach über sie wegen Hochverraths das Todesurtheil, das von Theodor jedoch in lebenslänglichen Kerker verändert wurde. Die Hauptsache aber blieb, daß, gegen die ausdrückliche Verabredung, jene Missionäre versucht hatten, Proselyten zu machen.
Als diese aufregenden Scenen sich ereigneten, befand sich der englische Konsul Cameron in Gondar beim Könige; er war nur für Massaua beglaubigt, keineswegs aber für Abessinien, da seit Plowden’s Tode kein Konsul dort anerkannt wurde. Cameron sollte sich in keiner Weise, wie Plowden, in die Landesfehden mit einlassen, sondern nur Handelsbeziehungen anbahnen und über die politische Lage Bericht erstatten. In Gondar angelangt, nahm ihn Theodor sehr freundlich und mit großen Ehren auf. Der englischen Allianz glaubte sich Theodor gerade gegen den Feind, welchen er am meisten fürchtete, gegen Aegypten, bedienen zu können. Denn dieses blieb seit dem Kampfe, den er am Rahadflusse – als er noch Kasa hieß – gekämpft, sein Schreckgespenst und ein Feldzug gegen Aegypten, sowie die Eroberung des Küstenlandes bei Massaua seine Lebensaufgabe. Denn die Oberherrschaft, welche der Pascha sich über die Grenzlande, namentlich Galabat, anmaßt, war der größte Dorn in Theodor’s Augen.
Durch Plowden’s warme Freundschaft verwöhnt, konnte der König sich in Cameron’s kalte Neutralität nicht finden und wurde um so mißtrauischer gegen diesen, als er sich erlaubte, zu Gunsten Stern’s und Rosenthal’s auftreten zu wollen. Die nach europäischem Muster begonnenen Reformen wurden nun eingestellt und in jedem Europäer ein Spion gewittert. So haben wir gesehen, daß auch Lejean unter jenem Mißtrauen zu leiden hatte. Als dieser endlich wieder entlassen wurde, ging er zu seinem Kollegen, dem Konsul Cameron, zum Frühstück. Unterwegs fanden die beiden Europäer in einer der engen Gassen Gondar’s einen todten Esel liegen. „Sehen Sie, da liegt ein krepirter Konsul“, sagte Cameron und schritt über das todte Thier hinweg. Dieser starke Ausdruck, welcher Lejean Anfangs unverständlich schien, fand durch Folgendes seine Aufklärung. Kaiser Theodor hatte vor einigen Tagen in sehr übler Laune gesagt: „Ich weiß nicht, weshalb mir meine lieben Vettern Napoleon und Victoria solche Leute geschickt haben. Der Franzose ist ein Narr und der Engländer ein Esel.“ Ganz Unrecht hatte der Fürst nicht und sein Grimm stieg. Entscheidend wurde jedoch erst ein anderer Umstand.
Oft schon hatte Theodor sich geäußert, daß ein Handelsvertrag mit England in Kraft treten müsse, und demgemäß schrieb er gegen Ende 1862 einen [pg 282]eigenhändigen Brief an die Königin Victoria. Ein gleichzeitiges Schreiben an den Kaiser Napoleon, mit ähnlichen Anträgen, wurde höflich erwidert, jedoch der Abschluß eines Handelsvertrags abgelehnt. Von England aber, wo das Schreiben im Auswärtigen Amte verlegt wurde – man ist nie klar darüber geworden, was mit demselben geschah – kam keine Antwort. In ganz Abessinien machte der Vorfall großes Aufsehen, da der König sich der Hoffnung hingegeben hatte, die britische Regierung würde es sich angelegen sein lassen, die angeknüpften Beziehungen zu fördern, angesichts seiner Freundschaft gegen Plowden, der guten Aufnahme, welche Krapf gefunden, und wegen der Abschaffung des Sklavenhandels. Doch keine Antwort kam. Sicherlich fühlte sich der stolze Halbbarbar durch diese Nichtbeachtung verletzt; ein europäischer Hof würde dasselbe gethan haben, und dann rächte er sich eben wie ein Barbar. Cameron mußte zunächst seinen Zorn fühlen und wurde gefangen gesetzt. Hatte die Königin von England seinen höflichen Brief, in welchem er seinen Wunsch ausdrückte, mit ihr und ihren Unterthanen in freundschaftlichem Verkehr zu stehen, unbeantwortet gelassen, so brauchte er auch, seiner Meinung nach, den Bevollmächtigten einer so unhöflichen europäischen Monarchin nicht weiter zu respektiren. Er ließ Cameron mit einem abessinischen Soldaten an einer und derselben Kette befestigen. Dabei glaubte er, daß die Engländer ihm in seinem Lande so leicht durch Waffengewalt nicht beikommen würden und ließ sich deshalb nicht gern auf Unterhandlungen ein.
Schließlich sandte man am 15. Oktober 1865 den Konsularagenten Rassam, einen Armenier, von Massaua, reich mit Geschenken versehen, zum König Theodoros. Im Januar des folgenden Jahres fand die Zusammenkunft statt und Rassam wurde freundlich aufgenommen, sodaß der König schon wenige Stunden nach der ersten Besprechung die Freilassung aller gefangenen Europäer befahl; er schickte sofort einen Kammerherrn nach Magdala und ließ ihnen die Ketten abnehmen. Unterdessen ging Rassam mit dem König und dessen Heere von Daunt nach Korata. Dann wurde am 29. Januar der Befehl zur Freilassung ertheilt, aber nicht vor dem 24. Februar 1866 ausgeführt. Am 12. März langten die Freigelassenen in Korata an, alle gesund, mit Ausnahme des Konsuls Cameron, der sich indessen auch bald erholte. Ihre Zahl betrug 18 Köpfe, und Rassam bekam Erlaubniß, sie nach Aegypten oder nach Aden führen zu dürfen. Theodor behandelte den Agenten mit großer Aufmerksamkeit und wollte nicht einmal gestatten, daß Hofleute von demselben Geschenke annahmen. Die Diener des Negus mußten Rassam königliche Ehren erweisen, weil er Vertreter der englischen Königin sei; sie mußten vor ihm knieen und den Boden mit der Stirn berühren. Als er in Korata ankam, wurde er von 60 Priestern empfangen, die in vollem Ornate dastanden und Psalmen sangen. Die Freigelassenen wurden noch einmal verhört, gestanden ein, daß sie Unrecht gethan, und baten, daß der König Theodor als Christ ihnen, den Christen, vergeben möge. Der König hatte an Rassam geschrieben: „Wenn ich ihnen Unrecht gethan habe, so lasse es mich wissen, und ich will es wieder gut machen; findest du aber, daß sie [pg 283]im Unrechte sind, dann will ich ihnen verzeihen.“ Rassam, dem daran lag, den König bei guter Laune zu erhalten, hütete sich wohl, dem mächtigen Manne Anlaß zur Unzufriedenheit zu geben. Dieser ließ dann das Schreiben verlesen, welches Königin Viktoria an ihn gerichtet hatte. Ein Gleiches geschah mit der Antwort. In dieser sagte er: „In meiner Niedrigkeit bin ich nicht würdig, Ew. Majestät anzureden, aber erlauchte Fürsten und der tiefe Ozean können Alles vertragen. Ich, ein unwissender Aethiopier, hoffe, daß Ew. Majestät mir meine Fehler nachsehen und meine Vergehen verzeihen werde.“ Der Schluß lautet: „Rathe mir, aber tadle mich nicht, o Königin, deren Majestät Gott verherrlicht hat und der er Weisheit im Ueberfluß gegeben.“
Plötzlich trat nun ein Umschlag in dem unberechenbaren Gemüthe des Herrschers ein. Rassam’s Plan war, nach dem abessinischen Osterfeste mit den Freigelassenen abzureisen. Da fiel es dem König auf einmal ein, sie alle, dieses Mal Rassam mit einbegriffen, wieder in das Gefängniß zu werfen. Er war so grimmig, daß er sie ohne Ausnahme hinrichten wollte. Dieses geschah allerdings nicht, dagegen führte man die Europäer wieder nach der Bergfeste Magdala. Es ist ein Räthsel geblieben, was den König Theodor bewog, die schon befreiten Gefangenen wieder einzusperren. In der veröffentlichten amtlichen Korrespondenz betreffs der abessinischen Angelegenheiten findet sich die Andeutung, daß Theodor’s böser Geist ein Franzose Namens Bardel gewesen sei, der, früher Sekretär Cameron’s, aus Rache gegen letzteren den mißtrauischen Theodor gegen alle Europäer einzunehmen wußte und ihm den Verdacht einflößte: die englische Regierung stehe im Begriff mit Aegypten ein Bündniß abzuschließen. Die Zahl der Gefangenen war nach und nach auf 18, darunter 10 Deutsche angewachsen. Die Beschuldigungen, welche Theodor gegen sie erhob, waren folgende: Cameron sei zu seinen Feinden, den Türken, gegangen und habe mit ihnen unterhandelt; ferner habe er auf den Brief an die Königin von England keine Antwort gebracht; Stern, Rosenthal und Cameron’s Diener hätten sich durch Verspottung und Verläumdung der Majestätsbeleidigung schuldig gemacht und die andern hätten mit ihnen konspirirt.
Nochmals wurde von Seiten Englands ein gütlicher Versuch gemacht, um den König zur Nachgiebigkeit zu veranlassen, dabei jedoch wieder in sehr ungeschickter Weise vorgegangen. Theodor hatte den Wunsch geäußert, gewisse Maschinen und einige Arbeiter von England zu erhalten. Diese wurden mit andern Geschenken nach Massaua geschickt, um die angestrebte Befreiung der Gefangenen zu unterstützen. Unser Landsmann Flad, von dem früher die Rede war (S. 136, 182), hatte die Unterhandlungen mit dem Könige übernommen. In einem eigenhändigen Briefe, den er überbrachte, kündigte die Königin Victoria an, daß die Arbeiter und die Geschenke dem König zugeschickt werden würden. Dies geschah jedoch nicht. Lord Stanley, der englische Minister des Auswärtigen, hatte später entschieden, daß die Geschenke sowol als die Arbeiter, obgleich die letzteren willig waren, sofort nach Abessinien weiter zu gehen, in Massaua zurückgehalten und erst dann ausgeliefert werden sollten, wenn [pg 284]Theodor die Gefangenen durch eine Eskorte nach Massaua geleitet und zur Verfügung des englischen Agenten, Oberst Merewether’s, gestellt haben würde. Wie zum Hohn schickte dieser anstatt der erwarteten, von Theodor erbetenen und von der Königin versprochenen Geschenke, deren Anschaffung dem englischen Staatsschatz gegen 4000 Pfund Sterling gekostet, ein Teleskop durch Herrn Flad. König Theodor, der Beherrscher eines Reiches und der Befehlshaber einer Armee von mindestens 60,000 Mann, der durch ein Fernrohr besänftigt werden sollte, sagte: „Dieser Mann, welcher mir das Teleskop sendet, wünscht mich nur zu verhöhnen. Er will mir sagen: Obgleich du ein König bist und ich dir ein treffliches Teleskop schicke, so vermagst du doch nichts dadurch zu sehen.“ Das Ausbleiben der versprochenen Geschenke bestärkte den mißtrauischen König von Abessinien in dem lange gehegten Verdacht, daß es die Engländer darauf abgesehen, ihn zu betrügen und zu verrathen. Nachdem Herr Flad Lord Stanley’s Verfügung in Betreff der Geschenke mitgetheilt, antwortete Theodor: „Ich bat sie um ein Zeichen der Freundschaft, welches mir verweigert wird. Wenn sie kommen und fechten wollen, laßt sie kommen; bei dem allmächtigen Gott, ich werde ihnen nicht ausweichen und nenne mich ein Weib, wenn ich sie nicht schlage!“
Und nach weiteren Erörterungen des Herrn Flad: „Ich habe keine Furcht, ich vertraue auf Gott, der sagt, daß du Berge versetzen kannst, wenn du den Glauben eines Senfkornes hast. Ihr könnt nicht Alles. Ich weiß, daß, wenn ich Herrn Rassam nicht in Ketten geschlossen hätte, die Arbeiter mir nie geschickt worden wären. Nicht nur zur Zeit des Kapitäns Cameron, als sie keine Antwort auf meinen Brief gaben, in dem ich um ihre Freundschaft bat, fand ich heraus, daß sie nicht meine aufrichtigen Freunde sein, sondern ich sah es sogar schon zur Zeit von Plowden und Bell – diese waren meine Freunde – und aus Freundschaft für sie behandelte ich ihre Landsleute gut. Ich überlasse es dem Herrn und er soll unterscheiden zwischen uns, wenn wir uns auf dem Schlachtfelde gegenüberstehen.“ Es ist also klar, daß ein tiefes Mißtrauen gegen die Pläne Englands, dessen Agenten er im Bunde mit seinen rebellischen Vasallen und mit seinen auswärtigen Feinden, namentlich den Aegyptern wähnte, die eigentliche Ursache war, weshalb Theodor alle Engländer und ihre Schutzbefohlenen, auf die er seine Hand legen konnte, einkerkern ließ, und daß das Zurückhalten der Geschenke ihn in diesem Mißtrauen nur bestärkte und die Krisis herbeiführte.
Die vielgenannte Bergfeste Magdala liegt an der Grenze von Wollo-Galla im Süden des reißenden Beschlo-Flusses, der seine Wasser mit dem Blauen Nil vereinigt. Sie ist in neuer Zeit (1862) von Heuglin und Steudner auf ihrem Wege nach Etschebed ins Lager des Königs Theodor besucht und sehr gut geschildert worden. Von der Hochebene Talanta’s her kommend und nach Süden vorschreitend, gelangten die Reisenden an den steilen Absturz zum Beschlo. Die Aussicht von da auf die jenseitigen Galla-Länder ist großartig. Zu ihren Füßen schlängelte sich das über 3000 Fuß tiefe Thal des Flusses, als natürliche Grenze zwischen Abessinien und Galla.
[pg 285]
Zur Linken, nach Osten, mündete eine steile Schlucht, und darüber hinaus lagen die steilen Kuppen der Bergfeste Kahit, dahinter die berühmte Festung Amba Geschen, die im November 1856 von Theodor erobert wurde. Im Süden tritt, vom Hochlande Woro-Haimano und Amara Seint durch einen langen Felsgrat getrennt, die Bergfeste Magdala zwischen tiefen, aber anmuthig grünen Thälern weit nach Norden vor; links davon die Berge von Tenta, dahinter die kegelförmigen Schwesterberge Dschifa und etwas mehr im Süden steigt der majestätische Kollo, ganz mit blendend weißem Firn bedeckt, hoch in den blauen Aether. Das Strombett des Beschlo ist an der Furt 150 Schritt breit und nimmt so ziemlich die ganze, mit vulkanischem Geschiebe erfüllte Sohle der tiefen Schlucht ein, die einen reichen Pflanzenwuchs zeigt. Dieses Thal verließen die Reisenden nach anderthalbstündigem Marsche und stiegen an einer ziemlich hohen und steilen Terrasse hinauf, die sich am nordwestlichen Fuße von Magdala ausbreitet. Kleine Dörfer mit niedlichen Gärtchen und Kaffeeplantagen lagen zerstreut umher.
[pg 286]Ein ziemlich steiler Pfad führt in 1¼ Stunde an buschigen Gehängen und kahlen Felsen hinan zu dem schmalen Plateau, das die eigentliche Festung Magdala von einer weiter nach Norden vorspringenden, natürlichen Bergfestung trennt, die etwas niedriger ist als erstere. Herden von Erdpavianen bewohnen die steilen Wände des Vorwerks. Das erwähnte Plateau ist ganz kahl, Gruppen von Hütten befinden sich an der Südostseite, die, wie der Platz selbst, Islam Gie (Muhamedaner-Dorf) heißen. Hier ist zugleich der Marktplatz für die Festung.
Die eigentliche Festung Magdala, einst im Besitze der Galla, kann als Hauptstadt der Provinz Woro-Haimano angesehen werden. Das Land südwärts bis Schoa war früher von amharischen Christen bewohnt, kam aber nach und nach in Besitz der sich immer mehr nach Norden ausbreitenden muhamedanischen Galla, welche von hier aus beständige Einfälle in Abessinien machten, bis Negus Theodor Land und Festung wieder eroberte. Magdala selbst nimmt einen Flächenraum von 2 englischen Meilen ein, ragt 100–200 Fuß über das Plateau von Islam Gie hinaus, hängt im Süden mit der nahen Hochebene zusammen durch einen niedrigen, langen und scharfen Felsgrat; im Osten und Westen fallen natürliche, mauerartige, senkrechte Bastionen viele hundert Fuß tief in die Seitenthäler ab, gegen Norden und Süden führen Felsspalten als natürliche Thore herab, die mit Ausfallthoren versehen sind. Auch Wasser findet sich auf der Amba und einiger Raum zum Feldbau. Der Negus, der die Wichtigkeit der Amba wegen seinen Beziehungen zu Schoa und weil die Galla von hier aus leicht im Zaum gehalten werden können, wohl erkannte, ließ Magdala restauriren, einige Geschütze hinaufschaffen, ein wohlversehenes Zeughaus errichten und weitläufige Getreidemagazine bauen.
So war die Festung beschaffen, nach der Theodor die Gefangenen hatte schleppen lassen und auf der sich sein Schicksal erfüllen sollte. Als die letzten Friedensaussichten geschwunden waren, fing man in England an sich zum Kriege vorzubereiten, dessen offizieller Zweck die Befreiung der Gefangenen war. Das Parlament wurde zu einer Extrasitzung zusammenberufen und am 18. November 1867 von der Königin mit einer Thronrede eröffnet, in welcher es heißt: „Der Herrscher Abessiniens fährt fort, allen internationalen Rechten Hohn sprechend, mehrere Meiner Unterthanen in Gefangenschaft zu halten, von welchen einige von Mir besonders accreditirt waren, und seine hartnäckige Mißachtung gütlicher Vorstellungen hat Mir keine andere Wahl gelassen, als die Freilassung Meiner Unterthanen durch eine peremptorische Aufforderung zu verlangen, die zugleich durch eine entsprechende Truppenmacht unterstützt wird. Ich habe demgemäß die Absendung einer Expedition zu diesem ausschließlichen Zweck angeordnet, und ich verlasse Mich voll Vertrauen auf die Unterstützung und Mitwirkung meines Parlaments in Meinem Bemühen, unsere Landsleute aus einer ungerechten Gefangenschaft zu befreien und gleichzeitig die Ehre Meiner Krone zu wahren.“

Nach einigem Zögern bewilligte das Parlament die nöthigen Gelder, und [pg 287]die indische Armee erhielt den Auftrag, den Krieg zu beginnen. Am 4. Oktober war bereits ein Pioniercorps bei Zula in der Bay von Adulis (Annesley, S. 169) gelandet. Dieses schlug an der öden, wasserlosen Küste ein Lager auf und begann eine Straße nach dem Innern zu bauen, ohne dabei belästigt zu werden. Die Gesammtstärke der aus Indien nach Abessinien beorderten Truppen betrug 12,000 Mann, darunter 4000 Europäer. Die Infanterie war mit Hinterladern bewaffnet. Außer diesem Armeecorps folgte ein Troß von 8000 Mann, 35,000 Lastthiere, worunter 24,000 Maulesel und 40 Elephanten, welche letztere zum Tragen der Armstrong-Geschütze bestimmt waren. Zum Kommandanten der Armee wurde General Robert Napier ernannt. Auch ein ganzer Stab von Gelehrten, Künstlern und Zeitungsberichterstattern schloß sich der Expedition an. Unter den ersteren sind zu nennen Werner Munzinger, Ludwig Krapf, der Nilquellentdecker Grant und – im Auftrage des Königs von Preußen – der berühmte Afrikareisende Gerhard Rohlfs. Die beste Stütze der Armee war jedoch eine ungeheure Summe von Maria-Theresia-Thalern, die man in Wien hatte prägen lassen.
Ohne Schwierigkeiten war das Eindringen in das Innere keineswegs; namentlich verursachte der Wassermangel große Gefahren für Menschen und Thiere, und nur mit den bedeutendsten Kosten konnte man diesem durch destillirtes Wasser abhelfen. Die Truppe war gesund, verlor aber ziemlich viele Kameele und Maulthiere, minder durch die Ungunst des Klimas als durch die schlechte Pflege ihrer Wärter. Dieselben waren ein aus Persien, Arabien und Indien zusammengelaufenes Gesindel, das nicht arbeiten wollte, unterwegs nicht selten, um rascher fortzukommen, die Fracht wegwarf und auf der Straße liegenließ, die Thiere nicht fütterte und tränkte, sodaß diese erhitzt und halb verdurstet zu den Tränkrinnen kamen, dann übermäßig tranken und erkrankten. Fällt ein solches Thier, so verursacht die Wegschaffung des Aases, das man im heißen Klima aus Furcht vor Ansteckung nicht im Freien liegen lassen kann, neue Schwierigkeiten, und man konnte sich nur dadurch helfen, daß die Aeser mit dürrem Gesträuche bedeckt und verbrannt wurden. Oberst Merewether war des langen Liegens an der Küste, des destillirten Wassers und der Langeweile müde geworden und hatte die Truppe gegen die Hochplatte von Abessinien, wo er Nahrung und Wasser zu finden gegründete Hoffnung hatte, vorgeschoben. Drei Wege standen ihm offen, alle drei durch die trockenen Bette von Bergströmen gekennzeichnet, denn wie zur Zeit der Völkerwanderung sind in diesem halbwilden Lande heute noch Bäche und Flüsse die Wegweiser für Wanderer und Völkerschwärme. Die kürzeste der drei Routen war wol die mittlere, vom Flusse Hadasch gebildete, aber sie bot die meiste Schwierigkeit, daher wurde die mehr links liegende, durch den Fluß Kamoyle gebildete Straße gewählt. Unter den Einwohnern wurde eine Proklamation des kommandirenden Generals verbreitet, des Inhalts: daß die Engländer nur gekommen seien, die widerrechtlich gefangen gehaltenen Landsleute zu befreien; Freiheit und Glaube des Volks werden ebenso wie Eigenthum und Vermögen der Individuen geschützt und [pg 288]geachtet werden. Am 2. Dezember setzte sich die Kolonne in Bewegung. Anfangs ging es durch eine sandige, nur spärlich von Akazien und Steppengewächsen bedeckte Ebene, dann stieg der Weg langsam auf. Nirgends waren Menschen, nur hier und da das Gerippe verlassener Hütten zu sehen, bis man Kamoyle erreicht hatte, das im Bergkessel liegt, wo man sich wieder an dem Genusse frischen Quellwassers labte und einen Wegzeiger mit der Aufschrift: „Route nach Abessinien“ aufstellte. Jetzt gelangte man ins Gebirge, wo Felsenmassen den Weg zu sperren schienen, aber stets öffnete bei jeder Krümmung sich ein Ausweg, oft unter überhangendem Gestein hinweg, oft an steiler Bergwand entlang; nur vom Regen herabgeschwemmtes Gestein hemmte den Pfad bis Ober-Suru, das, 2000 Fuß über der Meeresfläche liegend, freundlich ins Thal hinabschaut. Hier wurde gerastet; Nacht und Morgen waren kühl; gestärkt von der frischen Luft stieg die Truppe das Plateau hinauf.
Die Wirkungen der englischen Invasion waren zunächst an der Bai von Adulis zu bemerken. Zwei Landungsbrücken, Docks und Magazine, eine mehrere Meilen lange Eisenbahn von der Bai nach dem Lager in Zula, ein für das schwerste Fuhrwerk fahrbarer Weg von Zula bis zum Fuße des Senafe-Berges, Stationen auf diesem Wege, um den Transportdienst durch Relais zu beschleunigen, Telegraphen erhoben sich sofort als Zeugen englischer Thatkraft.
In Senafe, 7500 Fuß über dem Meere, wurde das erste größere Lager aufgeschlagen und ein förmlicher Stationsplatz errichtet. Die gesammte Zufuhr, die durch fabelhafte Preise jedoch dorthin gelockt wurde, war nicht genügend, ein einziges Regiment zu ernähren. Daher mußte Alles durch eine bedeutende Transportschiffflotte erst in die Annesleybai geschafft und dann durch Maulthiere und Kameele weiter gebracht werden. Täglich verließen 20,000 Rationen Zula, von denen aber nur die Hälfte nach Senafe gelangte, da der andere Theil von den Lastträgern und Treibern verzehrt wurde. 30,000 bis 40,000 Gallonen Wasser wurden täglich auf den Schiffen kondensirt und dieser Prozeß kostete allein täglich über 1000 Thaler.
Ehe wir den staunenswerthen Marsch der Engländer in südlicher Richtung weiter verfolgen, müssen wir uns nach ihrem Gegner und dessen Lage umsehen. Die drohende Invasion und der den Abessiniern innewohnende revolutionäre Trieb, die Eifersüchteleien der kleinen Häuptlinge und die Sucht derselben, sich unabhängig zu machen, war mit erneuter Stärke ausgebrochen, in je größere Verlegenheiten König Theodor gerieth. Ueberall, im Norden wie im Süden, entbrannte die Revolution, und mit Schluß des Jahres 1867 befand sich Abessinien wieder in der Lage, in der es war, ehe König Theodor seinen ehrgeizigen Traum träumte, ehe er die zerstreuten Theile zusammenfassen konnte. Ihm blieb schließlich nur der Landstrich vom Tanasee bis Magdala unterthan, ja zeitweilig nicht einmal dieser, und seine Macht beschränkte sich nur auf sein Lager, das meistens in Debra Tabor sich befand. Magdala aber, seine für uneinnehmbar geltende Feste, hütete er wie seinen Augapfel. Die Gefangenen befanden sich dort ziemlich wohl und waren so wenig streng bewacht, daß sie mit der größten [pg 289]Leichtigkeit mit den Engländern korrespondiren und diese von allen Vorgängen im Lager des Negus in Kenntniß setzen konnten.
Das Reich, das Theodor gebildet hatte, war wieder in eine Anzahl unabhängiger Fürstenthümer zerfallen, und nicht das ganze stolze Aethiopien – nein, nur ein einzelner Herzog, der sich noch immer Negus nannte – stand gegen England im Felde. Das große Reich Tigrié, das unter Ubié einst selbständig war, hatte unter dem Detschasmatsch Kassai, einem Sohne Ubié’s, seine Unabhängigkeit wieder erlangt, und dieser Fürst, welcher fürchtete, daß Theodor ihn doch einst vertreiben könne, schloß sofort mit den Engländern Freundschaft und empfing Gesandte in seiner Hauptstadt Adoa. In Lasta und den angrenzenden Distrikten hatte sich Gobazye, der Schum von Wag, kurzweg der Wagschum genannt, ein tapferer Krieger und einst einer der besten Generäle Theodor’s, unabhängig gemacht. Kassai und Gobazye befehdeten einander, doch nicht minder stark war die Feindschaft beider gegen Theodor, ihren gemeinschaftlichen Gegner.
Mehr als der Abfall dieser Fürsten schmerzte Theodor aber der Verrath des jungen Menilek. Dieser, der Sohn des 1856 von Theodor besiegten Königs Hailu Melekot von Schoa, war Theodor’s Schwiegersohn geworden; aber weder die junge Frau, noch die Gnade des Königs vermochten ihn zu fesseln; er trachtete nur danach, wieder in den Besitz seines Erbes zu gelangen. Unterstützt von der Gallafürstin Workit entfloh er mit Zurücklassung seiner Frau nach Ankober, wo ihn die Schoaner jubelnd als Negus anerkannten. Theodor selbst wurde durch diesen Abfall und das Mißtrauen, welches er gegen die Europäer hegte, zur schrecklichsten Wuth getrieben, die sich in blutigen Greueln äußerte. Der Kerker zu Debra Tabor war, wie wir aus den Berichten eines Augenzeugen, des deutschen Naturaliensammlers Karl Schiller, selbst erfuhren, fortwährend mit Unglücklichen überfüllt, die entweder zum Hungertode oder zur Hinrichtung durch Abschneiden der Hände und Füße verdammt waren. Dreihundert Soldaten, die im Verdachte standen, desertiren zu wollen, wurden zum Hungertode verurtheilt. Gefesselt und bewacht, mit langen Holzgabeln am Halse, saßen sie zusammengekauert ohne die geringste Bekleidung im Freien. Des Nachts fror fingerdickes Eis oder strömte der Regen auf die Elenden hernieder, während am Tage die brennenden Strahlen der tropischen Sonne die nackten Körper trafen. Nach Verlauf von zwei Wochen starb der letzte; er hatte mit dem Regen, der seine verdorrenden Lippen netzte, mit dem Grase, auf dem er saß, sein jammervolles Dasein so lange gefristet. Solche Greuel aber ereigneten sich fast täglich! Blitzschnell zog Theodor im Lande herum, und wehe der Gegend, in die sein raublustiges Heer einfiel. Das Volk der Waito wagte zuerst, dem Gewaltigen Widerstand zu leisten, ja es war so glücklich, Anfangs einen Theil seines Heeres zu schlagen. Da beschloß Theodor, mit ihnen kehraus zu machen. Wie der Habicht vom hohen Thurme herniederfährt zwischen das scheue Geflügel, so stürzte er von Debra Tabor auf die Waito. Was nicht sogleich vor dem Schwerte der Krieger fiel, wurde in die Häuser getrieben, und als diese mit Männern, Weibern, Kindern gefüllt waren, da befahl Theodor, Feuer an die [pg 290]Strohdächer zu legen, und Hunderte von Unschuldigen fanden ihren qualvollen Tod in den Flammen.
In Gafat, später in Debra Tabor, herrschte währenddem eine große industrielle Thätigkeit. Dort hatte man Flammenöfen gebaut, dort hämmerte, schmiedete und formte man Tag und Nacht unter der Leitung der deutschen Handwerker, an deren Spitze jetzt Dr. Schimper und Eduard Zander standen. Mit geringen Mitteln war mitten in der abessinischen Wildniß ein ziemlich bedeutendes industrielles Etablissement entstanden, eine Oase in der Wüste, in welcher fast nur deutsche Laute wiederklangen. Die erste Kanone, welche 8 Fuß lang war und eine 6 Zoll weite Seele besaß, wurde von dem über den Guß hocherfreuten Könige „Theodor“ getauft, während ein 80 Centner schwerer Riesenmörser mit anderthalbfußweiter Oeffnung den stolzen Namen „Sebastopol“ erhielt.
Als die Gegend um Debra Tabor im Spätsommer vollständig ausgeplündert war und die Raubzüge in der Umgegend kein Vieh und Getreide mehr einbrachten, beschloß Theodor, nach Magdala aufzubrechen. Debra Tabor wurde, damit es keinem Feinde in die Hände fiel, in Brand gesteckt und dann der Marsch mit einem Heere von etwa 50,000 Menschen angetreten, worunter sich jedoch höchstens 10,000 Krieger befanden, denn Hinrichtungen und Desertionen hatten die Armee stark reduzirt. Ueber Hochlande, die theilweise 11,000 Fuß über dem Meere liegen, durch zerrissene Tiefebenen und vom Regen angeschwollene Ströme führte der Marsch über Tschetscheho nach Woadla. Mitten im Zuge schritten gebunden die fünf Deutschen: Steiger, Brandeis, Schiller, Eßler, Makerer, während Cameron, Rassam, Stern, Rosenthal u. s. w. bereits auf Magdala schmachteten.
Am 31. Oktober 1867 stand das Heer bei dem Flecken Biedehor, der etwa 10,000 Fuß hoch über dem Meere liegt. Von dort hat man einen weiten Blick in das Land nach Süden, nach Magdala und dem hohen, schneebedeckten Kollogebirge. Südlich von Biedehor aber durchsetzt eine jener grausigen Thalschluchten das Land, an denen Abessinien so reich ist. Hier fließt zwischen senkrechten, fast 3000 Fuß hohen Felsen die rauschende Dschidda hin. Nur einige Terrassen unterbrechen die jähen mauerartigen Wände. In diesen Schlund mußte die ganze Armee hinabsteigen und, nachdem sie das Flußbett überschritten, am jenseitigen Ufer wieder einen ebenso steilen Felsenwall über nacktes, vulkanisches Gestein nach der fruchtbaren Ebene von Talanta hinaufklimmen. Dorthinab mußten auch die Kanonen und der Riesenmörser „Sebastopol“ geschleppt werden. Der letztere wurde auf einem ungeheuren Wagen von Hunderten von Menschen fortgezogen, so wie die alten Aegypter einst ihre Kolosse fortbewegten. Aber auf den gewöhnlichen Maulthierpfaden konnte der Mörser unmöglich durch die Dschiddaschlucht gelangen, und rasch entschlossen befahl Theodor den deutschen Arbeitern, die ihn begleiteten, eine Straße zu bauen. Dieses geschah, während die Engländer schon im Anmarsch waren, und mit Erstaunen vernahm Theodor, was er für unmöglich gehalten, daß jene in Zula gelandet seien. Zwei Monate nahm der Bau der Straße in Anspruch, denn erst am 15. Januar 1868 war die Dschidda glücklich überschritten und die Talanta-Ebene erreicht.
[pg 291]Wohlgefälligen Auges schaute der König auf die fruchtbare Ebene. Die Weizen- und Gerstenfelder standen in der üppigsten Pracht, überall wimmelte es von fleißigen Menschen, die den Boden bestellten, von fröhlich singenden Kindern, denn ein Owatsch (Herold) des Königs war umhergezogen und hatte in ganz Talanta verkündigt: „Kehrt heim ihr Bauern zu eurer Arbeit, bestellt die Aecker und flüchtet euch nicht. Der König bringt den Frieden, kein Haar wird euch gekrümmt, euer Eigenthum ist geachtet.“ Und friedlich kehrten die, welche schon auf der Flucht waren, in ihre Dörfer zur gewohnten Beschäftigung zurück. Aber Theodor hielt sein Wort nicht; er brauchte Proviant für seine Festung Magdala, fiel über die schmählich betrogenen Leute von Talanta her und zog dann über den Beschlo in seine Felsenburg ein.
Unterdessen rückten die Engländer mit großer Geschwindigkeit nach Süden vor. Ihr Marsch war kein leichter. Besonders muß man bedenken, daß eine Verbindungslinie von 400 englischen Meilen zwischen dem Meere und Magdala offen zu halten und durch eine Postenkette zum Schutze des Proviants und der Munition zu befestigen war. Letzteres war um so mehr erforderlich, als man auf freundschaftliche Gesinnung der Eingeborenen nur so lange mit Gewißheit rechnen konnte, als Gewalt und Glück auf Seite der Europäer stand.
Dabei bewegte sich die Truppe mit ihrem riesigen Troß, ihren Elephanten und Kanonen auf Gebirgen, die unsere höchsten Alpenpässe bei Weitem überragen, wie aus der folgenden, in Petermann’s Mittheilungen (1868, S. 180) angegebenen Höhenlage der hauptsächlichsten Stationen hervorgeht. Senafe, besetzt am 6. Dezember 1867, liegt 7464 Fuß über dem Meere; Adigerat (Ategerat), besetzt 31. Januar 1868, 8291 Fuß; Tschelikut 6279 Fuß; Antalo (besetzt 15. Februar) 7935 Fuß; Aladschin-Paß 9630 Fuß; Aschangi-See 7264 Fuß; Lat (besetzt 31. März) 8478 Fuß; Dasat-Berg 9502 Fuß; Quelle des Takazzié 7700 Fuß; Abdikom 10,000 Fuß; Talanta (4. April) 10,700 Fuß; Magdala (erstürmt am 13. April) etwa 11,000 Fuß. In diesem Verzeichniß ist zugleich die Marschroute des Heeres kurz angegeben, über die wir hier noch Einiges nachtragen wollen.
Von Senafe zog das Heer über ein hohes, offenes, grasbedecktes Plateau mit einer reizenden Aussicht auf Gebirgsmassen von allen nur denkbaren Formen, nach Adigerat zu. Die zwischen den Bergen sich hinwindenden Schluchten, denen nur Bäche und Wälder zur Vollendung der Schönheit mangeln, schienen sehr fruchtbar zu sein, sodaß man die schwache Zufuhr an Getreide von Seite der Eingeborenen kaum begreifen konnte, und selbst die beschränkten Zufuhren erschöpften die Gegend immer schnell, da keine Idee von Großhandel herrschte und jeder nur das zu Markte brachte, was er von seinen eigenen Vorräthen erübrigen konnte. Adigerat selbst, das man am 31. Januar 1868 besetzte, war allen bisher gesehenen abessinischen Städten überlegen, da außer den gewöhnlichen schmuzigen Hütten und einer hübschen Kirche noch ein Palast und ein befestigter Thurm sich dort befanden. Hinter diesem Hauptorte der Provinz Haramat führt ein gangbarer Weg nach Mai Wihis, durch weite, offene, gras[pg 292]bewachsene Ebenen, die häufig von Dörfern unterbrochen und ziemlich kultivirt waren. Für den kriegerischen Charakter der Bevölkerung zeugten genugsam die vielen auf fast unerreichbaren Felsspitzen erbauten Festungen, die selbst europäischer Artillerie zu trotzen vermögen. So namentlich Amba Zion (siehe Abbildung S. 41), das ehemalige Staatsgefängniß Theodor’s, welches jetzt leer stand, da bei dem Abfall Kassai’s auch der mit der Beaufsichtigung dieser Festung betraute Häuptling revoltirte und die Gefangenen in Freiheit setzte. Ad Abagin, 7849 Fuß über dem Meeresspiegel, war die nächste Station. Hier waren die Nächte so kalt, daß man kaum schlafen konnte, wozu sich die lieblichen Töne eines Schakal- und Hyänen-Konzerts gesellten. Allein die Thiere waren weniger gefährlich, als man denken sollte, da sie sich genügend an den todten Maulthieren sättigen konnten. Bei Agala, 6300 Fuß über dem Meere, zeigte sich eine merkliche Veränderung der Vegetation. Duftende Kräuter versüßten die Luft, die Straße war wunderbar gut und nur auf eine kurze Strecke abschüssig. Hier in dieser Gegend erhielt man wieder Briefe von den Gefangenen in Magdala, woraus hervorging, daß sie sich Alle wohl befanden und daß Theodor im Januar Magdala noch nicht erreicht hatte, aber entschlossen sei, es mit den Engländern aufzunehmen. Da man die Abessinier für keine zu verachtenden Feinde hielt, wurde die Straße, die nach Magdala führt, durch mehrere Positionen befestigt. So erhielt Adigerat Wall und Graben, die von 200 Mann und einigen Armstrongkanonen vertheidigt wurden. Die Flüsse, welche man auf dem ferneren Wege nach Antalo zu traf, eilen der Geba, einem Nebenflusse des Takazzié, zu und senden durch diesen Kanal ihren Tribut zum Anschwellen des Nil. Die Armee hatte daher über eine Reihe von Wasserscheiden im rauhen Gebirgslande zu setzen. Hier traf man auch auf die Salzkarawanen, welche, von Taltal kommend, die Salzstücke in das Innere des Landes verführen.
Während die Armee solchergestalt vordrang, suchte der Oberbefehlshaber sich mit den Häuptlingen des Landes in freundschaftliches Einvernehmen zu setzen und begann mit einem Besuche Kassai’s, des Fürsten von Tigrié. Als Ort der Zusammenkunft diente eine Stelle am Flüßchen Diab, unweit der herrlichen Amba Zion; als Tag war der 25. Februar bestimmt. Kassai erschien mit 4000 Mann am Ufer des Baches. Sir Robert Napier ritt auf einem Elephanten, gefolgt von seinem ganzen Stabe, ihm entgegen, verließ aber seinen hohen Sitz auf dem Rüsselträger, damit der Anblick des Thieres unter der Kavallerie der Abessinier keine Verwirrung anrichte. Nun öffneten sich auch die Reihen der Abessinier und mitten durch sie kam der etwa 35 Jahre alte Kassai auf einem weißen Maulthiere angeritten. Die Briten empfingen ihn mit allen militärischen Ehren, ihr Oberkommandant schüttelte ihm die Hand und führte ihn ins Zelt, wo Kassai reich beschenkt wurde und ein Freundschaftsbündniß mit England schloß. Er bewunderte vorzüglich die Waffen der Europäer und lud hierauf Napier ein, seine eigenen Truppen zu inspiziren. Mit wenigen Ausnahmen trugen diese alle Feuerwaffen. Der größte Theil von ihnen besaß doppelläufige Perkussionsgewehre englischen oder belgischen Fabrikats. Viele führten Pistolen und kein [pg 293]einziger fand sich, der nicht das lange krumme Schwert an der rechten Seite getragen hätte. Die wenigen, die ohne Gewehre erschienen, waren mit Speer, Schwert und Schild bewaffnet. Die Mannszucht schien gut, ihre Manövrirfähigkeit war nicht zu verachten. Gleichfalls beschenkt mit silbernen Armringen, einer Löwenhaut, dem Abzeichen tapferer Krieger, mit Speer und Schild, kehrte der englische Oberkommandant in sein Lager zurück. Er hatte nun im Rücken nichts mehr zu besorgen, und der Vormarsch auf Antalo begann auf schwierigen Wegen.
Das Land zeigte überall Spuren der vielen Kämpfe, denen es durch seine unruhigen Häuptlinge ausgesetzt war. Die Dörfer lagen verwüstet, die Unsicherheit der Zustände hinderte eine geregelte Bodenkultur und statt den Engländern für die Verbesserung der Straßen und Wegbarmachung der Pässe zu danken, grollten ihnen die Eingeborenen, weil hierdurch den Häuptlingen der Nachbarländer später feindliche Einfälle erleichtert würden.
Antalo unterschied sich nicht von Adigerat als Stadt, war aber bedeutend als Marktplatz. Brot, Mehl, Butter, Honig, Schlachtvieh wurden in reichem Maße zugeführt, doch stellte sich eine Schwierigkeit ein: Napier hatte einen Augenblick lang Ebbe in der Kasse, denn Gold nahmen die Eingeborenen nicht und Maria-Theresia-Thaler waren in ungenügender Menge zugeführt worden. In ihren Thalern hatten die Engländer das beste Mittel, die Allianz der Einwohner zu erzielen; aber ihre Kopfzahl erschien diesen immer noch zu gering, um den fürchterlichen Theodor anzugreifen, welcher sich, den angelangten Nachrichten zufolge, auf der Hochebene von Talanta, zwischen den Strömen Dschidda und Beschlo befestigte.
Der Zug der Engländer ging nunmehr durch Wodscherat und Doba zum Aschangi-See, der östlich liegen blieb, und durch Wofila nach dem 8478 Fuß hoch gelegenen Lat, wo das ganze Expeditionscorps in zwei Divisionen getheilt wurde, von denen die erste unter General Stavely, 4600 Mann und 600 Pioniere zählend, zum aktiven Vorgehen, die zweite unter General Malcolm zur Reserve und Besatzung der Zwischenstationen bestimmt war. Alles unnöthige Gepäck blieb zurück; für je 12 Offiziere wurde nur ein Zelt und für 20 Gemeine eins bewilligt, die ersteren durften nur 30 Pfund, die letzteren nur 25 Pfund Gepäck mitführen.
Nachdem der 10,662 Fuß hohe Emano-Amba-Paß durchschritten war, stieg die Armee hernieder zu den Quellen des Takazziéstromes. Dann wurde die Ebene von Woadla (Wadela) durchschritten, und am 30. März standen die Engländer in Biedehor am höchsten Rande des Dschidda-Thals, 10,000 Fuß über dem Meere, auf der Kunststraße, die Theodoros mühsam durch die Deutschen hatte herstellen lassen. Durch den Bau dieser Straße hatte der Negus den Engländern ein gutes Theil an Zeit und Mühe erspart, allein es blieben noch Hindernisse genug übrig. Der Uebergang über die Dschidda, welcher am 4. April bewerkstelligt wurde, war nicht das geringste derselben. Die abschüssigen, felsigen Ufer hinab und wieder hinauf zu steigen, war kein leichtes Unternehmen; die Lastthiere rutschten die ganze Strecke hinunter und mehrere erlagen [pg 294]den Strapazen. Das Aufsteigen auf der anderen Seite war womöglich noch schwieriger für Menschen und Thiere, die sich mit leerem Magen und unter schwerem Gepäck hinaufzuwinden hatten. Hier wurde es allmälig zur Gewißheit, daß Theodor sich auch von der Hochebene Talanta, die man jetzt betrat, zurückgezogen und nach Magdala geworfen habe, daß man ihn daher hinter dem Beschlo aufsuchen müsse. Die vorausgeschickten Rekognoszirungstruppen hatten bereits die Nachhut von Theodor’s Heer erblickt, und nun war es klar, daß in den nächsten Tagen ein Zusammenstoß stattfinden könne. Was die Einwohner von Talanta betraf, so bezeigten sie sich den Engländern freundlich, da sie kurz vorher von Theodor’s Truppen nach Maßgabe der altabessinischen Praxis ausgeplündert waren und nun in den Fremdlingen ihre Rächer erblickten. Gefährlich schien für die Engländer einen Augenblick das Auftreten des Rebellen Wolda Jesus in ihrem Rücken, der die Transporte, welche durch Lasta gingen, zu stören versuchte, aber von dem ihnen verbündeten Kassai von Tigrié zur Ruhe verwiesen wurde. Von den Gefangenen hatte man die Nachricht, daß sie sich wohl befänden und milder als früher behandelt würden.
Ueber das Verhalten Theodor’s kurz vor dem Zusammentreffen mit den Engländern giebt ein Brief des gefangenen Gesandten Rassam interessante Auskunft. Hiernach hatte sich der König schon am 18. März über den Beschlo zurückgezogen und an diesem Tage einen Brief an Rassam geschickt, in welchem er bedauerte, daß dieser in Fesseln gelegt worden sei, denn ohne sein Wissen hätten dieses die Behörden gethan; gleichzeitig gab er den Befehl, Rassam die Ketten abzunehmen, was auch geschah.
Am 27. März zog Theodor mit seinen sehr zusammengeschmolzenen Getreuen in Magdala ein, wo die größte Verwirrung herrschte. Ein hoher militärischer Würdenträger war desertirt und zwei andere Häuptlinge wurden angeklagt, Menilek, den König von Schoa, eingeladen zu haben, die Festung in Besitz zu nehmen. Dieses Alles setzte den stolzen Herrscher, der bisher nur die unbedingteste Unterwerfung unter seinen Willen gekannt, derart in Wuth, daß er zuerst beschloß, die alte Garnison aus der Festung zu entfernen und durch eine neue zu ersetzen; am nächsten Tage jedoch gab er Gegenbefehl, beschränkte sich darauf, den Kommandanten abzusetzen und die Besatzung durch 1000 Mann zu verstärken. Am 29. März schickte Theodor zu Rassam, den er in einem seidenen Zelt empfing. Er theilte ihm höflich und in seiner unberechenbaren Weise mit, daß er ihn nur darum übel behandelt habe, weil er wünschte, die Engländer möchten gegen ihn zu Felde ziehen. Darauf drückte er den Wunsch aus, er möge Rassam in der englischen Uniform sehen, was dieser natürlich zugestehen mußte. Umgeben von 400 Offizieren und den deutschen Handwerkern empfing er den ehemaligen Abgesandten der Königin Victoria, welcher die Ehre hatte, dem königlichen Prinzen vorgestellt zu werden. Alles schien dem Könige daran gelegen, den Gefangenen möglichst zu imponiren, und um diesen Zweck zu erreichen, wurde der berühmte Riesenmörser Theodor’s herbeigeschleppt, den dieser „Sebastopol“ getauft hatte. Freudenschüsse begleiteten die Ankunft des Ungethüms, das sich [pg 295]später als sehr ungefährlich erwies. Theodor selbst beaufsichtigte die Befestigungs- und Wegarbeiten und war darüber, daß er Magdala vor den Engländern erreicht, so erfreut, daß er sämmtlichen Gefangenen die Fesseln abnehmen ließ. Nachdem alle Kanonen und Mörser an Ort und Stelle waren, erkundigte er sich bei Rassam aufs genaueste nach der Zahl der gegen ihn ausgesandten englischen Truppen. Letzterer erwiderte: man spreche von 10,000 Mann; er glaube aber nicht, daß mehr denn 6000 bis Magdala kommen würden. Darauf hin setzte der Negus auseinander: wenn er noch so mächtig wäre, wie ehedem, hätte er die Engländer bei ihrer Landung erwartet und sie gefragt, was sie denn eigentlich wollten; aber jetzt habe er mit Ausnahme Magdala’s das ganze Land verloren und müsse sich damit begnügen, sie hier zu erwarten. Dann befahl er, die Gefangenen in seiner unmittelbaren Nähe zu halten, während er von seiner luftigen Burg unablässig mit dem Fernrohr nach Norden hin schaute, von wo der Feind kommen mußte. Endlich am 7. April sah Theodor die ersten Engländer am Beschlo anlangen.
Am 10. April überschritt auch Sir Robert Napier diesen Fluß und hatte nun die Feste Magdala in ihrer ganzen Fürchterlichkeit vor sich liegen. Kühn ragten die steilen Felsen gen Himmel, und oben befand sich Theodor mit seinem Heere. Obgleich die Engländer keineswegs die Absicht hatten, sogleich zum Angriff überzugehen, sondern außerhalb Schußweite von Fala, einer Vorburg Magdala’s, kampiren wollten, so wurden die Truppen Theodor’s doch durch die englischen leichten Reiter, welche nahe an die Festung heranritten, hervorgelockt. Theodor, der selbst in Fala bei seinen großen Kanonen sich aufhielt, gab Befehl, diese dreisten Leute gefangen zu nehmen. Aber er hatte nicht gewußt, daß inzwischen die ganze Brigade unter Sir Stavely auf einem verdeckten Wege ebenso nahe war. Die leichten Reiter zogen sich, als etwa 1200 Fußgänger von der Amba herunterkamen, so schnell sie konnten, zurück. Statt ihrer rückten nun ein Regiment Beludschen, ein englisches Infanterieregiment, eine Batterie Berggeschütze und eine Raketenbatterie vor. Theodor that aus seinem schweren Geschütze in Fala einige gutgezielte Schüsse und seine Leute liefen in Unordnung, aber tapfer vor, bis sie auf 150 Schritt an die Engländer herangekommen waren. Dann aber hatte es ein Ende: Die Wirkung der Geschütze und das auf die Abessinier einströmende Feuer der Raketen machte, daß an keinen Halt mehr zu denken war; Hunderte deckten, mit dem Anführer (Fit Auri, S. 19) an der Spitze, die Wahlstatt; der Rest stob auseinander und flüchtete nach der Burg zurück.
Theodor, welcher seines Sieges sicher war, hatte unterdessen geschickt eine andere Abtheilung in den Rücken der englischen Bagage gesandt; aber auch dieser ging es schlecht. Von einer Bergbatterie unterstützt, richtete die Bagagemannschaft ein entsetzliches Blutbad unter den Abessiniern an, die immer in dem Glauben gelebt hatten, wehrlose Leute vor sich zu haben. Von diesen 600 Mann kehrte keiner in die Amba heim; die Ueberlebenden konnten nicht in die Burg zurück, da ihnen der Rückzug abgeschnitten war, und, ins Land fliehend, wurden sie ein Opfer der erbitterten Bevölkerung. Der Kampf dauerte bis 6½ Uhr [pg 296]Abends, wo Dunkelheit und Regen die Engländer nöthigten, die Verfolgung, die bis an die Felsenwälle Magdala’s selbst führte, einzustellen. Während des ganzen Gefechts, das die Engländer als „Schlacht von Arodsche“ bezeichnen, fand ein furchtbares Gewitter statt, sodaß Donner und Kanonengebrüll sich miteinander mischten. Die Zahl der abessinischen Todten betrug viele hundert, die Engländer dagegen hatten keinen Todten und nur zwanzig Verwundete.
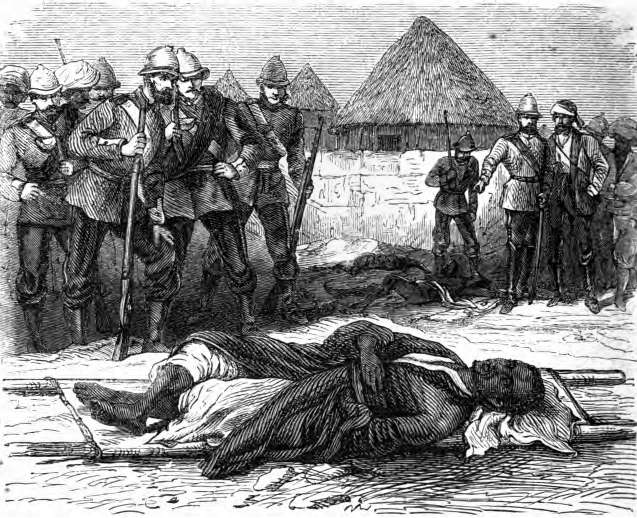
Theodor war über den Mißerfolg seiner Waffen außer sich. Zum ersten Male, seit er die Krone trug, war er ordentlich geschlagen worden, und zwar von den verachteten „rothen Barbaren“. Seine Wuth kannte keine Grenzen, und das Damoklesschwert schwebte fortwährend über dem Haupte der europäischen Gefangenen. Indessen kühlte er seinen Zorn nur an den abessinischen Gefangenen, von denen er über 300 vor den Augen der Europäer hinrichten und über die Felswälle Magdala’s hinabstürzen ließ. Aber soviel sah er ein, daß er auf die Dauer den Engländern nicht zu widerstehen vermöge. Am nächsten Morgen sandte er daher den Missionär Flad, von zwei abessinischen Häuptlingen begleitet, in das englische Lager, um zu unterhandeln. Die einzige Antwort, die [pg 297]Sir Robert Napier durch diese dem König geben konnte, war: bedingungslose Kapitulation.
Noch einmal schickte Theodor die Parlamentäre ins Lager, doch Sir Robert Napier gab ihnen dieselbe Antwort, und traurig waren sie im Begriff, in die Gefangenschaft zurückzukehren, als sie auf dem Wege die plötzlich freigegebenen Europäer Cameron, Rassam und einige der Handwerker antrafen. Am nächsten Morgen wurden alle übrigen Gefangenen freigelassen, der Franzose Bardel, den man für den schlechten Rathgeber Theodor’s hielt, ausgenommen. Bardel fanden die Truppen später, bei der Einnahme von Islam-Gie, hinter einem Felsen liegend, krank vor Hunger und Fieber. Theodor hatte ihn aus Magdala hinausgejagt. Dieser selbst aber war entschlossen, sich nicht zu unterwerfen und bis zum letzten Augenblicke auszuhalten. Lieber wollte er muthig untergehen, als feige sich ergeben. So blieb denn den Engländern nichts übrig, als zum Sturm auf Magdala zu schreiten, welches immer noch von einigen tausend Mann besetzt war.
Die Festung, von steilen Felsen beschützt, so erzählt ein englischer Bericht, bot nur zwei Zugänge, an der Nord- und der Südseite, die so enge waren, daß nur ein Maulthier sie jedesmal passiren konnte, und die jeder zu einem stark verrammelten Thore führten. Das nördliche Thor war es, durch welches der Eingang erzwungen wurde. Gegen halb drei Uhr Nachmittags am 13. April, dem Ostermontag, begann das Bombardement, und nach einer zweistündigen Kanonade wurde der Befehl zum Sturm gegeben. Die Truppen erkletterten den zum Thore führenden Pfad, fanden aber dieses, wie das umgebende Pfahlwerk, von den Kugeln nur wenig verletzt. Die Palissaden mußten daher mit Hülfe einer Strickleiter überstiegen werden, um das Festungsthor von beiden Seiten angreifen und die Vertheidiger zurücktreiben zu können. Den Zugang bildeten zwei etwa zehn Fuß voneinander entfernte Thore; der Raum zwischen denselben war mit schweren Steinen angefüllt. Hatte die Kanonade auch keinen direkten Vortheil erzielt, so trieb sie doch die Vertheidiger zurück. Nur sechs Offiziere stellten sich mit Todesverachtung den Angreifern entgegen, doch waren ihrer zu wenige, um die Position halten zu können.
Als die Engländer über die Leichen dieser Tapferen vordrangen, fanden sie auf einer etwas entfernten Anhöhe den entseelten Körper des Königs Theodoros liegen – er hatte die Schande nicht überstehen können und sich, um einer schmachvollen Gefangenschaft zu entgehen, durch den Mund erschossen, und zwar mit einem jener Revolver, welche ihm „die Königin Victoria zum Zeichen ihrer Dankbarkeit für die Güte geschenkt hatte, die er ihrem Diener Plowden erwiesen.“ So sagte die Inschrift des sechsläufigen Revolvers. Theodor’s Waffenträger gab die Einzelheiten an über das Verhalten seines Herrn in den letzten Stunden während des Angriffs der Engländer, gegen welchen der sonst so gefürchtete Tyrann nur mit wenigen Getreuen Stand hielt. Zweimal brach unter den hervorragendsten Häuptlingen und deren Gefolge Meuterei aus. Sie weigerten sich, an seiner Seite zu kämpfen, und beschlossen, ihn dem Feind auszuliefern, [pg 298]doch hatten sie noch immer nicht genug Muth, ihr Vorhaben auszuführen. Als so Alles verloren war, erschoß sich Theodor selbst, gleichsam um seine Feinde dadurch zu beschämen, daß er wie ein König sterbe. Das Gesicht des Todten ließ allerdings nicht auf seine früheren Züge schließen, zumal da das Auge das Feuer und den Ausdruck verloren, die als sein Charakteristicum bezeichnet wurden. Die Stirn zeugte von Intelligenz, der Mund von Entschlossenheit und Grausamkeit. Eine Anzahl englischer Truppen hielt bei dem königlichen Leichnam Wache, bis er, am Abend des 14. April, in der Kirche von Magdala begraben wurde.
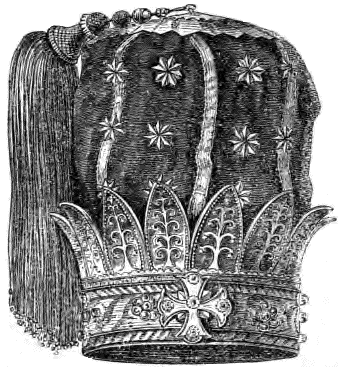
Der englische Oberbefehlshaber bot das eroberte Magdala dem Gobazye, Schum von Waag, an; dieser lehnte jedoch das Geschenk ab, weil er es nicht gegen die Angriffe der Wollo-Galla vertheidigen könne und es überdies noch jedem, der dort geherrscht, den Untergang bereitet habe. Deshalb beschloß Napier, Magdala zu zerstören. Am Nachmittag des 17. April wurde der Ort in Brand gesteckt, die hochaufwirbelnden Feuer- und Rauchsäulen verkündeten den erstaunten Eingeborenen, daß Theodor gefallen, seine Zwingburg zerstört sei. Mit der Kirche, die man vor den Flammen nicht retten konnte, verbrannte auch der Leichnam des Königs. Damit war jedoch nur der Ort Magdala vernichtet, die natürliche Felsenfeste aber war unzerstörbar. Die Stadt an und für sich war uninteressant, sie bestand aus den gewöhnlichen Hütten mit kegelförmigen Strohdächern. Nur die keineswegs schöne Kirche und die Wohnung Theodor’s stachen von den übrigen Häusern ab. Letztere bestand aus zwei Stockwerken und war mit einem flachen Dache gedeckt. In ihr fand sich eine Anzahl europäischer Luxusartikel vor, Klaviere, Harmoniums, Spieldosen, Patronen für Hinterlader und ein Gemenge anderer Gegenstände. Sonst fanden sich Zeichen der Civilisation nur in den Werkstätten der von Theodor gefangen gehaltenen Handwerker. Einige Kronen, Becher, die Mörser Theodor’s, Speere, Säbel, Kreuze, amharische Bibeln u. s. w. wurden als Trophäen mit nach England genommen. Unter den Gefangenen befand sich auch ein Sohn Theodor’s, welchen der Obergeneral mit nach England zu nehmen beschloß. Auch die beiden Königinnen fielen den Engländern in die Hände. Die rechtmäßige Gattin Toronesch, die Tochter Ubié’s, erschien als eine vornehm aussehende Frau von [pg 299]26 Jahren, mit heller Hautfarbe, lebhaften Augen, hübscher Hand und wunderschönem Haar, das in dichten Locken auf die Schultern herabfiel. Sie vermochte das Ende ihres Gemahles nicht zu überleben und starb auf dem Wege nach der Küste.
Sofort begannen die Engländer den Rückmarsch; um den Besitz der kahlen Felsenwände Magdala’s, das zur Berühmtheit geworden, stritten sich nun wieder die Galla – für die Abessinier war das Land am Kollogebirge, welches sie von ihren Stammesgenossen in Schoa trennt, verloren, und der muhamedanische Keil, den einst Theodor beseitigt, war wieder zwischen die christlichen Reiche eingeschoben. Auf der Talanta-Hochebene sammelte Sir R. Napier sein kleines tapferes Heer, hielt über dasselbe Revue und dankte ihm für die bewiesene Aufopferung. Dann wurde die Dschidda überschritten und auf demselben Wege, den man gekommen, die Heimkehr vollzogen.
Die befreiten Gefangenen und die Beute brachten die Engländer triumphirend nach Zula, von wo sie nach England eingeschifft wurden. Auch die deutschen Handwerker kehrten heim und nur Schimper und Zander zogen es vor, sich nach Adoa in Tigrié zu begeben, wo sie ihre Tage beschließen wollen. Die Expedition selbst war ein großer Erfolg, für den England aber theuer bezahlen mußte. Wenn der Brief, den Theodor Ende 1862 an die Königin Victoria schrieb, im Auswärtigen Amte nicht vergessen und nicht unbeantwortet geblieben wäre, so würde kein Grund vorhanden gewesen sein, die Expedition überhaupt zu unternehmen, 6 Millionen Pfund Sterling zu opfern und einige Tausend schlecht bewaffneter Abessinier mit Armstrongkanonen und Hinterladern niederzuschießen.
Selten wurde wol ein Kriegszug mit solchem Widerstreben unternommen, mit solcher Genauigkeit entworfen und so rasch und vollständig ausgeführt, wie die englische Expedition gegen Abessinien. Sir Robert Napier konnte mit Cäsar schreiben: Veni, vidi, vici! Der König todt, Magdala erstürmt, die Gefangenen frei! Das waren die nächsten Resultate. Die Schnelligkeit und Entschiedenheit des Erfolges, die vollständige Vernichtung Theodor’s und seiner Macht kann uns kaum Wunder nehmen. Der Kampf zwischen einem englischen Heere mit englischen Waffen und einer Streitmacht wenig geschulter, wenn auch tapferer Abessinier war für letztere von vornherein ein hoffnungsloser. Das eigenthümliche Verdienst der Engländer bestand aber nicht darin, daß sie die Abessinier, sondern daß sie das Land besiegten. Die Natur kämpfte gegen sie, aber die Wissenschaft und die Organisation überwanden diesen gefährlichsten der Gegner. Napier mußte sich fast Zoll für Zoll erst den Weg bahnen, und dieser mühsame und gefahrvolle Marsch ging über jäh abstürzende Klippen und an schwindelnden Abgründen vorbei; dazu gesellte sich die Kälte auf den Alpenhöhen von 12,000 Fuß über der Meeresfläche. Man begreift die ängstliche Spannung der englischen Armee, indem sie sich Magdala näherte, Theodor möchte sich zurückziehen und [pg 300]sie in endloser Verfolgung seiner Person und seiner Gefangenen zu ermüden suchen – aber der Negus hatte geschworen: „wenn auch alle seine Truppen flöhen, allein den Briten Stand zu halten“. Und er hat Wort gehalten, und in der That kann man im Hinblick auf die früheren Großthaten und die letzte Stunde sein Mitgefühl dem Manne nicht versagen, der selbst die Engländer zwang, ihn zu zermalmen. Er war aus dem Stoffe vieler orientalischer Eroberer gemacht, ein willensstarker, bedeutender Mensch, aber ohne Selbstbeherrschung und unfähig, die Kraft einer der seinigen überlegenen Civilisation zu begreifen. Selbst die Engländer ließen dem überwundenen Feinde schließlich Gerechtigkeit widerfahren und eines ihrer Blätter ruft aus: „Schade um den Mann! Der wahnsinnige Barbar, das feige Ungeheuer, als welchen ihn die schreibseligen Judenmissionäre in ihren Episteln aus der Gefangenschaft schilderten, war vielleicht der einzige wirkliche Held in diesem romantischen Drama. Schade um den Mann! Ein Mann von wilder Genialität, durchdringendem Scharfsinn und eiserner Willenskraft, mit all den Eigenschaften ausgerüstet, welche nöthig sind, um Afrikanern zu imponiren und Barbaren für die Civilisation zu gewinnen, so erschien er unsern Kriegern und er hat ihr Urtheil durch sein Herzblut besiegelt.“
In Abessinien sind von Zeit zu Zeit große Männer aufgetreten, welche ihr daniederliegendes Vaterland aus dem Staube zu heben suchten – der Abuna Tekla Haimanot stellte zu Ende des 13. Jahrhunderts das Reich unter der salomonischen Dynastie wieder her; Kaiser Fasilides verjagte die Jesuiten und unterwarf alle Rebellen – aber größer und gewaltiger erscheint der Sohn der armen Kussohändlerin aus Koara, Theodor II. – Und Abessinien? wird man fragen. Ohne kräftige Regierung steht es wieder da, zerklüftet und zerfallen, als das Land, das es von je gewesen, „das Land der Verwirrung“.

Ende.
Verlag von Otto Spamer in Leipzig.
Das Buch der Reisen und Entdeckungen.
Neue illustrirte
Bibliothek der Länder- und Völkerkunde.
Herausgegeben
unter Mitwirkung mehrerer Geographen und Schulmänner.
Zum Subscriptions-Preis von 5 Sgr. = 18 Kr. rhein. pro Heft zu beziehen.
6–10 Hefte bilden einen Band, welcher ein abgeschlossenes Werk enthält.
Jeder Band von 18–30 Bogen ist einzeln zu haben und kostet:
geheftet 1-1/3 Thlr. = 2 Fl. 24 Kr. rhein. bis 2 Thlr. = 3 Fl. 36 Kr. rhein.
In elegantem Prachtband 1-2/3 Thlr. = 3 Fl. rhein. bis 2-1/3 Thlr. = 4 Fl. 12 Kr. rhein.
A. Aeltere Reisen.
I.
Cook, der Weltumsegler. Leben, Reisen und Ende des Kapitän James Cook, insbesondere Schilderung seiner drei großen Entdeckungsfahrten. Nebst einem Blick auf die heutigen Zustände der Südsee-Inselwelt. Herausgegeben von Dr. Karl Müller. Mit 120 Text-Abbildungen, fünf Tonbildern etc. Vollständig in 6 Heften. In elegantem Prachtband 1-2/3 Thlr.
B. Neuere Reisen.
Amerika.
Kane, der Nordpol-Fahrer. Arktische Fahrten und Entdeckungen der zweiten Grinnell-Expedition zur Aufsuchung Sir John Franklin’s in den Jahren 1853, 1854 und 1855 unter Dr. Elisha Kent Kane. Vierte durchgesehene Auflage. Mit 125 Text-Abbildungen nach Zeichnungen des Verfassers, sechs Tondrucktafeln und zwei Kärtchen. Vollständig in 6 Heften. Elegant gebunden 1-2/3 Thlr.
Die Franklin-Expeditionen und ihr Ausgang. Entdeckung der nordwestlichen Durchfahrt durch Mac Clure, sowie Auffindung der Ueberreste von Franklin’s Expedition durch Kapitän Sir M’Clintock, R. N. L. – Zweite, durchgesehene und vermehrte Auflage. Mit 110 Text-Abbildungen, 5 Tonbildern, mehreren Kartenumrissen, sowie einer Karte der nördlichen Polarländer etc. Vollständig in 6 Heften. In elegantem Prachtband 1-2/3 Thlr.
Afrika.
Livingstone, der Missionär I. Aeltere und neuere Erforschungsreisen im Innern Afrika’s. In Schilderungen der bekanntesten älteren und neueren Reisen, insbesondere der großen Entdeckungen im südlichen Afrika während der Jahre 1840 bis 1856 durch Dr. David Livingstone. Dritte Auflage. Mit 90 Text-Abbildungen und 4 Tondrucktafeln. Vollständig in 6 Heften. In elegantem Prachtband 1-2/3 Thlr.
Livingstone, der Missionär II. Neueste Erforschungsreisen im Süden Afrika’s und auf dem Eilande Madagascar. In Schilderungen von David Livingstone’s neuesten Forschungen während der Jahre 1858–1864; der Universitäts-Mission und Livingstone’s letzter Expedition von 1866. Ferner der Reisen von Albert Roscher und Karl Mauch, der portugiesischen Expedition in das Land des Muata-Kazembe, sowie der Reisen auf der Insel Madagascar während des letzten Jahrzehnts. Mit 90 Text-Abbildungen, sechs Tondrucktafeln und einer Uebersichtskarte des südlichen und mittleren Afrika sammt Madagascar, unter Angabe der Reiserouten von David Livingstone, du Chaillu, Andersson, Burton-Speke, Speke-Grant, A. Roscher u. s. w. Vollständig in 8 Heften. In elegantem Prachtband 1-2/3 Thlr.
Das Buch der Reisen und Entdeckungen.
Afrika.
Die neuesten Entdeckungsreisen an der Westküste Afrika’s. Mit besonderer Berücksichtigung der Reisen und Abenteuer, Handels- und Jagdzüge von Paul Belloni du Chaillu im äquatorialen Afrika, sowie von Ladislaus Magyar in Benguela und Bihe, von C. Joh. Anderson am Okavango-Flusse. Bearbeitet von H. Wagner. Mit über 100 Text-Abbildungen, fünf Tonbildern und zwei Karten etc. Vollständig in 6 Heften. In elegantem Prachtband 1-2/3 Thlr.
Eduard Vogel, der Afrika-Reisende. Schilderung der Reisen und Entdeckungen des Dr. Eduard Vogel in Central-Afrika: in der großen Wüste, in den Ländern des Sudan, am Tsad u. s. w. Nebst einem Lebensabriß des Reisenden. Nach den Originalquellen bearbeitet von Hermann Wagner. Zweite durchgesehene Auflage. Mit 100 Text-Abbildungen, acht Tondrucktafeln und einer Karte von Vogel’s Reiseroute. Vollständig in 6 Heften. In elegantem Prachtband 1-2/3 Thlr.
Abessinien, das Alpenland unter den Tropen und seine Grenzländer. Schilderungen von Land und Volk, vornehmlich unter König Theodoros (1855–1868). Nach den Berichten älterer und neuerer Reisender bearbeitet von Dr. Richard Andree. Mit 80 Text-Abbildungen, sechs Tonbildern sowie einer neuen Karte von Abessinien. Vollständig in 6 Heften. In elegantem Prachtband 1-2/3 Thlr.
Die Erforschung des Nilquellen-Gebietes und der angrenzenden Länder von Zanzibar bis Chartum. Nach Burton, Speke, Baker, Petherick, Heuglin, v. d. Decken u. A. In 6–8 Heften. Mit 100 Text-Abbildungen, Tondrucktafeln, einer Karte etc. (In Vorbereitung.)
Asien.
Die Nippon-Fahrer oder das wiedererschlossene Japan. In Schilderungen der bekanntesten älteren und neueren Reisen, insbesondere der amerikanischen Expedition in den Jahren 1852 bis 1854 und der preußischen Expedition nach Ostasien in den Jahren 1860 und 1861. Ursprünglich bearbeitet von Friedrich Steger und Hermann Wagner. In neuer Auflage herausgegeben von Dr. Richard Andree. Zweite gänzlich umgearbeitete, vermehrte Auflage. Mit etwa 150 Text-Abbildungen, sieben Tondrucktafeln, sowie einer Karte von Japan. Vollständig in 10 Heften. In elegantem Prachtband 2-1/3 Thlr.
Reisen in den Steppen und Hochgebirgen Sibiriens und der angrenzenden Länder Central-Asiens. Nach Aufzeichnungen von T. W. Atkinson und Anderen. Bearbeitet von A. v. Etzel und H. Wagner. Mit 120 Text-Abbildungen und fünf Tondrucktafeln. Vollständig in 8 Heften. In elegantem Prachtband 1-2/3 Thlr.
Das Amur-Gebiet und seine Bedeutung. Reisen in Theilen der Mongolei, in den angrenzenden Gegenden Ost-Sibiriens, am Amur und seinen Nebenflüssen. Nach den neuesten Berichten, vornehmlich nach Aufzeichnungen von A. Michie, G. Radde, R. Maack und Anderen. Herausgegeben von Dr. Richard Andree. Mit 80 Text-Illustrationen, vier Tonbildern, sowie einer Karte des asiatischen Rußlands und der angrenzenden Theile von Inner-Asien. Vollständig in 6 Heften. In eleg. Prachtband 1-2/3 Thlr.
Die ostasiatische Inselwelt I. Land und Leute von Niederländisch-Indien:
den Sunda-Inseln, den Molukken sowie Neu-Guinea. Reise-Erinnerungen und Schilderungen, aufgezeichnet
während seines Aufenthaltes in Holländisch-Ostindien und herausgegeben von Dr. S. Friedmann.
Vollständig in 6 Heften. In elegantem Prachtband 1-2/3 Thlr.
Das Tropen-Eiland Java. Mit 120 Text-Abbildungen, sechs Tonbildern und einer Karte von Java.
Die ostasiatische Inselwelt II. Land und Leute von Niederländisch-Indien:
den Sunda-Inseln, den Molukken sowie Neu-Guinea. Reise-Erinnerungen und Schilderungen, aufgezeichnet
während seines Aufenthaltes in Holländisch-Ostindien und herausgegeben von Dr. S. Friedmann.
Vollständig in 6 Heften. In elegantem Prachtband 1-2/3 Thlr.
Sumatra, Borneo, Celebes, die Molukken und Neu-Guinea. Mit 100 Text-Illustrationen,
sechs Tonbildern etc.
Neueste Kinderschriften, illustrirt durch F. Flinzer u. A.
Die Kinderstube I. Was man seinen Kindern erzählt, wenn sie 2 bis 5 Jahre alt sind. Kleine Geschichtchen, Gedichtchen und Räthsel. Von Ernst Lausch, Lehrer an der Ersten Bürgerschule zu Wittenberg. – In zwei Abtheilungen, mit 54 Text-Abbildungen und drei Buntbildern. Geheftet 15 Sgr. = 54 Kr. rhein. In prächtig ausgestattetem Umschlag gebunden 20 Sgr. = 1 Fl. 12 Kr. rhein.
Die erste Abtheilung enthält 50 Geschichtchen und Gedichtchen, die zweite Abtheilung 50 Gedichtchen, Räthsel und Gebete zum Auswendiglernen.
Die Kinderstube II. Hundert kleine Erzählungen, Gedichte und Verschen für Kinder von 4 bis 6 Jahren. Der lieben Kinderwelt und deren Freunden gewidmet von Fr. A. Glaß. Neu bearbeitet und herausgegeben von Ernst Lausch. Zweite umgearbeitete Auflage. Mit 60 Text-Abbildungen und drei Buntbildern. Geheftet 15 Sgr. = 54 Kr. rhein. In prächtig ausgestattetem Umschlag gebunden 20 Sgr. = 1 Fl. 12 Kr. rhein.
Die Kinderstube III. Erstes A-B-C-, Lese- und Denkbuch für brave Kinder, die leicht und rasch lesen lernen wollen. Ein Führer für Mütter und Erzieher beim ersten Unterricht durch Wort und Bild. Herausgegeben von Ernst Lausch. Mit 300 Text-Abbildungen und zwei Buntbildern. Geheftet 15 Sgr. = 54 Kr. rhein. In prächtig ausgestattetem Umschlag gebunden 20 Sgr. = 1 Fl. 12 Kr. rhein.
Inhalt: I. Die kleinen Buchstaben. II. Die großen Buchstaben und Ergänzung der kleinen. III. Lesebuch. IV. A-B-C-Bilder-Reime. V. Kinderspiele. VI. Rechenbuch. VII. Gebetbuch.
Ein namhafter Pädagog spricht sich über die vorstehenden Bändchen in folgender Weise aus: „Wir können nicht anders als mit Freuden anerkennen, daß es dem Autor gelungen ist, den rechten Stoff und für denselben die rechte Form, d. h. die rechte Sprache für die Kinder-Erzählungen getroffen zu haben. Die Geschichtchen sind höchst einfach und natürlich in der Sprechweise der Kinder gegeben, ohne jedoch etwa einen kindischen oder gar läppischen Ton anzuschlagen. Man siehts diesen Büchelchen deutlich an, daß ein innig liebendes Vaterherz, geleitet von einem klaren pädagogischen Sinne, sie zunächst für sein Theuerstes auf Erden, für seine eigenen Kinder erfunden und erzählt hat. Sie sind den Kleinen aus der Seele gelesen und darum echte Mosaikstücke aus einem wahren und wirklichen Kindesleben. Mit vielem Glück hat der Verfasser in diesen Erzählungen alles Gekünstelte und Sentimentale, alles Ueberschwengliche und Unnatürliche à la Struwelpeter, sowie besonders auch trocknes und langathmiges Moralisiren fern gehalten.“
Noch sei bemerkt, daß diese Geschichtchen so einfach und kunstlos sind, um von jeder Mutter und Erzieherin jemalig nach dem Bedürfniß und der Anschauungsweise ihrer Pfleglinge leicht umgeändert oder auch als Themata zu verschiedenen Variationen benutzt werden zu können.
Wo und wann ein Lehrer von Müttern oder von Erzieherinnen nach lobenswerthen und zweckdienlichen Erzählungen für kleine Kinder befragt wird, da kann derselbe mit gutem Gewissen die Geschichtchen von Ernst Lausch ihnen aufs Wärmste empfehlen.
Gleiches Lob verdient das neueste Bändchen desselben Verfassers unter dem Titel:
Die Schule der Artigkeit.
Goldenes A-B-C der guten Sitten in Lehr- und Beispiel, Mahnung und Warnung. Auserwählte Fabeln, Sprüche und Sprüchwörter für die Kinderstube. Herausgegeben von Ernst Lausch. Mit einem Titelbilde, sowie 60 Text-Abbildungen von F. Flinzer, O. Rostosky und Fr. Waibler. Elegant geheftet 22½ Sgr. = 1 Fl. 21 Kr. rhein. In prächtig ausgestattetem Umschlag gebunden 25 Sgr. = 1 Fl. 30 Kr. rhein.
(Diesem Bändchen schließt sich im nächsten Jahre eine Sammlung der vorzüglichsten deutschen „Märchen und Sagen“ an.)
Die kleinen Tierfreunde.
Fünfzig Unterhaltungen über die Thierwelt. Ein lustiges Büchlein, für die liebe Jugend bearbeitet von Dr. Karl Pilz, Lehrer an der Dritten Bürgerschule zu Leipzig. Zweite, gänzlich umgearbeitete, vermehrte Auflage. Mit 60 Text-Abbildungen und einem Titelbilde. Geheftet 20 Sgr. = 1 Fl. 12 Kr. rhein. Elegant cartonnirt 25 Sgr. = 1 Fl. 30 Kr. rhein.
Kinderschriften von Hermann Wagner.
Illustrirtes Spielbuch für Knaben. 1001 unterhaltende und anregende Belustigungen, Spiele und Beschäftigungen für Körper und Geist, im Freien sowie im Zimmer. Herausgegeben von Hermann Wagner. Zweite unveränderte Auflage. Ein Band von 400 Seiten in buntem Umschlag, mit mehr als 500 in den Text gedruckten Abbildungen, sowie einem Titelbilde. Elegant geheftet Preis 1-1/3 Thlr. = 2 Fl. 24 Kr. rhein. In geschmackvollem Cartonnage-Einband 1½ Thlr. = 2 Fl. 42 Kr. rh.
Der gelehrte Spielkamerad oder der kleine Naturforscher, Thierfreund und Sammler. Anleitung für kleine Physiker, Chemiker, Botaniker und Naturfreunde zum Experimentiren, zur Anlage von Pflanzen-, Stein-, Muschel-, Insekten-, Schmetterling-, Vogel-, Briefmarkensammlungen etc., sowie zur Pflege der Hausthiere und des Hausgartens. Ein Supplement zum „Spielbuch für Knaben“. Herausgegeben von Hermann Wagner. Mit über 200 Text-Abbildungen, sechs Abtheilungs-Frontispicen sowie einem Titelbilde. Eleg. geheftet 1-1/3 Thlr. = 2 Fl. 24 Kr. rh. In geschmackvollem Cartonnage-Einband 1½ Thlr. = 2 Fl. 42 Kr. rhein.
Bestens empfohlen.] Für Knaben und Mädchen. [Zweite Auflage.
Entdeckungsreisen in Haus und Hof. Mit seinen jungen Freunden unternommen von Hermann Wagner. Mit 100 Abbildungen, Titel- und Tonbildern. Eleg. geh. 15 Sgr. = 54 Kr. rhein. Eleg. cartonnirt 20 Sgr. = 1 Fl. 12 Kr. rhein.
Entdeckungsreisen in der Wohnstube. Mit seinen jungen Freunden unternommen von Hermann Wagner. Mit über 100 Abbildungen, Titel- und Tonbildern etc. Eleg. geh. 15 Sgr. = 54 Kr. rh. Eleg. cartonnirt 20 Sgr. = 1 Fl. 12 Kr. rh.
Entdeckungsreisen im Wald und auf der Heide. Mit seinen jungen Freunden unternommen von Hermann Wagner. Mit 130 in den Text gedruckten Abbildungen, zwei Buntdruck- und drei Tonbildern und einer Extrabeilage von getrockneten Moosarten. Eleg. geh. 20 Sgr. = 1 Fl. 12 Kr. rhein. Eleg. cartonnirt 25 Sgr. = 1 Fl. 30 Kr. rhein.
Entdeckungsreisen in Feld und Flur. Mit seinen jungen Freunden unternommen von Hermann Wagner. Mit 110 in den Text gedruckten Abbildungen, zwei Buntdruck- und drei Tonbildern, einem Titelbilde etc. Eleg. geh. 20 Sgr. = 1 Fl. 12 Kr. Eleg. cartonnirt 25 Sgr. = 1 Fl. 30 Kr. rhein.
Entdeckungsreisen in der Heimat. I. Im Süden. Eine Alpenreise mit seinen lieben jungen Freunden unternommen von Hermann Wagner. Mit 100 in den Text gedruckten Abbildungen, Tonbildern etc. Eleg. geh. 20 Sgr. = 1 Fl. 12 Kr. Eleg. cartonnirt 25 Sgr. = 1 Fl. 30 Kr. rhein.
Entdeckungsreisen in der Heimat. II. Im Flachlande von Mitteldeutschland. Streifereien mit seinen lieben jungen Freunden unternommen von Hermann Wagner. Mit 100 in den Text gedruckten Abbildungen, Tonbildern etc. Eleg. geheftet 20 Sgr. = 1 Fl. 12 Kr. Eleg. cartonnirt 25 Sgr. = 1 Fl. 30 Kr. rhein.
Im Grünen oder die kleinen Pflanzenfreunde. Erzählungen aus dem Pflanzenreich von Hermann Wagner. Dritte vermehrte Auflage. Mit 80 Abbildungen und kolor. Titelbilde. In prachtvollem Umschlage eleg. carton. 25 Sgr.
Verlag von Otto Spamer in Leipzig.
Fußnoten
- 1.
- Adara Bille, der Peiniger Krapf’s, ließ sich 1863 in eine Verschwörung gegen den König Theodoros ein, die jedoch verrathen wurde, infolge dessen jener das Leben verlor.
- 2.
- Die beigefügte Abbildung stellt einen pflügenden Mensa dar. Zugochsen und Pflug, ebenso das Joch des Ochsen, sind ganz genau so wie im eigentlichen Abessinien gestaltet.
Bemerkungen zur Textgestalt
Die Fußnoten wurden an das Ende des Textes gesetzt.
Die Werbeseiten wurden am Ende des Textes zusammengefaßt.
Die Originalausgabe ist in Fraktur gesetzt. Antiqua ist in der elektronischen Fassung durch Kursivierung ersetzt (bis auf römische Zahlen und den Titel „Dr.“), Sperrung übernommen.
„etc.“ ist im Original mit der Tironischen Note für et geschrieben.
Korrektur offensichtlicher Druckfehler:
| Seite 1: „Lefebvre“ in „Lefêbvre“ geändert | |
| Seite 16: „Sanglu“ in „Saglu“ geändert | |
| Seite 19: „Indiko,pleustes“ in „Indikopleustes“ geändert, „kopirte-“ in „kopirte,“ | |
| Seite 26: „würtembergischen“ in „württembergischen“ geändert | |
| Seite 51: „Allgemeine-n“ in „Allgemeinen“ geändert | |
| Seite 57: „Mohamedaner“ in „Muhamedaner“ geändert | |
| Seite 67: „lezteren“ in „letzteren“ geändert | |
| Seite 95: zweites Anführungszeichen hinter „vergeblich“ ergänzt | |
| Seite 136: „Metemme“ in „Metemmé“ geändert | |
| Seite 144: „brereitete“ in „bereitete“ geändert | |
| Seite 146: „Waizen“ in „Weizen“ geändert | |
| Seite 153: „Einwoher“ in „Einwohner“ geändert | |
| Seite 172: „Rüppel“ in „Rüppell“ geändert | |
| Seite 175: „Raum“ in „Rauch“ geändert | |
| Seite 185: „Reb,“ in „Reb“ geändert | |
| Seite 199: „Woito“ in „Waito“ geändert | |
| Seite 203: „Lalmalmon“ in „Lamalmon“ geändert | |
| Seite 218: „Schutzherrrn“ in „Schutzherrn“ geändert | |
| Seite 221: „Regeu“ in „Regen“ geändert | |
| Seite 230: „Assasee“ in „Assalsee“ geändert | |
| Seite 236: „Meeresspiel“ in „Meeresspiegel“ geändert | |
| Seite 237: „vernachläßigt“ in „vernachlässigt“ | |
| Seite 246: „Banketsales“ in „Banketsaales“ geändert | |
| Seite 250: „Agollala’s“ in „Angollala’s“ geändert | |
| Seite 253: „Garagué“ in „Guragué“ geändert | |
| Seite 253: überflüssiges Anführungszeichen vor „Satan“ entfernt | |
| Seite 287: „Ungust“ in „Ungunst“ geändert |
Nicht vereinheitlicht wurden (außer in Fällen einzelner, als Druckfehler anzusehender Abweichungen) verschiedene Schreibvarianten wie „Augenbrauen“ und „Augenbraunen“, „Bajonnet“ und „Bajonett“, „danieder“ und „darnieder“, „erwidern“ und „erwiedern“, „Galla“ und „Gala“, „Kusso“ und „Kosso“, „male“ und „Male“, „Tanasee“ und „Tana-See“, „Victoria“ und „Viktoria“, „Wag“ und „Waag“, „wol“ und „wohl“ oder unterschiedliche Verwendung von Akzenten. Das Original verwendet durchgehend die Schreibungen „Schmuz“, „schmuzig“, „jenseit“.