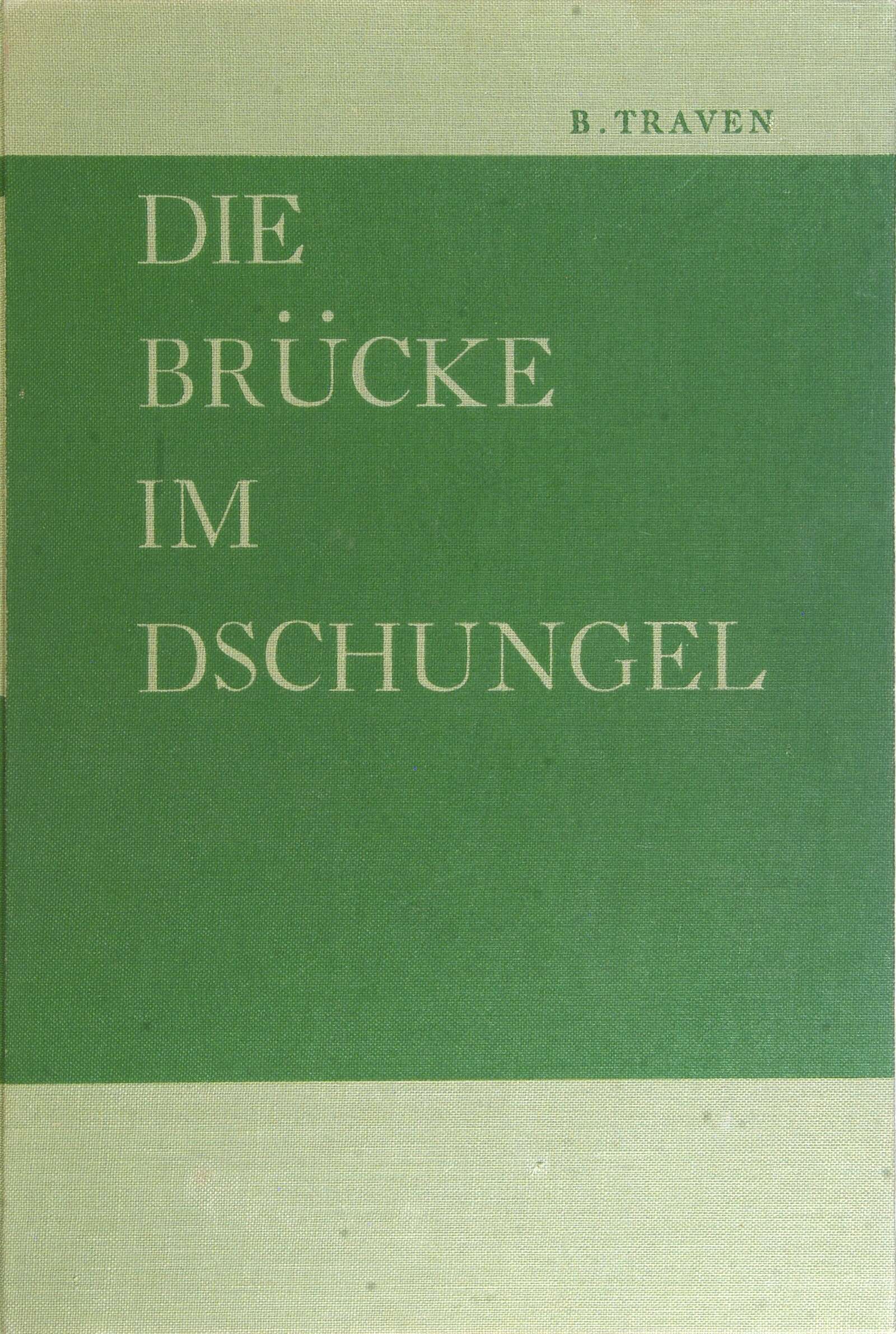
Title: Die Brücke im Dschungel
Author: B. Traven
Release date: January 6, 2026 [eBook #77625]
Language: German
Original publication: Berlin: Büchergilde Gutenberg, 1929
Credits: Jens Sadowski and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
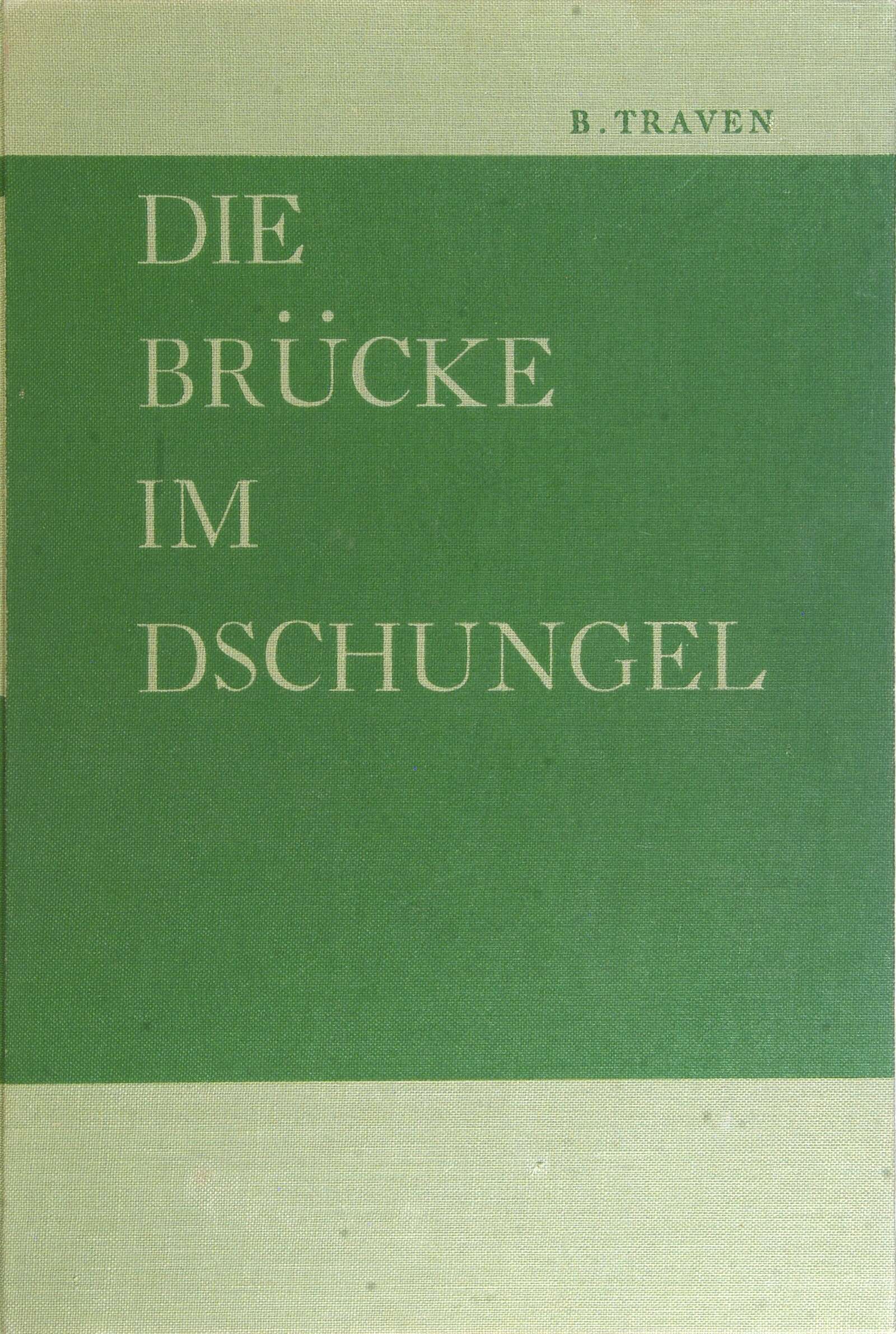
B. TRAVEN Die Brücke im Dschungel
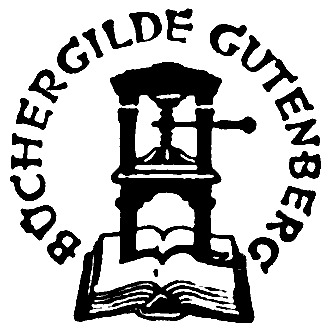
BÜCHERGILDE GUTENBERG
Satz und Druck von der Buchdruckwerkstätte GmbH., Berlin SW 61
Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten. Nachdruck verboten. Copyright 1929 by B. Traven, Tamaulipas (Mexiko)
Den Müttern!
jedes Volkes
jedes Landes
jeder Sprache
jeder Rasse
jeder Farbe
jeder Kreatur
die lebt!
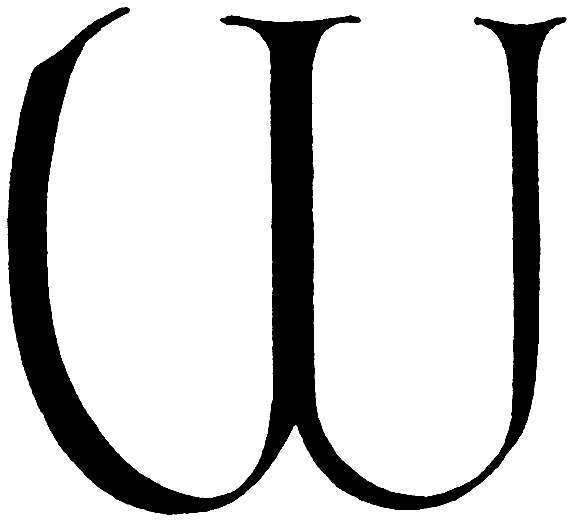 Wann und wo ich Sleigh eigentlich zum
erstenmal getroffen hatte, weiß ich so
genau nicht mehr zu sagen. Doch wenn
ich mich recht erinnere, so war es an
einem moderigen Pfuhl im Dschungel,
wo ich meine Pack-Mules tränken
wollte. Ja, so war es. Es fällt mir jetzt ein, daß, als ich zum
Pfuhl geritten kam, ich in die Mündung eines auf mich gerichteten
Sixshooters sah. Sleigh hatte gehört, daß sich jemand
nähert, und im Dschungel oder im Busch läßt man es nicht
darauf ankommen, sondern man sieht sich rechtzeitig vor.
Man weiß ja nicht, wer der Ankömmling ist und welche Absichten
ihn leiten. Ich hätte es genau so gemacht.
Wann und wo ich Sleigh eigentlich zum
erstenmal getroffen hatte, weiß ich so
genau nicht mehr zu sagen. Doch wenn
ich mich recht erinnere, so war es an
einem moderigen Pfuhl im Dschungel,
wo ich meine Pack-Mules tränken
wollte. Ja, so war es. Es fällt mir jetzt ein, daß, als ich zum
Pfuhl geritten kam, ich in die Mündung eines auf mich gerichteten
Sixshooters sah. Sleigh hatte gehört, daß sich jemand
nähert, und im Dschungel oder im Busch läßt man es nicht
darauf ankommen, sondern man sieht sich rechtzeitig vor.
Man weiß ja nicht, wer der Ankömmling ist und welche Absichten
ihn leiten. Ich hätte es genau so gemacht.
„Stick ’em up, boy! Die Flossen hoch!“
Seelenruhig zog er mir meinen Shooter aus der Tasche des Patronengürtels und schob ihn in seinen Gurt. Wir wechselten ein paar Worte. Er erzählte mir, daß er auf weiter Fahrt sei.
Als dann sein Pferd getränkt war und er den Wasserbeutel gefüllt hatte, saß er auf und sagte: „Zweihundert Schritt, da können Sie Ihren Klicker abholen; ich bin kein Bandit, aber ich weiß ja nicht, ob Sie vielleicht einer sind. Savvy?!“ Ich folgte ihm, und als zweihundert Schritte zwischen uns lagen, winkte er, ließ meinen Revolver fallen und sauste ab. Ich ging zurück zum Pfuhl, ohne ärgerlich auf ihn zu sein; denn ich hätte es ganz genau so gemacht. Er hatte das Trommelröhrchen nur früher hoch als ich, und das entschied, wer das Recht zum Kommandieren hatte. Daß er ein ehrlicher Bursche war, bewies er; denn er konnte mir meine Mules abnehmen und den letzten Faden vom Leibe ziehen. Dann hätte ich noch dankbar sein müssen, wenn er mir den Hut, meine Hose und meine Stiefel gelassen hätte, weil, würde einem auch dieses genommen, man im Dschungel schon lieber um den Gnadenschuß ersucht.
Drei Monate später ritt ich, in einer ganz anderen Gegend, durch ein Indianerdorf. Vor einer grasgedeckten Lehmhütte sah ich einen Weißen stehen, den einzigen Weißen im Dorf. „Hallo!“ rief er herüber. Es war Sleigh.
Ich mußte in seine Hütte kommen, um seine Familie kennenzulernen. Seine Frau war Vollblutindianerin, und sie hatten drei Kinder. Die Frau mußte mir ein Ei backen und etwas vorsetzen, das er Kaffee nannte.
Seit zwanzig Jahren lebte er unter den Indianern oder zwischen ihnen. So genau ließ sich in der kurzen Zeit, die ich in seiner Hütte verbrachte, das wahre Verhältnis nicht feststellen.
Ein Jahr darauf etwa machte ich von Matehuala über Tula eine ziemlich beschwerliche Reise, um an den Tamesi zu kommen mit der Absicht, Alligatoren zu jagen. Es war aber nicht viel los damit; teils war der Dschungel so dicht und undurchdringlich, daß man den Fluß nicht erreichen konnte, teils war die Gegend so sumpfig und morastig, daß man es aufgeben mußte, an die eigentlichen Jagdgebiete heranzukommen. Ich ritt deshalb weiter den Fluß hinunter, um die größeren Nebenflüsse abzusuchen.
So kam ich eines Tages an eine kleine Pumpstation, die das Flußwasser viele Meilen weit zu einer anderen Station pumpt, von wo aus es wieder weitergepumpt wird, bis es die Eisenbahnlinie erreicht. Ein Teil des Wassers dient zur Auffüllung der Lokomotivkessel; der größere Teil des Wassers jedoch wird von der Bahn in Tankwagen zu einigen Dutzend von Dörfern und kleinen Städten, die an der Bahnlinie liegen, gefahren, um die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen.
Der Pumpmeister war ein Indianer. Mit Hilfe eines vierzehnjährigen indianischen Jungen bediente er die Pumpe. Der Kessel wurde mit Holz geheizt, und das Holz wurde von einem anderen Indianer mit Maultieren von der fernen Bahnlinie herangeschafft.
Der Kessel machte den Eindruck, als ob er jeden Augenblick aus den Nähten gehen würde, und die Pumpe, die zweihundert Jahre alt zu sein schien, ächzte, stöhnte, schwitzte, quietschte, keuchte und blubberte, daß den Alligatoren und Jaguaren der Aufenthalt hier in der Nähe sicher nicht zum Paradiese wurde.
Dem Pumpmeister konnte das nur angenehm sein, denn er wohnte ja hier dicht neben seiner Pumpe in einer Hütte, vereint mit seiner ganzen Familie. Je mehr die Pumpe stöhnte und ratterte, um so sicherer konnten seine Kinder sich hier herumtummeln und im Flusse schwimmen.
In der Nähe der Pumpe führte eine Brücke über den Fluß. Die Brücke war breit genug, daß Wagen oder Autos sie benutzen konnten; aber sie hatte kein Geländer. Das wäre auch eine ganz überflüssige Geldausgabe gewesen.
„Hay muchos caimans, Senjor“, sagte der Pumpmeister.
„Wo?“ fragte ich.
„Weiter rauf oder runter. Natürlich nicht gerade hier an meiner Pumpe. Das wäre mir gar nicht einmal lieb. Die würden mir die kleinen Schweinchen und die Hühner alle wegstehlen.“
„Was ist denn da drüben auf der anderen Seite?“ fragte ich.
„Da ist Prärie. Ein Cattle-Ranch. Eine Viehweide. Gehört einem Amerikaner. Dahinter kommt dann wieder Dschungel. Und dann etwa zwanzig Meilen durch den Dschungel, da kommt ein Camp, da bohren sie auf Öl. Die haben hier die Brücke gebaut. Die müssen ja hier rüber, wenn sie das Material von der Bahn holen.“
„Wer ist denn auf dem Rancho?“
„Ein Gringo.“
„Ach was, ich meine, wer nach dem Vieh sieht?“
„Das habe ich Ihnen doch soeben gesagt: Ein Gringo.“
„Wo wohnt er denn?“
„Gleich da hinter dem Busch.“
„Muy bien! Da will ich doch mal rüber, sehen, wie es ihm geht.“
Hinter dem Gebüsch waren sechs oder acht der üblichen Indianerhütten, rauchende Indianerfrauen und herumjagende nackte braune Kinder die Menge. Hier war Gras und Wasser im Überfluß; also fanden auch die Indianer ihren Lebensunterhalt. Die Weide gehörte ihnen zwar nicht, aber daran störten sie sich nicht. Jede Familie hatte ein paar Ziegen, einige Esel, ein Dutzend Hühner, und im Wasser waren so viele und so schwere Fische, daß die Leute um ihre Mahlzeiten nie verlegen zu sein brauchten. Ein umgebogener Nagel mit einem kleinen Fisch daran und einem Stück Schnur war das ganze Angelgerät. Die Männer arbeiteten bei den Ölsuchern, oder sie brannten Holzkohle, um die Bedürfnisse zu befriedigen, die ihnen die Zivilisation gebracht hatte. Aber diese Bedürfnisse beschränkten sie auf das Allernotwendigste. Weder die müßig auf dem Erdboden hockenden Frauen, noch die kreischenden Kinder ließen sich durch mich stören. Nach meinem Manne zu fragen, hielt ich für überflüssig, denn im Hintergrunde sah ich eine Hütte, die zwar nach Indianerart gebaut, jedoch größer und sorgfältiger angelegt war. Kein Zweifel, da wohnte mein Amerikaner.
Ich ritt zur Hütte, bis ich in respektvoller Entfernung der Tür war, wo ich ruhig hielt, ohne die Bewohner durch Rufen zu stören. Eine Tür war es ja eigentlich nicht, sondern es war eine türgroße Öffnung in der Wand. Aber da die Leute eine solche Öffnung Tür nennen, fühle ich mich nicht berechtigt, ihr einen anderen Namen zu geben.
Nachdem ich eine Weile gewartet hatte, kam eine Frau, eine Indianerin, heraus und sagte: „Pase, Senjor!“
Ich stieg ab, und als ich in die Hütte trat, fand ich, daß die Frau die Gattin meines alten Bekannten Sleigh war. Sie begrüßte mich mit großer Herzlichkeit, lud mich zum Niedersitzen auf einem ächzenden Korbstuhl ein und sagte mir, daß ihr Mann gleich kommen würde, er sei auf der Pastura, um einen Stier hereinzubringen, der gedoktert werden müsse, der Stier sei von einem anderen Stier gespießt worden, und nun könne man in die Wunde schon die ganze Faust tief hineinstecken, und es seien bereits fingerdicke Würmer drin.
Es dauerte auch nicht allzulange, da kam Sleigh an mit seinem Stier, den er mit Hilfe eines Indianerjungen in den Korral trieb. Dann stieg er vom Pferde und schüttelte mir die Hand. „Haben Sie nicht vielleicht eine Zeitung bei sich?“ fragte er gleich darauf. „Ich habe seit acht Monaten kein Stück Zeitung in der Hand gehabt, und manchmal möchte man ja doch gern wissen, was los ist.“
„Ich habe den Brooklyn Eagle hier, ist aber auch schon fünf Wochen alt, alles, was ich habe.“
„Geben Sie her, der ist ja noch ganz warm von der Presse, wenn er erst fünf Wochen alt ist.“
Er setzte sich seine Brille auf. Das tat er sehr bedächtig und umständlich, denn sie war – für ihn wenigstens – mehr wert als ein dicker Brillantring. Während er sie an den Ohren zurechtrückte, sagte er: „Rosita, gib dem Senjor etwas zu essen, er hat Hunger.“
Von jeder Seite las er zwei Zeilen, dann nickte er, um seine volle Zustimmung mit dem darin Gedruckten zu bekunden, sehr nachdenklich, faltete die Zeitung zusammen, setzte die Brille ab und sagte gedankenschwer: „Es ist doch gut, daß man wieder einmal eine Zeitung gelesen hat.“
Sein Wunsch nach einer Zeitung war nunmehr vollkommen befriedigt. Von den paar Zeilen, die er gelesen hatte, hatte er auch nicht einen einzigen Gedanken aufgenommen oder auch nur gefaßt. Was kümmerte ihn dieser Trubel der Welt, der sich in den Zeitungen austobte? Hätte er in der Zeitung gelesen, die ganzen Vereinigten Staaten und Kanada seien durch eine Wassersflut von der Erdoberfläche hinweggespült worden, so würde er gesagt haben: „Wer hätte so etwas denken können, wir haben hier gar nichts davon gemerkt. Ich wollte vorige Woche noch an meine Schwester schreiben, die ist Sekretärin bei einer Methodistengemeinde, aber das ist ja nun nicht mehr notwendig. Wer hätte auch so etwas denken können!“ Dabei würde er auch nicht eine Miene seines Gesichts verzogen haben.
„Ich bin hier auf Alligatoren“, sagte ich.
„Großartig, Mann! Massenhaft. Die können Sie hier herdenweise schießen. Aber wir könnten ja erst einmal auf einen Hirsch gehen.“
„Warum nicht. Haben Sie denn viel Wild hier?“
„Massenhaft! Bleiben Sie nur ein paar Tage hier und sehen Sie sich um. Was haben wir denn heute? Donnerstag. Da kommen Sie gut. Meine Frau geht morgen früh mit den Kindern auf Besuch zu ihrer Mutter. Ich bringe sie bis zur Station. Den Morgen darauf bin ich wieder zurück, dann sind wir hier ganz allein und haben die ganze Hütte für uns. Eines von den Nachbarmädchen kommt herüber zum Kochen. Da können wir hier ganz angenehm hausen.“
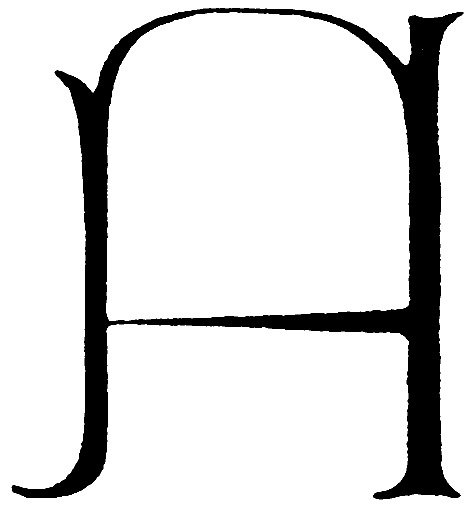 Am Samstag morgen kam Sleigh zurück. Ich
hatte inzwischen ein wenig gefischt und alle
Hütten gut versorgt.
Am Samstag morgen kam Sleigh zurück. Ich
hatte inzwischen ein wenig gefischt und alle
Hütten gut versorgt.
„Heute abend ist Tanz,“ sagte Sleigh, „drüben an der Pumpe. Der Pumpmeister hat Musik bestellt. Er hat auch einen Kasten Bier und zwei Kasten Limonade herangeschafft, damit er die Kosten für die Musik herauskriegt.“
„Wie stark ist denn das Orchester?“
„Ein Geiger und ein Gitarrespieler.“
„Die können doch soviel nicht kosten.“
„Ja, denken Sie denn, daß er an dem Bier und der Limonade viel verdient?“
Das Indianermädchen kam, um für uns zu kochen. Sie brachte ihren Säugling mit, obgleich sie selber kaum aus den Säuglingsjahren heraus war.
„Der Mann ist ihr davongelaufen, dem armen Ding“, sagte Sleigh.
Sie war sehr häßlich, und das ist eine Ausnahme hier unter den indianischen Mädchen, die an Schönheit miteinander wetteifern.
„Ihr Mann hat sie sicher nur des Nachts gesehen, und als er sie bei Tageslicht betrachtete, da ist er so aus allen Himmeln gefallen, daß er sich in Nebel verflüchtete, so will mir scheinen“, sagte ich. „Sie soll eigentlich jener Nacht dankbar sein, denn auf andere Weise wäre sie nie zu einem Kinde gekommen, und seit sie nun ein Kind hat, findet vielleicht ein anderer Gefallen an ihr, unter der Suggestion, daß sie verborgene Schönheiten haben müsse.“
„Sie haben ganz recht“, erwiderte Sleigh. „Ihren Spaß hat sie gehabt, und sie ist eigentlich nicht darum mißgestimmt, daß der Bursche abgezogen ist, als vielmehr, daß der Spaß nicht dauernd ist.“
Dann aßen wir unsere Tortillas und Frijoles.
Nachmittags ritten wir auf die Prärie hinaus, um uns das Jungvieh anzusehen und nach frischen Antilopenfährten zu suchen.
Am Abend, als wir wieder bei unseren Tortillas und Frijoles saßen, fragte ich Sleigh, ob an dem Tanzvergnügen nur die Leute teilnehmen, die hier herum wohnen. Er erklärte mir aber, daß wenigstens hundert oder hundertzwanzig Personen anwesend sein werden, die aus allen Richtungen herkommen, aus den verstecktesten Hütten im Dschungel und von den schmalen Flußarmen und Standpfuhlen, fünf bis acht Meilen im Umkreise.
Wir gingen nun rüber zur Pumpstation. Als wir an einer der Nachbarhütten vorüberkamen, sahen wir, daß vor dem Eingang an einem Pfahl eine Laterne hing, die den sandigen Platz vor der Hütte hell erleuchtete. Auf einer rohen Bank saß ein etwa vierzigjähriger Indianer mit einem dünnen Vollbart und spielte auf einer Geige Tanzmusik. Er spielte herzlich schlecht, hielt aber gut den Takt.
„Ja, ist denn der Tanz hier?“ fragte ich Sleigh.
„Das glaube ich doch nicht.“
„Die haben hier aber den Platz gefegt, und da hängt doch eine Laterne. So großartig gehen die nicht mit dem Petroleum um, daß sie aus purem Vergnügen hier Licht machen.“
„Wir werden ja gleich beim Pumpmeister hören. Vielleicht machen die hier einen Tanz für sich. Da sind doch immer zwei oder drei Parteien. Kann sein, daß sie den Pumpmeister nicht mögen.“
An der Pumpstation hing eine düstere verräucherte Laterne. Der Platz war gefegt. Ein paar Burschen saßen herum. Auf einer Bank quetschten sich einige Mädchen in bunten Musselinkleidern. Musik war keine da.
„Was ist denn los?“ fragte Sleigh den Pumpmeister.
„Ich weiß nicht,“ antwortete der, „die Musik ist nicht gekommen. Jetzt ist es zu finster, jetzt kommt sie nicht mehr, der ganze Weg geht ja durch Dschungel. Die haben es mir doch so bestimmt versprochen, aber vielleicht sind sie an der Station hängengeblieben und machen da Musik.“
„Was ist denn drüben beim Garza los, macht der einen Extratanz?“
„Möglich. Der große Junge ist heute abend auf Urlaub gekommen, er arbeitet in Texas. Der alte Garza sucht immer nach einer Gelegenheit, wo er seine musikalischen Talente zeigen kann.“
Wir gingen nun wieder zurück zu Sleighs Hütte, denn er wollte sehen, ob eine bestimmte Kuh, die er am Nachmittag auf der Prärie nicht finden konnte, hereingekommen sei.
Garza saß noch immer vor seinem Jacalito und wimmerte auf der Fiedel. Neben ihm hockte auf dem Erdboden „der große Junge von Texas“. Er war ein zwanzigjähriger Bursche, gut gewaschen und gekämmt, hatte ein neues Hemd an und fühlte sich sonnig, der verwöhnte Gast in seiner Familie zu sein. Auf dem linken Knie hatte er eine Tasse mit schwarzem Kaffee, und auf das rechte Knie stützte er den rechten Ellbogen. In der rechten Hand hatte er eine mit Queso und Chile gefüllte Tortilla. So, jede überflüssige Kraftverschwendung peinlichst vermeidend, führte er bald die linke, bald die rechte Hand, alles auf Kugellagern laufend, an den Mund, um sein Nachtmahl einzunehmen und sich für den anstrengenden Zehnstundentanz zu stärken. Irgendwie würde es ja wohl zum Tanzen kommen; denn wo eine Violine in der Nähe war, da war auch Tanzmusik möglich.
„Bist du denn immer noch nicht fertig, Manuel?“ rief jetzt eine Kinderstimme. Und hinter der Hütte kam ein sechsjähriger Junge vorgesaust und sprang dem zufriedenen Manuel wie ein Panther auf den Nacken, so daß Kaffee und Tortilla, oder was davon noch übrig war, in den Sand kollerten.
Der Kleine saß fest im Nacken, zerraufte dem armen Manuel das strähnige Haar und trommelte ihm mit den kleinen Fäusten auf den Kopf und die Schultern, daß Manuel endlich aufstehen mußte. Carlos rutschte den Rücken hinunter, stellte sich vor den großen Bruder hin und begann, ihn zum Boxkampf herauszufordern. Aber Carlos war nicht ganz auf der Höhe. Gewöhnt, immer barfüßig herumzulaufen, stand er jetzt nicht sicher auf den kleinen Füßen. Manuel hatte ihm von Texas ein Paar echt amerikanische Stiefelchen mitgebracht, und Carlos hatte sie natürlich sofort anziehen müssen, um seinen großen Bruder zu ehren.
Garza, unbekümmert um die Dinge, die da in seiner Nähe sich abspielten, kratzte unermüdlich auf seiner Fiedel herum.
„Der Kleine ist ganz verrückt nach seinem erwachsenen Bruder“, sagte Sleigh, während wir auf seine Behausung zugingen. „Eigentlich sind sie gar nicht einmal Brüder. Der Große ist von der ersten Frau, der und noch ein anderer Junge von fünfzehn. Der Junge von fünfzehn ist nicht ganz richtig im Kopf, er hat zuweilen ganz verrückte Tage. Der Kleine ist von der zweiten Frau des Garza, eine noch ziemlich junge Frau. Aber der Große und der Kleine würden sich am liebsten auffressen vor Liebe. Der Manuel ist nur des Kleinen wegen auf Urlaub gekommen. Er hat seinen ersparten Lohn auf der Bahn verfahren, um ihm die Schuhe zu bringen und eine kleine Gitarre. Der mittlere, der Halbverrückte, ist gegenüber beiden, und selbst gegenüber seinem Vater, völlig indifferent. Ich glaube, er haßt den Kleinen fürchterlich, und wenn er ihm irgend etwas Hinterlistiges antun kann, so läßt er es sich nicht entgehen.“
Inzwischen waren wir zur Hütte gekommen, wo das Mädchen sich auf dem Erdboden ihr Lager zurechtmachte. Sleigh ging hinaus, um nach der Kuh zu sehen. Das Mädchen, ohne sich um meine Anwesenheit zu kümmern, streifte ihr Kleid von den Schultern herunter bis dicht an die Hüften und gab ihrem Säugling zu trinken. Dann schob sie das Kleid wieder hoch, kroch mit dem Würmchen im Arm unter das Moskitonetz und, wie ich an dem Gewoge des Netzes bemerken konnte, zog sie sich darunter aus. Darauf streckte sie, mit einem wohligen Seufzer, der dem vollbrachten Tageswerk galt, alle viere von sich. Ob diese kleine Welt da draußen vor der Hütte einer Tanzlustbarkeit oder einer mysteriösen Tragödie entgegeneilte, war ihr durchaus gleichgültig.
Es fing an, langweilig zu werden. Das kleine rauchige Lämpchen – ein Stückchen Docht in einer kleinen Blechflasche mit Petroleum – machte die Hütte gespenstisch. Die Decke war trockenes Gras. Die Wände waren dünne Stämmchen, durch die man in die Nacht hinaussehen konnte. Käfer, Motten und Schmetterlinge, so groß wie beide ausgebreiteten Hände, kamen auf das flackernde und rußende Flämmchen zugeflogen. Hin und wieder gluckste es in dem nahen Flusse, wenn ein Fisch hochsprang oder ein Tierchen vom Ufer hineinplanschte. Der ganze Erdboden und die umgebende Atmosphäre war angefüllt mit einem nimmer ermüdenden Zirpen, Pfeifen, Quietschen, Winseln und Wimmern. Ein Esel begann kläglich zu trompeten, und einige andere antworteten ihm, um sich Mut gegen die Gefahren der Nacht einzuflößen. Dann brüllte eine Kuh. Ein Mule kam wild angetrabt, von einer eingebildeten oder wirklichen Bestie in Angst gejagt. Als es einige Schritte von der Hütte stand und jemand drin sitzen sah, war es beruhigt, schnüffelte eine Weile auf dem Boden herum und trottete gemächlich wieder hinaus in die Nacht. Abgebrochene Stücke menschlicher Reden und Laute klangen heran und wieder hinweg. Ein gelles Lachen, das scharf durch die Nacht schlug und alles andere übertönte, einen Moment schrill über dem Erdboden hing und sofort hinweggeschluckt wurde, schien die Dunkelheit aufzufärben. Aber als es so hart abgeschnitten verlöscht war, lastete die Dunkelheit schwärzer und wuchtiger als zuvor. Zuweilen wehten einige Noten von der Geige durch die Nacht. Sie schwirrten tänzelnd und krächzend, kamen und gingen, ohne eine Verbindung mit Musik zurückzulassen.
Plötzlich stand Sleigh in dem türlosen Eingang wie ein Schatten. Alles, was man von dem Schatten sehen konnte, war das helle Gesicht.
„Ob das Mädel noch einen Schluck Kaffee zurückgelassen hat?“ fragte er. „Ich habe Durst.“
Das Mädchen verstand nicht Englisch, aber Kaffee hatte sie verstanden und aus dem fragenden Tonfall heraus instinktiv begriffen, was er meinte. Sie hatte geschlafen, denn ich hörte sie schnarchen. Aber das leise Herankommen Sleighs, das ich nicht gehört hatte, das hatte sie im Schlafe deutlich vernommen, und sie war dadurch wach geworden.
„Da steht noch Kaffee auf dem Feuer“, rief sie unter ihrem Netz hervor.
„De veras?“ sagte Sleigh. Dann ging er zum Feuer, wo die Kanne in den glimmenden Holzstückchen stand.
Er goß sich eine Tasse voll.
„Wollen Sie auch noch haben, Gale?“
„No, thanks just the same.“
Das Mädchen schnarchte bereits wieder.
Sleigh setzte sich mir gegenüber und sagte nach einer Weile: „Blitz und Donner noch mal, ich habe das dreckverfluchte Luder von Kuh nicht gesehen. That fucking son of a bitch hat doch ein Kalb hier. Kommt jeden Abend herein, auch des Mittags. Das Kalb ist fest. Ich glaube, wir haben einen Löwen herum. Vielleicht gar ein Pärchen. Dann geht’s bitter. Dem Pena ist vor ein paar Nächten eine feine Milchziege ausgeblieben. Nie wiedergekommen. Die Kuh ist sonst sehr pünktlich.“
„Wie alt ist denn das Kalb?“ fragte ich.
„Acht Wochen. Aber die hängen hier bei uns vier, fünf Monate an der Milch herum. Da ist ganz bestimmt etwas nicht in Ordnung. Ich werde ja morgen sehen. Jetzt in der Nacht kann ich doch nichts tun. Wir wollen uns was erzählen.“
Eine Minute darauf schlief er, nickte aber zu meinem Gespräch, runzelte die Stirn, zog den Mund zu einem Lächeln und machte vorschriftsmäßig alle die Gesten, die ich auf das, was ich sagte, von ihm erwartet hätte, wenn er völlig wach gewesen wäre. Aber er schlief seelenruhig.
„He!“ rief ich plötzlich laut. „Wenn Sie schlafen, brauche ich doch nichts zu sagen.“
„Schlafen?“ fragte er verwundert und mit einem beleidigten Ton in der Stimme. „Ich habe alles gehört, was Sie gesagt haben. Den Ladron Gomez kenne ich persönlich ganz gut, ich habe ja in Cuichapa Vanille gebaut, und in Huatusco war ich zwei Jahre mit einem Kakaofarmer.“
„Was ist denn nun eigentlich mit der Tanzgeschichte? Wird getanzt oder wird nicht getanzt? Wenn nicht, dann fange ich jetzt an zu schlafen. Das ist ja zum Auswachsen.“ Ich wurde in der Tat ungeduldig.
„Wir gehen jetzt wieder rüber zur Bomba, zur Pumpe. Da werden wir nun sehen, was los ist. Der Pumpmeister wird wohl Rat geschafft haben.“
Er zog sich gemächlich die ledernen Cowboy-Hosen herunter, kramte irgendwo einen zerbrochenen Kamm hervor, kratzte sich damit durch das Haar, und dann gingen wir los.
Als wir an der Hütte des Garza vorüberkamen, hing die Laterne noch vor dem Haus; aber Garza selbst saß nicht mehr da. Auch von den Jungen sahen wir keinen. In der Hütte war trübes Licht, und ich sah durch die Staketen, daß die Frau darin Toilette machte.
„Scheint doch Tanz zu sein,“ sagte ich zu Sleigh, „die Senjora da drin zieht sich ihr Bestes an.“
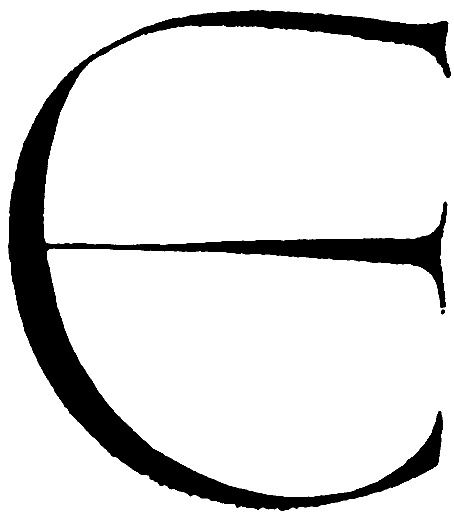 Es war dicke schwarze Nacht. Der Himmel
war klar, und die Sterne standen hell in der
schweren Finsternis.
Es war dicke schwarze Nacht. Der Himmel
war klar, und die Sterne standen hell in der
schweren Finsternis.
Als wir zum Flußufer kamen, mußten wir nach der Brücke tasten. Drüben von der anderen Seite sahen wir die Laterne vom Pumpmeister herüberwinken. Endlich hatten wir die Brücke.
„Ei verflucht noch mal!“ sagte ich. „Da muß man verteufelt vorsichtig sein. Jetzt wäre ich doch wahrhaftig gleich in den Fluß gestürzt. Ist der denn tief?“
„Acht bis fünfzehn Fuß, an den Ufern ziemlich flach. Im Durchschnitt wohl sechs Fuß, an den tiefsten Stellen sicher nicht mehr als fünfzehn“, sagte Sleigh.
„Das ist tief genug, um für immer zu verschwinden“, erwiderte ich.
Ich war geradezu auf die Laterne des Pumpmeisters losgegangen, bis ich plötzlich dicht zu meinen Füßen Sterne funkeln sah. Darüber war ich so erstaunt, daß ich mit einem Ruck stehenblieb, um das Wunder zu betrachten. Aber diese Sterne, die da so merkwürdig glitzerten, war die Spiegelung des Flußwassers, das leise dahinwellte. Sleigh ging weiter rechts neben mir. Ich konnte ihn nur undeutlich sehen, hörte aber seine Tritte auf den Holzplanken der Brücke.
Ganz verwundert war ich über mein Erlebnis, das mir beinahe ein unerwartetes Bad gebracht hätte. Zuerst konnte ich mir gar nicht erklären, wie ich so hatte drauflosdösen können. Aber als ich dann in Ruhe den Vorgang übersah, war es mir durchaus klar: die Brücke kreuzte rechtwinklig zum Flußufer das Wasser; aber in der schwer durchdringlichen Finsternis konnte ich den rechten Winkel nicht fühlen, weil ich weder die Richtung des Ufers noch die der Brücke erkennen konnte. Die Pumpe war nicht unmittelbar am Ausgang der Brücke, sondern etwa dreißig Schritte links vom Ende der Brücke. Vom diesseitigen Ufer aus konnte man nichts weiter erkennen als das Licht der Laterne, die auf dem Platz vor der Pumpe hing. Daß die Pumpe und also das Licht nicht gerade am Ende der Brücke war, hatte ich, ohne darüber nachzudenken, im Gefühl gehabt; was ich aber nicht richtig im Gefühl gehabt hatte, war die wahre seitliche Entfernung der Pumpe von der Brücke. Ich war viel zu scharf auf die Laterne losgegangen, und so war ich auf dem besten Wege, von der Brücke herunter glatt in den Fluß zu laufen. Ein Geländer grenzte sie ja nach den Seiten hin nicht ab. Die Täuschung war so vollkommen, daß, nachdem ich den Sachverhalt erkannt hatte, ich mich nach einigen Schritten schon wieder dicht am Rande befand, weil ich eben das Gefühl nicht los wurde, daß ich mehr auf die Laterne loszugehen habe, um nicht rechts über die Brückenkante zu fallen, wo ja tiefschwarze Nacht lag. Wäre drüben gar keine Laterne gewesen, würde man die Brücke viel sicherer gekreuzt haben. Als wir an das Ende der Brücke kamen, saßen da mehrere halbwüchsige Indianerburschen auf den Planken, ließen die Beine über den Seitenbalken herunterhängen und sangen. Sangen in jener, den Indianern so eigentümlichen Weise, immer innerhalb derselben sechs Töne bleibend, ab und zu aber unvermutet und ohne Übergang die Stimme hoch überschlagen lassend, so daß dieser Ton nicht in derselben Skala lag, wo die übrigen sechs oder sieben lagen, sondern zwei oder gar vier Oktaven höher. Dieser Ton, der den Gesängen die Farbe zu geben hatte, konnte nicht gesungen werden, sondern er wurde geschrillt. Irgendein anderer Gesang würde in den Nächten des Dschungels unnatürlich klingen. Hier tönte er in voller Harmonie nur so, wie er von den Indianern gesungen wird.
Links am Ausgang der Brücke lag die Pumpstation. Rechts der Brücke war ein sandiger, mit dünnem harten Grase bewachsener Platz. Eine Packkarawane war angekommen, die wegen der Nähe des Flusses und der ganz unerwartet schweren Finsternis der Nacht hier Lager zu machen beschlossen hatte. Sie war etwa vierzehn Packesel und drei Reitesel stark. Sie brachte Ware nach den Dschungeldörfern. Die beiden Männer, natürlich auch Indianer, wie alle Leute, die hier herum waren, packten die Tiere ab, während der Junge, der mit ihnen war, ein Feuer anmachte.
Bei der Pumpe sah es jetzt ein wenig bunter aus als eine Stunde vorher. Der Pumpmeister hatte noch eine zweite Laterne aufgehängt. Die Musik war immer noch nicht gekommen, und sie kam jetzt auch auf keinen Fall mehr. Dagegen waren inzwischen zahlreiche Männer, Frauen und Mädchen angekommen. Die Frauen und Mädchen in grünen, roten, blauen und gelben ganz dünnen Kleidchen aus den denkbar billigsten Stoffen. Alle hatten sie Strümpfe an und Schuhe. Keine hatte einen Hut, aber manche hatten ein schwarzes Baumwolltuch. Die Männer waren gekleidet wie immer, denn sie hatten meist ja nur ein Hemd und eine Hose, für Festtag und Arbeitstag dasselbe Zeug. Viele waren barfuß, manche hatten Stiefel, die Mehrzahl aber Sandalen, selbstgemachte. Wer Kinder besaß, hatte sie mitgebracht.
Sie waren nun alle da, und irgend etwas mußte geschehen. Garza war mit seiner Geige herübergekommen und fiedelte unermüdlich darauf herum. Aber niemand nahm sich den Mut, nach dieser Fiedelei zu tanzen. Alles wartete, daß irgendein großer Musiker irgendwoher erscheinen würde, um in diese Zusammenkunft Sinn hineinzubringen. Denn bis jetzt waren die Menschen ganz zwecklos hier. Und wenn schon die bunten Gazelümpchen angezogen werden, wenn schon das Haar stundenlang durchgekämmt, eingeölt und dann sorgfältig auffrisiert worden ist, wenn man schon die schönsten Blumen zusammengesucht und in die schwarzen Strähnen geflochten hat, wenn man schon die kleinen Bälger gebadet, und wenn man endlich auf Eseln oder gar zu Fuß meilenweit durch den Dschungel gewandert ist, dann soll doch auch nachher etwas zu erzählen sein. Aber nun so gar nichts, nur weil die Musik nicht gekommen ist.
Die Frauen und Mädchen sitzen herum und schwätzen; die jüngeren stecken die Köpfe zusammen und kichern oder stehen plötzlich zu zweien oder dreien auf, laufen ein wenig herum, kommen zurück und setzen sich wieder. Ein paar Bänke sind da, sehr roh gearbeitete, und drei arme Stühle aus des Pumpmeisters Hütte. Die Mehrzahl der Damen sitzt auf Baumstämmen, Holzklötzen und morschen Eisenbahnschwellen, dem Feuerungsmaterial für die Pumpe.
Die Kinder balgen sich herum, wälzen sich auf der Erde, jagen sich, kreischen, schreien, heulen und quieken. Die größeren Burschen hocken gruppenweise zusammen auf dem Erdboden, prahlen sich gegenseitig etwas vor, hecken irgendwelche Streiche aus oder zeigen sich gegenseitig wichtige Kunststückchen, Talente und Fingerfertigkeiten, biegen sich Daumen um, recken sich die Knöchel aus, verrenken sich Gliedmaßen, Genick und Augen.
Alles raucht Zigaretten. In Maisblätter gerollter Tabak. Alles raucht: Männer, Frauen, Mädchen, Burschen und die kleinsten Kinder. Während die Mütter die Säuglinge an der Brust haben, rauchen sie und blasen den kleinen Engerlingen den Rauch über das Gesicht. Auch schon der Moskitos wegen. Die Männer stehen auch in kleinen Gruppen zusammen und schwätzen und rauchen. Sie halten ihre Frauen unausgesetzt im Auge, um ihnen, wenn nötig, eine Mühe zu erleichtern.
Ich stehe mit Sleigh, dem Pumpmeister und einem Indianer, der bei den Ölbohrern arbeitet, halbenwegs zwischen der Brücke und der Pumpe. Ich habe das Gesicht auf den Fluß zu gerichtet; aber ich kann natürlich weder die Brücke noch den Fluß erkennen.
Bei den Eseltreibern glimmt das Feuer, und ich sehe, wie der Junge Kaffee in den Kessel schüttet, während sich die Männer die Tortillas wärmen, Käse schaben und Zwiebeln schneiden. Durch das Gebüsch am gegenüberliegenden Ufer sehe ich zwei dünne Lichtchen, die aus den Hütten herüberschimmern. Wenn sich das Gebüsch im leichten Winde bewegt, verschwinden die Fünkchen und tauchen wieder auf, gerade als ob jemand mit einer Laterne durch das Gebüsch hin und her huschte. Zuweilen täuscht es, und man sieht nicht die kleinen Lämpchen, sondern sieht die großen Glühkäfer, die, wenn sie entfernt genug sind, auch nicht größer erscheinen als die Lampen.
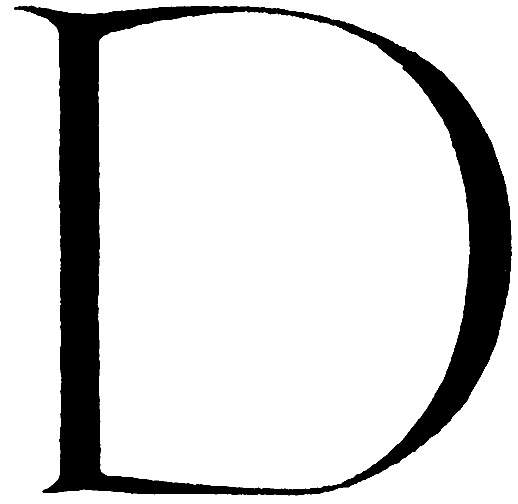 Die Burschen, die auf der Brücke sitzen,
singen noch immer. Sie singen längst
andere Lieder, aber für den Uneingeweihten
scheint es stets die gleiche Melodie
zu sein. Nicht aber für die Burschen.
Rundherum ist Schwatzen, Lachen,
Kichern und Quieken.
Die Burschen, die auf der Brücke sitzen,
singen noch immer. Sie singen längst
andere Lieder, aber für den Uneingeweihten
scheint es stets die gleiche Melodie
zu sein. Nicht aber für die Burschen.
Rundherum ist Schwatzen, Lachen,
Kichern und Quieken.
„Und ich sage Ihnen, die werden gleich wieder zementieren“, spricht Ignacio, der Ölarbeiter, mit Wichtigkeit.
„Wie tief seid ihr denn?“ fragt Sleigh.
„Elfhundert Fuß.“
„Da wird doch noch nicht zementiert,“ sagt der Pumpmeister, „da gibt es doch Bohrungen, wo sie bis auf viertausend Fuß hinuntergehen.“
„Weiß ich doch am besten“, sagt darauf Ignacio mit fachmännischer Sicherheit, obgleich er erst seit fünf Wochen im Ölfeld arbeitet. „Aber ich sage Ihnen, die zementieren Montag oder Dienstag.“
Garza fiedelt unermüdlich, aber keiner folgt seiner Lockung. Das Singen der Burschen ebbt ein wenig schwermütig ab, und in das laute Schwätzen und Lachen der Leute bricht ein verhaltenes Gähnen ein. Nur ein paar der Kinder quieken.
„Warum die zementieren sollen bei elfhundert Fuß, sehe ich nicht ein“, sagt der Pumpmeister noch einmal.
In dem Augenblick tönt vom Fluß, der die ganze Zeit hindurch schlief und schwieg, ein Platsch herüber.
Der Platsch ist kurz und wird von niemand empfunden. Niemand achtete darauf. Und doch war er, als riefe der Fluß: „Vergeßt mich nicht, ich bin noch immer da und werde euch alle überleben!“
Ich sehe Sleigh an, und er sieht mich an. Auch er hat den Platsch gehört, schenkt ihm aber keine Bedeutung.
Es war, als ob von den Jungen, die da auf der Brücke saßen und sangen, einer aus Übermut hineingesprungen oder von andern hineingeschubst worden war. Aber nein, so war es nicht. Ich hörte kein folgendes Plätschern, kein Juchzen oder lachendes Zurufen. Das Wasser gab keinen weiteren, auch noch so leisen Laut von sich. Die Jungen ließen den abgeebbten Gesang wieder anschwellen. Sie waren von dem Platsch nicht beunruhigt worden. Es war also keiner der Jungen hineingesprungen. Wahrscheinlich hatte jemand einen Stein hineingeworfen; das war sicher ein dicker Stein gewesen. Doch wozu? Diese Mühe macht sich niemand.
Garza fiedelt und fiedelt. Ich denke, die Finger müssen ihm ganz lahm sein.
Es kann aber auch ein großer Fisch gewesen sein, der plötzlich hochschnellte und wieder zurückfiel ins Wasser. Nein, das war es nicht. So hatte es nicht geklungen.
„Warum die zementieren werden“, antwortete Ignacio, „das werde ich Ihnen sagen. Die haben schon zwei zementiert, weiter drin. Die bohren so lange, bis sie Öl spüren, und dann zementieren sie sofort und sagen, sie haben nichts gefunden, die Biester.“
Es kann ja auch ein Hund hineingesprungen oder hineingeworfen worden sein?
Der Pumpmeister schüttelt den Kopf und sagt: „Das machen die Gringos nicht. Wenn die Öl finden, dann holen sie es auch raus bis auf das letzte Faß, das sie kriegen können. So eine Bohrung kostet doch wenigstens zwanzigtausend Dollar. Die schmeißen doch ihr Geld nicht weg und bohren da nur zum Spaß, bohren nur bis elfhundert und machen dann dicht, weil sie bis dahin nichts haben. Auf sechzehnhundert oder achtzehnhundert kann ja das dickste Öl liegen.“
Ein Hund kann es auch nicht sein, der würde plätschern, um ans Ufer zu kommen. Aber da war kein Plätschern hinterher, kein Rufen, kein Kreischen, nichts. Nur der eine kurze Platsch und vorbei.
Ignacio ist wissend. Er kennt die Geheimnisse der Ölmagnaten. „So können Sie nur reden,“ sagt er zum Pumpmeister, „weil Sie durchaus nichts von Öl verstehen. Wenn die nicht bis auf dreitausend Fuß bohren, sondern schon vorher zementieren, so beweist das gerade, daß sie auf Öl gestoßen sind, oder aber, daß sie es fühlen. Dann machen sie rasch dicht und sagen, es sei überhaupt kein Öl da.“
Manuel steht bei einem Mädchen, schwatzt auf sie ein, und sie lacht, lacht in einem fort. Er ist doch ganz anders als die anderen Burschen hier herum. Das macht eben, er arbeitet in Texas, er sieht die Welt und lernt, die schönen Mädchen von den weniger schönen zu unterscheiden.
„Das müssen Sie mir nun nicht einreden, Ignacio,“ antwortet der Pumpmeister, „die Gringos mag alle der Teufel holen, da kehre ich mich nicht darum, aber stupid sind sie nicht, das können Sie mir nicht erzählen.“
„Das behaupte ich ja gar nicht,“ widerspricht Ignacio eifrig, „eben das ist es, sie machen ja gerade die Bohrlöcher dicht, weil sie nicht stupid sind. Sie zementieren nur deshalb, weil sie noch nicht das ganze Land hier herum in Vorpacht haben. Das machen sie, um die Bohrungspachten niedrig zu halten. Sobald sie alles Land in Pacht halten, dann kommen sie raus mit dem Öl, dann brechen sie die ganzen Zementierungen wieder aus, und dann sollen Sie mal sehen, wie das Öl hier flutet.“
Weder Sleigh noch ich mischten uns in das Gespräch der beiden. Der Pumpmeister machte große Augen und sah Ignacio an wie einen Weltweisen. Dann sagte er in einem Ton, aus dem deutlich die Bewunderung vor der Klugheit des Ignacio herauszuhören war: „Ich glaube, Sie haben recht, Ignacio. Das sieht ihnen ganz ähnlich, diesen Americanos. Ich sage es ja, stupid sind die ganz gewiß nicht, wenn sie auch sonst niederträchtige Biester sind.“
Darauf antwortete Ignacio triumphierend: „Ja, man muß nur die Augen und Ohren aufmachen, dann kann man schon etwas lernen und sehen, auf welche Weise die ihr Geld machen. Mir können die alle nichts vormachen, ich bin ihnen weit über, diesen Burschen.“
Inzwischen hatte sich ein anderer Mann neben Garza gesetzt und ihm die Geige aus der Hand genommen. Die Mädchen sahen alle auf, weil er so tat, als ob er nun einmal zeigen wolle, wie man zum Tanze aufzuspielen habe. Ein paar Takte schien es auch, daß er wirklich hervorragend spielen könne, und die Mädchen zupften bereits an ihren Kleidern herum. Aber dann war es auch schon aus, und er spielte schlechter als Garza.
Zwei Mädchen wagten es endlich, zu tanzen. Nach zehn Schritten aber setzen sie sich wieder. Wenn wenigstens eine Gitarre da wäre, dann ließe sich so etwas wie Musik zusammenstoppeln.
Dennoch denkt niemand an Aufbruch. Man ist einmal hier, und irgend etwas wird ja wohl geschehen. Wo so viele Leute beieinander sind, geschieht immer etwas. Vielleicht kommt doch noch der große Musikmeister, auf den sie alle in einem unbestimmten Gefühl warten.
Ignacio hat sich von uns entfernt. Er sucht sicher eine andere Gruppe auf, die er mit seiner großen Entdeckung auf die Knie zwingen kann.
Eine junge, hübsche Frau kommt auf uns zu. Sie hat ein meergrünes Gazekleid an, durch das man den weißen Unterrock schimmern sieht. In dem schwarzen, sorgfältig durchgekämmten Haar hat sie zwei dicke rote Blumen, und sie trägt einen kleineren Blumenstrauß an die Brust gesteckt und einen mit dicken roten Blumen am Gürtel.
„Haben Sie Carlos nicht gesehen?“ Sie fragt es ganz leichthin. „Er hat noch nicht sein Abendbrot gegessen. Er ist ja ganz aus dem Häuschen vor Aufregung, weil Manuel gekommen ist. Das geht in einem fort: „Buenas noches!“ und „Adios!“ und „Bonito!“ und „Bonita!“ und immer gleich wieder auf und davon.“
„Hier war er nicht, ich habe ihn nicht gesehen“, sagt der Pumpmeister.
„Kann sein, daß er hier war,“ sagt Sleigh, „aber ich habe nicht auf ihn geachtet.“
Ein anderer Mann kommt auf uns zu, und wir reden von dem neuen Dampfkessel, der dem Pumpmeister schon seit zwei Jahren versprochen wurde, aber immer noch nicht angelangt ist.
Die junge hübsche Frau sieht Manuel und geht zu ihm rüber. Ich sehe, wie er den Kopf schüttelt und dann wieder auf sein lachendes Mädchen einredet.
Die Frau – es ist die Gattin Garzas und die Mutter des kleinen Carlos – geht nun zu ihrem Manne. Er dreht sich gerade eine Zigarette, hört gleichgültig zu und schüttelt dann mit dem Kopfe.
Eine Weile steht die Frau unschlüssig und nachdenklich da. Dann sieht sie sich zwischen den Leuten und den Kindern um. Alle die Personen sitzen, stehen und laufen in dem trüben Licht herum wie bunte gespenstische Schatten. Die Gesichter, die alle tiefbraun, viele beinahe schwarz sind, sind weniger zu erkennen als die grellfarbigen Kleider der Mädchen und die hellen Hemden und Hosen der Männer. Zuweilen sieht es aus, als ob Kleidungsstücke herumlaufen, über denen ein großer Hut hängt und mitläuft, denn die Gesichter und Hände verlaufen in der Nacht.
Einige Male sehe ich noch die Frau Garza zwischen den Gruppen hin und her streifen, dann aber achte ich nicht mehr auf sie.
Garza hat die Fiedel wieder genommen. Man sieht ein, daß er von allen, die es nun versucht haben, immer noch am besten spielt.
Aus irgendeinem Winkel der Nacht heraus bläst jemand auf einer Mundharmonika. Wieder versuchen einige Mädchen zu tanzen, und wieder stellen sie den Versuch nach einer Runde ein.
Die Frau des Pumpmeisters steht auf, nimmt eine Laterne fort und geht damit ins Haus. Der Platz wird dadurch noch gespenstischer. Drüben bei den Eseltreibern ist das Feuer am Verlöschen, und die beiden Männer und der Junge kommen näher heran, um unter Menschen zu sein. Sie finden gleich Bekannte, stellen sich bei ihnen hin, spucken aus und mischen sich in das Gespräch.
Da kommt die Garza in der Richtung von der Brücke auf uns zu. Sie geht sehr eilig und sagt, noch während sie geht: „Der Junge ist nicht da. Ich kann ihn nicht sehen. Wo steckt er nur?“ Ihr Gesicht, das vorhin noch nebensächlich, alltäglich geschäftig war, nimmt jetzt einen auffallend deutlichen Ausdruck der Besorgnis an. Sie zieht die Stirne hoch, öffnet ihre Augen weit und richtet sie fragend auf uns. In diesen Augen schimmert ein leiser Verdacht, gegen den sie sich noch zu wehren sucht. Und ein zweiter Verdacht glimmert hindurch, ob wir vielleicht etwas ahnen, aber unsere Ahnung vor ihr verbergen wollen. Hilflos sieht sie sich nach allen Seiten um, wo sie noch suchen könnte. Dann blickt sie uns wieder an. In ihren Augen ist eine Wandlung vor sich gegangen. Der Verdacht, die leise Ahnung fangen an, Gestalt anzunehmen.
Der große Musikmeister ist erschienen! Der größte, den die Menschen haben. Gleich wird er zum Tanze aufspielen. Zu einem wirbelnden Tanze, bei dem die Fanfaren des letzten Tages der Welt zu hören sein werden.
Die Tänzer beginnen sich langsam aufzustellen. Zuerst nur die, wie bei jedem Tanze, die gehört haben, daß die Musik eingesetzt hat.
„Machen Sie sich doch keine Sorgen, Carmelita,“ sagt der Pumpmeister, „der Junge ist müde geworden und hat sich hingelegt zum Schlafen.“
„Im Hause ist er nicht, ich habe jeden Winkel durchsucht.“
„Er wird bei andern Leuten sein.“
„Nein, auch nicht.“
„Vielleicht irgendwo unter eine Decke gekrochen, oder er liegt auf einem Dache, wo er eingeschlafen ist, und wo es kühl ist“, sagt jetzt Sleigh.
An das Dach hat die Frau nicht gedacht. Das kann sein, er schläft ja oft mit dem andern Jungen auf dem Dache, sie hat ihm ja oft den Fetzen Decke hinaufwerfen müssen. In ihre Augen kommt ein Schein von Hoffnung. Sie eilt davon. Wieder über die Brücke zurück.
Die Pumpmeisterin ist mit der Laterne aus der Hütte zurückgekommen, und der Platz wird wieder ein wenig heller.
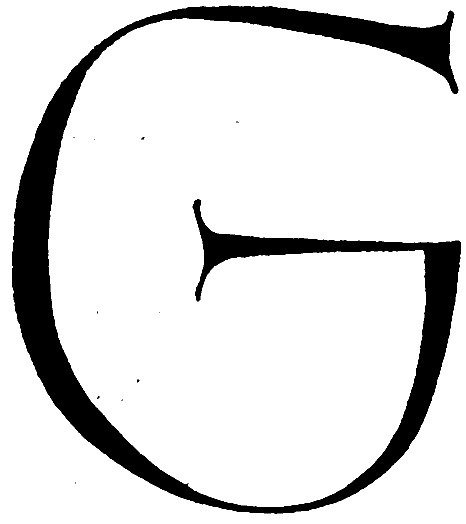 Garza fiedelt noch immer. Der Junge ist schon
hundertmal nicht zum Abendessen gekommen,
man hat ihn schon dutzende Male
wer weiß wo suchen müssen, oft hat er sich
einen Esel genommen und ist auf und davon
geritten aus reinem Vergnügen. Die
Frauen haben immer gleich den Sack voll Angst. Obgleich
niemand zu tanzen versucht, er ist nicht beleidigt oder verärgert,
unverdrossen spielt er weiter. Wenn einer besser
spielen kann als er, so mag er sich doch melden, er will ihm
gern seine Geige leihen. Aber da soll erst einmal einer kommen,
der besser spielt. Das ist ja eben die Sache, man muß
spielen können, und er kann spielen, besser als alle hier in
der Runde. Die Onesteps, Twosteps, Walzer und Foxtrotts
schieben sich ja alle ein wenig ineinander, so daß man immer
erst eine Weile hinhören muß, was er eigentlich spielt; und
wenn man dann überzeugt ist, daß er einen Foxtrott meint,
dann ist es ein Walzer.
Garza fiedelt noch immer. Der Junge ist schon
hundertmal nicht zum Abendessen gekommen,
man hat ihn schon dutzende Male
wer weiß wo suchen müssen, oft hat er sich
einen Esel genommen und ist auf und davon
geritten aus reinem Vergnügen. Die
Frauen haben immer gleich den Sack voll Angst. Obgleich
niemand zu tanzen versucht, er ist nicht beleidigt oder verärgert,
unverdrossen spielt er weiter. Wenn einer besser
spielen kann als er, so mag er sich doch melden, er will ihm
gern seine Geige leihen. Aber da soll erst einmal einer kommen,
der besser spielt. Das ist ja eben die Sache, man muß
spielen können, und er kann spielen, besser als alle hier in
der Runde. Die Onesteps, Twosteps, Walzer und Foxtrotts
schieben sich ja alle ein wenig ineinander, so daß man immer
erst eine Weile hinhören muß, was er eigentlich spielt; und
wenn man dann überzeugt ist, daß er einen Foxtrott meint,
dann ist es ein Walzer.
Ab und zu spielt wieder einer auf der Mundharmonika, die von Hand zu Hand oder richtiger von Mund zu Mund zu gehen scheint, denn zwischendurch hört man immer sprechen und zuweilen etwas lauter: „Gib mir mal, du kannst ja nicht.“
Die Jungen auf der Brücke singen nicht mehr. Vielleicht sitzen sie noch da und erzählen sich etwas, vielleicht auch haben sie sich zu den Mundharmonikaspielern gesellt oder zwischen die Gruppen hier gemischt.
Die Garza kommt schon wieder zurück. Da wir ja am nächsten zur Brücke stehen, muß jeder, der zum Pumpplatz will, an uns vorbei.
Sie kommt so natürlich zuerst auf uns zu. Ihr Gesicht hat den ersten Schimmer von Angst angenommen. Die Augen sind starr und weit auf uns gerichtet mit einer ganz stillen Hoffnung, daß wir, während sie drüben auf der anderen Seite des Flusses war, etwas erfahren haben könnten. Ihr Haar, das so sorgfältig geordnet war, ist an der einen Seite ein wenig aufgezaust. Sie ist auf das Dach geklettert, und sie hat zwischen Gestrüpp gesucht.
„Er ist auch nicht auf dem Dache, Senjores. Die andern haben auch überall nachgesehen. Sie haben ihn nicht gefunden.“ Sie sagt es so, als ob die Worte Blei wären. „Drüben ist er nicht.“ Sie geht hinüber zu ihrem Manne. Während er ruhig weiterfiedelt, redet sie auf ihn ein. Dann schweigt sie plötzlich und sieht ihn groß fragend an, seine Meinung erwartend.
Er zieht noch einen langen Strich, dann setzt er den Bogen ab und läßt die Hand aufs Knie fallen. Die Geige hat er noch an der Brust, denn kein Indianer hier hält die Geige gegen das Kinn. Über die Geige hinweg sieht er mit seinen schwermütigen Augen seiner jungen Frau ins Gesicht. Plötzlich ruckt er zusammen. Er hat mehr in den Augen gelesen, als sie für ihn hineingeschrieben hatte. Er öffnet den Mund weit, und der Unterkiefer scheint zu erschlaffen. Jetzt endlich nimmt er die Geige auch herunter und stützt sie aufs Knie; und während er den Kopf sinken läßt, übergibt er die Fiedel dem großen Meister, den er jetzt kommen sieht.
Der Junge ist noch keine Stunde fort. Er ist dutzende Male halbe Tage fortgewesen und hat sich hunderte Male viele Stunden lang wer weiß wo herumgetrieben, aber noch nie hat Garza seine Frau so gesehen wie jetzt.
„Manuel!“ ruft die Frau.
Manuel kommt von seinem lachenden Mädchen, der er noch ein lustiges Wort zurückruft, langsam heran.
Lachend sagt er: „Was ist denn, Mutter?“
„Wir können Carlos nicht finden“, sagt sie, ängstlich in seinem Gesicht suchend, ob er nicht das erlösende Wort sprechen würde.
Das Lächeln auf dem Munde Manuels wird um einen Grad leichter, und er sagt: „Ich habe ihn ja gerade eben noch gesehen.“
„Wo?“ ruft die Mutter, während sich ihr Gesicht merkwürdig aufhellt, als wäre es plötzlich von strahlender Mittagssonne getroffen worden.
„Ja, hier, er wollte sich an meinem neuen Taschentuch die Nase abputzen. Das tat er auch. Dann schob er mir das Tuch wieder in die Hosentasche. Da, hier ist es. Dann puffte er mich in die Seite, trat mich auf den Fuß, und fort war er wie ein Coyote.“
„Du sagst, gerade eben noch?“ drängt die Mutter auf ihn ein.
„Ja, natürlich, gerade eben noch. Oder –“
„Was oder? Was oder?“ Die Mutter schüttelt ihn heftig an den Armen.
„Oder – Warte mal, das kann auch schon zehn Minuten her sein.“
Die Garza läßt kein Auge von seinen Lippen.
„Laß mich mal denken. Es kann auch eine halbe Stunde her sein. Vielleicht noch mehr. Ja, ich glaube, es ist länger her. Seit dann habe ich ihn nicht mehr gesehen.“
Das Gesicht der Garza verdunkelt sich mit einem Ruck. Die Stirne zieht sich über der Nasenwurzel zusammen wie in einem Krampf, und das ganze Gesicht scheint zusammenzuschrumpfen, als ob es verwelke.
„Nachdem war er noch drüben bei mir. Er reichte mir den Faden, damit ich die Blumen zusammenbinden konnte. Das war nachher –“ Trotz ihrer fliegenden Angst rekapituliert die Frau so genau, als läse sie das aus einem Buche. „Das war nachher, denn er sagte mir, daß er dir das Taschentuch aus der Tasche gezogen habe, und wenn du nicht so ein guter Manuel wärest, dann würde er es dir sicher stehlen.“
Nun sieht sich Manuel besorgt um, dreht sich und hofft augenscheinlich, den kleinen Bruder im selben Augenblick irgendwoher aus der Nacht auftauchen zu sehen, denn er hat ihn zu lebensdeutlich vor Augen.
Garza ist aufgestanden und steht unschlüssig da, er weiß nicht, was er tun soll. Seine Geige hat er gedankenlos auf die Bank gelegt.
Die Pumpmeisterin ist näher gekommen, mit ihr einige andere Frauen. Es kommen jetzt auch Männer näher heran, um zu hören, was hier los sei. Die Pumpmeisterin redet beruhigend auf die Garza ein, sie hat selbst Kinder, und die sind alle Augenblicke zu suchen, manchmal an Stellen, wo es kein Mensch vermuten würde. Auch die übrigen Frauen sprechen ihre Erfahrungen aus: „Das kleine Kroppzeug kommt immer wieder. Nur ja keine Angst, Carmelita. Wenn er Hunger hat oder sich irgendwo ausgeschlafen hat, dann werden Sie ihn schon erscheinen sehen.“
Manuel hat sich entfernt. Nach einer Weile hört man ihn aus der Finsternis herausrufen: „Carlos! Carlos!“
Alle, die hier herumstehen, hören auf zu sprechen und lauschen auf die Antwort. Aber man hört nur das Singen und Wimmern des Dschungels und das Sprechen der mehr abseits stehenden Gruppen.
Durch das Rufen Manuels werden auch die übrigen Gruppen aufgescheucht, sie beginnen sich zu bewegen und an dem Tanze, dessen erste Takte sich noch schwerfällig hinschleppen, teilzunehmen.
Der Pumpmeister geht zu dem offenen Schuppen, wo die Pumpe und der Kessel stehen, und leuchtet mit einigen Zündhölzern herum. Alle sehen hinter ihm her und erwarten, daß er den Jungen jetzt gleich da irgendwo am Arme hervorzerren wird. Als er aber wieder zurückkommt, sieht jeder ein, daß es unsinnig war, zu erwarten, der Junge würde sich zwischen dem verölten und verschmierten Eisengestrüpp verkrochen haben.
Gequält sieht die Garza von einem zum andern. Sie hält eine Faust am Munde und nagt daran herum. Ihre Augen werden wie die eines Tieres, das instinktiv eine Gefahr herannahen fühlt. Ein Gedanke kommt ihr. Sie nimmt die Faust vom Munde fort, birgt sie in die linke Hand, hält so beide Hände eine Weile vor der Brust und dreht sich dann rasch entschlossen um. Sie geht schnell auf die Brücke zu. Nach wenigen Schritten bleibt sie stehen, läßt Kopf und Arme entmutigend sinken und kommt mit schweren schleppenden Schritten zurück zu der Gruppe.
Garza weiß nicht, was er tun soll. Er dreht sich endlich gedankenlos eine Zigarette.
„Carlos! Carlos!“ hört man hin und wieder aus verschiedenen Richtungen her Manuels Stimme. Das veranlaßt mehrere Burschen nach anderen Richtungen auszustreifen, und bald vernimmt man von überall her den Ruf „Carlos!“ Nach jedem Ruf folgt ein Schweigen, und manchmal scheint es, als ob selbst der Dschungel für kurze Momente mitschwiege, um ein Menschenkind retten zu helfen.
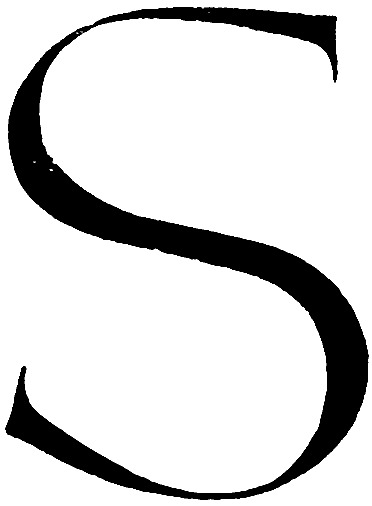 „Senjora! Senjora Garza!“ ertönt da die rufende
Stimme zweier Jungen, die offenbar von
drüben, von der anderen Seite herangesaust
kommen.
„Senjora! Senjora Garza!“ ertönt da die rufende
Stimme zweier Jungen, die offenbar von
drüben, von der anderen Seite herangesaust
kommen.
„Also, da ist er ja, der Junge“, ruft die Pumpmeisterin aus. Alle Gesichter entspannen sich, und eilige Worte fliegen hin und her, um rasch etwas zu sagen, ehe die heranspringende Neuigkeit einem die Möglichkeit nimmt, etwas ungemein Wichtiges auszusprechen.
Ein paar Burschen und Mädchen entfernen sich von der Gruppe, gelangweilt. Es war ja die Aufregung wahrhaftig nicht wert. Wie kann denn der Junge verlorengehen.
Die Garza schluckt, und sie leckt sich die trockenen Lippen. Dann holt sie tief Atem, als habe sie seit Stunden nicht geatmet. Dennoch läßt sie sich nicht überwältigen. Es steigt Hoffnung in ihrem Gesicht auf, aber der Zweifel bleibt die stärkere Empfindung. Sie hat sich so sehr in Gewißheit hineingearbeitet, daß sie nicht leicht herausfinden kann.
Nun sind die Jungen heran. Atemlos reden sie drauflos: „Senjora, Sie suchen Ihren Chiquito, Ihren kleinen Carlos?“
„Ja doch, wo ist er denn?“ rufen die Umstehenden, während die Mutter mit weiten verglasten Augen auf die Jungen starrt, als kämen sie aus einer andern Welt.
„Aber der Carlos ist doch nach Magiscatzin geritten“, sagt der größere der beiden Jungen.
„Ja, das ist er,“ bestätigt der kleinere, „das ist er ganz bestimmt.“
„Na ja also“, sagt die Pumpmeisterin gedehnt und klopft der Garza freundschaftlich auf die Schulter.
„Habe ich doch schon gesagt“, spricht eine andere Frau. „So ein Junge kann doch nicht so ganz einfach aus der Welt herausfallen.“
Die Männer sagen nichts, und die meisten entfernen sich von der großen Gruppe, um wieder ihre unterbrochenen Gespräche aufzunehmen.
Die Garza zieht die Stirne zusammen, als fiele ihr das Nachdenken sehr schwer. Sie hält beide Hände vor den Leib und sieht die Jungen an. Die Jungen wollen hinwegtrollen. Aber die Garza hält den einen am Arme fest, und dadurch bleibt der andere von selbst auch stehen.
„Ihr sagt, er ist nach Magiscatzin geritten?“
„Ja freilich.“
„Worauf denn?“
„Auf einem Pferd!“
„Auf einem Pferd? Auf wessen Pferd denn eigentlich?“
Ganz ruhig fragte die Garza das.
„Ein großer Junge kam vorbei auf einem Pferde“, erwidert nun der ältere der beiden Burschen.
„Ja, ein großer Junge“, mischt sich der Jüngere ein. „Und Carlos stand gerade hier, und da sagte –“
„– und da sagte der Junge,“ nun redet wieder der Ältere, „willst du nicht mitkommen, Carlos, ich reite schnell.“
„Was hat denn da der Carlos gesagt?“ fragt die Garza.
„Reitest du nach Magiscatzin? hat Carlos gefragt. Da hat der große Junge genickt, und Carlos sagte, dann könne er sich ja in Magiscatzin Bonbons kaufen, er habe zwanzig Centavos. Und der Junge hat wieder genickt und gesagt, das könne er wohl, und sein Pferd sei ein sehr schnelles Pferd.“ Wenn der eine der beiden Jungen aufhört zu reden, fängt jedesmal gleich der andere an. Die Geschichte scheint ganz wahr zu sein. Das können sich zwei Jungen nicht so gut von selber ausdenken.
Die Leute sind wieder dichter herangekommen. Die Garza blickt eine Weile auf die Jungen, dann sieht sie sich um, blickt in die Gesichter der Umstehenden, die infolge des trüben Lichtes der verräucherten Laternen kaum richtig zu erkennen sind. Inzwischen ist Manuel näher gekommen, weil er hörte, daß hier eine Neuigkeit sei. Der Blick der Garza fällt jetzt auf Manuel und bleibt eine Weile darauf haften, als ob sie bei ihm Rat suche. Dann wendet sie sich rasch zurück zu den Jungen und sagt laut: „Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Carlos reitet nicht fort, wenn Manuel hier ist und Manuel Montag früh schon wieder abreisen muß. Und wenn er wirklich nach Magiscatzin geritten wäre, so hätte er es Manuel gesagt.“
„Er ist aber doch mit dem großen Jungen geritten“, besteht der ältere Bursche auf seiner Behauptung.
„Wer war denn der Junge?“ fragt die Garza.
„Das wissen wir nicht, wie er heißt.“
„So, das wißt ihr nicht?“ sagt die Garza. „Kennt ihr den Jungen?“
„Nein, wir kennen ihn nicht“, sagt der Ältere, während der Jüngere behauptet: „Ich habe ihn aber schon einmal hier vorbeikommen sehen mit einem beladenen schwarzen Esel.“
Nun mischt sich der Pumpmeister ein: „Wie sah denn der Junge aus?“
Bisher haben die Jungen klar und sicher gesprochen. Als sie aber diese Frage beantworten sollen, fangen sie an, sich fortgesetzt zu widersprechen. Sie vermögen nicht genau anzugeben, wie der Junge ausgesehen hat. Sie können nicht einmal sagen, ob er auf einem Sattel saß oder nur auf einer Matte, und über die Farbe des Pferdes und das Brandzeichen wissen sie gar nichts. Dagegen stimmt die Zeit wieder, denn sie behaupten, es sei ungefähr etwas mehr als eine gute Stunde her, seit Carlos fortgeritten sei. Das wäre also um acht Uhr gewesen. Und um diese Zeit lief der Junge aus der Hütte fort, um rüber zur Pumpe zu rennen, wo Manuel war und der Vater die Geige spielte. Seitdem hat ihn die Mutter nicht mehr gesehen. Als alle Anwesenden, mit Ausnahme der Mutter, erklären, daß sie die Erzählung der beiden Jungen für glaubhaft halten, weil mehrere Männer und Burschen vorübergeritten seien und die Jungen gar keinen Grund hätten, zu schwindeln in einer so ernsten Sache, setzt sich Garza aufs Pferd und reitet nach Magiscatzin, um nach Carlos zu fragen. Es ist möglich, jener Junge auf dem Pferde ist nicht aus der Gegend hier, sondern macht eine Reise und hat Carlos in Magiscatzin abgesetzt, und Carlos kann nicht zurück. Der Junge ist doch nur sechs Jahre alt und mag leicht unüberlegte Streiche dieser Art machen. Nun sitzt er wahrscheinlich in jenem kleinen Dorf und heult, weil er nicht zurück kann in der Nacht. Durch die Beschäftigung des Aufsattelns, durch das Fortreiten ihres Mannes und infolge der Zuversicht aller übrigen Leute wird die Garza ein wenig von ihren schweren Befürchtungen abgelenkt. Sie fühlt sich leichter, setzt sich zu anderen Frauen auf eine Bank und mischt sich in deren alltägliches Geschwätz über alltägliche Dinge.
Manuel steht gegen einen Baum gelehnt. Er weiß nicht recht, was er tun soll. Zu den Mädchen gehen, da herumsitzen und kichern, hat er keine Lust. Endlich aber macht er sich doch auf und geht langsam auf jenes hübsche Mädchen zu, mit der er schon früher am Abend geplaudert hatte.
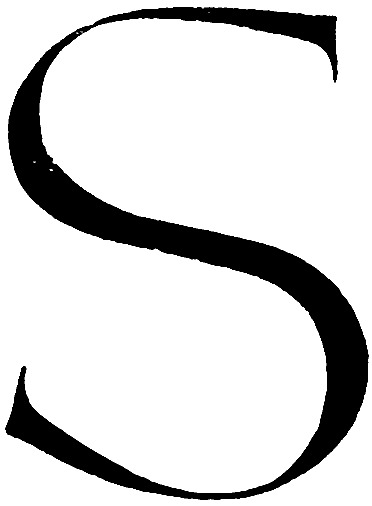 Sleigh war an der ganzen Sache ziemlich uninteressiert
gewesen. Was ihn überhaupt lebhaft
in Bewegung bringen könnte, habe ich bis
heute nicht erfahren können. Aber vielleicht
lerne ich etwas mehr von ihm, besser über ihn,
wenn ich ihn später wieder einmal treffe. Als
die Aufregung sehr hoch ging, sagte er mir, daß er wieder
rübergehen wolle, um zu sehen, ob die Kuh jetzt vielleicht
hereingekommen sei. Nun ist er zurück. Die Kuh ist noch
nicht da, und sein Gespräch dreht sich nur darum, wo die
Kuh sein könne und warum sie nicht komme.
Sleigh war an der ganzen Sache ziemlich uninteressiert
gewesen. Was ihn überhaupt lebhaft
in Bewegung bringen könnte, habe ich bis
heute nicht erfahren können. Aber vielleicht
lerne ich etwas mehr von ihm, besser über ihn,
wenn ich ihn später wieder einmal treffe. Als
die Aufregung sehr hoch ging, sagte er mir, daß er wieder
rübergehen wolle, um zu sehen, ob die Kuh jetzt vielleicht
hereingekommen sei. Nun ist er zurück. Die Kuh ist noch
nicht da, und sein Gespräch dreht sich nur darum, wo die
Kuh sein könne und warum sie nicht komme.
Da kommt ein Junge an uns vorüber und geht zu Manuel. Ich folge ihm, um zu hören, was er will.
„Das ist ja gar nicht wahr, daß der Carlos nach Magiscatzin geritten ist“, sagt er sehr laut zu Manuel. „Der Carlos ist mit einem Jungen nach Tamalan geritten, aber nicht auf einem Pferde, nein, auf einem Esel.“
„Hast du es gesehen?“ fragt Manuel mißtrauisch.
„Natürlich habe ich es gesehen, sonst würde ich es dir doch nicht sagen.“
„Warum hast du denn das nicht früher gesagt?“
„Ich habe doch nicht gewußt, daß die andern erzählt haben, Carlos sei nach Magiscatzin geritten“, sagte der Junge entschuldigend.
Die Garza hat das alles gehört. Sie ist aufgeschnellt und kommt so rasch herbei, als sei sie in einem Satz hergesprungen.
„Was sagst du da?“ schreit sie auf den Jungen ein und schüttelt ihn bei beiden Schultern.
Der Junge wiederholt seine Rede und schwört bei allen Heiligen, daß er Carlos habe auf einem Esel fortreiten sehen, in der Richtung nach Ocampo.
Die Garza läßt den Kopf tief zwischen ihren Schultern versinken, und sie erscheint plötzlich ganz klein und zusammengedrückt. Ihr Mund steht weit offen, und ihr Blick flackert irre hin und her.
Der Pumpmeister rüttelt sie energisch am Arm. Er fürchtet, daß sie stehend sterben werde, wenn er sie nicht aufwecke. Dabei sagt er: „Regen Sie sich doch nicht auf, Carmelita, regen Sie sich doch nur nicht auf. Warten Sie doch erst einmal ruhig ab, bis Garza zurück ist.“
Die Frau sagt nichts darauf. Sie hat augenscheinlich überhaupt nichts gehört. Der flackernde irre Blick schweift weiter ruhelos umher.
Einer der Eseltreiber des Packzuges sagt nun: „Ich kenne den Weg nach Tamalan. Es ist ein ganz verfluchter Weg. Wenn man ihn nicht genau kennt, kommt man in der Nacht nicht mehr wieder. Habt ihr eine Mula oder einen Esel, dann will ich rüberreiten und nach dem Jungen herumhören. Meine Esel sind müde.“
Sogleich wird ihm ein Esel angeboten. Als er abreitet, kommt noch ein Junge mit einem Esel an, um ihn zu begleiten.
„Habt ihr auch Zündhölzer?“ ruft der Pumpmeister hinter ihnen her.
„Wir haben genug“, wird ihm zurückgerufen.
Die Garza wird immer aufgeregter. Die leise Hoffnung, die sie hatte, als die Leute alle so zuversichtlich waren, der Junge müsse in Magiscatzin sein, ist völlig verflogen. Stark war in ihr diese Hoffnung ja nie gewesen. Nun aber fällt die Frau zurück in jenen Zustand der Gewißheit, den sie besaß von jenem Augenblicke an, als sie den Kleinen vermißte. Was niemand sonst wissen kann, sie, die Mutter, weiß es: der Junge kommt nie wieder! Herz und Instinkt sagen ihr die Wahrheit. Alle mögen leugnen und zweifeln, sie zweifelt nicht. Sie hat ernsthaft keine Sekunde lang gezweifelt.
Mit dieser endgültigen Wiederkehr der Gewißheit verfliegt der irre flackernde Blick aus ihren Augen. Sie rafft sich zusammen. Sie muß etwas tun für ihr Kind, wäre es auch nur, um seinen kleinen Körper noch einmal zu liebkosen.
Sie eilt hinweg, zurück über die Brücke, heim in die häusliche Hütte. Eine Minute darauf sieht man sie auf der anderen Seite des Flusses mit einer Laterne durch die Gebüsche am Ufer streifen. Bald kriecht sie tiefer in den Dschungel, bald wieder kommt sie näher zum Ufer. Mit weit ausgestrecktem Arm leuchtet sie in das Wasser. Zuweilen ruft sie den Namen des Kindes. Es klingt gespensterhaft. Hier auf dieser Seite haben die Leute das Gefühl, als ob auf das Rufen eine Antwort folgen würde, die grauenhaft sein müsse.
Eine Weile steht sie dann drüben am Ufer, überlegend, was wohl zu tun sei. Die Laterne hängt am Arme herunter und beleuchtet die so festlich gekleidete Frau. Das Gesicht aber, das von unten her sein Licht empfängt, während oben und von allen Seiten die tiefen schwarzen Schatten der Nacht liegen, ähnelt weder einem menschlichen, noch einem tierischen Antlitz. Es ist eine grausige Fratze und Maske, die sich mit keinem Dinge auf Erden vergleichen läßt.
Hier, auf dieser Seite des Flusses, stehen die Leute in Gruppen und sehen hinüber zu der einsamen Mutter, die mit der Laterne am Ufer steht, um nach ihrem einzigen Kinde zu suchen. Zwei feindliche Lager, durch den Fluß getrennt; zwei gegenüberstehende Welten. Die eine Welt in ihrem tiefsten Schmerze, die andere hilfsbereit, aber doch im Herzen froh, daß es der andere ist, den es traf.
Es gehen einige Männer hinüber, um der Frau beim Suchen zu helfen. Sie kriechen ziellos in dem Dornengebüsch herum. Daß sie den Jungen dort finden könnten, glaubt keiner von ihnen; sie wollen nur der Mutter zeigen, daß sie nicht allein sei, daß man alles tun wolle, was nur in der Macht der Menschen liegt, um ihr zu helfen.
Die Frau bewegt sich langsam auf die Brücke zu. Während sie über die Brücke geht, leuchtet sie bei jedem Schritt in das Wasser hinunter. Aber das Wasser ist dick und gelb; der Schein der Laterne dringt nicht eine Handbreit unter die Oberfläche. Sie ist nun wieder auf dieser Seite. Die Pumpmeisterin legt ihr die Hand auf die Schulter und redet tröstend auf sie ein: „Wir wollen doch erst einmal sehen. Der Kleine ist wirklich mit den Jungen fortgeritten, das ist ganz sicher. Kommen Sie, setzen Sie sich auf die Bank und denken Sie jetzt nicht mehr daran; das können wir noch immer genug tun, wenn die Leute zurück sind.“
„Carlos ist nicht fortgeritten“, die Garza sagt es mit fester Bestimmtheit. „Er reitet nicht fort, wenn Manuel hier ist.“
„Ach, Kinder!“ erwidert die Pumpmeisterin. „Sie haben nur das eine, da wissen Sie nicht viel über Kinder. Ich weiß das besser von meinen Gören. Woran man gar nicht denkt, das tun sie gerade zuerst.“
Die Garza hat die Laterne vor sich auf den Erdboden gestellt. Sie dreht sich um und blickt mit schweren müden Augen zum Fluß hinüber. Dann wendet sie ihr Gesicht wieder der Gruppe zu, in der sie steht. Unschlüssig und ratlos sieht sie alle der Reihe nach an. Den Kopf legt sie schwerfällig in den Nacken und schließt für eine Weile die Augen. Plötzlich aber reckt sie sich zusammen und ruft mit keuchender Stimme: „Der Junge ist im Fluß. Er ist ertrunken!“
Erstarrt stehen die Anwesenden, als habe der Blitz zwischen sie eingeschlagen. Die Pumpmeisterin kann vor Entsetzen kaum schlucken. Endlich sagt sie: „Segne Sie Gott, Carmelita, wie können Sie nur so etwas Sündhaftes und Schauderhaftes sagen!“
Die Garza jedoch stößt einen tiefen Seufzer aus. Sie fühlt sich erlöst von einem Klumpen, der ihr seit langem in der Kehle gelegen hat und sie zu ersticken drohte. Sie reckt und dehnt den Hals, und ihr Blick wird mit einem Male sachlich und brutal nüchtern. Alles Irre und Flackernde ist daraus verschwunden. Sie steht bewußt und sicher in der Welt wie vielleicht nie zuvor im Leben.
Während die Leute noch wie entgeistert sind, nicht wissen, was sie tun oder sprechen sollen, redet die Garza frisch weg, um sich noch mehr Luft zu schaffen.
„Der Junge war ja so wild und ausgelassen den ganzen Abend. Er wußte ja kaum, was er tat, und wo er rannte. Ich konnte ihn nicht halten im Hause, er mußte wieder hinüber zu Manuel und rannte fort wie ein Wirbelwind. Er kennt den Weg und die Brücke ganz genau. Aber da hat er die neuen Schuhe an und war nicht ganz sicher auf den Beinchen. Als ich vorhin zum ersten Male hier über die Brücke kam, wäre ich beinahe ins Wasser gefallen. Ich sah die Laterne hier hängen und ging drauf zu; erst als ich gegen den Balken stieß, fiel mir ein, daß die Brücke gar nicht auf die Laterne zuläuft, sondern weit ab. Und als ich das bemerkte, da kam mir der Gedanke, wenn der Junge so wild drauflosläuft, dann fällt er sicher ins Wasser. Und als ich dann hier drüben ankam, war meine erste Frage die nach dem Jungen. Ich würde sonst vielleicht gar nicht an ihn sofort gedacht haben. Aber ich wußte gleich, es ist schon zu spät, denn mein Herz war ganz voll Angst.“
Niemand hat sie unterbrochen, und eine gute Weile spricht kein einziger der Zuhörenden. Dann aber sagt die Pumpmeisterin: „Aber das ist ja ganz unmöglich, man würde doch gehört haben, wenn der Junge in den Fluß stürzt.“
Ich blicke seitwärts, und meine Augen treffen die des Sleigh, der im gleichen Moment aufschaut und mich ansieht. Weder er noch ich fühlen das Bedürfnis, irgend etwas zu sagen.
„Nein, nein,“ sagt jetzt ein Mann, „das würde man sicher gehört haben. Das platscht doch, wenn so ein Junge in den Fluß fällt. Auch fällt so ein Junge nicht rein und ist gleich lautlos verschwunden. Der schreit und strampelt und macht Lärm.“
„Natürlich“, mischt sich nun der Pumpmeister ins Gespräch. „Ich kenne doch den Jungen, es verging doch kein Tag, wo er nicht hier herumgeschwommen und herumgeplantscht hat im Wasser. Er ist wie ein Fisch. Der hätte sich schon herausgekrabbelt, und wenn er das nicht gekonnt hätte, dann hätte er geschrien. Er ist doch Wasser gewöhnt.“
Die Garza hört dem allen zu, als ob über etwas gesprochen würde, das sie gar nicht berühre. Nun aber fühlt sie sich verpflichtet, ihren Jungen zu verteidigen: „Gewiß hätte er sich herausgearbeitet, oder hätte er geschrien, aber er konnte es ja nicht mehr. Er hatte doch die neuen Stiefelchen an. Er hat gewiß, als er so ausgelassen drauflostrabte, mit den Stiefeln gegen den Balken gestoßen. Wäre er barfuß gewesen, hätte er sich halten können. Aber die Sohlen waren spiegelglatt. Ehe er wußte, was überhaupt geschah, da war er übergekippt und hatte mit dem Kopf auf den Balken geschlagen, und ehe er zur Besinnung kam, war er schon unter dem Wasser. Er hat gar keine Zeit gehabt, zu strampeln oder zu schreien.“
Mit dieser Rede schließt die Garza ihre Erzählung ab. Sie hat nichts mehr zu sagen, und niemand kann sie überzeugen, daß es anders wäre oder daß der Junge nicht im Flusse sei.
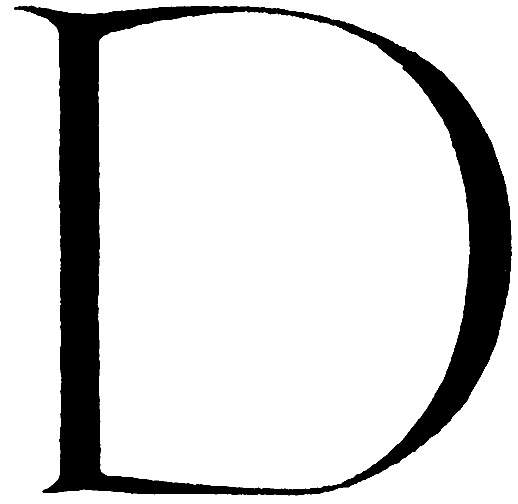 Die Leute freilich geben sich keineswegs zufrieden.
Man erinnert sich der Jungen,
die auf der Brücke saßen und sangen,
gerade zu der Zeit, als das Unglück sich
zugetragen haben solle. Aber die Jungen
haben nichts gehört und nichts gesehen.
Sie saßen am Ende der Brücke mit dem Gesicht zum Wasser
und dachten nur an ihr Singen. Dicht in ihrer Nähe ist der
Junge nicht hineingefallen. Außerdem ist es so schwarze
Nacht, daß sie es auch kaum bemerkt haben würden, wenn
sie die Brücke im Auge gehabt hätten. Einen Platsch haben
sie auch nicht gehört. Wenn sie ihn gehört haben, so haben
sie ihn nicht aufgenommen, denn hochspringende große
Fische platschen ebenfalls. Aber daß diese Burschen, die am
nächsten waren, nichts bemerkt haben, veranlaßt die Leute,
der Garza einzureden, sie bilde sich Dinge ein, die gar nicht
geschehen könnten.
Die Leute freilich geben sich keineswegs zufrieden.
Man erinnert sich der Jungen,
die auf der Brücke saßen und sangen,
gerade zu der Zeit, als das Unglück sich
zugetragen haben solle. Aber die Jungen
haben nichts gehört und nichts gesehen.
Sie saßen am Ende der Brücke mit dem Gesicht zum Wasser
und dachten nur an ihr Singen. Dicht in ihrer Nähe ist der
Junge nicht hineingefallen. Außerdem ist es so schwarze
Nacht, daß sie es auch kaum bemerkt haben würden, wenn
sie die Brücke im Auge gehabt hätten. Einen Platsch haben
sie auch nicht gehört. Wenn sie ihn gehört haben, so haben
sie ihn nicht aufgenommen, denn hochspringende große
Fische platschen ebenfalls. Aber daß diese Burschen, die am
nächsten waren, nichts bemerkt haben, veranlaßt die Leute,
der Garza einzureden, sie bilde sich Dinge ein, die gar nicht
geschehen könnten.
Die Garza sagt nichts darauf.
Jeder der Anwesenden weiß einen neuen Gedanken aufzubringen, um zu beweisen, daß es so, wie die Garza annimmt, nie gewesen sein könne, daß es überhaupt ganz und gar ausgeschlossen sei, daß der Junge in den Fluß gefallen sei, und vor allen Dingen, daß es undenkbar wäre, daß er so geräuschlos in den Fluß gestürzt sein könne. Niemand unterstützt die Mutter in ihrer Meinung. Man glaubt den Jungen an den allerunmöglichsten Stellen, an denen ein Junge nur sein könne, selbst im Feuerloch des Dampfkessels der Pumpe, aber im Fluß glaubt ihn niemand.
Schließlich wenden sich ein paar der Männer an mich, weil ich gar nichts sage, und fragen mich geradezu, was ich von der ganzen Sache denke. Ich weiß, wo der Junge ist, und Sleigh weiß es auch. Sleigh blickt mir gerade ins Gesicht, während ich gefragt werde von den Männern, die mir am nächsten stehen in der Gruppe. Ich sehe, daß Sleigh die Achseln zuckt, als ob man die Frage an ihn gerichtet hätte.
Und ich antworte: „Was kann ich da sagen? Ich kenne ja nicht die Schlupfwinkel hier herum, in die sich der Junge verkriechen könnte.“
Ja, ob ich denn glaube oder es für möglich halte, daß der Junge in den Fluß gefallen sei?
„Möglich,“ sage ich, „möglich ist alles, und möglich ist durchaus, daß der Kleine ins Wasser gefallen ist. Wo Wasser ist, kann immer jemand hineinfallen, ob er will oder nicht.“
„Der Senjor hat recht,“ antwortet einer der Männer, „im vorigen Jahr ist doch hier in demselben Wasser, nur weiter unten, der Ägypter ertrunken, der dort seine Hütte hatte und Gemüse pflanzte.“
„Das lag aber ganz anders,“ erwidert einer, „der Ägypter badete und kam an eine tiefe Stelle, wo er versank und nicht wieder heraufkam.“
Ein alter Indianer kommt etwas näher und fragt mich: „Was denken Sie denn, Senjor, was wir tun könnten?“
„Ich denke, wir suchen den Fluß ab. Wenn der Junge im Fluß ist, müssen wir ihn ja finden, und dann wissen wir wenigstens, wo er ist. Wenn die Männer zurückkommen und haben ihn nicht gefunden, und wir finden ihn im Flusse auch nicht, dann müssen wir wohl den ganzen Dschungel absuchen.“
Die Garza ist mit ihrer Laterne schweigend zur Brücke gegangen, sie hat die Brücke überquert, und sie steht jetzt an der anderen Seite der Brücke, nicht weit vom Ufer. Nach einer Weile leuchtet sie über den Rand in das Wasser hinunter, und dann stößt sie einen markerschütternden Schrei aus.
Ein paar Jungen rennen hinüber und kommen zurück mit der Botschaft, daß die Frau durchaus nichts im Wasser gesehen hat. Es war kaum nötig, uns das zu sagen; denn jeder wußte, daß sie an jener Stelle nichts sehen konnte, selbst wenn der Junge dort versunken sein sollte.
Nun beginnt die Frau unausgesetzt gellend zu schreien. Wenn der eine Schrei verklungen ist, ertönt gleich darauf der folgende. Es ist das Wehklagen indianischer Frauen, die einen Toten beweinen. Es klingt nicht wie Weinen, es klingt vielmehr wie ein den Himmel anklagendes langgezogenes Schreien. Viele große Säugetiere, denen der Gefährte oder das Junge erschossen, erschlagen oder geraubt wurde, schreien und klagen in genau der gleichen Weise. Hört man dieses wehklagende Schreien der Frauen zum ersten Male, glaubt man nicht, daß es ein Schreien des Trauerns wäre. Lebt man länger unter den Indianern, hört man den tiefen Schmerz aus dem Schreien so deutlich heraus wie aus dem stillen Weinen einer europäischen Frau.
Wäre der Tod des Jungen gewiß oder hätte man gar seinen kleinen Leichnam gefunden, so würden sofort alle Frauen in dieses Schreien, das man kilometerweit hören kann, mit einstimmen. Einstimmen mit all dem Mitgefühl und der Mittrauer, die eine Mutter und eine Gattin der anderen aus der Tiefe eines warmen und stark empfindenden Herzens zeigen kann.
Aber die Frauen, noch nicht überzeugt von dem Tod des Jungen, bleiben ruhig und tasten nur nach ihren Kindern und legen die Säuglinge sofort an die Brust als den sichersten Platz, den sie ihnen bieten können.
Zwei Männer gehen hinüber und führen die unaufhörlich schreiende Frau zart und besorgt auf diese Seite des Flusses, um sie auf eine Bank zu setzen.
Die Pumpmeisterin kommt sofort heran, gibt ihr Wasser zu trinken und streichelt sie mütterlich.
Die Männer stehen eine Weile herum, nicht wissend, was zu tun. Sie fühlen sich unbehaglich in Anwesenheit der Mutter, die ihr Kind verloren hat und die, trotz der Zartheit, mit der sie behandelt wird, jetzt eigentlich ganz allein in der Welt ist. Es überkommt die Männer nach und nach ein Schuldbewußtsein, daß sie mehr für die Mutter hätten tun können. Sie stehen herum, drücken sich herum und reden kaum. Sie zwingen sich, nicht nach der Mutter zu sehen, und wenn die Frau hin und wieder aufschreit, werden ihre Gesichter zerquält. Das Unbehagen, das sie belästigt, wird endlich so stark, daß sie das einzige tun, was Männer auf der ganzen Erde tun, welche Hautfarbe sie auch immer haben mögen, sobald sie sich überflüssig zu fühlen beginnen. Sie fangen an, tätig zu werden, sich zu beschäftigen, nur um nicht in Gegenwart der Mutter so schuldbewußt dazustehen.
Ohne viele Worte zu machen, ohne daß jemand die Führung übernimmt, beginnen sie zu arbeiten wie ein Ameisenvolk. Sie schleppen Holz herbei und zünden auf beiden Ufern große Feuer an, auf jedem Ufer zwei Feuer, so angelegt, daß die Längsseiten der Brücke beleuchtet werden. Einer entkleidet sich und geht in den Fluß. Er beginnt entlang der Brücke zu tauchen. Das ist ein Wagnis und kann das Leben kosten. Das Wasser ist, besonders auf dem Grunde, mit Dornengestrüpp, das sich von den Ufern losgerissen hat, bedeckt und kann sich leicht um die Füße oder Arme des Tauchenden schlingen. Da sind große, grausig aussehende Krebse auf dem Grunde, Schlangen und was sonst noch alles ein Fluß im tropischen Dschungel nur beherbergen mag.
Ein anderer und wieder ein anderer springt in den Fluß. Und bald sind sechs tiefbraune Männer im Fluß. Die Mädchen und Frauen stehen auf der Brücke oder an den Ufern und sehen den Bemühungen der nackten Männer zu.
Die sehnigen schlanken Körper der Männer, die alle so jünglingshaft erscheinen, haben einen stumpfen metallischen Glanz. Das lange strähnige, dichte Haar erscheint noch schwärzer und massiger, wenn die Köpfe auftauchen und von Wasser triefen. Während sie sich an den Brückenpfeilern anklammern, um neuen Atem zu schöpfen, blicken sie zuweilen hinauf zu den Frauen und Männern, die auf der Brücke stehen, und wenn sie auch nichts sagen, so steht doch in ihren traurigen Augen immer wieder die Nachricht: „Nada! Nada! Nichts! Nichts!“
Ein uralter Indianer mit weißem Haar ist unter den tauchenden Männern. Seine Brust ist nicht mehr so voll wie die der jüngeren Männer, und er kann nicht so lange tauchen wie die übrigen, aber wenn die anderen aufgeben wollen, weil jetzt in der Nacht nicht viel zu erwarten sei, ermuntert er sie immer wieder zu neuer Tätigkeit.
Der Pumpmeister kommt mit einem mächtigen Eisenhaken, den er an ein langes Tau gebunden hat, und schrittweise geht er an der Brücke entlang, wirft den Haken weit hinaus in den Fluß und zieht ihn langsam heran. Aber immer, wenn man glaubt, er hat den Körper gefunden, so ist es nur dickes moderiges Dschungelgebüsch, das der Haken gepackt hat.
Von den Ufern lodern die Feuer, und auf der Brücke stehen Männer und Burschen, halten flammende Holzscheite hoch empor, um das Wasser zu erleuchten. Andere laufen mit brennenden Scheiten auf der Brücke entlang, andere an den Ufern, teils um ausgehende Leuchtscheite wieder anzuflammen, teils um dort das Wasser zu erleuchten, wo besonders gefährliche und unübersichtliche Stellen sind und von wo aus die tauchenden Männer nach Licht rufen.
Ich sehe Sleigh an der Pumpe stehen und gehe hinüber zu ihm. „Hätte man ein Boot,“ sage ich, „könnte man mehr tun. Es ist schade, daß der Pumpmeister keines hat.“
„Da ist ein Boot, weiter unten am Fluß,“ sagt Sleigh, „der Holländer hat eins. Das ist aber einige Meilen runter. Da können wir vor Sonnenaufgang nicht hin.“
Er geht zu einer Gruppe von Männern, die über andere Dinge reden und augenblicklich keine Teilnahme an dem Ereignis nehmen, weil man ja nicht immerfort dasselbe tun kann.
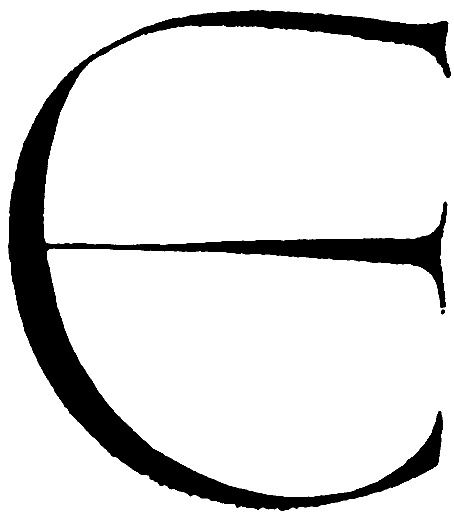 Es ist ein Bild, unvergleichlich in seiner Großartigkeit.
Da sind die lodernden Feuer.
Dunkelrote und braune Burschen stehen herum,
werfen neue Scheite auf oder stirren das
Feuer, um ihm mehr Leuchtkraft zu geben. Auf
der Brücke stehen Männer mit brennenden
Ästen, die sie hoch empor halten, oder die sie, auf der Brücke
kniend, zum Wasser richten, das die wechselnden Bilder widerspiegelt.
Frauen und Mädchen, in ihren bunten Tanzkleidern
und mit Blumen im Haar, Säuglinge im Arm oder Kinder
an der Hand, stehen auf der Brücke oder wandern umher,
sprechend zu anderen Frauen, oder in das Wasser blickend
oder schnell zu einem Punkte laufend, wo gerufen worden
ist, als habe man etwas gefunden oder entdeckt. Die flackernden,
flammenden Scheite werfen das Licht bald hierhin, bald
dorthin, wie der leichte Wind es weht. Die eine oder andere
Gestalt, die man ins Auge fassen will, steht bald im vollsten
Lichte da, bald im schwärzesten Schatten, bald im schwelenden
Rauch halbverschleiert, bald in einer lächerlich grotesken
Form, hervorgebracht durch wechselnde Streifen von hellem
Licht, tiefem Schatten und wehendem Rauch.
Es ist ein Bild, unvergleichlich in seiner Großartigkeit.
Da sind die lodernden Feuer.
Dunkelrote und braune Burschen stehen herum,
werfen neue Scheite auf oder stirren das
Feuer, um ihm mehr Leuchtkraft zu geben. Auf
der Brücke stehen Männer mit brennenden
Ästen, die sie hoch empor halten, oder die sie, auf der Brücke
kniend, zum Wasser richten, das die wechselnden Bilder widerspiegelt.
Frauen und Mädchen, in ihren bunten Tanzkleidern
und mit Blumen im Haar, Säuglinge im Arm oder Kinder
an der Hand, stehen auf der Brücke oder wandern umher,
sprechend zu anderen Frauen, oder in das Wasser blickend
oder schnell zu einem Punkte laufend, wo gerufen worden
ist, als habe man etwas gefunden oder entdeckt. Die flackernden,
flammenden Scheite werfen das Licht bald hierhin, bald
dorthin, wie der leichte Wind es weht. Die eine oder andere
Gestalt, die man ins Auge fassen will, steht bald im vollsten
Lichte da, bald im schwärzesten Schatten, bald im schwelenden
Rauch halbverschleiert, bald in einer lächerlich grotesken
Form, hervorgebracht durch wechselnde Streifen von hellem
Licht, tiefem Schatten und wehendem Rauch.
Dann tauchen die braunen nackten Gestalten im Wasser auf oder unter, klammern sich an den Brückenpfeilern fest, um sich für eine Weile auszuruhen oder die Pflanzen, die sich ihnen um die Beine geschlungen haben, abzuzerren. Hin und wieder kriecht einer an das Ufer und geht zum Feuer, um die erstarrten Hände anzuwärmen. Breitbeinig steht er am Feuer, den Rücken dem Flusse zugekehrt und streckt die offenen Hände vorwärts zum Feuer, während ihm ein Bursche eine angezündete Zigarette in den Mund schiebt.
Hier drüben fängt ein Kind, das eingeschlafen war, zu weinen an, und ein zweites wacht davon auf und schreit. Schnell kommen die Mütter herbei und geben ihnen zu trinken. Die kleineren Kinder sind nun alle eingeschlafen und liegen zusammengekauert auf dem Erdboden. Manche sind eingewickelt in ein Tuch, manche in eine Decke, manche in eine Reitmatte, manche liegen auf einem leeren alten Sack, und wieder andere liegen auf dem nackten Erdboden. Die größeren Kinder, soweit sie nicht interessiert an dem Tauchen der Männer sind, wo sie sich in einem fort darüber streiten, ob Sanchez bis sechzig unter Wasser war oder ob Jose diesmal bis hundert unten bleiben würde, drücken sich herum und besprechen Streiche, die sie an anderen Jungen verüben wollen, oder sie probieren irgend eine neue Schleuder aus. Andere musizieren auf einer Mundharmonika.
Die Esel des Packzuges grasen in der Nähe des Ufers, und wenn sie gerade nichts weiter wissen, trompeten sie in die Nacht. Sie fühlen sich außerordentlich wohl, in der Nähe so vieler lodernder Feuer und herumlaufender Menschen zu sein. Käme jetzt ein Jaguar vorüber, sie würden ihn dreist einladen, er möge ihnen doch ein wenig Gesellschaft leisten, denn sie haben gar keine Angst vor ihm.
Die Pumpmeisterin steht in ihrer Küche und kocht Kaffee. Was sie Küche nennt, und was die Mehrzahl der anwesenden Leute eine großartige Küche nennen würden, ist ein offener Raum. Nein, Raum kann man nicht sagen. Die Küche hat nur eine Wand, und diese Wand ist gleichzeitig die Wand der Hütte. Das Grasdach der Hütte ist hier weit überhängend und bildet so die Küche. Damit das überhängende Dach infolge der Schwere nicht herunterbrechen kann, ist es an beiden Ecken sowie in der Mitte mit einem Stamm gestützt. Durch diese drei rohen Stämme wird die Küche abgegrenzt. Der Küchenofen ist eine große flache Kiste, die mit Erde ausgefüllt ist und auf vier Pfählen ruht in einer Höhe, daß sie recht handlich für die Frau ist. Auf dieser Erde in der Kiste brennt ein offenes Holzfeuer, dessen Flammen durch einige rohe Steine zusammengehalten werden, damit die Hitze dicht an die Blechkanne kommt, die unmittelbar auf dem brennenden Holze steht. In einem irdenen Topfe, der neben der Kanne auf dem Feuer steht, sind schwarze Bohnen zum Kochen aufgestellt, für den Fall, daß jemand Hunger bekommen sollte. Ein Blech steht bereit, auf dem die Pumpmeisterin Tortillas anzuwärmen gedenkt. Der Schilfkorb, in dem sie die Tortillas, die vom letzten Mahle übriggeblieben sind, aufbewahrt, hängt an einem Draht, der an einem der Stämme befestigt ist, die das Gras des Daches halten.
Die Garza ist zu ihrer eigenen Hütte gegangen. Was sie dort sucht oder erwartet, weiß sie selbst nicht zu sagen. Sie kommt jetzt wieder über die Brücke zurück, die Laterne an der herunterhängenden Hand tragend. Eine Weile sieht sie den Tauchenden zu, dann geht sie weiter zur Pumpe, völlig gedankenlos und in einer Weise, als ginge sie das alles, was hier geschieht, nichts an.
Manuel sitzt stumpf und brütend auf einer Bank. Als er die Garza plötzlich vor sich sieht, blickt er sie groß mit leeren Augen an wie irgendeine Fremde. Dann, als ob ihm etwas einfiele, steht er rasch auf, geht über die Brücke und wandert auf dem sandigen Wege, der auf der anderen Seite durch den Dschungel zu fernen Dörfern führt, in die Nacht hinaus.
Der Pumpmeister wirft unermüdlich seinen schweren eisernen Haken hinaus in den Fluß und zieht ihn sorgfältig ein, manchmal leer, manchmal mit einer Last Wasserpflanzen und Gestrüpp beladen.
Die Tauchenden fangen an müde zu werden. Immer seltener tauchen sie unter, und immer länger müssen sie sich an die Brückenpfeiler klammern oder in der Nähe des Ufers ausruhen, wo das Wasser weniger tief ist und wo sie stehen können. Da das Wasser nun kühler wird, fangen sie auch noch an zu frieren. Der weißhaarige Alte muß aufgeben. Bald schwimmen auch die jüngeren ans Ufer, holen sich ihre Hosen, Hemden und Sandalen und laufen zu den Feuern, die ebenfalls Zeichen von Müdigkeit zeigen und lange nicht mehr so lodernd und lebhaft brennen wie eine Stunde bevor. Denn die Burschen und Männer müssen immer weiter in den Dschungel kriechen, um das notwendige Holz heranzuschleppen.
Schließlich fallen die Feuer gänzlich zusammen, und sie sind bald nur noch Gluthaufen. Die flammenden Äste und Scheite, die auf der Brücke als Fackeln dienten, sind nur noch funkensprühende Keulen, die ausgedient haben und wertlos sind, nun ins Wasser geschleudert oder in die Gluthaufen am Ufer geworfen werden.
An der Pumpe ist eine der Laternen ausgegangen, und ein Junge läuft mit der Laterne zu den Hütten, um Petroleum zu borgen.
Zwei der Taucher stehen an einem Gluthaufen auf dieser Seite und rauchen. Sie haben sich nicht angekleidet, sondern nur das Hemd um die Hüften gewickelt, um wieder bereit zu sein, sobald sie gerufen werden sollten. Denn es kann ja jemand einen neuen Gedanken haben.
Die Leute alle, insbesondere die Männer, die im Fluß getaucht haben, halten nun die Geschichte, die die Garza erzählte, für wahrscheinlich, und dennoch glaubt niemand, daß der Junge im Wasser ist. Sie haben keinen andern Gegenbeweis als allein nur den, daß ein Mensch, auch wenn er nur ein Junge ist, nicht so leicht und geräuschlos stirbt. Der Tod ist ein so großer Vorgang, daß er nie schweigend sein kann. Da ist immer Geschrei damit verknüpft oder Schießen oder Stechen oder Mit-dem-Pferde-Stürzen oder der Krach eines gefällten Baumes oder das Plätschern und Kreischen eines ins Wasser Gefallenen oder das Herumwälzen des an den Blattern Erkrankten. Daß der Tod inmitten von sechzig oder mehr Menschen, die sich zum Tanze versammelt haben, so ganz still erscheinen kann, ohne daß sich auch nur die Luft bewegt, das begreift keiner von diesen Leuten. Man hat auch nur alles das getan, um der Mutter zu zeigen, daß sie nicht allein auf der Welt ist, und daß man das einzige Hemd, das man hat, hergeben würde, könnte man ihr dafür den Sohn zurückbringen.
Nun beginnen einige Männer mit einer langen Stange, die sie sich geschaffen haben dadurch, daß sie zwei dünne Stämme mit Bast zusammenbanden, den Grund des Flusses an der Brücke entlang abzutasten, weil jemand den Gedanken hatte, man könne mit einer Stange den Körper deutlich fühlen, falls er überhaupt im Wasser sei.
Das Bild hat sich inzwischen völlig verändert.
An den glimmenden verlöschenden Feuern sitzen oder stehen die braunen Gestalten herum, rauchend und redend. Sie sind so ungewiß beleuchtet, daß man nur bewegende Schatten sieht. Ein erregtes Gespräch hebt an, das plötzlich abbricht, als habe es die Nacht verschlungen, um bei einer anderen Gruppe auszubrechen, als sei es unterirdisch hinübergekrochen. Dann hört man nur halblautes Reden, aber man sieht heftige und eindringliche Gesten. Auf der Brücke sitzen andere, kauern oder halten die Beine über den Rand der Brücke und schaukeln mit den Füßen. Andere wieder, die nichts Besseres zu tun wissen, wehen die verglimmenden Äste durch die schwarze Luft und zeichnen funkelnde Figuren.
Irgendwo in einem Winkel der Nacht wird auf der Mundharmonika gespielt. Aus einem anderen Winkel der Finsternis hört man das Kichern eines Mädchens und das hastige, unterdrückte und erregte Sprechen eines Mannes. Dann wieder, von einem anderen Winkel her ein hartes, abweisendes Hin- und Herreden eines Paares, das sich verkrochen hat. Von ferner her tönt das unternehmende lustige Pfeifen eines Burschen, der in der Stimmung eines Siegers zu sein scheint. Auf dem Pumpplatze haben sich wieder Gruppen gebildet, die meist mit langen Pausen sprechen, weil schon alles zwanzigmal gesagt worden ist. Die Frauen und Mädchen sitzen herum oder gehen, ohne sich jedoch vorzudrängen, zur Küche der Pumpmeisterin, wo sie heißen Kaffee in kleinen Emailletassen erhalten. Der Kaffee ist schwarz, und jedesmal, wenn die Frau eine Tasse hinreicht, deutet sie auf eine Konservenbüchse, die mit Zucker gefüllt ist, und neben der ein kleiner Löffel liegt.
Die Pumpmeisterin hat nur fünf Tassen, alle verschieden in Form und Farbe, und mit diesen fünf Tassen versorgt sie alle Frauen mit Kaffee. Aber der Kaffee ist bald alle, und die Pumpmeisterin beeilt sich, frischen zu kochen.
Niemand trinkt mehr als eine kleine Tasse, manche der Frauen trinkt die Tasse nur halb und reicht die andere Hälfte ihrer Nachbarin; denn die Nacht ist nun recht hübsch kühl geworden, und jedem wird ein Schluck heißer Kaffee wohl tun.
Auf der Brücke sind einige der Männer immer noch damit beschäftigt, die Längsseiten der Brücke Schritt für Schritt mit der Stange abzutasten.
Jetzt krähen die Hähne zum erstenmal in der Nacht. Also ist es elf Uhr.
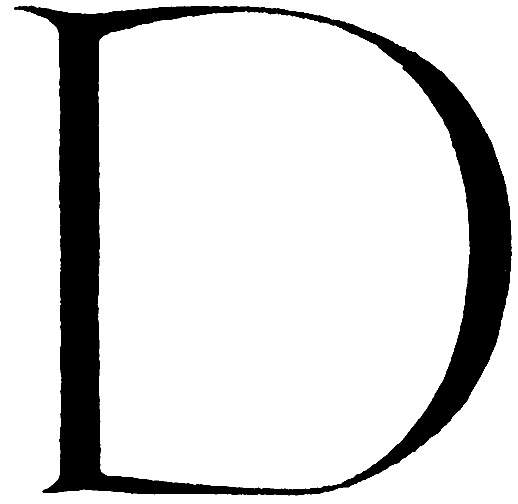 Der Pumpmeister hat sein Suchen und
Fischen mit dem Haken aufgegeben. Der
Haken liegt verlassen auf der Brücke,
und der Pumpmeister steht nun auch bei
den Gruppen in der Nähe der Pumpe.
Er erzählt von einigen Todesfällen, die
er erlebt hat, die aber in gar keiner Beziehung zu diesem
Ereignis stehen.
Der Pumpmeister hat sein Suchen und
Fischen mit dem Haken aufgegeben. Der
Haken liegt verlassen auf der Brücke,
und der Pumpmeister steht nun auch bei
den Gruppen in der Nähe der Pumpe.
Er erzählt von einigen Todesfällen, die
er erlebt hat, die aber in gar keiner Beziehung zu diesem
Ereignis stehen.
Die Garza war die erste, der Kaffee angeboten wurde. Sie ist der respektierte Ehrengast der Pumpmeisterin. Und die Pumpmeisterin ist hier in dieser Dschungelsiedlung ungefähr dasselbe, was eine Baronin in einem armseligen Bergdörfchen in einem europäischen Lande ist. Sie kann ein wenig lesen und ein wenig schreiben, und sie ist deshalb eine hochgebildete Frau, die in die Schule gegangen ist. Ihre Kinder haben keine Läuse oder nur hin und wieder ein paar, und sie laufen nur selten nackt herum. Wenn sie auch nicht gerade immer ein Hemd an haben, so doch wenigstens eine Hose oder ein Röckchen. Das kann man nicht einmal von den Kindern Sleighs sagen. Die Frau Pumpmeisterin selbst hat vier verschiedene Musselinkleider und wenigstens drei Hemden. Mehr hat sie nicht, das weiß jeder. Hosen hat sie sogar vier, von denen zwei aber nicht mehr ganz für voll gerechnet werden können. Sie hat Ohrringe, echtes Gold. Auch hat sie einen spanischen Kamm fürs Haar, der mit Perlchen besetzt ist. Diese Perlchen, weiß auch jeder, sind aber nicht echt. Der Pumpmeister hat einen Sonntagsanzug mit einer Jacke. Sie haben eine Uhr im Hause, eine Weckuhr, ferner einen Spiegel, sogar ein Messer, nicht zu reden von den beiden Gabeln, die sie haben. Und was das größte ist, ein eisernes Bett mit Drahtmatratze. Wer hat das sonst noch? Vielleicht der Präsident in der Hauptstadt. Aber kein Wunder, der Pumpmeister gehört ja zur Eisenbahn. Da ist nichts in der Welt, das größer wäre. Und was die Pumpmeisterin sagt, ist mehr wert, als was der Priester sagt, bei dem man nie weiß, was er meint und was er vielleicht hintennach beabsichtigen mag. Wenn man mit der Frau Pumpmeisterin gut befreundet ist, kann man die Königin von England leicht entbehren. Ob die Königin von England zwei Paar gelbseidene Strümpfe hat und drei Taschentücher, von denen eines gestickte Kanten hat, das soll erst noch bewiesen werden. Denn was die Leute so erzählen, darf man noch lange nicht immer glauben.
In eine Gruppe, die weiter ab von der Pumpe steht, kommt plötzlich Bewegung. Man hört schnelles Sprechen und Fragen.
„Der Junge war nicht da?“ klingt nun eine Stimme deutlich heraus.
Der Eseltreiber und der ihn begleitende Junge sind von Tamalan zurückgekommen.
„Nein, er war nicht dort.“
„Habt ihr denn überall herumgefragt?“
„Ganz natürlich. Alles schlief, und wir sind in jede Hütte gegangen, haben die Leute aufgeweckt und nach dem Kleinen gefragt.“
„Habt ihr euch auch erkundigt, ob vielleicht der Kleine durchgekommen ist?“
„Auch das haben wir getan. Es ist heute niemand aus Tamalan hier herum gewesen und auch niemand aus der hiesigen Gegend dort vorbeigekommen. Die Hunde würden gelärmt haben, wenn da jemand in der Nacht durchgeritten wäre.“
„Und auf dem Wege?“
„Auf dem Wege war keine frische Spur, wir haben abgeleuchtet. In der Richtung nach Tamalan sind die nicht geritten.“ Die redende Gruppe kommt näher heran, bis sie im Licht der Laterne steht. Das Gespräch ebbt ab, weil man nichts mehr zu fragen weiß.
Die Garza steht auf von ihrem Sitz und sieht auf den Eseltreiber, der seine Augen verlegen von einem zum andern wandern läßt. Er will jetzt etwas zur Garza sagen. Aber in diesem Augenblick setzt sie sich wieder. Sie weiß es schon. Der Eseltreiber wendet sich langsam um. Er hat einen Ausdruck im Gesicht, als ob er am Tode oder wenigstens am Verschwinden des Kleinen schuld wäre. Erst als er ganz aus dem Gesichtskreis der Frau heraus ist, sich zwischen eine Gruppe von Männern gemischt hat und eine Zigarette raucht, fühlt er sich wieder wohler.
Ich gehe zur Brücke, wo ein Indianer weiter mit der Stange tastet, während ein anderer dicht neben ihm auf der Brücke kniet und mit einer Laterne immer da ins Wasser leuchtet, wo der andere mit der Stange hineinfühlt.
Da mit einemmal läßt der Mann die Stange auf dem Grunde, dreht sich um, sieht mich mit großen Augen an und sagt halblaut: „Senjor, ich habe ihn. Da fühlen Sie selbst.“
„Seien Sie ganz ruhig, Perez,“ gebe ich zur Antwort, „sonst haben wir gleich alle Leute hier, und wir können nichts tun. Wir wollen erst durchaus sicher sein. Halten Sie die Stange ruhig an der Stelle.“
Ich trete nun dicht an seine Seite und nehme ihm die Stange behutsam ab. Ich taste am Grunde und fühle in der Tat etwas, das ein menschlicher oder tierischer Körper sein könnte. Vorsichtig, um den Grund nicht aufzurühren und den Körper vielleicht fortschwemmen zu lassen, hebe ich die Stange und führe sie, leise suchend, wieder nach unten, um das Gefühl voll in die Fingerspitzen zu lenken. Und wieder fühle ich den Körper.
„Na?“ fragt Perez.
„Sicher bin ich noch nicht“, erwidere ich.
Ich taste nun weiter, ob dieser Fund auch die Ausdehnung eines menschlichen Körpers hat, denn bis jetzt haben wir ja nur einen Ballen, der die Brust oder der Unterleib sein kann oder der Oberschenkel. Aber der Fund hat keine Ausdehnung in der Länge, sondern die Ausdehnung geht gleichmäßig nach jeder Richtung, und nach langem geduldigen Abfühlen komme ich zur Überzeugung, daß der vermeintliche Körper ein versandeter Ballen Gras oder dünner Strauchäste ist, der sich dort unten irgendwie festgehakt hat. Was immer es auch sein mag, der Körper eines Kindes ist es nicht. Perez sieht ein, daß er sich geirrt hatte. Er gibt jetzt auch auf, setzt sich auf die Brücke und dreht sich eine Zigarette.
Nach einer Weile gehen wir zur Pumpe, und die Pumpmeisterin bietet uns Kaffee an, Bohnen und Tortillas; denn inzwischen waren die Männer an die Reihe gekommen, Kaffee trinken zu dürfen. Der Kaffee steht in den fünf Tassen eingegossen auf einem hölzernen Gegenstand, den die Pumpmeisterin ihren Küchentisch nennt. Wer von den Männern Durst auf Kaffee empfindet, kommt heran, nimmt sich eine Tasse, schüttet Zucker hinein, und wenn er sie ganz oder halb ausgetrunken hat, stellt er sie wieder auf das Brett, damit ein anderer trinken kann. Auf Frijoles und Tortillas habe ich augenblicklich keinen Appetit, dagegen tut der Schluck Kaffee mir so wohl, daß die Pumpmeisterin mir das Behagen ansieht und lächelnd fragt: „Mas?“ Da ich sehe, daß drei volle Tassen unberührt dastehen und die Männer offenbar alle schon getrunken haben in der Zeit, während ich mit Perez an der Brücke fischte, kann ich dem Angebot nicht widerstehen, wofür mich die Pumpmeisterin dankbar anblickt, daß ich ihren Kaffee für so gut befinde.
Die Brücke ist nun ganz verlassen. Niemand ist in ihrer Nähe. Hier stehen die Leute wieder in Gruppen umher und schwatzen. Die Mädchen und Frauen sitzen herum, wo sie etwas zum Sitzen gefunden haben, und schwatzen und lachen. Durch den Kaffee ist alles mehr lebendig geworden. Die Welt scheint nicht mehr so düster auszusehen. Man hat vollständig vergessen, was während der letzten Stunden alle Anwesenden erfüllte. Die zunehmende Müdigkeit der Leute, die alle seit Sonnenaufgang auf den Beinen sind, läßt die Gefühle erschlaffen. Man sieht die Garza sogar zwei- oder dreimal lachen. Es hat sich dadurch, daß der Junge im Fluß nicht gefunden wurde, die Gewißheit festgesetzt, daß der Kleine nicht ins Wasser gefallen ist, sondern daß er entweder nach Magiscatzin geritten ist, wie die beiden Jungen behaupten, oder aber, daß er in irgendeinem Winkel sich hingelegt hat und eingeschlafen ist.
Man hat sich darüber geeinigt, daß man warten wolle, bis Garza von Magiscatzin zurück ist. Sollte er den Jungen nicht bringen und auch nichts erfahren haben, so wolle man bis Sonnenaufgang hier beieinander sitzenbleiben und dann bei Tageslicht von neuem den Fluß absuchen. Die Stimmung ist im Grunde die gleiche, die bis zu jenem Augenblick herrschte, an dem der Junge vermißt wurde.
Ein paar Männer, denen das Herumstehen zu langweilig wurde, haben sich wieder zur Brücke aufgemacht und fangen abermals an, mit der Stange zu tasten und mit dem Haken zu fischen. Plötzlich fängt auch die Garza wieder an zu schreien, und sie rennt wie rasend zu der Brücke und gebärdet sich, als ob sie hineinspringen wolle. Sie schwenkt die Laterne über das Wasser, während sie sich weit hinüberlehnt, und schreit unaufhörlich: „Mein Kleiner! Mein Liebling! Ninjo, ninjo mio!“ Der Pumpmeister und noch ein anderer Mann laufen herbei und halten sie fest. Sie wehrt sich, schlägt um sich und kreischt: „Laßt mich los! Was wollt ihr denn von mir?“
 In der Nähe der Pumpe bildet sich jetzt eine Gruppe von
Männern, die immer größer wird. Es wird lebhaft geredet,
zugestimmt, genickt, gestikuliert. Der Wortführer
ist jener weißhaarige alte Indianer, der mit den jungen
Männern getaucht und endlich, ganz blau gefroren, hatte
aufgeben müssen. Die Gruppe, den heftig redenden Alten
in der Mitte, bewegt sich der Hütte des Pumpmeisters zu.
In der Nähe der Pumpe bildet sich jetzt eine Gruppe von
Männern, die immer größer wird. Es wird lebhaft geredet,
zugestimmt, genickt, gestikuliert. Der Wortführer
ist jener weißhaarige alte Indianer, der mit den jungen
Männern getaucht und endlich, ganz blau gefroren, hatte
aufgeben müssen. Die Gruppe, den heftig redenden Alten
in der Mitte, bewegt sich der Hütte des Pumpmeisters zu.
Auch die Brücke wird wieder belebter, obgleich sich doch nichts Neues ereignet hat. Überall sieht man eine merkwürdige Geschäftigkeit. Hier auf der Brücke weiß man nicht, was jene Gruppe beabsichtigt. Aber man legt offenbar keinen Wert darauf, es zu erfahren. Es wird immer emsiger gefischt und getastet.
Nun gehe ich hinüber zur Pumpe, und ich höre, wie der Alte zu der Pumpmeisterin sagt: „Eine starke Kerze, ja.“
„Ich habe nur ein paar dünne im Hause“, antwortet die Frau.
„Wer hat denn wohl hier eine dickere Kerze?“ fragt der Alte.
„Ich glaube nicht, daß jemand hier überhaupt Kerzen hat, und wenn da noch welche sind, dann auch nur die dünnen. Aber die fallen ja immer zusammen“, erklärt die Pumpmeisterin.
„Ja, wenn wir nur eine Kerze hätten“, wiederholt der Alte.
„Oiga!“ sagt nun die Pumpmeisterin. „Ich habe noch eine Kerze, aber das ist eine geweihte, die ich noch hier habe von einem Corpus-Christi-Fest.“
„Die ist um so besser,“ nickt der Alte, „bringen Sie die nur her.“
Die Pumpmeisterin nimmt eine Laterne und verschwindet in ihrer Hütte.
Der Alte sieht sich um und entdeckt eine Kiste, die bisher als Sitz diente. Er schleift die Kiste unter das Licht der Laterne und bricht ein Brett heraus. Es ist ein ganz dünnes Brett, etwas länger als breit. Er sieht über die Fläche und untersucht, ob das Brett auch ganz eben ist, ob auch alle vier Ecken gleichmäßig aufliegen.
„Das Brett wird gehen“, sagt er zu den Umstehenden, die nicht wissen, was er vorhat.
Nun kommt die Pumpmeisterin heraus, sie hat in der Hand eine halbabgebrannte Kerze, von der Art jener starken Kerzen, die von Kindern bei kirchlichen Festen getragen werden.
Der Alte legt das Brett auf den Erdboden, hängt die Laterne ab, stellt sie neben das Brett und markiert mit dem Fingernagel die genaue Mitte des Brettes. Dann zündet er die Kerze an, tropft auf den markierten Mittelpunkt des Brettes Stearin und klebt die Kerze mit großer Sorgfalt auf dem Brette fest. Die Laterne hängt er nun wieder zurück an den Stamm.
Die Männer, die herumstehen, sehen aufmerksam zu, wissen jedoch nicht, worauf das alles abzielt, fragen aber auch nicht, um den Alten nicht zu stören.
Nun hebt der Alte das Brett mit dem brennenden Licht auf und trägt es vor sich zum Ufer des Flusses. Die Männer und auch eine Anzahl Frauen folgen ihm. Auf der Brücke wird man aufmerksam. Das Suchen und Fischen wird eingestellt, und auch diese Leute kommen näher, bleiben aber alle auf der Brücke stehen, um das Ereignis besser zu beobachten.
Eine uralte Indianerin hockt auf der Brücke, sieht auch zu, ist aber nicht neugierig und viel weniger interessiert an den Vorgängen als sonst irgend jemand. Sie raucht und raucht. Immer wenn sie einen Zug getan hat, betrachtet sie die Zigarette und drückt das Maisblatt etwas fester zusammen. Ich habe das Empfinden, daß sie außer dem alten Manne die einzige Person hier ist, die weiß, was da vor sich gehen soll. Ich hocke mich neben sie und gehe geradeswegs auf den Kernpunkt los: „Was wollen denn die da tun?“
„Die werden jetzt den Bastard suchen.“ Sie sagt das so leicht und so selbstverständlich, als ob sie an dem Erfolge nicht mit dem leisesten Gedanken zweifle.
„Wie meinen Sie das, Senjora? Suchen?“
„Ja suchen. Und nun werden sie ihn auch gleich haben, wenn er überhaupt im Wasser ist.“
„Wir haben doch die ganze Zeit gesucht und haben ihn nicht gefunden“, sage ich, um sie mehr zum Reden und zum Erklären zu bringen.
Sie grinst ironisch. „Wie das heutzutage die Esel tun, die ja so klug sind und alles besser wissen, so werden die das Böckchen nie finden. Da können sie alle miteinander suchen, vier Wochen lang. Und wenn er nicht von selber auftreibt und die Caimans und das Fisch- und Krabbenzeug noch etwas von ihm übriglassen, so kriegt ihn sein Vater nie mehr zu Gesicht.“
„Aber was hat denn das Licht damit zu tun? Wir haben doch tausendmal und überall herumgeleuchtet, und das Licht ist doch nicht heller als die Fackeln und Feuer, die wir hatten.“
„Ihr mit euren Laternen und Haken und Stangen. Das ist alles für den Hund, aber nicht für einen Menschen. Das Licht findet ihn ganz von selbst, wir brauchen nur aufzupassen, wo es hingeht.“
„Wie kann denn das Licht ihn finden, wenn wir ihn nicht finden?“
Auf diese Frage schweigt sie eine Weile, zieht ein paarmal an der Zigarette, betrachtet sich die Zigarette dann mit gedankenvollen Augen und sieht mich an, als ob sie überlegen wolle, ob ich einer Antwort wert sei.
Ich dränge nicht, sondern blicke nur hinüber zu der Gruppe, die sich jetzt in einem Kreise um den Alten sammelt, der in der Mitte steht und das Brett mit dem Licht in halber Armeslänge vor sich hält. Er sieht jetzt aus wie ein alter heidnischer Priester, der eine geheimnisvolle religiöse Handlung vorzunehmen bereit ist.
Die Alte betrachtet mich mit halbgeschlossenen Augen, und da sie offenbar bemerkt, daß ich sehr ernst bleibe und die Vorgänge am Ufer mit keiner Geste oder Miene abfällig beurteile, spricht sie, mich unausgesetzt im Auge behaltend: „Der Junge ruft doch unausgesetzt.“
„Der Junge ruft?“ frage ich erstaunt. „Ich höre nichts.“
„Freilich nicht“, sagt die Alte. „Ich kann das auch nicht hören. Kein Mensch kann das Rufen hören. Aber das Licht hört das Rufen.“
„Das Licht?“ frage ich. Und weil ich glaube, nicht genau verstanden zu haben, was sie in ihrem vermischten Dialekt gesagt hat, frage ich noch einmal: „Sie wollen sagen, das Licht hört das Rufen!“
„Wenn er überhaupt im Wasser ist, dann ruft er. Und er wird das Licht zu sich heranrufen. Und das Licht wird kommen. Das Licht wird zu ihm kommen und wird bei ihm stehenbleiben, weil es seiner Stimme folgen muß.“
Es war Nacht. Beinahe Mitternacht. Und es war im Dschungel, und ich war mitten unter Indianern. Als die Alte das so erzählte, als ob es sich um irgend etwas ganz Alltägliches handele, kam mir der Gedanke, daß entweder sie irre ist, oder ich bin es. Aber ich hatte auch gleichzeitig das Gefühl, daß in dieser Umgebung, unter diesen Umständen und unter diesen Vorgängen, die sich seit nun etwa vier Stunden zugetragen hatten, alles andere, was die Alte mir erzählt haben würde, unnatürlich geklungen hätte, daß sie gar nicht anders reden konnte, als sie in Wirklichkeit tat.
Ich blieb bei ihr hocken. Sie sagte nichts mehr, rauchte ruhig weiter und blickte gleichgültig zu der großen Gruppe hinüber. Der Alte hielt das Brett mit dem brennenden Licht noch weiter vor sich und begann nun laut zu reden. Es war wie eine Beschwörung. Nach einer langen Reihe von Worten folgte jedesmal ein Satz, der durch eine Pause eingeleitet wurde und mit gehobener Stimme gesprochen wurde. Dieser Satz wurde von allen Anwesenden in einem singenden getragenen Tone als Refrain nachgesprochen.
Alle Männer hatten den Hut in der Hand und folgten der Zeremonie ernst und feierlich.
Es kam häufig das Wort „Heilige Jungfrau“ darin vor, was als Refrain gesprochen wurde. Aber das Gefühl, daß, wenn die Indianer beten, sie zwar den Namen des christlichen Gottes und der christlichen Heiligen auf den Lippen tragen, jedoch in ihrer Vorstellung ihre alten heidnischen Götter haben, hatte ich vorher nie so stark und unabweisbar empfunden wie in dieser Nacht. Sie sprachen „Heilige Jungfrau“, aber sie meinten die indianische Göttin Cioacoatl. Wie kann ein zimtbrauner Indianer sich vorstellen, daß die gnadenreiche Göttin, die er bittet, in seinem Herzen zu wohnen, eine weiße Hautfarbe hat, die Farbe, die ihn an Leichen und an Aas erinnert, die Farbe einer Haut, deren Ausdünstung ihm unangenehm ist? Die Namen der Götter und Göttinnen hat er gewechselt, ihre Gestalt, ihre Hautfarbe, ihr Wesen nicht.
Diese Beschwörung geht eine gute Weile nun vor sich. Endlich hebt der Alte das Brett sehr hoch, so hoch seine Arme reichen, so daß es sich im Wasser widerspiegelt, und spricht noch einen langen Satz, der mit einem von allen gesprochenen Refrain endet.
Blitzschnell hat sich Perez ausgekleidet, und während er bis zu den Schenkeln im Wasser steht, reicht ihm der Alte das Brett mit der brennenden Kerze.
Perez hält das Brett hoch über sich und watet in den Fluß, bis ihm das Wasser über die Hüften reicht. Jetzt wartet er eine Zeit, damit das Wasser, das durch sein Waten in Bewegung gekommen ist, sich beruhige. Dann setzt er ganz behutsam das Brett auf den Wasserspiegel und watet so ruhig als möglich zum Ufer zurück. Das Brett folgt ihm ein klein wenig, weil das Hinauswaten einige schwache Wellen zurückließ.
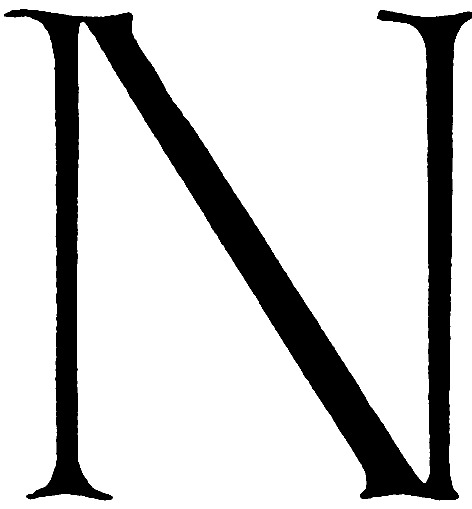 Nun steht das Brett ruhig im Wasser, als ob
es entscheiden wolle, wohin es zu gehen
habe.
Nun steht das Brett ruhig im Wasser, als ob
es entscheiden wolle, wohin es zu gehen
habe.
Perez wickelt sich sein Hemd um die Lenden und tritt vom Ufer zurück, um von der Brücke aus das Brett zu beobachten. Aller Leute, die anwesend sind, bemächtigt sich jetzt eine atemlose Spannung. Die Männer haben die Hüte noch in der Hand, oder sie haben sie irgendwo hingeworfen. Niemand raucht. Man hört nicht ein Wort. Nur das Singen und Tschirpen des Dschungels tönt in der Luft. Gebannt hängen alle Augen an dem Licht. Niemand weiß, ob das Wunder vor sich gehen werde, wie es Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende vor sich gegangen ist. Ein einziger Glaube erfüllt diese Versammlung von Menschen, und nicht einer denkt, daß jenes Licht versagen könne. Es muß versagen, wenn der Junge nicht im Wasser ist; denn wenn er nicht ertrunken ist, kann er nicht rufen, und das Licht kann nur dem Rufe folgen. Plötzlich ein unterdrückter Aufschrei und der gleichzeitige Atemzug eines vielköpfigen Körpers:
Unendlich langsam schwimmt es vom Ufer fort nach der Mitte des Flusses zu. Es bleibt stehen, wiegt und wackelt ein wenig auf dem Wasser und rückt, kaum merklich, wieder weiter voran.
Die ganze Front der geländerlosen Brücke ist mit Menschen besetzt, die auf dem Boden knien, die Hände auf den Balken stützen, den Kopf weit über den Rand der Brücke halten und mit stieren Augen auf das Brett starren. Niemand wagt zu atmen, teils aus Spannung, teils aus einem Gedanken heraus, daß der Atem den Lauf des Brettes beeinflussen könne.
Ich sehe alle diese braunen, dunkelroten und dunkelgelben Gestalten der Reihe nach an. Die schwarzen Augen spiegeln in einem Funken das Licht auf dem Brette wider. Nackte Körper und von zerfetzten Hemden halbbedeckte Körper. Auf den Scheiteln und in den Nacken das dicke, schwarze, strähnige, ölig glänzende Haar. Die Füße nackt oder mit rohen Sandalen bekleidet. Dazwischen die Frauen mit ihren roten, grünen, blauen und gelben Gazekleidern und mit grellfarbenen Blumen im Haar, durch den Gegensatz ihrer europäisch erscheinenden, in modernen Fabriken hergestellten Kleidung viel unheimlicher wirkend als die Männer, deren halbe oder zerlumpte Kleidung natürlicher und harmonischer erscheint.
Der Gedanke an die mysteriöse Handlung, die diese unheimlichen Gestalten vornehmen, ihre abergläubische Hoffnung, daß das Wunder sich vollziehen werde, das trübe Licht der Laternen von der Pumpe her, das flackernde Aufflammen eines der Uferfeuer, das wieder angefacht worden ist, das schwimmende Brett mit dem Licht im Wasser, das der Mittelpunkt aller Augen ist, das dumpfe Schweigen dieser Masse von Menschen und das Singen des Dschungels, beginnt so entsetzlich auf mir zu lasten, daß ich fühle, mich nur durch einen gewaltigen Schrei von dem Alpdruck, der mir die Kehle abschnürt, befreien zu können. Wo ist die Welt? Wo ist die Menschheit geblieben? Ich bin auf einem anderen Planeten, von dem ich nie mehr zurück kann, zu meiner Rasse, zu meinen Wiesen und meinen Wäldern und meinen Bergen. Ein einziger hier braucht jetzt nur aufzustehen, mit dem Finger auf mich zu weisen und zu sagen: „Der da, der Weiße, der Fremde, der ist schuld; der hat das Unglück über die Mutter und über uns alle gebracht. Er ist hierher gekommen, und sofort hat der Fluß, der ihn haßt, uns das Kind geraubt. Seht ihr es nicht an seinen Augen, mit denen er unsere Kinder vergiftet?“
Ich wäre nicht der erste Weiße, der in ein Indianerdorf kam und mit seinen Augen ein oder zwei oder gar noch mehr Kinder mordete, gesunde Frauen tödlich erkranken, kräftige Männer im Busch verunglücken ließ, Hühnern die Eier aus dem Neste wegguckte und die Jaguare herbeisang, um die schönsten jungen Kühe zu schlagen. Und wenn sie mir hier meine Zauberei und Morderei heimzahlen und ich nicht wieder zurückkehre, wer wird je erfahren, wo ich geblieben bin, wo meine Gebeine faulen und meine Knochen bleichen? Die Geier arbeiten schneller als die Alligatoren und die Riesenkrebse. „Auf einer Reise durch den Dschungel umgekommen.“ „Beim Fischen von Alligatoren gepackt worden.“
Aber warum sollte ich Unbehagen empfinden? Da steht ja Sleigh, weiß am Körper wie ich, Gedanken, die ich denke, Sprache, die ich spreche. Er steht hinter den Knienden und blickt ebenfalls nach jenem Brette. Sollte diese Masse von einem dummen, ihr aber sehr vernünftig erscheinenden Gedanken ergriffen werden, Sleigh ist meine Rettung. Er würde an seinem großen Hute rücken und würde sagen: „Aber das dürft ihr doch nicht machen. Das ist ja dumm. Er hat den Jungen nicht ins Wasser geworfen.“ Dann würde er sich zu mir wenden und sagen: „Ich muß nach der schwarzen Kuh sehen, vielleicht ist sie jetzt hereingekommen.“ Und dann würde er mich allein lassen. Wenn ich in Stücke gerissen bin, wird er zurückkommen und zu den Leuten sagen: „Wer hätte so etwas gedacht? Ich glaube nicht, daß er den Jungen ins Wasser geworfen hat.“ Sleigh! Wer ist Sleigh? Er lebt ein halbes Menschenalter unter diesen Indianern, er hat eine Indianerin zur Frau und hat Kinder mit ihr. Er ißt nur indianische Kost und fühlt sich in einem Hause, wie es hier Weiße haben, ungemütlich. Nicht der aus einer Kreuzung hervorgegangene Wolfshund ist er, nein, er ist der aus Bewußtsein und aus Gleichgültigkeit gegenüber dem zivilisierten Menschen sich selbst erzeugte Wolfshund. Ohne eine Miene zu verziehen, wird er dabeistehen, wenn diese erregte Masse plötzlich eine lächerliche Idee bekommt und mich zerfleischt.
* * *
Das Brett ist jetzt etwa fünf Schritte vom Ufer entfernt. Es rastet wieder eine Weile, beginnt nun zu quirlen und gerät quirlend in die Strömung des Flusses. Die Strömung ist eine ganz leichte, sie ist kaum bemerkbar, aber doch vorhanden. Einen Schritt folgt das Brett der langsamen Strömung, dann bleibt es stehen und quirlt wieder auf der Stelle.
Abermals folgt es der Strömung drei oder vier Schritte, was eine gute Weile in Anspruch nimmt. Und abermals steht es, quirlt herum und kommt nun ganz langsam zurück, der Strömung entgegen.
Die Menge findet nichts Auffallendes oder gar Verwunderliches in der Tatsache, daß jenes Brett der Strömung entgegengleitet. Das erscheint diesen Leuten in dem Falle durchaus natürlich. Sie sind nunmehr überzeugt, daß der Junge im Wasser ist, daß er ruft, und daß er nicht die Strömung hinuntergeschwemmt ist.
Das Brett kommt zurück, so langsam freilich, daß man sein Kommen nur bemerken kann, wenn man die Punkte markiert, wo es vor einer Weile war, und wo es jetzt ist.
Nun hat es sich verfangen in dem Geäst eines irgendwo am Ufer abgerissenen Strauches, der sich in Wasserpflanzen festgehängt hat.
Regungslos sieht die Menge zu, und auf den Gesichtern vieler zeigt sich Enttäuschung. Einer der Männer will hineinspringen, um das Brett zu befreien, aber der alte Indianer verbietet es ihm und sagt: „Kein Strauch und nichts kann das Brett festhalten. Laßt uns geduldig warten.“
Und in der Tat, es dauert nicht allzulange, da quirlt das Brett wieder und dreht sich aus den umklammernden Ästen heraus. Es schwimmt weiter der Strömung entgegen, und langsam kommt es wieder auf die Brücke zu.
Nun steht es am siebenten Pfeiler, stößt leicht gegen ihn und wird wieder abgestoßen. Es beginnt nunmehr auf den sechsten Pfeiler loszuwandern. Dort angekommen steht es lange und ganz ruhig.
„Jetzt steht es! Da ist der Junge!“ wird von einem Dutzend Stimmen gleichzeitig gerufen.
„Laßt uns warten!“ sagt der Alte. „Das Licht steht noch nicht.“
Und kaum hat er das gesagt, da löst sich das Brett von dem Pfeiler los und wandert, immer längsseit der Brücke haltend, auf den fünften Pfeiler zu. Auf seinem Wege wird es wieder und wieder von der leisen Strömung getroffen, wodurch es mehrere Male von der Brücke einen Fuß oder einen halben abgetrieben wird. Aber immer kommt es zurück zur Brücke mit einer Beharrlichkeit, als würde es von einem festen Willen gelenkt.
Es hängt nun wieder am fünften Pfeiler. Aber nicht lange. Dann dreht es sich um diesen Pfeiler und wandert schneckenlangsam unter die Brücke.
Die Leute klammern sich mit den Händen fest an dem Balken und stecken die Köpfe weit herunter, um die Wanderung des Brettes besser verfolgen zu können. Ein großer Teil springt erregt auf und läuft auf die andere Längsseite der Brücke hinüber, weil man jetzt von der anderen Seite ebensoviel bereits sehen kann wie von dieser. Andere wieder haben sich in die Mitte der Brücke flach auf den Bauch gelegt und stieren durch die weiten Spalten der Bretter auf das Wasser hinunter. Das Brett ist immer dieser Pfeilerverstrebung entlang gekrochen, bis es endlich mitten unter der Brücke ist. Dort hält es eine Weile und wandert nun, immer genau mitten unter der Brücke haltend, auf den vierten Pfeiler zu, jedoch nur auf die Länge eines Fußes.
Hier steht es nun. Und hier steht es jetzt wie genagelt. Es kehrt sich weder an Strömung noch an die leichte Brise, die über das Wasser fegt.
Der Menschen bemächtigt sich eine ganz ungeheuerliche Erregung. Man hört ihr schweres Atmen. Den meisten bricht dicker perlender Schweiß aus. Das lastende Schweigen wird von einem gelegentlichen Flüstern unterbrochen, so schüchtern, als habe man Angst vor der eigenen Stimme.
Das Brett beginnt nun, ohne sich auch nur einen Finger breit von der Stelle fortzubewegen, zu tänzeln und zu schaukeln und dreht sich dabei langsam im Kreise. Es macht den Eindruck, als wolle es nach unten gehen, auf den Grund des Flusses, und als sei auf der Unterseite des Brettes ein Haken, an dem es nach unten gezerrt würde.
Der Alte beobachtet das Brett sehr scharf und ausdauernd. Endlich sagt er: „Da könnt ihr jetzt tauchen. Da liegt der Kleine.“
Eine Stelle, an der ihn niemand gesucht, niemand vermutet hätte. Denn wie kann er, der über den Rand der Brücke gestolpert ist, unter der Brücke liegen?
Perez ist schon im Wasser, und sofort folgen ihm zwei andere Männer. Perez ist der erste an der Stelle. Er schiebt das Licht beiseite und taucht unter.
Nach wenigen Sekunden kommt er wieder hoch und ruft: „Der Junge ist da. Ich habe ihn gefühlt.“
Die Leute auf der Brücke sind alle aufgestanden und sehen auf Perez, der von dem flackernden Licht trübe beleuchtet, ein unheimlich entsetztes Gesicht zeigt.
Die Garza hat den Mund weit aufgerissen, kann aber nicht schreien. Sie ballt eine Faust und steckt sie in den Mund. In ihren Augen jagen Grauen, Angst vor der letzten brutalen Wahrheit und ein schwacher Glimmer von Zweifel und Hoffnung. Nicht wissend, wohin ihren Blick zu lenken, starrt sie mit einem Ruck nach der Richtung auf den Weg nach Magiscatzin, wo der letzte Funke der Hoffnung ruhen bleibt.
Kein Wort fällt, man hört nur das leichte Scharren von Füßen auf der Brücke.
Perez ist wieder getaucht und mit ihm einer der Männer.
Sie kommen hoch mit den Händen voll faulen Ästen und Gestrüpp.
Dann tauchen sie aufs neue. Es blubbert, abgerissene Pflanzen und kleines Gesträuch quirlen hoch. Triefend taucht einer der Männer auf, und drei oder vier Sekunden später erscheint auf der Wasserfläche etwas Schwarzes, das langsam hochkommt, bis man erkennt, es ist der dichte Haarschopf des Perez. Sein Kopf ist nun ganz über Wasser. Er schüttelt sich, prustet, atmet und schluckt und kommt nun weiter nach oben. In seinen Armen hat er den kleinen Carlos, dessen Beinchen, mit den neuen Stiefelchen an den Füßen, in einen unnatürlich spitzen Winkel eingekrümmt sind.
„Chiquito mio!“ schreit die Garza und rennt zum Ufer, wo sie Perez erwartet.
Perez kommt herangewatet und steigt die niedrige Uferböschung empor. Nun steht er vor der jungen Mutter, die in ihrem grünen flimsigen Tanzkleide und mit den glutroten Blumen im Haar ihn mit weit ausgestreckten Armen empfängt. Mit unsagbar trauriger Geste, wie sie nur Tiere und Menschen des Urwaldes und Dschungels ausdrücken können, legt er den kleinen Leichnam in die ausgestreckten Arme der Mutter. Er tut es mit solcher Zartheit, als wäre der Körper hauchdünnes Glas.
In diesem Augenblick schreien die Pumpmeisterin und eine Anzahl anderer Frauen schrill auf, und der Schrei geht in das klagende Trauerschreien über, das eine Weile andauert und dann abebbt.
Die Garza hat den Kleinen gegen ihre Brust gepreßt. Mit der einen freien Hand quetscht sie seine feuchten und geschrumpelten Händchen.
Perez schleicht sich scheu hinweg, als habe er das ganze Herzeleid verursacht.
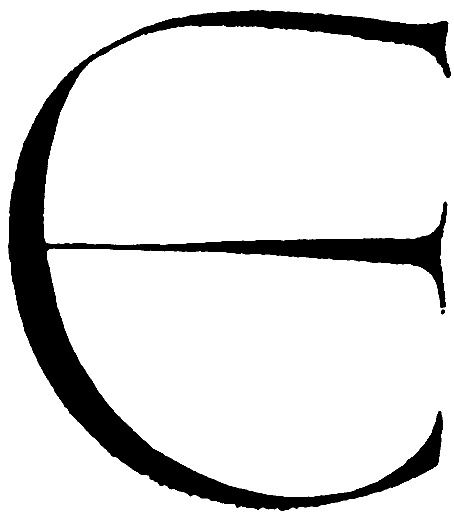 Ein älterer Indianer kommt herbei, redet auf
die Mutter ein und nimmt ihr das Kind ab.
Er hält den kleinen Körper an den Füßen
hoch, und aus dem Munde fließt nichts als
Blut und nur ganz wenig Wasser. An der
Stirn wird jetzt eine dicke Beule sichtbar.
Nase und Mund sind verquollen, und der Oberkiefer ist
aufgeschlagen. Ich taste den nach unten hängenden Schädel
ab und fühle ein kleines Loch. Eine Laterne ist jetzt zur
Hand, und ich sehe, daß dieses Loch offenbar von einem
Nagel herrührt.
Ein älterer Indianer kommt herbei, redet auf
die Mutter ein und nimmt ihr das Kind ab.
Er hält den kleinen Körper an den Füßen
hoch, und aus dem Munde fließt nichts als
Blut und nur ganz wenig Wasser. An der
Stirn wird jetzt eine dicke Beule sichtbar.
Nase und Mund sind verquollen, und der Oberkiefer ist
aufgeschlagen. Ich taste den nach unten hängenden Schädel
ab und fühle ein kleines Loch. Eine Laterne ist jetzt zur
Hand, und ich sehe, daß dieses Loch offenbar von einem
Nagel herrührt.
Ein anderer Mann preßt nun den Leib des Knaben, aber auch jetzt fließt nur wenig Wasser aus dem Munde, während immer noch Blut sickert.
Der Garza laufen die Tränen dick aus den Augen, und sie schnüfft ruckweise und schwer mit der Nase, die sie einige Male mit dem Kleide abputzt. Sie versucht, die Knie des Kleinen durchzudrücken, damit die Beinchen, die so spitzwinklig in den Kniegelenken eingekrümmt sind, daß die Hacken beinahe die Oberschenkel berühren, gerade werden mögen. Trotz ihres Schmerzes denkt sie doch schon an die „schöne Leiche“, die das Kind sein soll, das letzte, was sie für ihren Kleinen tun kann. Und mit den spitzen Beinchen dürfte die Leiche wohl nie schön aussehen. Aber die Knie sind schon ganz starr, und es gelingt ihr nicht. Endlich versucht der Mann, der bisher den Leib auspreßte, die Knie durchzubiegen, und nach langem geduldigen Kneten, Drücken und Ziehen gelingt es ihm auch. Während der Mann an den Knien massiert, streichelt die Mutter die kleinen Stiefelchen, deren fabrikneuer Lackglanz an vielen Stellen der langen Einwirkung des Wassers widerstanden hat. Sie drückt und preßt die Stiefelchen, und während sie, zweifellos, dumpf die geheimnisvollen Wege des Schicksals empfindet, daß die aus inniger Bruderliebe dargebotene Gabe gleichzeitig die mittelbare Ursache des Todes des beschenkten Kindes wurde, beginnt das hineingewürgte Weinen sie zu ersticken und nun, zum erstenmal, seit der Kleine vor ihren Augen ist, stößt sie einen markerschütternden Schrei aus, der die tiefe Nacht des Dschungels aufzureißen scheint.
Die wenigen Sekunden Schweigen, die diesem Wehschrei folgen, wirken so beklemmend, als versänke die Welt. Und abermals stößt die Garza einen Schrei aus. Diesmal ist er aber nicht so gell, jedoch mehr gezogen und klagend.
Die Männer, die herumstehen, fühlen sich gedrückt und scheu. Sie schlagen die Augen nieder, tasten an ihrem Gesicht oder an ihren Kleidern verlegen hin und her. Angesichts des Schmerzes der Garza schrumpfen sie in sich zusammen und werden ganz klein und ärmlich. Sie ahnen den Schmerz der Mutter, denn sie alle haben eine Mutter gehabt, eine Mutter, die, wie alle Mütter nichteuropäischer Völker, ihre Kinder mit einer, uns tierisch anmutenden, Zärtlichkeit lieben und behandeln. Sie ahnen das Weh der Mutter, aber weil sie Männer sind, können sie das Weh nicht fühlen. Und weil sie in diesem Gefühl von der Natur benachteiligt wurden, kommen sie sich jetzt allesamt so arm, so erbärmlich und so schuldbewußt vor. Keiner wagt die Mutter zu berühren oder sie zu trösten, sie stehen da wie kleine Jungen, die sich schämen.
Da kommt die Pumpmeisterin herbei, umarmt die Garza, als ob sie sie zerpressen wollte, und küßt sie wie wild auf den Mund, auf die Backen, auf die tränenden Augen. Sie hebt ihr feines Kleid auf und trocknet der Garza die Tränen und die Nase und küßt sie wieder und wieder. Dann haben sie beide ihren Kopf auf die Schulter der anderen gelegt, halten sich fest umarmt und schreien und schreien.
Wer hätte geglaubt, daß die feine Pumpmeisterin sich je so gehen lassen würde. Die Mütter. Die Mütter. Und die Männer werden noch kleiner, noch beschämter, noch ärmer und haben nur einen Wunsch: Auch weinen zu können. Sie verzerren die Gesichter und möchten am liebsten zehn Meilen weit entfernt sein.
Die Männer beneiden die beiden, die den kleinen Leichnam hochhalten und sich damit beschäftigen können. Nur etwas zu tun haben. Und die Männer fangen an, sich zu drehen und auf den Beinen hin und her zu treten, sie sehen sich um, ob nicht irgendwo eine Arbeit für sie wartet. Sie klauben Holz auf und werfen es wieder fort, weil es ja nun nicht mehr nötig ist, ein Feuer anzuzünden.
Sleigh kommt heran, steht eine Weile unschlüssig da und sagt dann zu mir: „Ich werde Kaffee kochen gehen, damit die Garza was Warmes kriegt.“
Die Pumpmeisterin löst sich nun aus den Armen der Garza und betrachtet den Kleinen, der immer noch mit den Füßen hochgehalten wird, weil man nicht weiß, was man Besseres tun soll. Sie hebt den Kopf an, streicht das Haar zurück und streichelt das Gesicht. Über ihre Hände läuft das wässerige Blut, und mit ihrem Kleide wischt sie dem Kleinen den blutenden Mund und die blutbeschmierte Nase ab. Das Blut läuft aber gleich wieder nach.
Der Kleine hat die Stiefelchen an und kurze neue Strümpfchen. Das kurze Höschen ist alt, geflickt und hat eine Menge Löcher, wie die Hose eines jeden kleinen Jungen, der nur die eine Hose hat für den allgemeinen Gebrauch. Hosenträger hat er nicht. An deren Stelle ist eine Strippe, die von einem vorderen Knopf rechts nach einem hinteren Knopf links über die Schulter geht. Dann hat er noch ein weißes zerrissenes Hemdchen an.
Während er jetzt so hoch hängt, rutscht aus einer der Hosentaschen ein kleines Holzpfeifchen hervor. Als es herunterfallen will, fängt es die Garza auf, und als sie es betrachtet, fängt sie an zu weinen, diesmal in einem stillen wehmütigen Zuge, der sie durch und durch schüttelt. Sie schiebt das Pfeifchen oben in ihre offene Brust.
„Hat er keinen Hut gehabt?“ fragt einer der Männer.
Erregt und als ob sie von einem Zauberbann erlöst wären, drängen die Männer, die diese Frage gehört haben, heran. Es gibt Arbeit. Sie dürfen ins Wasser springen, um den Hut zu suchen und herauszufischen.
Aber die Hoffnung auf Tätigkeit war verfrüht, denn die Mutter sagt, daß der Hut im Hause sei. Das sei mit einer der Gründe gewesen, warum sie nicht geglaubt habe, daß er fortgeritten sei. Die Hälfte von dem, was sie sagt, muß man sich freilich selbst zusammenreimen.
Wir stehen noch am Ufer, dicht neben dem Anfang der Brücke. Durch die Laterne, die hier einer hochhält, wird ein Teil der Brücke beleuchtet. Ich sehe auf, weil ich an Sleigh denke, der, wie mir erscheint, vor einer Woche zu mir gesagt hat, daß er Kaffee kochen gehen wolle.
Da kommt einer von der anderen Seite des Flusses über die Brücke. Er geht schwer und schleppend wie ein sehr alter Mann. Wenn er den Fuß hebt, so ist es, als klebe der Fuß fest und als müsse er ihn erst jedesmal losreißen. Den Kopf hält er ganz tief gebeugt. Ehe ich sehe, wer es ist, kenne ich ihn an seinem städtischen Texashute. Manuel.
Jetzt hat er den Anfang der Brücke hier erreicht. Eine Weile steht er still, dann kommt er langsam heran, ohne aufzusehen. Er ist bleich, soweit es die Farbe seiner Haut nur zuläßt. Sein Gesicht ist ganz schmal geworden. Seine Augen sind matt und müde.
Die Garza sieht auf zu dem großen Jungen. Ihre Augen stehen dick mit Wasser. Sie öffnet den Mund und will etwas sagen. Aber dann läßt sie den Mund zuklappen wie ein Automat.
Manuel steht nun ganz dicht vor den beiden Männern, die den Jungen halten. Den Kopf ganz tief auf die Brust gesenkt, hebt er langsam die Arme und streckt sie weit vor sich hin mit den offenen Handflächen nach oben.
Der Indianer, der den Jungen hochhält, sieht Manuel an wie einen Geist, der plötzlich erschienen ist. Dann stützt er den Kopf des kleinen Leichnams mit der einen Hand, hält den Körper wagerecht und legt ihn schweigend in die hingestreckten Arme des großen Bruders.
Niemand sagt ein Wort. Aber alle Männer und Burschen, die inzwischen ihre Hüte wieder aufgesetzt hatten, nehmen jetzt die Hüte ab, auch die beiden Männer, die sich bis zu diesem Augenblicke mit dem Kleinen beschäftigt hatten.
Eine Weile steht Manuel jetzt so da, den Kopf immer noch tief auf die Brust gesenkt und den Kleinen in den vorgestreckten Armen haltend wie ein Opfer, das dargebracht werden soll. Er ist jetzt der einzige, der den Hut auf hat. Und dieser hellgraue, breitrandige, hohe Hut über dem tiefbraunen Gesicht, das man kaum als Gesicht erkennen kann, läßt den Vorgang unwahrscheinlicher erscheinen als einen fremdartigen Traum.
Mir wird das Bild so unerträglich, daß ich dasselbe Angstgefühl bekomme, das ich für einige Sekunden empfand, während das Brett auf dem Wasser schwamm. Um dieses Gefühl zu zerstreuen, entschließe ich mich, zu handeln, irgend etwas zu tun. Ich gehe rasch auf Manuel zu, berühre seinen Arm und sage: „Bitte!“
Ob Manuel es gehört hat oder nicht, weiß ich nicht. Er verrät durch keine Miene, daß er verstanden hat, was ich sagte. Ich aber lege meine Hand auf die Brust des Kleinen, schiebe das Hemdchen zurück und lege mein Ohr auf die Stelle, wo sein Herz ist. Ich weiß, daß der Junge so gut wie tot war, ehe er das Wasser berührt hatte, und daß er bestimmt tot war, fünf Minuten nachdem ich den Platsch – nein, nachdem ich den Fisch im Wasser hatte hochspringen hören. Denn es war ein Fisch. Zweifellos. Ich möchte nicht, daß dieser Platsch mir mein ganzes Leben hindurch im Ohr klinge, wenn ich für eine Sekunde meine Gedanken ruhen lasse.
Der kleine Körper ist eiskalt, und auch nicht das leiseste Klopfen seines so fröhlichen Herzens ist zu vernehmen. Es hat auch niemand hier gehofft. Aber sie lassen mich handeln. Ich hebe den Kopf hoch, man sieht mich fragend an, und als ob ich nicht ganz sicher gewesen sei, lege ich mein Ohr ein zweites Mal auf die kleine Brust. Diesmal länger, und ich fühle die Kälte des Todes noch stärker als zuvor. Als ich nun wieder den Kopf hebe, wende ich mich ab, ohne jemand anzublicken, obgleich ich weiß, daß alle Augen auf mich gerichtet sind, als ob ich etwas Unerwartetes zu erzählen hätte. Aber man begreift durch mein Abwenden, daß Unerwartetes nun nicht mehr eintreten kann.
Mein Angstgefühl ist verflogen. Durch diese Handlung bin ich in die Trauergemeinde aufgenommen worden, sie zählen mich zu den ihrigen, weil ich an ihrem Schmerze Anteil nehme.
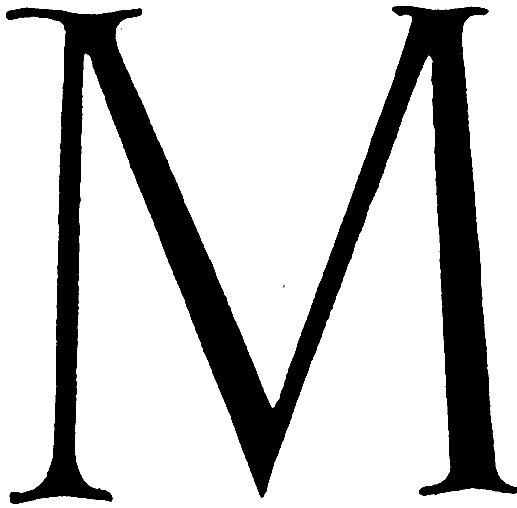 Manuel schreitet langsam über die Brücke,
mit dem Kleinen vor der Brust. Neben
ihm geht die Garza, von einer Frau
begleitet, die ihren Arm um die Schulter
der trauernden Mutter geschlungen hat.
Hinterher folgen alle Männer und
Burschen, den Hut in der Hand. Als Manuel an der Stelle
der Brücke angekommen ist, unter der Carlos gefunden
wurde, bleibt er einen kurzen Moment stehen. Die Garza
stößt einen klagenden Schrei aus, und die Frau schlingt sie
fester in ihre Arme, um sie zu trösten. Einer der Männer tritt
zur Seite, ergreift sein Machete und haut an dieser Stelle des
Seitenbalkens eine tiefe Kerbe in das Holz als ein Denkmal.
Der Zug geht weiter, erreicht das andere Ufer und kommt
über die Dschungellichtung zu dem gekehrten Platze der
Hütte, wo am Abend der Garza fiedelte und Carlos dem
großen Bruder das Haar zerzauste.
Manuel schreitet langsam über die Brücke,
mit dem Kleinen vor der Brust. Neben
ihm geht die Garza, von einer Frau
begleitet, die ihren Arm um die Schulter
der trauernden Mutter geschlungen hat.
Hinterher folgen alle Männer und
Burschen, den Hut in der Hand. Als Manuel an der Stelle
der Brücke angekommen ist, unter der Carlos gefunden
wurde, bleibt er einen kurzen Moment stehen. Die Garza
stößt einen klagenden Schrei aus, und die Frau schlingt sie
fester in ihre Arme, um sie zu trösten. Einer der Männer tritt
zur Seite, ergreift sein Machete und haut an dieser Stelle des
Seitenbalkens eine tiefe Kerbe in das Holz als ein Denkmal.
Der Zug geht weiter, erreicht das andere Ufer und kommt
über die Dschungellichtung zu dem gekehrten Platze der
Hütte, wo am Abend der Garza fiedelte und Carlos dem
großen Bruder das Haar zerzauste.
Wir kommen in die Hütte. In ihrem Innern ist sie eine der ärmlichsten Indianerhütten, die ich je gesehen habe. Weder Tisch noch Stühle noch Bank. Nicht einmal das einfache, zusammenklappbare Holzgestell mit einem darüber gespannten Segeltuch, das hier der Mehrzahl der Bevölkerung als Bett zu dienen hat, ist vorhanden. Ein Gerüst aus dünnen rohen Baumstämmchen, mit Bast und Bindfaden zusammengehalten, wird von dem Ehepaar als Bett benutzt. Eine alte Decke, als Kissen ein Bündel Gras. Der Schlafplatz der Jungen ist oben auf dem Grasdach der Hütte, mit dem Himmel als Decke und Moskitonetz.
In der Hütte sind vorausgeeilte Frauen schon tätig gewesen. Sie haben Kerzen herbeigeschafft, sie in leere Flaschen gesteckt und auf Kisten aufgestellt. Die Hütte bekommt dadurch ein feierliches Aussehen, das die Garza, als sie beim Eintreten die Lichter erblickt, zu einem erneuten Ausbruch des Schmerzes hinreißt. Aber sie schüttelt den Schmerz diesmal rasch ab und fängt an, sehr geschäftig zu werden. Zuerst weiß sie nicht recht, wo beginnen. Sie rennt in diese Ecke, dann in jene, ergreift diesen Gegenstand, dann wieder einen andern und legt ihn wieder aus den Händen. Dann endlich geht sie zu einer Kiste, die auf dem Erdboden steht und die der Kleiderschrank der Familie ist, und nimmt einen völlig zerknitterten und verkrumpelten Ballen Stoff heraus. Sie hält ihn eine Weile in der Hand und dreht sich suchend um.
Da sitzt Manuel hockend auf einem Sack, der zu einem Drittel mit Maiskolben gefüllt ist. Er sitzt da wie eine Bronzestatue, den Kopf noch immer gesenkt und auf den Armen den kleinen Bruder vor sich.
Sleigh erscheint im Eingang des Jacalito. Auf dem Kopfe trägt er seinen Tisch, den einzigen, den er hat. Er läßt ihn jetzt herunter und bringt ihn in die Hütte, wo er ihn in der Mitte, dem Eingang gegenüber aufstellt. Gleich darauf kommt die Pumpmeisterin mit zwei weißen Bettüchern, die sie auf dem Tisch ausbreitet.
Manuel steht auf und legt den Kleinen auf den Tisch. Er sieht auf ihn nieder, dann dreht er sich um und geht hinaus in die Nacht.
Die Garza umklammert die kleinen Händchen, die zerweicht und alt aussehen, und preßt sie so hart, als wollte sie ihnen damit wieder Wärme einflößen. Nun sieht sie, daß der Kopf flach liegt und daß wieder Blut aus Mund und Nase sickert. Sie geht zu ihrer Bettstatt und kommt mit einer Handvoll Gras zurück, das sie ihm als Kissen unterlegen will. Auf halbem Wege bleibt sie stehen, sieht auf ihr Kind und läßt das Gras fallen. Eine Frau läuft fort und kommt im Augenblick zurück mit einem kleinen schmutzigen Kinderkopfkissen. Die Pumpmeisterin kramt in den Lumpen herum, sucht sich etwas zusammen, und sie näht mit flinken Fingern ein zweites Kissen.
Die Kissen und die weißen Tücher bekommen große nasse blaßrote Flecken, die sich immer weiter ausdehnen.
Die Garza zieht dem Kleinen nun die Stiefelchen aus, die Strümpfe, die zerflickte und zerlöcherte Hose und das zerrissene Hemdchen.
Die Pumpmeisterin findet einen Kamm und kämmt dem Kleinen das Haar. Erst macht sie einen Scheitel links, dann gefällt er ihr nicht, und sie macht ihn rechts.
Die Hähne krähen zum zweitenmal in der Nacht. Es ist ein Uhr.
Die Garza hebt jetzt den zerknüllten Ballen Stoff von der Erde auf und verwandelt ihn zu einem ganz billigen blauen Matrosenanzug, den Sonntagsanzug des Kleinen und sein größter Stolz. Sie zieht ihm das Höschen und das Jäckchen an. Der große Matrosenkragen hat drei schmale weiße Kanten. In seinem geflickten Höschen, der quer über die Schulter gezogenen Strippe und dem zerrissenen Hemd sah der Junge schön aus, ein echtes Kind des Dschungels. Nun aber sieht er aus, als sei er in einer Fabrik in Manchester, Chemnitz oder New Jersey per Gros als Nr. 3½ angefertigt worden. Immerhin, sein braunes, wenn auch verquollenes Gesichtchen, die strengen Züge seines reinen unvermischten Indianerblutes triumphieren über die blaßhäutigen Krämer, die eine Welt zu vergiften suchen. Über seinem Gesicht vergißt man die Peitschmeister und Schwitzhöhlen New Yorks, wo die weißen Sklaven sich die Schwindsucht anarbeiten, damit der Sohn des Dschungels in einem billigen Matrosenanzug, dessen Sinn hier niemand versteht, begraben werden kann. Denn zu seinen Lebzeiten hat der Junge den Anzug nur ein einziges Mal getragen, und das war, als er ein Jahr jünger war.
Weder die Hosen noch die Jacke lassen sich zuknöpfen, weil der Anzug lange nicht mehr paßt, und weil der Körper nun auch noch aufgeschwollen ist. Die Garza versucht es immer wieder, und immer wieder ist es vergebens. Endlich preßt sie den Körper so fest zusammen, daß sie zuknöpfen kann, und nun sitzt der Anzug so prall, daß man meint, er müsse gleich platzen. Sie wringt die Strümpfe aus und hält sie gegen das kleine Feuer, das auf dem Erdboden in der Hütte brennt, und wo ein irdener Topf mit Wasser aufgestellt ist für Kaffee. Dann zieht sie dem Kleinen die Strümpfe an und endlich auch die neuen Stiefelchen.
Während der ganzen Zeit schnaubt sie mit der Nase, ohne ein Taschentuch zu gebrauchen, das sie ja auch gar nicht besitzt. Wenn es ihr ein wenig zu viel wird, hebt sie ihr Kleid an und gebraucht es für diesen Zweck, oder sie nimmt einen Lumpen auf, der mit aus der Kiste gerissen wurde.
An der einen Seite der Wand ist ein Brett befestigt dadurch, daß zwei Bindfaden nach je einer Ecke des Brettes gehen, während die Hinterkante des Brettes auf zwei kurzen Pflöcken aufliegt. Auf diesem Brett steht, gegen die Staketenwand gelehnt, ein Muttergottesbild ohne Rahmen. Daneben einige kleine Bildchen mit Heiligen und mit einem Spruch oder Gebet auf der Rückseite. Vor dem Muttergottesbilde steht ein Glas mit einem Lichtchen, das nie ausgehen darf. Aber wenn man kein Öl kaufen kann und auf Dinge zu achten hat, die wichtiger für das Leben sind, so geht das Lichtchen eben doch aus, wie es mit allen Sachen geht, die ewig sind. Aber die Pumpmeisterin hat auch dieses Lichtchen in Ordnung gebracht, und es glimmt wieder. Auf dem Brettchen stehen noch verwelkte Blumen in mehreren zerbrochenen Scherben. Außerdem lag das Nähzeug darauf, das die Pumpmeisterin für das Kissen gebrauchte, der Kamm, Haarnadeln, Streichhölzer und noch so allerlei andere Kleinigkeiten, darunter das Spielzeug des Kleinen: ein kleines, verbogenes und verschrammtes Blechauto, ein Angelhaken, eine Schleuder aus einem alten Autoreifen gefertigt, eine bunte Glaskugel, zwei Messingknöpfe, ein abgebrochener Flaschenkork, einige Zigarettenbildchen und die kleine Gitarre, die Manuel mitgebracht hat. An der Seite des Brettes, über die Ecke gehängt, ist ein ganz billiger Rosenkranz.
Durch Aufstellen von dünnen Stämmchen, die mit Bast verbunden und oben am Dache befestigt sind, ist auf dreiviertel Breite der Hütte eine Wand geschaffen worden, die einen schmalen Raum der Hütte abtrennt, in dem alte Säcke liegen, Sattel- und Zaumzeug, ein alter Korb, in dem die Hühner die Eier hineinlegen und ausbrüten. Außerdem hängt hier das Wochentagskleid der Garza. Die paar Lebensmittel, die im Hause sind, etwas Kaffee, brauner Rohzucker, Reis, Fett und Bohnen sind in einem zerrissenen Schilfkorbe, der an einem Drahte in der Hütte hängt, damit die Ratten und Mäuse nicht heran können. Dieser Korb baumelt so im Wege, daß er immerfort in Bewegung ist, weil immerwährend von jemand, der größer ist als die Garza, mit dem Kopfe daran gestoßen wird. Aber niemand denkt daran, den Korb für diese Zeit anderswo hinzuhängen. Gegenüber dem Feuer auf der Erde, an der Wand, steht das Blech zum Backen der Tortillas, drei braune Tontöpfe, von denen einer halb zerbrochen ist, eine eiserne alte Pfanne und der große Stein, auf dem mit einem knüppelartigen kleineren Stein der Mais zermahlen wird.
Es sind inzwischen noch mehr Kerzen gebracht worden, vier brennen neben dem Leichnam und zwei sind vor das Muttergottesbild gestellt worden. Durch diese brennenden Kerzen, durch die vielen Leute, die in der Hütte sind, aus- und eingehen und durch die Frauen, die alle ihre Sonntagskleider anhaben des Tanzes wegen, sieht der Jacalito, die Hütte, gar nicht mehr so arm aus. Er sieht wahrhaft festlich aus und reich, und man vergißt zuweilen ganz, weshalb diese festliche Stimmung hier in der Hütte lagert.
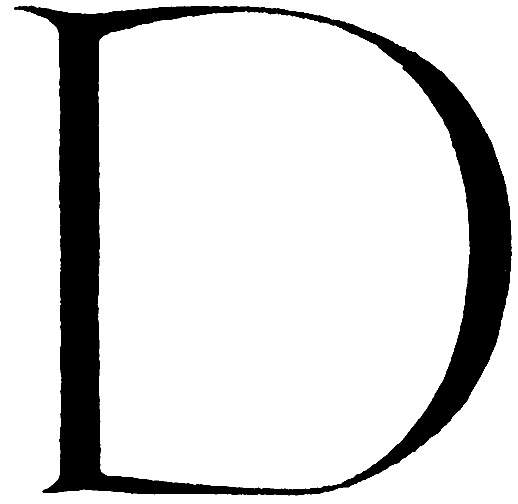 Die Mehrzahl der Leute ist vor der Hütte
geblieben, wo sie auf dem Erdboden
hocken, rauchen und schwätzen. Ab und
zu kommen einige hinein, während
andere wieder hinausgehen.
Die Mehrzahl der Leute ist vor der Hütte
geblieben, wo sie auf dem Erdboden
hocken, rauchen und schwätzen. Ab und
zu kommen einige hinein, während
andere wieder hinausgehen.
Der mittlere Junge, der halbverrückte, hockt gleich rechts beim Eingang der Hütte auf dem Boden und heult still vor sich hin. Niemand achtet auf ihn, und er selbst macht sich nicht bemerkbar, faßt nirgends zu und kümmert sich um gar nichts. Ob er um den kleinen Stiefbruder weint, oder darum, weil er die Frauen weinen sieht, oder weil er nichts Besseres zu tun weiß, oder weil er glaubt, es sei seine Pflicht zu weinen, genau so gut wie es sonst seine Pflicht ist, zu essen, wenn er gerufen wird, das weiß niemand zu sagen. Aber niemand interessiert sich auch für ihn. Er ist der Fremde hier, der einzige Fremde seit dem Augenblicke, wo ich zur Trauergemeinde zähle.
Manuel kommt jetzt still hereingeschlichen. Er sieht auf den Kleinen, geht dann zu dem Altarbrett, nimmt den halbabgebrochenen Blechkamm herunter und kämmt dem Kleinen den Scheitel wieder auf die andere Seite. Er gebraucht dazu eine unglaublich lange Zeit. Die Pumpmeisterin steht dicht daneben, zwischen dem Leichnam und dem Altarbrett, und näht aus Pappstreifen und aus goldenem, silbernem, rotem und blauem Papier, das sie sich zu verschaffen gewußt hat, eine Krone zusammen mit einem Kreuz darauf. Das Kreuz hat einer der Männer mit seinem Messer aus einer Konservenbüchse geschnitten und mit Hilfe tropfenden Stearins mit Goldpapier beklebt. Die Pumpmeisterin nimmt unzählige Male Maß rund um das Köpfchen herum, damit das Krönchen auch passen möge. Die Tränen kollern ihr immer über das bunte Papier, das sie verarbeitet; aber immer, wenn sie das Krönchen aufpaßt und es bei jedem Aufsetzen schöner aussieht, lächelt sie. Und jedesmal, wenn sie es zurückgenommen hat von dem Kopfe des Kleinen, kommt ihr eine neue Idee, um wieviel schöner und lieblicher noch sie das Krönchen gestalten könne. Zwei Männer sind damit beschäftigt, dem Kleinen die Knie, die noch immer zu spitz nach oben stehen und verkrampft aussehen, durchzubiegen. Nach einer Weile glückt es auch, und man legt ein Brettchen, das mit einem Steine belastet ist, über die Knie, um sie eine Zeit so zu halten, damit sie nicht wieder zurückknicken.
Ich sehe, daß der Mund weit offen hängt. Es stört mich durchaus nicht, und ich finde, daß diese Geste für einen kleinen Jungen, der so plötzlich in eine neue Welt sieht, ganz natürlich ist und er gut seine Reise so antreten kann, ohne daß es ihm jemand übelnehmen wird. Aber die Mutter denkt anders darüber, und sie stellt sich eine schöne Leiche feierlicher vor. Sie versucht, den Mund zu schließen. Aber der Mund will nicht halten. Ich lasse mir einen Streifen von einem alten Hemd geben und binde ihn dem Kinde über den Unterkiefer und den Scheitel.
Wenn irgendein Indianer sich an dem Jungen betätigt, so wird kaum darauf geachtet, und man sieht sehr gleichgültig zu. Sobald ich aber herankomme und das Kind auch nur berühre, drängen sie alle um mich herum, und was nur in der Hütte Platz findet, strömt von draußen herein. Es macht auf mich ganz den Eindruck, als ob sie alle von mir erwarten, daß ich ein großes Wunder verrichten, den Kleinen gar wieder ins Leben zurückrufen würde. Denn der Gedanke, daß ich dem Jungen etwa gar nachträglich noch etwas Böses durch den Blick meiner Augen oder durch die Berührung meiner Hände antun könnte oder möchte, ist lange verschwunden. Ich kenne die Leute hier nur seit drei Tagen, aber sie kennen mich alle. Mein Ruf ist bis hierher gedrungen, lange, ehe ich kam. Und dieser Ruf wurzelt in einer Geschichte, die sich in einem fern von hier liegenden Indianerdorfe, das aber zu demselben Flußgebiete gehört, vor längerer Zeit zugetragen hat. Im Mittelpunkt jener Geschichte war auch ein toter Indianer, den ich, nachdem er schon acht Stunden tot war, wieder zum Leben, oder richtiger, zum Atmen brachte, und den ich auch, das ist unerschütterlicher Glaube der Leute jenes Dorfes, ins Leben zurückgerufen haben würde, wenn sich nicht ein Teufel von einem nichtswürdigen Spanier hineingemischt hätte, der eine gegenteilige Behandlungsweise anordnete, der man folgte, und die den Indianer innerhalb von zwanzig Minuten, was alle Anwesenden mit eigenen Augen sahen, tötete. Daß jene Geschichte bis in dieses ferne Dschungeldorf schon gedrungen war, erfuhr ich erst einige Tage später.
Jedenfalls wird dieses Hochbinden des Unterkiefers anerkennend beurteilt, und ich rutsche dadurch in den engeren Kreis der Trauergemeinde.
Die Pumpmeisterin, mit Hilfe eines Mannes, biegt nun die Ärmchen über die Brust und bringt die kleinen Hände zum Falten. Weder die Arme, noch die Hände wollen halten. Deshalb werden sie nun mit einem Bindfaden, der in das Fleisch einschneidet, zusammengebunden.
Dem Kleinen ist das Krönchen aufgesetzt worden. Verwunderlich, mit wie geringen Mitteln die Frau ein solches kleines Kunstwerk zuwege gebracht hat. Wenn man nicht ganz dicht dabeisteht, kommt man nicht auf die Idee, daß die Krone aus Papier ist. Würde der Kleine nicht diesen entsetzlichen Matrosenanzug aus New Jersey oder Crimmitschau anhaben, der einen mehr zum Weinen als zum Lachen bringen kann, würde das Kind aussehen wie der in einer armen Hütte aufgewachsene Sohn eines entthronten texkukischen Königs, der im Tode seine Würde zurückerhalten hat.
Die Pumpmeisterin betrachtet den Knaben eine Weile lächelnd, und es kommt ihr ein neuer Gedanke. Der Kleine ist noch nicht schön genug. Sie geht hinaus, bricht einen dünnen Zweig von einem Strauche und beginnt nun, mit dem Papier, das sie noch zur Hand hat, jenen Zweig auszuschmücken. Und als es getan ist, da ist ein goldenes Zepter entstanden mit einem kleinen Kreuz am oberen Ende.
Sie bindet dem Kleinen die Hände los. Die Arme spreizen ein wenig auseinander, und die Händchen, die dadurch auch auseinandergehen, stehen starr über der Brust frei in der Luft. Durch das Ineinanderfalten der Hände sind die Finger gespreizt worden. Sie sind in dieser Form erstarrt und sehen aus wie Krallen, die irgend etwas über der Brust packen wollen. Die Frau legt das Zepter in die kleinen Hände, schließt sie wieder, biegt sie abermals zum Falten ineinander und bindet sie endlich zusammen.
Gerade als sie damit fertig ist, tritt Garza, der von Magiscatzin zurückgekommen ist, in den Eingang der Hütte.
Er steht ganz still im Eingang. Dann blickt er, ohne mit der leisesten Geste in seinem Gesicht zu verraten, was in ihm vorgeht, auf seinen Prinzen und sein Nesthäkchen. Nun nimmt er langsam den Hut ab und kommt ganz nahe heran. Die Garza, die Pumpmeisterin und alle übrigen, die in der Hütte sind, sehen ihn an. Sie alle wissen, wie sehr er den Kleinen, das einzige Kind, das er von seiner jungen Frau hat, liebt.
Mit leeren Augen, als ob da nichts wäre, sieht er auf den kleinen Leichnam. Er versteht das nicht und faßt es nicht. Es kommt ihm gar nicht zum Bewußtsein, daß der Junge tot ist, daß er ihn nie wieder herumlärmen hören wird. Nach einer Weile dreht er sich um und blickt auf den Boden, als ob er etwas suche. Als er wieder aufsieht, kollern ihm die Tränen aus den Augen wie kleine Kieselsteine. Er fragt nicht wann, er fragt nicht wo, er fragt nicht wie. Er ist ganz interesselos. Er wendet sich ab, macht eine scharrende Bewegung mit dem einen Fuß, steht dann eine Weile am Eingang, mit dem Kopf gegen den Stamm gelehnt, und geht hinaus.
Ein paar Männer, seine näheren Freunde, kommen auf ihn zu. Er aber sieht sie nicht. Er verläßt den Hof, setzt sich wieder auf sein Pferd und reitet fort.
Ich gehe nun hinüber zu Sleigh. Hier vor der Hütte liegen die Leute herum und schlafen. Andere sitzen und schwätzen. Wieder andere gehen oder kommen. Aus allen Hütten sieht man Licht schimmern. Die Esel schreien kläglich, und der Dschungel singt sein ewiges Lied, unbekümmert, was um ihn herum vor sich geht. Ihm gegenüber zählen die Menschen für nichts, er verachtet sogar ihren Dünger, den er gar nicht annimmt, sondern den Fliegen und Käfern überläßt.
Sleigh pustet am Feuer und hat nun endlich den Kaffee fertig.
„Wollen Sie eine Tasse trinken?“ fragt er mich.
„Bringen Sie den nur erst einmal da rüber zu den Frauen, damit die etwas bekommen“, sage ich.
„Gut,“ erwidert er, „ich koche gleich eine zweite Kanne, dann können Sie davon haben.“
Das Mädchen schläft auf dem Boden unter ihrem Moskitonetz ruhig weiter. Wahrscheinlich hat ihr Sleigh das von dem Jungen erzählt. Aber das läßt sie kühl.
„Wollen Sie nicht so gut sein und die Tassen bringen?“ Sleigh deutet auf das Brett, wo einige Emailletassen stehen. „Zwei lassen Sie nur hier für uns.“
Ich nehme die Tassen, und wir ziehen ab, hinüber zu den Garzas. Sleigh stellt den Kaffee und die Tassen hin und bietet der Garza zu trinken an. Sie nimmt die Tasse und trinkt mechanisch den heißen Kaffee hinunter. Auch die Pumpmeisterin und einige andere Frauen kosten von dem Kaffee. Dann dreht sich die Pumpmeisterin eine Zigarette und reicht das Tabakbeutelchen der Garza, die auch zu rauchen beginnt, aber sich nicht setzt, sondern steht oder herumhantiert. Viel kann man jetzt nicht mehr tun. Endlich setzt sie sich doch, hält es aber nicht aus. Sie springt auf und läuft hin und her, bald dies in die Hand nehmend, bald jenes wieder fallen lassend. Die Kerzen biegen sich und müssen wieder gerade gestreckt werden, damit sie nicht so schnell verbrennen. Ein paar andere Kerzen liegen in einer Schüssel mit Wasser, um sie kühl zu halten. Dann fangen die Frauen an, aus den Lumpen, aus alten Kleidern und Hemden bunte Bänder, Stickereieinsätze und Häkelkanten abzutrennen, um das für den weiteren Aufputz des kleinen Leichnams zu verwenden.
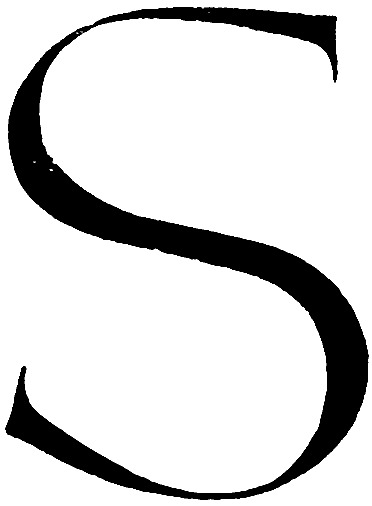 Sleigh und ich, wir gehen wieder zurück zu
seiner Hütte. Bei dem zylinderlosen rauchenden
Blechlämpchen, das kaum Licht verbreitet,
sitzen wir um den leeren Platz herum, wo sonst
der Tisch steht, der ja jetzt einem anderen
Zwecke dient. Wir blinzeln rüber in das offene
Holzfeuer, wo die Kaffeekanne mit frischem Wasser aufgestellt
ist, das Sleigh, wie ich gesehen habe, eben aus dem
Fluß geschöpft hat.
Sleigh und ich, wir gehen wieder zurück zu
seiner Hütte. Bei dem zylinderlosen rauchenden
Blechlämpchen, das kaum Licht verbreitet,
sitzen wir um den leeren Platz herum, wo sonst
der Tisch steht, der ja jetzt einem anderen
Zwecke dient. Wir blinzeln rüber in das offene
Holzfeuer, wo die Kaffeekanne mit frischem Wasser aufgestellt
ist, das Sleigh, wie ich gesehen habe, eben aus dem
Fluß geschöpft hat.
Daran denke ich jetzt gerade, und ich sage: „Hören Sie, Sleigh, wo bekommen Sie denn hier das Wasser her zum Trinken, Kochen und Waschen?“
Er sieht mich erstaunt an und erwidert: „Ich denke, das ist doch groß genug, daß man es sehen kann, wo wir das Wasser herholen.“
„Doch nicht vom Flusse?“ frage ich. Ich frage das keineswegs erschreckt, denn ich lebe zu lange in den Tropen, im Busch, im Dschungel und auf Dörfern, um zu wissen, was Wasser bedeutet.
„Meinen Sie wirklich aus dem Flusse dort?“ wiederhole ich meine Frage, weil er ein ganz dummes Gesicht macht.
„Ja denken Sie denn vielleicht, wir lassen uns das Wasser in zugekorkten Bierflaschen von Mexico City oder gar aus dem Yosemite-Tal per Post schicken? Sie sollten doch wahrhaftig nicht eine so unerlaubte Frage stellen. Haben Sie denn seinerzeit, als wir uns an dem Dreckpfuhl da oben trafen, nicht mit Wonne geschlürft, ohne zu fragen, wer eine halbe Stunde vorher reingespuckt hat?“
„Was das Spucken anbelangt, da muß ich Ihnen schon sagen, daß ich noch nicht gesehen habe, daß ein Indianer ins Wasser spuckt, das andere Leute zum Trinken gebrauchen müssen. Amerikaner habe ich aber schon oft in Zisternen und Tanks spucken sehen. Brunnen im Kriege zu vergiften, das haben auch nur die Weißen erfunden; wenn die Indianer es rechtzeitig gelernt und getan hätten, wäre Mexiko nie spanisch geworden.“
„So bös meint das einer auch nicht, wenn er schon mal ins Wasser spuckt. Er denkt sich nichts dabei. Ich freilich tu es nicht.“
„Recht haben Sie, Sleigh,“ sage ich, „er denkt sich nichts dabei. Das ist eben die Sünde. Aber nun zu dem Wasser da aus dem Flusse –“
Er sieht mich eine Weile grinsend an und antwortet: „Das Wasser, das Sie bisher getrunken haben, solange Sie hier in diesem Hause sind, war das Wasser aus dem Flusse. Sie glauben doch nicht, daß ich für Sie besonders das Wasser erst abkoche oder ehnt–ke–eime, wie Sie das nennen.“
„Sie wissen ganz gut, was ich meine,“ antworte ich, „da ist doch nun gerade der Kleine darin ertrunken, kaum fünfzig Schritt von hier.“
„Ja, das weiß ich. Na und was weiter? War der Kleine vielleicht ein Giftpilz?“
Sleigh hat recht. Und daß da hin und wieder einer im Flusse ertrinken mag, ist schließlich auch nicht schlimmer, als wenn die Kühe, Pferde und Esel in das Wasser gehen, sich halbe Stunden lang darin aufhalten, um sich abzukühlen, Männer, Frauen und Kinder darin baden und Wäsche darin gewaschen wird.
„Mich,“ sagt Sleigh nach einigen Minuten Schweigens, „mich interessiert viel mehr das mit dem Licht und dem Brett. Es ist doch eigentlich eine ganz merkwürdige Sache. Meine Frau hat mir schon davon erzählt. Die tun es daheim auch. Und das Licht findet den Ertrunkenen immer.“
„Immer?“ frage ich zweifelnd.
„Immer!“ bestätigt Sleigh. „Meine Frau hat mir erzählt, daß dieses Licht sogar in einer ganz starken Strömung stromauf geht, wenn der Ertrunkene in jener Richtung liegt.“
„Das bezweifle ich ganz entschieden, ich glaube es einfach nicht und halte das für übertrieben.“
„Meine Frau hat es selbst gesehen, und ich glaube es“, sagt Sleigh, ohne sich aufzuregen. „Diese Indianer können eben mehr als wir.“
„Auch das bezweifle ich“, antworte ich und meine es so. „Der Indianer kann nicht mehr als wir und weiß viel weniger als wir. Kein Farbiger kann mehr, auch nicht ein Chinese oder ein Inder. Das sind alles Märchen, die man sich erzählt, weil man die Sprache nicht genügend kennt, weil einem die Sitten und Gebräuche fremd sind und darum geheimnisvoll anmuten. Ich kann Sie versichern, Mann, daß ich Durst und Hitze leicht ertrug, wenn Indianer umklappten oder vom Felde mußten.“
„Das gebe ich zu,“ sagt Sleigh, „Sie und wir alle haben den Willen, das und das zu tun. Die Leute legen keinen Wert darauf, den Willen zu haben. Sie fragen sich: Wozu? Für den Weißen den Sklaven zu machen? Aber Sie wissen doch ebensogut, wie ich es weiß, daß die Indianer sich von einer Klapperschlange beißen oder einem Gift-Skorpion stechen lassen und es tut denen gar nichts, während unsereiner in ein paar Stunden alle ist auf Nimmerwiedersehen.“
„Jeder von denen ist auch nicht immun“, widerspreche ich.
„Sicher nicht, weil eben nicht jeder die Mittel kennt.“
„Und die sterben an Fieber und an anderen dummen Sachen genau so gut wie wir.“
„Natürlich, sie sind ja Menschen.“ Damit steht Sleigh auf und stirrt das Feuer, um den Kaffee zu beschleunigen.
Nachdem er sich wieder gesetzt hat, sagt er: „Wenn Sie der Meinung sind, daß hier keine geheimen Naturkräfte, die nur die Eingeborenen kennen, mitwirken, dann geben Sie mir doch eine natürliche Erklärung.“
„Das eben kann ich nicht. Die Erklärung finde ich nicht.“ Und in der Tat, ich wüßte nicht einmal, in welcher Richtung ich eine Erklärung für den merkwürdigen Vorgang suchen soll.
Mir steigt eine Erinnerung an eine andere Methode auf, die ich einmal sah, und ich sage: „Ich habe einmal etwas gesehen, das zuerst sehr geheimnisvoll erschien, mir aber später, als ich darüber nachdachte, klar wurde. Ich habe einmal gesehen, wie ein Ertrunkener gefunden wurde dadurch, daß man Pulverladungen unter Wasser explodieren ließ und der Ertrunkene zum Vorschein kam. Aber das wirkt nur, wenn der Verunglückte schon einen Tag oder gar länger im Wasser ist. Durch die Explosionen wird das Wasser aufgerührt, und der Körper, der ja jetzt schon an und für sich versucht, hochzukommen, wird an die Oberfläche getrieben.“
„Das ist natürlich“, erwidert Sleigh. „Aber so einfach liegt dieser Vorgang hier nicht. Ich lebe lange genug hier unter diesen Leuten, und ich habe so viele merkwürdige Dinge gesehen, daß ich sie Ihnen gar nicht erzählen will, weil es ja doch zwecklos wäre, denn Sie würden nichts davon glauben.“ Mit Sleigh sich in solche Gespräche einzulassen, führt zu nichts. Ich weiß es nicht seit heute nur, ich weiß es länger. Er glaubt es und sucht nicht nach irgendeiner Erklärung. Darum drehen sich Unterhaltungen dieser Art mit ihm immer im Kreise. Im Grunde genommen ist es mir auch gleichgültig. Ich habe es gesehen vom ersten Anbeginn bis zum letzten Ausgang. Die Handlungen waren durchaus klar. Unter einer Suggestion stand ich keineswegs, ich war nicht einmal schläfrig, sondern vollauf munter. Freilich, einen Zeugen, einen weißen Zeugen habe ich nicht. Sleigh ist kein Zeuge. Seine Kritik, wenn er überhaupt an irgendeinem Dinge in der Welt Kritik übt, was ihm nie einfällt, zählt nicht mit, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, deren Mittelpunkt Indianer sind. In seiner Vorstellung sind die Indianer mit allen geheimnisvollen Kräften ausgestattet, von denen man nur je geträumt hat. Er glaubt alles und schließt jedes neue Kapitel ab mit dem, was seine Augen sahen, seine Ohren hörten und seine Frau ihm erzählte.
Es macht vielleicht die Umgebung. Ich überrasche mich selbst damit, daß ich anfange, nach keiner Erklärung zu suchen, sondern es so hinzunehmen, wie ich es sah. Warum nicht? Es lebt sich hier leichter und schöner, harmonischer und beglückender, wenn man sein Hirn nicht mit Grübeleien belastet. Nimm es hin, wie es ist, freue dich darüber, liebe, tanze und sterbe. Das ist hier – vielleicht überall – der ganze Sinn des Lebens. Alles andere ist der Unsinn des Lebens, aus dem alles Unheil und Herzeleid entspringt.
Ich sehe auf und bemerke, daß Sleigh die Hütte verlassen und das Lämpchen mitgenommen hat. Und auf dem krachenden Korbstuhl vor mir, von dem man sich nicht erklären kann, wie er überhaupt noch zusammenhalten mag, sitzt Perez. Perez, der Indianer, der den Kleinen aus dem Flusse brachte.
„Hören Sie, Perez, Sie wollten mir doch zwei Gelbhauben besorgen, zwei junge?“
„Ich bin jetzt lange nicht im Busch gewesen. Ich gehe auch vorläufig nicht rauf.“ Er sitzt breitbeinig auf dem Stuhl, dessen Sitzhöhle nur noch eine Handbreit über dem Erdboden ist. Die Hände hängen zwischen den Beinen weit herunter.
„Warum gehen Sie denn nicht in den Busch? Brennen Sie keine Kohle mehr?“
„Ja, sehen Sie, Senjor, der Gringo da oben sagt, ich hätte ihm sein Maultier gestohlen, ich sei ein Bandit.“
„Das glaube ich nicht, daß Sie ein Bandit sind, ich glaube auch nicht, daß Sie die Mula gestohlen haben.“
„Bestimmt nicht, Senjor, bei der Heiligen Jungfrau und dem Kinde nicht. Ich will doch hier gleich in die Hölle versinken, wenn ich ein Bandit bin. Der Gringo ist nicht ehrlich. Er sagt, er hätte meine Fußspuren neben denen seiner Mula außerhalb des Fences gesehen und durch den Busch verfolgt. Ich gehe da nie hin, wo er die Fußspuren gesehen hat.“
„Ich habe davon gehört. Senjor Griggs sagt, die Mula sei hundertfünfzig Pesos wert gewesen.“
„Esta bien, Senjor, da können Sie gleich sehen, daß der Gringo kein ehrlicher Mann ist. Achtzehn Pesos haben mir diese vereiterten Hundesöhne in Llerra für die Mula bezahlt, und dann sagt dieser Mann hundertfünfzig Pesos. Es ist ja zum Lachen. Und nun gar noch zu sagen, ich hätte das Tier gestohlen, das ist eine so niederträchtige Lüge. Anständig ist es nicht. Ganz gewiß nicht.“ Er ist aufgestanden und zum Feuer gegangen, um sich seine Zigarette anzuzünden.
Sleigh kommt zurück mit dem Lämpchen und einem irdenen Topf voll frischgemolkener Milch.
„Die Kuh ist jetzt hereingekommen. Ich weiß nicht, wo die gesteckt hat“, sagt er, schüttet Kaffee in das kochende Wasser und bringt die Kanne her.
Er gießt mir Kaffee ein und dann sich selbst. „Sie bekommen gleich meine Tasse, Perez“, sagte er zu dem Indianer.
„Schon gut“, erwidert der.
„Lag der Kleine gleich so flach auf dem Boden?“ fragt Sleigh.
„Nein, die Füße und die Hände waren in Wasserkraut verwickelt“, sagt Perez. „Ich glaube nicht, daß er je hochgekommen wäre, wenn wir ihn nicht geholt hätten.“
„Wie wußten Sie denn, daß der Junge an dieser Stelle war?“ frage ich.
„Das Licht stand doch über ihm. Das haben Sie ja selbst mit eigenen Augen gesehen.“
„Allerdings. Aber wie kann denn das Licht wissen, wo der Junge ist, wenn es keiner von uns allen weiß?“
„Aber das ist doch sehr einfach, Senjor. Er ruft das Licht heran, und das Licht muß kommen. Da ist durchaus nichts Unheimliches dabei.“
Sleigh lacht: „Da hören Sie es. Es ist ganz einfach. Gar nichts Unheimliches dabei. Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Das ist das ganze Geheimnis. Zaubern können die so wenig wie wir. Der Junge ruft, und das Licht kommt. Alles sehr klar wie der helle Tag.“
„Also, Perez, wie ist es mit den jungen Gelbhauben?“
„Ich gehe nicht rauf in den Busch. Es hat keinen Zweck. Die haben kaum zu brüten angefangen. Warum soll ich da in dem Busch herumkriechen, wenn ich doch keine bringen kann, weil jetzt keine da sind. Zwei Monate später.“
Er hat nun seinen Kaffee in der Hand und schlürft ihn langsam hinein. Sleigh gießt mir noch eine Tasse voll und trägt den Rest der Kanne rüber zu den Garzas.
Nach einer Weile kommt er wieder. Er geht zum Feuer, um sich eine Zigarette anzuzünden. Dann hockt er sich nach Indianersitte auf den Boden, weil keine andere Sitzgelegenheit vorhanden ist. Das Mädchen unter dem Moskitonetz auf dem Boden hat vor einer Weile ihrem weinenden Kinde zu trinken gegeben und schnarcht jetzt, daß die Hütte bebt.
Perez und Sleigh werden schläfrig, lassen den Kopf sinken und blinzeln schwer mit den Augen. Als Sleigh im Schlafe fühlt, daß die Zigarette ausgegangen ist, erhebt er sich und geht zum Feuer. Nachdem die Zigarette wieder glüht, steht er eine Weile mit dem Rücken gegen einen Pfosten gelehnt und nickt abermals ein. Er schläft jedoch nur einen Wink, dann wird er wach und geht zum Eingang. Er sieht zu dem klaren Nachthimmel auf und sagt: „Es ist zwei Uhr vorbei.“
Ich ziehe meine Uhr und sage: „Zwanzig nach.“
„Dann muß ich melken gehen“, erwidert er darauf. „Perez, kommen Sie mit?“
„Freilich.“ Er schlief so fest, daß ihm die Zigarette aus der schlaffen Hand gefallen ist. Er ist aber sofort munter, sucht gleich die Zigarette, nimmt das Lämpchen, zündet die Zigarette daran an und folgt mit dem Lämpchen Sleigh, der mit einem Eimer zum Korral geht, wo die Kühe stehen.
„Sie können sich hinlegen und ein wenig schlafen“, sagt Sleigh zu mir, ehe er in der Nacht verschwindet.
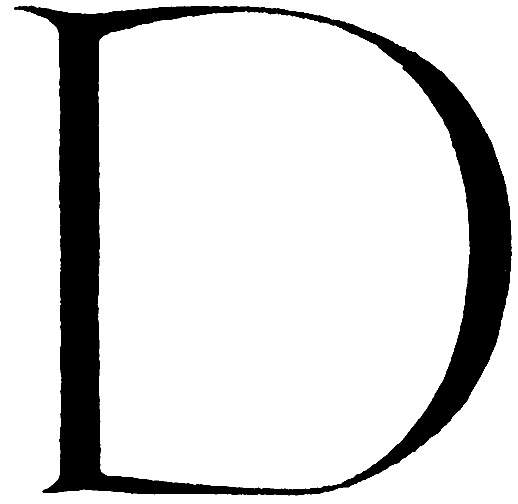 Da die Hütte nun stockfinster ist und ich
wirklich nichts Besseres zu tun weiß,
taste ich mich zu jener Ecke, wo das Bett
steht. Das Bett? Hängematte wäre richtiger.
Aber gegenüber dem Lattengestell,
das die Garzas haben und Bett nennen,
ist das hier ein Luxusbett.
Da die Hütte nun stockfinster ist und ich
wirklich nichts Besseres zu tun weiß,
taste ich mich zu jener Ecke, wo das Bett
steht. Das Bett? Hängematte wäre richtiger.
Aber gegenüber dem Lattengestell,
das die Garzas haben und Bett nennen,
ist das hier ein Luxusbett.
Stiefel aus, reinbalanciert, Moskitonetz dicht gezupft und losgeschlafen.
Alligatoren, Brücken, Eseltreiber, Pumpen, Königinnen von England, Kinderleichen, nackte Indianer, brennende Kerzen unter Wasser, Kühe mit einem Jaguar im Genick, selbstspielende Mundharmonikas, auf Maultieren reitende Banditen, ein vom Erdboden verschwundenes Kanada, unausgebrütete Gelbhauben, geigensingende Muttergottesbilder, die mit Stahlfedermatratzen tanzen wollen – nein, ich kann nicht einschlafen. Es ist alles Wirbel und Dröhnen im Kopfe, aber kein Schlafen. Dann drösele ich doch ein, und Mister Griggs liegt im Wasser. Ich kann ihn deutlich liegen sehen, weil das Wasser ganz klar ist. Ich habe den Mann nie gesehen, weiß aber, daß er Griggs heißt und Gelbhauben auf Hufspuren ausbrütet. Niemand sieht ihn im Wasser, weil ich auf Griggs zeige und sage: Da liegen zwei neue Kinderstiefel. Die Chinesen lassen Pulver unter Wasser explodieren, um die Kaffeekanne, die in einem Maissack ertrunken ist und von Alligatoren festgehalten wird, hochzutreiben. Von der Explosion wache ich auf. Und wieder höre ich die Explosion und abermals, bis ich völlig wieder wach bin und höre, daß draußen geschossen wird.
Ich stehe auf und ziehe mir wieder die Stiefel an. Schlafen kann ich ja doch nicht. Es ist noch schwarze Nacht. Ich sehe nach hinten durch das Geflecht der Hütte und bemerke das dünne Flämmchen der Blechlampe, das den melkenden Sleigh und den danebenhockenden Perez, dessen Geschwätz ich bis hier höre, ungewiß beleuchtet.
Die Stiefel an und den Hut auf, gehe ich zum Eingang der Hütte. Drüben bei den Garzas ist helloderndes Feuer. Und beim Schein dieses Feuers sehe ich zahlreiche Männer, die von ihren Pferden steigen und ihre Revolver abfeuern. Ich hin. Die Mehrzahl der Männer kenne ich, alle Indianer.
Ein hier im Lande geborener Spanier ist darunter, der in Quintero eine Tienda unterhält, einen Laden, in dem man alles bekommt. Die Kunde von dem Verschwinden des Jungen ist, schneller als die Post das könnte, auf zehn Meilen im Umkreise schon verbreitet. Trotz der Nacht. Und die Leute sind mit Pferden gekommen, um suchen zu helfen. Sie haben auch Feuerwerkskörper gleich mitgebracht für den Fall, daß der Junge nur tot gefunden wird.
Wenn unter den Indianern ein Kind stirbt, so werden zahllose sehr krachende und knallende Feuerwerkskörper abgebrannt, um dem Himmel anzuzeigen, daß ein Engel ankommt. Bei Erwachsenen Feuerwerk abzubrennen, wäre verkehrt, weil man den Teufel nicht unnützerweise darauf aufmerksam machen soll, wenn ein alter Sündenknochen zum Verhandlungstermin erscheint. Deshalb geht die Bestattung von Erwachsenen geräuschlos vor sich. An kleinen Kindern ist der Höllenonkel nicht so sehr interessiert, da ärgert er sich, wenn er das Böllern hört, weil ihm eine zukunftsreiche Seele verlorengeht, während im Himmel sich alle festlich rüsten, sobald sie das Knallen hören, um den kleinen Engel, der unterwegs ist, herzlich empfangen zu können.
Daß der Junge inzwischen gefunden ist, haben die neu angekommenen Leute schon vernommen. Die Feuerwerkskörper nimmt der fünfzehnjährige Stiefbruder, der Halbverrückte, gleich in Verwahr. Von diesem Augenblicke an hat er für nichts anderes mehr Sinn, als sich mit der Knallerei zu befassen. Einer muß es ja sowieso tun, und er ist der Nächste dazu. Zu weinen hat er längst aufgehört, und für ihn kommt nun der lustige Teil der Veranstaltung.
Die Männer nehmen alle den Hut ab und gehen nacheinander in die Hütte, um sich den Kleinen anzusehen und die Garza dadurch von ihrem Kummer abzulenken, daß jeder fragt, wie es gekommen sei.
Die Garza erzählt es wieder und immer wieder und natürlich immer mit den gleichen Worten. Durch dieses so häufige Wiederholen der traurigen Geschichte wird das Ereignis immer alltäglicher, immer nüchterner, immer sachlicher. Ihr selbst scheint es zuweilen, als sei das eine durchaus natürliche Begebenheit, an der gar nichts Außerordentliches zu sehen ist. Je häufiger die Geschichte erzählt wird, je mehr wird sie der Tragik entkleidet, je mehr wird sie zu einem bloßen Wortgeläute, zu einem Bericht, zu einem Ereignis, das irgendeiner anderen fremden Person geschehen ist. Die Begebenheit wird unpersönlich, sie wird geschichtlich, sie verläßt Herz, Seele und Geist und wird klingendes lautes Wort. Zu ihrem Erstaunen fühlt die Frau, daß sie jetzt schon manchmal auf den kleinen Leichnam blicken kann mit dem abrückenden Gedanken, daß er ihr Kind gar nicht sei. Ihr Kind war ein lustiger, munterer, immer geschwätziger Bub und nicht so ein kalter stumpfer Klumpen, wie er daliegt. Durch den Anzug und durch die Krone und das Zepter ist er überhaupt noch weiter von ihr abgerückt und ihr sehr fremd geworden. Und wenn sie wieder weint, so ist es eigentlich schon gar nicht mehr so oft des Jungen wegen. Sie weint ihretwegen, sie kommt sich so bemitleidenswert vor, daß sie nun kein Kind mehr hat, dem sie leibliche Mutter ist. Auf diesem Gefühlswege und wenn sie einige andere Frauen bemerkt, die herum sind, kommt es ihr zum Bewußtsein, daß sie nicht einmal eine Ausnahme ist, für die sie sich den ganzen Abend hielt. Sie ist nur die übliche Mutter. Was sie zu leiden hat, ist das Los einer jeden Mutter auf Erden. Aber es ist gewiß die Müdigkeit und die ungeheure Abspannung nach diesen entsetzlichen Stunden, daß sie jetzt gefaßter ist.
Die Männer kommen wieder heraus und sitzen nun vor der Hütte herum, wo sich ein Heerlager aufgetan hat. Männer, Burschen, Frauen und Mädchen liegen herum und schlafen oder dröseln vor sich hin. Mehrere Burschen helfen dem Morano beim Knallen. Sie dürfen aber nur das Feuer schüren, an dem Morano die Körper entzündet, oder sie dürfen diejenigen Kracker in die Hand nehmen und noch mal versuchen, die nicht gezündet haben und die Morano fortgeworfen hat.
Die Männer haben auch Tequila mitgebracht, und die Flasche geht rund. Auch der Garza wird die Flasche hineingebracht, und sie tut einen gesunden Zug von diesem feuerscharfen Schnaps, der normale Menschen mit einem Ruck auf die hinteren Kanten wirft. Aber diese mit Chile ausgeschwefelten Kehlen und Mäuler können noch ganz andere Dinge, unheimliche Dinge schlucken, ohne eine Muskel des Gesichts zu verziehen.
Einer jener Männer, die jetzt gekommen sind, ein ganz armer Indianer, nimmt nun ein Buch aus der Hosentasche und blättert darin eine Weile herum. Und dann fängt er an zu singen. Lesen kann er nicht. Aber die gedruckten Worte geben ihm doch ein Bild, durch das er sich auf die Versanfänge leichter besinnen kann. Manche Strophe singt er dreimal oder noch öfter. Sobald er begonnen hat, fallen einige andere Männer in den Gesang mit ein.
Nun beginnt er die zweite Strophe, und im Innern der Hütte fallen auch die dort herumsitzenden Frauen, darunter die Pumpmeisterin, in den Gesang mit ein, zuerst ein wenig zurückhaltend, dann kräftiger. Manchmal singt der Indianer allein, weil sich die übrigen Zigaretten drehen oder wieder einen Schluck aus der Flasche nehmen oder des Singens müde sind.
Der Mann aber singt ununterbrochen. Er trinkt keinen Schnaps, denn er ist ein Kommunist und gehört zu den Agraristas, zu jener energischen Gruppe von indianischen Landarbeitern, die das alte indianische Gemeinde-Landrecht wieder einführen wollen, das die Spanier bei der Eroberung durch blutige Gewalttaten aufhoben und für ungültig erklärten.
Der Sänger wird von niemand bezahlt, er singt aus reiner Menschenliebe, um der Mutter über den Schmerz hinwegzuhelfen, denn das Kind wird weder von einem Geistlichen in das Grab gebetet, noch von einem Arzt angesehen. Das kostet Geld, und weil Priester und Arzt zwei Tagereisen weit entfernt wohnen, würde es noch mehr kosten. Außerdem kann das Begräbnis so lange nicht aufgeschoben werden, denn trotzdem es noch kühle Nacht ist, stinkt der Junge schon außerhalb der Hütte.
Gesungen werden Kirchenlieder. Ohne Zweifel. Denn ab und zu hört man etwas wie Heilige Jungfrau aus den Reimen heraus. Aber niemand, der Kirchenlieder kennt, würde glauben, man sänge hier jetzt solche Lieder. Denn der Gesang hat weder im Rhythmus noch in der Melodie auch nur die allerfernste Ähnlichkeit mit dem, was wir uns unter Kirchenchorälen vorstellen. Wahrscheinlich wurde so gesungen, als die ersten spanischen Mönche hier durch die Dschungel zogen. Niemand unter den lebenden Menschen weiß, wie Choräle vor vierhundert Jahren in Europa gesungen wurden, denn die geschriebenen Noten aus jener Zeit geben uns darüber nicht mehr Aufschluß als die ägyptischen Hieroglyphen uns etwas aussagen über die Aussprache und Betonung ägyptischer Worte. Ein- oder zweimal in ihrem ganzen Leben haben die Männer hier eine Kirche besucht, wo die Choräle mit der Orgel begleitet wurden. Drei- oder viermal im Jahre kommt ein Priester in eines der Dschungeldörfer, wo er die Beichte hört und Absolution erteilt. Dann wird gesungen ohne Musikbegleitung. So bleibt etwas von der wahren Melodie, wie sie die Orgel festhalten kann, im Gedächtnis der Leute haften. Das übrige verschwindet ganz aus dem Gedächtnis und wird nun mit Teilen aus anderen weltlichen Gesängen und Tänzen vermischt. Bei Totenfeiern wird dann gesungen, und jedesmal kommt eine neue Beimischung durch neue Sänger hinzu. Nun aber können die Eingeborenen überhaupt nicht so singen, wie wir meinen, daß gesungen werden muß. In ihren Gesängen klingt heute noch die schrille Note der Gesänge ihrer heidnischen Vorfahren durch, und diese Note ist so urmächtig, daß sie den ganzen Gesang allein zu tragen hat.
Dieser Totensänger ist weit bekannt und gesucht als der beste Sänger. Man folgt seinem Gesange mit Andacht und Rührung, und glänzende Augen sind bewundernd auf seinen Mund gerichtet.
Als die erste Strophe begann, fing die Garza in der Hütte an gellend zu schreien und zu jammern. Sie verfiel in eine Raserei des Schmerzes und hämmerte mit ihren beiden harten Fäusten auf ihren eigenen Schädel ein, als wollte sie ihn in Stücke zertrümmern. Sie warf sich über den Leichnam und schrie: „Mein Kleiner! Mein Kleiner! Warum? Warum?“ Und dann begann sie wahnsinnig zu fluchen in der gräßlichsten Art und Weise. Schließlich gab man ihr die Tequila-Flasche. Sie wehrte sich dagegen und versuchte, die Flasche herunterzuschlagen. Aber endlich hatte sie doch den Mund so voll mit dem Schnaps, daß sie schlucken mußte, und man hielt die Flasche an ihren Mund und goß immer noch hinterher. Das Betäubungsmittel half nicht viel. Sie wurde ein wenig müde und stumpf. Doch wenn sie des Gesanges gewahr wurde und die Frauen in der Hütte mitsangen, stieß sie aufs neue ihre erschütternden Schreie aus.
Der Junge an dem großen Feuer läßt in kurzen Zeitunterbrechungen seine Raketen und Kracker knallen. Und hat der Gesang für eine Weile ausgesetzt, so wird die Garza durch das Knallen wieder daran erinnert, daß der Kleine oben als Engel erwartet wird.
Der Gesang hat für eine Weile aufgemuntert, aber nun fallen die Leute doch wieder in ihre Müdigkeit zurück. Die meisten legen sich glatt auf die Erde, kauern sich ineinander wie Hunde und schlafen sofort. Andere halten den Tequila für den wertvolleren Teil des gegenwärtigen Lebens und schlafen darum nicht, weil sie fürchten, um einen Schluck zu kurz zu kommen.
Auch drinnen in der Hütte sitzen die Frauen schläfrig, und zwei haben sich auf das Staketengestell gelegt, das den Garzas als Bett dient. Auf dem Erdboden glimmt das Feuer. Töpfe stehen daran, aber niemand kümmert sich darum, was darin ist, ob es kocht, ob es überflüssig ist oder ob man die Töpfe absetzen könne. Niemand weiß offenbar, wer die Töpfe angesetzt hat und zu welchem Zwecke. Aber es fragt auch niemand. Man ist ziemlich interesselos geworden.
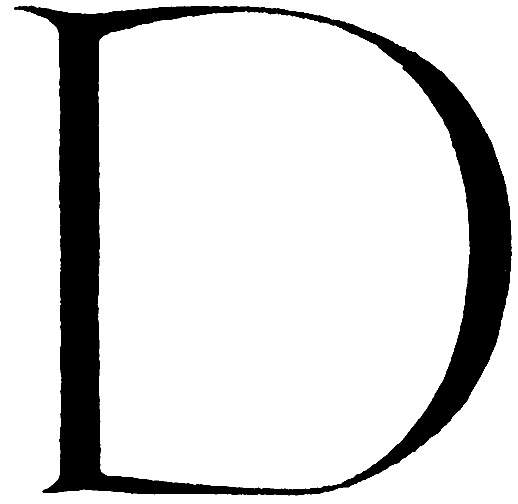 Der Gesang hat nun aufgehört. Der Sänger
hat die letzte Viertelstunde nur noch mit
Mühe gesungen, so heiser war er geworden.
Alle, die noch nicht schlafen,
drücken sich jetzt herum und versuchen,
sich zu entfernen, ohne die Garza zu
beleidigen oder ihr wehe zu tun. Es wird geredet und gestanden
und wieder gesetzt, bis die Männer, die nachträglich
gekommen waren, um zu singen, zu ihren Pferden gehen,
aufsitzen und unter auffallend vielem und auffallend lautem
Reden davonreiten. Sie sind alle vorher noch einmal in die
Hütte gegangen, haben sich den Kleinen noch mal angesehen
und der Frau die Hand gegeben. Die Frau hatte zu jedem
„Gracias!“ gesagt und war dann mitten in der Hütte stehengeblieben,
ohne den Fortreitenden nachzublicken.
Der Gesang hat nun aufgehört. Der Sänger
hat die letzte Viertelstunde nur noch mit
Mühe gesungen, so heiser war er geworden.
Alle, die noch nicht schlafen,
drücken sich jetzt herum und versuchen,
sich zu entfernen, ohne die Garza zu
beleidigen oder ihr wehe zu tun. Es wird geredet und gestanden
und wieder gesetzt, bis die Männer, die nachträglich
gekommen waren, um zu singen, zu ihren Pferden gehen,
aufsitzen und unter auffallend vielem und auffallend lautem
Reden davonreiten. Sie sind alle vorher noch einmal in die
Hütte gegangen, haben sich den Kleinen noch mal angesehen
und der Frau die Hand gegeben. Die Frau hatte zu jedem
„Gracias!“ gesagt und war dann mitten in der Hütte stehengeblieben,
ohne den Fortreitenden nachzublicken.
Aber die Garza bleibt dennoch nicht allein.
Inzwischen ist die Sonne aufgegangen, und der helle Tag ist erschienen wie mit einem Sprung. Er drängt sich in die Hütte, wo die Kerzen flackernd und rauchend weiter neben der Leiche brennen.
Das helle Tageslicht gibt der Hütte wieder ein anderes Aussehen. Man hatte sich an die Nacht so gut gewöhnt, daß man nichts Unheimliches und nichts Außergewöhnliches während der letzten Stunden mehr empfunden hatte. Der Tag aber zerstört das mitleidslos. Eine neue Unheimlichkeit erfüllt die Hütte, und man muß sich in der neuen Unheimlichkeit erst wieder zurechtfinden.
Jetzt erst, nicht in der Nacht, wirken die brennenden Kerzen gespensterhaft. Und gespensterhaft sieht die verweinte, verhärmte und hohläugige Garza jetzt aus. Sie hat noch immer das meergrüne Gazekleid an mit den völlig verwelkten Blumen im Gürtel. In der Nacht sah das Kleid natürlich aus, jetzt aber gehört es weder zu der Frau, noch zu der Hütte, noch zu dem kleinen Leichnam. Das Kleid hat sich ganz und gar von der Frau losgesagt, es hat keine Gemeinschaft mehr mit ihr. Die Frau ist die Mutter des Kleinen noch immer, aber das Kleid hüllt nicht länger mehr den Körper der Mutter ein. Es ist ein dreckiger Fleck, der der Mutter in jeden Winkel folgt. Und da der schmierige Fleck immer hinter ihr ist, kann die Mutter ihn nicht sehen und wegwischen.
Der kleine Junge war schön, und er war er selbst in der Nacht. Jetzt ist er nicht mehr er selbst, nicht mehr schön, nicht mehr der kleine Junge. Der helle Tag hat ihn zu einem stinkenden Kadaver gemacht, der in einen Affenanzug gewickelt ist. Der Oberkiefer beginnt bereits zu verwesen, der Mund ist grünlich geworden, die Oberlippe ist aufgebrochen, und widerlicher gelbgrüner Eiter kriecht daraus hervor. Um die Gelenke der gefalteten Hände sieht man die tiefen Rinnen, die jener Bindfaden, der die Hände in faltender Geste zusammenhalten sollte, eingeschnitten hat, und die faltenden Hände sehen aus, als habe ein Folterknecht sie zur Strafe gefaltet.
Der erste Strahl der Sonne fällt durch die dünnen zusammengebundenen Stämmchen der Wand in die Hütte. Die Garza folgt dem Strahl mit den Augen und blickt in die Sonne und dann auf den Jungen, und nun sieht auch sie zum erstenmal, daß der Junge gegangen ist, daß dort Aas liegt, das sie nicht mehr küssen kann, ohne sich zu schaudern und zu schütteln. Und der Morgenwind, der durch die Wände fegt, hebt eine dicke Wolke unerträglichen Gestanks von dem Aas auf und wirft sie ihr ins Gesicht. Die Mutter wendet sich ab und seufzt tief auf.
Als sie wieder hinblickt zu dem Aas, sieht sie, daß zwei dicke grüne Fliegen auf der Oberlippe sitzen, und daß die Hütte von anderen Fliegen zu summen beginnt, die auf das Aas zufliegen. Und die Frau deckt ein Tuch über das Gesicht. Sie kann das Gesicht ihres Kindes nicht mehr sehen.
Aber sie hat keine Gelegenheit, sich ihrem Schmerze hinzugeben oder sich hinzusetzen und zu brüten. Mit dem anbrechenden Tage sind Frauen und Männer angekommen von fernen Plätzen. Denn die Nachricht von dem Tode des Kleinen verbreitet sich immer weiter, und sobald die Leute davon hören, setzen sie sich auf ihre Esel oder Mulas und ziehen zu der beweinenswerten Mutter, ihr zu sagen, daß man sie liebe, und daß man mit ihr weine. Und da es Sonntag ist, fällt es den Leuten leichter, zu kommen.
Die Männer steigen ab, helfen dann den Frauen und Kindern von den Tieren, drehen sich eine Zigarette und beginnen mit anderen Männern, die herumstehen, zu schwatzen.
Die Frauen gehen nacheinander in die Hütte, bleiben eine Weile stehen, betrachten den Leichnam, und dann gehen sie zur Garza, umarmen und küssen sie. Dann fangen sie an zu weinen, und die Garza beginnt nun wieder zu schreien und nimmt das Tuch von dem Gesicht des Kleinen. Die Frauen, die Berge von Blumen mitgebracht haben, dicke Kränze und Gold- und Silberpapier, stellen das beiseite und gehen näher zu dem Leichnam, um ihn sich genau anzusehen.
„Er sieht so schön aus, der kleine Carlos!“ sagt die eine Frau bewundernd und ehrlich. Sie wiederholt es noch einmal, um es zu bekräftigen.
Aber die Garza hat es bereits beim ersten Male gehört, trotz ihres Schluchzens, und sofort hört sie auf zu weinen. Ein Lächeln des Stolzes huscht über ihr Gesicht, und sie sagt dankbar: „Muchas gracias, Senjoras! Muy muchas gracias!“ Sie bedankt sich überschwenglich für die Bewunderung der aufgeputzten Leiche, als habe man ihr persönlich eine Schmeichelei gesagt. Aber es ist keine Schmeichelei, die Frauen meinen es so. Die Leute sind alle bitterarm, und die angekommenen Frauen sind meist barfuß, haben nichts weiter als ein schwarzes Baumwolltuch um den Kopf gelegt, um die Sonne abzuhalten, und durchlöcherte und geflickte Kattunkleider verhüllen ihren Körper nicht überall. Diejenigen, die ihre Säuglinge mithaben, geben ihnen nun, neben dem Leichnam sitzend, zu trinken, wobei sie abwechselnd weinen und abwechselnd fragen, wie es gekommen sei.
Die Garza hat das Gesicht des Kleinen sofort wieder zugedeckt. Der Gestank des Kadavers, der mit jeder Minute, mit der die Sonne höher kommt, immer unerträglicher wird, der Geruch der schwelenden Kerzen, das schwere Ausatmen der Tausende von Blumen, die so peinvoll sterben und nicht sterben wollen, der beißende Rauch des großen Feuers, wo die Kracker angezündet und abgeschossen werden, dieser beißende Rauch, der durch den Wind in die Hütte getrieben wird, der Geruch von Schnaps, Kaffee, Zigaretten und Schweiß lastet in der Hütte und zieht nicht ab, weil er sich unter dem Grasdach festnistet. In zwei Stunden wird die Morgenbrise vorüber sein, und dann wird bis elf Uhr kein winziger Lufthauch sein, und das Innere der Hütte wird schlimmer sein als das Innere eines Ofens, in dem Tierkadaver langsam verbrannt werden. Die Leute aber sitzen und tun so, als ob sie es nicht empfinden; die Garza muß dort sein, und also bleiben auch sie da.
Die Männer haben ihre Zigaretten ausgeraucht. Sie nehmen nun ihre Hüte ab und kommen herein wie verlegene Schuljungen. Einer nimmt das Tuch vom Gesicht, die Männer kommen näher heran, stehen eine Weile, dann gehen sie wieder hinaus. Das Hinausgehen ist noch verlegener als das Hereinkommen. Sie wissen nicht, ob sie der Garza die Hand geben sollen oder nicht, ob sie etwas sagen oder fragen sollen oder ob sie besser ganz schweigen. Es sieht aus wie Verlegenheit, aber in Wahrheit sind die Leute nie verlegen. Ihr Benehmen wird nur geleitet von dem einen Gedanken: Was tun, um die Mutter ihren Schmerz vergessen zu lassen?
Trotz ihrer unbeschreiblichen Armut, einer Armut, bei der Kartoffeln und Kaffee ein Festmahl sind, von dem sie tagelang, wenn nicht wochenlang sprechen, trotz ihrer Lumpen, trotz ihrer Unkenntnis des Lesens und Schreibens, sie alle sind von einer rührenden Höflichkeit. Ihre Zeremonien sind nicht leere Gesten, sie sind Teile ihres Wesens, eines Wesens, das in tausend Jahre alter Kultur wurzelt. Ihr Takt wird von ihrem Herzen bestimmt, nicht von Formeln, die ihnen eingetrommelt wurden.
Ich sitze auf einer Kiste neben dem Ausgang. Die Männer müssen an mir vorüber, um hinauszugehen. Es ist soviel Platz, daß sie schlendernd vorübergehen können, ohne daß sie mich berühren müssen. Aber jeder einzelne, der an mir vorbeigehen will, bleibt erst stehen und sagt: „Con su permiso, Senjor! Mit Ihrer gütigen Erlaubnis!“ Worauf ich, der ich nur unter meinesgleichen unhöflich bin, weil man mich sonst für idiotisch halten würde, antworte: „Pase, Senjor!“, und der Mann sagt: „Gracias, Senjor! Ich danke!“ Nun erst geht er wirklich vorüber, denn meinen Blick und meinen Atem zu kreuzen, ohne ein höfliches Wort zu sagen, wäre ihm unerträglich. Aber wenn auf der Kiste nicht ich, der Weiße, sitzt, sondern ein verlumpter Indianer, so wird der Vorübergehende genau die gleichen Worte gebrauchen und sie mit einer Geste der Hand begleiten. Denn was bin ich in seinen Augen denn mehr als jener verlumpte Alte?
So höflich und so taktvoll sind die Leute, und sie alle nennen sich Katholiken, aber ich habe nur einmal seit gestern abend gesehen, daß sie das Kreuz in die Luft malen, und das war nur, als der Alte ein Kreuz über das Brett machte, ehe es ins Wasser gesetzt wurde. Während den Leuten alle Gesten aus dem Herzen kommen, das Schlagen des Kreuzes und das Herumfingern am Rosenkranz sind ihnen eingedrillte Gesten, deren Sinn zu begreifen die vierhundert Jahre der Übung nicht gelangt haben, und die nun anfangen, ganz blaß und sinnlos zu werden. Jede Formel und jede Geste und somit auch jede Religion gehört zu ihrem eigenen Klima, zu ihrer eigenen Umgebung, zu ihrer eigenen Rasse. Verpflanzt man sie in eine andere Umgebung, so wird sie inhaltlos und verliert ihre Zeugungskraft; sie kann nicht mehr gebären, sich nicht mehr verjüngen, und nach einem qualvollen Degenerieren stirbt sie endlich aus.
 Ich bin hungrig geworden und gehe hinüber zu Sleigh.
Das Mädchen ist schon lange aufgestanden, hat den
Mais gerieben, Tortillas gebacken, Bohnen gekocht und
Kaffee aufgestellt. „Der Kaffee ist noch nicht fertig,“
sagt Sleigh, „wir müssen noch eine Weile warten. Verflucht
noch mal, ich bin doch jetzt schläfrig.“
Ich bin hungrig geworden und gehe hinüber zu Sleigh.
Das Mädchen ist schon lange aufgestanden, hat den
Mais gerieben, Tortillas gebacken, Bohnen gekocht und
Kaffee aufgestellt. „Der Kaffee ist noch nicht fertig,“
sagt Sleigh, „wir müssen noch eine Weile warten. Verflucht
noch mal, ich bin doch jetzt schläfrig.“
Er nickt ein, fährt aber gleich wieder auf und fragt: „Haben Sie den Jungen nicht gesehen? Er hat doch die Milch fortzubringen.“
„Der Junge steht drüben am Feuer und hilft knallen“, gebe ich zur Antwort.
„Den will ich mir gleich heranholen.“ Er steht auf, und wir gehen wieder zurück zu den Garzas.
Gerade kommt Garza von seinem Ritt heim. Er hat ein dickes Bündel Kerzen, ein Paket gemahlenen Kaffee und zwei kleine Kolben braunen Zucker. Außerdem hat er drei Flaschen Tequila, die er aus dem Basttäschchen zusammen mit den anderen Sachen herausholt. Die eine Flasche ist schon halb ausgekostet. Freilich, der Weg ist lang. Und wer die halbe Flasche ausgekostet hat, das sieht man. Garza hat sich einen ganz netten Flicker angesäuselt. Gleich geht die halbe Flasche rund. Garza hatte nur ein paar Pesos in der Tasche. Aber in der Tienda hat man sich, angesichts des traurigen Falles, nicht geweigert, ihm zu borgen. Wie sollte er denn das Begräbnis zustande bringen ohne Tequila, ohne Kerzen, ohne Kaffee, ohne Zucker? Jedoch in der Tienda weiß man genau: Diese Schuld wird bezahlt, wenn Garza sonst vielleicht auch nichts bezahlen würde. Etwas hat er ja gleich angezahlt, und da die Preise doppelt so hoch sind als in der Stadt, so hat der Besitzer der Tienda schon jetzt die Selbstkosten mit einem ansehnlichen Gewinn in der Tasche. Kein Schlachtfeld ist so traurig, so beweinenswert, daß nicht irgendeiner daran verdienen könnte. Alles läßt sich zu Geld machen, seien es Tränen oder sei es Lachen, sei es Freude oder sei es Weh; der Mensch muß seinen Kummer so gut bezahlen wie seinen Tanz, und selbst seine letzte Höhle unter der Erde, wo er niemand mehr im Wege ist, muß bezahlt werden.
„Muchacho!“ ruft Sleigh. „Teufel noch mal, was ist denn mit der Milch?“
„Vengo, Senjor.“
„Aber sofort. Senjor Velasco wird einen Heidenlärm machen.“ Sehr aufgeregt ist Sleigh nicht. Es ist ihm ganz gleichgültig, ob Senjor Velasco, der Tiendabesitzer in dem näher zur Bahn gelegenen Dorfe, Lärm macht oder nicht. Sleigh hört den Lärm nicht, und wenn er zur Tienda kommt, um die Quittungen zu vergleichen, so daß er mit seinem Farmer abrechnen kann, und der Senjor Velasco sollte etwas sagen wegen der Milchverspätung, dann dreht ihm Sleigh den Rücken, geht raus und setzt sich aufs Pferd. Die Kühe liebt er, aber sein Farmer, der Velasco und die Milch interessieren ihn nicht besonders.
Wir gehen wieder zu seiner Hütte und frühstücken auf einer Kiste, wo das Mädchen das Essen auf einer Zeitung ausgebreitet hat.
Sleigh sieht über die Tafel hin und sagt dann zu dem Mädchen: „Backen Sie uns noch jedem ein Ei.“
Das Mädchen geht zu einer Ecke, wo neben dem Bettgestell ein Korb steht, in dem eine Henne mit schläfrigen Augen sitzt. Als das Mädchen näher kommt, reißt die Henne die Augen weit auf. Aber das Mädchen läßt sich nicht einschüchtern. Mit einem Griff hat sie die Henne gepackt und aus dem Nest gepfeffert. Die Henne läuft gackernd und mit den Flügeln schlagend herum, fliegt auf unsere Tafel, wirft meine Kaffeetasse um, fliegt lärmend wieder herunter und wieder auf das Nest zu. Das Mädchen hat zwei Eier weggenommen, und die Henne setzt sich beruhigt wieder auf die übrigen zurückgebliebenen Eier. Gleich sitzt sie wieder so schläfrig und mit sich selbst zufrieden da, als ob sie nie gestört worden wäre. Sie nimmt es nicht sonderlich tragisch, weil sie nicht zählen kann; denn zählen können und sich erinnern können sind die einzigen echten Quellen der Tragik.
Nachdem wir gefrühstückt haben, halten wir es für wünschenswert, zu schlafen.
Musik weckt mich auf. Die zwei Musiker, die gestern abend kommen sollten, und die, wenn sie gestern abend gekommen wären, jetzt vielleicht nicht zum Begräbnis hier sein brauchten, spielen einen Foxtrott.
Sleigh ist schon lange vor mir aufgewacht und kriecht durch das Gebüsch, weil sich ein Kalb losgerissen hat und er es suchen muß. Ich wasche mich, trinke einen Schluck Kaffee, esse einen Löffel voll schwarzer Bohnen in eine Tortilla gewickelt und gehe zu den Garzas.
Hier ist nun eine große Versammlung. An jedem Baum und an jedem Pfahl ist ein Esel oder ein Maultier oder ein Pferd angebunden, gesattelte und ungelsattelte. Frauen in ihren Sonntagskleidern, viele Männer und eine Herde von nackten und halbnackten Kindern schwirren herum. Es sind mehr Feuerwerkskörper gebracht worden, und es wird in einem fort geknallt. Die Musik, die ja die ganze Nacht hindurch zum Tanze aufgespielt hat, hat schon wieder aufgehört, um die Kräfte für den langen Marsch zu sparen. Ein paar Männer liegen betrunken und schlafend herum, wo sie eben hingefallen sind. Niemand stört sie. Wenn ihnen die Sonne, die jetzt mit ihrer ganzen Kraft herunterglüht, zu heiß wird und sie davon aufwachen, kriechen sie zu einem Baum in den Schatten. Oft erreichen sie den Schatten nicht, sondern bleiben unterwegs liegen wie ein Klumpen.
Ziegen und Schweine laufen zwischen den Leuten umher, Hunde beißen sich oder spielen herum, Hühner zanken sich mit Truthühnern um Würmer und weggeworfene Tortillas, die Esel trompeten und suchen dann wieder mit den Pferden und Maultieren auf dem Erdboden herum, ob noch ein Grashälmchen vergessen wurde. Denn gestern war hier alles grün, jetzt aber, seitdem so viele Pferde und Esel hier gestanden haben, ist der Boden wie abrasiert. Obgleich das Tierzeug den herumsitzenden und auf dem Boden hockenden Leuten in einem fort zwischen die Beine läuft, die Leute werden nie nervös oder wütend auf die Tiere. Ab und zu ruft mal eine Frau: „Perro! Hund!“ oder „Muchacho! Junge!“ (Kosename für das Schwein), wenn die Tiere es gar zu arg machen. Manchmal aber fliegt den Tieren doch ein Scheit Holz gegen den Kopf, wenn sie mit einem Basttäschchen mit Tortillas, das sie gestohlen haben, ausrücken wollen.
Bei einigen Gruppen wird laut geschwatzt und noch lauter gelacht. Gruppen von jungen Burschen singen oder spielen auf der Mundharmonika.
Man möchte nicht denken, daß da drinnen in der Hütte ein Leichnam liegt. Wenn es den Leuten plötzlich einfällt, hören sie auf zu lachen oder dämpfen ihr Geschwätz, während sie die singenden und musizierenden Burschen mit einem kurzen Wort zur Ruhe mahnen.
Je näher man zur Hütte kommt, je ernster sind die Leute, und je leiser reden sie. Hier wird es eigentlich nur dann laut, wenn die Tiere zu aufdringlich werden.
Vor dem Eingang der Hütte hat man mehrere Decken dachartig ausgespannt, damit die Leute unter diesem Dach im Schatten sitzen können, denn die Hitze lastet wuchtig und schwer. In den Tropen, in der Tierra Caliente, um ein Uhr mittags, und kein Wölkchen am Himmel, und die Elf-Uhr-Brise ist heute ausgeblieben. Gerade heute, während sie gestern ein guter Wind war, der bis fünf Uhr anhielt.
Ich nehme den Hut ab und gehe in die Hütte. Die Hütte ist gefüllt mit Frauen, die sich mit ihren Pappfächern unermüdlich und rein mechanisch gleichmäßig kühle Luft zufächeln. Die Kerzen sind ganz zusammengebogen, und an jeder Kerze ist man tätig, um sie gerade zu halten. Die Mehrzahl der Kerzen stehen in Konservenbüchsen, die mit Wasser gefüllt sind. Die Flamme guckt nur ein kleines Stückchen aus dem Wasser heraus; sobald die Flamme einen Finger lang zuviel herausguckt, biegt sich die Kerze sofort in einen rechten Winkel um, als sei sie aus warmer Butter gemacht. Wenn die Flamme das Wasser erreicht, wird das Wasser wieder ein Stück abgegossen, und kommt die Flamme zu tief in die Blechbüchse, wird die Kerze herausgenommen und eine neue hineingesteckt. Die Kerzen liegen alle in einer großen Schüssel mit Wasser, aber das hält sie nur solange in der Form, solange sie im Wasser liegen, werden sie in die Hand genommen, legen sie sich gleich um. Es erfordert die ungeteilte Aufmerksamkeit mehrerer Burschen, um die Kerzen in Ordnung zu halten.
Die Garza hat wieder einmal das Tuch vom Gesicht des Kleinen genommen. Sein Gesicht ist nicht mehr zu erkennen. Es fließt bereits wie Brei auseinander. Die kleine Wunde an der Oberlippe, die, als der Kleine aus dem Wasser kam, kaum zu sehen war, hat sich zu einer schwärenden großen Fläche erweitert infolge der raschen Verwesung. Beide Lippen sind schon fortgelaufen, und das Gebiß liegt offen da wie bei einem Skelett. Auch das Zahnfleisch ist eine breiartige eiterähnliche Masse, die seitlich an den Zähnen herunterläuft. Die Nase ist mehr als zur Hälfte fortgefressen, und von der kleinen Wunde, die am Kopfe war, hat sich eine andere zerfallende Fläche gebildet, die den Schädelknochen freigelegt hat. Unter dem Auge, wo die Beule war, hat der Zerfall auch begonnen, und das Auge, seiner Umkleidung beraubt, liegt starr und allein auf der Augenhöhle. Es ist nicht die tropische Hitze allein, die eine so grauenhafte Zerstörung in einer so kurzen Zeit anrichten konnte, sondern es ist die Hitze, vereint mit der Überfülle des Wassers, das der Körper im Flusse aufgenommen hatte.
Der ganze kleine Körper ist nun in rockartige Gewänder von rotem, blauem und grünem Papier gehüllt. Die Gewänder sind mit Sternen und Kreuzen, die aus Gold- und Silberpapier geschnitten sind, übersät. Das Kunstwerk aus Kottbus oder Birmingham ist nicht mehr zu sehen. Papier ist nicht nur geduldig, es kann auch wohltätig sein. Hier ist es sogar erlösend, und von den vielen Sünden, die das Papier auf dem Gewissen hat, mögen ihm für diese Tat einige vergeben werden. Beinahe jede der Frauen hat sich daheim, noch in der Nacht, sobald sie von dem Tode des kleinen Jungen hörte, sofort hingesetzt und Papierröcke für den Jungen gemacht. Und da sich die Frauen ja nicht durch Draht miteinander verbinden können, so weiß keine, ob der Kleine auch ein schönes Papierkleidchen haben wird für seine letzte Reise. Deshalb hat jede Frau für den Kleinen ein Röckchen gemacht, und jede Frau hat es mitgebracht, und jede bringt es mit soviel Freude und soviel Liebe zu der weinenden Mutter, daß die Mutter nicht anders kann, als die Kleider anzunehmen und sie mit Hilfe der Geberin dem Kleinen anzuziehen. Glücklicherweise haben nicht alle Frauen nur Röckchen gebracht, sondern manche nur Sterne und andere nur Kreuze und wieder andere nur Bänder aus Gold- und Silberpapier.
Nun kommt eine Frau herein, die ich kenne. Sie ist die Mutter jenes jungen Mannes, den ich beinahe zum Leben wiedererweckt hätte, wenn der Spanier nicht gekommen wäre. Ob ich in jenem Dorfe dasselbe Ansehen unter den Indianern genösse, wenn der Spanier nicht gekommen wäre und ich den jungen Mann hätte vom Tode auferwecken müssen, ist fraglich. Aber ich glaube, ich würde mich derselben Anerkennung trotzdem erfreuen, weil ich mich sechs Stunden mit Wiederbelebungsversuchen abgegeben hatte, was ja auch dann anerkannt werden muß, wenn es erfolglos sein sollte. Die Frau begrüßt mich vor allen anderen Anwesenden zuerst, und sie tut es sehr herzlich. Sie hat für den Kleinen auch eine Krone gemacht. Diese Krone ist nicht so geschmackvoll wie die Krone, die von der Pumpmeisterin noch in der Nacht gefertigt worden war. Aber diese Frau hält ihre Krone für schöner. Sie geht zu dem Leichnam, nimmt das Krönchen vom Kopfe des Kleinen und setzt ihm ihre Krone auf.
Die Pumpmeisterin steht dabei, sieht es und läßt es geschehen. Ich sah in der Nacht, mit welcher Liebe die Pumpmeisterin das Krönchen machte und wie sehr sie sich freute, daß es so gut gelungen war und daß der Kleine so hübsch darin aussah. Sie sieht ihre Nebenbuhlerin eine Weile an und macht dann eine kurze Bewegung, als wolle sie es verhindern, daß ihre Krone so ohne Zeremonie ausgetauscht wird. Aber dann lächelt sie, legt ihre Hände über ihre Brust, sieht neidlos dem Vertauschen zu und ist zufrieden. Jeder will dem Kleinen und der Mutter ja nur Liebes tun und Liebe zeigen. Wozu also um das Krönchen einen Streit beginnen und das Prioritätsrecht geltend machen! Das erste Krönchen hat ja seinen Zweck völlig erfüllt, mag nun das zweite Krönchen an die Reihe kommen.
Die Frau mit der zweiten Krone hat die erste Krone abgenommen und wirft sie beiseite mit einer Gebärde, als ob sie sagen wolle: „So ein Dreck!“
Die Krone ist allerdings schon ein wenig beschmutzt von der zerfallenden Kopfhaut. Die Pumpmeisterin bückt sich, hebt ihre Krone vom Erdboden auf, zerknüllt sie zwischen den Fingern so unauffällig wie möglich, geht dann damit hinaus und wirft sie in das große Feuer, wo die Kracker angezündet werden.
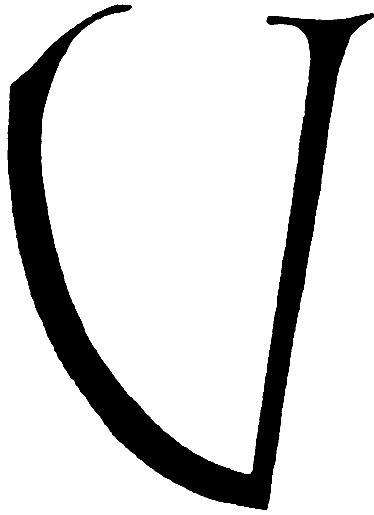 Vor der Hütte hört man reden, und bald darauf
kommt der Mann herein, der den Sarg bringt,
den er selbst gemacht hat. Als dieser Mann hereinkommt
und den Sarg, den er unter dem Arm
trug, auf den Boden stellt, fängt die Garza entsetzlich
zu schreien an. Alle Frauen in der Hütte
beginnen ebenfalls gell zu schreien, und auch die Frauen, die
vor der Hütte sitzen, schreien und klagen laut.
Vor der Hütte hört man reden, und bald darauf
kommt der Mann herein, der den Sarg bringt,
den er selbst gemacht hat. Als dieser Mann hereinkommt
und den Sarg, den er unter dem Arm
trug, auf den Boden stellt, fängt die Garza entsetzlich
zu schreien an. Alle Frauen in der Hütte
beginnen ebenfalls gell zu schreien, und auch die Frauen, die
vor der Hütte sitzen, schreien und klagen laut.
Der Sargmann hat den Hut abgenommen und wischt sich den Schweiß mit dem Handrücken. Es kommen nun einige andere Männer herein, und man wird sofort geschäftig, ohne das Schreien der Frauen zu beachten. Auch Sleigh ist mit hereingekommen.
Der Sarg wird nun auf eine Kiste gestellt. Er ist selbst nichts weiter als eine rohe längliche Kiste. Nichts daran ist gehobelt. Die Wände der Kiste sind außen mit blauem Papier beklebt, damit man das rohe Holz nicht sehen kann. Im Innern der Kiste ist trockenes Gras, und es sind trockene Maisblätter darin. Auf diesen Blättern ist eine Schicht zerbröckelter Kalkstücke.
Vier Männer, darunter Sleigh, fassen den Körper an seinen vier Ecken an und versuchen, ihn in den Sarg zu heben. Während sie ihn hochheben, fällt der Kopf tief herunter, und es gewinnt den Anschein, als wolle er abbrechen. Ich springe rasch hinzu und halte ihn mit dem kleinen Kissen, auf dem er ruhte, in gleicher Lage mit dem Körper. Dabei läuft mir der Verwesungsbrei über die Hände. Die Papierkleider fallen auseinander, und der ganze schöne Aufputz wird eine heillose Manscherei. Endlich haben wir den Körper in dem Sarge, und die Pumpmeisterin ist sofort tätig, um die Kleider wieder in Ordnung zu bringen.
Der Sarg ist nun auf den Tisch gestellt worden, und sobald er dort steht, wirft sich die Garza darüber, um das kleine Gesicht zu küssen. Aber als sie gerade ihren Mund auf die Lippen pressen will, sieht sie, daß keine Lippen mehr da sind, sondern nur Zähne, die aus einem grünlich-gelben Brei herausgrinsen, und daß der runde Augapfel, der losgelöst auf der Höhle liegt, sie fremd anstarrt. Eine dicke, durch die Bewegung des Körpers aufgerüttelte Wolke entsetzlichen Gestanks nimmt ihr den Atem und läßt sie mit einem Ruck zurückfallen. Dort steht sie, gierig nach frischer Luft ringend, und sie wirft ihre Arme so unsinnig und unnatürlich in der Luft umher, als seien sie plötzlich aus den Gelenken gefallen und gehörten nicht mehr ihr. Dann tastet sie mit flinken Fingern an ihrer Brust entlang und läßt die Hände wie von selbst über den Hals am Gesicht hinaufklettern, bis sie das Haar erreichen, das die Finger zerkrallen. Ihre Augen irren hilflos umher, ihre Arme fliegen mit einem Ruck hoch, und während sie einen grauenhaften Schrei ausstößt, bricht sie zusammen.
Andere Frauen springen sofort hinzu, flößen ihr Wasser ein und Schnaps, sprengen ihr Wasser ins Gesicht, versuchen, ihre Hände auseinanderzureißen, klopfen ihr auf die Backen und auf den Rücken. Nach einer Weile ist sie wieder munter. Es war der letzte Abschied von ihrem Jungen.
Ihr Mann, seit einiger Zeit schon völlig im Nebel, kommt nun torkelnd und stolpernd auf sie zu. Aus der hinteren Hosentasche zieht er die Tequilaflasche hervor und drückt sie ihr in die Hand. Die Frau nimmt die Flasche und verschwindet mit ihr in jenem engen Nebenraum. Durch die Stämmchen sehe ich, daß sie einen mordsmäßigen Zug tut, der einem frumben Raubritter die Augen auf Stiele setzen würde. Dann kommt sie wieder hervor, gibt ihrem Manne die Flasche zurück und wischt sich mit der Hand über den Mund. Der Mann nimmt die Gelegenheit, daß die Flasche nun doch einmal in der Hand ist, wahr und zieht sich einen wackeren Hieb durch die Kehle. Man muß die Feste feiern, wie sie fallen.
Der Sargmann holt einen Hammer aus der Hosentasche und aus der anderen zwei dicke Nägel. Er hält das für besser, als lange zu reden, was nun zu geschehen habe.
Die Frau hat diese Ansprache auch sofort begriffen. Sie kommt heran, deckt das Tuch ab und sieht auf das, was vom Gesicht noch übrig ist. Sofort summen dicke grüne Fliegen herbei, die sich auf das Gesicht setzen. Die Frau läßt das Tuch wieder auf das Gesicht fallen und steht nun eine Weile da, als ob sie auf etwas warte. Dann dreht sie sich rasch um, nimmt die kleine Gitarre herunter und legt sie neben den Kleinen in den Sarg. Wieder sinnt sie einen Augenblick, und dann rafft sie das verschrammte Blechwägelchen und den übrigen Jungenkram zusammen und packt es auch noch in den Sarg. Und dann sagt sie ganz still und andächtig: „Adios, Carlos mio!“
Niemand in der Hütte, wo alles dicht gedrängt steht, bewegt sich, niemand spricht etwas, niemand atmet.
Die Garza läßt den Kopf sinken, dreht sich völlig um, bis sie mit dem Rücken zum Sarge steht, und geht einen Schritt vorwärts der Wand entgegen, durch deren Stäbe man das Feuer sieht.
Mit flinken Händen hat der Sargmann den Deckel aufgesetzt, und er gibt zwei leichte Schläge auf die Köpfe der zwei Nägel, die er eingesteckt hat, leicht genug, daß man sie noch einmal herausziehen kann.
Nun geht es rasch. Vier Burschen nehmen den Sarg auf die Schultern, und stolpernd wird losgezogen. Die Männer, Frauen und Kinder folgen. Sie gehen nicht in einem Zuge, sondern in einem Haufen.
Garza torkelt zwischen zwei Männern, die nicht fähig sind, ihn gerade zu halten, weil sie mit sich selbst genug zu tun haben, um auf den Beinen zu bleiben.
Die Mutter geht neben der Pumpmeisterin, in deren Arm sie eingehängt ist. Immer noch hat sie das meergrüne Kleid an. Das Kleid hat Streifen und Flecke von Blut und schmutzigem Wasser. Die Blumen sind abgefallen.
Nach wenigen Augenblicken ist der Haufen bei der Brücke. Als der Sarg an der Stelle ist, wo die Kerbe eingehauen ist, bleiben die Träger stehen. Die Männer nehmen ihre Hüte ab. Die Garza beginnt herzzerbrechend zu weinen. Die Pumpmeisterin küßt sie und nimmt sie in ihre Arme.
Die Träger haben sich wieder in Marsch gesetzt. Der Haufe trottet schwätzend hinterher.
Sleigh bleibt eine Weile auf der Brücke stehen, dann dreht er sich um und geht heim.
Jetzt hat man die Brücke verlassen, ist an der Pumpstation vorüber und wandert nun auf dem Dschungelwege zum Friedhof, der ein paar Stunden weit entfernt ist.
Die Musik, ein Geiger und ein Gitarrespieler, fangen an, die Trauermusik zu machen. Daß es Trauermärsche gibt, wissen sie nicht, würden es auch nicht glauben, wenn man es ihnen erzählte. Daß es Choräle gibt, davon haben sie gehört, können aber keine spielen. Aber amerikanische Tänze, die können sie spielen. Und der kleine Junge soll doch mit Musik zu Grabe gebracht werden, weil er nun als kleiner Engel auf der Reise ist.
So setzt die Musik lustig ein mit: „It ain’t goin’ t’rain no’ mo’ –.“ Jene Kulturwelle, die in genau bestimmten Intervallen von der europäischen und von der amerikanischen Hochzivilisation erbrochen wird, die in „Puppchen, du bist mein Augenstern“ ihren glorreichen Anfang nahm, die mit „Yes, we have no bananas“ die bewohnte und die unbewohnte Erde so verschlammte, daß ich, selbst in den unzugänglichen Dschungeln von Chiapas, Guatemala und Honduras, diesem hehren Ausdruck einer angebeteten Zivilisation nicht entgehen konnte, jene Kulturwelle hat nun einen weiteren, in die fernsten Winkel des Weltalls strahlenden Höhepunkt erklommen mit „It ain’t goin’ t’rain no’ mo’–“. Man muß Amerikaner durch Geburt sein, um die Geistlosigkeit, die Sinnlosigkeit, die Seelenlosigkeit, die Brutalität dieses Tanz-Chorals der Zivilisation in ihrem vollen Umfange erfassen zu können; wie man geborener Deutscher sein muß, um zu begreifen, daß „Puppchen, du bist mein Augenstern“ das hüpfende Vorspiel werden mußte für eine Tragödie der Gehirnlähmung, die einen fünfjährigen Weltraubmord ermöglichte.
Für den eingeborenen Bewohner der Tropen ist das Wasser etwas Heiliges, die köstlichste Gabe, die dem Menschen gegeben wurde. „Unser täglich Wasser gib uns heute!“ Flüsse und Seen sind schön, das gesegnetste Wasser aber sendet der Himmel herunter auf seine Kinder, wenn ihre Not am höchsten ist. „Es wird nun nie mehr regnen“ mag für den Herrn Gerichtsaktuar, der Angst um den neuen Hut seiner Gerichtsaktuarin hat, ein recht freudiger Gedanke sein. Aber der Fluch der Zivilisation und die Ursache, warum die nichtweißen Völker sich endlich zu rühren beginnen, beruhen darin, daß man die Weltanschauung europäischer und amerikanischer Gerichtsaktuare, Polizeiwachtmeister und Weißwarenhändler der ganzen übrigen Erde als Evangelium aufzwingt, an das alle Menschen zu glauben haben oder ausgerottet werden.
Würden die Indianer, deren Sprache wie Gesang ist, weil sie Ehrfurcht vor der Sprache haben, erkennen, wie tief die weißen Kulturschöpfer ihre Sprache zu erniedrigen vermögen und wie gedankenlos sie diese Erniedrigung ihrer Sprache allein in jener einen Zeile in die Welt hinausschreien und hinausmusizieren und hinaustanzen, so würde ich mich schämen, einem Indianer ins Gesicht zu blicken, und ich würde mein Gesicht mit Zinnober bemalen, nur um nicht mit meiner Rasse identifiziert werden zu können. Aber sie verstehen weder den Sinn jener Zeile, noch verstehen sie die Erniedrigung der Sprache, die in jener Zeile zum Ausdruck kommt. Übrig bleibt nur die Musik. Und durch jene Musik, die der einen Zeile völlig ebenbürtig ist, dringt die Kultur der weißen Rasse, die ja in der Musik ihren empfindungsreichsten Ausdruck sucht, in das Leben der farbigen Völker ein. Und in dieser Musik lernt der Indianer, dessen Seele und Empfindung noch ursprünglich sind, die Kultur der weißen Herrenrasse in ihrem Wert erkennen.
Daß dieser blöde Tanz hier als Begräbnismusik dient, offenbart, daß der Sinn der europäischen Musik hier seine Grenzen gefunden hat und genau wie die Religion, die von den Weißen gebracht wurde, auf eine undurchbrechliche Mauer stößt. Den Tod begreift der Mensch hier, aber die christliche Form des Begrabens ist ihm fremd. Sie ist ihm hohle Formel, die er rein äußerlich nachahmt. Und darum ist ihm die Tanzmusik bei dem Begräbnis nichts, das ihn stören könnte. Der Tod ist das Große, das Eigene; was darüber ist, das ist das Fremde. Die Tanzmusik ist am richtigen Platze. Wäre es anders, würde der Indianer in Verwirrung geraten.
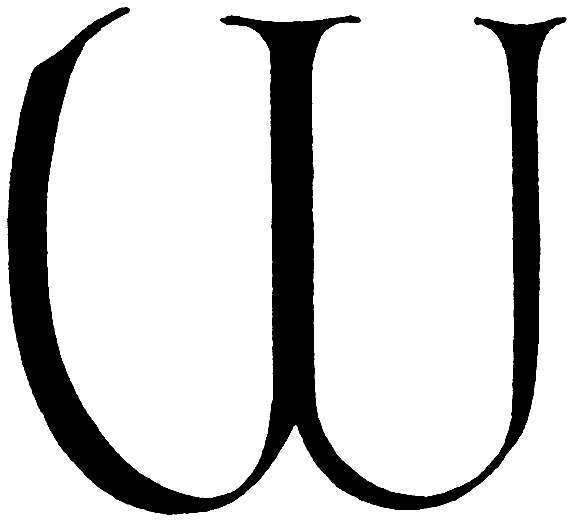 Was schiert sich die Sonne hier um Leichen,
um weinende Mütter, um Begräbnisse?
Was schiert sich die Sonne um Zivilisationen,
um echte Kultur, um unechte
Kultur, um gute Musik, um schlechte
Musik und um Ärger über Verpöbelung
der Welt, der Rassen und der Seelen? Was immer es auch sei,
das uns Weh bereitet, sie steht erhaben und mächtig im All.
Sie ist der Gott, der alleinige, der sichtbare, der allgegenwärtige,
der ewig junge und lachende Gott, wandernd am
Firmament wie ein steter jubilierender Schöpfungsgesang.
Sie ist Schöpfer und Erhalter und Erzeuger und Gebärer. Sie
spendet und verschwendet, ist nimmer müde, fordert keine
Gebete als Belohnung und droht nie mit höllischen Strafen.
Was schiert sich die Sonne um ein Begräbnis? Steil steht sie
hoch über uns, und ihre Glut brüllt. Und wir stolpern und
staggern dahin, über Wurzeln, umgefallene Baumgiganten,
über Löcher und ausgewaschene Furchen, wir drängen uns
durch Gestrüpp, durch Dornengesträuch und durch hohes
scharfes Gras. Schwätzend, lachend, rufend, kreischend,
weinend und musizierend. Onesteps und Twosteps und Foxtrotts
und immer, wenn den unermüdlichen Musikanten
nichts einfällt, was sie spielen sollen, dann spielen sie das
große Tedeum „It ain’t“. Der Sarg schaukelt bedenklich auf
den Schultern der stolpernden Burschen, und wenn einer
durch die trockene Erde in ein darunter ausgewaschenes oder
von Tieren ausgegrabenes Loch bricht, schreit die ganze
Herde, plötzlich aus dem stumpfen Dahinstolpern aufwachend:
„La caja! Die Kiste!“ Und die am nächsten sind,
springen hinzu, um die Kiste aufzuhalten, damit der Inhalt
nicht vorzeitig verlorengeht und die Böschung hinunterschießt.
Denn ehe man ihn in diesem Gewirr des Dschungels
gefunden und herausgepellt hätte, würden die Geier, die an
den Seiten des Weges lauern, wo sie von Baum zu Baum
fliegen und die aussehen wie verwunschene Kapläne, ein
Dutzend Fetzen herausgerissen haben, und es würde sich
kaum noch recht lohnen, zum Friedhof zu ziehen.
Was schiert sich die Sonne hier um Leichen,
um weinende Mütter, um Begräbnisse?
Was schiert sich die Sonne um Zivilisationen,
um echte Kultur, um unechte
Kultur, um gute Musik, um schlechte
Musik und um Ärger über Verpöbelung
der Welt, der Rassen und der Seelen? Was immer es auch sei,
das uns Weh bereitet, sie steht erhaben und mächtig im All.
Sie ist der Gott, der alleinige, der sichtbare, der allgegenwärtige,
der ewig junge und lachende Gott, wandernd am
Firmament wie ein steter jubilierender Schöpfungsgesang.
Sie ist Schöpfer und Erhalter und Erzeuger und Gebärer. Sie
spendet und verschwendet, ist nimmer müde, fordert keine
Gebete als Belohnung und droht nie mit höllischen Strafen.
Was schiert sich die Sonne um ein Begräbnis? Steil steht sie
hoch über uns, und ihre Glut brüllt. Und wir stolpern und
staggern dahin, über Wurzeln, umgefallene Baumgiganten,
über Löcher und ausgewaschene Furchen, wir drängen uns
durch Gestrüpp, durch Dornengesträuch und durch hohes
scharfes Gras. Schwätzend, lachend, rufend, kreischend,
weinend und musizierend. Onesteps und Twosteps und Foxtrotts
und immer, wenn den unermüdlichen Musikanten
nichts einfällt, was sie spielen sollen, dann spielen sie das
große Tedeum „It ain’t“. Der Sarg schaukelt bedenklich auf
den Schultern der stolpernden Burschen, und wenn einer
durch die trockene Erde in ein darunter ausgewaschenes oder
von Tieren ausgegrabenes Loch bricht, schreit die ganze
Herde, plötzlich aus dem stumpfen Dahinstolpern aufwachend:
„La caja! Die Kiste!“ Und die am nächsten sind,
springen hinzu, um die Kiste aufzuhalten, damit der Inhalt
nicht vorzeitig verlorengeht und die Böschung hinunterschießt.
Denn ehe man ihn in diesem Gewirr des Dschungels
gefunden und herausgepellt hätte, würden die Geier, die an
den Seiten des Weges lauern, wo sie von Baum zu Baum
fliegen und die aussehen wie verwunschene Kapläne, ein
Dutzend Fetzen herausgerissen haben, und es würde sich
kaum noch recht lohnen, zum Friedhof zu ziehen.
Vor dem Sarge geht Morano, der mittlere Bruder. Er ist von einer Schar schreiender und quiekender Jungen umgeben. Einer von den Jungen schwingt fortgesetzt ein angebranntes Holzscheit, um es glimmend zu halten. Und Morano zündet seine Kracker an und schleudert sie in die Lüfte, wo sie knallend explodieren. Bei den ersten Knallern erhoben sich die Schwarzröcke mit schweren mächtigen Schwingen in die Lüfte. Jetzt aber haben sie sich schon daran gewöhnt. Schwer rudern sie von Baum zu Baum, mit gierigen und wütenden Augen den Zug anstarrend. Die heiligen Vögel der Tropen, die nicht geschossen, nicht gejagt oder gefangen werden dürfen, denn sie sind legitimierte Beamte, die Gesundheitspolizei des Dschungels, des Busches, der Prärien und der Sandmeere.
Manuel geht ganz für sich allein, als ob er nicht dazugehöre. Garza bleibt häufig stehen, zerrt die Flasche aus der hinteren Hosentasche und zieht einen Tüchtigen. Seine beiden Freunde helfen ihm dabei, und wer sonst gerade Lust hat, kommt herbei. Garza ist freigebig, und wenn diese Flasche leer ist, dann hat er in der linken hinteren Hosentasche eine andere Literflasche voll Leichenschmaus.
Die Mutter geht in der Herde. Wer es nicht weiß, würde nicht vermuten, daß sie die Trauernde ist. Sie geht nicht mehr im Arm der Pumpmeisterin, weil die nahe Berührung wegen der Glut, in der wir marschieren, unerträglich geworden ist. Aber die Pumpmeisterin geht neben ihr, und einige andere Frauen sind in ihrer Nähe. Man spricht, um den Weg abzukürzen. Man redet von tausend Dingen, die Frauen interessieren können, nur nicht mehr von dem Kleinen. Der Marsch ist schon ein Zurückwandern in das alltägliche Leben. Die Burschen, die den Sarg tragen, streiten unausgesetzt miteinander; niemand will tragen, niemand will ablösen. Es stinkt unerträglich in der Nähe des Sarges, und die Burschen binden sich Taschentücher vor die Nasen. Das Tragen ist ermüdend, lästig und unbequem. Die schwarzen Vögel würden nicht von Gestank oder von Anstrengung sprechen, aber streiten würden sie sich noch viel mehr, und die Schwachen hätten zu warten, bis die Starken schwerfällig auf einen Ast zufliegen müssen, um zu verdauen.
Es ist bewundernswert, wie die Musiker trotz der Gluthitze, trotz des Kletterns auf dem Dschungelwege – denn Wandern oder Gehen ist es nicht –, trotz einer langen Nacht unermüdlichen Zum-Tanz-Aufspielens unverdrossen und berufsfreudig den Trauermarsch spielen und dadurch der dahintrottenden Herde Sinn und Inhalt geben. Man würde sonst vergessen, warum man diese Reise überhaupt unternommen hat. Denn grün ist es rundherum und unter den Füßen, goldschimmernd blau ist der Himmel, die Sonne bläst schmetternde Fanfaren, die Vögel singen, von Blumen übersät und durchleuchtet ist der Dschungel, und Schmetterlinge, fächergroße und edelsteinkleine spielen jubelnde Farben durch die Luft. Es zirpt und geigt und flötet im Grase und im Laube.
Es lebt die Welt. Was ist ihr das Stückchen zerfließende Verwesung? Nichts. Nicht einmal Dünger. So reich ist sie, so verschwenderisch, daß sie dieses Düngers nicht braucht und ihn den Schwarzröcken zum Festmahle preisgibt. O Mensch, wie wenig bist du, wie wenig dein Mühen und Streben! Freue dich, liebe, stirb und rufe die Geier, den Rest zu tun!
Aber da ist das Dorf in Sicht. Hütten, Palmhütten und Grashütten. Nackte Kinder wimmeln herum die Menge; Hühner, Ziegen, Schweine, Esel und Hunde zwischen den Hütten, hinter den Hütten, in den Hütten, auf den Wegen. Die Leute kommen aus ihren Behausungen. Schweigend lassen sie den Zug herankommen und schweigend lassen sie ihn vorübergehen. Die Männer alle nehmen ihre Hüte ab, wenn der Zug an ihnen vorbeikommt. Selbst die nackten und zerlumpten braunen kleinen Wildlinge halten in ihrem Herumjagen inne, bleiben schweigend stehen und sehen dem Haufen mit weitaufgerissenen Augen nach. Eine Frau stößt einen gellenden Schrei aus, bückt sich, hebt ihr kleines Würmchen, das auf dem Boden strampelt auf und drückt es an ihre Brust, als wolle es jemand stehlen kommen. Dann bricht sie in langgezogenes Klagen aus, in das andere Frauen einstimmen und das aus dem Zuge heraus von der Garza und einigen anderen Frauen beantwortet wird.
Aus der Tienda kommt ein Mann herausgetorkelt. Er hat einen billigen weißen Leinenanzug an mit einer Jacke. Einen dünnen Zweig hat er in der Hand, mit dem er kreuz und quer in der Luft herumfuchtelt. Er hat schwer Topgewicht und kann sich kaum auf den Beinen halten. Es ist der Lehrer aus dem nächsten Dorf, das näher zur Bahn liegt. Er ist nur für zwei Monate in jenem Dorf, weil die Regierung jenem Dorfe nur für zwei Monate Schullehrergehalt bewilligt hat. Mehr Geld ist nicht da. Und wenn die zwei Monate um sind, geht der Lehrer wieder heim zu seiner Familie, die in einem anderen Staate lebt, sechshundert Kilometer von hier entfernt. Das Geld für die Heimreise muß er sich in den Dörfern zusammenbetteln gehen, weil von dem Gehalt, nachdem er sein Kostgeld bezahlt und seiner Familie den Rest geschickt hat, nichts mehr übrig ist.
Freunde der Garzas in dem Dorfe, wo er Schule hält, in einer Hütte, wo die Kinder keinen Tisch haben, um ihr Schreibheft oder ihr Lesebuch draufzulegen und sie deshalb auf den Knien schreiben müssen, haben ihn gebeten, hierher zu kommen und die Trauerrede für das Kind zu halten. Er hat sich sofort sehr früh aufgemacht, weil man ihm gesagt hatte, das Begräbnis sei um ein Uhr. Das war ein Mißverständnis. Es sollte heißen, daß der Zug um ein Uhr von Hause fortginge. Und jetzt ist es fünf Uhr.
Ich kenne den Lehrer von früher her, als er in einer kleinen Indianerstadt Schule hielt. Damals habe ich mit ihm und seiner Schule Schulfeiern und Schulausflüge mitgemacht und habe mit den erwachsenen Indianern, die Lesen und Schreiben lernen wollten, weil jeden Sonntag die Kommunisten herauskamen und ihnen predigten, das sei wichtig, die Abendschule besucht, wo ich zwar nicht Lesen und Schreiben lernte, wo sich mir aber eine neue Welt erschloß.
Der Lehrer ist kein Indianer, er hat nicht einen Tropfen indianischen Blutes; er sagte mir einmal, er sei Spanier. Ich glaubte es ihm aber nicht ganz, zur Hälfte hat er sicher maurisches Blut in sich, und wenn ich mich nicht täusche, ist er Ägypter. Er ist freilich hier im Lande geboren. Nun weiß ich, daß er ein sehr nüchterner Mensch ist. Aber da steht er nach einem langen anstrengenden Marsche hier vor der Tienda, wo es nicht nur Hosen, Stiefel und Laternen gibt, Mehl, eingemachte Pfirsiche, Kaffee, Hüte, Äxte und Revolverpatronen, sondern auch Tequila. Und dann kommt ein Indianer, der Vater eines oder mehrerer Kinder ist, die zu dem Lehrer in die Schule gehen, und er ersucht den Lehrer um die Ehre, einen Schnaps mit ihm zu trinken oder eine Flasche Bier. Der Lehrer möchte nicht nein sagen, um den Mann nicht zu beleidigen und um nicht den falschen Eindruck zu erwecken, daß er zu stolz sei, mit dem einfachen indianischen Arbeiter einen zu trinken. Und so trinkt er. Nach einer Weile kommt ein anderer Vater, und der Lehrer trinkt, weil er ja den zweiten unsagbar kränken würde, nicht mit ihm zu trinken, nachdem er doch mit dem ersten getrunken hat. Fünf Stunden sind lang, die Sonne glüht, das Wasser schmeckt lau wie Jauche, Kaffee ist nicht zu haben, Limonade, wenn zu viel getrunken, bläht auf, und den Schnaps kann man nicht ablehnen, und so ist der nüchterne Lehrer im Tran.
Der Zug geht weiter. Aus dem Dorfe folgen viele nach. Hinten torkelt der Lehrer und braucht den ganzen Weg für sich. In seinen Arm eingehängt ist jener Freund der Garzas, der den Lehrer gebeten hat, die Rede zu halten. Jener Freund ist noch betrunkener als der Lehrer, dessen Willenskraft wohl geschwächt, aber nicht betäubt ist. Der Lehrer versucht immer wieder, sich gerade zu halten, aber sein Begleiter schleift auf dem Boden entlang und macht durch sein Zerren und Herumdrehen und Hinstürzen den Lehrer mehr berauscht, als er es sonst wäre, wenn er ganz allein sein könnte und nicht unter dieser Suggestion des Schwerbetrunkenen stünde, der sich durchaus gehen läßt.
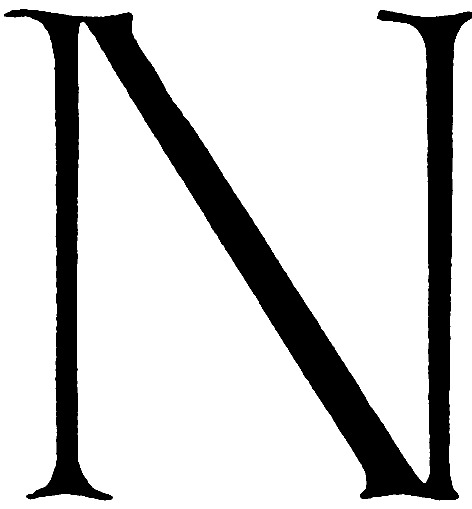 Nun ist der Zug vor dem Friedhof. Die
Männer nehmen ihre Hüte ab, und unter
unaufhörlichem Knallen und Raketenfeuern
wird der Leichnam durch die
kleine Pforte getragen. So wenig wie dem
Indianer diese Religion in sein Wesen
gedrungen ist, so wenig wie er diese Form des Begrabenwerdens
begreifen kann, so wenig klar ist ihm der Sinn eines
christlichen Friedhofes. Ein Schindacker in einem europäischen
Lande sieht besser aus.
Nun ist der Zug vor dem Friedhof. Die
Männer nehmen ihre Hüte ab, und unter
unaufhörlichem Knallen und Raketenfeuern
wird der Leichnam durch die
kleine Pforte getragen. So wenig wie dem
Indianer diese Religion in sein Wesen
gedrungen ist, so wenig wie er diese Form des Begrabenwerdens
begreifen kann, so wenig klar ist ihm der Sinn eines
christlichen Friedhofes. Ein Schindacker in einem europäischen
Lande sieht besser aus.
Da sind Hügel, und da sind Haufen. Da liegen verwelkte Kränze, und da stehen auf Gräbern Kreuze. Und es stehen viele Kreuze herum, wo man nur aus dem Kreuz schließt, daß hier ein Grab sei. Auf die Kreuze ist manchmal mit weißer Kreide, manchmal mit blauer Kreide, manchmal mit Tintenstift und manchmal mit Bleistift etwas geschrieben. Es soll der Name sein und das Datum. Es könnte aber auch etwas anderes sein, es kann auch eine Rechnung aus der Tienda sein. Nach dem Datum sind manche Gräber nur ein Jahr oder ein halbes Jahr alt, aber die Kreuze sind halb zerbrochen oder liegen gar in Stücken herum an ganz anderen Stellen, als wo sie eigentlich hingehören. Manche Grabplätze sind aufgewühlt von Hunden oder Schweinen oder Ziegen. Die Gräber liegen durcheinander. Dazwischen ist Dornengestrüpp, da sind Kakteen, und da ist Gras und Wüstenkraut. Alles ein Dschungel von schwarzen, weißen, blauen, roten und grünen Kreuzen und von zerbrochenen Kreuzen, als hätten die Höllenbewohner hier ein infernalisches Knüppelholzschlagen veranstaltet, ein Dschungel von Hügeln, Haufen, Löchern, Schutt, Papierblumen, dürren Kränzen, Sträuchern, Lehmklumpen, Kraut und Gras.
Sieht man einen solchen Friedhof zum ersten Male und vergleicht man ihn bei diesem ersten Male mit jenen friedlichen, sauberen Kirchhöfen, die man in Europa gesehen hat, so möchte man fragen: Wie ist das denn möglich? Ich wollte eine solche Frage an mich stellen, als ich einen solchen Friedhof zum ersten Male sah. Aber ehe ich diese Frage zu Ende gedacht hatte, fand ich die Frage in dieser Betonung lächerlich. Denn das allein ist ja der Friedhof, den die Menschen haben sollten, wenn sie keine Heuchler wären. Aber sie müssen noch nach dem Tode heucheln und als Gespenster herumlaufen. Seit jenem Tage, wo ich zum ersten Male einen echten indianischen Friedhof im Dschungel sah, bin ich zu der Wahrheit gelangt: Steht das Kreuz ein halbes Jahr auf dem Hügel und ist der Hügel ein halbes Jahr sichtbar, so ist es in beiden Fällen sechs Monate zu lange. Das Kreuz und der Hügel verhindern, daß der Mensch im Herzen und im Geiste der Zurückgebliebenen weiterleben kann, darum ist er gezwungen, als Gespenst uns das Leben zu verbittern.
Der Zug ist jetzt an dem Loche, wo der Kleine hineingebettet werden soll. Kein Totengräber gräbt die letzte Grube. Der Vater muß es tun oder der Bruder oder ein Freund. Manuel hat das Grab aus dem harten lehmigen Boden herausgehackt und herausgeschaufelt. Dann ist er auf dem Pferde zurückgeritten, um dem Sarge folgen zu können.
Der Sarg wird hingestellt. Der Sargmacher zieht die Nägel heraus und hebt den Deckel ab, damit die Mutter Abschied nehmen kann.
Man sieht die grellbunten Papierröcke, die goldene Krone, das Zepter und die goldenen und silbernen Sterne und Kreuze. Aber das Gesicht kann irgend etwas sein, nur kein Gesicht. Mit einem Schrei wirft sich die Garza über den Sarg, den sie fest umklammert. Ihr Schrei geht in Wimmern über.
Garza kommt stolpernd heran. Er muß sich fest auf die Männer, die dicht dabei stehen, stützen, damit er nicht umfällt, denn die zweite Tequilaflasche ist inzwischen auch nahe zur Neige gegangen, und es sind gerade noch ein paar Trosttropfen für ihn und seine Frau drin. Aber es ist sein gutes Recht, hier dicht an dem offenen Sarge zu stehen, denn er ist der Vater. Er will etwas sagen, vielleicht will er auch nur einen Schmerzensschrei ausstoßen, aber er quiekst nur und wischt sich mit der Hand die Tränen von den Backen. So betrunken ist er lange nicht, daß er nicht weiß, was da von ihm genommen wird, daß sein Nesthäkchen nun für immer abgewandert ist.
Die Pumpmeisterin und zwei andere Frauen, die laut schluchzen und schreien, als wäre es ihr Kind, heben die Garza auf. Sobald der Sarg auch nur ein wenig frei ist, zieht ihn der Sargmacher gleich unter der noch halb niedergebeugten Garza hervor. Ein anderer Mann hat schon den Deckel bereit, und im Augenblick ist der Sarg zugenagelt. Diesmal für immer. Dann trägt man ihn dicht an das Loch.
Und nun drehen sich alle Leute um und warten auf den Lehrer. Der Lehrer ist noch draußen vor der Friedhofspforte. Er weigert sich, den Friedhof zu betreten, weil er genug Verstand behalten hat, um ganz genau zu wissen, was mit ihm los ist, und daß er, der weinenden Mutter wegen, nicht unter die Trauergemeinde treten kann und es auch nicht mag. Aber jener Freund der Garzas, der ihn eingeladen hat, zerrt ihn jetzt durch die Pforte und ruft noch einen anderen Mann herbei, um den Lehrer zum Grabe zu schleifen.
Endlich steht er am Grabe, und alle Leute sehen ihn. Er schwankt bedenklich. Und mit einem Male geht er wieder fort vom Grabe und versucht, sich davonzuschleichen. Der Freund hat das trotz seiner Trunkenheit bemerkt und schreit wie besessen hinter ihm her. Es fängt an, ein lautes Begräbnis zu werden. Der Freund kann sich nicht beruhigen und schreit, es sei eine Schande, erst die Rede zu versprechen und sie dann nicht zu halten. Andere Männer reden auf den Wütenden ein, den Lehrer doch zu entschuldigen, aber das macht den Mann nur noch wütender. Er beginnt den Lehrer maßlos zu beschimpfen. Um den Mann zu beruhigen und den Streit, den andere Halbbetrunkene aufnehmen, zu beenden, wirken die Leute auf den Lehrer ein, doch zu reden. Aber der Lehrer lallt nur. Und während er sich umwendet, um die Leute abzuwehren und seiner Wege zu gehen, sieht er die weinende Mutter, die weder bittend, noch abweisend die Augen auf ihn gerichtet hält. Was die Mutter denken mag angesichts dieser Streiterei und der Unwilligkeit des Lehrers, ist aus ihrem Blick nicht zu erkennen. Aber es scheint, daß der Lehrer in seinem Nebelzustande etwas darin sieht, was wir anderen nicht zu sehen vermögen. Jedenfalls geht er plötzlich wieder auf das Grab zu.
Er steht dicht am Rande der Grube und schwankt verdächtig hin und her. Mit beiden Armen gestikuliert er nun heftig in der Luft herum und öffnet den Mund. Da er in der einen Hand noch immer den abgeschnittenen Zweig hält, so sieht er aus, als ob er mit jemand kämpfen wolle. Seine Augen werden ganz stier und gläsern. Es spiegelt sich in seinem Blicke der Eindruck wider, daß alle die Gesichter, die auf ihn jetzt gerichtet sind, zu einer Einheit verschmelzen, die für ihn etwas Unheimliches haben muß; denn seine Gesichtszüge beginnen, sich in Angst zu verzerren.
Ich habe ihn einmal am Unabhängigkeitstage reden hören, und ich weiß, daß er für Verhältnisse dieser Art als guter Redner gelten kann und daß er auch keine Redefurcht hat. Warum er die gräßliche Angst zeigt, ist mir unverständlich. Er fuchtelt jedoch immer heftiger mit den Armen durch die Luft, macht den Mund weit auf und klappt ihn wieder zu. Man könnte leicht annehmen, daß er glaubt, er rede bereits.
Plötzlich aber schreit er ganz unvermittelt los: „Wir sind alle sehr traurig!“
Er schreit das so gewaltig hinaus, als ob er zu fünftausend Menschen zu sprechen hätte, die auf weiter Ebene versammelt sind und ihn alle hören sollen.
Dann brüllt er los, als ob er nun zu zwanzigtausend Leuten reden müßte: „Der kleine Junge ist tot!“
Das alles war aber noch gar nichts, denn jetzt hebt ein Brüllen an, als ob der Himmel auseinandergerissen werden solle: „Auch die Mutter des kleinen Jungen ist sehr traurig. Sie weint.“
„Auch die Mutter ist sehr traurig. Jawohl, das ist sie!“ wiederholt er mit diesem Brüllen, und dabei schlägt er mit dem Zweige so heftig durch die Luft, als ob er den, der etwa bezweifeln sollte, daß die Mutter auch sehr traurig sei, mit einem Hieb der Länge nach durchspalten wolle.
Dieser Hieb war gut gemeint, und er war auch ehrlich gemeint, und vielleicht war er ein Trost für die Mutter, die sehr traurig ist. Aber der gutgemeinte Hieb war mehr, als das Gleichgewicht des Redners in diesem Augenblick vertragen konnte. Der gute Mann sauste über und sauste in das Grab hinein. Er kam aber nicht ganz bis auf den Boden des Grabes. Über dem offenen Grabe lagen zwei Baumstämme, auf denen der Sarg eigentlich stehen sollte, zum großen Glück des Redners aber noch nicht hingestellt worden war, weil man durch das Streiten diese Handlung vergessen hatte. Einen dieser Baumstämme hatte der Lehrer im Fallen gerade noch erwischt, und nun hing er, beide Arme vor sich hingestreckt, ebenso kläglich wie hilflos auf dem Stamm. Mit den Beinen angelte er nun seitlich aufwärts, um den Rand zu erklimmen und daran hochzuklettern. Aber seine Anstrengungen waren vergeblich, und hätte man ihm nicht brüderlich beigestanden, so wäre er in das Grab hinabgesunken, von wo er, wäre er allein hier gewesen, sich heute auf keinen Fall selbst wieder hätte herauskrabbeln können.
Trotzdem diese Entgleisung des Redners recht lustig war, sah ich doch nicht einen einzigen unter allen, die anwesend waren, lachen. Und ich selbst, dem das Lachen für gewöhnlich verhängnisvoll nahe steht, fand auch nicht eine Spur von Komik in dem Vorgang. Damals auf keinen Fall, ich erinnere mich dessen noch sehr genau, und ich erinnere mich ebenso genau, daß mir in jenem Augenblick ein Weinkrampf näher war als das bescheidenste Lächeln. Heute, nachdem ich drei Monate Zeit hatte, mir jene einundzwanzig Stunden des wirbelnden Tanzes, zu dem der große Musikmeister aufspielte, einzeln zurückzurufen, sie wieder zu erleben und durch und durch zu erleben, weiß ich, daß niemand lachen konnte darum, weil alle, alle dasselbe fühlten, was ich in jenem Augenblick fühlte. Denn warum sollte ich ein Ausnahmemensch sein und etwas fühlen, was andere Menschen nicht fühlen können! Und ich fühlte: Der Lehrer ist, während er am Grabe steht, nichts als reine brüderliche Liebe für die weinende Mutter, nichts als hingebende Hilfsbereitschaft für den trauernden Mitmenschen. Und warum sollte einer von allen den Anwesenden etwas anderes empfunden haben als ich? Hat doch keiner gelacht! So wenig wie ich den Drang zum Lachen fühlte!
Der Lehrer steht wieder an dem Rand der Grube. Den Zweig hat er noch immer in der Hand, er hat ihn nicht einmal in seiner höchsten Not fallen lassen. Er steht da mit einer Miene, als habe das, was eben geschehen sei, gar nicht ihm gegolten, sondern irgendeinem anderen, und er habe während dieses Zwischenfalles seine Rede unterbrochen, bis die Störung vorüber sei.
Mit demselben Brüllen redet er nun wieder weiter: „Auch der Vater ist recht traurig. Jawohl!“ Und wieder wird der, der daran zweifelt, der ganzen Länge nach durchgespalten. Jetzt aber hat sich der Weise besser vorgesehen. Er steht nicht mehr so dicht an der Grube, daß er hineinfallen könnte. Dafür aber hat der Hieb, der bei dieser Redewendung seitlich weggeführt war, wie der Hieb eines Reiters vom Pferde herab, um nicht etwa abermals in die Grube zu lenken, das Gleichgewicht nach einer anderen Grundidee ausgeschwenkt. Denn nun, als die Schwungkraft dieses Hiebes sich auszuwirken bemüht, saust der Redner rechts herum wie ein Kreisel. Der Hieb war so kräftig geführt, daß eine ganze Drehung zustande kommt. Diese Drehung ist zwar nicht kerzengerade, weil das ja sowieso gegen die physikalischen Gesetze verstoßen würde und deshalb schon unzulässig wäre und mit Geldstrafe belegt werden kann. Nein, die Drehung ist schwankend schwenkend, etwa wie bei einem großen Blechkreisel, der seine letzten aushauchenden Tänze vollführt.
Der Redner steht wieder in seiner Anfangsstellung, mit dem Gesicht den Leuten zugekehrt. Auch diesmal hat keiner gelacht. Wie könnte man auch lachen, wenn jemand seine Sympathie mit solchem Nachdruck äußert!
„Der kleine gute Junge hat so früh sterben müssen“, brüllt der Lehrer und schlägt wieder zur Bestätigung mit dem Zweig. Nun aber hat sich der Körper an diese Beiprodukte der Rede gewöhnt und antwortet nicht mehr darauf.
„Der gute Junge, den wir alle so lieb hatten, hat so rasch sterben müssen. Das tut uns allen so sehr leid. Nun wollen wir ihn begraben. Adios, mein lieber, kleiner Junge!“
Verflucht noch mal und ausgespuckt, der Geier soll doch das ganze Begräbnis holen! Jetzt heule ich. Wahrhaftig, ich heule wie ein alter Schloßhund, dem die weiße Frau als Ameisenbär erscheint. Ich heule, und die ganze Gesellschaft, Männer, Weiber und zerbröckelnde Lehmkügelchen weinen und schluchzen. Es ist nicht mehr jenes gelle Schreien wie in der Nacht. Es ist ein stilles weinendes Trauern.
Und was geht mich denn der Junge an! Ein Indianerjunge. Er ist doch gar nicht mein Junge. Aber ich heule. Vielleicht ist er doch mein Junge, ebensogut mein Junge, wie er der Junge aller dieser Leute hier, wie er der Junge aller Menschen ist. Mein Junge, mein Bruder, mein kleiner Mitmensch, ein Menschenkind, das leiden konnte wie ich, das lachen konnte wie ich, das sterben konnte, wie ich es muß.
Man will den Sarg mit Stricken, die aus fünf verschiedenen Riemen, Stricken und Bindfaden zusammengeknüpft sind, herunterlassen. Aber die Stämme wackeln hin und her, und die Stricke lassen sich der vielen Knoten wegen nicht recht handhaben.
Da springt ein Mann kurz entschlossen in die Grube.
„Reich’ mir die Kiste zu.“
Der Mann klimmt heraus.
Mutter und Vater werfen Erde darauf.
Dann fliegen die Hände voll Erde von allen Seiten polternd auf die Kiste.
Die Musik hat sich da aufgestellt, wo der Lehrer, der sich unauffällig entfernt hat, während seiner Rede gestanden hatte. Die Musik wird nun spielen: „O heilige Jungfrau, voller Gnaden, du segensreiche Dulderin.“
Ich bin erlöst. Die Musik hat Geschmack und Takt. Sie weiß den wahren Ton für die leidende Menschheit zu treffen. Sie heuchelt nicht und macht keine Heuchelei mit. Diese Todsünde begeht sie nicht. Sie ist echtes Geblüt des Dschungels. Sie hat den bewundernswerten Mut, die Dinge beim rechten Namen zu nennen, immer und überall; sie hat die unerschütterte Urkraft, den Dingen, deren Sinn von der Gedankenlosigkeit eines taumelnden Geschlechts verwirrt wurde, den ursprünglichen Sinn zurückzugeben, der die Gestalt und das Wesen des Dinges bestimmt.
Und sie spielt den großen Trauermarsch der Menschheit: „It ain’t goin’ t’rain no’ mo’ –.“
Und als der Choral, der mit Ewigkeiten Marmeln spielt und mit dem Entsetzen des Weltalls Stiefel putzt, verklungen ist, mehrere Burschen emsig Erde in die Grube schaufeln, andere die Blumen und Kränze ordnen, die Mutter weinend in einem Knäuel weinender Frauen steht, die sie umarmen und küssen, die Männer ihre Hüte aufsetzen und sich Zigaretten drehen und niemand den Friedhof verläßt, bis die Mutter das Zeichen zum Aufbruch gibt, fühlt die Musik, noch immer am Kopf der Grube stehend, daß man noch etwas von ihr erwartet, weil sie erst die Hälfte ihrer Aufgabe erfüllt hat.
Da besinnt sie sich auf den Trauermarsch von gestern, glorreich wie der beendete Fischzug von gestern, der die Säcke der Wissenden und Verständigen mit Gold füllte, und die Rippen der Begeisterten und Gläubigen mit Nickelstahl. Jener Trauermarsch, der die Faust, die sich erhob, während man die Säcke zählte, recht dienstbeflissen und geschickt mit Nagelputzcreme behandelte und zur selben Zeit den Unknown Warrior, den Unbekannten Krieger, zur Hilfe aufrief, um der Faust die Krallen zu stutzen. Jener Trauermarsch kam zur guten Stunde, um das herannahende Weltdonnerwetter abzuleiten in die goldbronzierte Inschrift: – Arbeiten, damit die andern nicht verzweifeln. Do It Now! –
Und dieser Trauermarsch kommt auch jetzt zur guten Stunde und fällt den Musikern am rechten Platze ein: „Yes, we have no bananas, we have no bananas to-day.“
Adios, mein lieber kleiner Junge! Adios! Es leben die Maden und Würmer! Adios! So wie du wurde noch kein König begraben!
Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Weitere Änderungen, zum Teil basiert auf späteren Ausgaben, sind hier aufgeführt (vorher/nachher):