
Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XVI, Heft 1–2
Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege
Editor: Landesverein Sächsischer Heimatschutz
Release date: January 2, 2026 [eBook #77607]
Language: German
Original publication: Dresden: Landesverein Sächsischer Heimatschutz, 1927
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Unterschiedliche Schreibweisen, insbesondere von Namen, wurden wie im Original beibehalten.

Landesverein Sächsischer
Heimatschutz
Dresden
Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege
Band XVI
Inhalt: Vom Fischerdorf zum Königsschloß – Gedenkbäume und andere Erinnerungsmale in Sachsen – Köhler, Flößer und Pecher im Erzgebirge – Der Dresdner Saugarten in der Dresdner Heide – Zur Geschichte unserer Moore – Die Gefahren der Vogelbruten – Die Elster, ein volkstümlicher Bösewicht im schmucken Gewand.
Einzelpreis dieses Heftes 3 Reichsmark
Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24
Dresden 1927
Kauft Lose!
Ziehung bestimmt am 9. und 11. April 1927
3. Geldlotterie
für die Erhaltung des Dresdner Zwingers
500 000 Lose
54 643 Gewinne und 1 Prämie im Gesamtwerte von 160 000 Reichsmark
| Gewinnplan | |||||
| Höchstgewinn im günstigsten Falle | 50 000 | Reichsmark | |||
| 1 Prämie | 30 000 | " | |||
| 1 Hauptgewinn | 20 000 | " | |||
| 1 Hauptgewinn | 10 000 | " | |||
| 1 Hauptgewinn | 5000 | " | |||
| 5 | Gewinne je | 1000 | Reichsmark | = 5000 | " |
| 10 | Gewinne je | 500 | " | = 5 000 | " |
| 25 | Gewinne je | 200 | " | = 5 000 | " |
| 50 | Gewinne je | 100 | " | = 5 000 | " |
| 100 | Gewinne je | 50 | " | = 5 000 | " |
| 150 | Gewinne je | 20 | " | = 3 000 | " |
| 300 | Gewinne je | 10 | " | = 3 000 | " |
| 1 000 | Gewinne je | 5 | " | = 5 000 | " |
| 3 000 | Gewinne je | 3 | " | = 9 000 | " |
| 50 000 | Gewinne je | 1 | " | = 50 000 | " |
| 54 643 | Gewinne und 1 Prämie | 160 000 | Reichsmark | ||
Gewinne in barem Gelde ohne Abzug
Wir erbitten Bestellung durch beigefügte Karte
Landesverein Sächsischer Heimatschutz
Dresden-A., Schießgasse 24
[1]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben
Abgeschlossen am 20. März 1927
Ein Gang durch die Geschichte von Pillnitz
Von Professor Dr. Alfred Meiche, Dresden
Mit Aufnahmen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz
Wie ein Kranz von Perlen um einen edlen Ringstein, so lagern sich Meißen, Moritzburg, Pillnitz, Pirna und Tharandt um die Landeshauptstadt Sachsens. Eine der kostbarsten Perlen ist unser Pillnitz, leuchtend in landschaftlicher Schöne, hervorragend als Denkmal altsächsischer Kultur in Schloß und Garten, bedeutsam als Schauplatz einer welthistorischen Begebenheit, der Pillnitzer Konvention von 1791. Auch die Landesgeschichte ist hier mit starken Fäden angeknüpft; war doch Pillnitz zwei Jahrhunderte lang der bevorzugte Sommersitz unseres alten Fürstenhauses, dessen Glück und Glanz, dessen Schuld und Leid sich in den Wellen des rauschenden Elbstromes spiegelten.
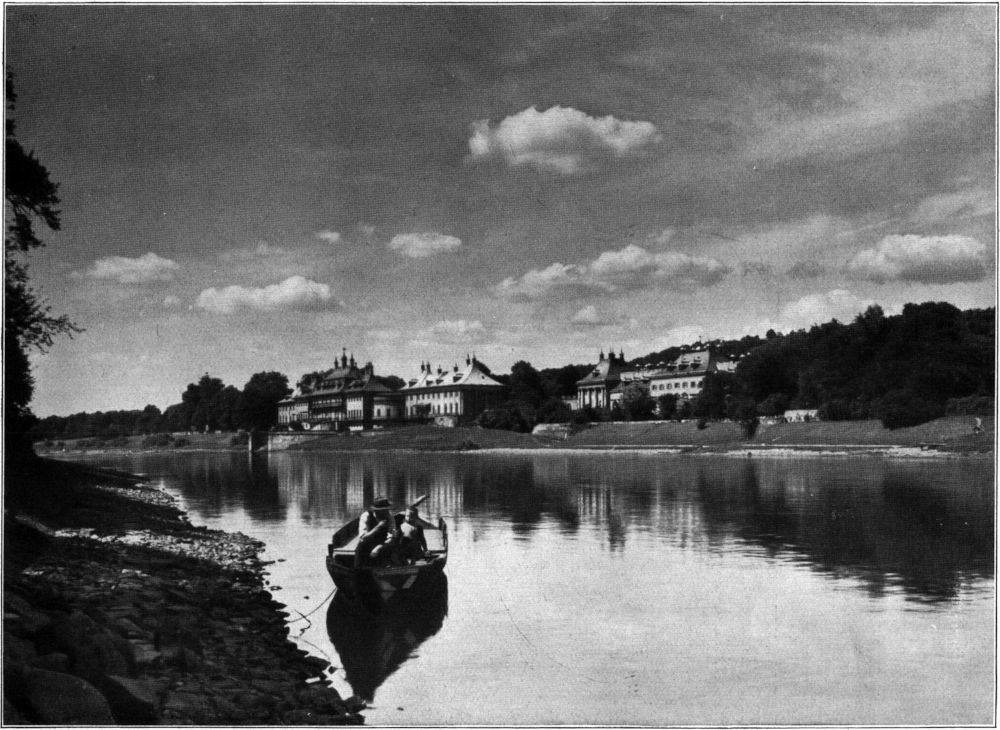
Früher glaubte man (und manche meinen es noch heute), daß Pillnitz und Dresden gemeinsam in derselben Urkunde zum ersten Male genannt würden; nämlich Dresden als Ausstellungsort eines Grenzschiedes vom 31. März 1206 und Pillnitz als Sitz eines der damaligen Urkundenzeugen, eines »Henricus de Beuelnewitz«. Allein das im sächsischen Hauptstaatsarchiv ruhende Originaldokument (Faksimile in den Dresdner Geschichtsblättern 1906 Nr. 2) zeigt klar und zweifelsohne die Namensform »Becelnewiz«, was [3]mit Pillnitz sprachlich nicht zusammenstimmt. Wohl aber gleichen die Anfänge des Ortes dem Ursprunge der Hauptstadt. Wie diese zunächst ein sorbenwendisches Fischerdorf am Sumpfwalde der Elbaue war (oberwendisch Draždźany = Waldsassen), so hatten sich auch am Fuße des Borsberges Elbfischer derselben Nation angesiedelt, die anscheinend der Sippe eines gewissen Bělan angehörten, weshalb ihr Wohnplatz nach slawischer Art Bělanovici (d. h. eben Sippe des Bělan) genannt wurde. Der Personenname ist eine Kurzform von Bělomir und bedeutet etwa »der durch seine weiße (běły), glänzende Hautfarbe Berühmte«.

Diese Namenserklärung muß der bisher fast allgemein angenommenen als »Schneidemühl« (von altslaw. pila »Säge, Sägemühle«) vorgezogen werden, trotz der am Nordrande des Dorfes gelegenen Piel-, Pielz- oder Pilzmühle, weil einerseits ein höheres Alter dieser Mühlstelle nicht nachweisbar ist und ihr Name aus »Pillnitzer Mühle« verstümmelt sein oder nur zufällig anklingen kann, andererseits aber die hier zum ersten Male dargebotenen ältesten Urkundenformen (1335: Belennewitz; 1350: Belanicz) nachdrücklich auf das Stammwort běły »weiß« zurückleiten. (Vgl. auch: Über Berg und Tal. VII, 135). Noch ein zweiter Flurname führt uns in die Wendenzeit hinauf und lehrt uns, daß die Pillnitzer Dorfgenossen vom Elbstrom abhängig waren. Zwischen hier und Söbrigen befand sich früher ein Floßplatz, der noch vor [4]einem Menschenalter »der Plauen« hieß (v. Minckwitz, Geschichte von Pillnitz. Dresden 1895. Seite 2. Fußnote 1). Das Wort stammt vom altslawischen plavŭ »das Flößen«; Plauen an der Weißeritz, Plauen an der Weißen Elster und Plaue an der Zschopau gehören gleichfalls in diese weitverzweigte Ortsnamengruppe.
Nach einem altslawischen Worte chizŭ, »Fischerhütte«, pflegt man solche Fischer- und Schifferwohnplätze »Kitzen« zu nennen. Sie ziehen sich als einfache Häuserzeilen, die ihre Giebel dem Flusse zuwenden, an diesem hin; wo es »der Platz erlaubt, mit einer hakigen Abbiegung in eine Seitenschlucht. Das ist die Grundform aller Talsiedlungen in der Sächsischen Schweiz«. Man trifft sie auch unterhalb Dresdens in großer Anzahl.

In Pillnitz hat der Herrenwille der Rittergutsbesitzer dieses ursprüngliche Ortsbild fast ganz verwischt. Nur östlich vom Schloß stehen noch einige der malerischen Holzhäuser, nicht mehr in den altwendischen Bauformen, aber sicher noch an der Stelle alter »Kitzen«. Wenn an schönen Sommertagen der Schwarm plaudernder Großstädter vom Dampfschifflandeplatz nach der Schloßrestauration hier vorüberflutet, dann gönnt wohl mancher ihren altfränkischen Vorbauten einen flüchtigen Blick, und sinnige Menschen lesen wohl auch am Hause Nummer 47 den frommen Spruch:
[5]
Wann jene Ursiedelung am Elbufer abgebrochen wurde, sagt uns keine Urkunde. Wahrscheinlich aber geschah es damals, als die ritterlichen Herren über Pillnitz von ihrem ersten Sitz an der Berglehne, dem alten Schloß, ins Tal hinabzogen und dort einen neuen stattlichen Wohnbau errichteten. Das mag wohl schon vor fünfhundert und mehr Jahren geschehen sein. Viel später erzählen uns Akten von dem Aufgehen anderer Flurteile in den Schloßbereich. So wurden 1721 nördlich vom Bergpalais fünf Häusler- und Gärtner-Nahrungen ausgekauft und zum Schloßpark geschlagen, und 1785 und 1790 mußten abermals neun Häusler ihre Heimstätten verlassen, die dem mit Treibhäusern ausgestatteten »Holländischen Garten« angegliedert wurden.

[6]
Es mag wohl ein thüringisches oder fränkisches Vasallengeschlecht gewesen sein, das im Gefolge der Markgrafen von Meißen ins slawische Elbtal gekommen war und zum Lohn für seine Mitarbeit an der Wiedergewinnung altgermanischen Volksbodens in dem späteren Slawengau Nisani den Herrensitz unterm Borsberge mit seinem Zubehör an wendischen Frönern zu Lehen bekam; leider wissen wir nicht, welcher Familie sie entstammten.
Der erste aktenmäßig nachweisbare Gutsherr ist ein »Ludewicus«, der sich nach seinem Besitze »de Belennewitz« nennt und am 4. April 1335 als Urkundenzeuge in Stolpen auftritt. 1350 aber besitzen unmündige Söhne aus der Familie »de Belanicz« Zinsen im benachbarten Söbrigen, und als Vormünder für sie schalten ein »Hartungus de Nimans« (aus dem Geschlechte, das schon im dreizehnten Jahrhundert auf Königstein und Rathen haust) und »Ludolfus Karaz de Belanicz«. Letzterer zeigt uns, daß die Gutsherren von Pillnitz wenigstens z. T. mit der um Dresden und im Meißner Hochlande vielfach begüterten Familie von Karrasz identisch waren. Und noch am 5. August 1403 begnadet Markgraf Wilhelm die Ehefrau eines Heinrich Karrasz, Femika = Euphemia genannt, mit ihrem Leibgedinge zu Pillnitz. Es war ein ganz hübscher Besitz: allodium (Vorwerk), villa (Dorf), et curia inferior et superior (Ober- und Niederhof) – in Bilnicz mit der Fischerei, den Weinbergen, den Gehölzen im Frundirsperge, vallis (Tal) dicta Michcz (Meix) cum molendino (Mühle) et nemore (Hain), das Dorf Kribischendorf (Krieschendorf) nebst Zubehörungen und zwei zinspflichtige Bauern im Dorfe Borsberg.
Die lateinisch geschriebene Urkunde wirkt wie eine Offenbarung; in das Dunkel der Vergangenheit fällt ein helles Licht. Zwar dürfte es heute Mühe kosten festzustellen, welcher Höhenzug mit dem »Frundirsberge« gemeint ist, aber zum ersten Male erfahren wir etwas vom Weinbau um Pillnitz herum, zum ersten Male hören wir vom Friedrichsgrunde und der an seinem Ausgang liegenden Meixmühle, zum ersten Male werden uns zwei Höfe (Wirtschaftshöfe) im Orte genannt. Man sucht den niederen an der Stelle der noch jetzt bestehenden Gutsgebäude, den oberen dort, wo später die Schäferei stand. Aus dem Vorhandensein der beiden Höfe aber darf man den Schluß ziehen, daß schon damals, also vor fünfhundert Jahren, auch zwei Herrensitze vorhanden waren. Das »alte Schloß« (wie es um 1600 auf einem im Hauptstaatsarchive befindlichen Vermessungsblatt von Math. Öders Hand heißt) lag dort, wo 1785 die künstliche Ruine erbaut wurde. Beim Grundgraben soll man auf sein Mauerwerk gestoßen sein und solches dann zum Bau der Ruine mit gebraucht haben. Da in der Nähe der »Ruine« übrigens ein »Hausberg« liegt, so bleibt es ungewiß, ob nicht auf diesem ein noch älteres Schloß (mhd. hûs) oder schon ein zweiter Herrensitz zu suchen ist.
Was wir als »Neues Schloß« kennen, lag höchstwahrscheinlich der Insel gerade gegenüber. Man mag es sich als eine bescheidene Wasserburg vorstellen; Spuren des Wallgrabens und einer Zugbrücke fanden sich noch 1818 beim Grundgraben zu dem heutigen Bauwerke.
[7]
Als Lehnsinhaber von Pillnitz begegnet uns bald nach Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts die Familie Karlowitz. Schon am 8. Mai 1420 wird »Frederich Karlewicz zcu Bilnicz gesessen« als Leibgedingevormund genannt. Sein Geschlecht ist damals im Elbgau und Meißner Hochland weithin begütert. Friedrich von Karlowitz besaß Pillnitz offenbar ungeteilt. Nach seinem Tode belehnte 1438 der Landesherr die Gebrüder »Bathe, Lawatzsch, Friderich, Jan, Otto, Jurge und Mulich von Karlowitz« mit »Bilnicz dorff und vorwerg« samt allem Zubehör sowie den Dörfern Zschachwitz, Dobritz, (Ober-)Poyritz, Zinsen auf der Wüstung Kloden (am Pillnitzer Tännicht gelegen) und zu Graupa, dem Dorfe Bonnewitz und einem Steinbruche mit der Fischerei unter Liebethal. Das wüste Kloden sollen die Karlowitze schon im folgenden Jahr an die Kreuzkirche zu Dresden veräußert haben. Als anderweitiges Zubehör von Pillnitz (Karlowitzischen Anteils) werden 1476 September 18. erwähnt: »die mol, der werd in der Elben mit der fachstat doran, eine freie schafftrifft doselbist (zu Pillnitz) und die leite, die Karis gewest.« Das ist das älteste schriftliche Zeugnis sowohl für die Pillnitzer Mühle wie für die Insel.
Von den obengenannten Brüdern hatten wenig später Friedrich und Otto den niederen Hof inne, Lawacz (Labaczsch) dagegen den Oberhof. Letzteren nimmt 1465 Friedrich Karlowitze (wohl der Sohn des Lawacz) zu Lehn, der ihn jedoch 1477 an Caspar Kundig (aus dem Geschlechte, nach dem die heutige Breite Straße in Dresden früher Kundigengasse genannt wurde) verkaufte. Dazu gehörten (manches wohl nur anteilig) »der wird (= Insel) in der Elben«. eine »vachstat (= Fischfang) in der Elben«, fünf Gärtner im Dorfe Pillnitz, das halbe Dorf Wachwitz (und zwar die Niederseite nach der Elbe zu) mit der Rehejagd u. a. m. Spätestens 1486 aber ist dieser Oberteil von Pillnitz mit dessen Unterhälfte wieder vereinigt worden.
Letztere war schon 1443 durch Friedrich und Otto von Karlowitz an Wygand und Nickel Ziegler (Angehörige des reichen Patriziergeschlechtes) verkauft worden. Schon bei diesem Anteil wird das »fach uff der Elben« erwähnt; desgleichen der Werder (die Insel). Ebenfalls 1443 erhält Ursula, Wygands Witwe, den »vorderen Sitz zu Bilnicz« als Leibgut, während 1445 ein anderer »Wigand Czigeler (vermutlich der Sohn des ersten) und Lawacz Carlewicz, bede zu Bilnicz« zusammen mit einem Ritterpferde unter der »Erbarmannschaft« der Pflege Dresden aufgezählt werden, weil sie (gemeinsam) »das vorwerg doselbst haben und darzcu vier schock geldis«.
1486 stehen, wie schon erwähnt, beide Hälften von Pillnitz in einer Hand. Am 6. November dieses Jahres wird abermals ein Wygand Ziegler mit beiden Anteilen belehnt. Als Lehnstücke gehörten damals zum Gute: das Dorf, die Insel, die Fachstatt in der Elbe und die Dörfer Krieschendorf und Borsberg.
Um jene Zeit (um 1500) hören wir zum ersten Male auch vom Gasthofe zu Pillnitz. Das Schankrecht war auch hier, wie meist in den Dörfern unserer Gegend, mit dem Erbgericht verbunden. Nun beschwert sich damals der Rat zu Pirna, der allzeit scharf auf seinem Privileg der Bannmeile bestand, [8]daß »der richter zcu Bilnicz (under Cristoff Czigeler) eyne meyle von Pirna gelegen, seyns junckherrn bier geschanckt« habe. Demnach scheint mit dem Pillnitzer Wirtschaftshof auch schon eine Brauerei verbunden gewesen zu sein.
1513 werden anläßlich einer Messestiftung im St. Afrakloster zu Meißen auch die Namen einiger Ortsbewohner genannt: Andreas Strausz, Georg Schmidt und Johann Weidicht heißen diese Pillnitzer Erzväter; 1529 wird auch ein Halbhüfner Johann Sauppe dortselbst erwähnt.
Von einem Weinberge, dem »hinderbergk sampt dem preszhaus« hören wir aus dem Lehnbriefe für Caspar Ziegler vom Jahre 1534.
Bald danach, 1538, wird uns eine Nachricht überliefert, die uns Heimatschutzfreunden, besonders den Botanikern der Abteilung C (Naturschutz) hochinteressant sein müßte, wenn sie – ohne Bedenken – auf die Pillnitzer Elbinsel bezogen werden dürfte. In jenem Jahre weilte, vom 18. bis 20. Mai, König Ferdinand zum Besuche Herzog Georgs in Dresden. Ein zeitgenössischer Bericht schildert seinen Einzug in Sachsen auf dem Elbstrom und die Festlichkeiten in der Residenz. Darin heißt es: Der König sei nach einem Nachtlager zu Pirna früh »auff das schyff geczogen und wider (weiter) nach Dreßten gefahren«; während der Fahrt seien »etliche fas mit schussen auf ein wert der mitten in der Elben leyt, (do es) sandick, ganz blos ist, gesetzt, die viel schusse gethan, da die schieff nohent voruber haben gehen mussen, darczu k. m. trommetter lostick geblasen haben.« (Ermisch, N. Archiv für sächsische Geschichte. III. S. 242.)
Wäre damit unsere Pillnitzer Naturschutzinsel gemeint, so müßte die Vorstellung, daß wir auf ihr noch einen von Menschenhand ungestörten, sich selbst verjüngenden Auenwald aus vorgeschichtlicher Zeit besäßen, eingeschränkt werden, weil dann der jetzige Pflanzenwuchs auf dem »ganz blosen, sandigcken werd« von 1538 erst aus späteren Tagen stammen dürfte und wohl gar der Unterstützung durch Menschenhand sein Dasein verdanken könnte. Allein damals gab es einen solchen »werder« auch bei Birkwitz vor der Müglitzmündung, der heute völlig verschwunden ist, den aber noch die große Landesaufnahme Mathias Öders um 1600 (Hauptstaatsarchiv Dresden. Blatt 180) verzeichnet. Wir haben also die Wahl, neigen uns aber gern nach der Seite derjenigen, die den ehemaligen Birkwitzer Werder als den Platz annehmen möchten, wo 1538 Salut geschossen wurde. Und in jedem Falle bleibt die Pillnitzer Insel ein Naturdenkmal, das unseres unentwegten Schutzes würdig ist.
Unter den Zieglern ist das Zubehör von Pillnitz vermehrt worden. Im Lehnbrief von 1514 stehen die von Hans Kundigen erkauften Güter und Dörfer Papperitz und Wachwitz; 1535 wurde von Wilhelm von Karlowitz Ober-Poyritz hinzuerworben, das ja schon früher einmal mit Pillnitz verbunden war. 1542 erlangte Caspar Ziegler gegen Abtretung der Reh- und Schweinejagd auf seinen Gehölzen von Herzog Moritz die Ober- und Niedergerichtsbarkeit auf seinem ganzen Besitztum. Caspar Ziegler starb am 27. April 1547 und wurde in der Frauenkirche zu Dresden begraben.
[9]
Aus seinem Todesjahre liegt uns die älteste statistische Angabe über Pillnitz vor. Der Ort hatte damals zwölf besessene (= ansässige) Männer, deren Grundbesitz auf zusammen drei Hufen geschätzt wurde, und sieben Gärtner. Auf den Dorfgenossen ruhten vielerlei Lasten. So mußten alle, ausgenommen der Müller (von dem wir also wieder einmal hören), auf die Hasenjagd gehen, wobei sie allerdings für jeden Hasen einen Groschen bekamen; gefangene Füchse durften sie selbst verkaufen. Sie mußten für den Gutsherrn ferner Heu dörren, Flachs jäten, raufen, riffeln und brechen, Mist breiten, Kraut stecken, Schafe waschen (d. h. sie ein- oder zweimal des Jahres baden), den Weinberg lesen helfen, Weinpfähle ausziehen, Hafer rechen usw.
Der letzte Ziegler auf Pillnitz war Christoph Ziegler. Er verkaufte das Gut samt allem Zubehör an Christoph von Losz, der die Lehen darüber am 18. März 1569 empfing. Auf dessen Schultern ruhten viele Würden. Er war des heiligen römischen Reiches Pfennigmeister, Oberschenk des Kurfürsten Christian I., später Chef der Haushaltung der Kurfürstin Mutter und Geheimer Rat.
Schon unter ihm haben einmal (1578) Verhandlungen über den Ankauf von Pillnitz durch den Landesherrn geschwebt. Man kam aber zu keiner Einigung, vermutlich weil die Ansichten über den Wert des Gutes zu sehr auseinandergingen. Christoph von Losz veranschlagte ihn auf 25 734 fl. 13 Groschen 9 Pfennige, während die kurfürstliche Rentkammer Pillnitz nur auf 14 445 fl. 14 Groschen 1 Pfennig schätzte.
Diese Wertanschläge enthalten nun auch die erste Nachricht über die Schloßgebäude. Losz selber sagt: »Die Gebäude seind ziemlich, doch zu einer Bewohnung nottdurftig angerichtet, wie im Augenschein vorhanden,« und er berechnet sie samt Scheunen und Ställen auf 1000 Gulden. Die kurfürstlichen Kommissare dagegen bemerken: »Die Gebäude sind gar geringe und über fünfhundert Gulden nicht würdig.«
Wie schon gesagt, der Handel zerschlug sich, und Christoph von Losz vergrößerte nun in den folgenden Jahren sein Besitztum durch den Ankauf weiterer Dörfer und Rechte. Zuletzt (1607) schenkte ihm der Kurfürst noch die Dörfer Wünschendorf und Bonnewitz.
Neue Unterhandlungen der Kammer wegen Erwerbung von Pillnitz für Herzog Johann Georg zeitigten wiederum kein Ergebnis.
Unterdessen hatte Christoph von Losz mancherlei bauliche Veränderungen an seinem Rittersitze vorgenommen; die Tradition nennt besonders einen zweiten Turm an der nach Abend zu gelegenen Hauptfront, sowie den gegen Mittag gekehrten Seitenflügel.
Am bedeutsamsten war aber sein von Erfolg gekröntes Bemühen, die kirchlichen Verhältnisse seines Besitztums neu zu ordnen. Bis zur Einführung der Reformation hatte Pillnitz zu der großen Kirchfahrt Dohna gehört, deren Mittelpunkt aber doch so weit von Pillnitz entfernt lag, daß sich daraus allerhand Unzuträglichkeiten ergaben, allein schon wegen des zur Winterszeit oft unmöglichen Verkehrs über den Elbstrom. Deshalb wurden 1539 Rittergut [10]und Dorf Pillnitz samt Ober-Poyritz und Söbrigen zur Pfarre in Hosterwitz geschlagen. Streitigkeiten mit dem dortigen Geistlichen wegen Unterhaltung der kirchlichen Gebäude riefen in Christoph von Losz den Plan hervor, eine eigene Kirche und Pfarrwohnung in Pillnitz zu schaffen. Nach mancherlei Verhandlungen wurde am 8. Mai 1593 der Grundstein zur Schloßkirche gelegt; im April 1597 war der Bau vollendet, und der hochangesehene Superintendent Polycarp Leyser vollzog am Sonntag Jubilate (17. April) seine Einweihung, während am Montag darauf der neuernannte Schloßprediger Magister Jacob Daniel Starke seine Antrittspredigt hielt.
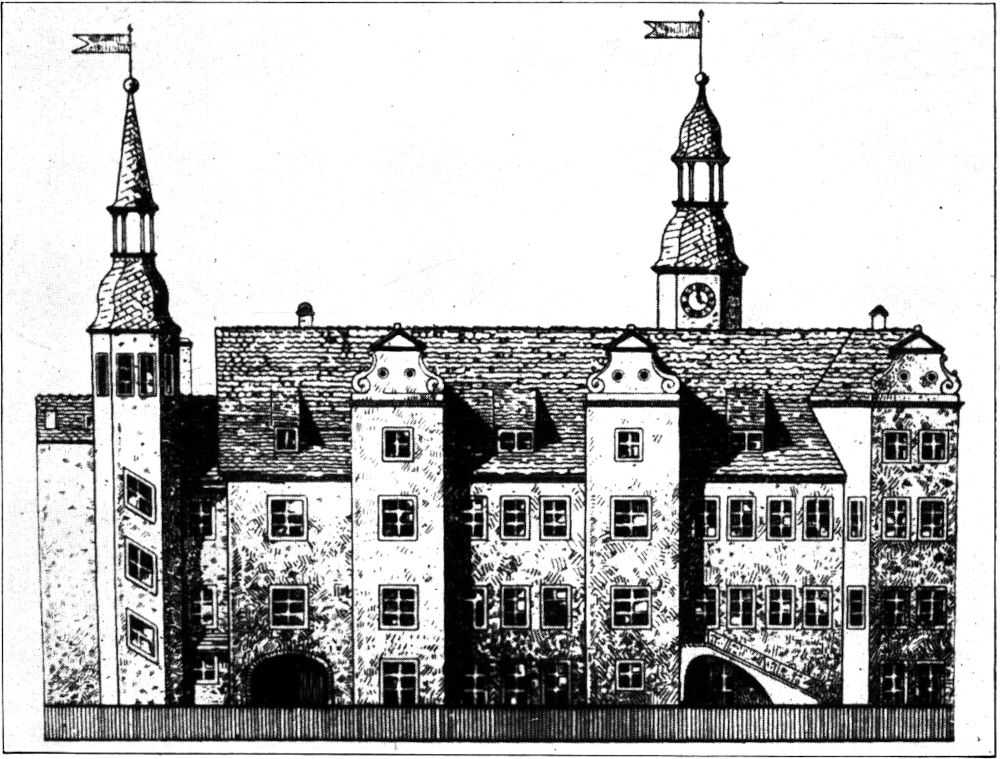
Zu dem Vorhaben des von Losz: »nicht allein eine neue Kirche zu Pillnicz zu erbauen, sondern auch einen Pfarrherrn und Schulmeister dahin zu verordnen,« hatte schon 1595 die Kurfürstinwitwe Sophie geborene Markgräfin von Brandenburg 500 fl. Beisteuer bewilligt, was vielleicht die Vermutung rechtfertigt, daß der sächsische Hof seine Absicht auf Erwerb des Gutes noch immer festhielt. Tatsächlich bot der Kurfürst 1608 das Amt Senftenberg zum Tausch gegen Pillnitz an. Letzteres war dabei auf 59 345 Gulden geschätzt worden. Auch diesmal kam der Handel nicht zustande. Übrigens hat dieser Widerstand gegen die Wünsche des Hofes weder dem Christoph von Losz noch seinem Erben die Gunst des Kurfürsten gemindert, da beide auch weiterhin mit allerhand Gnadenbeweisen bedacht wurden.
Zu jener Zeit sah Pillnitz schon einmal, wohl zum ersten Male, eine große Hofgesellschaft. 1607 weilte nämlich Kaiser Matthias zu Besuch in Dresden, und Johann Georg I. veranstaltete ihm zu Ehren eine Jagd am Oberen Hasengehege [11]bei Pillnitz, der von Losz aber bewirtete die hohen Gäste in seinem damals schon vielgerühmten herrlichen Lustgarten (Dresdner Geschichtsblätter Band V. Jahrgang XVIII, S. 27).
Am 4. April 1609 starb Christoph von Losz und wurde in seiner neuerbauten Schloßkirche beigesetzt. Sein Sohn Joachim folgte ihm nach einem (1610 abgeschlossenen) Erbvergleich mit seinen Brüdern als Besitzer von Pillnitz. Von seinen Maßnahmen als Gutsherr sei hier nur hervorgehoben, daß er die Schenke zu Pillnitz nebst der dazu gehörigen Hufe Landes von Georg Ramisch kaufte und daß er im Jahre 1624 (Februar 22.) die landesherrliche Begnadung erlangte, über seine Güter (Lehngüter) Pillnitz, Graupe und Jessen nebst allen Zubehörungen »libere wie mit erb- und eigentümlichen Gütern« zu verfahren. Joachim von Losz war ein umsichtiger Geschäftsmann, der seinem kurfürstlichen Herrn in manchen Finanzangelegenheiten einer geldarmen Zeit wertvolle Dienste leistete. Seinen Untertanen gegenüber erwies er sich jedoch als ein harter und strenger Mann. Die Volkssage, die oft das Volksgericht ist, läßt den »bösen Losz« darum noch heute zuweilen als schwarzen Hund bellend und heulend auf dem Hofe zu Pillnitz erscheinen.
1633, am 5. Oktober, war er aus dem Leben geschieden. Nur drei unmündige Töchter standen an seiner Bahre. Auf die älteste, Sophie Sibylle, kam infolge der Erbteilung vom 13. Juni 1636 das Rittergut mit den Dörfern Pillnitz, Borsberg, Papperitz, Krieschendorf, Ober-Poyritz, Söbrigen und Hosterwitz nebst den beiden Vorwerken zu Ober-Poyritz und allen Zugehörungen. Der Wert dieses Erbteils betrug 92 102 Gulden 16 Groschen 3 Pfennige. Im November desselben Jahres vermählte sich Sophie Sibylle mit Günther von Bünau aus dem Hause Tetschen, starb aber schon nach kaum vierjähriger Ehe (6. Oktober 1640). Ihr letzter Wille setzte den Gatten als Herrn von Pillnitz ein. Wenige Wochen später mußte dieser der Kriegsunruhen halber »Schiff, Kahn und Gefäße« aus Pillnitz nach Dresden in Sicherheit bringen. Am 17. April 1643 aber wurde Günther von Bünau mit dem Gute feierlich belehnt. Als er 1659 die Augen für immer schloß, blieb es zunächst längere Zeit im gemeinsamen Erbe seiner zwei Söhne aus verschiedenen Ehen, bis 1681 Heinrich von Bünau, der Sohn der ersten Gattin Christine Elisabeth Löser, durch Vergleich den Anteil seines Stiefbruders Rudolph ebenfalls erwarb.
Wieder einmal taucht die Schenke zu Pillnitz in der Überlieferung auf. Ihr Inhaber, Johann Weißkopf, kauft 1687 ein Bauerngut in Hosterwitz. (Dresdner Geschichtsbl. Jahrgang XVIII, Seite 50.)
Unter Heinrich von Bünau gelangt nun endlich – 116 Jahre nach dem ersten Versuch es zu erwerben – Pillnitz in kurfürstliche Hand.
Es kam nach längeren Verhandlungen am 31. Januar 1694 zu einem Vertrage, laut dessen Kurfürst Johann Georg IV. Pillnitz gegen Schloß und Amt Lichtenwalde sowie eine Barsumme von 20 000 Gulden eintauschte. Der Gesamtwert des Schlosses am Elbstrome war dabei nach Abzug der Lasten auf 72 895 Gulden 18 Groschen 1 Pfennig veranschlagt worden.
[12]
Sehr rasch erkannte man im Lande, welche Absicht der Kurfürst mit Pillnitz gehabt hatte. Am 24. Februar 1694 schenkte er den kostbaren Besitz seiner Geliebten, der Gräfin Sibylle von Rochlitz, geborenen von Neitschütz. Es kam darüber (am 6. März) zu einem »unerhörten und gefärlichen rencontre mit der Gemahlin« des Kurfürsten, die dieser zu erstechen drohte; in seinem Wutanfall wäre es wohl zu einer solchen Freveltat gekommen, wenn nicht sein starker Bruder, Herzog Friedrich August, dazwischen getreten wäre, der ihm »drei Degen nacheinander aus der Hand gerissen«. (Vgl. Haake, August der Starke im Urteil seiner Zeit. Dresden 1922. Seite 14.) Man weiß, wie bald jener Liebestaumel sein Ende fand. Schon im April desselben Jahres starb die schöne Buhlerin an den Blattern und riß den verblendeten Liebhaber mit sich in das Grab. Ihr Nachlaß wurde beschlagnahmt; die Familie Neitschütz und ihr Anhang in einen peinlichen Prozeß verwickelt. Pillnitz nahm der Regierungsnachfolger Friedrich August (nachmals der Starke genannt) wieder zurück und ließ es durch die Kammer an Wolf Rudolph von Carlowitz verpachten. Im Jahre 1701 betrug die Pachtsumme für das Vorwerk 2300 fl. jährlich. Aber August der Starke brauchte, um seine Pläne auf die polnische Königskrone zu verfolgen, gewaltige Summen, und diesem Bedürfnisse mußte nun anscheinend auch Pillnitz dienen. So verpfändete es der Fürst schon am 12. Juni 1697 seiner Mutter Anna Sophie für 30 000 rh. fl., wobei noch besonders betont wurde, daß Pillnitz kein der Kammer einverleibtes Domanialgut sei, sondern des Kurfürsten ererbtes Allodialeigentum.
Nach seiner Erwählung zum König von Polen löste August der Starke Pillnitz 1702 wieder ein, indem er seiner Mutter statt dessen das Ostravorwerk einräumte. Pillnitz selbst aber verkaufte der Landesherr am 11. Juli dieses Jahres um 60 000 Meißn. fl. an die sehr wohlhabende Witwe Anna Sophie von Einsiedel, deren Mann der Oberhofmeister der Kurfürstin-Mutter gewesen war. Letztere nahm am 1. August 1706 das Gut um 52 500 Taler zurück, und schon am 12. Oktober 1707 gab sie es wiederum für 60 000 Taler in die Hand des Kurfürsten-Königs.
Es handelt sich hier seit 1697 offenbar um eine Reihe von Scheinkäufen, deren Zweck nicht mehr recht durchsichtig ist. Dagegen zeigt sich bald sehr deutlich, welcher Absicht der letzte Handel dienen sollte. Zum zweiten Male legte ein Wettiner das schöne Besitztum einer Gunstdame in den Schoß. Gräfin Anna Constantia von Cosel war die Empfängerin. Der Öffentlichkeit gegenüber ward die Schenkung in einen Kaufkontrakt gekleidet, der am 21. November 1707 abgeschlossen wurde und einen Kaufpreis von 60 000 Talern angab. Wahrscheinlich ist die eigentliche Schenkung schon im Jahre vorher erfolgt und nur durch die kriegerischen Ereignisse von 1706 und vor allem durch den im Herbst dieses Jahres erfolgten Einfall der Schweden in Sachsen die formelle Übergabe verzögert worden.
Welchen Einfluß die Cosel auf die äußere Gestaltung von Pillnitz ausgeübt hat, entzieht sich unserer Kenntnis; nachwirkend scheint er nicht gewesen [13]zu sein. Ihre Biographen schildern diese Frau als »habsüchtig, eigennützig und geizig,« und die gewaltigen Summen, die ihr fürstlicher Gönner für den Glanz ihres Auftretens opferte, sind offenbar an andere Güter und Paläste gewendet worden. Denn die eigentliche Baugeschichte von Pillnitz unter dem genialen Fürsten setzt erst nach der Verbannung der Favoritin vom Hof und aus dem Herzen des Königs ein. Zweifelsohne hat aber das Schloß zu Zeiten der Cosel manches glänzende Fest in seinen Räumen, auf dem Strome und der Insel und in dem ausgedehnten Parke gesehen. August der Starke verbrachte den Sommer 1708 zumeist in Pillnitz bei der Geliebten; von hier aus unternahmen beide am 16. Juli einen Ausflug nach Stolpen, das wenige Jahre später ihr Gefängnis und zuletzt ihr Sterbeplatz werden sollte, und von hier aus trat am 30. Juli 1708 der König jene Reise nach den Niederlanden an, die er in einem Schreiben an seine Kabinettminister bezeichnete als »un voyage de plaisir pour me désennuyer des chagrins, que je supporte pendant un certain temps« (v. Weber, Arch. f. Sächs. Gesch. IX, 19).
In Pillnitz saß Gräfin Cosel auch noch in den Jahren 1713 und 1714, als ihr Liebes- und Herrschaftstraum in Sachsen seinem Ende entgegenging: Pläne brütend, wie sie »die verlorene Gunst des Königs wieder erlangen, die verhaßte Nebenbuhlerin (Gräfin Dönhoff) verdrängen und an ihren Feinden Rache nehmen« könne. Wie einst die Generalin von Neitschütz (die Mutter der schönen Sibylle, der Cosel Vorgängerin als Schloßfrau in Pillnitz) versuchte sie dabei Mittel, die nur der blinde Aberglaube jener Tage für wirksam halten konnte. So ließ sie damals wiederholt Zigeunerweiber nach Pillnitz kommen, mit denen sie im Ofen ihrer Silberkammer geheimnisvolle Droguen braute; einen Schiffsmann im Dorfe beauftragte sie, einen klugen Mann in Böhmen aufzusuchen, dem sie viel Geld in Aussicht stellte, wenn er ihr die Liebe des Königs wieder zuwege bringen könne; den Wagner Georg Krausze in Pillnitz bewog sie 1714, ihr in der Nacht einen Totenkopf vom Kirchhof in Klotzsche zu holen, speiste ihn freilich statt der zugesagten hohen Belohnung mit nur einem Groschen ab; anderer Sinnlosigkeiten nicht zu gedenken. Vielleicht hätte ihr ein würdiges, maßvolles Auftreten, wenn auch nicht die Liebe des Herrschers zurückgewonnen, so doch seine Achtung gesichert. Ihr Starrsinn aber trieb sie dem bitteren Ende entgegen. Am 12. Dezember 1715 entfernte sich die Cosel heimlich aus Pillnitz; nur ihren dreijährigen Sohn ließ sie dort zurück. Über Berlin, Halle, Nossen führte ihr Leidensweg nach Stolpen.

In der ersten Zeit ihrer Haft wurde Pillnitz noch durch den Verwalter der Cosel administriert; dann unterband man ihre geheime Verbindung mit diesem. Der König aber beschloß am 14. April 1718, Pillnitz wieder an sich zu nehmen, allerdings unter Berücksichtigung der Rechtsansprüche der Cosel. Man bot ihr einen Tausch gegen Lohmen oder Zabeltitz an; da sie jedoch darauf nicht einging und hartnäckig 5000 Taler jährlich oder eine Abstandssumme von 80 000 Talern verlangte, so wurde ihr schließlich durch Reskript vom 21. Juli 1729 der Betrag der jährlichen Einkünfte des Gutes, den man mit 3206 Talern 15 Groschen 9½ Pfennig ermittelt hatte, auf Lebenszeit ausgesetzt. [15]Später wurde der Kaufpreis ihrem Sohne, dem General Friedrich August Graf Cosel, vergütet.
So ist denn Pillnitz vom Jahre 1718 an genau zweihundert Jahre lang ohne Unterbrechung im Besitze des Königshauses geblieben.

Nun entfaltete hier August der Starke seine hochfliegenden Pläne als Baumeister. Auch in Pillnitz wirkten in seinem Sinne seine Meisterarchitekten Pöppelmann und Longuelune und deren erprobte Gehilfen. Die Bauleitung wurde dem in solcher Tätigkeit wohl bewährten General Grafen Wackerbarth übertragen. Eine Darstellung der Baugeschichte in allen ihren Einzelheiten kann nicht unsere Aufgabe sein. Wir verweisen auf die mit Plänen und Ansichten reich ausgestatteten Arbeiten von A. v. Minckwitz und Cornelius Gurlitt. Die Bautätigkeit begann mit dem Abbruch der Schloßkirche. Das neue Gotteshaus wurde 1723 bis 1725 an der Weinbergslehne errichtet; zu seiner Ausstattung dienten Einrichtungsgegenstände des älteren Gebäudes. Noch heute sind in der »Weinbergskirche« die schönen Grabdenkmäler einiger Mitglieder der Familien Losz und Bünau zu sehen. 1925 beging die Gemeinde Pillnitz das zweihundertjährige Jubiläum ihres Gotteshauses, das am 11. November 1725 eingeweiht worden war. 1720 bis 1721 entstand auch das sogenannte Wasserpalais, das damals als orientalisches oder indianisches Lustgebäude bezeichnet wurde. Es ist jenes noch heute von allen Dampfschiffreisenden [16]angestaunte Bauwerk in einem pseudo-ostasiatischen Stil mit der großartigen Hafentreppe. An ihr schaukelten sich einstmals, freilich erst seit 1744 nachweisbar, die künstlerisch ausgestatteten Gondeln mit ihren bunt gekleideten Führern; mit dem Weggange der fürstlichen Herrschaften von Pillnitz sind sie wohl für immer verschwunden. Dagegen grüßt uns an der Elbseite noch einer der wenigen Überreste aus dem älteren Schlosse, nämlich jener Sandsteinobelisk aus der Zeit um 1650, der mit einem verlorengegangenen zweiten Obelisken einst vor der Ostfront des Loszschen Bauwerks stand und nach dem Brande von 1818 auf den »Löwenkopf«, den Unterbau eines früheren Lusthauses an der Elbe, gebracht wurde, der seinen Namen von einem an der Stromseite in das Mauerwerk eingelassenen Löwenhaupte, auch aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, bekommen hat. 1722 und 1723 wurde auf der nördlichen Seite des Lustgartens, symmetrisch zum Wasserpalais und ebenfalls im chinesischen Stil, das Bergpalais errichtet.

An den Bau beider Palais schloß sich 1723 der des Venustempels an, der als großer Speisesaal diente. Seinen Namen verdankt er einer Galerie weiblicher Schönheiten, namentlich vom Hofe des fürstlichen Bauherrn selbst, die den mächtigen achteckigen Saal schmückten.
Heute sind die Wände, ach, so kahl; denn auch gemalte Schönheit vergeht. Viele Porträts sind beim Brande von 1818 verlorengegangen; manche wurden schon 1791 nach Dresden gebracht; andere befinden sich noch im Wasserpalais.
[17]
Von der inneren Einrichtung des neuen Schlosses wie des zweiten Neubaues vor hundert Jahren brauchen wir hier nicht zu sprechen, da ihrer in einem Parallelaufsatz eines hervorragenden Kunstschriftstellers später gedacht wird.
Gleichzeitig mit den vorhin genannten Bauten entstanden vielerlei Nebengebäude, die zum Teil wirtschaftlichen Zwecken oder als Wohnhäuser für Beamte dienten. Hervorgehoben sei die Schloßwache für das seit 1723 hierher verlegte Wachkommando. Das Gebäude ist 1824 vollständig umgestaltet worden. – Unter August dem Starken erlebte auch der Pillnitzer Schloßgarten eine neue Blütezeit. Da seine Entwicklung ebenfalls demnächst in den Mitteilungen von berufener Feder geschildert wird, erübrigt sich hier eine besondere Darstellung.
Ein südöstlicher Anbau am Venustempel wurde 1724 als katholische Kapelle geweiht, die nach unerwiesener Tradition früher ein Altarbild von Lukas Cranach enthalten haben soll. Um jene Zeit ist wohl auch die Schloßrestauration entstanden; jedenfalls wird sie 1724 in Akten zum ersten Male erwähnt. In dem Gebäude hatten auch der Hoftraiteur und der Hofmundbäcker ihren Sitz; nachdem die Hofmundbäckerei 1876 aufgehoben worden war, wurde die Schloßapotheke hierher verlegt.
Den kostbaren Rahmen, den August der Starke hier in Pillnitz geschaffen hatte, füllten nun immer neue Bilder rauschenden Hoflebens. Oberstaatsarchivar Dr. H. Beschorner hat einen solchen Pillnitzer Festmonat auf Grund der Akten geschildert (Über Berg und Tal. Bd. VII, Seite 430). Es handelt sich um die Hochzeitsfeier der Gräfin Augusta Constantia von Cosel, der ältesten Tochter des Kurfürsten-Königs von seiner in Stolpen schmachtenden Geliebten, mit dem Ober-Falkenmeister Heinrich Friedrich Grafen von Friesen, die der fürstliche Brautvater höchst persönlich ausrüstete. Vom 3. bis 22. Juni 1725 dauerten die Lustbarkeiten, die aus Festtafeln und -bällen, Bauernkomödien im sogenannten Französischen Dorf zu beiden Seiten der Maillebahn, Vogel- und Scheibenschießen, Zigeuner- und Drescheraufzügen, Tauben- und Fasanenjagden, Ringrennen, einem Ausfluge nach dem Königstein und einem Schlußfeuerwerk für 795 Taler 19 Groschen bestanden. August der Starke verband aber in seiner originellen Art damit auch eine fortifikatorische Übung großen Stiles, die zwar zur Erheiterung der Hochzeitsgäste manchen humoristischen Einschlag bekam, der aber doch ein ernster militärischer Zweck zu Grunde lag, wozu starke Aufgebote von Infanterie und Artillerie unter Mitwirkung einer Stromflotte viele Tage lang um ein dazu besonders errichtetes Festungswerk auf dem linken Elbufer, Pillnitz gerade gegenüber, und um die Insel ringen mußten. Dieses Pillnitzer Manöver von 1725 ist somit als ein Vorläufer des fünf Jahre später folgenden berühmten Zeithainer Lagers anzusehen.
Bekanntlich starb August der Starke 1733. Die Beziehungen seines Sohnes zu Pillnitz scheinen nur oberflächlicher Art gewesen zu sein.
Seit 1765 aber benutzte die kurfürstliche Familie Pillnitz vielfach als Sommeraufenthalt, weshalb das Schloß durch weitere Anbauten, namentlich [18]durch die noch jetzt stehenden Flügelgebäude am Bergpalais (1788) und am Wasserpalais (1789 und 1791) ansehnlich erweitert wurde. Der westliche Flügel führte später den Namen Kaiserflügel (Kaiser Leopold weilte 1791 hier als Gast), der östliche den Namen Königsflügel (er beherbergte gleichzeitig den König Friedrich Wilhelm von Preußen). Der bei all diesen Arbeiten tätige Architekt scheint der Oberlandbaumeister Chr. Fr. Exner gewesen zu sein. In jene Bauperiode fallen auch die Errichtung des sogenannten Chinesischen Pavillons im Baumgarten hinter der Orangerie und die Erschließung des Friedrichsgrundes durch Anlegung von Wegen, Schmuckplätzen und Wasserfällen (1780 bis 1783), sowie der Bau der künstlichen Ruine (1785) am Ausgang dieses Grundes.
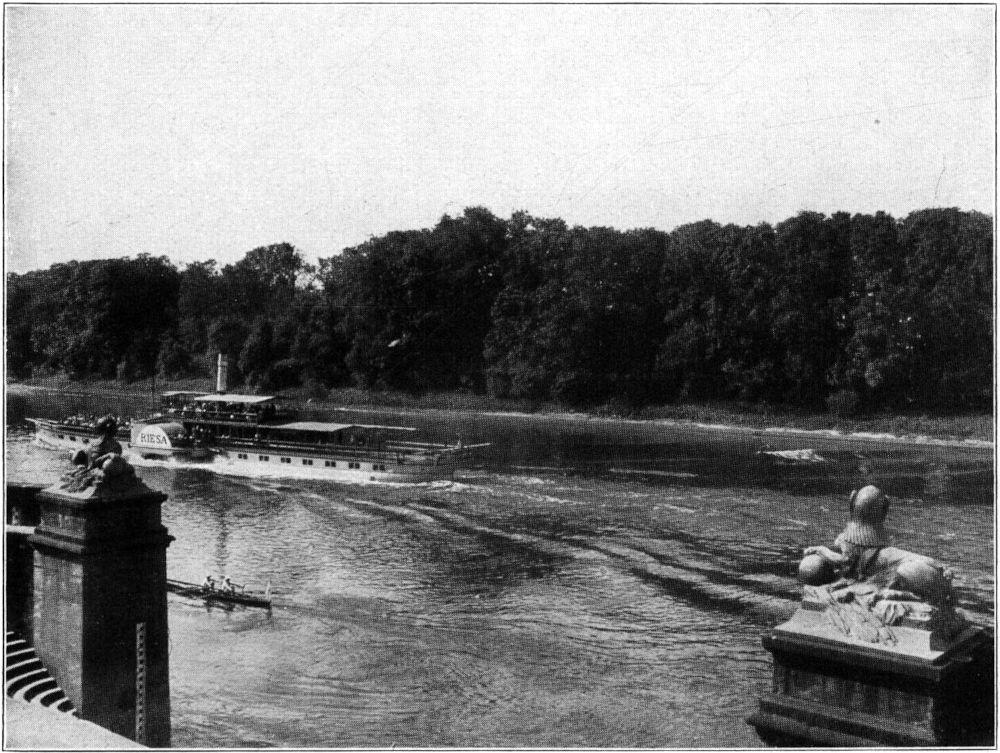
Endlich hängt mit der Erhebung von Pillnitz zum ständigen Sommersitz des Hofes auch die dauernde Einrichtung der fliegenden Fähre im Jahre 1765 zusammen. Von einer älteren »fliegenden Brücke« hören wir zuerst 1727. Es ist aber ein Irrtum des Pillnitzer Chronisten A. v. Minckwitz, wenn er (S. 77 seiner Geschichte von Pillnitz) die »vachstat« von 1443 (s. o.) als eine Fähre deutet; man hat darunter vielmehr eine aus Steinen, Holz und Flechtwerk durch den Strom gezogene Mauer zu verstehen, die dem Fischfang diente.
Im Jahre 1834 wurde den zur Dienstleistung auf der Fähre kommandierten Pontonniers gleichzeitig mit dem zur Bewachung von Pillnitz bestimmten [19]Kommando der Leibgrenadiergarde das Pillnitz gegenübergelegene Jagdhaus zum Unterkommen überwiesen und im Jahre 1860 für dieselben eine besondere Kaserne am linken Elbufer hergestellt.
Das einfach stille Leben, das der sächsische Hof hier in Pillnitz führte, ward nun im Sommer 1791 durch jene Fürstenzusammenkunft unterbrochen, die damals die Augen von ganz Europa auf sich zog und deren Ergebnis als Pillnitzer Deklaration in den Tafeln der Weltgeschichte steht.
In den Tagen vom 25. bis 27. August trafen sich hier Kaiser Leopold II., König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und der Graf von Artois (der spätere König Karl X. von Frankreich) als Gäste des Kurfürsten August III. Der Gedanke dieser Fürstenzusammenkunft war vom Kaiser ausgegangen; Graf Marcolini, der Vertraute des Kurfürsten, hatte ihn eifrig gefördert. Zunächst bezweckte man durch eine persönliche Aussprache der Herrscher die seit den Schlesischen Kriegen noch bestehende Spannung zwischen den Höfen von Wien und Berlin zu beseitigen; ferner wollte man die polnische Erbfolgefrage, die damals die politische Welt bewegte, durch freundschaftliche Besprechung lösen, wobei die Person des Kurfürsten im Mittelpunkte stand, da diesem vom polnischen Reichstage die Königskrone angeboten worden war; endlich hoffte der Kaiser, den von ihm angeregten Bund der europäischen Mächte zur Beruhigung Frankreichs und zur kraftvollen Wiederherstellung der Monarchie ins Leben zu rufen.
Mehr als Eindringlinge denn als erwünschte Gäste nahmen die französischen Emigranten, unter denen der übelberüchtigte Herr von Calonne hervortrat, an der Zusammenkunft teil. Aus den Verhandlungen zwischen den beiden mächtigsten Fürsten Deutschlands und dem Grafen von Artois ging jene Erklärung hervor, die nachmals als Pillnitzer Deklaration so berühmt geworden ist. Ihr Hauptinhalt war folgender:
»Die Fürsten bezeichnen die augenblickliche Lage des Königs von Frankreich als einen Gegenstand der allgemeinen Teilnahme und sprechen die Hoffnung aus, daß das Interesse von denjenigen Mächten nicht verkannt werde, deren Beistand man anrufe. Man erwartet von ihnen, daß sie nicht anstehen werden, im Verein mit Österreich und Preußen nach Maßgabe ihrer Kräfte ausreichende Mittel anzuwenden, um den König von Frankreich in die Lage zu versetzen, in vollkommener Freiheit die Grundlage einer Regierungsform zu befestigen, welche den Rechten der Souveräne und dem Wohle Frankreichs entspräche. Der Kaiser und der König seien in diesem Falle entschlossen, im wechselseitigen Einvernehmen rasch vorzugehen und mit den notwendigen Mitteln das vorgesteckte Ziel anzustreben. Mittlerweile werden sie ihren Truppen die nötigen Befehle erteilen, durch welche sie in den Stand kommen, sich in Bewegung zu setzen.« Der Wunsch des Grafen Artois, daß die Monarchen sofort einen Winterfeldzug gegen Frankreich unternehmen sollten, wurde nicht erfüllt. Trotzdem hat man später die Pillnitzer Deklaration als eine Art Kriegserklärung gegen Frankreich aufgefaßt, und sie erregte dort eine gewaltige [20]Empörung. (Nach P. Rachel in den Dresdner Geschichtsblättern, XX. Jahrgang, Nr. 1 und 2.)
Die Pillnitzer Verhandlungen wurden umrahmt und halb verdeckt durch allerhand rauschende Festlichkeiten: prunkvolle Tafeln und Opernspiele, feenhafte Beleuchtung des inneren Schloßhofes und der schönen Alleen mit 45 000 oder gar 60 000 Lampen und ein prächtiges Feuerwerk auf der Insel, zu dem nicht nur aus Dresden gewaltige Menschenmengen sondern auch Neugierige aus Leipzig (allein 300 Studenten), Dessau, Berlin, Prag und Wien herbeigeströmt waren. Aber wie dieses pyrotechnische Spiel, so verpuffte rasch auch das Spiel der Pillnitzer Diplomatie. »Eine ehrliche innere Annäherung Preußens und Österreichs ist nicht erfolgt; der Kurfürst von Sachsen hat die polnische Krone nicht angenommen; der europäische Verein, der sich gegen die demokratischen Umtriebe bilden sollte, ist nicht zustande gekommen. Vielmehr ist der Gedanke, irgend etwas für die Wiederherstellung der alten Verhältnisse in Frankreich zu tun, sehr bald fallen gelassen worden, als sich Ludwig XVI. noch im September 1791 entschlossen hatte, die seit 1789 beratene Verfassung anzunehmen.
Wohl aber ist aus der Anwesenheit des Grafen Artois in Dresden und Pillnitz und aus der Pillnitzer Deklaration die Auffassung entstanden, als wenn damals die erste Koalition der europäischen Mächte zum Angriff gegen die französische Revolution gestiftet worden sei.« (Rachel, a. a. O.)
Die Erinnerung an den glänzenden Rahmen der Pillnitzer Fürstenzusammenkunft ist im Lande und besonders in der Dresdner Bürgerschaft noch lange lebendig geblieben, und der einst viel gelesene und in manchen Kreisen selbst heute noch beliebte Jugendschriftsteller Gustav Nieritz schildert das Riesenfeuerwerk recht anschaulich im letzten Kapitel seiner Erzählung: Der Johannistopf.
Ein noch gewaltigeres Feuerwerk entzündete sich zur Mittagsstunde des 1. Mai 1818, dem alles, was noch vom alten Schloß erhalten war, dazu auch der Venustempel, innerhalb weniger Stunden zum Opfer fiel. Nachmittags einhalb drei Uhr stürzte der Schloßturm zusammen. Als Ursache der Feuersbrunst wurde Fahrlässigkeit bei einer Essenreparatur angesehen. Gerade hatte der Hof nach Pillnitz übersiedeln wollen. Schon am folgenden Tage boten die eben zu Dresden versammelten Landstände ihrem geliebten Fürsten 60 000 Taler zum Wiederaufbau des Schlosses an, und nachdem die Abräumungsarbeiten alsbald in Angriff genommen worden waren, konnte schon am 29. Oktober 1818 der Grundstein zum Neubau gelegt werden. Im Herbst 1822 war der Mittelbau, der den großen Speisesaal enthält, vollendet; 1822 und 1823 entstand der Küchenflügel, der seine Front dem Elbstrome zuwendet; erst 1826 ward der gegenüberliegende Kapellenflügel fertig gestellt. Die Einweihung der Kapelle erfolgte sogar erst 1830. Oberlandbaumeister Christian Friedrich Schuricht war der leitende Architekt.
Seit jener Zeit sind wesentliche Um- und Neubauten beim Schlosse nicht mehr vorgenommen worden.
[21]
Dagegen erfuhr der Wirtschaftsbetrieb bald nachher einen Wandel. 1832 begann nämlich die Ablösung der Grunddienstbarkeiten, Naturalzinsen und Geldgefälle der Gutsuntertanen, die erst 1846 zum Abschluß gelangten. Das Kgl. Kammergut erhielt dabei insgesamt 91 235 Mark als Entschädigung.
Pillnitz blieb auch ferner die bevorzugte Sommerresidenz der Wettiner, und zwei derselben haben in seinen Mauern ihre Augen zum letzten Schlafe geschlossen. Am 29. Oktober 1873 erlöste hier ein sanfter Tod König Johann, den Danteforscher, von seinem schweren Herzübel. Am Abend des 30. Oktober wurde der allverehrte Tote auf einem schwarz ausgeschlagenen, mit Fackeln erleuchteten Dampfer unter dem Geläute der Glocken nach Dresden gebracht. Und ein Menschenalter später, wieder an einem Herbsttage, trugen die Wellen des Elbstromes abermals die sterblichen Überreste eines Sachsenherrschers zu seiner Gruftkammer unter der katholischen Hofkirche. König Georg war in der Nacht vom 14. zum 15. Oktober 1904 in Pillnitz verstorben.
Von den Fürsten, die gern hier weilten, sei noch Friedrich Augusts II. (1836 bis 1854) gedacht, des Botanikers, dem der Schloßgarten und die Gewächshäuser manches seltene Stück verdanken. Doch ist als der eigentliche Gründer der botanischen Anlagen Friedrich August der Gerechte anzusehen. Seit der Umwälzung von 1918 ist Pillnitz in das Eigentum des Staates übergegangen. Eine Zeitlang schien es, als ob das Schloß industriellen und Wohnzwecken dienstbar gemacht werden, der herrliche Park aber aufgelassen werden sollte. So wünschenswert jede Lösung unserer gegenwärtigen Wohnungsnot sein muß, der nur bescheidene Erfolg hätte in keinem Verhältnis zu dem Verluste gestanden, den wir und die Nachwelt erlitten hätten, wenn diese bau- und gartenkünstlerisch hervorragende und auch historisch bedeutsame Stätte der Allgemeinheit entzogen worden wäre. Dem wiederholt aufgetauchten Plane, die Geleise der Elektrischen durch den Park von Pillnitz hindurchzuführen, ist unser Verein bisher noch immer mit Erfolg entgegengetreten. Zwar hat ein für Sachsen neuer Gewerbebetrieb, eine Teppichweberei, Unterkunft in einem Nebenraume des Schlosses gefunden; sie ist aber bisher nicht störend empfunden worden, und die »Höhere Staatslehranstalt für Gartenbau«, die im alten Marstallgebäude ihren Sitz aufgeschlagen hat, fügt sich sehr passend zu dem Pillnitzer Schloßgarten und zu der ganzen Landschaft.
Durch den noch immer wohlgepflegten Park aber lustwandelt heute die erholungsbedürftige, schönheitsfreudige Volksmenge, und viele der Besucher pilgern auch durch die Schloßräume und lassen die historischen Erinnerungen, die aus den Sälen und Kabinetten, in Ausstattungsstücken und Bildern vor ihre Seele treten, auf sich wirken – falls ihnen der eilige Führer Zeit zur Betrachtung gewährt und gedankenlose Mitläufer ihr Schwatzen und Kichern einstellen. Und in der Schloßwirtschaft und in der Mühle, im Goldenen Löwen und im Dampfschiffrestaurant staut sich das Volk wie einst in der guten alten Zeit vor 1914.

Das Dorf Pillnitz hat sich seit Menschenaltern nur wenig verändert. Die Schenke, die schon vor hundert Jahren als »Gasthof zum goldenen Löwen« [24]bezeichnet wurde, ist am 11. April 1835 vom Gute Pillnitz wieder abgetrennt und für 5850 Taler an Christian Friedrich Görner veräußert worden; auch die Mühle ging 1835 in den erblichen Besitz des zeitherigen Pächters Joh. Gottlieb Wendisch über. Viel früher, schon 1752, war die Schmiede, die übrigens erst seit 1720 belegt ist (damals Schmied Christian Großer), vom Kammergut gelöst worden.

Zu den alten Gärtner- und Häuslernahrungen sind nun eine Anzahl schmucker Landhäuser getreten. Mancher Dresdner von Ruf hat seinen Musensitz am Fuße der Weinberge aufgeschlagen. In einem kleinen Häuschen unweit der Ortsgrenze an der Pillnitz-Hosterwitzer Straße komponierte Carl Maria von Weber seinen Freischütz, die Euryanthe und den Oberon, und zu Pillnitz lebte und starb der feinsinnige Dichter Julius Hammer, dessen Denkmal vor der hiesigen Schule steht. Pillnitzer Luft weht in seinem schönen Liede »Vertraue dich dem Licht der Sterne«, und es waren wohl die Waldwege seiner Umgebung, die ihm solchen Trost gewährten, daß er singen konnte:
Noch einmal schauen wir von der aussichtsreichen Terrasse des Dampfschiffrestaurants auf die Pillnitzer Insel. Ihrer ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1443 gedachten wir schon, desgleichen ihrer Verwendung bei den großen Pillnitzer Festlichkeiten. Später diente sie der Fasanenzucht; jetzt ist die Zahl dieser stolzen Vögel, wie überhaupt der Wildstand, auf dem Werder stark herabgemindert. Auch mit den ältesten Erinnerungen der Dresdner an den Luftverkehr ist die Insel verknüpft. Hier ließ sich 1834 der Luftschiffer Professor Reichardt mit seiner Tochter nieder. Für die königliche Familie wurde Ende des achtzehnten Jahrhunderts ein Bad bei der Insel angelegt, das aber schon längst wieder eingegangen ist. Dafür tummelten sich auf ihrem Strande in den bewegten Tagen, die dem Zusammenbruch der deutschen Fürstenthrone folgten, Männlein und Weiblein aus der Nachbarschaft wie aus Dresden, die Rousseaus Ruf: »retour à la nature« so gern mit »Pflege der Nacktkultur« übersetzen. Aber der Plan, hier ein großes Freiluftfamilienbad zu gründen, scheiterte. Die Insel ward zum Naturschutzgebiet erklärt und ist nunmehr dem allgemeinen Besuch verschlossen. Dafür wird sie unter solchem Schutze noch vielen Geschlechtern, die nach uns kommen, das Bild eines selbstgewachsenen Auenwaldes zeigen, ein seltenes Naturdenkmal vor den Toren einer Großstadt. – Mit diesem Wunsche besteigen wir den Dampfer, der uns elbabwärts trägt; hinter uns verschwimmen Königsschloß und Fischerdorf im Abendnebel.
Der vorliegende Aufsatz beruht im wesentlichen auf eigenen Studien im Dresdner Hauptstaatsarchiv (= Zettelsammlung zum Historischen Ortsverzeichnis [25]von Sachsen) sowie auf A. von Minckwitz, Geschichte von Pillnitz; Dresden, 1893 und C. Gurlitt, Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. Heft XXVI. Dresden, 1904, S. 159 ff. Daneben sind eine Anzahl von Führern (Mayer, Schäfer, Gottschalk) und verschiedene Pillnitz betreffende Artikel in Zeitschriften benutzt worden, auf die an den betreffenden Textstellen verwiesen ist.
Von Dr. Stephan, Freiberg
Der Verein Sächsischer Heimatschutz hat sich schon oft der Bäume angenommen, die durch ihr Alter ehrwürdig sind oder durch ihren Wuchs eine hervorragende Zierde einer Landschaft bilden, auch wohl durch den ihnen beigelegten Namen sich vor anderen auszeichnen. Seine Aufmerksamkeit verdient aber auch die reiche Anzahl der Bäume, die zum Andenken an bestimmte geschichtliche Ereignisse oder an hervorragende Persönlichkeiten gepflanzt worden sind, die Gedenkbäume. Es gibt in unserem Vaterlande keine Stadt und kein größeres Kirchdorf, wo nicht auf dem Friedhofe oder vor ihm, auf einem öffentlichen Platze, innerhalb gärtnerischer Anlagen, hier und da auch auf Bergeshöhen ein solches Erinnerungsmal den Vorübergehenden grüßte; und gar mancher dieser Gedenkbäume erregt durch seine Größe und die Stattlichkeit seines Wuchses Staunen und Bewunderung. Die Ortsverwaltungen hegen und pflegen ihn; sie haben seinen Stamm mit einem Holz- oder Eisengitter umgeben, einen kleinen Ziergarten um ihn herum angelegt, am Fuße einen Stein mit Inschrift errichtet, um allen, die sich an ihm erfreuen, zu sagen, wessen Gedächtnis er lebendig erhalten, an welche allgemein- oder ortsgeschichtliche Tatsache er erinnern soll.
Leider ist solche liebevolle Pflege und solche Sorge für die Erhaltung der Gedenkbäume nicht überall zu finden. In einem Dorfe, wenige Wegstunden von der Residenz entfernt, steht an der Hauptstraße noch das alte, kleine Schulhaus aus dem achtzehnten Jahrhundert. Neben der Haustür befindet sich in einem gemalten Kranze aus Eichenzweigen die Inschrift: »Zum Denkmal des 3. Reformations-Jubiläi d. 31. Oktbr. 1817 wurde dieser Stein von der hiesigen Schuljugend errichtet und 2 Linden und 1 Eiche allhier gepflanzet.« Nebeneinander standen bis vor wenig Jahren die drei Bäume vor dem schlichten Hause, es mit ihren schönen Kronen beschattend. Heute sind die Zeugen der Begeisterung, die vor hundert Jahren die Herzen der Evangelischen allüberall im Sachsenlande erfüllte, verschwunden. Weil sie alt und morsch geworden seien, hat man sie umgeschlagen. Sie sahen noch vor sechs bis zehn Jahren wahrlich nicht so aus. Die Inschrift steht aber noch da. Nicht anders ist es mit der Buche auf der Rittergutsflur Neusorge bei Mittweida, die dankbare Hände im Jahre 1763 aus Freude über den Frieden zu Hubertusburg gepflanzt [26]hatten, der den siebenjährigen schweren Kriegsleiden unseres Volkes ein Ende machte. Sie war zu einem prächtigen Baumriesen mit einem Stammdurchmesser von einem Meter siebzig Zentimeter emporgewachsen. Zu Beginn dieses Jahres ist sie unter den Äxten von Arbeitern gefallen. Auch sie soll morsch und »eine Gefahr für Vorübergehende geworden« sein. Kenner bezweifeln das, und Natur- und Heimatfreunde beklagen das Vorgehen des Besitzers, des Fürsorgeverbandes Leipzig, auf das tiefste. Anderwärts mußte, wie es heißt, einem Gedenkbaume die Krone abgesägt werden, weil er einem Neubau im Wege stand oder weil ein neuer Weg angelegt werden sollte; die schönsten Äste eines andern entfernte man, um Fernsprech- oder Lichtleitungen bequemer führen zu können. Hier und da liegt der Verdacht nahe, daß ein Gedenkbaum nur deshalb hat fallen müssen, weil aus seinem Holze ein hübsches Stück Geld zu lösen war.
Begünstigt wird die Unüberlegtheit und Rücksichtslosigkeit den Gedenkbäumen gegenüber vielfach dadurch, daß sie sich äußerlich gar nicht oder gar nicht mehr von anderen Bäumen im Orte unterscheiden. Die Tafel, die verkünden sollte, zu wessen Ehren die Ortsbewohner eine Eiche oder Linde gepflanzt haben, ist schon lange verschwunden; Bubenhände haben sie abgerissen oder so beschädigt, daß sie entfernt werden mußte; das Gitter um den Stamm ist verfault oder verrostet, der Stein an seinem Fuße verwittert oder nicht mehr vorhanden. Nicht zu selten hat man überhaupt versäumt, den Gedenkbaum mit einem Kennzeichen zu versehen; seine Bedeutung sei ja allgemein bekannt, heißt es. Fragt nun aber ein Freund der Heimatgeschichte einen Knaben oder jüngeren Erwachsenen, warum und wann ein schöner, meist an hervorragender Stelle stehender Baum gesetzt worden sei, so bekommt man fast regelmäßig ein Achselzucken als Antwort; ältere Leute glauben zwar zu wissen, daß ihn die Eltern oder Großeltern an einem besonderen Festtage gepflanzt haben, aber an welchem, können sie nicht sagen. Was Wunder, wenn er, vielleicht schon nach einem halben Jahrhundert, als ein Baum gilt wie jeder andere und daher auch keiner besonderen Schonung und Pflege wert erscheint.
Es möchte daher den Gemeindebehörden auch vom Verein Sächsischer Heimatschutz angelegentlich empfohlen werden, sich der in ihrem Geschäftsbereiche vorhandenen Gedenkbäume anzunehmen.
Es ist erstaunlich, wie groß der Reichtum an Gedenkbäumen in unserem Vaterlande ist, wenn sich auch die Sitte, solche zu setzen, erst mit Beginn des vorigen Jahrhunderts allgemein durchgesetzt hat. Doch fehlt es auch nicht ganz an ihnen aus früherer Zeit. Sehen wir von den alten Linden ab, unter denen der Überlieferung nach Luther gepredigt hat (Prießnitz bei Borna, Ringetal bei Mittweida, hier leider nur noch ein Stumpf) und der sogenannten Lotterlinde in Augustusburg aus dem Jahre 1584, so dürfte als ältester noch vorhandener Gedenkbaum die Linde anzusprechen sein, die bei der zu Niederzwönitz gehörigen Brettmühle am hundertsten Todestage Luthers (1646) gesetzt worden ist. Ihr folgen im Alter die Linde, die nach mehrfachen Zeugnissen im Jahre 1655 an dem hundert Jahre zuvor geschlossenen Augsburger Religionsfrieden, [27]und die Linde, die aus demselben Anlaß ein Jahrhundert später in dem kleinen Dörfchen Ölsnitz in der Amtshauptmannschaft Großenhain gepflanzt wurde. Nachdem die Hubertusburger Friedenslinde in Neusorge gefallen ist, erinnert kein Baum mehr an das Jahr, in dem der Siebenjährige Krieg zu Ende ging; denn auch die Friedenslinde in Löthain bei Meißen aus demselben Jahre ist vor nicht zu langer Zeit durch Blitzschlag zerstört worden. Um so stattlicher ist die Zahl der Gedenkbäume, die dem neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert angehören. Die Rückkehr des Königs Friedrich August des Gerechten aus der Gefangenschaft (1815) gab den ersten Anlaß zur Pflanzung von Linden und Eichen, so in Deutzen (A. H. Borna) und Friedrichswalde (A. H. Pirna), und von da an gibt es bis in unsere Tage kein Ereignis von geschichtlicher Bedeutung, das nicht durch Gedenkbäume ausgezeichnet wäre, so das Reformationsjubiläum 1817 (Annaberg, Auerbach, Blankenstein bei Wilsdruff, Konstappel, Heynitz, Gatzen bei Groitzsch, Höckendorf, Possendorf, Röhrsdorf bei Maxen, Struppen, Tharandt – die letzten fünf Orte gleich mit je drei Linden), das fünfzigjährige Regierungsjubiläum des Königs Friedrich August I. 1818 (die »Königseichen« in Borna-Stadt, Chemnitz-Schloß, Olbernhau, Bockendorf, Reichenbrand bei Chemnitz, Neustädtel, Gelenau, Zethau und die »Königslinden« in Zöblitz, Markersbach bei Mittweida), die Dreihundertjahrfeier der Übergabe der Augsburgischen Konfession von 1530 (Erdmannsdorf, Gleisberg bei Roßwein, Meißen, Kleinschirma bei Freiberg, Hermsdorf bei Frauenstein, Vielau bei Zwickau), ferner die der Einführung der Reformation im Herzogtum Sachsen, die 1539 erfolgte (Pegau, Regis, Thiemendorf bei Öderan), des Todestags Luthers (Bubendorf bei Frohburg, Gostewitz bei Riesa, Hohenkirchen, Kötzschenbroda, Neukirchen bei Borna), des Augsburger Religionsfriedens 1555 (Euba bei Chemnitz, Großnaundorf), die fünfzigjährige Wiederkehr der Leipziger Schlacht, vor allem aber die Friedensfeier 1871, der vierhundertste Geburtstag Luthers 1883 und das Wettinjubiläum 1889. Dem Verfasser sind jetzt schon gegen dreihundert sächsische Gemeinden bekannt, die am 10. November 1883 eine Eiche oder Linde, eine Buche, einen Ahorn- oder einen Apfelbaum gepflanzt haben. Ebenso zahlreich vertreten sind die Kaiser Wilhelm (I.)-, Albert-, Bismarck- und Moltke-Gedenkbäume, als Zeichen der Verehrung für diese Schöpfer der deutschen Einheit gepflanzt, sei es zur Feier ihres Geburtstages, ihrer silbernen Hochzeit, ihres Regierungsjubiläums oder auch zum Andenken an ihren Tod. Weiter haben die Jahre 1859 und 1905 Anlaß zur Pflanzung von Schillerlinden, 1863 und 1913 zu der von Körnereichen gegeben. Das Gedächtnis Heinrich Cottas, des genialen Forstmannes, lebte fort in Eichen in Werdau, Rauschenbach, Borstendorf und in ganzen Baumgruppen im Tharandter und im Zschopauer Walde, das des Turnvaters Jahn in einer Eiche in Großschönau und Ernst Moritz Arndts in einer solchen in Rabenstein. Endlich: wollte eine Gemeinde bei ihren Kindern und Enkeln das Andenken an ein Ereignis lebendig erhalten, das ihr bedeutungsvoll war, an ein verheerendes Schadenfeuer, die Weihe der neuerbauten Kirche oder Schule, oder an einen Mitbürger, der sich große Verdienste um sie erworben, [28]oder an einen Wohltäter der Armen des Ortes, so pflanzte sie einen Gedenkbaum; ja auch Vereine taten das an dem Tage, da sie ihr fünfundzwanzig- oder fünfzigjähriges Bestehen feierten. Und es sei wiederholt, es sind oft Prachtstücke, diese Gedenkbäume, die allein um ihrer Schönheit willen gehegt und gehütet zu werden verdienen, wie vielmehr ihrer geschichtlichen Bedeutung wegen, wenn auch nur der für einen einzelnen Ort.
Schutz und Pflege, wie die Gedenkbäume, verdienen aber auch und haben vielfach nötig die anderen Erinnerungsmale in Sachsen, die Denkmäler, Denksteine und die Gedenktafeln. Ihre Zahl übertrifft die der Gedenkbäume bei weitem.
Die Denkmäler in unseren Städten sind meist von Künstlern geschaffen, also Kunstwerke, und sind schon um deswillen wertzuhalten, mögen sie auch an frühere Herrscher und beseitigte Staatsformen erinnern. Nur Unverständige können sie beseitigen, Rohlinge sie beschädigen wollen. Aber auch die Denkmäler, denen der Kunstwert abgeht, wie die überaus zahlreichen Obelisken und Pyramiden, die nach dem deutsch-französischen Kriege auf den Friedhöfen oder öffentlichen Plätzen unserer Land- und kleineren Stadtgemeinden errichtet worden sind, sollten nicht mißachtet und vernachlässigt werden. Wenn in den letzten Jahren allüberall Ehrenmale für die im Weltkriege gefallenen Krieger entstanden sind, so ist das doch ausnahmslos in der Erwartung geschehen, daß nicht nur das gegenwärtige Geschlecht, sondern auch die kommenden sich bei ihrem Anblicke dankbar der schweren Opfer erinnern, die das deutsche Volk in Millionen seiner besten Söhne für des Vaterlandes Erhaltung und Freiheit gebracht hat, und angespornt werden zu gleicher Opferfreudigkeit, wenn es not tun sollte. Ganz dasselbe haben aber auch die Volksgenossen erwartet, die vor fünfzig Jahren ihren gefallenen Brüdern ein Dankesmal aufrichteten, und ein jedes von diesen verdient denselben Schutz, den die in unseren Tagen geschaffenen beanspruchen.
Am leichtesten scheinen Gedenktafeln zu verschwinden. Eine Gedenktafel soll dem Vorübergehenden künden, daß in dem Hause, über dessen Eingangstür oder Mittelfenster sie angebracht ist, ein berühmter oder doch weit bekannter Dichter, Komponist, Gelehrter, oder ein hervorragender Vertreter der Industrie, des Handels, der Landwirtschaft, ein Wohltäter für die Gemeinde, ein hochherziger Förderer von Kunst und Wissenschaft geboren oder gestorben ist, oder doch längere Zeit gewohnt und gewirkt hat, wohl auch, daß ein Napoleon, Alexander I., Friedrich der Große, ein Bismarck oder Moltke in Kriegs- oder Friedenszeiten dort abgestiegen ist, usw. Aber das durch diese Bewohner geweihte Haus, vielleicht aus der Biedermeierzeit stammend, oder noch höheren Alters, will nicht mehr in seine Umgebung passen, der Grund und Boden, auf dem es steht, kann gewinnreicher durch die Errichtung eines Kaufhauses oder eines vielstöckigen Mietgebäudes gemacht werden. Deshalb wird es abgebrochen, und damit verliert sich seine Gedenktafel. So sucht man z. B. in Leipzig die Tafel, die Gellerts Wohnung in der Rittergasse bezeichnete, und die am Geburtshause des Mathematikers Kästner auf der Petersstraße angebracht [29]gewesene, in Dresden die dem Erbauer der Frauenkirche, George Bähr, an dem Eckhause Seestraße und An der Mauer gewidmete vergeblich. Es würde dem Bauherrn des neuen Hauses gewiß keine besonderen Mehrkosten verursachen, wenn er an ihm die Gedenktafel des alten wieder anbringen oder, wenn das wegen ihres Textes nicht angängig ist, eine andere gießen läßt, auf die statt des »In diesem Hause« ein bloßes »Hier« gesetzt wird oder auf der es nur heißt: Geburtsstätte des Dichters –. Selbst der Ausweg, die Gedenktafel irgendwo im Inneren des neuen Hauses anzubringen, oder doch wenigstens statt ihrer eine Inschrift, die auf die Bedeutung des Hauses hinweist, das dem Neubau hat weichen müssen, wie dies geschehen ist, im Hofe des Hauses Brühl Nummer 3 in Leipzig, an dessen Stelle Richard Wagners Geburtshaus stand, ist der pietätlosen Beseitigung des Erinnerungsmales vorzuziehen.
Viele Erinnerungsmale sind schon verloren gegangen. Daher wollen wir die noch vorhandenen heilig halten. Sie für das Gebiet unseres Sachsenlandes festzustellen und zu verzeichnen, bemüht sich der Verfasser seit Jahren. Vielleicht trägt seine Arbeit nach ihrer Vollendung dazu bei, daß die Zahl derer recht groß wird, die gern mithelfen, das, was unsern Eltern lieb und wert war, also auch die von ihnen gepflanzten Gedenkbäume, die von ihnen errichteten Denkmäler und die Gedenktafeln, mit denen sie ihre hervorragenden Zeitgenossen ehren wollten, sorglich zu schützen und zu pflegen.
Von Dr. Siegfried Sieber, Aue
Der staatlich angestellte Waldarbeiter von heute, der in einem hübschen Heimatschutzhäuschen wohnt, seinen Gehalt nach dem Dienstalter erhält, dazu Ortszuschläge, Kinderzulage und Altersrente beanspruchen kann, ist der Nachfahre der ehedem erbärmlich im Walde hausenden Köhler, Pecher und Flößer.
»Wild, wüst, wölfisch«, sagt der Erzgebirgschronist Lehmann, war damals weitum der Wald, drin der Kohlenbrenner schürgte. Einst grub er Erdmulden, warf Holz und Reisig hinein, überdeckte dies mit Erde und ließ den Brand darunter langsam schwälen, bis die Grubenkohle fertig gebrannt war. Später lernte er den kunstvollen Meiler bauen.
Auf ebenem lehmigem Boden, locker mit Rindenstückchen und Fichtennadeln bedeckt, damit Wasser durchsickern konnte, grenzte er kreisrund die Kohlstatt. Eine Stange, das Quendelholz, stieß durch die Mitte, trocknes, mürbes Brennholz ward herumgehäuft und die Zündrute daran geschnürt. In vier Stockwerken schichtete das Kohlholz sich hoch zur Form eines gewölbten Backofens. Fichtenreisig, Erde und Rasen vermummten den Meiler luftdicht, ließen nur die Zündstelle und ein paar Zuglöcher nahe am Boden offen. Gegen den Wind baute der Köhler eine Wand von Wurzelstöcken. Dann ward der Aufbau nach fünf oder sechs Tagen strenger Arbeit vollendet, und mit den Worten: »Walts Gott!« ließ der Meister die Flamme zur Mitte des breiten [30]Rundbaues laufen. Der grobe Schürbaum stieß während des zehn Tage langen Brandes weitere Löcher in die Decke. Auch wurde von oben aus noch eine ganze Menge Holz nachgeschüttet, wenn das Kohlholz im Meiler sich langsam verzehrte. Besonders gefährlich war es, wenn der Köhler auf einem Stamm, dessen Äste als Leitersprossen zugestutzt waren, zum Kranz des Meilers emporkletterte, um Luft zu schaffen oder den Kranz abzudecken. Wie oft brach der einsame Wäldner dabei durch und verbrannte elendiglich im eigenen Meiler! Dann konnten Plattenschmieden und Hammerwerke vergeblich harren, wer ihnen die rauchende Ware ins Kohlhaus brächte.
So lange die schwarze Kuppe rauchte, mußte der Köhler im niedrigen Kohlkram hockend bei ihr wachen. Tagsüber hackte er Holz für den nächsten Brand zurecht. Zum Abdecken holte er sich einen Gehilfen, sofern er nicht schon für die anstrengenden Nachtwachen einen bei sich hatte. Ins nächste Dorf kam er selten hinunter. Man glaube nicht, daß die Köhlerei längst vorüber sei. Im neunzehnten Jahrhundert war sie noch gar lebhaft. Die größte Holzverkohlung Sachsens lag im Bereich der Blumenau-Görsdorfer Flöße an der Flöha. Gegen dreißig Männer kohlten dort im Walde. Freilich seit Stein- und Braunkohlen auf Eisenbahnen ins Erzgebirge rollten, schrumpfte die Köhlerei, und gegen 1900 rauchten nur noch wenige Meiler bei Zöblitz und Hirschenstand, bei Morgenröthe und Carlsfeld. Jetzt kann man Köhler noch bei der Arbeit sehen hinter Sosa im Walde am Auersberg. Sie liefern für bestimmte Gießereizwecke Holzkohlen nach Aue.
Noch schneller strandete die Flößerei. Einst wiegten alle Erzgebirgsflüsse das Holz der Wälder ins Niederland. An den Steilhängen der Waldufer blinkten die Scheite und Schnittflächen der frischgeschälten Stämme wie Silberanbrüche. Eichen erseufzten unter der Axt, graue Tannen rutschten in Runsen bergein. Auf dem Kälberplan bei Crottendorf gab eine Tanne allein dreizehn Klafter Holz, und nahebei am Katzenstein fällten sie eine Fichte, die über vierzig Meter hoch ragte. Geschworene Holzschläger hafteten für Auswahl und Aufbereitung der Stämme. Brettbäume, zu Bauholz geeignet, kamen ins Wasser, dagegen schlechte Stämme wurden der Köhlerei überwiesen. Windbruch, Leseholz und Gnadenholz für Bäcker, Schulmeister und arme Leute wurden an ihre Bestimmungsorte geschleift. So schrieb es Vater Augusts berühmte Holzordnung aus dem Jahre 1560 genau vor.
Glashütten und Hammerwerke fraßen ihre Nachbarwälder kahl. Noch ärger wüstete der holzhungrige Bergbau. Drum bauten die großen Bergstädte lange, künstliche Floßgräben, um Grubenholz aus entfernten Wäldern heranzuschwemmen. Schneeberg begann damit 1546. Noch heute ist der wundervolle Flößgrabenweg von Bockau über Aue nach Schneeberg ein beliebtes Ziel der Wanderer. Nächst ihm ist unter den vielen sächsischen Floßgräben der Aschergraben bei Altenberg der bekannteste. Für Annaberg legte Senator Georg Öder 1564 eine Holzflöße an. Der Graben ward allmählich bis zum Bärenstein verlängert. Er endete auf dem Floßhof, im jetzigen Stadtpark am Fuße des Pöhlberges. Außerdem zogen die Annaberger jährlich dreitausend Klafter [31]aus dem Pöhlbach, während auf der Sehma das Holz vom Nachbar des Fichtelberges, dem Eisenberg, herabbefördert wurde. Auf der Mittweida stießen sich in jeder Flößzeit eintausend Klafter nach Crottendorf und Scheibenberg. Flöha und Zschopau, Schwarzwasser und Mulde legten ihren Holztribut auf Floßplätzen und Holzangern nieder. Im sechzehnten Jahrhundert verpachtete der Kurfürst noch den Flößbetrieb, später saßen staatliche Floßmeister zu Lauter, Olbernhau oder Eibenstock, ja in Mittweida-Markersbach haftete der Schulmeister für den Floßanger. Der Name Floßplatz bei Wolkenstein erinnert ebenfalls an die Flößerei. Bisweilen gab es wohl auch Kämpfe um die Flöße, wenn z. B. adelige Herren den Holztransport auf der Mulde nach Zwickau nicht gestatten wollten und von Schloß Stein oder Wiesenburg die Floßknechte beschossen. Doch im neunzehnten Jahrhundert entkräfteten Eisenbahnen mit billigen Frachten sowie Fabriken, die den Flüssen für ihre Betriebsgräben Wasser entzogen, die alte Flößerei. 1872 ging die letzte Floßanstalt, 1878 der letzte Holzhof ein.
Pecher sind bis in unser Jahrhundert im Erzgebirge tätig gewesen. Um Crottendorf und Grünhain, besonders aber zwischen Schwarzenberg und dem Vogtlande lagen die großen Pechwälder, die besonders geschützt und bei Waldbränden sogar mit Aufgebot von Hilfskräften aus dem Niederland gesichert wurden. Für das Gebiet um den Auersberg hatten im fünfzehnten Jahrhundert die ritterlichen Herren von Tettau auf Schloß Schwarzenberg besondere Pechlehnbriefe ausgegeben und Gewerkschaften nach dem Muster des Bergbaues mit Pechsteigern, Mutzetteln und Kuxen zur Pechnutzung ermächtigt. Die größte Gesellschaft, Flötzmaul nach einer berühmten alten Grube benannt, hatte im Walde um Eibenstock zu harzen, sechs andere an der Wilzsch und im Schönheider Waldland. Nach den Tettaus übernahm der Kurfürst die Belehnung, ward selbst Gewerke, gab aber auch Vorschriften, daß junge Hölzer zu schonen und jeder entharzte Stamm drei Jahre zu meiden sei. Denn der Harzer schnitt etliche Risse breit und lang in den Baum, schabte im nächsten Jahre das Harz und trug es zur Pechhütte, einer verschalten Grube nebst einem Kupferkessel, den ein Rindendach schützte. Das gesottene Pech schöpfte der Pecher mit langer Kelle in die Grube und brach es nach Erkalten heraus. Seit 1740 erzielte man in Holzformen gleichmäßige Pechtafeln.
In vierzig solcher Pechhütten dienten einsame Wäldner auf Tagelohn. Pechsteiger beaufsichtigten ihre mühsame Arbeit und pürschten mit den Forstbeamten den Harzdieben nach, die in Banden von zwanzig und dreißig Mann aus Böhmen kamen, um das Harz der sächsischen Wälder zu stehlen. Dreihundert Zentner Pech schmolzen die Gewerkschaften des Schwarzenberger Gebietes alljährlich und verkauften sie an die Brauhäuser, an Handwerker und Apotheker. 1845 übernahm der Staat die Pechweide, unterhielt bei Tannenbergstal und im Wiesenhause Pechhütten, stellte aber 1894 die Nutzung ein. Nur in Schwarzenberg blieben Pechbetriebe bis nach dem Weltkrieg erhalten. Sie verwendeten Pech von auswärts, bestehen aber heute auch nicht mehr.
[32]
Von Oskar Pusch, Dresden
Der Kahlschlag in Abteilung 6 des Dresdner Reviers, der »Sausechs« im Munde der Waldarbeiter, im Jahre 1924 bis 1925 ließ einen tiefen Blick in die Geschichte der Dresdner Heide tun. Es ist wohl noch bekannt, daß Professor Deichmüller dank dieser Rodung unweit der Radeberger Landstraße ein bronzezeitliches Gräberfeld mit etwa sechzig Urnen bloßlegen konnte. Waldarbeiter waren auf Steinsetzungen und Urnenreste gestoßen. Ein Jahr später brachte man ein ungefähr dreitausend Jahre jüngeres Werk unserer Vorfahren ans Tageslicht. Außerordentlich feste Mauerreste, ein wohlerhaltener Plattenbelag, ein Pflaster nach Katzenkopfart, Reste von Ziegeln, Glassplittern und Tonpfeifchen waren die letzten Zeugen einer vergangenen höfischen Jagdbetätigung. »Ein verschollenes Dorf« meinten die Waldarbeiter, der »Dresdner Saugarten« aber war es in Wirklichkeit.
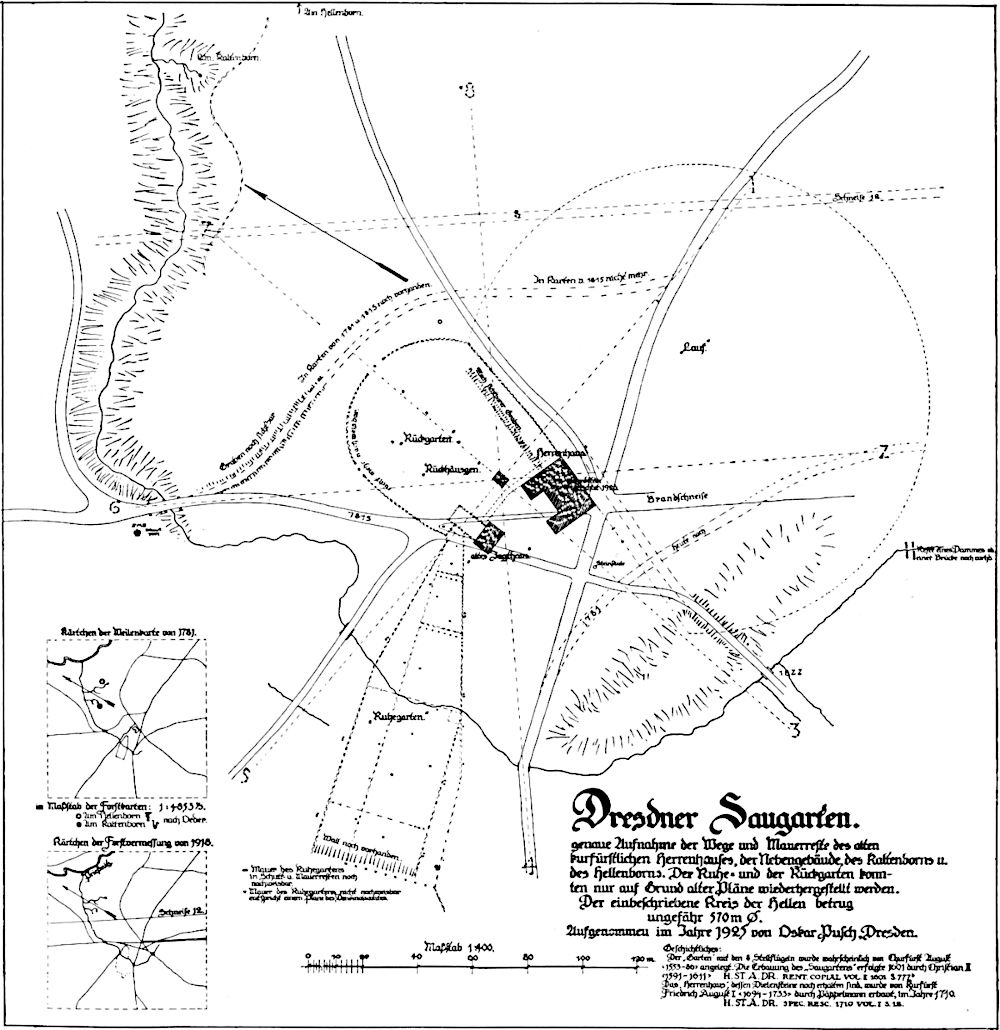
Es lohnt, einmal kurz die Geschichte des Dresdner Saugartens, die völlig aus der Überlieferung der Heidebewohner verschwunden war, wie sie aber dank [33]dem Aktenmaterial des Hauptstaatsarchives und des Denkmalamtes festgelegt werden konnte, aufzurollen.
Von der Zeit seiner Entstehung ist nichts bekannt. Die unmittelbare Nähe des bronzezeitlichen Gräberfeldes läßt die Vermutung aufkommen, im Saugarten einen germanischen Kultplatz zu sehen. Jedenfalls war der Platz durch die unmittelbare Nähe zweier Quellen zu jeder Zeit für menschlichen Aufenthalt besonders geeignet.
Kurfürst Vater August (1553 bis 1611) ließ bei Beginn seiner Regierung vom Magister Humelius aus Leipzig die erste Heidevermessung vornehmen. Mathias Oeder führte eine genauere um 1570 aus. Oeders Plan bildet noch heute eine Zier des großen Kartensaales des Hauptstaatsarchives.
Beide Männer kannten schon den »Treybegarten« oder kurz »Garten«, d. i. eben unser Saugarten. Humelius orientiert sogar die Kartenbeschriftung nach der Gartenmitte. Man darf wohl annehmen, daß das System der Wege 1–8, die strahlenförmig vom Saugarten ausgingen, erst von Vater August angelegt worden ist. Er selbst war ein großer Landmesser und es werden sogar von ihm eigenhändig gezeichnete Karten im Hauptstaatsarchiv aufbewahrt. Die Hauptstrahlen des mittelalterlichen Gartens sind trotz Einführung des Schneisensystems im Jahre 1833 noch heute erhalten. Die Radeberger Straße z. B., die vom Linckeschen Bad nach dem Jägerpark führt, ist der alte Jagdflügel 4, der in der alten 8 seine Fortsetzung findet und bei Radeberg endet. Die alte 5 »fehet sich an« beim Rabenstein, d. i. das heutige Bilzsanatorium in der Lößnitz, setzt sich über dem Garten in der alten 1 fort und »endet sich« an der Wesenitzbrücke bei Rennersdorf »unter dem Stolpen«. Die Anlage diente nur jagdlichen Zwecken. Hatten die Strahlen bei Oeder bereits Zahlen, so waren die Sehnen, die die Strahlen spinnennetzartig miteinander verbanden, noch namenlos. Unter August dem Starken (1694 bis 1733) erschienen sie als Kreuz 4, Kreuz 5, Kreuz 6 usw. und sind zum Teil heute noch als solche bekannt. Die Strahlen gingen damals nicht bis zum Gartenmittelpunkt, sondern ließen einen Kreis von zirka sechshundert Metern Durchmesser, die »Hellen«, offen.
In Moritzburg befand sich eine ebensolche Anlage; dort steht in der Hellen das Hellenhaus, ein reizendes Schlößchen mit Ausblick nach allen »Flügeln«. In den Hellen fanden die »Jagden auf dem Lauf«, das sind Jagden, die mit Netzen und hohen Tüchern umstellt waren, statt. –
Über die Stärke und Anzahl des Wildes der Zeit Vater Augusts gibt ein Jagdbuch im Hauptstaatsarchiv Auskunft. Beispielsweise fing er (wahrscheinlich mit der Saufeder) 1585 1608 wilde Sauen. 1583 erlegte er ein hauendes Schwein von 737 Pfund. In der Weidenhainschen Heide streckte er einen Hirsch von 705 Pfund.
Die runde Steinsäule des heutigen Dresdner Saugartens mit den Zahlen der Flügel ist nicht der Mittelpunkt des Gartens. Sie wurde 1920 an Stelle einer morschen Holzsäule, deren gut erhaltene Fußnägel höchstens vierzig Jahre alt sein konnten, gesetzt und ist ein Prellstein des ehemaligen Prinz-Max-Palais [35]der Ostra-Allee. Der Mittelpunkt des Flügelsystems lag im »Rückhäusgen«.
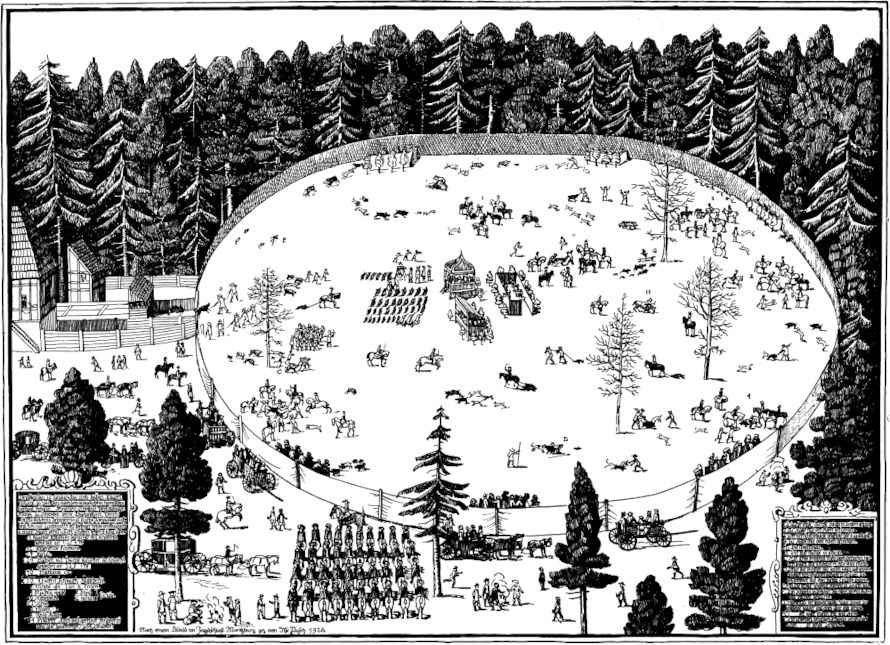
Kurfürst Christian II. gibt 1601 den Befehl »an Schosser (Steuerbeamter) und Oberförster zu Dresden«, »auf Dreßnischer Heide einen neuen Saugarten beim Ascherofen« zu erbauen. Oberförster zu Dresden war Günter. Sein Revierteil hieß »Klugenorth«. Am heutigen Weißen Hirsch lag Hermannsorth und bei Klotzsche Rohrorth.

Ein Ölgemälde im Schloß Moritzburg mit der Jahreszahl 1656 stellt ein eingestelltes Jagen auf dem Dresdner Saugarten mit den Gebäuden Christians dar. Die Jagd ergab eine Strecke von 250 Sauen und war zu Ehren des schwedischen Gesandten abgehalten worden (siehe Abbildung).
[36]
»1706 haben die Schweden als Feind im Lande gestanden«. Die Ausführung des Befehls des Kurfürsten Friedrich August I. (als König von Polen August II.), an den Landbaumeister Karcher ein »neu Gebäude auff dem in hiesiger Dreßdner Heyde gelegenen Saugarten aufführen zu lassen«, muß auf bessere Zeiten verschoben werden. 1710 erhält Landbaumeister Pöppelmann denselben Befehl und erbaut das Herrenhaus mit »Jagtmaurermeister« Caspar Haußwald und Zimmermeister Georg Dünnebier für 2156 Thaler 21 gl. und 9 Pfg. – Nach aufgefundenen Stuckresten mag das Herrenhaus auch verwöhnteren Ansprüchen genügt haben: es enthielt unter anderem »Zimmer vor Staatsdamen und polnische (fremde) Damen.«
Die anderwärts erwähnten Stallungen müssen hölzerne gewesen sein und ihren Standort in einiger Entfernung vom Herrenhaus gehabt haben. Hin und wieder findet man im Verlaufe des achtzehnten Jahrhunderts eine Aktennotiz über den Dresdner Saugarten.
Ein Plan von 1728 im Landesamt für Denkmalpflege ist zwar nach damaliger Sitte nicht als Plan des Saugartens bezeichnet, stellt aber, wie man nunmehr sicher weiß, eine Lustjagd unter August dem Starken dar. 1758 soll eine warme Stube am Saugarten vorhanden sein, um »die Wolffsspuhren daselbst observieren zu können«.
(Die eben beendeten Schlesischen Kriege und der beginnende Siebenjährige Krieg mögen der Vermehrung der Wölfe sehr gedient haben. Das Wolfsdenkmal am Auer bei Moritzburg stammt aus dem Jahre 1618, doch wohl aus einer Zeit, in der Wölfe schon selten waren.)
1804 findet man das Herrenhaus noch auf alten Karten. Die große Forstvermessung unter Cotta 1815 kennt nur noch den Ruhegarten, das Schlößchen ist nicht mehr. Wahrscheinlich haben die hundert Jahre Waldleben in ziemlich feuchter Gegend dem Bau so zugesetzt, daß er abgebrochen werden mußte. Brandreste sind nirgends zu finden. Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts verschwinden auch die Mauern des Ruhegartens. Die lange Mauer, an den Albrechtsschlössern entlang der Bautzener Straße, der früheren »Stolpischen Straße«, soll die Reste des Saugartens enthalten. 1924 standen auf dem Saugartengelände bereits wieder hundertjährige Eichen und Fichten und kein Mensch hatte mehr eine Ahnung von dem einstmals hier gelegenen Hoflager.
Nur ein kleiner Brunnen, der Kaltenborn, hatte seine Gewölbe aus jener Zeit in die Neuzeit gerettet. Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz besserte ihn vor kurzem aus und ließ die am Boden liegenden Grundmauern des Saugartens genau vermessen und einen Gedenkstein »an die Zeit der Hohen Jagd in der Dresdner Heide« errichten.
Erwähnt mag zum Schluß noch werden, daß die Heide noch die Spuren von (z. T. erhaltenen) weiteren Saugärten aufzuweisen hat: Lausaer, Liegauer, Langebrücker und Rossendorfer Saugarten. Oeder kennt noch einen »Garten« am Schnittpunkt von Bautzener Straße und Prießnitzbach.
[37]

Von Prof. Dr. A. Naumann
Mit Aufnahmen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz
Von einer neuen erfreulichen Tat des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz ist zu berichten: »Das Georgenfelder Krummholz-Moor am Lugstein ist von dem Verein erworben und zu einem Naturschutzgebiet gemacht worden«. (Abb. 1–3.) Durch die fleißigen und verständnisvollen Bemühungen des Herrn Georg Marschner, Dresden, ist aber dieses elf Hektar umfassende Moorgebiet nicht bloß geschützt, sondern auch durch geeignete Wege, durch Bohlenpfade und Überbrückungen der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Dies ist um so erfreulicher, als dieses Hochmoor in leicht erreichbarer Nähe Dresdens das einzige einigermaßen wohlerhaltene Moor des östlichen Erzgebirges darstellt. Gerade dieses Moor zeigt, wie nötig ein Schutz der Moorpflanzen für unsere sächsische Heimat geworden ist, denn, so ursprünglich uns der geschützte Teil des Georgenfelder Moores erscheint, so sind durch Entwässern und Abbau bisher doch einige der auf Abbildung 10 dargestellten Charakterpflanzen verschwunden; darunter das Schlammried (Carex limosa), das sich vereinzelt noch am Galgenteich entdecken läßt, die Krähenbeere (Empetrum nigrum), die noch den benachbarten Kahlen Berg besiedelt, und die Rosmarinheide (Andromeda polifolia), die bisher von uns nicht wieder aufgefunden wurde.
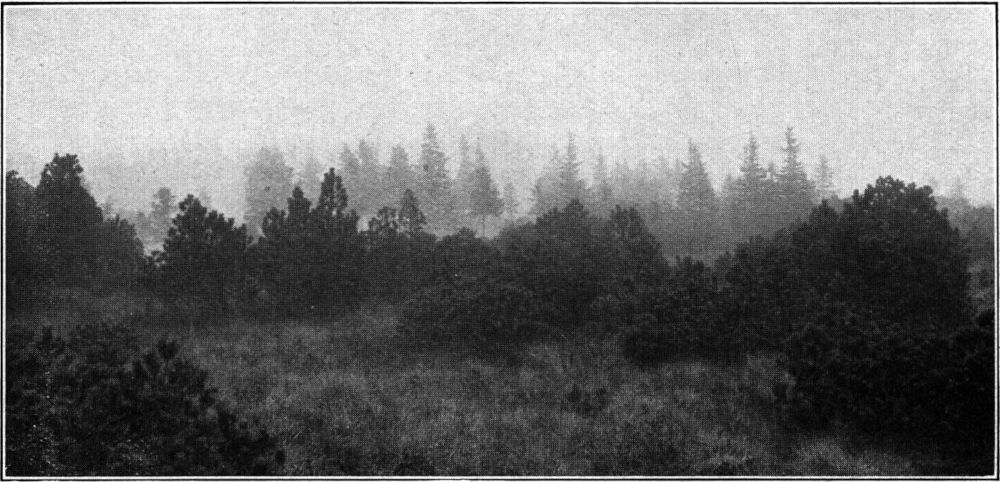
Dafür ist uns durch Frau Marschner eine floristisch wichtige Wiederentdeckung geworden: Der herbduftende, weißblühende Strauch des Sumpfporstes [38](wilden Rosmarins) Ledum palustre ist im neuen Schutzgebiet vorhanden. An den Sandsteinklippen des Winterberggebietes in der Sächsischen Schweiz gedeiht er noch in erfreulicher Menge, da er sich dort durch seine Unzugänglichkeit schützt (vgl. Heimatschutzmitteilungen Bd. I, Heft 12, Abb. 14). In meiner Isisabhandlung: Die Vegetationsverhältnisse des östlichen Erzgebirges, habe ich auf dieses Moorvorkommnis [39]mit folgenden Worten hingewiesen: »Nach einer Mitteilung des Prager Professors Domin ist in Zinnwald auch Ledum palustre vorgekommen. Ausgeschlossen wäre dies nicht, da Filzteich (bei Schneeberg) und die Johanngeorgenstädter Moordistrikte, auch Satzung und Seeheide bei Neuhaus diese ostbaltische Moorpflanze sicher enthalten.« Gerade diesem Strauch, der infolge des sogenannten Ledumkampfers bitteraromatisch schmeckt und narkotisch wirkt, mag viel nachgestellt worden sein, denn vielfältig ist seine Volksnutzung. Seine Zweige, zwischen Wäsche und Pelzwerk gelegt, vertreiben die Motten (Mottenkraut!); die Bienen lieben den Strauch, darum reiben die Bienenväter ihre Stöcke und Körbe damit aus (Zeidheide!); auch die Brauer bedienten sich in Ermangelung des Hopfens dieses Strauches zum Bittermachen des Bieres, teilten ihm aber gleichzeitig eine nachteilige, berauschende Wirkung mit. In Rußland wird übrigens ein daraus destilliertes Öl zur Juchtenbereitung verwendet.
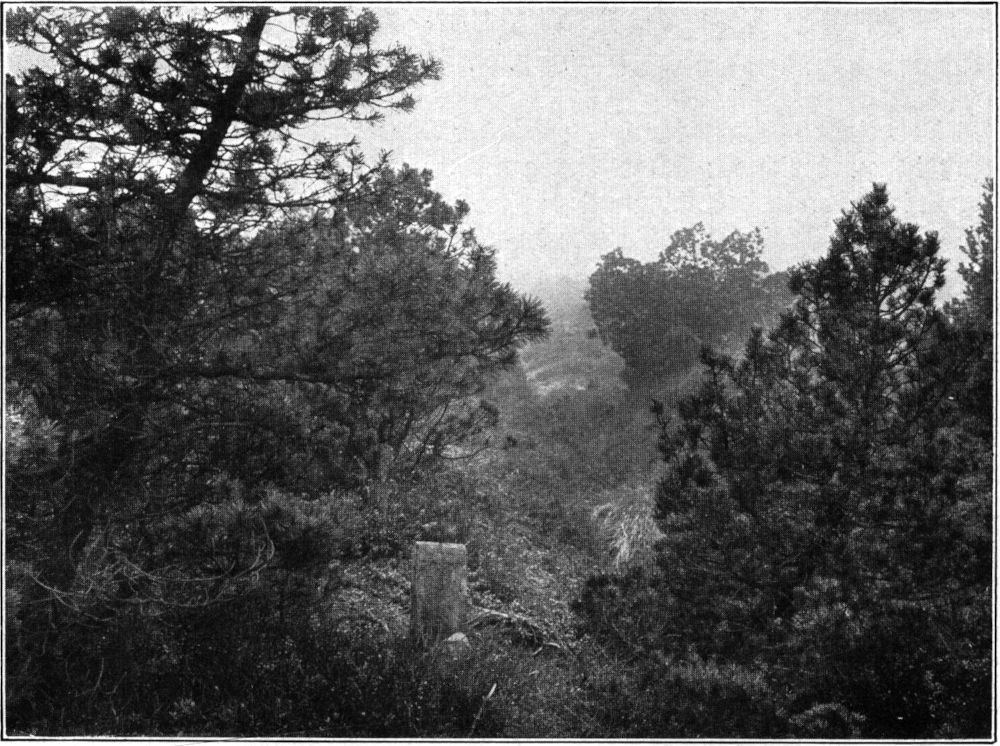
Im westlichen Teile des Erzgebirges ist der große Kranichsee, ein Hochmoorgebiet nahe Carlsfeld, bereits seit dem Jahre 1912 ein sächsischer Schutzbezirk (Abb. 4)[1].

Ein weiterer geschützter Moorteil auf dem Erzgebirgskamm ist die nördlich von Reitzenhain gelegene, vorweltlich anmutende Mothhäuser Heide (Abb. 5). [40]Dieselbe wurde im November 1915 durch das Finanzministerium in entgegenkommender Weise als Naturschutzbezirk erklärt. Gerade dieser Teil unserer Kammoore zeigt die Moorkiefer nicht nur in der niederliegenden, nach außen aufstrebenden Form, sondern, wie Abbildung 6 erkennen läßt, auch die »Spirke« genannte hochstämmige Hakenkiefer, wie sie in den trockenen Randgehängen der Sebastiansberger Moore so schön und eigenartig in Erscheinung tritt und bis zur Höhe von sechs Metern heranwächst. Auch im westlichen Teil des Erzgebirgskammes tritt uns diese hochwüchsige Form entgegen, und zwar in der Nähe des bekannten, leider stark abgebauten Filzteichmoores, nicht weit von der Forstmeisterei Hundshübel (Abb. 7 und 8). Wir sehen eine vom Torfstechen noch unberührte Waldecke, die aus dieser aufrechten Form gebildet ist und im Vordergrund einen schönen Bestand von Moorheidelbeeren (Trunkelsbeere) und Krähenbeere darbietet. Diese beiden Charakterpflanzen unserer Kammoore finden sich auch auf dem Mothhäuser Schutzgebiet wieder und werden dort erfreulicherweise noch durch die Rosmarinheide (Andromeda polifolia) wirksam ergänzt.

Meist sind in einem einzigen Moore nicht alle moorbotanischen Schätze vorhanden, besonders die seltenen Arten, zumal arktische Relikte, wie Zwergbirke, Moltebeere und manche Seggenarten suchen wir vergeblich. Auf dem sächsischen Anteil unserer Erzgebirgsmoore z. B. findet sich die reizvolle nordische Zwergbirke mit ihren lederigen rundlichen Kleinblättern nicht mehr, aber [41]sowohl das Gottesgaber Moor, als auch die Sebastiansberger Moore zeigen davon noch ausgedehnte Bestände (Abb. 9).

Auch in dieser Hinsicht will der Heimatschutz im Georgenfelder Moor belehrend wirken, indem er bestrebt ist, an besonders geeigneter, eingezäunter Stelle die diesem Moore mangelnden moorgewohnten Pflanzen zur Schau zu stellen und dem Besucher ein möglichstes Gesamtbild deutscher Moorflora zu gewähren. In diesem »Moorgarten« Georgenfelds sollen zugleich Moorprofile mit kurzen Hinweisen auf die Entstehungsgeschichte dieser Jahrtausende alten Pflanzenformation aufgestellt werden (Abb. 11).

Ohne naturwissenschaftliche Vorkenntnisse und Führung wird der Laienbesucher eines Moores im ersten Augenblick enttäuscht sein: Das wilde, unwirtliche, nur mit niedriger Sumpfkiefer bewachsene Gelände will ihm nicht des Besuches wert erscheinen; aber bei naturwissenschaftlicher Belehrung wird ihm dieses letzte Stück Urwelt, diese im Witterungskampfe gestählte Vegetation, diese wundersame Kleinwelt der Moose und Flechten immer mehr ans Herz wachsen; immer mehr der verborgenen Schönheiten werden sich ihm entschleiern. Wunderbar wechselnde Landschaftszüge weiß dieses Moorgelände anzunehmen. Ich habe seine verschiedenen Jahresstimmungen kennen gelernt: im klaren Glanze des blauenden Frühlingstages, noch immer verbrämt mit dem Schneehermelin des Winters, im düstern Grau des Regenhimmels, beim Fauchen des Gebirgswindes, der [44]Schauer auf Schauer heranwirft und die Sumpfkiefern mit Nebelschleiern umspinnt, im Farbenbunt des Herbstes, wenn die Torfmoospolster leuchten vom frischen Altgold bis zum sattesten Purpur und tiefsten Violett. Immer war es gleich eindrucksvoll – ein Stück Urweltschönheit mit einem müden Greisenlächeln. Ja, altersmüde sind unsere Moore geworden, nicht nur durch Zutun der Menschen! Sind doch seit ihrer Entstehung Jahrtausende verflossen. Der Mensch, jener Allherrscher auf Erden, hat sich dieser alternden Bodendecke genaht, um Torf zu gewinnen, und hat ihr durch Gräben und Anstichflächen schwer vernarbende Wunden beigebracht (Schlußvignette).
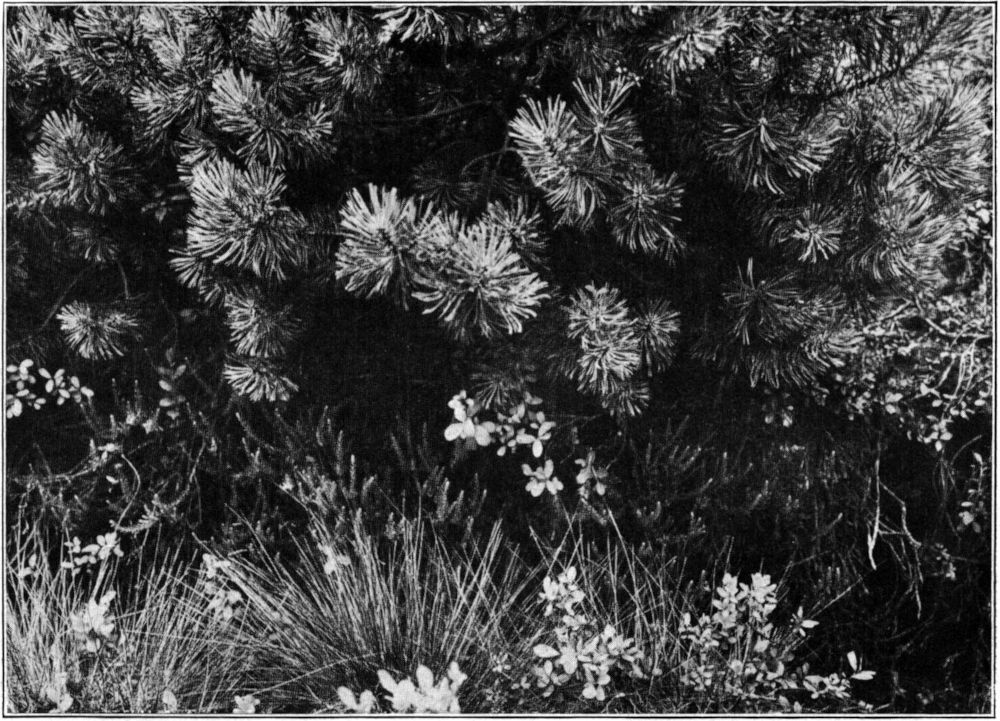
Über die Entstehung dieser Torflager ist viel gegrübelt worden, und noch immer gibt es ungelöste Probleme in Aufbau, Schichtenfolge und Alter dieser angehäuften Moorlager.

Der Hauptbestandteil aller Moorböden ist Humus. Derselbe entsteht durch Zersetzung absterbender Pflanzensubstanz, alterstoter Tierleiber und Kotausscheidungen; sei es in dem Röhrichtgürtel stehender Gewässer als Faulschlamm oder in dem aufgeschichteten Blättermeer abgefallenen Laubes als Moder, sei es in der sich ansammelnden Nadelstreu der Wälder oder in dem wurzeldurchsetzten Boden sumpfiger Sauerwiesen, sei es endlich in torfmoosbestandenen quelligen Mulden unserer Gebirge. Wenn abgestorbene Pflanzensubstanz reichlich durchlüftet wird, so verwest sie, d. h. sie verbrennt durch den Sauerstoff der Luft langsam zu Asche. Dort aber, wo bei angehäuften Pflanzenmassen der Luftzutritt gehemmt ist, findet eine Art Verkohlung statt, die sich durch Bräunung oder Schwärzung, also durch dunkle Farbe und durch teilweisen Verlust einer deutlichen Pflanzenstruktur kund gibt.
Solche Verhältnisse aber finden sich nicht bloß infolge dichter Lagerschichten, sondern auch bei reichlichem Durchtränken der absterbenden Pflanzen mit luftabschließendem Wasser, am besten natürlich, wenn beides zusammen wirkt. Gewöhnlich treten bei diesem Prozeß der Vertorfung Humussäuren auf, die bei mineralreichen Böden gebunden werden, aber bei mineralarmen, zumal kalkarmen Böden, als freie Säuren den meisten Pflanzen schädlich sind. Besonders schädlich erweist sich solch saurer Humus dann, wenn gleichzeitig mangelhafte Durchlüftung wurzelschädigend wirkt. Auch die Wurzel will bei ihrem Wachstum atmen, d. h. durch Sauerstoffaufnahme Verbrennungswärme und in ihr die nötige Betriebskraft zum Leben gewinnen. Da Trockenperioden durch die allzureichliche Wasserverdunstung jeglicher Humusbildung feindlich sind, so werden sich Moore nur in kühleren und feuchten Erdgebieten vorfinden können, oder dort, wo durch Nebel oder Schatten die Verdunstung gehindert wird. In den Tropen ist daher Moorbildung selten und Schimper meint, daß dort erst von zwölfhundert Metern Höhe an Rohhumus und Torf auftritt.
Über den Begriff des Rohhumus gehen noch immer die Ansichten auseinander. Er ist ein Produkt aus der Streudecke von Wäldern, das allmählich in den eigentlichen Mineralboden übergeht. Buchen-Rohhumus besteht oben [45]aus dichtem Trockentorf, während sich darunter eine Moderschicht ausbildet. Rohhumus bildet sich bei kühler Temperatur und bei durch den Wald zurückgehaltener, also geringerer Feuchtigkeit.
Dies Wenige über Rohhumus und Trockentorf! Für uns geht es nur um Vertorfung der Moore und um ihre Ursachen.
Bei der überreichen Feuchtigkeit, bei der geringen Durchlüftung und bei dem Säuregehalt können im Moore nur ganz bestimmte Pflanzenarten gedeihen (Abb. 10). Solche Pflanzen sind unter den Holzgewächsen die flachwurzelnden und wenig unter dem Boden hinstreichenden Heidesträucher, welche auch durch ein Zusammenwirtschaften mit Pilzmyzelien (Mycorrhiza)[2] zum Nahrungserwerb aus solch humusreichen Böden befähigt sind. Außerdem gehören hierzu mit inneren Luftreservoiren versehene Sauergräser, Binsenarten und Schachtelhalme und die nur mit feinen Haftfäden die Bodenoberfläche durchdringende Kleinwelt der Moose. Unter letzteren seien die Braumoose (Hypnum), die Haarmoose (Polytrichum) und ganz besonders die Torfmoose (Sphagnum) hervorgehoben. Bei den Sauergräsern möchte ich an die sumpfgewohnten Riedgräser (Carex) mit ihrer Ausläuferbildung, und an die Wollgräser (Eriophorum) mit ihrer Blatthorstbildung (Abb. 11) erinnern. Gerade die Wollgräser verraten ja mit dem reinen Weiß ihrer wehenden Fruchtfahnen besonders eindringlich mooriges Gelände (Abb. 12, aus Naumann, A.: Praktische Wege des Heimatschutzes S. 14).
Bei beginnender Moorbildung aus stehenden Gewässern nehmen lebhaften Anteil die Röhrichtpflanzen, die fußtiefes Wasser vertragen können, hierzu gehören Schilfrohr (Phragmites), Rohr- und Igelkolben (Typha, Sparganium) und die nordische Dreizackpflanze der Scheuchzeria, ferner die Sumpfschachtelhalme, besonders Equisetum limosum. Die meisten der bisher aufgeführten Gewächse lassen die jährlich absterbenden Blattreste oder Ausläufersprosse infolge Luftabschlusses durch Wasser vertorfen, während sie von innen heraus neue Sprosse treiben, wie die horst- und ausläuferbildenden Riedgräser; wieder andere sterben im ganzen unteren Teil ab, um am oberen Ende weiter zu wachsen, wie die vorher genannten Moose. Während die letzteren das Moorgelände immer höher aufbauen müssen, also Hochmoore (Moosmoore) entstehen lassen, werden die anderen Gewächse sich mehr in die Fläche, also horizontal ausbreiten und mit ihren Ausläufertrieben Neuboden in Besitz nehmen. Es werden Flachmoore (Niederungsmoore, Riedmoore, Grünmoore) gebildet.
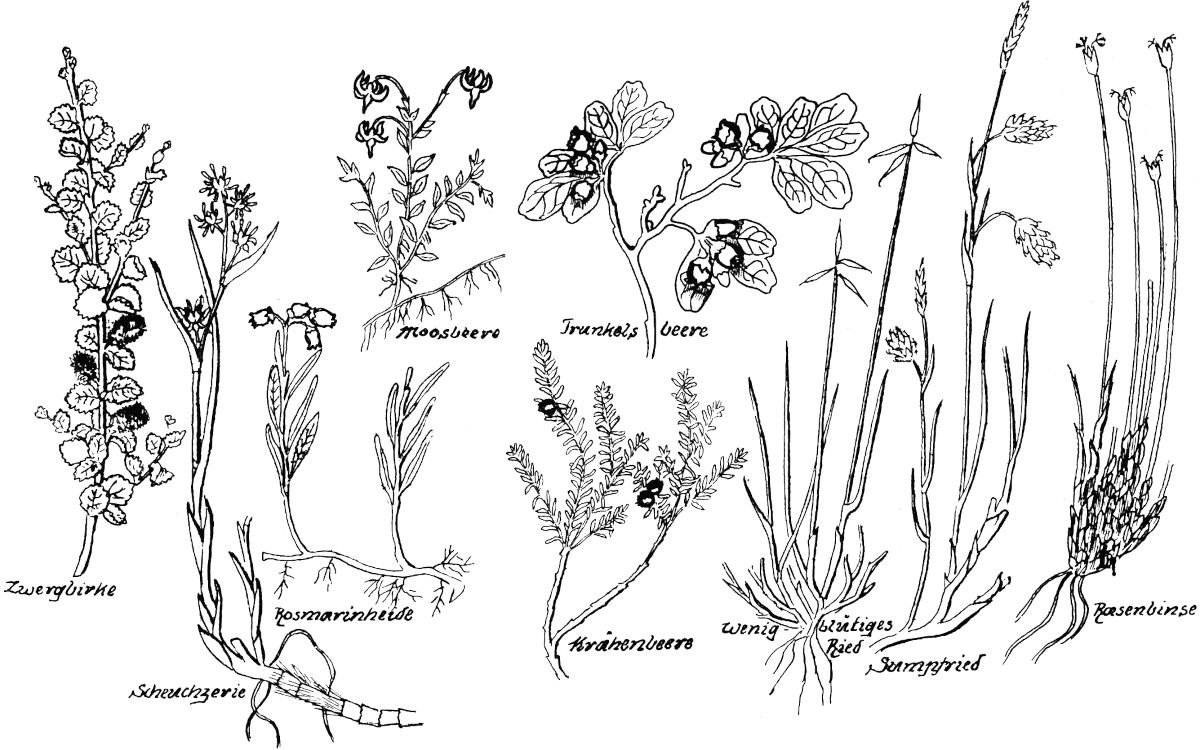
In Deutschland nehmen die Moorflächen noch immer einen großen Raum ein. Von Hochmooren seien hervorgehoben das Bourtanger Moor (etwa dreitausend Quadratkilometer), das Teufelsmoor [47]bei Bremen, und in Ostpreußen das etwa einhundert Quadratkilometer bedeckende große Moosbruch.

Flachmoore begleiten meist Stromtäler. Zu ihnen darf man rechnen den Spreewald, das Oderbruch, das Lebamoor in Pommern und die ausgedehnten Erlenmoore am kurischen Haff. Sie alle werden teils abgebaut auf Brenntorf oder wurden und werden umgewandelt in Kulturland. Austrocknende Moore werden meist in Besitz genommen von Sträuchern: in Norddeutschland östlich der Elbe von Strauchbirke (Betula humilis), von Gagelstrauch [49]Myrica Gale, von Sumpfporst; oder von Zwergsträuchern: Trunkelsbeere Vaccinium uliginosum, Heidel- und Preißelbeere, auch von Krähenbeere Empetrum nigrum (Abb. 13). Vor allem das Heidekraut (Calluna vulgaris) mit seiner unverwüstlichen Lebenskraft überzieht schließlich jene Moorgebiete besonders bei sandig-grusigem Untergrund, während in bruchigem Gelände, zumal im Nordwesten unseres Vaterlandes, in der Lüneburger Heide, die reizvolle Glockenheide Erica tetralix sich ansiedelt, und der Wacholder (Machandelbaum, Knisterbusch) Juniperus communis seine dunklen Säulenpyramiden baut, um der Landschaft einen lieblich herben Reiz zu verleihen.
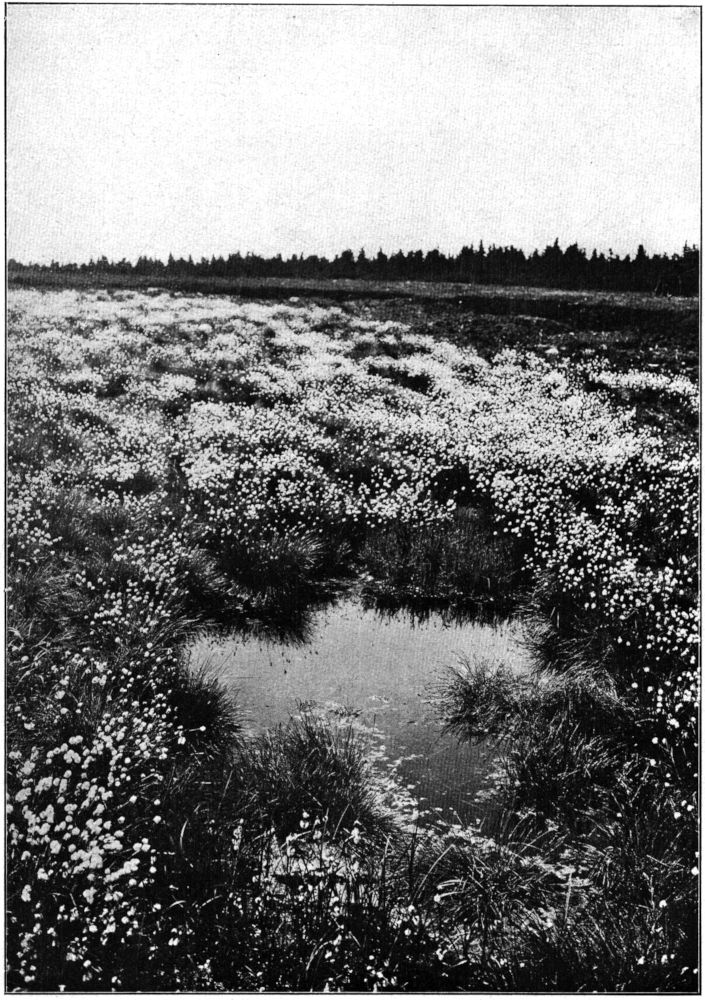
Wir lernen hieraus, daß bei klimatischen Veränderungen, bei Trockenperioden oder bei künstlicher Trockenlegung ursprüngliche Pflanzenbestände bis zum Verschwinden unterdrückt werden können durch andere Pflanzengenossenschaften. Das ganze Landschaftsbild verändert sich: auf das feuchte Moor folgte die trockene Heide; eine Vegetationsformation löst die andere ab. Folgeformationen bezeichnet man mit dem Namen Sukzessionen (Nachfolge). Kaum eine natürliche Pflanzenformation ist eine Dauerformation. Im Laufe geringerer oder gewaltigerer Zeiträume erschöpfen sie sich selbst, und Pflanzenbestände, die vorher unterdrückt waren, entfalten sich zu formationsmäßigen Beständen. Professor Schimper schildert anschaulich den in allen Klimaten angesagten Kampf zwischen Gehölzflur und Grasflur, bei uns zwischen Wald und Wiese und zwischen Moor und [50]Wald. Auch die Entstehungsgeschichte der Moore zeigt solche natürliche Sukzessionsglieder. Aus einem stehenden Gewässer wird allmählich ein Flachmoor. Mit ihm wechselt Bruchwald und Trockenwald, bis schließlich ein Hochmoor entsteht, das wiederum neuen Formationen, beispielsweise der Heide, Platz macht. Daher deckt sich auch i. a. das Gebiet der größten Hochmoorflächen in Norddeutschland nahezu mit dem Gebiet der norddeutschen Heide.

Von solchem Formationswechsel, herbeigeführt durch den Wechsel klimatisch feuchter und trockener, kühler und wärmerer Erdperioden, gibt uns das Anstichbild eines Moores, das sogenannte Moorprofil (Abb. 14), anschauliche Kunde.
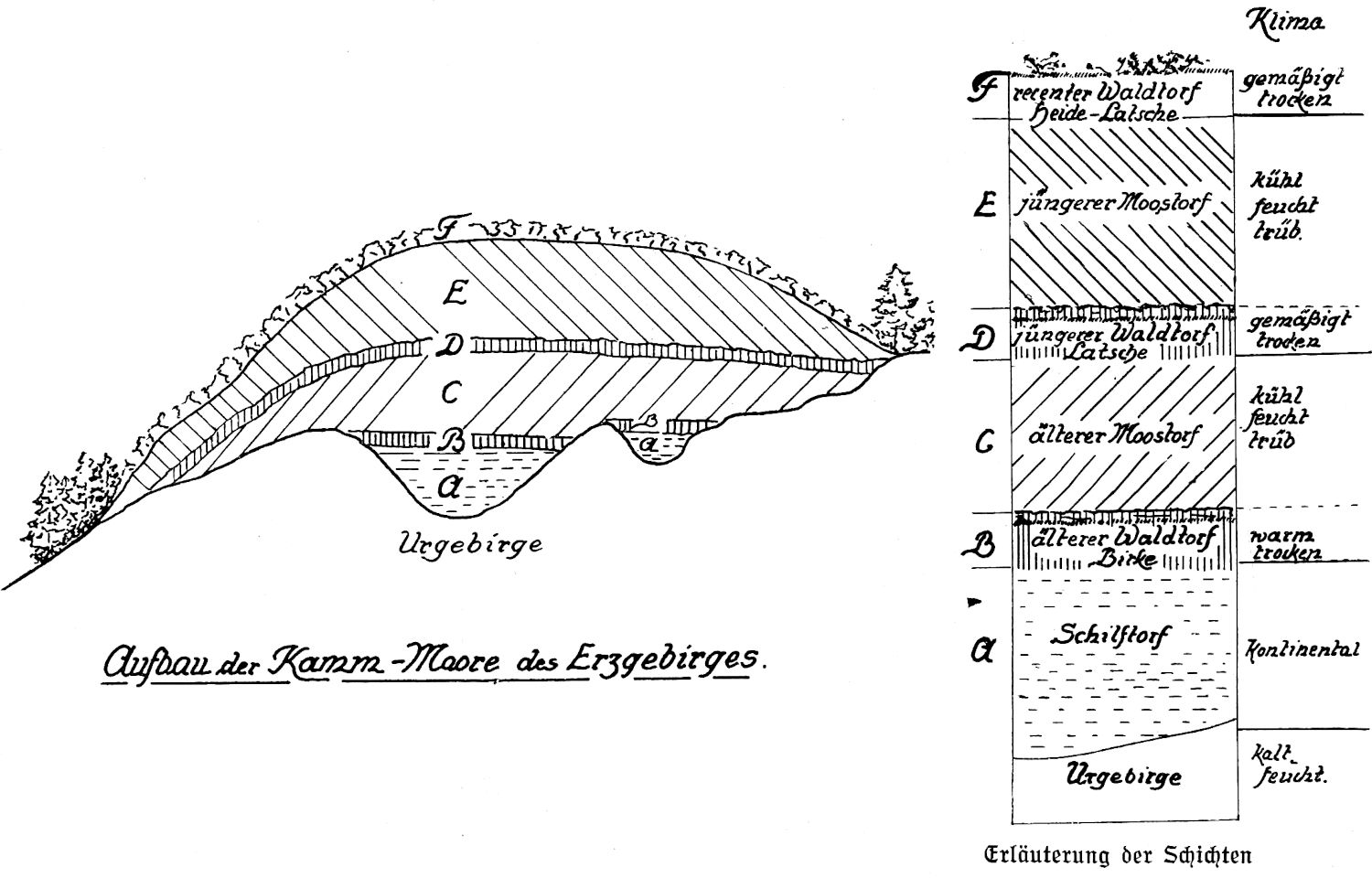
Es gab eine Erdperiode mit derartigem Kälterückschlag, daß von den schottischen und skandinavischen Gebirgen breite Gletscherströme sich in das Herz Mitteleuropas ergossen und eine gewaltige Decke von Inlandeis bildeten. Blockwälle wurden von den Gletscherstirnen vorausgeschoben und führten nordische Pflanzen, darunter auch viele unsrer jetzigen Moorgewächse, mit sich. Viel Jahrtausende lastete dieses Eisschild über dem nördlichen Mitteleuropa – freilich auch hier bei klimatischen Schwankungen bald vorstoßend, bald sich zurückziehend – bis schließlich die Wärmelage der Jetztzeit das Abschmelzen des Eises bewirkte. Dort, wo die nordischen Verhältnisse annähernd auch bei uns herrschen, also Kälte und Feuchtigkeit, konnte sich diese nordische Flora erhalten, und zu ihr gesellten sich alte kühlegewohnte Pflanzenbürger Mitteleuropas. Solche Zufluchtsorte waren die Moore, die sich daher in dem feuchtkühlen Seeklima Deutschlands mit seinen restlichen Binnenseen und ferner auf den feuchtkühlen Kammhöhen unserer Mittelgebirge mit ihren quelligen Hängen häufen mußten. Jedenfalls gab die gewaltige Durchfeuchtung des eisfreien Diluvialbodens durch die Schmelzwässer des Inlandeises den Mooren die günstigsten Entwicklungsbedingungen, sei es aus durch die Schmelze entstandenen Binnenseen, sei es längs der durchnäßten Uferlandschaft der Urströme. Daher sind auch unsere meisten Moore auf Diluvialboden erwachsen[3], so daß in den Mooranstichen, welche bis tief hinab zum gewachsenen Diluvialboden reichen, geradezu ein erdgeschichtliches Archiv geöffnet wird. Die ältesten Moore finden wir in Norddeutschland, und Dr. C. Weber hat von ihnen ein Normalmoorprofil entworfen, welches auf die Entstehung aus Binnengewässern gegründet ist. Solche Moore sind lakustrisch, d. h. seenbürtig, entstanden. Die Entstehungsgeschichte der Einzelschichten ist lehrreich: Absterbende pflanzliche und tierische Organismen des Sees, zumal der reichen Uferflora und -fauna, erhöhen allmählich den Seegrund und bilden eine sich verdichtende Schlammschicht, Mudde genannt, die zu unterst ton- und kalkreich ist: Ton- und Kalkmudde. Die höheren Schichten zeigen fast reine organische Substanz in gallertartig vertorftem Zustande. Weber nennt diese Schicht Lebermudde oder Lebertorf (Sapropel). Auf diesen sich erhöhenden Schlammschichten siedelte sich [52]immer wieder neues Röhricht an, besonders das Schilfrohr, sowie ausläufer- und horstbildende Seggen (Carices), so daß sich darauf die Torfmudde schichtet. Immer seichter wird durch diese Auflagerung der Moorsee, immer weiter vom Ufer aus rückt diese Röhrichtformation aus Schilf, Rohrkolben, Schwertlilie, Riedgräser und Straußselberich (Lysimachia thyrsiflora) in die Seemitte vor, bis schließlich unter Mithilfe von Laichkräutern Froschbiß, Krebsscheere (Stratiotes) der See völlig verlandet, anfangs noch mit trügerischer Decke, als »Schwingmoor«, später sich zum »Standmoor« festigend. Ein muldenförmiges Flachmoor oder Niederungsmoor ist auf diese Weise entstanden. Der durch diese Verlandung gebildete Torf heißt Schilf- und Seggentorf. Vom erzgebirgischen Moorforscher Schreiber wird er als Riedtorf bezeichnet, denn bei den Erzgebirgsmooren ist die Verlandung unter Anteilnahme des untergetauchte Polster bildenden Torfmooses (Sphagnum [53]molluscum) und vorrückende Ausläufer bildende, riedartige Pflanzen z. B. Schlammried und Scheuchzerie zustande gekommen (Abb. 15). Auf diese Weise überziehen sich die Moortümpel, vom Volke poetisch Mooraugen genannt, mit einer trügerischen unter den Tritten des Besuchers schwankenden Moos- und Rieddecke, wie wir sie besonders schön am Kranichseemoor und an einzelnen Stellen des Gottesgaber Moores studieren können (Abb. 16). Gerade diese Verlandungsbilder geben der Hochmoorlandschaft unseres Erzgebirges ein besonders charakteristisches Gepräge.

Auf den schließlich entstehenden Standmooren war neue Siedelungsmöglichkeit geschaffen. Strauchvegetation aus niedrigen Weiden, auch die Erle faßten Fuß, und Bruchwälder entstanden, die mit ihrem feuchtkühlen Schatten dem Mooswachstum Vorschub leisteten, bis schließlich der Bruchwald unter dem Moosansturm erstickte, umbrach und der Vertorfung anheimfiel. Wieder erhöhte sich dadurch der Boden und der Bruchwaldtorf entstand. Neue Pflanzensiedlungen konnten natürlich mit ihren Wurzeln nicht mehr zu dem nährstoffreichen Grundwasser gelangen, denn die aufgehäuften Schichten hinderten daran. Es mußte das nährstoffarme Niederschlagswasser zum Leben und Wachstum genügen. Solche genügsame Holzgewächse waren Kiefer und Birken. Es entstand ein Übergangswald, beziehungsweise ein Zwischenmoor, dessen Vorhandensein [54]nicht in allen Moorprofilen nachweisbar ist. Auch dieser Wald wurde von Scheuchzeria- und Riedgrasbeständen, sowie durch Moossiedelungen besiegt und schließlich herrschte das Torfmoos, welches schon bei einer Schichthöhe von dreißig Zentimetern Kiefernwald ersticken kann. Es herrschte durch seinen porösen Bau in Blatt und Stengel (Abb. 17), welcher imstande war, große Niederschlagsmengen festzuhalten, Ammoniakgase in sich zu verdichten, vor allem aber trotz des vertorfenden unteren Teiles oben freudig weiterzuwachsen. Derart bildete sich ein uhrglasförmig gewölbtes Hochmoor mit trocknerem Randgehänge und seeartigen Blänken (Mooraugen), die sich aus den vom wassersatten Moose nicht aufgenommenen Niederschlägen sammelten. An dem trockneren Randgehänge erheben sich vielfach kleine, oft nur quadratmetergroße Heidehügel, sogenannte Bulte. In den dadurch entstehenden Tälchen sammelt sich ebenfalls Ablaufwasser an, sie werden zu Schlenken. Oft auch bilden sich zum Rande gehende tiefere und längere Rüllen, in welchen bräunliches Moorwasser abfließt. Fließendes Wasser aber versorgt die Rüllenränder mit immer neuen Nährstoffen, so daß sich hier eine anspruchsvollere Hochstaudenflur ansiedelt.

Ein solches Hochmoor gedieh, so lange die jährlichen Niederschlagsmengen reichlich flossen. Ziemlich unvermittelt scheint aber in ganz Mitteleuropa eine Trockenperiode, vielleicht eine Steppenzeit, eingetreten zu sein. Das Wachstum des Moosmoores stockte, und der Moostorf zersetzte sich durch Lufteintritt zu einer dunkelbraunen, strukturarmen Masse. Wie lange diese Trockenheit angehalten hat, ist nicht zu ermitteln. Sicher ist aber, daß auf dem trocken gelegten Moore Heidekraut und Wollgras Platz fanden, die allmählich, wahrscheinlich [55]bei Wiedereintritt reicher Niederschläge, zu einer mulmigen Torfschicht zusammenschwanden. Dieser stark zersetzte Torf wird von Weber Grenzhorizont genannt und findet sich nicht bloß in den norddeutschen und schwedischen Mooren, sondern auch in den Höhenmooren der Mittelgebirge und des Alpenlandes. Bei den Höhenmooren, also auch im sächsischen Erzgebirge, scheint aber anstelle von Heide- und Wollgras ein Trockenwald von Birken aus der Umgebung eingedrungen zu sein, so daß Schreiber, der Erforscher erzgebirgischer Moore, diese Grenzschicht als jüngeren Waldtorf bezeichnet. Auf diese Schicht baut sich, begünstigt durch einsetzende Niederschlagsperiode, ein neues Hochmoor mit fast reinem Sphagnumbestand, aus dem der gelbgefärbte, wenig zersetzte jüngere Moostorf hervorging, dessen Entstehung überall dort noch andauert, wo nicht aus natürlichen Gründen, oder, durch Menschenhand verursacht, Austrocknung die Moosbildung verhindert. An den trockneren Randgehängen unserer Erzgebirgsmoore finden wir als Charakterstrauch die vielästig vom Boden aufstrebende Moorkiefer, eine Unterart uncinata der eigentlichen Bergkiefer Pinus montana (Abb. 18), während in den norddeutschen Zwischenmooren die Krüppelkiefer Pinus silvestris forma turfosa erscheint.
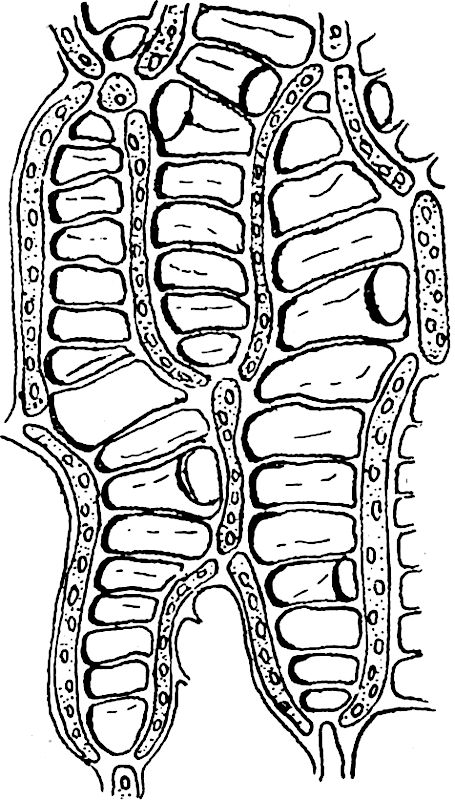
Wir fassen noch einmal die Schichtenfolge eines Moorprofils kurz zusammen: Zu unterst Diluvialboden, dann die Muddeschichten, Schilf- bzw. Seggentorf, Bruchtorf oder älterer Waldtorf, älterer Moostorf, Webers Grenzhorizont, bzw. jüngerer Waldtorf, jüngerer Moostorf und rezenter Moostorf. [56]Diese Schichten erreichen in den Mooren der norddeutschen Niederung über dem Diluvialboden eine Mächtigkeit von mehr als zehn Metern, in den Erzgebirgshochmooren bis zu fünf Meter. In der Höhe der Moorschichten hat man ein Mittel, schätzungsweise das Alter des Moores zu bestimmen. Halbreifer Moostorf bildet in hundert Jahren eine Schicht von etwa acht Zentimetern, reifer Moostorf dagegen in derselben Zeitspanne eine Schicht von zwei bis drei Zentimetern, so daß ein sechs bis sieben Meter mächtiges Moorlager einer Entstehungszeit von mindestens zehntausend Jahren bedarf.

Bei der inneren Verschiedenheit der genannten Moorschichten ist es klar, daß die wirtschaftliche Verwendung des Torfes nur an bestimmte Schichten gebunden ist, und zwar vornehmlich an die Moostorfschichten. Der braunschwarze, ältere Moostorf ist im nassen Zustande eine schwarzbraune, breiige Masse, die beim Austrocknen steinhart wird und das Aufsaugungsvermögen für Wasser verliert. Er liefert den wertvollen Brenntorf! Der jüngere hellbraune Moostorf (gegenüber dem schwarzen Torf auch Weißtorf genannt) bleibt immer elastisch und kann auch nach Austrocknen das zwanzigfache seines Volumens an Wasser aufnehmen. Er kann mit Vorteil zu Torfstreu und Torfmull verarbeitet und in Ballen gepreßt in den Handel gebracht werden. Er ist es, der im Gartenbau so geschätzt wird, besonders wenn er durch Lagerung, Umstechen oder Behandlung mit Kalkwasser entsäuert ist. Er vereinigt in sich noch immer all die wertvollen Eigenschaften des Humus, die ich folgendermaßen gekennzeichnet habe[4]. Er hält die Nährstoffe im Boden fest, er macht die Böden warm und feucht, er lockert zähe Tonböden auf und macht durch die Humuskolloide Sandböden krümelig, er löst als Kohlensäurequelle die Mineralteilchen und führt unverwertbare Stickstoffverbindungen schließlich in Salpeterstickstoff über. Was Jahrtausende im ewigen Wechsel der Zeiten aufgebaut haben, wird, gleich der vor Jahrmillionen aus einer vergangenen Pflanzenwelt aufgebauten Kohle, dem jetzigen Geschlechte zu Nutzen und Segen.
Ein volkswirtschaftlicher Gewinn ist weiterhin die erwähnte Umwandlung der ausgedehnten norddeutschen Moorflächen in wertvolle Kulturböden, wie sie durch die Moorkulturstationen geübt wird. Gewarnt aber muß werden vor dem rücksichtslosen Abbau der Kammoore unserer Mittelgebirge, also auch unseres sächsischen Erzgebirges. Sie sind meist Plateau- und Hangmoore und leisten für uns das, was für die Schweiz die Gletscher schaffen: Sie regulieren in rationeller Weise die reichen Niederschläge der Gebirgshöhen. Manche Wasserkatastrophe wäre vermieden, manche kostspielige naturmordende Talsperre wäre erspart worden, hätte man die Moorflächen, welche etwa vier Prozent der Gesamtfläche von Sachsen einnehmen, nicht durch Abbau, Aufforstung und Trockenlegung verringert. Welche gewaltigen Wassermengen von unseren Moosmooren aufgesaugt [57]werden können, erhellt eine Mitteilung des Professors Delitzsch, Leipzig, über den Kranichsee. Nach ihm enthält der Kranichsee nahe Karlsfeld bei vollständiger Sättigung soviel Wasser, daß er ein ganzes Jahr lang in jeder Sekunde fünfhundert Liter Wasser liefern könnte. In dem »Kranichsee« ist wohl das ausgedehnteste sächsische Kammoor des Erzgebirges geschützt, und wir dürfen dies als eine Großtat unserer Heimatschutzbestrebungen buchen.
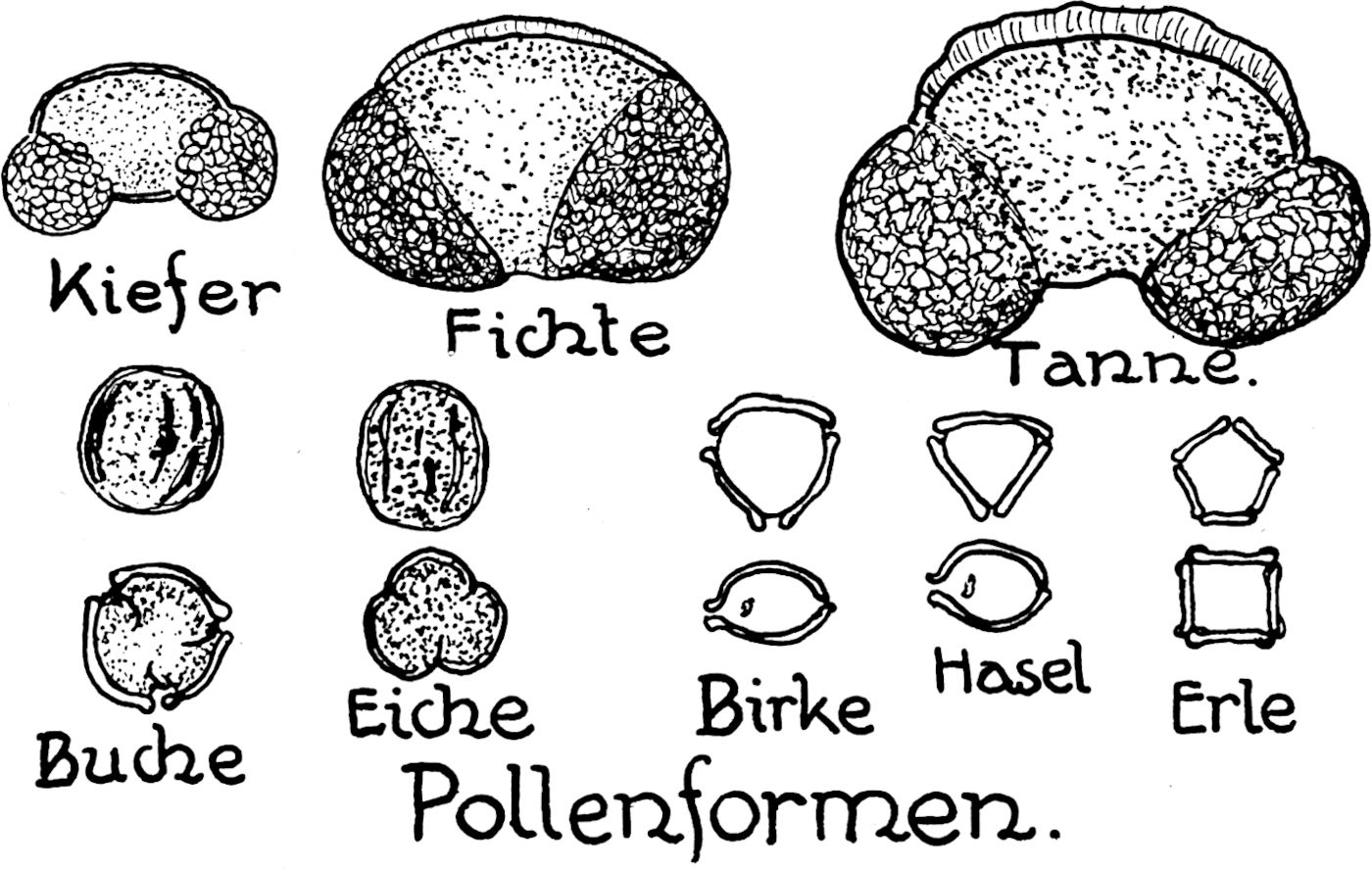
Gerade in jüngster Zeit hat Professor Karl Rudolph von der Deutschen Universität Prag im Verein mit Dr. Firbas einen wertvollen Beitrag zur Erforschung unserer Erzgebirgsmoore geliefert. Diese Veröffentlichung führt den Titel: Die Hochmoore des Erzgebirges, ein Beitrag zur postglazialen Waldgeschichte Böhmens. In dieser anregenden Schrift wird, nach dem Vorbild schwedischer Moorforscher, versucht, einen Einblick zu gewinnen in die Wälder der Moorumgebung, wie sie nach der Eiszeit, also »postglazial«, in wechselnden Beständen den Erzgebirgskamm schmückten. Wenn wir die seit dem Diluvium (Eiszeitalter der Erde) verflossene Zeit auf etwa fünfzigtausend Jahre schätzen, so muß es uns Wunder nehmen, wie man Schlüsse wagen will auf die Waldumgebung unserer Moore vor vielen Jahrtausenden.
Hierzu befähigt uns eine genaue Kenntnis des Blütenstaubes (Pollen) unserer hauptsächlichsten Waldbäume, sowohl der Nadel- als auch der Laubbäume. (Abb. 19.) Diese Blütenstaubzellen sind äußerst kleine Gebilde. Wir messen sie in Tausendstel eines Millimeters, des sogenannten Mikro, als Maßeinheit und bezeichnen dieses Kleinmaß mit dem griechischen Buchstaben µ. Den Pollen unserer wichtigsten Nadelbäume: Kiefer, Fichte und Tanne kann man von dem Laubbaum-Pollen sofort unterscheiden durch die ihm beiderseits anhängenden [58]zu weiter Verbreitung dienenden Flugblasen, außerdem auch durch die erheblichere Größe. Den kleinsten Pollen unter den Nadelhölzern besitzt die Kiefer mit 60 µ, das Mittelmaß des Fichtenpollens beträgt 100, das der Tannen 140 µ. Die dreieckigen Pollen von Birke und Hasel messen beide etwa 25 µ, und sind schwer zu unterscheiden; von etwa gleicher Größe ist der fünfeckige Pollen der Erle. 30 µ im Durchmesser halten die einander sehr ähnlichen kugeligen Pollenzellen von Buche und Eiche. Den kleinsten Pollen von etwa 15 µ besitzt die Weide.
Der Blütenstaub der das Moor umgebenden Waldbäume wurde, wie noch heute, so vor Jahrtausenden alljährlich in ungeheurer Menge erzeugt, so daß er, von den Bergwäldern verweht, aus ziemlicher Ferne auf die Moorfläche gelangen konnte. Werden doch von der Fichte auf eine Entfernung von vier Kilometern noch vierzehn Prozent, bei Birke noch elf Prozent des Gesamtpollens durch den Wind vertragen. Auf den baumlosen Farör-Inseln hat man sogar Baumpollen beobachtet, der aus einer Entfernung von vierhundert Kilometern stammen mußte.
Nun wird in jedem Denkenden die Frage auftauchen, ob sich diese zarten und winzigen Gebilde in den vor Jahrtausenden gebildeten Moorschichten auch unversehrt oder wenigstens kenntlich erhalten haben, besonders wenn wir den Druck der Schichten und die Wirkung der Humussäuren in Betracht ziehen. Gewiß! Nicht alle Pollenarten sind uns überliefert, der Blütenstaub mancher Bäume, z. B. Ahorn und Pappel, ist unter solchen Bedingungen zugrunde gegangen. Aber bei den oben genannten Holzgewächsen ist die meist wunderbar ornamentierte wachsartige Außenhaut der Pollenzellen durch die Jahrtausende hindurch wohl erhalten geblieben. Zwar sind gegen den Pollen von heutzutage die Maße etwas zurückgeschwunden, aber Form und Ziselierung sind unversehrt. Wir werden also aus den Verhältniszahlen der in den Schichten befindlichen Pollenarten zueinander ein ungefähres Bild von der Waldbedeckung jener Zeit gewinnen können, während welcher jene Schichten entstanden.
In dem Vorherrschen einer Baumart besitzen wir außerdem gewisse Anhaltspunkte, um auf die Klimalage jener weit zurückliegenden Waldperioden rückschließen zu können. Wir wissen, daß die feuchtgewohnten Weiden und Erlen starke Niederschläge gebrauchen, daß dagegen Birke und Kiefer mit geringen Niederschlägen und wenig Wärme fürlieb nehmen. Die Fichte dagegen bedarf bei kühler Temperatur einer mittleren Bodenfeuchtigkeit, während die Tannen starke Luftfeuchtigkeit und die Buche eine nicht zu tiefe Wintertemperatur erfordern; die Eiche hingegen braucht zu freudigem Gedeihen eine erhöhte Sommerwärme. Alle diese Erwägungen zusammengefaßt, berechtigten uns recht wohl, Schlüsse zu machen auf die seit der Eiszeit periodisch erfolgten Klimaschwankungen in unsern Breiten.
Noch einige Worte über die Methodik der Pollenuntersuchungen in unsern Mooren. Die Methode, welche die obengenannten Forscher angewandt haben, lehnt sich an die vom schwedischen Staatsgeologen Post eingeschlagene an. Aus [59]der Stichwand eines Moores werden von unten nach oben in Abständen von zehn bis fünfzehn Zentimetern Schichtproben entnommen. Diese Proben (etwa ein bis zwei Kubikdezimeter Torf, für mikroskopische Untersuchungen höchstens fünfzig Kubikzentimeter) werden zerkleinert und mit fünfzehnprozentiger Salpetersäure aufgeschlämmt. Nicht völlig ausgetrocknete Torfproben zerfallen alsdann in ein bis zwei Tagen in die einzelnen Pflanzenbestandteile und werden dabei gleichzeitig aufgehellt. Das Ganze wird alsdann durch ein Haarsieb geschickt und der Siebrückstand wird makroskopisch untersucht. Mittelst dieser Untersuchungen können wir die jeweilig moorbildenden Großpflanzen und Moose herausfinden. Beispielsweise ergab eine Probe des Reißzechenmoores bei Gottesgab in ein Meter vierzig Zentimeter Höhe über dem Diluvialgrund folgenden Pflanzenbestand: Sumpfschachtelhalm, Schlammried (Carex limosa), Schilfrohr und die früher erwähnte Scheuchzerie. Von den hier genannten Pflanzen kommt das Schilfrohr heute in diesen Gegenden nicht mehr vor, und die Scheuchzerie ist jetzt eine Seltenheit geworden.
Der durch das Sieb gegangene Feinschlamm soll uns zur mikroskopischen Bestimmung, besonders des Waldpollens, dienen. Natürlich finden sich auch Blütenstaubzellen von Heidegewächsen, Binsen- und Riedgräsern darin, aber gezählt werden auf den in Glyzerin-Gelatine ausgeführten Präparaten nur die Anteile der verschiedenen Baumpollen, so daß wir nicht nur eine qualitative, sondern auch eine quantitative Analyse der Pollenschicht gewinnen. In jedem Präparate zählen wir nicht mehr als einhundertfünfzig der darauf befindlichen Pollenkörner aus, notieren dabei die Anzahl der einzelnen Pollenarten und gewinnen dadurch das sogenannte Pollenspektrum. Dieses möge lauten: Kiefer einhundertelf, Birke dreißig, Fichte sechs, Weide drei. Daneben haben wir noch siebenundzwanzig Haselpollen gezählt, die wir im Pollenspektrum ausschalten. Diese Ausschaltung geschieht nach dem Beispiel von Post, der die Hasel, weil Unterholz, den eigentlichen waldbildenden Bäumen nicht gleichstellen will.

Für jede der untersuchten Höhenschichten erhalten wir ein solches in Artprozenten angegebenes Pollenspektrum und können das Gesamtergebnis unserer Untersuchungen für die betreffende Stichwand unter Zugrundelegung eines Koordinatensystems zu lehrreichen Diagrammen zusammenstellen, wie es in beigegebener Abb. 20 für Fichte und Buche geschehen ist. Auf der wagerechten Linie ist die Anzahl der errechneten Pollenprozente, auf der senkrechten die Schichthöhe der untersuchten Proben über dem Diluvialboden aufgetragen. Aus den beiden Pollenkurven kann man folgende Tatsachen herauslesen: Die Fichte zeigt sich zuerst im Riedtorf und dominiert zur Zeit des Scheuchzeriatorfes über alle anderen Waldbäume, geht alsdann zurück, um in der Jetztzeit (wahrscheinlich infolge der Forstkultur) wieder herrschend zu werden. Erst während der Fichtenherrschaft erscheint die Buche (mit ihr die Tanne), welche – wir dürfen annehmen aus klimatischen Gründen – den rasch abnehmenden Fichtenwäldern als Waldanteil gleichkommt und im jüngeren Moostorf eine dominierende Stellung erringt. In ähnlicher Weise läßt sich die Geschichte der [61]anderen Waldbäume während der Moorbildungszeit verfolgen. Für das Erzgebirge fassen Rudolph und Firbas die Waldgeschichte des Kammes folgendermaßen zusammen:
1. Kiefernzeit mit Birke und Weide;
2. Kiefern-Haselzeit. Massenausbreitung der jetzt fehlenden Hasel auf dem Erzgebirgskamm und wachsende Ausbreitung des Eichenmischwaldes mit Ulme und Linde;
3. Eichen-Fichtenzeit. Neben der Eiche Vorherrschaft der Fichte und Einwanderung der Buchen;
4. Buchen-Fichtenzeit. Wachsende Ausbreitung der Buche, Abklingen der Eiche und Hasel. Einwanderung der Tanne und deren Ausbreitung während der Grenzhorizontzeit;
5. Buchen-Tannenzeit. Vorherrschen von Buche und Tanne;
6. Jetztzeit. Neuerliche Ausbreitung der Fichte, wohl durch die Forstkultur.
Diese Waldgeschichte haben wir gelesen aus einem Buche, dessen Blätter die Moorschichten, dessen Buchstaben die Pollenkörner waren. Und wie sich in einem Buche Unrichtigkeiten und Druckfehler einstellen, so werden sich auch in der Methode der Pollenuntersuchungen Irrtümer und Fehlerquellen finden, aber alle Bemängelungen können nicht den großzügigen Inhalt dieses Naturbuches verwischen. Wir dürfen somit, wie Rudolph sagt, die Pollendiagramme auffassen als den Ausdruck der wechselnden Waldgeschichte unseres Erzgebirges seit der Eiszeit. Wir werden es dadurch umsomehr verstehen, daß sich der Heimatschutz auf die Moore als Urkunden der Vorzeit erstrecken muß. Wir werden mit einem ehrfürchtigen Schauer die geschützten sächsischen Moore durchwandern, und die scheinbare Eintönigkeit der Landschaft wird schwinden in dem Lichte, welches diese vergangene und vergehende Pflanzenwelt auf die Vorzeit wirft. Die einsame Größe dieser Landschaft macht uns klein und läßt uns so recht das Dichterwort empfinden:

[62]
Fußnoten:
[1] Vergleiche 10. Flugschrift des Heimatschutzes. Prof. Dr. A. Naumann: Das Kranichseemoor bei Carlsfeld im Erzgebirge, ein Naturschutzbezirk Sachsens.
[2] Bei vielen Pflanzen auf Humusboden finden wir anstatt der Wurzelhaare einen Überzug von Pilzgeflecht an der Wurzel. Solche verpilzte Wurzel heißt Mycorrhiza. Man nimmt an, daß das Pilzgeflecht (Myzel) von der Wurzel zu seinem Aufbau die Kohlehydrate erhält, während das den Boden durchspinnende Myzel für die Wurzel von weither die nötigen Nährsalze, vielleicht auch stickstoffhaltige Humusstoffe herbeiführt. Ein solches Zusammenwirtschaften zu gegenseitigem Nutzen bezeichnen wir als Symbiose.
[3] Wir kennen auch voreiszeitliche (präglaziale Moore). Sie zeigen durch ihre Pflanzenreste, darunter ein der serbischen Fichte (Picea Omorica) ähnliches Nadelholz, ein subalpines Klima an.
[4] Naumann, Dr. A.: Bau und Leben der Pflanze, eine Botanik des Praktikers. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
Von Rud. Zimmermann, Dresden
Mit drei Abbildungen nach Naturaufnahmen des Verfassers
Wenn das Nest der Dorngrasmücke in dem Rosenbusch unseres Gartens, dessen Werden wir fast von seinen ersten Anfängen an verfolgt haben, auf dem wir das Weibchen brütend über den fünf grau und bräunlich gesprenkelten Eiern sitzen sahen und in dem wir dann auch schon die geschlüpften Jungen schauen durften, eines Morgens zerrissen im Gezweige hängt und sein lebendiger Inhalt verschwunden, das Opfer irgendeines Räubers geworden ist – wir betrachten in derartigen Fällen fast immer eine Katze als den Frevler, ohne daß es eine solche immer gewesen zu sein braucht –, so ist mit Recht unser Bedauern groß und das Mitgefühl mit dem seines Familienglückes beraubten Vogelpaare ein lebhaftes. –
Wie viele von denen aber, die schon einmal Zeugen eines derartigen Vorganges gewesen sind, ahnen es, daß er eine ganz regelmäßige Erscheinung im Naturleben darstellt, wissen es, daß er sich tagtäglich hundertfältig ereignet und auch ereignen muß. Die Natur bringt ja alles im Überfluß hervor, rechnet mit derartigen Verlusten, die uns ja auch gar nicht zum Bewußtsein kommen überall dort, wo das Naturleben noch in normalen Grenzen sich abspielt. Würden alle Vogelnester ihre Bestimmung erfüllen, die Eier ausfallen und alle erbrüteten Jungen hochkommen und diese dann wieder in der gleichen Weise sich fortpflanzen, so würde schon innerhalb weniger Jahre eine derartige Übervölkerung in der Vogelwelt eingetreten sein, daß nicht nur diese sich gegenseitig selbst zugrunde richten würde, sondern daß darunter auch die übrige Natur leiden müßte und zum Teil wohl auch rettungslos vernichtet werden würde. Nur wo sich das Naturleben – fast ausschließlich nur unter dem Einfluß des Menschen und seiner Kultur – wesentlich geändert hat und ein ärmeres geworden ist, wo – um bei unserem Beispiel aus der Vogelwelt zu bleiben – der Vogelbestand einer Gegend eine gewisse untere Grenze erreicht hat oder gar bereits schon unter sie herabgesunken ist, wo umgekehrt aber auch wieder die die Vogelwelt bedrohenden Gefahren – und das ist eine weitere Begleiterscheinung des Menschen und seiner Kultur – größere geworden und vielleicht gar noch im Anschwellen begriffen sind, äußeren sich diese in einer verhängnisvolleren und den Bestand direkt bedrohenden Weise. Sache des Menschen ist es dann und zu seiner Pflicht wird es, die Gefahren nach Möglichkeit zu verringern und damit einen gefährdeten Vogelbestand wieder zu erhöhen und zu erhalten versuchen. Die Folgen seines Unterganges würden in den meisten Fällen den Folgen einer Übervölkerung ähnlich oder ihnen gleichbedeutend sein. Freilich ist der Versuch einer Vermehrung eines geschwächten Vogelbestandes eine Aufgabe, die nicht immer leicht ist und der auch oft genug der Erfolg versagt bleiben wird. – Um nun aber Gefahren von einem Naturgeschöpf abwenden zu können, ist es notwendig, diese Gefahren auch zu kennen, und so sei es mir denn heute [63]an dieser Stelle gestattet, gestützt auf eigenes, persönliches Erleben, einmal von den Gefahren zu reden, die unsere Vogelwelt in der wichtigsten Zeitspanne ihres Lebens, zur Brutzeit bedrohen. Freilich, bei der Unerschöpflichkeit dieses Kapitels in nur wenigen, dem Leser aber vielleicht doch ein einigermaßen umfassendes Bild aufzeichnenden Beispielen. –
Völlig machtlos steht der Mensch den schädigenden Einflüssen ungünstigen Wetters gegenüber, das – glücklicherweise in nur seltener sich ereignenden Fällen – mitunter von geradezu katastrophalen Wirkungen auf den Vogelbestand kleinerer oder größerer Gebiete werden und vielleicht wohl auch einmal eine bereits stark gelichtete Vogelart einer Gegend restlos vernichten kann. In den erfreulicherweise überwiegenden günstigeren Fällen spürt man die Folgen ungünstigen Wetters – meist Kälte und Nässe, doch kann auch übermäßige Trockenheit ähnliche Wirkungen haben – auf das Brutleben eines Vogels in einer Verminderung dieser Vogelart im folgenden oder in den folgenden Jahren. Sie gleicht sich allerdings in der Regel auch wieder aus. Ich habe derartige Fälle wiederholt schon beobachten und sie namentlich an den Rohrsängern verfolgen können, deren Bestandsmengen in den verschiedenen Teichgebieten sich meistens ja recht gut kontrollieren lassen. Ich kenne aber auch Fälle, in denen die erwarteten Wirkungen ausblieben. In einer Trauerseeschwalbenkolonie in der sächsischen Oberlausitz, die ich 1925 unter ständiger Kontrolle hatte, fiel das Ausfallen und Heranwachsen der Jungen in den im genannten Jahre ja ganz besonders kalten und nassen Juni, so daß diese unter den Folgen der Nässe und Kälte in geradezu erschreckender Zahl zugrunde gingen. Im Frühjahr 1926 erschienen die Vögel aber nicht in der erwarteten verminderten Menge an ihrem vorjährigen Brutplatz, sondern in sichtlich stärker gewordener Zahl, und wenn sie schließlich auch nicht wieder an ihm brüteten, so lagen dem andere Ursachen zugrunde. Wahrscheinlich hatten sich in dem vorbeobachteten Falle Vögel verschiedener Kolonien zusammengefunden oder aber ihre Menge war durch den Brutüberschuß aus einer anderen Gegend aufgefüllt worden.
In Ausmaßen, wie ich sie in den vielen Jahren meiner Beobachtertätigkeit noch nie erlebt habe, wirkten sich in meinem Lausitzer Beobachtungsgebiet im Frühjahr 1926 die Wetterkatastrophen dieses Jahres aus. Besonders die Zeit der sich wiederholenden Überschwemmungen im Juni, die hier im Flachlande ganz andere Strecken unter Wasser setzten als in höher gelegenen Hügel- und Berglandschaften und deren Folgen nicht nur wochen-, sondern monatelang in den wasserbestandenen Feldern und weiten Wiesenflächen sichtbare blieben, sind tausende von Nestern vor allem bodenbrütender Arten, wie Feldlerche, Schafstelze, Wiesenpieper, Bekassine und so viele andere mehr zum Opfer gefallen. Der Dauerzustand der Überschwemmungen hatte dann noch die weitere Folge, daß von den unter ihnen gelittenen Vögeln, von denen vielleicht die meisten bei einem rascheren Ablauf des Wassers zu Ersatzbruten verschritten wären, nur wenige zu solchen gekommen zu sein scheinen, wie das nach dieser Zeit vielfach zu beobachtende ziellose Umherstreichen [64]dieser Vögel anzudeuten schien. Aber auch das Wassergeflügel litt ähnlich; während die Jungen frühgebrüteter Arten (Stockente usw.) sich in dem sehr warmen April ungewöhnlich günstig entwickelten, trat bei allen Spätbrütern und solchen, die sich durch Ursachen irgendwelcher Art im Brüten verspätet hatten, das gerade Gegenteil ein – ich entsinne mich keines Frühjahres, in dem ich beim Abwaten von Teichen so viele eingegangene Jungvögel gefunden hätte, wie 1926 etwa von ausgangs Mai an bis weit in den Juli hinein. Rohrsängernester wurden vielfach die Opfer der fast alltäglich auftretenden und meist von stürmischen Winden begleiteten Gewitter. Ihr Inhalt endete im Wasser, und in denen, die diese Fährnisse glücklich überstanden, gingen dann später häufig die Jungen (an Nässe und Kälte? oder aus Nahrungsmangel?) zugrunde; besonders in der ersten Juli-Hälfte war die Zahl der verlassenen Teichrohrsänger-Nester mit mehr oder weniger weit entwickelten toten Jungen eine große, und übertraf fast noch die Zahl der unversehrt gebliebenen. Auch die Busch- und Baumbrüter zeigten größere Verlustziffern als in normalen Jahren, vielfach wurden in den nassen, vom Wasser vollgesogenen Nestern die Gelege einfach verlassen, während in anderen die Jungen unter den Wirkungen der Kälte und Nässe oder aus Nahrungsmangel – der andauernde Regen verhinderte die normalen Fütterungen – hinstarben. Man darf gespannt darauf sein, wie sich die hier nur in ihren gröberen Umrissen aufgezeichneten Erscheinungen im Bestandsbilde der Lausitzer Vogelwelt in den kommenden Jahren widerspiegeln werden.
Während Schädigungen der brütenden Vogelwelt durch Witterungseinflüsse in größeren Ausmaßen aber nur recht unregelmäßige Erscheinungen sind – in kleinerem Umfange lassen sie sich alljährlich beobachten – und namentlich solche wie die hier geschilderten im vergangenen Frühjahre zu den schon selteneren Erscheinungen gehören, treten andere Gefahren mit einer viel größeren Gleichmäßigkeit auf. Es sind namentlich die, die den Vogelbruten von seiten der vielen tierischen Feinde drohen; gelegentliche Schwankungen und Verschiebungen, bedingt durch das zeitweise stärkere oder schwächere Auftreten einer bestimmten Feindart, äußern sich mehr örtlich auf kleinerem Raume und ändern am Gesamtbild nichts. Gar nicht gering ist die Zahl dieser tierischen Feinde, und wir begegnen ihnen in allen Tiergruppen, vom Kleinlebewesen angefangen bis herauf zur höchstorganisierten Klasse, zu den Säugetieren. Die Kleinwelt stellt in Milben, Flöhen, Zecken und dergleichen zahlreiche Schmarotzer, denen sich noch Larven parasitärer Fliegen usw. zugesellen. Mir will es scheinen, als ob die an den menschlichen Wohnstätten lebenden Vögel besonders stark unter Schmarotzern zu leiden hätten und als ob unter diesen wieder der Mauersegler und unsere Schwalben am häufigsten von ihnen heimgesucht würden. An Schmarotzern eingegangene Schwalben und Segler sind mir besonders viel schon gebracht worden; vor einigen Jahren erhielt ich in Moritzburg einen eben verendeten jungen Mauersegler, der von Milben strotzte und dessen Kopffedern fast völlig fehlten oder nur noch in [65](abgefressenen?) Stummeln vorhanden waren. Sein Tod ist sicherlich durch die ihn heimgesuchten Schmarotzer hervorgerufen worden. Im vergangenen Frühjahr fand ich dann weiter, um noch ein Beispiel zu nennen, in Königswartha einen frischverendeten jungen, noch warmen Feldsperling, von dessen Kopf ich zweiunddreißig (!) Zecken ablas. Und zwei Tage später sah ich einen weiteren jungen Feldspatz, der in der Schar seiner Geschwister mir sofort durch seine taumelnden Bewegungen auffiel und den ich in meine Hände bringen konnte; auch von seinem Kopf und Hals las ich siebzehn Zecken ab. Sehr viel Nestjunge fallen auch den Ameisen zum Opfer; manche von ihnen vernichtete Brut habe ich schon gefunden und wie selten einmal geflucht und gewettert – die verehrte Leserin möge es mir verzeihen, wenn ich mit diesem Ausdruck etwas »aus der Rolle falle« – als an jenem Tage, an dem ich mit der Kamera zu meinem gefundenen ersten Ziegenmelker-Nistplatz pilgerte, und dann die am Tage zuvor noch während des Ausschlüpfens beobachteten Jungen von Ameisen angegangen tot vorfand.
Die höhere Tierwelt stellt Feinde aus allen Klassen; selbst unter den Fischen gibt es Arten, denen junges Wassergeflügel zum Opfer fällt. Der Hecht schnappt manchen, das Nest verlassenen und auf dem Wasser sich tummelnden Jungvogel, und einem Hechte wohl auch wurde jenes junge Teichhuhn Beute, das 1911 auf einem Teiche bei Königswusterhausen vor meinen Augen trotz seines Sträubens von einem mir unbekannt gebliebenen Etwas unter das Wasser gezogen wurde. Unter den Kriechtieren sind es die Schlangen – die Kreuzotter vor allem und vielleicht öfters auch, wie ich dies bereits vor Jahren an anderer Stelle nachzuweisen versucht habe, die Glatte Natter – die Interesse an dem lebendigen Inhalt des Vogelnestes zeigen können, und von den Lurchen vergreifen sich, wie dies der als Tierphotograph bekannte Amtmann Behr in Cöthen photographisch festhalten konnte, der Teich- und Seefrosch gelegentlich einmal auch an den Jungen eines ihnen erreichbaren Vogelnestes.
Von den Säugern sind Feinde der Vogelbruten zunächst alle unsere Raubtiere, ferner die meisten Nager und von den Insektenfressern der Igel und die Spitzmäuse.

Von den Raubsäugern fallen nach meinen Erfahrungen, wenigstens bei uns, den marderähnlichen auch relativ die meisten Bruten zum Opfer; namentlich der überall noch vorhandene Iltis und die ebenfalls wohl nirgends noch fehlenden beiden Wiesel können es zu ganz erstaunlichen Leistungen bringen. Und manches in unseren Gärten verschwundene Nest, dessen Verlust wir dem Schuldkonto der Katze zuschreiben, muß – ich habe dies oft aus noch vorhandenen Spuren nachweisen können – einem dieser kleinen blutdürstigen Raubritter, denen ich deswegen aber noch niemals gram geworden bin, angekreidet werden. Das kleine Wiesel als Nesträuber kennen zu lernen, hatte ich 1924 in Königswartha in geradezu hervorragender Weise Gelegenheit. Es trieb sich in diesem Jahre so häufig auf den Teichdämmen umher, daß kaum ein Tag verging, an dem ich nicht einen oder einigen dieser geschmeidigen [66]Tiere begegnet wäre. Öfter sah ich Wiesel im Wasser, wie sie gewandt namentlich die vegetationsreichen Uferstrecken abschwammen und nach Nestern der hier brütenden Vögel durchsuchten, und die großen Verluste, die ich gerade in diesem Jahre an den Nestern namentlich der Taucher und der Zwergrohrdommel, aber auch von Enten, Wasserhühnern usw. zu verzeichnen hatte, mögen größtenteils »Arbeit« des Wiesels gewesen sein. In einer kleineren Schwarzhalstaucherkolonie von zwölf bis fünfzehn Paaren wurden sämtliche Nester von ihm geplündert, auf einem derselben fand ich, das Gelege noch bedeckend, den weiblichen Taucher tot und im Nacken angefressen vor, der Überfall und das Töten des brütenden Vogels muß so rasch vor sich gegangen sein, daß dieser nicht einmal mehr Zeit zur geringsten Bewegung gehabt hat. Trotz der starken Nestplünderungen aber ließen sich 1925 wesentliche Veränderungen im Bestande der von den Plünderungen betroffenen Vögel kaum feststellen; und daß ein gelegentliches stärkeres, durch irgendwelche günstigen Umstände gefördertes Auftreten irgendeines Räubers auch wieder normale Formen annehmen kann und annehmen wird, bewiesen die beiden letzten Jahre, in denen ich trotz fast noch häufigerer Anwesenheit in Königswartha das Wiesel erheblich seltener antraf und die Begegnungen mit ihm fast an den Fingern herzählen kann.

Von den Nagern ist das Eichhörnchen als Nestplünderer ja ganz allgemein bekannt; ihm fallen vor allem die offenen Nester der baumbrütenden [67]Arten, wie der Ringeltaube mit ihren zwei weißen, weithin leuchtenden Eiern und viele andere mehr zum Opfer. Ist es nur ein Zufall gewesen, daß ich auf dem Rochlitzer Berge die Taubennester gerade in den Brutbezirken des Hühnerhabichts, die das Eichhörnchen nach Möglichkeit mied, antraf? Oder lag die Möglichkeit vor, daß die Tauben, trotzdem auch der Hühnerhabicht einer ihrer ärgsten (allerdings die Nester kaum heimsuchenden) Feinde ist, diese Stellen bevorzugten, weil sie an ihnen vor den Nachstellungen durch das Eichhörnchen verschont blieben? Es ist schwer, dies zu entscheiden. – Von den Schlafmäusen sind Nestfeinde die beiden größeren einheimischen Arten, der Siebenschläfer und der Gartenschläfer. Den ersteren konnte ich in meinem früheren Rochlitzer Beobachtungs- und Arbeitsgebiet Nesträubereien mehrfach nachweisen, eine meiner photographischen Zufallsaufnahmen zeigt ihn ja auch bei dieser Tätigkeit. Und vom Gartenschläfer berichtete mir unter anderen Freund Keiler-Pfaffenstein, daß er vor Jahren dem Nager einmal ganz energisch nachzustellen und seinen Bestand einzuschränken gezwungen war, weil in der Umgebung seines Wohnhauses infolge der Räubereien durch den Schläfer Singvogelbruten nicht mehr hoch kamen. Man wird derartige örtliche Abwehrmaßnahmen auch nie verurteilen können, wie dies mehrfach auf die Bekanntgabe dieser Tatsache in einer meiner Schlafmausarbeiten hin geschah: meine Untersuchungen haben den jedenfalls einwandfreien Nachweis erbracht, daß Garten- und Siebenschläfer in unserem Vaterlande durchaus noch nicht [68]selten, stellenweise sogar sehr häufig sind, und daß die vielfach hier und da einmal gebotenen energischeren örtlichen Nachstellungen nie ihren Bestand ernstlich gefährden können. Die mir wiederholt um den Bestand unserer Tiere ausgesprochenen Befürchtungen entbehren wirklich jeder tatsächlichen Grundlage. – Auch unsere Mäuse und der Hamster kommen als Nesträuber in Betracht; die ersteren scheinen aber den Eiern ein größeres Interesse als den später im Neste befindlichen Jungen entgegenzubringen, so daß sich die Schäden, die sie der Vogelwelt zufügen, durch die größere Möglichkeit von Ersatzbruten wieder etwas ausgleichen. Dem Hamster dagegen scheinen Eier in gleicher Weise wie Nestjunge zum Opfer zu fallen, doch möchte ich mit meinem Urteil hier noch zurückhalten, da meine persönlichen Erfahrungen darüber noch geringe sind. Spitzmäuse sind nach meinen hier allerdings auch nur spärlichen Beobachtungen mehr Eier- als Vogeldiebe, scheinen für Eier aber manchesmal eine direkte Leidenschaft zu entwickeln. Dem Igel möchte ich ebenfalls eine größere Vorliebe für die Gelege als für die späteren Jungen zuschreiben, die ihm aber auch zum Opfer fallen können. Seine Nestplünderungen abzuleugnen oder sie als ganz unbedeutende hinzustellen, wie man dies angesichts der allerdings oft auch wieder stark übertriebenen Anschuldigungen besonders von seiten des Jägers getan hat und noch tut, geht jedenfalls nicht an, wie man umgekehrt ihretwegen aber auch kein Recht zu einer schonungslosen Verfolgung des Igels herleiten kann. Seine Nesträubereien fallen durchaus [69]noch in den Rahmen des normalen, natürlichen, und wenn sie ja einmal örtlich (in Fasanerien usw.) einen etwas größeren Umfang annehmen sollten, so genügen auch rein örtliche Abwehrmaßnahmen. In meinem Elternhaus auf dem Rochlitzer Berg hatte einst ein Haushuhn sich einen Eiervorrat an einer stillen Stätte im Freien angesammelt und diesen zu bebrüten begonnen. Eines Morgens lief es mit ausgerissenem Schwanze umher, während sein Eierschatz zerbrochen und ausgefressen über den Boden zerstreut war – ein Igel hatte, wie die Spuren ergaben, dem brütenden Huhn nachts einen Besuch abgestattet und die Verwüstungen angerichtet.

Viel schwerer als die Schädigungen der Vogelbruten durch freilebende Säuger wiegen in der Umgebung unserer Ortschaften, besonders derjenigen ländlichen Charakters, in der Regel die, die zwei unserer Haussäuger, die Katze und der Hund, verursachen können. Über die der Katze bestehen unter den Einsichtigen kaum größere Meinungsverschiedenheiten, die des Hundes aber werden nur zu oft unterschätzt. Streunenden Dorfkötern können unzählige Nester bodenbrütender Arten zum Opfer fallen und der Schaden, den sie dadurch der Vogelwelt zufügen, bleibt oft kaum hinter dem durch die Katze angerichteten zurück. Um des letzteren willen ist schon viel Tinte geflossen und Druckerschwärze verbraucht worden; Berufene und Unberufene haben sich zu ihm geäußert, die letzteren meistens mit dem größten Stimmaufwand. Und doch sind wir noch weit von einer zufriedenstellenden Lösung der immer brennender werdenden Katzenfrage entfernt, den oft weit über das Ziel schießenden Forderungen der Katzengegner gegenüber verfallen die Katzenfreunde dann regelmäßig in das entgegengesetzte Extrem. Und doch müßte bei gutem Willen auf beiden Seiten – der vor einiger Zeit gegründete »Bund der Katzenfreunde« (war er notwendig) könnte hier das Seine dazu beitragen – sich auch in der Katzenfrage manches erreichen lassen, könnten die oft so erheblichen Schädigungen der Vogelwelt durch die Katze, wenn auch niemals ganz beseitigt, so doch wesentlich herabgemindert werden. Einen Weg hierzu habe ich vor einigen Jahren an anderer Stelle zu zeigen versucht (Naturschutz 3, Berlin 1922, S. 100–107).
Schließlich sind es auch eine ganze Anzahl Vögel selbst, die sich Nestplünderungen zuschulden kommen lassen und die Gelege und Bruten des eigenen Geschlechts zehnten. Und es gibt unter ihnen manche Art, die darin ganz »Hervorragendes« leistet und unter der eigenen Sippe oft ärger wüten kann, als z. B. manch einer der übelberüchtigsten vierfüßigen Räuber. Besonders die Krähenvögel tun sich in Nesträubereien hervor, und unter ihnen wieder sind es vor allem Raben- und Nebelkrähe, die sich oft den hemmungslosesten Nestplünderungen widmen. Wenn man ihre Tätigkeit einmal beobachtet und solche Verheerungen unter dem Brutvogelbestand einer Gegend gesehen hat, wie ich sie nun schon manches Mal verfolgen konnte, wird man bei aller Achtung auch ihrer Rechte an das Leben doch auch dafür eintreten, daß sie nach Möglichkeit kurz gehalten und ihrer von tierischen Feinden wenig bedrohten Vermehrung Schranken gesetzt werden. In der Lewitz in [70]Mecklenburg z. B. fand ich an einem einzigen Morgen längs eines Dammes auf einer Strecke von höchstens hundertfünfzig Metern gegen vierzig bis fünfzig von Krähen ausgefressene Enteneier, ein Fall, den ich aus eigenen Erlebnissen noch manchen anderen, ähnlichen angliedern könnte. Das tollste in dieser Beziehung jedoch erlebte ich 1925 in meinem Lausitzer Beobachtungsgebiet, wo Krähen eine gegen zweihundert Brutpaare zählende Lachmöwenkolonie in noch nicht zwei Wochen restlos vernichteten. Ich halte es daher auch für eine unbedingte Notwendigkeit, Krähen (und unter Umständen auch noch einige andere Vögel) von Vogelschutzgebieten fern zu halten. Sie sind von der Kultur begünstigte Vögel; in den Naturschutzgebieten aber wollen wir vor allem doch die Arten schützen und erhalten, die unter der Kultur leiden und durch sie in ihrem Bestande bedroht sind, und für die im Gegensatz zu den Krähen und einigen anderen, sich der Kultur vorzüglich angepaßten Arten der Lebensraum in der Kulturlandschaft aufs äußerste eingeengt worden ist. Der Gedanke, Stätten zu schaffen und Stätten zu besitzen, an denen man der Natur allein das Wort lassen kann, ist gewiß ein sehr schöner. Aber wir können uns seine Erfüllung nicht leisten, wenn wir an solchen Stätten eben etwas mehr noch erhalten und schützen wollen, als das, was hundertfach in unserer Kulturlandschaft Platz findet. Diesen Gedanken hier weiter auszuspinnen, muß ich mir jedoch versagen, es würde dies eine besondere Arbeit erfordern, für die mir die Schriftleitung der Heimatschutzmitteilungen vielleicht später einmal den nötigen Raum bewilligt.
Starke Nestplünderungen läßt sich auch der aus Sachsen allerdings längst verschwundene Kolkrabe zuschulden kommen, ihm sind nicht einmal die Nester vieler größerer Raubvogelarten heilig. Manche im vogelkundlichen Schrifttum niedergelegte Beobachtung erzählt davon, und ich selbst hatte in Bialowies Gelegenheit, das große Interesse des Kolkraben für Raubvogelhorste kennen zu lernen; ein Paar unseres Vogels vereitelte mir durch seine Raubzüge meine sicheren Aussichten auf photographische Aufnahmen an einem Milanhorst und kurz darauf ertappte ich es bei Auseinandersetzungen mit einem Schreiadlerpaar um die Rechte an dessen Horst. Übrigens machen auch unsere beiden eben genannten Krähen vor Raubvogelhorsten ebenfalls nicht Halt; von den hierher gehörenden, von mir oder anderen beobachteten Fällen sei nur der erwähnt, in dem im vergangenen Frühjahr in meinem Königswarthaer Beobachtungsgebiet der Horst eines Rohrweihenpaares, das seinerseits wiederum stark die Nester des Wassergeflügels zehntete und von mir dabei wiederholt auch, einmal sogar aus nur wenigen Metern Entfernung, beobachtet wurde, einer Anzahl im Teichgebiet plündernd umherstreifender Nebelkrähen zum Opfer fiel.
Auch die sonst so schmucke und jeder Landschaft zur Zier gereichende Elster erhebt von den Nestern kleinerer Vögel einen recht hohen Tribut; dort, wo sie sich häufiger findet, bleiben die durch sie bewirkten Schädigungen der Kleinvogelwelt in keiner Weise hinter den durch Krähen verursachten zurück, so daß auch ihr gegenüber oft ein regelndes Eingreifen durch den Menschen [71]ratsam erscheint, und ebenso fällt in unseren Wäldern dem forstlich oft recht nützlichen Eichelhäher manches Singvogelnest zum Opfer. Die Würgerarten weiter gehören ebenfalls zu den Nestplünderern; der häufigste und verbreitetste von ihnen, der Rotrückige oder Neuntöter, steht in dieser Hinsicht sogar in einem oft recht üblen Rufe. Auf der kürzlichen Tagung des Vereins sächsischer Ornithologen in Plauen wurde sogar von einem anwesenden Gaste die Forderung erhoben, daß sich der Verein für eine Vertilgung des Vogels im großen einsetzen solle! Eine derartige, selbstverständlicherweise auch nirgends Gegenliebe gefundene Forderung geht natürlich weit über das Ziel hinaus; wir wissen aus vielen Einzelbeobachtungen und Untersuchungen, daß stärkere Schädigungen der Kleinvogelwelt durch den Rotrückigen Würger Erscheinungen mehr örtlicher Natur sind und daß dann in Fällen, in denen diese Schädigungen der Kleinvogelwelt durch unseren Vogel das normale Maß übersteigen und daher das regelnde Eingreifen des Menschen notwendig machen, eine Niederhaltung des Würgers durch das Zerstören von dessen ja leicht zu findenden Nestern möglich ist.
Leicht ließe sich die Liste nestplündernder Vögel weiter fortsetzen, die hier genannten stellen ja nur einen kleineren Teil aus einer weit größeren Schar dar. Und jenen Arten, die den Nestplünderungen mehr oder weniger regelmäßig huldigen, schließen sich dann noch diejenigen an, die sich nur gelegentlich einmal den Inhalt eines Nestes zu Gemüte führen, bei denen die Vorliebe dafür mehr individuellen Neigungen entspringt. Die Amsel z. B. gehört hierher. Über ihre räuberischen Gelüste ist ja auch schon sehr viel geschrieben, sind Urteile gefällt worden, die zu oft nur jede Spur von Sachlichkeit und Gerechtigkeit vermissen lassen. Es geht nicht an, wie ich dies erst kürzlich wieder las, Nesträubereien durch die Amsel einfach abzuleugnen nur, weil sie ein Beobachter aus eigener Erfahrung nicht kennen gelernt hat und die Beobachtungen anderer einfach übergeht oder gar ableugnet, es ist aber umgekehrt noch viel vermessener, wenn festgestellte Einzelfälle verallgemeinert und für Entartungen einzelner Vögel – und um solche handelt es sich hierbei – die ganze Sippe verantwortlich gemacht und die Forderung zu einer Allgemeinverfolgung der Amsel hergeleitet wird. Lokal (und zum Teil aus ganz anderen Gründen) wird man sich in Einzelfällen einmal mit einer weisen Beschränkung des Amselbestandes eines Ortes einverstanden erklären, nie aber die so oft geforderte, in die Hände der unverständigen Masse gelegte Allgemeinbekämpfung unseres Vogels befürworten können. Selbst Arten, wie unsere Meisen, können einmal Gefallen an dem Inhalt fremder Nester finden; ich selbst sah Kohlmeise sowohl wie auch Blaumeise die Eier in Nestern freibrütender Finkenvögel angehen.
Auch im Kampfe um das Nest gehen oft Gelege oder Bruten zugrunde. Der Star hat gar manches Mal Ursache, seinen Nistkasten von einem fremden Eindringling zu säubern, er setzt den Spatz, der sich darin häuslich eingerichtet hat, vor die Tür und wirft sein Nest heraus oder überbaut es kurzerhand, und er selbst wieder muß dann oft einer anderen Art, dem [72]Segler, dem Wendehals usw. das Feld räumen und sein Gelege oder die schon ausgeschlüpften Jungen durch die neuen Wohnungsinhaber vernichten lassen, Vorgänge, wie sie sich auch um den Besitz anderer Nisthöhlen und selbst freistehender Nester abspielen können. Alle diese Erscheinungen aber bewegen sich in der Regel noch im Rahmen normalen Naturgeschehens; ihre Wirkungen werden folgenschwer erst dort, wo Umstände äußerer Art, wo namentlich unsere Kultur gewisse Nestfeinde begünstigt und sie ein Übergewicht über die ihr tributpflichtigen hat erlangen lassen und wo auf diese Weise das regelnde Walten der Natur ausgeschaltet worden ist.
Viel schwerer ins Gewicht fallen zumeist die Schäden, die die Kultur im Gefolge hat und die auf direktes Eingreifen durch den Menschen zurückgehen. Wilde Nesträubereien durch den letzteren um der Eier mancher Vogelarten willen – das normale, in den gebotenen Grenzen sich haltende Einsammeln der Eier einiger freilebender Vögel (Lachmöwe usw.) bedeutet noch keine Schädigung dieser Vögel – können oft von den verhängnisvollsten Folgen für die davon betroffenen Vogelarten begleitet sein – 1925 z. B. gingen auf diese Weise die großen Lachmöwensiedlungen auf den Koblenzer Teichen in der Lausitz zugrunde – und nicht minder verhängnisvoll kann in manchen Einzelfällen das Vernichten von einzelnen Nestern aus bloßer Freude am Zerstören werden. Durch seine mannigfachen Arbeiten aber vernichtet der Mensch auch ungewollt viele Nester und Bruten, muß sie vernichten. Im Walde werden beim Fällen von Bäumen die auf ihnen befindlichen Nester mit zu Boden geworfen, beim Abfahren von aufgeschichtetem Holz die darin befindlichen zerstört, auf den Wiesen und Feldern die Gelege bodenbrütender Arten ausgemäht und was dergleichen Dinge mehr sind.
In sehr vielen Fällen ist es auch der Vogel selbst, der – natürlich ohne dies selbst zu empfinden – die Gefahren, die sein Nest bedrohen, dadurch erhöht, daß er zur Anlage desselben sich Orte aussucht, die von vornherein allen nur erdenklichen Unfällen ausgesetzt sind. Dieses Kapitel ließe sich durch unendlich viele Beispiele belegen, und sicherlich auch könnte mancher Leser noch dieses oder jene eigene Erlebnis dazu beisteuern. Besonders sind es die an oder in der Nähe der menschlichen Wohnstätten brütenden Vogelarten, die hierbei in Frage kommen. Es sei nur an die vom Hausrotschwanz und der weißen Bachstelze im Bereiche unserer Bahnhöfe so gern gewählte Nestanlage an den ganz oder auch nur zeitweise außer Betrieb gesetzten Eisenbahnwagen erinnert. In den wenigsten Fällen wohl wird dann bei der Inbetriebnahme eines derartigen Wagens eine Vogelbrut so günstig abschneiden, wie in jenem, mir aus meiner Rochlitzer Heimat bekannten, in dem ein Bachstelzenpaar mit seinem Nest täglich zweimal die Fahrt auf der siebzehn Kilometer langen Strecke Rochlitz–Großbothen mitmachte und seine Jungen glücklich hoch brachte, oder jenem anderen, aus dem Vogtlande bekannt gegebenen, in dem ein Rotschwanzpaar mit seinem Nest ungefährdet eine vierzehn Kilometer lange Strecke täglich gar sechsmal durchfuhr. Ich habe regelmäßig Nester und Nestanfänge von Orten, an denen ihr sicherer Untergang vorauszusehen [73]war, entfernt; eine Maßnahme, die durchaus nichts »barbarisches« an sich hat, wie mir dabei manches Mal von empfindsamer Seite im Tone größter Entrüstung erklärt worden ist. Denn auf diese Weise veranlaßte ich die Vögel, ihre Nester nochmals an anderen (und vielleicht auch viel geschützteren) Orten zu errichten, was sie auch bestimmt tun werden, wenn die Entfernung des Nestes entweder noch vor der Ablage der Eier oder doch während der Bebrütung erfolgt, während anderen Falles, in dem das Nest verunglückt, wenn in ihm bereits die Jungen vorhanden sind, es vielfach nicht wieder zu einer Ersatzbrut kommt. Und so glaube ich denn trotz meiner »Barbarei« manche Vogelbrut schon gerettet zu haben. Daß ein Vogel die sein Nest bedrohenden Gefahren erkennen und sie umgehen lernt, ist eine oft schon mitgeteilte und auch von mir wiederholt beobachtete Tatsache. Ein hierher gehörender, besonders interessanter Fall, den ich einer Anzahl Dresdner Vogelkundiger auch an Ort und Stelle vorführen konnte, ist folgender: In einer Straßenüberführung der seit undenklichen Zeiten schon im Bau befindlichen, aber nie fertig werdenden Bahnstrecke Radeburg–Priestewitz hatte ein Steinschmätzerpaar in einer der vier Abflußröhren etwa dreißig Zentimeter von der Ausflußöffnung entfernt sein Nest untergebracht. Das Gelege ging ebenso wie das zweite in einem neuen, in gleicher Weise in einer anderen der vier Röhren errichteten Neste zugrunde, worauf die Vögel zum Bau eines dritten Nestes in der dritten Röhre verschritten, das sie aber nicht mehr so kurz hinter der Abflußöffnung, sondern in der Röhre so weit hinten anlegten, daß die volle Armlänge knapp genügte, es zu erreichen. Und in diesem, nunmehr vor den Eingriffen des Menschen geschützten Nest kamen denn auch die Jungen glücklich hoch. Für Höhlenbrüter, deren Bruten sonst im allgemeinen geschützter als die der Freibrüter sind, entstehen Gefahren oft durch die Benutzung zu enger Höhlen. Im vogelkundlichen Schrifttum z. B. sind Fälle mitgeteilt worden, in denen brütende Mauersegler in derartigen Höhlen dadurch zugrunde gingen, daß die langen Schwanz- und Flügelfedern des brütenden Vogels sich sichelförmig nach oben gekrümmt und ihn auf diese Weise am Wiederausfliegen gehindert und dem Hungertod überliefert hatten. Ich selbst konnte wiederholt enge Höhlen untersuchen, die von Meisen bezogen worden waren und in denen nach dem Ausfliegen eines Teiles der Jungen ein anderer Teil tot in ihnen zurückgeblieben war, Fälle, die wohl ausnahmslos ihre Erklärung darin finden, daß für die heranwachsenden Jungen allmählich der Raum zu enge wurde und die schwächeren Vögel dann von den stärkeren erdrückt worden waren. In künstlichen Höhlen scheinen sich derartige Fälle, wie ich es mehrfach feststellen konnte und wie es mir wiederholt auch von anderer Seite bestätigt worden ist, verhältnismäßig oft zu ereignen; die Berlepsche A-Höhle (für Meisen) in ihrer bisherigen Form z. B. ist in ihren Innenmaßen entschieden zu klein, und es erscheint geradezu unverständlich, daß v. Berlepsch erst jetzt zu einer Überzeugung gekommen ist, die Vogelkundige schon seit langem immer wieder von neuem ausgesprochen und wiederholt haben. Im fünfzehnten und sechzehnten [74]Jahresbericht seiner Versuchs- und Musterstation schreibt er: »Ich habe deshalb seit Herbst 1922 den Nestraum der Höhle A von bisher im Durchmesser fünfundachtzig bis fünfundneunzig Millimeter auf hundert bis hundertfünfzehn Millimeter erweitern lassen. Hierdurch bietet nun auch diese kleinste Höhle ausgiebigst Platz, und so ist kein Grund mehr vorhanden, auch für die vielköpfigste Meisenfamilie die kostspieligere B-Flughöhle mit A-Flugloch verwenden zu wollen« und fährt dann weiter fort: »Der Fabrik Scheid aber ist es erlaubt, ihren Vorrat der A-Höhlen der bisherigen Abmessungen auszuverkaufen. Neue A-Höhlen bitte ich dagegen bezüglich dieser Nestraumweite einer strengen Kontrolle zu unterziehen.« Kopfschüttelnd nur wird man diese Worte lesen können und dem Münchener Ornithologen Laubmann beipflichten müssen, der dazu bemerkt: »Ein Kaufmann, der eine von ihm feilgebotene Ware als unbrauchbar erkannt hat, sie aber dennoch weiter verkauft, ist unreell … Ein solches Vorgehen, das gleichbedeutend ist mit »Geld zum Fenster hinauswerfen lassen« (und das auch erkannte Gefahren für die die Höhlen benutzenden Vögel bewußt weiter zu erhöhen heißt. Der Verf.) ist unverantwortlich, doppelt unverantwortlich in einer Zeit, wie die ist, in der wir heute leben müssen.« –
Einen etwas eigenartigen, eine natürliche Höhle betroffenen Unfall hatte ich vor Jahren zu beobachten Gelegenheit. Die etwas enge Eingangsöffnung dieser, Jahre hindurch von Kohlmeisen benutzten Höhle überwucherte ein Pilz (eine Polyporus-Art?) und als einige Wochen später von einem Sturme der Stamm über der Höhle geknickt wurde, fand ich in ihr die vertrockneten Kadaver von acht jungen und einer alten Kohlmeise; der Pilz hatte wahrscheinlich in einer Nacht, in der der alte Vogel schirmend über den noch kleinen Jungen gesessen hatte, sich derart entwickelt, daß am Morgen die Meise nicht mehr ausfliegen konnte.
Mit der Mitteilung dieser letzten Beobachtung seien meine Ausführungen beendet; sie zeigen jedenfalls aufs deutlichste die ungeheure Menge der unsere Vogelwelt zur Brutzeit bedrohenden Gefahren, die bereits unter völlig normalen Verhältnissen weit, viel weit mehr Vögel vernichten, als es zum Beispiel durch den trotzdem aber auch von mir nicht gebilligten und aufs schärfste verurteilten und bekämpften ziellosen Abschuß einzelner Vogelarten durch unweidmännisch denkende und handelnde Jäger geschieht. Und lediglich über die Höhe dieser Verluste nun am Schlusse noch ein paar nüchtern redende Zahlen! 1913 gingen in neun Tagen von dreizehn von mir auf dem Rochlitzer Berge kontrollierten Nestern (zwei von der Singdrossel, drei von der Amsel, je eins vom Hausrotschwanz, Weidenlaubvogel und Buchfink sowie vier von der Gartengrasmücke) noch vor dem Ausfliegen der Jungen sieben zugrunde und von neun im gleichen Jahre am Sebischteich bei Frohburg beobachteten Nestern (zwei vom Rotrückigen Würger, eins vom Hänfling, drei von der Garten- und eins von der Dorngrasmücke sowie zwei von der Amsel) waren nach Wochenfrist vier Unfällen zum Opfer geworden. Im folgenden Jahre notierte ich, wiederum in meiner Rochlitzer Heimat, innerhalb [75]zwei Wochen von sechzehn Nestern sieben zugrunde gegangen. Und das in allen drei Fällen an Orten, an denen menschliche Eingriffe kaum in Frage kamen. Ähnlich hoch sind auch die Verlustziffern, die ich nach dem Kriege in Moritzburg und in der Oberlausitz beobachtet habe, die ich augenblicklich aber nicht aus meinen Tagebüchern ausziehen kann. Daß sie trotz ihrer scheinbar erschreckenden Höhe dabei aber nicht über das normale Maß hinausgehen, bezeugen entsprechende Zahlen eines amerikanischen Vogelkundigen, die Erwin Stresemann in den Ornithologischen Monatsberichten (34, 1926, S. 148/149) mitteilt. Danach kamen in achtunddreißig Nestern mit hundertsiebenundachtzig Eiern nur hundertdrei Eier (= 55%) aus und von den ausgefallenen Jungen verließen sechsundsiebzig (= 74%) das Nest. 1925 kamen in neununddreißig Nestern von hundertachtundsechzig Eiern hundertvier Eier (= 62%) aus, während von den Jungen achtundsechzig (= 65%) das Nest verließen. Die Vernichtungsziffer betrug also in der Zeitspanne von der Eiablage bis zum Verlassen des Nestes durch die Jungen 1924 59%, 1925 59,5%. Zu diesen Verlusten kommen dann aber auch noch die gleichfalls noch ganz erheblichen, die die flüggen Jungen namentlich in den ersten Tagen und Wochen ihres Freilebens betreffen. Sie sind notwendige Erscheinungen im Normalkreislauf des Naturgeschehens, werden verhängnisvoll aber dort, wo dieser Normalkreislauf erheblich gestört worden ist. Und daher ergibt sich für uns die schon oben betonte Pflicht, in unseren Kulturländern mit ihrer gewaltigen Unterdrückung der Natur durch die Kultur, alles zu tun, was nur irgendwie geeignet ist, Gefahren von der Vogelwelt abzuwenden und die Verlustziffern zu verringern.
Ein volkstümlicher Bösewicht im schmucken Gewand
Von Martin Braeß
Wer nur die Frage nach Nutzen und Schaden im Auge hat, der wird es nicht verstehen, wenn ich die Männer vom grünen Tuch bitte, der Elster gegenüber, wenigstens unter gewissen Umständen, einige Rücksicht walten zu lassen. Aber auch der Freund der Natur, der von höherer Warte aus an der Vogelwelt seine Freude hat, wird es schwer begreifen, daß ich es über’s Herz bringe, ein Wort für die Elster einzulegen, statt ihre Ausrottung zu beantragen. Denn gerade dieser Vogel ist einer der schlimmsten Buschklepper unter dem gefiederten Raubgesindel; er durchsucht im Frühjahr Bäume und Sträucher in den Feldgehölzen und Obstgärten nach Vogelnestern – kein Mitleid, kein Pardon! Gierig zerrt der räuberische Tagedieb das hilflose Junge aus dem Nest und stopft es seiner nimmersatten Brut in den Rachen, als ob es ein Engerling wäre. Zumal wenn die Elsternkinder flügge sind und sich nun auch an dem Räuberhandwerk der Eltern beteiligen, dann bleiben in weitem Umkreis nur die verstecktesten Nester verschont. Selbst Höhlenbrüter sind nicht immer sicher. Ich habe es gesehen, wie eine Elster [76]vor einem Starenkasten Posto gefaßt hatte und nun trotz allen Schreiens und Flatterns der Hausbewohner ein Starenkind unbarmherzig herauszog.
Die Elster verschmäht keinen Bissen, dessen sie habhaft werden, kein Tier, das sie bewältigen kann. Wieviele Tragödien mögen sich Jahr für Jahr an den Nestern unsrer lieblichen Grasmücken, Drosseln, Finken abspielen; wieviele junge Rebhühner und Fasanen mögen in den nimmersatten Rachen des schwarz-weißen Strauchdiebs wandern! Aber selbst erwachsene Vögel sind vor den Räubern nicht sicher. Ich habe beobachtet, wie zwei Elstern gemeinschaftlich auf der Landstraße nach Feldsperlingen und Goldammern jagten und zwar mit Erfolg, und daß sie, bisweilen in Gesellschaft von Krähen, der Rebhuhnjagd pflegen, wird man gern glauben, wenn man weiß, wie gefährlich die Elster auch dem zahmen Federvieh werden kann. Hühner- und Entenkücken greift sie an, und wo sie sich sicher fühlt, holt sie wohl auch Jungtauben aus den Schlägen; selbst beim Fischdiebstahl hat man die Elster ertappt. Daß sie gelegentlich auch auf die Mäusejagd geht, ebenso Kerbtiere, Würmer und Schnecken frißt, wollen wir der Gerechtigkeit wegen nicht unerwähnt lassen, doch müssen wir sofort hinzufügen, daß die Elster durch ihre Vorliebe für Kirschen, Birnen und dergleichen auch dem Obstzüchter lästig wird.
Trotz dieses Sündenregisters bitte ich aus verschiedenen Gründen um etwas Nachsicht. Die Elster gehört nun einmal zu unsrer heimatlichen Vogelwelt, und zwar ist sie nicht nur der schönste Vertreter der Rabensippe, sondern eine der prächtigsten Erscheinungen innerhalb der mitteleuropäischen Ornis. Freilich, der Farbenreichtum, mit welchem die Natur das Gefieder des Eisvogels oder der Mandelkrähe ausgestattet hat, so märchenhaft schön, daß man glauben möchte, tropische Vögel vor sich zu haben, fehlt dem Kleide der Elster. Ihre Toilette erscheint lediglich schwarz und weiß; aber welch reines Weiß und welch tiefes Schwarz! Ich möchte die Wäscherin oder Plätterin kennen, die einem Oberhemd solch’ schneeige Weiße geben könnte, wie sie die Brust unsers Vogels vom Kropfe bis hinab an den Bauch auszeichnet; auch die Schultern sind weiß gefärbt. Und welchen Gegensatz bildet hierzu das tiefe Schwarz des übrigen Gefieders, gegen das selbst die beste chinesische Tusche matt und grau erscheint! Man beobachte auch die Elster, wenn sie niedrig über dem Boden dahinstreicht oder, auf einem Strauch sitzend, sich im Gefieder nestelt und ihre Schwingen glättet. Da werden an den großen Schwungfedern auch die inneren weißen Fahnen sichtbar, so daß der Flügel jetzt längsgestreift erscheint, schwarz und weiß, wie die Decke des Zebras, nur tausendmal schöner. Doch den herrlichsten Schmuck des Kleides bildet der wunderbare Metallschimmer, der über den größten Teil des Gefieders, soweit es schwarz, ausgegossen ist. Hals und Rücken erglänzen blau, die Flügel grün, die kleinen Schwungfedern dritter Ordnung goldig oder tiefblau oder spangrün. Und dann der lange, keilförmig abgestufte Schwanz! Seine Gestalt schon gereicht dem Vogel zum herrlichsten Schmuck; gleich einer Schleppe zieht er ihn im Fluge nach sich – das beste Erkennungszeichen der Elster auf weite Entfernung. Und hüpft der Vogel am Boden [77]oder fußt er auf einem Ast, so verleiht der Schwanz jeder Seelenstimmung seines Besitzers den beredtesten Ausdruck. Dazu der Farbenschmelz gerade dieses Schmuckstücks, wie die Palette des Malers ihn nicht wiederzugeben vermag: vom Grunde bis zur Mitte blaugrün, dann bis nahe dem Ende goldiggrün; nun folgt ein schmaler violetter Querstreifen, und an diesen schließt sich die stahlblaue Spitze.
Am besten gefällt mir die Elster im Winter; da bringt sie Leben und Bewegung in das Landschaftsbild. Mit etwas schwerfälligem Flug schwingt sie sich auf den Wipfel eines einsamen Baums, lüftet die Flügel, wippt mit dem Schwanz und ruft ihr bekanntes »schack, schack!« über die beschneite Flur, bald übermütig, bald ängstlich und warnend. Auch im Fluge läßt sie oft ihre schackernde Stimme hören, und stört man sie an der Niststelle, so will das ängstliche »schackschackschack« gar kein Ende nehmen. »Schackelster« nennt sie der Volksmund. So ganz ohne die edle Gabe Apolls ist unser Vogel aber doch nicht. Im zeitigen Frühjahr schon beginnt die Elster mit ihrem Gesang, einem geschwätzigen Plaudern, dem auch einige pfeifende Töne beigemischt sind. Das ist ihr Liebeslied, an dem sich beide Geschlechter beteiligen, am anhaltendsten in den Flitterwochen und fast nur in der Nähe ihres kleinen Horstes. Daß sie fremde Laute mit einflechten, bedarf kaum der Erwähnung; das treiben alle rabenartigen Vögel so, namentlich auch Vetter Markolf, der Eichelhäher. Schon der alte Geßner sagt von der »Aegersten« oder »Azel«, sie verändere stets ihre Stimme, »also / dz sy schier alle tag ein andere hat«; sie ahme die Stimme der Zicklein, Kälber und Schafe nach, selbst die des Jägers, wie er den Hunden ruft, und das Pfeifen des Hirten.
Das Verbreitungsgebiet der Elster ist sehr groß. Es gibt kein Land in Europa, dem sie fehlte; auch das nördliche Asien bewohnt sie bis hin zum japanischen Inselreich. Die meisten Elstern habe ich in den Städten des Orients angetroffen. Der Türke scheut sich, ihnen ein Leids anzutun, und dank der türkischen Wirtschaft sättigt sich der Vogel gleich den herrenlosen Hunden auf den belebtesten Straßen. In dieser Beziehung ist mir der Blick auf Sarajewo, wie er sich vom Festungsberg aus bietet, unvergeßlich. Da war kaum ein Dachfirst, auf dem nicht ein paar Elstern saßen. Viele flogen auch durch die Luft und ließen sich dann auf den hohen italienischen Pappeln am Ufer der Miljačka nieder, wo sie von ihresgleichen mit heiserem Geschrei begrüßt wurden. Auch sonst traf ich den bei uns doch recht scheuen Vogel überall innerhalb der minarettgeschmückten Ortschaften an, ein Zeichen, wie die Elster dort, wo man sie schont, die Nähe des Menschen mit Vorliebe aufsucht. In Deutschland findet sie sich fast überall, allerdings in manchen Gegenden recht häufig, in anderen nur vereinzelt. Im allgemeinen aber scheint ihr Bestand, wenigstens in Mitteldeutschland, in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen zu sein, wohl infolge der Nachstellungen, denen die Raubgesellen mit Recht ausgesetzt sind. Das gilt z. B. von unserer Dresdner Umgebung. Am Rande der Dresdner Heide, am Blasewitzer Elbufer, [78]in der Gegend von Pillnitz und Pirna, auch elbabwärts nach Meißen zu noch vor wenig Jahren eine alltägliche Erscheinung, begegnet man heute der Elster viel seltener, obgleich sie nirgends völlig fehlt. In noch erhöhtem Maße gilt dies vom Leipziger Gebiet. So schreibt Richard Schlegel in den Mitteilungen, Band XV., S. 347: »Auch unsere schmucke, einst in Stadtnähe brütende Elster ist selten geworden und scheinbar noch völliger Vernichtung preisgegeben; schade um den reizenden Burschen. Mir ist sie unter solchen Umständen auch als Weidmann heilig.« Ich wünschte, daß diese Worte überall dort Gehör fänden, wo die Elster heute nur noch vereinzelt auftritt.
Sie gehört in Sachsen zu den jagdbaren Vögeln, denen das Gesetz allerdings keine Schonzeit zugebilligt hat, während sie z. B. in Preußen »vogelfrei« ist, demnach von jedermann gefangen, getötet oder ihrer Eier beraubt werden darf. Ich wende mich also an den Forstmann und den Jagdberechtigten, die in Sachsen allein ein Anrecht auf die Elster und ihren Horst haben, mit der Bitte, dort wo der schmucke Vogel nur vereinzelt auftritt, unter Umständen einmal Gnade für Recht walten zu lassen. Und zwar veranlaßt mich hierzu nicht nur die Schönheit der Elster, ihr Prachtgewand und ihre ganze elegante Erscheinung, sowie die ästhetische Bedeutung namentlich für das winterliche Landschaftsbild, sondern auch die Volkstümlichkeit, deren sich die Elster in deutschen Landen überall erfreut. Es ist besonders schmerzlich, wenn man sieht, wie gerade so viele volkstümliche Tiere, um die unsre Altvordern einen reichen Kranz von Märchen, Sagen, abergläubischen Vorstellungen gewunden haben, immer mehr aus unserer Heimat schwinden. Wir wollen in folgendem einiges anführen, was sich das Volk von der Elster erzählt.
Im Aberglauben spielt sie eine hervorragende Rolle, dem Raben und der Krähe ähnlich, und sie verdankt diesem Umstande bald besonderen Schutz, bald schonungslose Verfolgung. Die Elster ist ein Hexentier, das heißt ein Vogel, in den sich die Hexen gern verwandeln; diese benutzen neben Ofen- und Heugabeln, Deichseln, Butterfässern, Dreibeinen, Kochlöffeln usw. auch Elsternschwänze, wenn sie in der Walpurgisnacht durch die Luft reiten. Weil die Elster verflucht ist, sagt man im Oldenburgischen, muß sie sich erst neunmal an einem Zweige aufhängen, ehe sie ein Ei legen kann, und weiter heißt es, wenn man in die Rinde ihres Horstbaums ein Kreuz schneidet, das Sinnbild des Christentums, so verläßt die Elster ihre Brutstätte; man hat damit die Hexe vertrieben. Mit diesem Glauben an die dämonische Natur der Elster hängt auch der in Tirol, Thüringen, Sachsen, Oldenburg und anderwärts geübte Gebrauch zusammen, eine Elster mit ausgebreiteten Flügeln an die Türe des Viehstalls zu nageln, um dessen Bewohner vor Zauber zu schützen. Gewiß soll das gekreuzigte Hexentier die Gespenster abschrecken, indem es ihnen meldet, wie unsanft der Hofbesitzer solch nächtliches Gelichter behandelt, das sich seinem Gute nähert. Andere wollen durch die angenagelte Elster die Fliegen vom Vieh abwehren.
[79]
Unter solchen Umständen gilt die Elster, ähnlich wie die Eule, als Unglücksbotin. Zank und Streit verkündet sie dem Hause, in dessen Nähe sie schackert, und setzt sie sich gar auf das Dach, so stirbt in drei Tagen ein Bewohner. Fliegt sie quer über das Dorf, so zeigt sie in der Wetterau ein Leichenbegängnis an, Krieg aber, wenn sie haufenweise erscheint. Hört man eine Elster auf der Reise, ohne sie zu sehen, so bedeutet das schlimme Gesellschaft; läuft sie einem aber gar über den Weg, so ist es besser umzukehren, denn es droht Unglück. Vielfach gilt es als eine frevelnde Herausforderung des Schicksals, eine Elster zu schießen oder ihren Horst zu zerstören, z. B. in der Lausitz, auch in Norddeutschland, und nur dann ist es keine Sünde, den Vogel zu töten, wenn man seiner zur Heilung von Krankheiten bedarf.
In der alten materia medica spukt die Elster vielfach herum; ja noch heute lebt der Glaube an ihre heilende Kraft in unserm Volke fort. Namentlich bei Augenkrankheiten und bei Epilepsie leisteten die Elstern vortreffliche Dienste. Das scharfe Gesicht des Vogels, der so lüstern auf blitzende Gegenstände ist, daß er nicht selten zum Dieb wird, diente wohl den alten medicis als »Signatur«. Man brannte die Elster zu Asche, indem man sie in wohlverschlossenem Gefäß der Glut aussetzte; die Asche pulverte man und rührte sie mit Fenchelwasser an oder bereitete eine Augensalbe daraus. Aus jungen Elstern destillierte man auch ein berühmtes Wasser, »aqua picarum«, das die Röte von den Augen nahm, zugleich aber auch sonst bei verschiedenen Gebrechen gute Dienste leistete. Wer Kügelgens »Jugenderinnerungen eines alten Mannes« gelesen hat, der wird sich mit Vergnügen des originellen Pfarrherrn Roller zu Lausa erinnern, der alljährlich an die hundert Elstern im Backofen verkohlte und das so gewonnene schwarze Pulver als Medizin weithin versandte, nachdem er es an seinem Bruder ausprobiert hatte. Dieser litt an epileptischen Krämpfen; nach ein paar Monaten war er geheilt. Von seinen Patienten verlangte Roller übrigens nichts anderes, als einen gewissenhaften Bericht, wie die Medizin bekommen sei. Noch heute gilt »gebrannte Elster« hie und da als volkstümliches Mittel gegen die »fallende Sucht«. Allerdings, so meinen manche, müßten die Vögel »in den Zwölfen«, das ist zwischen Weihnachten und Heiligdreikönig, geschossen sein; denn nur um diese Zeit habe die Natur ihre ganze Kraft zusammen. Vielleicht glaubte man, daß die Elster selbst mit der »schweren Krankheit« behaftet sei und deshalb ein Heilmittel biete nach dem Grundsatz »Gleiches durch Gleiches«. Ob das unruhige, allzeit quecksilberne Wesen der Elster die Veranlassung gewesen, bei ihr epileptische Zustände vorauszusetzen, oder ob nicht der einzige Grund der ist, daß Veitstanz und Fallsucht vom Volk für Krankheiten gehalten wurden, mit welchen dämonische Mächte den Menschen heimsuchen, weiß ich freilich nicht.
In einer Menge von sprichwörtlichen Redensarten macht sich unser Volk über die Schwatzhaftigkeit der Elster lustig, über ihr inhaltleeres, verständnisloses Nachplappern. Da sagt man: »So lange die Elstern schwatzen, [80]singen die Schwäne nicht«, das heißt, wo unwissende Schwätzer sich breit machen, schweigen die Verständigen. »Er hat von der Elster gegessen«, sagt man dem seichten Schwätzer nach; auch läßt die Fabel Elster und Nachtigall wettsingen zur Belustigung aller Tiere des Waldes, während im Märchen die Elster mit den Worten begrüßt wird: »Frau Elster, hat sie Plapperwasser getrunken?« Hans Sachs verspottet die schwatzhaften Dummköpfe mit folgenden Worten:
Auch auf die Ankunft von Gästen weiß das Volk der Elstern Geschwätz zu deuten: »Ich habe die Elster vernommen – es werden Gäste kommen«, oder man schließt aus ihrem Plappern auf anhaltend schönes Wetter. Man denke auch daran, daß jung dem Horst entnommene Elstern Worte und ganze Sätzchen nachzuplappern lernen. Schon Plinius weiß davon. »Die Elster,« sagt er, »ist weniger berühmt als der Papagei, weil sie nicht ausländisch ist, spricht aber noch ausdrucksvoller. Die Worte, die sie spricht, hat sie ordentlich lieb.« Auch der römische Dichter Martial, der »Verwegene«, wie ihn Goethe nennt, erwähnt die Elster in folgendem Epigramm:
Ovid erzählt, wie die neun Töchter des Königs Pieros in »allnachahmende Elstern« verwandelt wurden, weil sie die Musen geschmäht hatten.
Eine christliche Sage knüpft an den Erlösertod des Heilands an; sie berichtet, unter allen Vögeln seien die Elstern die einzigen gewesen, die beim Verscheiden Christi nicht getrauert, sondern gespottet und gelacht hätten; zur Strafe müßten sie nun zeitlebens ihr unschönes »Schackern« hören lassen.
Auch diebisch heißt der Volksmund die Elster, nicht ohne Berechtigung. Auffallende, glitzernde Gegenstände erregen die Aufmerksamkeit unsers Vogels in hohem Grade; er verschleppt solche Dinge gern in irgendeinen Winkel oder in seinen Horst. Ich weiß einen Fall, wo ein Elsternnest folgendes Stilleben aufwies: siebenundzwanzig blanke Knöpfe, fünfzehn farbige Glasscherben, viele bunte und glänzende Steinchen, acht Nickel- und Kupfermünzen, ein Trompetenmundstück und eine Brille. Die Redensart: »stehlen wie eine Elster« hat also ihre Begründung.
Es ist wenig Erfreuliches, was das Volk von der Elster erzählt, aber daß es so viel von ihr berichtet, ist doch ein Beweis für ihre Volkstümlichkeit. Dieser Umstand gibt mir eine gewisse Berechtigung zu der Bitte, der Elster nicht gerade den Vernichtungskrieg zu erklären. Man schieße zwei oder drei Nebel- bzw. Rabenkrähen mehr ab, aber schone das Elsternpaar, wenn es das letzte im Revier ist – volkswirtschaftlich wird es auf eins herauskommen.
Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Werner Schmidt – Druck: Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden
Photographische Platten »Perutz« – Photographische Aufnahmen: Max Nowak – Auflage 50 000
Diesem Hefte liegt eine Ankündigung der Dürr’schen Buchhandlung, Leipzig, bei, die wir der Beachtung empfehlen.
Einbanddecken
Jahrgang 1926 (Band XV)
in Leinen Mark 1.50
und 30 Pfg. Postgeld und Verpackung
Besucht unser
Erholungsheim Bienhof
bei Gottleuba
in herrlichster, nervenberuhigender Lage unweit
unserer Naturschutzgebiete Sattelbergwiesen
Preis für das Bett 75 Pfg. die Nacht in Einzelzimmern
Gute Verpflegung täglich M. 3.50
Anmeldungen an unsere
Geschäftsstelle, Dresden-A.
Schießgasse 24
(Für die Sommerferien erbitten wir umgehende Bestellung!)
3. Zwingerlotterie
zur Erhaltung
des weltberühmten Dresdner Zwingers
Geldgewinne RM 160 000
Los RM 1.—
Ziehung bestimmt
9. und 11. April
Lose
bei allen Kollekteuren
Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.