
The Project Gutenberg EBook of Vom sterbenden Rokoko, by Rudolf Hans Bartsch This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Vom sterbenden Rokoko Author: Rudolf Hans Bartsch Illustrator: Alfred Keller Release Date: August 24, 2018 [EBook #57765] Language: German Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VOM STERBENDEN ROKOKO *** Produced by Franz L Kuhlmann, Norbert H. Langkau, Jana Srna and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Deckblatt ist vom Einband des Originals übernommen.
Offensichtliche typografische und Fehler bei der Zeichensetzung sind stillschweigend bereinigt.

Rudolf Hans Bartsch


Umschlag und Buchschmuck
von Alfred Keller
Sechstes bis achtes Tausend

Leipzig
Verlag von L. Staackmann
1909
Alle Rechte vorbehalten.
Druck von C. Grumbach in Leipzig.
| Seite | |
| Die Schauer im Don Giovanni | 7 |
| Der frivole Vaudreuil | 29 |
| Der Liebestrank | 65 |
| Die kleine Blanchefleure | 113 |
| Madame Dorette und die Natur | 149 |
| Der Salon der Frau von Vermillon, oder: Das Register |
213 |



Es war einmal ein rasiges, wiesenhaftes Wien.
Um die Stadt hielten sich die grünen Basteien an den Händen: gar kein eherner Reifen. Nein, wie ein Ringelreihen lachender Mädchen. Bocksbart, violetter Salbei und sonnenfarbiger Löwenzahn wuchsen sorglos, das Gras wehte jedem Wind zuliebe, ganz so wie das große Kindervolk in jener Stadt, und ein hellgraublauer Invalidenfeldwebel hütete die kleine Halmbrut vor den zahllosen Kindern, welche mit eben dieser Zahllosigkeit schuld wurden, daß später graue Steine über die liebliche Rasensanftheit wuchsen.
Die Vorstädte lagen ringsum auf Wiesenhügeln oder in Bachsenkungen. Und die Wiese [10] war Königin der Gegend. Unverwüstlich brach sie selbst mitten in den heutigen inneren Bezirken aus der Erde, und alle Gassen waren rasig, weil das jubelnde Grün sogar zwischen den Pflastersteinen übermütig herauslachte. Die Natur neckte sich noch mit der Stadt; es war eine Kinderei ohnegleichen, und rechte Kinder des weinsonnigen Landes hatten auch diese Stadt gebaut.
Nicht hoch hinaus. Auf Zins und Miete wohnten damals so wenig Leute, daß in der Vorstadt ein zweites Stockwerk schon als protzig galt. Dazu vermochten diese hell lebendigen Menschen die Infamie der Baulinie noch nicht zu erfinden. Die Häuschen lagen wie aus dem Ärmel des lieben Gottes geschüttelt: Die einen über Eck, andere scheu in die Gartenferne zurückweichend; da und dort griff ein weingetreues Wirtshaus hedarufend mitten in den Fahrweg und zog die Langfront der Giebelstellung vor, weil Fuhrleute Raum haben wollen. Und in den Straßen lag die Sonne, und in den Straßen lag die Ruhe und die Bedächtigkeit. Der breite, volle Spruch: „Heute bin ich, und [11] das Morgen hat Zeit“. In unseren Tagen ist es eine Kostbarkeit, wenn der Sonnenstrahl bis auf den Straßengrund gelangt, eine Erstaunlichkeit, wenn sich dort ein Hund im warmen Scheine blinzelnd streckt, und ein Märchen, wenn ein Kätzlein die beneidenswerte Himmelsgnade auf seinen faulen Pelz brennen läßt. So ein Kater, der sich sonnt, ist wie ein Symbol der guten alten Zeit.
Damals war die Stadt eine Versammlung heimtrauter Anwesen, und über die Häuser hinweg grüßten sich winkend die Bäume der Nachbargärten. An der Mauer hing reichlich die Rebe, die wunderkräftige Rebe, welche eines ganzen Volkes Charakter bestimmen kann.
Damals war die Vorstadt Sommerfrische. Die beweglichen, reisegewohnten Künstler sogar, die leichtlebigsten Naturkinder, welche sich für eine Reise in den grünrauschenden Sommer Schulden aufzuladen vermochten, zogen hier nicht weiter als bis in die Vorstadt. Meister Wolfgang Amadé sogar, der nur zwei Werte kannte, den Tag und die Ewigkeit, der das [12] Morgen mitsamt seinen Reimen Borgen und Sorgen auslachte, dem war es genug, wenn er für den Sommer in Vorstadt oder Vorort ein vom Rauschen der Bäume ummusiziertes Gartenhäuschen hatte.
Dort schrieb er dann Sachen, über welche das Herz der ganzen Welt hüpfte und lachte. Das wiesenreiche Wien schaute ihm dabei über die Schulter. Jetzt im Herbst nahm er Abschied von der Wiese. Wenn er wiederkam, lag Allerheiligenreif darüber. Es war schon hoher Oktober, und er mußte nach Prag zu dem Volke, das fast besser zu singen und zu klingen verstand als die Wiener, um ihnen dort seinen Don Giovanni vorzustellen.
Wolfgang Amadé ging mit seinem Freunde, dem Geheimschreiber Gilovsky, der von Paris gekommen war, über die Rasenhügel der Türkenschanze; Wolfgang Amadé im schönsten Staatsfrack, der auf Kredit zu haben war, in Strümpfen und Schnallenschuhen, Gilovsky in der Werthertracht. Blauer Frack, gelbe Weste, Stiefel mit Stulpen. Ein wilder Junge, dem die Haare wie Flammen auseinander [13] standen; und seine Augen flackerten wie Lichter im Winde.
In der Ferne brannten die roten Buchenwälder des Kahlenberges.
„Der eine kommt, der andere geht,“ lachte Mozart, dem es wohltat, Plattheiten zu reden, wenn in seiner Seele der Aufruhr der Klänge wühlte. „Was gibt's Neues in Paris, Bruderherz?“
„Schwerwuchtig Neues,“ sagte Gilovsky. „Es rührt sich eine andere Welt, um zu entstehen. Die Franzosen werden ein anderes, eisernes Zeitalter schaffen.“
„Die Franzosen? Ach Gott nein. Das sind bloß Österreicher mit einer hübscher gefältelten Sprache. Ich glaube, die verklärten Seelen der Wiener kommen in Paris wieder auf die Welt.“
„Nimm das nicht so leicht, Wolfgang. Was hast du von Paris gesehen? Die Pompadour, Straußenschweif und Reiherbusch, Brokat und Parkett.“
„Und du?“
„Ich war anderswo. Bei den Winkelzeitungen, [14] wo junge Bürgerliche, glühend wie unterirdisches Feuer, für hundert Franken im Monat um zehntausend Franken Genie verbrennen. Wo über den Freiheitskrieg in Nordamerika gewispert wird, daß sich ihn Frankreich auf den eigenen Schiffen, in den eigenen Regimentern importieren wird. Gib acht, Wolfgang Amadé, — ein Volk, in dem die ersten Siedebläschen steigen.“
Mozart blieb stehen und schaute zu Boden. Die Musik in ihm schwieg. Nachhallend nur fielen ringsum von den goldenen Bäumen flüsternde Blätter. Wie verrieselnde Noten eines Scherzo, welches zu Ende ging.
Der junge, wilde Gilovsky in seiner Werthertracht aber zog ihn mit sich: „Hörst du, sie hassen dort das helle, frohe Genießen, und ich, Wolfgang Amadé, ich hasse es auch. Denn ich bin einer von der neuen Welt, das habe ich dort erfahren. Dort sind die Gassen eng, die Häuser hoch. Dort brütet in Staub und Brodem der Stank der Sonnenlosigkeit. Dort hockt die hohlwangige, skrofelfeuchte Wohnungsnot, das Elend der Masse, der [15] maschinenstarke Druck der Industrie über jeder Brust. Hier in Wien gibt es das noch nicht, was sie in London Mob, in Paris Pöbel nennen. Hier hat der unterste Stand seinen Stolz und der Stolz seinen Grundbesitz. Dort aber hat ein böser Übermut den Menschen zur Schachtelware gemacht. Gedrängt sitzt dort das blaßwangige Elend, — aber Wolfgang: es jammert nicht. Es brütet. Und das ist schön, — schön! Hier singt und leuchtet die Welt noch. Wien ist eine große Wiese, voll Grillen und Heupferdchen, die alle im schläfrigen Sonnenschein musizieren. Dort aber ist der Groll, das Stöhnen, der Seufzer, die Sehnsucht. Dort erlebst du das Wunder, daß Flammen aus dem Sumpfe steigen; die Flammen des Irrlichtes. Es ist schön, wunderschön, geheimnisvoll schön!“
Wolfgang Amadé fieberte leise. In ihm hatte stets wie hinter einem Vorhang ein kleiner, dunkler Raum gelegen, in dem Ähnliches träumte. Nun fingen dort seltsame Stimmen zu rufen an, die ihn mit Angst schüttelten. Stimmen, welche für seine Sonnenwelt das [16] Jenseits bedeuteten. Sie hatten schon vor Jahren aufgeschrien, als Graf Arco ihn wie einen Halunken aus den Diensten des Erzbischofs gestoßen hatte, und hatten von da ab stets einen leisen Unterton gesungen, wenn übermütige Adelige ihn begönnerten. Aber er liebte so sehr das Lachen, die bunten, schönen Kleider, die reichen, königlich frisierten Frauen, den Champagner und den Luxus, daß diese Stimmen selten sangen. Nur dann und wann schwang sich unendliche Wehmut wohllautvoll wie ein sterbender Schwan über die Welt seiner Melodien empor. Es war das österreichische Juchzen, von dem niemand sagen kann, ob es Lust bedeutet oder Weh, denn trunkene Arbeiter und Rekruten können es am besten.
Auch der kleinen Zofe Despinetta, so übermütig sie ist, hat er solche sehnsüchtige Töne gegeben, die wie geängstigte Lerchen über die abendlich verdunkelte Welt in das Sonnenreich hinaus wollen.
„Bruder Wolfgang,“ mahnte Gilovsky, „hast du nicht einen Geheimverein gründen wollen, mit dem Namen ‚Die Grotte’? Einen Verein, [17] in dem der Ernst des Lebens wie ein unterirdisches Wasser unter den Wiesenflächen der Sonne raunt und murmelt? Ich wüßte dir Mitglieder — — — —“
„Da muß ich dir gestehen,“ sagte Mozart, „daß wohl im Grunde meines Wesens der Widersacher stets eine Unterstimme hat. Aber der Gedanke mit der Grotte entstand nur aus der Angst, die unsereins, vom Menschenvolk, hat, sich nicht bestätigt und bekräftigt zu fühlen. Siehst du, lieber Gilovsky, man wünscht sich Mitschuldige. Aber freilich, wenn man dann einen sieht und hört, dann erschrickt man vor ihm und vor sich selber.“ — Und er lächelte: „Ich werde allein bleiben in meiner Grotte.“
„Das ist,“ rief Gilovsky unwillig, „weil du für nichts anderes ein Herz hast, als für deine Noten!“
Und er sprach weiter von London und Paris und wiederholte, daß ihm die düsteren Gassen, die Unzufriedenheit als Seele aller Menschengröße tausendmal geliebter sei als alles Te Deum laudamus.
Mozart aber, das Kind, in welchem das Ja [18] sonst lebendiger war als das Nein, schwieg mit bangem Herzen. Denn zwei gleich starke Mächte standen vor ihm und schauten ihn aus großen Augen an.
Er versuchte unter diesem Blicke abzulenken und spähte in die Ferne, wo, in den Buchenwäldern des Kahlenberges, des Todes festlich rot und gelbe Fahnen wehten; darüber lächelte der begütigt blaue Himmel. —
Wieder die beiden Mächte. Sie standen vor ihm und schauten ihn an.
Da schüttelte der geplagte Wolfgang Amadé die gepuderten Locken, daß der Zopf die Schultern schlug und ein leises Reismehlwölkchen im Herbsthauch davonflog. Er schüttelte sich wie ein Rößlein, das Bremsen verjagen möchte.
„Ein Glas Wein, Bruder,“ rief er dann. „Lassen wir jedem das Seine und vereinigen wir uns. Ich will vergessen, du mußt es. Ein Glas Wein, hier, vor diesem Häuschen? Wie schön winkt es uns zu!“
Gilovsky schüttelte den Kopf: „Du Leichtsinn! Du Leichtsinn!“
[19] Sie blieben vor der kleinen Heurigenschenke stehen. Das letzte Häuschen von Währing. Eigentlich zwei aneinandergebaute; sie standen unter einem Dache. Links eine Wirtshaustür mit dem Föhrenzweigbüschel, des Herrgotts Zeigefinger, daß hier heuriger Wein zu haben sei. Zwei laubüberfallene Tische im Freien, eine vormittagstille Wirtsstube. Rechts eine Gärtnerei, und des Hauses ganze Hälfte überhangen mit Kränzen für Allerheiligen. Tiefblutviolette Blattkränze oder welschkorngelbe Reifchen, in denen mit schwarzen Samenkörnern eingefügt stand: Ruhe sanft. Die Astern, die Enterbten des Sommers, hatten hier ihren Beruf gefunden, und was sonst noch von der kinderfroh stehenden Schar der Blumen den Herbst überdauert hatte, alles war hier als Trödelkram des Totenfestes in Kränzen zusammengeschnürt.
Abermals standen vor ihnen die beiden gleichstarken Mächte und schauten sie aus großen Augen an.
Wolfgang Amadé wehrte sich nicht mehr. Still und ergriffen trank er seinen Wein und [20] sah die Allerseelenkränze an. Und Gilovsky saß neben ihm, — Ossians Gesänge und die Leitartikel der Pariser Winkelzeitungen wildbunt in einem Herzen zusammengepreßt.
„Wird dein blaßwangiges Elend voll Druck und Haß jemals bis in diese Einsamkeit der Blumen und Reben heraufgreifen?“ fragte Mozart.
„Die neue Zeit wird ihre Hand auch um diese Vergessenheiten schließen. Es wird eine Welt kommen, in welcher selbst die Armut Geist und Seele haben wird.“
„Ich sehne mich,“ sagte Mozart, „mit zerspringendem Herzen nach jenen, welche sich in dieser neuen Zeit nach mir sehnen werden!“
Dann trank er rasch und viel von dem neuen Weine, der ihnen vorgesetzt worden war, und sprach den ganzen Tag kein vernünftiges Wort mehr.
Gilovsky trennte sich bald von ihm. 's ist ein Musikant, dachte er im Fortschreiten; die Harmonie ist ihm wichtig und die endliche Auflösung in Reinheit und Einheit notwendig. Niemals [21] wird er den Sturm, die Zerstörung und den Haß erkennen, welche viel notwendiger sind.
Mozart fuhr nach Prag, um seinen Don Giovanni zu vollenden, Gilovsky aber suchte in Wien die Freunde, welche ihm helfen sollten, die neue Zeit mit dem Sturm, der Zerstörung und dem Haß auch im wiesenhaften Wien zu gestalten.
Er wurde, zur Zeit der Revolution, Jakobiner und begann mit einem Dutzend Menschen, welche unter Millionen von Österreichern allein dachten wie er, jene Verschwörung, welche mit Kräften, die kaum hingereicht hätten, den Bürgermeister einer Kleinstadt zu stürzen, den Thron der Habsburger untergraben wollte.
Der Verhaftung hat er sich dann durch einen Pistolenschuß ins eigene Herz entzogen. Er starb im Wertherstil, den er so sehr geliebt hatte.
Alles, was von diesem wilden Herzen übrigblieb, sollten die ahnungsvollen Schauer sein, [22] die er an jenem Herbsttage in Mozarts Seele zum Tönen gebracht.
Wolfgang Amadé aber schien sie bereits vergessen zu haben. Denn vor Prag hatte Freund Duschek einen sonnenluftigen Weingarten. Dort wohnte Wolfgang Amadé, schob Kegel und hatte dabei Herz und Kopf voll Wohllaut.
Alles war zum Don Giovanni fertig. Die süßen Schmeicheleien Zerlinens und die Weltfreude seines Helden, — sogar der Bauernbursch; und einzig noch fehlten der tote Komtur und die Ouvertüre. War es ihm denn unbequem?
Sie tranken dort, tollten und neckten sich in der Villa vor dem goldenen Prag; nur bänglich leise fragten manchmal die Freunde: „Was ist mit der Ouvertüre? Die Oper soll in wenigen Tagen gegeben werden!“
Er aber lachte und sagte: „Laßt mir mein bißchen Freude.“
Und am Abend machte er nichts als Kindereien; es war ein prächtiges Festmahl gerichtet [23] worden, an dem sechs oder sieben Bewunderer Mozarts, fast alles Herren vom Adel, teilnahmen. Leckereien, Champagner, der den ganzen Tisch überströmte, Blumen — — —.
Und Wolfgang Amadé tollte und scherzte, während sich die Freunde in leiser Unruhe ansahen.
Als das laute Mahl zu Ende gegangen war, fragte Duschek: „Was ist mit der Ouvertüre?“
„Ich mache sie jetzt,“ lachte Mozart.
„Du wärst am Ende auch das imstande,“ sagte der Freund halb ungläubig und bot ihm gute Nacht.
Im Saale stand ein Spinett, und der einsam Zurückgebliebene warf sich in den Sessel davor und legte die wunderschönen, blassen Hände auf die Tasten. Leise klirrten die Saiten, wie die einer alten Harfe.
Duschek hatte den Dienern gesagt: Laßt den Saal in Ruhe. So strahlten noch sechzig Kerzen, und die großen, nachdenklichen, venezianischen Spiegel reflektierten sie und wucherten mit dem Lichte.
Da sah sich Wolfgang Amadé im Saale um.
[24] Hell schrien Lichter und Farben mitten in verlassener Mitternacht. Die Blumen prahlten, aber schon lag die Welkheit überstandener Blüte in ihrem Duft.
Es roch nach Blumen, nach Wachs, — — — und die große, lange Tafel stand da wie ein Katafalk.
Es ist ein überirdisches Sein, wenn man allein stehen muß in einem Festsaal, und das Fest ist aus. —
Noch sind die Farben des Lebens alle da, und die Lichter rufen Hosianna. Aber es riecht nach verschüttetem Schaumwein, und die hier jubelten, sind alle fortgegangen.
Die Wachskerzen leben allein noch. Aber sie sind doch schon tief heruntergebrannt. Und die Blumen neigen die müden, schönen Köpfe wie unglückliche, gekrönte Frauen. Entwurzelt und mit dem Glanze betrogen.
Die große, schwere Tür aber war weit nach außen geöffnet. Draußen im Korridor stand blindaugig die Nacht, und das weitaufgerissene schwarze Viereck starrte schaurig in den grellen Saal des ausgelärmten Lebens.
[25] Da schauten ihn abermals die beiden großen Gewalten an, aber dieses Mal war die zweite stärker als die erste.
In leisem Grauen setzte er sich an das Spinett. Zuckend breiteten sich die milden, schönheitspendenden Hände, und ein wohllautvoller Klageton flog im Saale empor.
Wolfgang Amadé sah nach dem schwarzen, starrenden Viereck der Türe, welche zur Nacht hinaus offen stand; leise rieselte ihm dieser Blick aus dem Jenseits über den Rücken, und gehorsam bebten die Hände nach dem Geheiß der großen Macht über die Tasten. Er war ein Kind, das auf Befehl folgte.
So entstand das „Weit — — — weit“ des steinernen Gastes mit seinen Schauern.
In ihren Betten aber hörten die adeligen Gäste eine Musik aus dem Festsaal herüberbeben, welche damals unerhört war; — — so schön und ergreifend wie die Liebe zum Leben, so mahnend und so schauerlich wie das Gericht.
[26] Diese Töne sangen den Druck der engen Gassen von Paris. Sie sangen die Not und Angst des Kindes Wolfgang Amadé. Sie sangen den Wein von Währing und die Allerseelenkränze. Den begütigt blauen Himmel und die herbstloh brennenden Wälder.
Sie bebten wie die zitternden Kerzen in Brand und Helle, dufteten wie welkende Blumen und rochen wie verschütteter Schaumwein.
Sie lockten und zogen sehnsüchtige Reihen mit festlichen Geigen und waren Jubellieder übermütiger, graziöser Adelszeit, — — — aber hinein schaute nachtäugig die viereckige, große, schwarze Tür des Jenseits, die zu einem Morgen führte, den sie noch nicht kannten.
Und sie schauerten und fröstelten in ihren Betten vor Entzücken und Angst.
Drunten aber stand Wolfgang Amadé vom Spinett auf, die sonst so trüben Augen fackellohend, aber das Antlitz leichenblaß und kalt.
Der verrieselnde Rausch fröstelte leise in ihm. Seine Ouvertüre war fertig.
Er merkte sie sich gut. In der nächsten Nacht schrieb er sie wohl nieder? Aber seine gute [27] Frau müßte ihn wach erhalten. — — — Denn so einsamkeitgeschüttelt wie heute? — — — Das war mehr Tod als Leben....
Er ging fort, um zu ruhen. Hinter ihm flammte und strahlte ein leerer Prunksaal.
Es war der Schwanengesang des Rokoko entstanden.
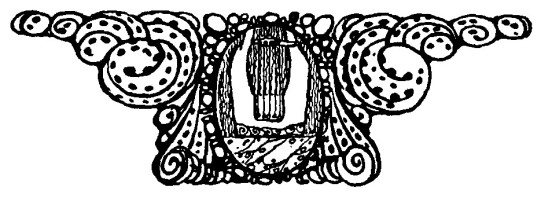


„Nun, Prospère? Verbündeter! Wie geht's? Was hat dein Herr mit unserem Theaterstück ausgerichtet?“
„Herr von Beaumarchais, wir sind sehr betrübt, Ihnen nicht besser gedient haben zu können,“ bedauerte der Kammerdiener. „Ich für meinen Teil habe alles angestrengt, die ‚Hochzeit des Figaro’ zur Aufführung zu bringen, die meinem Stande so viel Gerechtigkeit widerfahren läßt. Seit mein Herr dieses schöne Stück gelesen hat, behandelt er mich sozusagen mit Achtung.“
„Ah,“ lachte Beaumarchais; „er bildet sich ein, auch du müßtest ein Mensch sein? Ein Mensch mit eigenen Gedanken und selbstbedachten Überzeugungen? Was für [32] ein Schwärmer dein Graf; — was für ein Poet!“
Den letzten seiner elliptischen Sätze sprach Herr Caron de Beaumarchais in den Spiegel, durch den er des glänzenden Grafen von Vaudreuil Exzellenz eintreten sah. Er sah auch noch das Lächeln des geschmeichelten Herrn über solches Lob. Dann begrüßte er seinen Gönner.
Der Graf von Vaudreuil war noch von der Audienz im Trianon her in großer Gala und leuchtete von Tressen, Seide und Edelsteinknöpfen heller als ein Bischof im Prunkornat, nur daß diese flimmernden Sachen hübsch, knapp und zierlich an ihm saßen. Er war ein Herr voll feinster Eleganz, der nicht erst als Fünfziger in die Meisterjahre des guten Tons eingetreten war, der bei der Königin alles galt und beim König so viel als Marie Antoinette vermochte: also fast alles.
„Ach Caron,“ rief er müde. „Was soll man mit diesem König machen? Wenn man ihm einen alleruntertänigsten Vortrag hält, so muß alles gut und schön sein wie Gottes Schöpfung [33] am siebenten Tage, da Er sich selber Ruhe genehmigte. Was soll man mit diesem Herrn anfangen, der einem den Rücken dreht, wenn man ihn etwa versichert: Sire, der Adel Frankreichs ist so, wie ‚Figaros Hochzeit’ ihn schildert. Sie haben einen lächerlich unnützen Adel, Sire. — Eine öffentliche Aufführung von ‚Figaros Hochzeit’ würde nur die elektrische Entladung sein, die, nach Herrn Franklins neuester Theorie, die Lüfte im Kampfe ausgleicht, beruhigt und reinigt.
Und der König dreht mir den Rücken und die Audienz ist aus! Er dreht mir den Rücken, sage ich Ihnen, so: — — und die Audienz ist aus ...... Ist aus! Was doch soll man mit einem Herrn machen, der nur angenehme Beruhigungen hören mag?“
„Ei so,“ seufzte Beaumarchais. „Er ist von jener Königsrasse, die nur angenehme oberste Untergebene dulden mag. Noch Ludwig XIII. hielt große Stücke auf unangenehme Kanzler. — Richelieu! Und Frankreich war groß und blieb es so lange, als sein Nachfolger sich von ähnlichen, eigensinnigen Willenskräften beraten [34] ließ. Als der Sonnenkönig damit aufhörte, erging es Frankreich gar nicht mehr gut.
Die Herrscher mit den angenehmen Untergebenen zerstören ihre eigenen Reiche. Unsere ruheliebende Majestät ist solch ein Mann. Sie geruht, auf alle unbehaglichen Zumutungen so lange Nein zu sagen, bis sie Ja sagen muß. Dadurch beraubt sie sich nur des Verdienstes, selber zur rechten Zeit Ja gesagt zu haben. Diese Majestät wird auch zur Aufführung der ‚Hochzeit des Figaro’ in Paris ihre Einwilligung erst dann geben, wenn alle Welt das Stück schon heimlich kennt und wird damit nur meinen Erfolg steigern.“
Der Herr Graf von Vaudreuil bejahte eifrig und fuhr dann in seinem Berichte fort: „Übrigens, mein lieber Caron, war ich, gleich nach meiner kurzen Audienz, — bei Ihrer Majestät, der eigentlich regierenden Königin. Sie hat unsere Sache mit ihren schönen Händen, die sich in alle Dinge mischen, gleich ins Rollen gebracht: „Aber führen Sie doch die hübsche Satire als Liebhabervorstellung auf Ihrem eigenen Schloßtheater in Morfontaine auf,“ [35] lachte sie mich an. „Die Erlaubnis dazu gebe ich Ihnen, und, laden Sie tout Paris ein! —
Nun, Caron, was sagen Sie?“
„Ah,“ rief Beaumarchais und schnellte fröhlich empor. „Das ist eine entzückende Dame! Haben Sie denn, teuerster Graf, schon Vorbereitungen zu unserer Aufführung getroffen?“
„Ei freilich,“ lächelte der Herr von Vaudreuil. „Für die Rolle des Figaro habe ich den größten Philosophen und Charakter Frankreichs, den neuen Schauspieler Crambon gewonnen. Ein Puritaner! Sittenrein und natürlich bis zum Exzeß! Sie werden gleich seine Bekanntschaft machen. Die Regie führen Sie selbst, teurer Dichter. Die Leseproben und die Finessen des Dialogs leitet, wenn es Ihnen lieb ist, unser gemeinsamer Freund, der Dichter Lebrun.“
„Sehr gut,“ bemerkte Beaumarchais. „Lebrun ist ein Medisant von erprobtester Bissigkeit. Er wird die Unverschämtheiten im Dialog auf das feinste herausarbeiten.“
[36] „Der Chevalier von Coigny gibt den Jesuiten.“
„Ha, ha! Der Coigny, der berüchtigte Freigeist und Spötter steckt sich in die Soutane! Mein lieber Graf, der Einfall ist besser als mein ganzes Stück!“
„Die Gräfin,“ fuhr Vaudreuil überglücklich fort, „wird von der elsässischen Demoiselle Klincker sehr rührend und unschuldig gegeben werden. Demoiselle ist auch in den Stunden, wo sie mir ihre Liebe schenkt, rührend und unschuldig. Diese deutschen Mädchen sind wie das Blümchen Vergißmeinnicht. Sie schauen stets fromm in den Himmel, selbst während man sie pflückt. Demoiselle Klincker wird die Unschuld und das Gefühl in Person sein.“
„Wer gibt denn den Pagen?“ erkundigte sich Beaumarchais.
„Die kleine Cidronne, aus meiner Komödiantengesellschaft.“
„Und die Suzanne?“
„Hm,“ sagte Vaudreuil mit einer winzig kleinen, aber sehr liebenswürdigen Verlegenheit: „Das ist eine sonderbare Sache. Denken [37] Sie sich, die Zofe meiner Frau, die reizende Lenore Oiseau, liegt mir beständig an, ich solle sie einmal spielen lassen. Sie hat Ihr Stück gelesen und mir die hübschesten Sachen aus der Rolle der Suzanne, die sie auswendig kennt, entzückend rezitiert ....“
„Ah, da werde ich sie prüfen,“ freute sich Beaumarchais.
„Wenn ich bitten dürfte, so lassen Sie mich dabei sein,“ warf der Herr von Vandreuil rasch ein. Dann flüsterte er: „Im Vertrauen, mein Freund: Die kleine Lenore hat mir für diese Vergünstigung, die Rolle kreieren zu dürfen, eine reizende Zusage gemacht ....“
„Sie sind indiskret, lieber Graf,“ schmunzelte Beaumarchais. „Immerhin wird sie ihre Talentprobe abzulegen haben und ich werde sie strenge prüfen, denn an der Rolle liegt viel. „Ah!“ schaute er überrascht empor und starrte in die vom Kammerdiener geöffnete Tür. „Da kommt ein Amerikaner?“ Er erhob sich, über die Maßen höflich: „Herr Benjamin Franklin selbst, wenn ich nicht irre?!“
Vaudreuil lachte herzlich über diesen Irrtum, [38] und der neue Ankömmling, der, in sackgrobes Tuch gekleidet, mit Stiefeln, rundem Hut und Knotenstock in seltsamen Kontrast zu den beiden leuchtenden Messieurs trat, begann sogleich mit kurzen Worten: „Nein. Benjamin Franklin hat nur die dumme Manier, sich so freiheitlich zu kleiden wie ich. Mein Name ist Crambon, bester Dichter.“
„Ah.“ Beaumarchais verneigte sich belustigt. „Sie sind es, der meinen Figaro geben soll?“
„Mhm,“ bestätigte Crambon, indem er mit den zusammengebissenen Kinnbacken gegen die Brust knackte.
„Dann geben Sie ihn doch, bitte, nicht so ehrlich und rauh, wie Sie auftreten, sondern als gewandte Schlange; nicht?“
„Ich werde ein feines Luder aus ihm machen, so ungern ich Seidenstrümpfe trage,“ sagte Crambon. „Aber Ihre Philosophie ist so tüchtig, daß ich die meine für einen Abend gern beiseite stelle.“
„Ach bitte, das tun Sie möglichst vollständig!“
[39] „Wir werden, wir werden,“ murrte Crambon.
„Nehmen Sie das nicht so leicht,“ warnte Beaumarchais. „Es gehört viel Genie zu einem gewandten Darsteller des Figaro!“
„Da müssen erst viele Halbwüchsigkeiten Genies genannt werden, bis endlich ein wirkliches Genie — — übersehen wird,“ brummte Crambon prachtvoll.
„Aber Sie sollen nicht übersehen werden,“ klagte Beaumarchais. Ihm war sehr bange um den Erfolg dieses Figaro.
„Ich werde mich benehmen wie ein Schuft,“ versprach Crambon. „Ich werde elegant und geschmeidig sein. Ich werde brillant und liebenswürdig sein; ich werde eine weiche Stimme haben und spielen, wie die süßeste Geige des Meisters Amati. Geben Sie nur acht, ich werde mich so reizend benehmen, als ob ich ein Schuft wäre.“ Er schloß unerwartet, indem er schrie: „Jetzt aber muß ich endlich zu essen kriegen!“
Herr von Vaudreuil rannte nur so nach seinem Kammerdiener, um den Hunger des Bürgers Crambon nicht bis zu noch gefährlicheren [40] Grobheiten wachsen zu lassen. Nach drei Minuten schon klappte Prospère an der Tür die feinen Beine zusammen und meldete:
„M'sieur Crambon est servi.“
Herr Crambon stürzte gierig ab.
„Da geht er hin, das aufrichtige Kind der Natur,“ sagte Vaudreuil in andachtsvoller Ehrfurcht. „Er wird Filetstücke von der Größe einer neugeborenen Katze in sich hineinschwingen, aber er wird Wasser dazu trinken, in seiner rauhen Tugend. Es ist unglaublich, lieber Caron, aber er hat sich jedes Bett verbeten — und schläft auf einer Matratze in der entlegensten Dachkammer. Er trinkt keinen Wein, er ist keusch, er ist aufrichtig — — — es ist unglaublich!“
„Und der soll meinen Figaro geben,“ jammerte Beaumarchais. „Ach, Herr Graf, wo haben Sie Ihren sublimen Instinkt, Ihre Delikatesse, Ihre klugen Augen gehabt!“
„Der Schein spricht gegen ihn, das gebe ich zu,“ gestand Herr von Vaudreuil etwas bedrückt. „Und dennoch leistet er auf der Bühne geradezu das Gegenteil dieses seines wahren [41] Wesens! Es ist kaum möglich, aber Sie selbst werden es erfahren.“
Beaumarchais blieb ungläubig.
Immerhin: die Theaterprobe verlief entzückend.
Herr Crambon hatte seine rauhe Tugend abgelegt, wie ein galanter Konnetable von Frankreich am Abende nach der Schlacht das ruppige Kettenhemd. Er war nicht übel und verhieß nichts zu verderben. Die zahlreichen Sentenzen, Malicen und Frechheiten, die er abzufeuern hatte, sprach er etwas allzu ehrlich, aber das schadete nicht viel. Es war eine angenehme Enttäuschung.
Wer von den erlauchten Gästen des Schlosses scherte sich übrigens um Figaro, da eine solche Gräfin spielte! Demoiselle Klincker war ganz weiche, leise gekränkte Unschuld. Ihr Elsässer Französisch erhöhte noch den Eindruck naiver Betrogenheit. Demoiselle Klincker war zartfärbig, wie eine Seele nach der Beichte; ihr kornblondes Haar leuchtete selbst unter dem [42] Puder der majestätischen Frisur durch und ihre süßen, blauen Augen öffneten und schlossen sich langfransig wie die Portieren eines Brautbettes. Der leise Zug von Lethargie, mit dem sie ihre resignierte Rolle sprach, versetzte alle Intimen des Parketts in die süßeste Schwermut, diesem armen Geschöpf nicht schon zwischen dem zweiten und dritten Akt mit etwas Liebe beispringen zu dürfen. Wenn nicht der kleine Teufel, die Suzanne, ein unglaublich leises Vibrieren behender Sinnlichkeit fortwährend in das Stück hineingesprüht hätte, so hätte sich der Erfolg des Herrn von Beaumarchais, ganz gegen dessen Willen, nach der sentimentalen Seite hin verschoben.
Herr von Vaudreuil war außer sich vor Wonne. Alle Freunde, die zur Generalprobe geladen waren, hatten sich in Demoiselle Klincker verliebt. Alle machten ihr den Hof, als das Stück zu Ende war, und wenn nicht der geistreiche Schloßkaplan, Abbé Lucien, der sich um die schöne Klincker wenig kümmerte, dem Dichter die schönsten Komplimente gemacht hätte, so hätte Beaumarchais eine Zeitlang so vergessen [43] im Winkel gestanden, wie ein Kamin im Sommer.
Die bildschöne Klincker nahm alle Komplimente und all die fiebernde Verliebtheit der glänzenden jungen Herren stangensteif entgegen, gleich einem präraffaelitischen Madonnenbilde. Sie, die mit Recht im Verdachte stand, um ein volles Jahrhundert zu religiös zu sein, dankte bloß ruhig dem Himmel für diesen neuen Sieg, und nur als ihr Gebieter, der Herr von Vaudreuil, ihre schönen Hände küßte, erinnerte sie sich: Ach ja, da muß ich einen Händedruck von mir geben.
Sie war von einer entzückenden Zurückhaltung. Sie war in ihrer Art so unerhört an Tugend, wie Herr Crambon, der jetzt wieder ganz Benjamin Franklin in rauherer Auflage war; alles staunte, woher dieser gesträubte Pinienzapfen seine Glätte auf der Bühne genommen hätte.
Demoiselle Klincker bekam mehrere liebenswürdige Einladungen für diese oder einer der nächsten Nächte, aber sie lehnte alle ab, und verwundert und neidisch beglückwünschten die [44] Herren den alternden Vaudreuil zu solcher Tugend seiner Geliebten.
Herrn von Vaudreuil tanzten alle Nerven vor innerlichem Jubel ob solchem Triumph.
Es stach ihn aber doch ein sehr feines Dörnlein, als Demoiselle Klincker sich für heute von ihm frei bat, weil sie von der Generalprobe sehr abgespannt sei und eine Nacht lang fest ausschlafen wollte.
Ach Gott, sie schlief ja auch bei ihm fest genug, dachte er seufzend, als die unerschütterliche Tugend fortwandelte.
Es ließ ihm, als er dann auf seinem Zimmer allein war, keine Ruhe und er rächte sich an ihr als echter, französischer Kavalier. Stundenlang spazierte er, schon im Schlafrock, aber noch in Seidenstrümpfen, in der einsamen Nacht des Schlafgemaches auf und ab, bis seine witzige Seele endlich, endlich Erlösung in folgendem Epigramm gefunden hatte:
[45] Vaudreuil war sehr glücklich über diese Alexandriner, die ihm gelungen schienen. Nach seiner Gewohnheit lief er sogleich zu einem seiner feinsten Ehrengäste, dem Dichter Lebrun, der Bosheiten am besten zu würdigen verstand, pochte an dessen Tür und weckte ihn. Lebrun, der wußte, daß jede also gestörte Nacht am nächsten Morgen mit der holden Sendung einiger Louisdors begütigt wurde, öffnete ihm in bester Laune und bezeigte sich entzückt von dem Witz und der hübschen Formgebung seines Schülers. Er sagte ihm, daß in zwei Tagen ganz Paris sich hinter dem oeil de boeuf, auf den Boulevards und in den Garküchen das reizende Bonmot in die Ohren flüstern würde und beging, da die Gelegenheit gut war, schnell eine kleine Gemeinheit:
„Wir müssen diese reizend frivolen Verse augenblicklich dem Abbé Lucien vorlesen. Der ist in solchen Dingen ein Feinschmecker, und wie ich weiß, schläft er durchaus noch nicht.“
Abbé Lucien hatte in seiner Sorglosigkeit vergessen, die Türe seines Zimmers zu verriegeln, und als der gute Vaudreuil hinter [46] dem eiligen Lebrun eintrat, indem er sein ungalantes Blättchen voll freudiger Lesebereitschaft in Händen hielt, da mußte er Demoiselle Klincker bei dem freisinnigen Abbé eingenistet entdecken.
Es war ein großer Schmerz; Vaudreuil ließ sein Stammbuchblatt fallen, Lucien schnellte trotz mangelhafter Bekleidung überrascht in die Höhe, Demoiselle Klincker zog in schweigsam-träger Scham die Decke so hoch über den Kopf, daß unten die hübschen Füßlein herausguckten — — und Lebrun lächelte.
Aber Vaudreuil blieb Edelmann.
„Bester Pater,“ begann er zum Räuber seiner Freuden, „ich bedauere Demoiselle Klincker und mich, daß sie sich keinen anderen Herrn für diese kleinen Vergnügungen zu wählen wußte. Ich bedauere Demoiselle Klincker, weil sie durch den Wechsel ihres Liebhabers Einkünfte verliert, die ihr der neue Besitzer ihrer Schönheit nicht so reichlich wird zuwenden können. — — (Demoiselle Klincker unter der Decke weinte.) — — Und mich bedauere ich, weil es mir nicht vergönnt ist, einen ritterlichen Gegner für die [47] mir zugefügte Beleidigung zur Rechenschaft ziehen zu können.
„Oh!“ rief Lucien mit Lebhaftigkeit: „Was den zweiten Punkt betrifft, so ist das leicht zu korrigieren. Sie werden die Güte haben, Herr Graf, mir eine hübsche, gepuderte Zopfperücke, einen Tressenrock und einen Degen zu leihen, an welchen Dingen ich Mangel leide. Was die übrigen Bestandteile zu einem ritterlichen Gegner betrifft, so habe ich sie zufällig bei mir.“
„Ah!“ rief Vaudreuil schon halb erheitert. „Auf Wiedersehen also morgen um sieben Uhr früh im Garten bei der Ariadne, mein Pater.“
„Auf Wiedersehen!“ Der Abbé verbeugte sich höflich, und Vaudreuil bemerkte noch: „Herr Lebrun wird die Güte haben, Ihnen die gewünschten Requisiten zu überbringen und uns als Zeuge zu dienen.“
Eine tiefe Verbeugung der drei Herren und die Türe schloß sich geräuschlos.
Abbé Lucien hob den Zettel des Grafen auf und las ihn der schluchzenden Demoiselle [48] Klincker lächelnd und mit anmutiger Betonung des alexandrinischen Metrums vor:
Das interessante Duell im Garten bei der Ariadne nahm einen reizenden Verlauf. Abbé Lucien focht wie eine Wespe und entwaffnete nach dem dritten Gange seinen gräflichen Gegner. Ehrerbietig nahm er selbst den davonklirrenden Degen vom Boden auf und überreichte ihn mit tiefer Verneigung der Exzellenz des Herrn Grafen von Vaudreuil, der ihm belustigt und versöhnt die Hand hinstreckte.
Chevalier de Coigny und Herr Lebrun, Herr von Beaumarchais und ein Marquis Grouchy, die Zeugen, und Maitre Braçon, der Arzt, applaudierten.
„Und nun gestatten Sie mir, teuerster Herr Graf,“ begann der Abbé, indem er einen Zettel aus der Tasche zog, „Ihnen das gestern bei mir verlorene Epigramm zu überreichen, im Verein mit meinen größten Komplimenten über den Charme, über die zarte Zweideutigkeit und die [49] glückliche Form, in welcher Herr Graf eine Beobachtung eingeschlossen haben, von der es Sie freuen wird zu hören, daß ich selbst sie ihrem vollen Inhalte nach bekräftigt gefunden habe.“
Die Herren lächelten alle wie eine Reihe von Sonnenaufgängen.
„Ah!“ rief Vaudreuil erfreut. „Da Sie sich nicht schmeicheln dürfen, Demoiselles Temperament in größere Schwingungen versetzt zu haben, als dies mir glückte, so würden Sie meiner Neugierde einen großen Gefallen tun, mir zu sagen, wie doch es gerade Ihnen gelingen konnte, die Gunst Demoiselles zu erobern, um die sich so viele glänzende Kavaliere vergebens bemühten?“
„Die Antwort steht schon,“ lächelte Abbé Lucien, „unter Ihren reizenden Versen.“
Herr von Vaudreuil entfaltete den Zettel und las seinen Freunden vor:
[50] Die Herren applaudierten abermals entzückt und Vaudreuil umarmte seinen geistvollen Gegner. Das war ein köstliches Erlebnis, an dem sich der ganze Hof amüsieren würde.
„Sie müssen Mitleid mit mir haben, meine Herren,“ fügte Abbé Lucien in betrübtem Tone hinzu, „wenn ich Ihnen verrate, daß Demoiselle Klincker mein einziges Beichtkind von zweihundertneunundzwanzig auf Schloß Vaudreuil und Dependancen anwesenden Personen ist. Sie ist sehr fromm. Eine große Merkwürdigkeit, das,“ schloß er seufzend.
Die Herren lächelten alle wie eine Reihe von Sonnenaufgängen.
Die Erstaufführung der „Hochzeit des Figaro“ hatte schon vor dem Aufziehen des Vorhanges ungeheuern Erfolg. Die Blüte des Adels von Frankreich füllte das Parterre des Schloßtheaters so reich, so bunt und erregt, wie ein riesiges Blumenbeet, in dem der Wind plaudert.
Die Logen leuchteten von den herrlichsten [51] Schultern und dem anderen lebenden Elfenbein, das die Damen jener Zeit in so liebenswürdiger Fülle ausstellten. Die hohen Frisuren nickten nervös und lebhaft, die roten Mäulchen plapperten alle durcheinander, übereinander, und ein erregtes Kichern rieselte durch das ganze Theater. Man freute sich der reizenden Geschichte des glänzenden Vaudreuil mit der Klincker und dem kleinen Abbé, der heute wie eine kostbare Berloque umhergereicht wurde — überall vorgestellt, überall angelächelt, überall eingeladen.
Beaumarchais hatte eine Stimmung für sein Werk, wie sie nicht glücklicher sein konnte.
Und wie gespielt wurde! Herr Crambon schien durch die festliche Lichterfreudigkeit des Abends wie verhext. Beaumarchais traute seinen Ohren nicht, seinen Augen nicht, seiner Menschenkenntnis nicht. Dieser Figaro war wie ein Federball: elastisch, luftig, graziös gab und nahm er Stich und Intrige. Er war der vollendete Kammerdiener in jeder Bewegung und hatte mehr Temperament und Beweglichkeit, als alle Wasserkünste von Versailles.
[52] Ach, und die zwei Frauenzimmer! Ach, die Gräfin und Suzanne!
Sie spielten um Herrschaft und Leben, die beiden kleinen Luder. Demoiselle Klincker wußte: heut errang sie sich die Liebe des Herrn von Vaudreuil und ihr hübsches Nadelgeld zurück, oder nie mehr wieder. Die tiefe Wehmut und die passive Rolle der betrogenen Frau lag ihrem trägen Temperamente, und sie war sentimental wie eine Herbstzeitlose im Abendtau.
Das kleine Zöfchen, die Lenore Oiseau aber, die wußte: Heidi, heut gibt's eine vakate Stelle zu erobern! Sie war schlank und graziös wie eine Menuettfigur; sie schlang und schmeichelte sich um ihre Gräfin wie ein Kätzlein. Sie sprühte vor entzückender Koketterie; sie duftete leise und bestrickend nach verhohlener Sinnlichkeit, und die galanten Herren nagten sich vor Appetit die Lippen wund, während sie spielte.
Über alles hin aber sprühte und flammte das Klingengezisch des witzigen Meisterfechters, des Herrn von Beaumarchais. Der gesamte Adel beglückwünschte mit hellrieselndem Gelächter [53] den eleganten Angreifer seiner eigenen Gesellschaft, und ein Applaus ohnegleichen wurde dem unglaublichen Sieger von denen zuteil, die er hier hageldicht prickelnd mit Witz und Hohn überraschte.
Jeder meinte, es gälte dem anderen und alle amüsierten sich köstlich.
Der Anstifter dieser Aufführung, welche ganz eigentlich der geistvolle Prolog zur größten aller Revolutionen war, der ausgezeichnete Graf von Vaudreuil, saß leuchtend vor Glück und blaß vor Wehmut in seiner Loge.
Er hatte dem Genie einen unerhörten Sieg erkämpft.
Er hatte eine schöne Geliebte verloren.
Er würde diese kleine, entzückend geschmeidige Katze, diese Lenore Oiseau zur Geliebten nehmen, würde von ihr geherzt, gebissen und verliebt umringelt werden, wie ihn das Glück und die Hofgunst herzte, verliebt umringelte — — und biß. Und dennoch würde sie ihn betrügen, wie die schöne, fromme, träge Klincker ihn betrogen hatte.
Die kleine Lenore hatte ihm für morgen im [54] Garten ein Rendezvous gegeben. Mit welcher Bedeutsamkeit füllte sich also für ihn ihre Rolle, in der sie ihrem Grafen, ihrem gehänselten Grafen auf der Bühne, das Billettchen annestelte, worin sie den Ort zu einem Stelldichein mit den Versen eines scheinbar harmlosen Gedichtleins verdeckte:
Die Verse gingen ihm im Kopfe umher, er wußte nicht warum. Er wurde alt. Sollte er dennoch nach der kleinen, heißen Lenore greifen? Sollte er ein neues, ernsteres Leben beginnen? Die geistvolle Komödie seines Protegés machte ihn sehr nachdenklich ....
Das Stück war zu Ende gespielt. Rollender Jubel, prasselnder Applaus, donnernder Zuruf stürmte auf Beaumarchais, auf die Schauspieler, auf den erlauchten Mäcen ein. Ja, Vaudreuil wurde aus seiner Loge geholt und mußte mit Caron de Beaumarchais auf die [55] Bühne treten. In seiner Rechten hielt er die kühle Linke des witzigen Dichters, in seiner Linken zuckte die kleine, heiße Hand Lenorens.
„Beaumarchais wurde gefeiert wie die Sonne, Vaudreuil wie Phöbus, der sie am Himmel emporführt,“ schrieb Lebrun einer Freundin.
Es war betäubend und sogar für den Weltmann Vaudreuil zuviel des Sieges. Der Jubelsturm solch erlauchter Gesellschaft, in der die meisten Mitglieder der königlichen Familie vertreten waren, mußte den Widerstand des Königs zerknicken, wie zügellose Rosse einen Hühnerzaun.
Jeder der Gäste fuhr mit dem stahlfesten Entschluß fort: das muß man in Paris hören! Beaumarchais hatte gewonnen Spiel.
In der Nacht aber ging der erlauchte Dilettant Vaudreuil abermals unruhig in seinem Schlafzimmer auf und ab. Er dachte an Crambon, der trotz seiner glänzenden Beweglichkeit vorzöge, ein harter, reiner Philosoph zu sein. Er dachte an Lenore, in die er sich verliebt hatte, und an ihre Verse:
Sonne, die im Westen steht!
Er betrachtete sein Antlitz im Spiegel. Noch blitzten die Augen, aber zahllose, feine Runzeln umspannen sie mit den Buchstaben des nahenden Alters. Der Puder deckte das Grau seiner Haare, graziöse Lebhaftigkeit deckte die leisen Seufzer seines Herzens. Bei Hofe, bei den Dichtern und Denkern Frankreichs galt er als einer der Besten ....
Bei den Frauen nicht mehr.
Und wieder summte er vor sich hin: „Sonne, die im Westen steht ....“
Auch der Dichtertriumph seines Freundes hatte ihn angesteckt. Gestern war ihm eine reizende Sache gelungen. Er mußte heute wieder dichten. Er war voll Gefühl; die beste Stunde war da.
Als einer von den richtigen Feinschmecker-Dilettanten, [57] die äußere Form und Technik am höchsten schätzen, weil sie solche am besten verstehen und nachahmen können, versuchte er sich mit einem Ziseleurstückchen. Einer Glosse. Er wollte ein Thema variieren; das Thema: „Sonne, die im Westen steht.“
Alle vier Zeilen, jede in einer Strophe.
Nach manchem Seufzer, nach manchem Strich und einigen Änderungen hatte er das kleine Kunststückchen zu seiner großen Genugtuung fertig:
Herr von Vaudreuil las sein wehmütiges Gedicht in tiefer Rührung. Er sagte es sich auswendig vor; er stand, seine Verse leise summend, am offenen Fenster. In der Tiefe rauschten die Wasserkünste des Schloßbrunnens und leise schmeichelte die Nachtluft um die Wangen des glänzenden Herrn, der zum ersten Male in seinem Leben tief und schwer nachdenklich war.
„Ei sieh,“ lächelte er wehmütig, „da habe ich nun nicht eine Seele im ganzen Schlosse, die [59] ich aufwecken könnte, um ihr dieses Gedicht vorzulesen. Herr Lebrun würde nur schadenfroh grinsen, Herr von Coigny mich verächtlich bedauern, Marquis Grouchy an ganz Paris berichten, ich würde alt, und Herr Caron de Beaumarchais würde mich in ein Moralstück bringen, so daß sich die Leute über den melancholischen Vikomte zu Tode lachen müßten.
Niemand — niemand!
Aber? Vielleicht! Dort, in der tugendreichen Dachstube des Crambon, da ist noch Licht. Ja! Der herbe Philosoph wird mich verstehen.“
Und er wanderte durch hallenden Flur und Treppenhaus zum Philosophen der Entsagung, der rauhen Tugend und der Weltabkehr.
Er hatte mit seinen Versen stets Unglück, denn bei Herrn Crambon fand er die reizende Lenore Oiseau.
Still wie ein Bild stand Herr von Vaudreuil, obwohl sich das Zöfchen ihm zu Füßen warf: „Ach, gnädigster Herr Graf, nehmen Sie mir die kleine Pirouette nicht übel! Crambon war meine Jugendliebe. Ich war ein armes, unbeachtetes [60] Küchenmädchen von vierzehn Jahren, als er der glänzende Kammerdiener des verstorbenen Herzogs Rohan war. Ich liebte ihn, ich traf ihn erst jetzt wieder als den Liebling Ihrer Bühne, und — ach: da haben wir kleine Rocheforter Jugenderinnerungen aufgefrischt.“
„Geh, mein Kind, du hast mir nicht wehe getan,“ sagte der Graf, und das Kätzlein huschte ängstlich fort, den Reifrock unterm Arm, die Pantöffelchen in der Hand.
„Sie aber, Mensch — — Sie haben mir alles genommen,“ sagte der Graf zu Crambon, der bei der Enthüllung seiner Vergangenheit alle Fassung völlig verloren hatte und ganz vergaß, daß er nicht mehr Kammerdiener war. Er stand und wagte mit keiner Muskel zu zucken.
„Sie haben mich glauben machen, es gäbe Tugend. Sie haben mich hoffen gemacht, es gäbe Mannesgröße. Sie haben mich eine Philosophie lieben gemacht, deren Leerheit Sie mir nun zeigen. Ich wäre gerne geworden, wie der, für den ich Sie hielt. Sie aber sind schlimmer [61] als der Charlatan Cagliostro, der den sehnsüchtigen Seelen nur einen Wundertrank für tausendjähriges Leben aufband. Sie verhießen die Ewigkeit; — — und lehren mich nun den Satz: Nur die Gemeinheit ist ewig. Verlassen Sie mein Schloß!“
Und der erlauchte Graf von Vaudreuil ging auf sein Zimmer zurück und weinte — — weinte so stillos, wie es im delikaten Rokoko nicht einmal den Kindern erlaubt war!
Crambon schied.
Vor dem Tore straffte sich seine Gestalt und mit rauhem Tugendgruß wies er einen kleinen Marquis von sich hinweg, der ihm höflich wie ein Schüler hatte nahen wollen. Es war ein schöner Morgen. Crambon war wieder ganz Bürger, Philosoph und Cato.
„Das hat ihm dieser Vaudreuil nun übel genommen, statt sich daran zu belustigen,“ rief Beaumarchais, der ihm nachsah, aus. „Dieser Vaudreuil! Dieser Typus eines regierenden Standes, der sich weder behaupten, noch entsagen kann. Dieses Paradestück des [62] Adels, der sich selber nicht mehr in der Höhe halten zu können glaubt, in die er emporgeklettert ist und der seine eigene Strickleiter abschneidet, indem er stolz tut auf solche Größe.
Was verdient diese Welt, die applaudiert, wenn sie gelästert wird, Besseres, als gelästert zu werden?
Da seht mir doch die Juden an: Niemandem wurden so viel üble Dinge vorgeworfen, als ihnen, aber sie behaupteten sich und behalten recht, weil sie niemals müde wurden, zu behaupten, sie hätten recht.
Ich, was mich betrifft, wenn meine Dichterkraft je erlöschen sollte, ich werde Werke über meine Werke schreiben, in denen ich der Welt meine eigene Größe beweisen werde.
Das Leben will, daß seine Geschöpfe seine Gaben achten, und was sich nicht selbst behaupten kann trägt den Tod in sich. Da hat dieser Vaudreuil eine Erscheinung voll Glanz, einen erlauchten Namen, Geld, Macht, Weiber — — und ist unglücklich, weil er kein hungriger Philosoph und Dichter werden kann. Er protegiert [63] mich, der seinen Stand verhöhnt, und wird zum Spielball eines davongelaufenen Kammerdieners und einer Gans.
Es ist frivol von diesem Vaudreuil; wirklich frivol!“
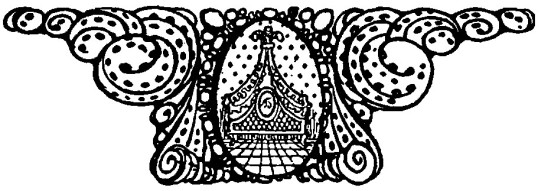

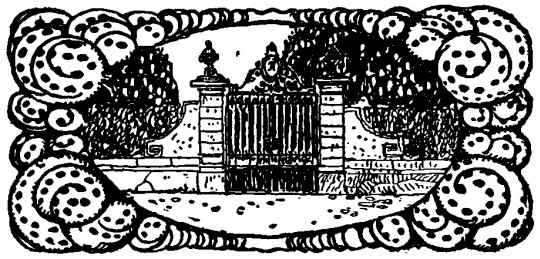
„Onkel Balsamo!“
„Fortunat, laß mich in Ruhe; wir sind schon an der Treppe. Hier bin ich der Graf Cagliostro.“
„Onkel Giuseppe! Ich weiß, Sie haben von den Geheimnissen der Natur nicht mehr erforscht, als die Geheimnisse menschlicher Schwäche. Gestehen Sie mir das eine, das ich nicht zu ergründen vermag: Welches ist das Geheimnis Ihres Liebestrankes?“
„Du sollst es gleich erfahren, mein Junge.“
„Wo?“
„Hier, jetzt in der Gesellschaft, beim Grafen Barrées. Ich weiß, daß sie mir heute eine Falle stellen wollen. Sei still und benimm dich unverschämt, aber vornehm. Wir sind am Ziel.“
[68] Der Saal ist weiß und gold, die Kerzen flammen, und die ganze Gesellschaft steht regungslos wie buntes Wachsgebilde in einem Krippenspiel. Denn der Graf von Cagliostro ist angekündigt und durch den Salon des Grafen Barrées wehen die Schauer heiliger Erstarrung; nur die ganz jungen Damen haben den Mut, sich auf die Zehenspitzen zu stellen und die Hälse zu recken.
Er tritt ein: groß, hager, ernst, von erhaben-kalter Liebenswürdigkeit. Alle sehen sie ihn schaudernd an: sie sehen ein von Leidenschaften zerfurchtes Gesicht? Nein. Es sind die Runen der zehn Jahrhunderte, die dieser Mann erlebte. Tausend Jahre alt .....
Die Herren lächeln, aber es graut ihnen. Den Damen graut, aber sie lächeln. Für tausend Jahre ist er interessant genug.
Man flüstert oder man denkt: „Diese Gelbheit des Gesichtes!“
„Aber doch, im Ganzen, diese gefaßte Zusammengenommenheit?“
„Er ist wie ein Gebäude von vier oder fünf Stilarten. Es scheint inkonsequent, [69] aber es ist nur alt. Es entstand, wie es mußte.“
„Aber warum kleidet er sich nicht mehr nach der Art der alten Magier? Er trägt gold-brokatne Weste, himmelblauen Frack und gleiche Kniehosen und Strümpfe.“
„Er leuchtet darum doch gleichsam von innen heraus durch diesen blauen Frack, wie eine Ampel aus Saphir. Wenn es dunkel wäre, er würde phosphoreszieren.“
So gehen die ängstlich-leisen Gespräche umher, indes sich die nahegedrängten, gepuderten, hohen Damenfrisuren verneigen, als ob der Wind hinter einem vollblühenden Perückenstrauch anflöge. Sämtliche linke Beine scharren nach rückwärts; leise klirren die Degen der Herren. Sie sind fast alle besiegt; die heißen Herzen von ihrer eigenen Glaubenskraft und ihrer Liebe zum Wunder, die kühlen Hohnköpfe vom Erfolg.
Nur der mächtige Barrées begrüßt seinen Gast zwar mit fast so tiefer Kopfneigung, als er sie den Größen Frankreichs erweist, aber doch leise lächelnd. Er empfängt zum Dank die nachlässigen [70] Worte: „Ja, lieber Barrées, ich bin recht gerne gekommen.“
Um die Lippen des Hausherrn zuckt heimlich eine feine Bosheit und er beginnt: „Ich werde Ihnen einige neue Verehrer Ihres Genies vorzustellen die Ehre haben. Nur sagen Sie mir: Wann befreien Sie mich von meiner verdammten Gicht?“
„Bei der nächsten Mondesfinsternis.“
Bis Barrées zu den nächsten Gästen und zurück gehumpelt war, flüsterte ihm sein Neffe zu: Du wirst dir mit solch nachlässiger Behandlung den Ärger und sehr bald den Haß des großen Herrn verdienen.“
„Geachtet wird, wer nicht achtet,“ sagte Cagliostro regungslos, mit geradeblickenden Augen und geschlossenen Zähnen. Kaum, daß sich seine Lippen bewegten. Er erwartete neue Tröpfe, da hieß es aufpassen und beobachten.
Barrées stellte sie lächelnd vor. Sie und ihre Krankheiten. Es war eine große, ärztliche Visite: „Gräfin des Fouches. Noch ziemlich jung, aber immer noch verliebt. Demoiselle Chanzy d'Armagnac de Bracy. Zu jung, kann [71] aber schon nicht mehr lieben. Madame Sinisterre de Solerol. Haßt die Kirche und sehnt sich nach wahrer Religion. Fürst Ehrenbreitenstein-Metsch, hat eine Flintenkugel ins Schultergelenk eingewachsen, Marquis Caval leidet an einem Nebenbuhler und einer Schauspielerin, und endlich“ — der Graf nahm all seine feine Bosheit zusammen — „Ehrendoktor Jakob Mignard, Mitglied und Abgesandter der Akademie: Wissensdurst und Zweifel an Ihrer Kunst.“
Bisher hatte der Graf von Cagliostro ruhig gelächelt und mit diesem Lächeln gesagt: „Wir werden helfen.“ Bei der Vorstellung des berüchtigten, neidischen Gelehrten Mignard zuckte er in leiser Nervosität auf, sammelte sich ungemein leicht und schnell und sagte: „Ah! Doktor Mignard? Das ist ein interessanter Fall. Beginnen wir also mit Ihnen? Nun: Sie begehren natürlich meine Kunst zu prüfen. Wählen Sie, verehrter Doktor, nur kühnlich jenes Gebiet, das Ihnen am zweifelwürdigsten erscheint.“
Die ganze Gesellschaft drängte sich um den [72] Akademiker und den göttlichen Schwindler. Mignard, der überraschen hatte wollen und dem es nun viel zu geschwind hergegangen war, wurde rot, und Cagliostro wurde noch verbindlicher. Er fuhr fort: „Es ist mir lieb, daß die Akademie den exaktesten ihrer Köpfe zu mir gesandt hat. Es ist mir lieb, Herr Professor, daß Sie mich prüfen, so strenge Sie es vermögen. Stellen Sie mir jede Frage, jede Aufgabe. Was, zum Beispiel, bezweifeln Sie an mir?“
Der leidenschaftliche Lehrling der Hochstapelei, Cagliostros Neffe Fortunat, hatte sich hinter den Professor gedrängt und flüsterte ihm mit dem ganzen Ausdruck seiner eigenen Ungeduld zu: „Den Liebestrank!“
Ach, der Professor hatte zwanzig Jahre lang Schule gesessen! Er war fast ein Musterschüler gewesen, aber dennoch: Wo ihm etwas fehlte, das hatte er sich von den Mitschülern zuflüsternd einblasen lassen. Nun saß es im Blute, nun wirkte es, im Bunde mit der unwiderstehlichen Gewohnheit des Gelehrten, der seiner ganzen Weisheit Beweiskraft nicht in sich, [73] sondern in enggeschlossenem Harst hinter seinem Rücken weiß.
Und er sagte aufatmend: „Der Liebestrank.“
„Ah,“ freute sich das ganze Menschenblumenbeet und vibrierte vor lauter Ereignisschauern.
„Wünschen Sie ein Experiment?“ gab ihm Cagliostro freundlich vor.
„Ja, ja!“ rief die entfachte Begeisterung der jungen Damen. Denn die standen schon alle auf den Sesseln.
Welcher französische Akademiker widerstände dem hüpfenden Zurufe junger Mädchen? „Ja,“ sagte also Herr Mignard. Und als die ganze Gesellschaft Beifall klatschte, lächelte sogar Mignards Sohn, Olivier, ein junger Marineoffizier, und kam freundlich näher heran.
„Recht streng, nicht wahr,“ fragte Cagliostro weiter.
Professor Mignard aber blieb Akademiker. Er sagte: „Streng wollen Sie? Da bitte ich doch diese erlauchte Versammlung, zwei Objekte für das Experiment des Liebestrankes zu wählen. Das wird Ihnen Ihre Aufgabe [74] sauer genug machen. Nebstbei frage ich, ob Sie der Akademie Kaution erlegen wollen für den Fall, daß einer der sich zum Experiment bereit erklärenden Teile an seiner Gesundheit Schaden litte?“
„Aber ja,“ lächelte Cagliostro, überlegte einen Augenblick, griff dann in die Tasche und zog eine dicke Handvoll blendend schöner Brillanten hervor, bei deren Anblick alles ergriffen stilleschwieg. Es mochte eine kleine Million sein, die der rätselhafte Graf da nur so aus der Tasche zog.
„Bitte, prüfen Sie, ob sie echt sind,“ sagte Cagliostro gleichgültig und legte die Steine vor Mignard hin. Der Gelehrte hatte einen Rubin am Finger, und an dem führte er mißtrauisch einen der Steine Cagliostros ritzend entlang.
„O weh,“ rief er. Der Rubin hatte einen tüchtigen Riß weg, und Cagliostro sah ihn strafend an. „Graf Barrées,“ bat er dann ruhig: „Nähmen Sie diese Diamanten für die Akademie der Wissenschaften in Verwahrung, bis ich rehabilitiert bin?“
[75] Barrées kam langsam herbei. Es waren Steine von solcher Schönheit, daß sogar er sie mit Ehrfurcht in Empfang nahm.
Das Parterre, das Cagliostro sich damit gebildet hatte, war präpariert. Alle Haare sträubten sich vor Erregung.
Cagliostro war zufrieden. Kardinal Rohan hatte einem wucherischen Juwelier die Diamanten zu einem verliebten Geschenk für die Königin abgepumpt. Dem Kardinal wieder hatte eine Schwindlerin das herrliche Halsband herausgelockt; ihr aber hatte es der Meister allen Betruges, Cagliostro, abgegaukelt. Nun begann aber die Geschichte zum Himmel zu stinken und Cagliostro war sehr froh, die aus ihren Fassungen gelösten Steine beim Grafen Barrées hinterlegen zu dürfen. Hier suchte und forderte sie niemand.
„Ich bitte Sie, Mesdames und Messieurs, Ihre Opfer zu wählen,“ sagte Cagliostro so kalt, daß den galanten Gesellschaften ein Grausen über den Rücken lief, denn Liebe als chemisches Experiment behandeln, hieß sogar mit der Frivolität frivol umgehen. Das war [76] stark; wirklich. Aber es war eine aufregende Neuigkeit. Man war zum erstenmal seit seiner Jugend in bänglichster Spannung.
Nun erstiegen auch die ersten Herren in den hintersten Reihen die Stühle.
„Wie wär's mit dir, Clarisse?“ fragte der verwitwete Barrées seine Tochter, und begeisterter Applaus lohnte dem kühnen Hausherrn.
„Oho; nein, ich danke!“ rief das Mädchen und hob abwehrend die Hand.
„Meine Tochter ist nämlich Künstlerin und will nichts anderes bleiben, als Künstlerin. Sie singt eine prächtige Koloratur und glaubt durch eine Heirat daran Schaden zu leiden. Sie kann nicht lieben. Bester Herr Graf, wenn Sie sie etwa in irgendeinen jungen Adeligen von guter Familie verliebt machen könnten, — ich wäre Ihnen höchlich verpflichtet.“
All das wurde gesprochen in jenem Tone, der aus Spaß und Ernst gemischt war und aus dem nur ein Weltmann die Ingredienzien zu scheiden vermochte.
[77] „Ist solch ein junger Edelmann hier?“ fragte Cagliostro ruhig dagegen; und wirklich verhinderte er damit den angeerbt taktvollen Barrées, einen Mann seiner Wünsche zu nennen.
„Aber Herr Graf und Sie, Komtesse! Glauben Sie denn, er brächte es fertig, mit sehenden Augen anzustiften, was sogar der Gott der klugen Griechen nur mit verbundenen Augen vermochte?“ flüsterte der gereizte Akademiker Mignard dem Gastgeber und seiner Tochter zu. „Herr Graf, sind Sie noch der alte Freigeist? Und Sie, Komtesse, fürchten sich vor einem Glase Kognak und etwas Hokuspokus? Habe ich Ihnen umsonst die chemische Analyse seines Liebestrankes mitgeteilt?“
„Gut,“ sagte das mutige Mädchen beruhigt, „ich gebe mich zu dem Experiment her.“
Es trat ein Augenblick der Ruhe ein. Alles hatte vernommen, um welchen Preis der Kampf gehen sollte; es war wirklich viel. Sehr viel: für Cagliostro, für Mignard, für Barrées und die Komtesse.
[78] „Sie gäben sich her, mit wem immer die Gesellschaft Sie zusammenbestimmte?“ fragte Cagliostro noch einmal in mitleidvoller Warnung.
Dem Mädchen kam ein wenig die Angst. Aber lieben ist immer schön. „Mit wem immer,“ lächelte sie großartig.
„Aber das ist ja frivol,“ rief halblaut der erzürnte Schiffsleutnant Olivier.
„Wer ist der junge Offizier,“ fragte Cagliostro leise seinen Gastherrn.
„Der Sohn Mignards,“ lächelte dieser.
„Der junge Mignard: ah, das ist gut!“ rief Cagliostro, als sagte er dies zu sich selbst.
Und wirklich; die ganze Gesellschaft wiederholte begeistert sein hypnotisches Wort wie ein Orakel: „Der junge Mignard! Der junge Mignard!“
Vater Mignard erbleichte, Barrées lachte laut auf, die Prinzessin warf in trotzigem Übermut den Kopf zurück und Olivier schrie: „Das verbiete ich mir!“
Aber die Gäste waren berauscht, als hätten sie Blut getrunken und jubelten immerzu: [79] „Der junge Mignard und Clarisse! Wir wollen keine andern!“
Es war unwiderstehlich.
„Ja aber,“ sagte Clarisse ängstlich, „ich habe mir Herrn Olivier noch gar nicht so genau angesehen.“
„Um so besser,“ lachten die Damen und klatschten in die Hände.
„Sie werden den Liebestrank vor unseren Augen bereiten?“ fragte der starke Herr von Ehrenbreitenstein mit der gelähmten Schulter.
„Ja,“ erwiderte Cagliostro gleichgültig. Er hatte schon aus seinen Taschen einige kleine Phiolen gezogen und damit zu arbeiten begonnen. „Ein Glas Madeira,“ winkte er einem Bedienten.
Es wurde sehr still. Die Scherze zweier Gamins kitzelten niemand; da wurde selbst jenen bang, die sonst die Fahnenschwinger des Gelächters waren.
Cagliostro war rasch fertig. Er hatte eine grüne, eine rote, eine braune Mixtur in je ein Gläschen getan, dann goß er alle drei [80] mit dem Madeirawein zusammen und wartete einige Sekunden, indem er kühl und hart vor sich hinblickte. Dann teilte er den Trank, scheinbar zerstreut, ungenau und gleichgültig in zwei andere Gläschen.
„Ich bitte rasch zu trinken; wo sind meine jungen Herrschaften?“
Clarisse kam zuerst heran. Sie war hübsch, nur etwas mager, und ihre Nase war lang, die Figur beweglich, das Gesichtlein hatte traurige Augen, die jetzt sehr ängstlich aussahen. Sie kostete und hustete. „Hinunter!“ rief Cagliostro grob. Da erbleichte sie und wollte nicht mehr.
„Trinken Sie,“ grollte er sie an. „Mignard bewies Ihnen ja die Ungefährlichkeit in der chemischen Analyse.“
Da trank sie das Ganze gehorsam und erschrocken hinunter.
„Woher wissen Sie das von der chemischen Analyse,“ fragte das arme Mädchen dann nach einer ganzen Schreckenspause, während derer ihm das starke Getränk wie Feuer im Magen wühlte.
[81] „Aus meinem Brennspiegel. Wo ist Herr Leutnant zur See, Olivier Mignard?“
Mignard trat in prachtvoller Haltung vor und erhielt Applaus. Er schlug den Zopf nach der Schulter wie eine Peitsche, als er rechts zur Gesellschaft hinüber sah und warf sich dann ganz wie ein Soldat ins Feuer: nach außen Entschlossenheit, Kraft und Halbgötterei, und innen windet sich angstvoll das Würmlein Menschenschwäche zurück. Für seinen Vater tat er alles. Messieurs und Mesdames waren aber auch hingerissen und entzückt über das hübsche Opfertier und sehr neugierig.
Als er jedoch Clarisse ansah, die ihm etwas verlegen, etwas kläglich und etwas empört entgegenblickte, da ward der Franzose in ihm stärker als der Sohn, oder vielmehr schwächer.
Sie war so rührend, so adelig, der Kopf saß so hingegeben unter der großen Last der Haartracht auf dem schlanken Halse; und er, er war gekommen, um öffentlich darzutun, daß er dieses entzückende Geschöpf nie und nimmermehr lieben wolle. Taktlos und vermessen!
[82] „Madame,“ sagte er und stolperte mit seiner Rede sehr: „Nicht, weil es Ihrem Reiz nicht gelingen könnte, mein Herz nicht klein und schwach zu machen“ —
Clarisse lächelte ein wenig, wandte sich aber in kokettem Trotze von ihm fort und wandte sich zum Gehen.
„— oh Madame,“ vollendete der geängstigte Schiffsleutnant seine Rede, indem er ihr nachsah; „das ist außer allem Zweifel, daß ich nicht Ihnen widerstehen möchte; nur diesem Herrn hier —“
„Also trinken Sie,“ sagte Cagliostro mit kühlem Lächeln.
Da hob Olivier das Glas und rettete das Gehaben eines Seemanns, der sich Trost gegen einen scharfen Nordnordwest zuführt, in diese bange Stunde. Cagliostro hatte ihm viermal soviel zugedacht, als dem Mädchen. Er aber setzte an: ein Schluck, ein Druck und ihm war wohl und warm im Leibe.
„Ausgezeichnet,“ sagte er unwillkürlich.
Die Herren riefen dieser natürlichen Trinkermanier Beifall zu, die Damen aber waren [83] etwas gereizt; — wie stets, wenn einer nicht recht lieben will. Ja, eine alte, sonst heitere Stiftsdame nahm das Wort und wandte sich ungeduldig an Herrn von Cagliostro: „Wie lange, mein Graf, wird es nun wohl dauern, bis dieser junge Atheist seine Strafe für die Vermessenheit, ein so entzückendes Geschöpf verschmähen zu wollen, in seinem Herzen aufsteigen fühlen wird!?“
Mignard erschrak über den Unwillen der alten Dame, Cagliostro aber räumte die Phiolen zusammen und übergab sie seinem Neffen. „Das ist,“ sagte er, „je nach der Anlage eines Menschen. Ich bedaure, daß Herr Mignard Offizier zur See ist. Man ist als solcher schon gegen ein bloßes Frauenlächeln schwach und hat in den Häfen einen Heidenrespekt gegen die dort gänzlich fehlende Frauenreinheit und Feinheit erworben. Ich hoffe übrigens, daß Herr Leutnant nicht kürzlich von einer langen Seereise zurückgekehrt sind.“ Er schmunzelte diabolisch. „Sechs oder sieben Monate ungebrochener Einatmung von Salzwasserluft, sowie die lange Gewöhnung des Auges an [84] nichts als Himmel und Meer ergeben eine ungemein starke chemische Affinität zu meiner Mixtur. — Ja. — Aber Herr Mignard, als Sohn, wird sich heldenmütig wehren.“
„Ach, und die Komtesse ist schon geflüchtet?“ rief ein junger Herr.
„O nein,“ erklang Clarisses Stimme aus einem Winkel. Sie hatte sich von dort, sehr gereizt, den jungen, trotzig-schönen Soldaten angesehen, der sie durchaus nicht lieben wollte. Sie hoffte, Olivier würde sich wenigstens zu ihr begeben und ihr den ganzen Abend Gesellschaft leisten, um den andern zu beweisen, daß er das Fluidum Cagliostros verachte. Dann würde sie ihn zu strafen wissen.
Aber, ach nein, Herr Mignard vermied sie und sah nur sehr selten mit schnellen, verbotenen Blicken nach ihr, als ob er stehlen wollte.
„Na wart',“ dachte sie. Sie war schwer gekränkt.
Kein Mensch hatte eine Ahnung, wie wunderbar singen sie gelernt hatte. Trotz aller Eitelkeit hatte sie es verborgen, daß sie bei [85] dem ausgezeichneten Maestro Primavesi Singstunden nahm. Sie gedachte am Hofe des Königs zum ersten Male hervorzutreten, als die vom Himmel gefallene Meisterin. Aber nun hielt sie es nicht mehr aus. Man verachtete sie, man beleidigte sie, man vermaß sich, sie samt einem Zaubertrank im Leibe nicht reizend zu finden. Weil sie noch schlank war? Weil ihre Nase nicht stumpf und rund war? Oh!
Bei Tische krampfte sie Tränen hinunter. Der junge Mignard saß neben einer Frau, deren Kehle, Schultern und Brust sich herrlich ausbreiteten, wie blühender Speck. Diese schöne, umfangreiche Dame war eine Freundin von Oliviers Mutter, und Clarisse ahnte, daß sie mit den Herren der Academie française verschworen sein könnte, und von ihrem ironischen Papa nur eingeladen war, um diesen ahnungslosen Leutnant zur See gegen den Liebestrank zu immunisieren, ja wohl gar, ihn zu verführen. Sie sah gar nicht hinüber, aber sie verachtete die ganze Akademie in dieser Frau.
[86] Ein Glück, daß Meister Primavesi neben ihr saß, der ihr seit einem halben Jahr an jedem großen Gesellschaftsabend zuraunte: „Ach, nur eine Generalprobe, Contessa; nur ein Pröbchen Ihrer liebenswürdigen Kunst und meiner Schule. Ich hätte einige hoffnungsvolle Damen hier, die unfehlbar meine Elevinnen würden, wenn sie Sie hörten.“
Heute entschloß sich Clarisse. „Gut,“ sagte sie. „Wenn Sie es geschickt machen, daß man mich bittet, liebster Meister, so gebe ich Ihnen nach.“
Der Maestro wäre kein Italiener gewesen, wenn er nicht Komödie zu spielen verstanden hätte. Als er nach aufgehobener Tafel ans Klavier gebeten ward, schlug er vor, daß Signorina Ravolini singen dürfe.
„Die Ravolini,“ riefen alle Herrschaften begeistert, denn das war eine beliebte junge Sängerin der heurigen Stagione. Aber die Ravolini war gar nicht da und Barrées gestand bedauernd, daß er sich nicht erinnere, sie eingeladen zu haben.
„Ach, wenn doch endlich Ihre Tochter, als [87] meine beste Schülerin, die Güte haben wollte, zu beweisen, daß ich Lehrer zu sein vermag,“ flehte der Maestro den Gastherrn an.
Da stand, von der Begeisterung der gesamten Gesellschaft geschoben, gezerrt, gehoben und von den Damen förmlich Schritt für Schritt nach vorne geküßt, sehr bald Clarisse auf der Estrade.
Und sie sang. Sie sang die kleinen, altmodischen Hirtenlieder der trefflichen italienischen Singspielkomponisten, die alle gleich liebenswürdig, gleich talentvoll und gleich leuchtend waren und das liebe achtzehnte Jahrhundert mit den entzückendsten musikalischen Schelmereien versorgten. Sie sang eine Arie, dann eine Arietta, dann einen Chanson, dann ein Madrigal und dann wieder eine Arietta. Sie sang, und atemlos verliebt starrte alles sie an.
Ihre Stimme war mühelos, leicht und elastisch, wie ein Federball von den Notenlinien wegprallend und wiederkehrend. Die Atemtechnik merkte man gar nicht; es schien, als ob dieses Vöglein kaum der Luft bedürfe. [88] So stand sie und neigte sich nach der ersten Arie tief und wurde vor Freude rot, denn ihre Gesellschaft raste vor Überraschung.
Die Arietta dann bäumte sich auf wie ein Wellchen im Bach, lockte, floh, entfernte sich, neckte und träumte durch eine Stimme hindurch, die zum Verzaubertsein leicht und zart, nein, zärtlich war.
Da begann der junge Mignard leise und glücklich in seinem Herzen zu leiden.
Aber weiter und weiter lachte das heitere Rokoko aus kapriziösen Liedchen ihn aus, und die fröhlich gewordene Clarisse wählte jenen Chanson, der soeben den Siegeszug über ein ganzes Geselligkeitsjahr anzutreten im Begriffe stand: das entzückende Grillenlied der kleinen Schäferin aus den „Sentiments du pauvre Robin“. Dieses Lied hatte einen Refrain, der mit dem französischen Wortstamm „ris“, der Wurzel des Wortes Lachen, auf reizende Weise Fangball spielte, indem er, zuerst als Grillengesang, dann als ernsthaft scheinendes Studienmonstrum einer Übenden, und zuletzt in ein stockend anfangendes, aber [89] bis ins Unaufhaltsame weiterrollendes leises Gelächter ging, das immer leichter, zarter und höher anstieg. Dieses Liedchen, das die junge Schäferin unbekümmert, wie auf und ab gehend, zu singen anfing, hatte als erste Strophe diese:
Und dieses ris, ris i i i i, zuerst schüchtern, dann schnell und zuletzt ein einziges, leises Forttrillern, war ein hinreißendes zitterndes Grillengezirpe, welches, von dem heitern, leichten, koketten Stimmchen nachgeahmt, jedes Zwerchfell vor Lust vibrieren machte, vor Lust nach der Wiese. Dann aber ging es weiter:
[90] Fast ernsthaft mühte sie sich, den Ton dieser Heupferdchen abzufangen. Sie begann in do, stieg über mi und sol immer höher und höher und lächelte dabei ihren tapferen Gegner Olivier ein Momentlein ganz versteckt an. Jedoch kümmerte sie sich während der letzten Strophe gar nicht mehr um ihn, denn diese Strophe ging:
Und dieses Lachen, dieses leise anzitternde Lachen, das wie eine Lerche in immer größere Heiterkeiten hinaufstieg, dieses ansteckende Kichern bezwang in seiner unendlichen Liebenswürdigkeit eine Gesellschaft, die so gerne, so gerne lachte dermaßen, daß es in sämtlichen Hälsen, musikalischen und dürren, innerlich mitzuperlen begann, als stiegen tausend entzückende Leichtigkeitsbläschen eilig aus den Schaumweinkelchen der französischen Seelen [91] empor; und als Clarisse in der feinsten, lustigsten Höhe ihr Lachen ausgetrillert hatte, da brach dieses selbe zitternde Rollen aus allen Kehlen mit Kinderfröhlichkeit los, und alle, alle lachten sie, als ginge es über den geprellten Schiffsleutnant her, der es unternommen hatte, dieses Geschöpf nicht zu lieben.
Der arme Junge kam sehr schwierig durch die Gratulanten hindurch, welche die junge Sängerin umringten, und rief ihr in der Schwäche der ersten Hingerissenheit zu: „Komtesse, ich hielt große Stücke auf Ihre Gaben, aber daß Sie solch ein kleiner Goldvogel seien, das, das — — —“
„Das ist ein um so schätzbareres Kompliment,“ sagte die schlanke Clarisse strahlend vor Übermut, „als es aus einer seltenen Herbheit und Unbestochenheit der Gesinnung erfließt.“ Und sie wandte sich neuen Beglückwünschen zu und hatte ihn sogleich vergessen. Also war nun Olivier der Gekränkte. — — —
Die darauffolgende erste Hälfte der Nacht verbrachte er mit Versuchen, jenes Grillenlied [92] in Diskant, und als das mißlang, in Baß zu singen, wobei er das Ris—ris—ris wunderbar gröhlte; die andere Hälfte der Nacht verschwendete er auf Bemühungen, es nicht zu singen.
Am nächsten Tage haßte er es. Es sah aus, als ob man dieses Lied auf ihn gedichtet hätte, und man begann es schon da und dort auf der Gasse zu trällern.
Clarisses Vater hatte sich am vorigen Abend, nach einer energischen Reklamation jener alten Stiftsdame, entschlossen, Mignard, Cagliostro, und all die übrigen Gäste dieses Abends zu bitten, in vierzehn Tagen wiederzukommen, um zu erfahren, ob der Liebestrank des Meisters der Geheimnisse inzwischen gewirkt haben könnte. Vierzehn Tage, bis er sie wiedersähe!
„Es ist ein hartes Ding,“ sagte er sich, „aber mein Vater darf nicht der Besiegte dieses Charlatans werden. Bin ich denn so schwach?“
Und er war stark, wehrte sich und dachte infolge dieses Kampfes in einemfort an die niedliche Clarisse.
[93] Sie aber war empört, daß die Akademie solch einen ahnungslosen, rein törichten jungen Menschen als Werkzeug ihres Hasses gegen Cagliostro mißbrauchte. Ihr Vater war mit im Spiele. Sie hatte Angst vor seiner Ironie, aber sie sagte sich, daß es ein Meisterstreich des kleinen Gottes wäre, wenn eben diese kalte Ironie ein wenig bestraft würde. Einem Edelmanne wollte er sie vermählen, einem Edelmanne! Nachdem Herr Rousseau und Herr Voltaire längst so niedliche Dinge über die Vorzüglichkeit und den Rang des Herzens und des Geistes geschrieben hatten, welche die einzige Ungleichheit auf Erden ausmachten? O!
Ihr ganzes kleines Wesen hatte sich von jeher nur im Widerspruch erfreut, denn sie war stets unmäßig verzogen worden. Übrigens aber meinte sie, Olivier müsse gedemütigt werden. Sie glaubte zwar noch, daß sie ihn nicht liebe, aber eine bedenkliche Angst vor der kalten Tücke des Cagliostro saß in ihr. Der war so rätselhaft. Und die Akademie hatte so viele Regeln, das Leben aber war so regellos. [94] Wenn nun der grauenhafte Mensch mit seinem Trank Recht behielte? Sie prüfte sich und erschrak, wie viel sie sich schon an jenem ersten Abend in Gedanken mit Mignard beschäftigt hatte, und wie viel nachsinnende Stunden inzwischen dazugewachsen waren, — alle voll von Olivier Mignard.
Es war schauderhaft; schauderhaft, aber süß. Denn wenn es bei ihr wirkte, dann saß es wohl auch bei dem jungen Marineleutnant fest. Wo der nur blieb?
Der? Der wehrte sich zehn Tage. Am Vorabend jenes Tages, der Cagliostros Gewalt oder Beschämung offenkundig machen sollte, lief er ihr in einem Gäßchen in den Weg.
„Komtesse, seit vier Tagen warte ich hier, wo Sie sonst täglich durchkommen, auf Sie ....“
Sie erkannte den ehedem tiefbraunen Jungen gar nicht gleich. Er war wirklich blaß.
„Was wollen Sie?“
„Komtesse, wir werden uns morgen sehen. [95] Ich habe Angst, Sie zu beleidigen, wenn ich abermals meinem Vater zuliebe als Verächter Ihrer Holdseligkeit dort stünde.“
„Schweigen Sie, und lassen Sie mich, ich muß zu Primavesi,“ sagte sie beleidigt.
„Aber haben Sie doch Erbarmen, Madame,“ rief er und hielt sie angstvoll zurück. „Ich kam, Sie zu bitten, dieser Komödie ein Ende zu machen und den Abend absagen zu lassen.“
„Wozu?“ lächelte sie frostig. „Ihr Herr Vater soll seinen Triumph genießen; denn auch ich fühle keine Wirkungen von dem Tranke des Grafen Cagliostro.“
„Ach, Komtesse,“ sagte der arme Junge traurig, „dann wäre ja alles gut. Ich werde das meinem Vater berichten, er wird mit Ihrer gütigen Zustimmung die Akademie von dem lächerlichen Schwindelversuch benachrichtigen, dessen Mißlingen dem Ansehen des wunderlichen Grafen übrigens kaum schaden kann, und ich, — ich werde morgen nicht zu erscheinen brauchen, um meinen guten Vater und mich keiner Demütigung auszusetzen.“
[96] „Ah, wie das?“
„Es ist nur, weil ich fürchte, Komtesse, daß nicht Graf Cagliostro, wohl aber Ihr Reiz mich verzaubert hat.“
Clarisse stand über seine unerwartete Botschaft sehr erschrocken und vermochte gar nichts zu sagen.
„Es ist so,“ bestätigte er betrübt: „Ich liebe Sie; aber,“ fügte er verzweifelt hinzu, „wenn Sie morgen diesen abscheulichen Schlächterabend eines Herzens zustande kommen lassen, so leugne ich alles!“
Da lief sie ihm davon.
„Clarisse,“ rief er, „Clarisse!“
In den leeren Gassen klang der Ruf nach, aber auch in ihrem Herzen vibrierte er weiter. Sie war fassungslos und kam sich ebenfalls wie verzaubert vor; in ihr wühlten Seufzer, Mitleid, Neugierde nach dem jungen Manne und stürmische Wünsche sehr; sie wehrte sich in Heidenangst vor der Macht Cagliostros, fand es aber dennoch schmerzvoll-schön, so sehr zu leiden.
[97] Der Abend, auf den die fröhlichen Zuhörer des Grillenliedes mit der heitersten Spannung gewartet hatten, wurde für diesmal abgesagt und abermals auf vierzehn Tage verschoben, denn Clarisse hatte sich krank erklärt. Da lief denn durch die Gesellschaft von Paris der leise, lustige Verdacht von einer Schlappe, die der ungläubige Graf Barrées und die Akademie erlitten haben könnten, und Herr Cagliostro vergabte in diesen Tagen dreiundeinhalb Maß Liebestrank an Bedürftige.
„Da habe ich sie mir,“ sagte er zu Fortunato. „Der alte spöttische Kavalier zittert schon heute vor mir. Und siehst du: nicht die gescheite, kleine Clarisse hat mein Trank bezwungen. Nein; all ihre Vorfahren, deren Geschäft es seit tausend Jahren war, gläubig zu sein, die haben in ihr vor dem Liebestrank jene Angst, der ihn so wirksam macht. Tausend Jahre glaubten diese Barrées blindlings an alles, was der Pfaff ihnen aufband. Der letzte Barrées und sein Töchterlein leugnen. Aber in ihnen sitzt bauernfest die Glaubsucht. Und es zuckt immer noch demütig in ihren Knien, [98] so oft sie an einem geweihten Öllämpchen vorübergehen, so wie es in dem Akademiker Mignard zuckt, sich vor den Barrées tief zu verbeugen. Denn all seine Vorväter waren katzbuckelnde Erwerbsleute. Der Glaube ist da, die Religion ist fort, nun müssen sie an alles glauben, was ihnen in den Weg gerät.“
„Ich wollte lieber, Onkel Giuseppe, du hättest Unrecht,“ sagte Fortunat bedrückt.
„Warum?“
„Ich fürchte, daß mir Clarisse selber gefiele.“
„Würdest du sie heiraten wollen?“
„Warum nicht?“
„Unmöglich,“ sagte Cagliostro kalt. „Eine Barrées. Es ist zwar alter reicher Adel und bei Hofe von höchster Geltung, aber wie wir heute dastehen, kann sich doch der Name Cagliostro nicht an eine Barrées ketten. Ja, wenn es eine Rohan, eine Condé, oder eine Savoyen-Carignan wäre! Laß sehen, es klopft.“
Cagliostro erhielt recht unerwarteten Besuch. [99] Es war die Wache, die ihn in die Bastille führen sollte. Der Offizier zeigte ihm achselzuckend den lettre de cachet. Nun wäre es ihm sehr erwünscht gewesen, wenn sein Neffe die Barrées mit ihrem Einfluß bekommen hätte können. Denn sein Weg ging jählings bergab. Die Halsbandgeschichte war ruchbar geworden, und man suchte die Diamanten. Freilich, Cagliostro hatte dafür gesorgt, daß mehrere seiner Adepten Eide schworen, sie seien in einer Säurelösung verdorben, und Fortunat, der frei geblieben war und die Gerichtsbeamten beim Versiegeln der Gemächer seines Oheims führen mußte, brach im Laboratorium des Schwindlers beim Anblick einer fluoreszierenden Essenz in ein krokodilfalsches Gewimmer aus. „O, meine Herren,“ schrie er, „welche Werte zerstören Sie hier! Diese Essenz ist Diamantlösung und soll kristallisieren; mein Oheim verbrachte sieben Stunden in jeder Nacht damit, um sie magnetisch zu beeinflussen, und nun kommen Sie, verhindern sein Werk und stören den Kristallisationsakt! Die Tinktur wird in zwei Tagen wertlos sein und die darin [100] gelösten Brillanten werden verrauchen, ich schwöre es Ihnen beim Tempel der Rosenkreuzer!“
Die erschrockenen Beamten nahmen ein Protokoll mit ihm auf. Gerade jene Brillanten waren es ja, die man suchte! Bis nun aber das Stück den umständlichen Instanzenweg zum Könige durchgemacht hatte und Cagliostro freigelassen wurde, um den großen Sammeldiamanten aus der Lösung herauszukristallisieren, war es zu spät geworden!
Die Tinktur erwies sich wirklich als wertlos; sogar die Akademie mußte es zugestehen. Herr Buffon, Herr Lavoisier selber zuckten die Achseln bei der Analyse; alles war verloren.
Warum Cagliostro so jählings verhaftet worden war?
Der junge Mignard hatte seinen Vater gebeten, für ihn um die Hand der kleinen Barrées anzuhalten. Da brachte Mignard alle Kräfte dieser Erde, als da waren zwei Hofdamen, einen Erzbischof und einen jüdischen Generalpächter, gegen Cagliostro in die [101] Schlacht. Seinem Sohne drohte er mit Enterbung.
Und die junge Clarisse war bei ihrem Vater gewesen: „Der junge Mignard liebt mich.“
„Und du, du liebst ihn?“ fuhr der Graf empor.
„Seine Demut rührt mich tief, lieber Vater, er ist sehr schmerzlich für seinen Mangel an galanter Rücksicht bestraft worden, und er fürchtet, daß eine Barrées niemals an einen Bürgerlichen weggegeben werden könnte.“
„Nein,“ lachte der Graf nervös, „niemals!“
„Niemals?“ horchte sein verzogenes Töchterchen empor. Durch ihr Herz fuhr ein Stich von Schreck und Trotz. „Und wenn ich ihn liebte!“
„Wenn du ihn liebst, mein Kind, dann werden wir in der Wahl deines Gatten rücksichtsvoll sein,“ sagte der alte Herr zartfühlend.
„Ah, wieso? Und wer sollte mir, mir einen anderen Gatten diktieren. Sie am Ende? Und welchen Gatten?“
[102] „Vielleicht den Marquis von Chateauvert; hm? Er ist neunundsechzig Jahre alt, reich, mächtig und dabei freidenkend, zart und rücksichtsvoll.“
„Ach so,“ sagte das junge Mädchen, und wurde tief dunkelrot. Dann faßte sie sich. „Das ist alte Mode, teuerster Herr Papa,“ sagte sie. „Das galt zu einer Zeit, wo man die herrlichen Gefühle der Natürlichkeit und der Herren Rousseau und Diderot noch nicht kannte. Ja, Herr Papa,“ rief sie mit edelglühenden Wangen aus, „die Welt ist anderen Sinnes geworden und ich sage Ihnen, sie verachtet jene Galanterien einer gänzlich abgetanen Zeit. Man heiratet wieder, Herr Papa!“
„Aber Kind, die Logik! Handelt es sich um Liebe oder Matrimonium? Die Logik!“
„Man kennt auch keine Logik mehr,“ sagte Clarisse kühn. „Sie ist eine Spielerei alter Leute. Man folgt den Instinkten der redlichen Natur, Herr Papa — — —“
„Clarisse,“ sagte der alte Edelmann. „In meinen Fingern zuckt es. Preise dein Glück, daß dein alter Vater den Instinkten der redlichen [103] Natur diesmal nicht folgt, sondern begib dich auf dein Zimmer, das du in drei Tagen nicht verlassen wirst.“
So hatte denn eine verbotene Liebe bei all den günstigen Vorbedingungen noch drei Tage Gelegenheit zu tiefer Wühlerei im Herzen eines eigensinnigen Mädchens.
In seinem Ärger schloß sich der Graf den Bemühungen Mignards an, und es gelang beiden, den Widerstand des Herzogs von Orléans und anderer einflußreicher Gönner zu brechen. Diese Herren, die bisher die Verhaftung Cagliostros in Sachen der Halsbandgeschichte hintertrieben hatten, ließen nun dem Groll des Königs freien Lauf, und der fortschrittliche und sehr freigeistige Graf Barrées wünschte jetzt die Zeit der Hexenprozesse zurück, um Cagliostro verbrennen lassen zu können. Denn nun glaubte auch er an den verfluchten Trank.
Wie stark dieser Trank gewesen sein mußte, leuchtete ihm nach den drei Tagen, in denen er seine Tochter nicht gesehen hatte, ein. Das Mädchen war fort und dem Vater [104] blieb von ihr nichts als ein Billettchen in der Hand: sie habe sich ihren Mann selber gesucht.
Die Komtesse war durchgegangen, der junge Mignard desertiert. Nun wohnten sie zusammen in einer kleinen Dachkammer am Rande von Batignolles. Graf Barrées und Mignard mußten mit zusammengebissenen Zähnen schweigen, weil der eine die Ehre seines Standes und der andere die seines Chemikerberufes zu wahren hatte.
Cagliostro aber schrieb aus dem Gefängnis einen Brief an den Grafen, in dem er drohte, die Wirkung seines Trankes an den Tag zu bringen, wenn er nicht seine Freiheit und jene Diamanten wieder erhielte, die er an Barrées um des Liebestrankes willen verpfändet hatte. Diese Diamanten! Barrées hatte sie schon triumphierend zur Lösung der ganzen Halsbandgeschichte ausliefern wollen. Nun mußte er allen seinen Bekannten erzählen, daß Mignard sie bei der chemischen Analyse als wertlose Komposition erklärt hätte, und Mignard, der froh war, dem Rufe Cagliostros wenigstens [105] hier schaden zu können, schimpfte mit ihm auf den Schwindel.
Cagliostro erhielt also vom Grafen seine schwer ergaunerten Brillanten zurück und das Versprechen der Freiheit, wenn er die beiden Verrückten, die weiß Gott wohin durchgegangen wären, ausfindig machte und durch ein Gegengift von ihrer entsetzlichen, taktlosen und gänzlich unmodernen Leidenschaft kurierte.
Ohne die brennende Eifersucht des jungen Fortunat wären die Verliebten nicht zu finden gewesen. Der aber erspähte ihr enges Nest in zwei Tagen und überbrachte ihnen einen Brief Cagliostros, gerade in dem Augenblick, als sie vier Artischocken, die ihr ganzes Mittagsmahl ausmachten, verspeist hatten und den letzten Fond unter sich aufteilten, wobei jedes wollte, daß das andere den ganzen Leckerbissen bekäme. Sie waren bettelarm, alle beide, und hatten fast gar nichts mehr zu leben.
Fortunat überbrachte den beiden jungen Leuten das Gegengift Cagliostros, das in folgendem Briefe bestand:
[106] „Madame! Der Liebestrank, den Sie und Herr Leutnant zur See Olivier Mignard mitsammen geleert haben, bestand aus altem Kognak, der sehr zu brennen vermag, etwas Rosenöl, das poetische Gefühle erweckt, und einer ganz nichtigen Spur von Kantharidenspiritus, aber nur genau so viel, um die Herren von der Akademie bei der Analyse ein wenig bedenklich zu machen. Ich hoffe nicht, daß er bei Madame gewirkt haben könnte. Die übrigen Ingredienzien sind etwas Saft von der verbotenen Frucht, geheimer Aberglaube, und schließlich die alte Lust Adams und Evas an der ganzen Sache überhaupt, der jede Gelegenheit recht ist, um lieben zu dürfen. Ich weiß, daß nach dieser Ernüchterung Ihre sehr verehrten Herren Eltern mit ihrer Vernunft wieder zu Rechte gelangen werden und Sie ob des kleinen und gar nicht unangenehmen Spaßes nicht zürnen werden Ihrem in Entzücken über Ihre Schönheit, Jugend und Unerfahrenheit versunkenen Grafen Cagliostro.“
Da wurde die kleine, gänzlich illegitime Gattin des jungen Mignard abermals dunkelrot [107] vor Scham und Zorn. Sie stand auf, machte dem jungen Fortunat einen Knicks, kurz und ungeduldig wie eine aufschnellende Fauteuilfeder: „Wohlan,“ rief sie mit dem ganzen Stolz ihres alten Geschlechtes und ihrer jungen Großtat: „Verkündigen Sie den Grafen Cagliostro und Barrées, daß ich mich glücklich schätze und ihnen dankbar bin, erfahren zu haben, daß diese Liebe, um deretwillen wir hier darben, uns nicht aus den Händen eines Charlatans, sondern aus den Händen der göttlichen Natur gegeben wurde. Sagen Sie diesen Herren und Herrn Doktor Mignard, daß wir uns fortab nicht mehr als vergängliche chemische Verbindung, sondern als das Urelement alles Entstehens fühlen und daß wir nun erst recht beisammen zu bleiben gesonnen sind. Nicht wahr, Olivier?“
„Ja,“ sagte Mignard erfreut und kleinlaut zugleich. Er war sehr hungrig.
„Oh,“ rief Fortunat, der den Unterton bemerkte, „und wovon wollen Sie leben?“
„Glauben Sie nicht,“ lächelte Clarisse, „daß jene Sängerin, die mit dem kleinen Grillenliedchen [108] eine ganze Versammlung wirbeln machte, wenig Sorge um ihren Unterhalt haben dürfte? Glauben Sie nicht, daß der Name Barrées meiner Stimme in den Theatern von London oder Wien nur noch mehr Wohlklang geben dürfte? Und glauben Sie, Maestro Primavesi hätte die große Gelegenheit, Furore für seine Schule zu erregen, nicht längst schon benützt und mir kein Engagement verschafft? Ah, wir haben unsere Zukunft in der Tasche! Nicht wahr, Olivier?“
„Ja,“ sagte Mignard gerührt und betreten. Denn dem ritterlichen Jungen war es entsetzlich, seine Zukunft der Arbeit seiner Frau verdanken zu sollen.
Da stürzte Fortunat voll Verzweiflung zu seinem Onkel, zu dessen Kerker ihm die Bemühungen Barrées und Mignards Zutritt verschafft hatten. „Onkel Balsamo,“ sagte er, „ich gehe hin, um mich aufzuhängen. Diese Menschen sind unerträglich! Wir verhöhnen sie, wir betrügen sie, wir geben ihnen Kognak und Kantharidensaft statt des heiligen Atems Gottes zu trinken, und aus all diesem Betrug [109] und Schwindel erwächst eine Liebe, so mutig, so opfervoll und so leidend, so süß und göttlich schön, als sei ein Rosenstrauch aus dem Dreck des Teufels erblüht!“
Da schrieb Cagliostro einen zweiten Brief an den Grafen von Barrées:
[110] „Teurer Graf! Daß Ihre Tochter nicht Sängerin werden und den Skandal nicht auch noch mit Trillern vor der Welt verkünden darf, darüber sind wir beide einig. Ein solcher Beruf wäre zwar das allersicherste Mittel, sie recht bald aus dem Besitze Herrn Mignards in einen anderen gelangen zu lassen, aber nicht leicht in den Besitz einer Grafenkrone. Versorgen Sie das junge Paar mit derart reichen Zuschüssen, daß es sich gedemütigt fühlt, keine Sorgen mehr hat und in seiner Verstecktheit Langeweile bekommt. Richten Sie Ihre Briefe mit dem Innentitel nur mehr an die Maitresse des Herrn Mignard und geben Sie Ihre Einwilligung zu ihrem Treiben unter der Bedingung, daß es geheim und versteckt bleibe, was bei dem augenblicklich so starken politischen Lärm leicht geschehen kann. Sie glauben nicht, Herr Graf, wie demütig Langeweile einen Menschen machen kann, Langeweile von der Art, wie ich sie hier in der Bastille kennen lerne. Es ist eine Qual, von der zu befreien Clarisse Sie bald ebenso bitten wird, wie Sie um diese Vergünstigung gebeten sind, von Ihrem ergebensten Diener
Cagliostro.“
Vierzehn Tage nachher war Graf Cagliostro mit seinem Neffen auf der Flucht nach Italien, und in den Salons ging die Nachricht von der Verlobung des Marquis von Chateauvert und der kleinen Clarisse de Barrées umher und war so selbstverständlich und langweilig, daß man nur mehr auf den nächsten Liebhaber der jungen Frau riet.
Mignard trat wieder in die Marine ein und besuchte Madame de Chateauvert nur mehr in den Pausen zwischen zwei seiner Seereisen, wodurch ein Verhältnis entstand, ein Verhältnis, welches auch nach der Revolution durchaus nicht altmodisch gescholten wurde und welches sowohl in jener flüchtigen und [111] leichtfertigen Zeit, als auch in den etwas kräftigeren Tagen, die ihr folgten, als das rührendste, schönste und dauerhafteste in dem ganzen riesenhaften Dreieck zwischen Calais, Toulon und Bordeaux galt. In dem Dreieck, dessen Schwerpunkt den Namen Paris trägt. —


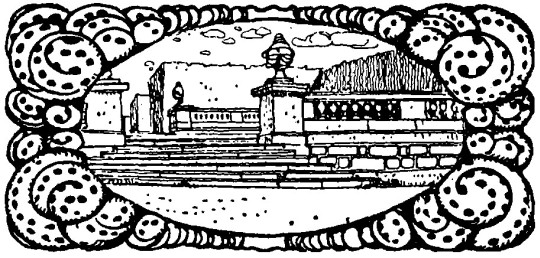
Mein Freund Fräneli Thaller aus Solothurn erzählte mir vor einem alten Bilde:
„Vom Trödler Hirschl am Hafnersteg habe ich das Bild der kleinen Marquise Blanchefleure gekauft, die mit dem größten Teile des französischen Adels im Jahre 1792 taktlosen Angedenkens ihren reizenden Kaprizenkopf verlor. Hier auf dem Bilde hat sie ihn noch; hat eine hohe Frisur und hohe, drollige erstaunte Augenbrauen; — wie mit Watteaus Pinsel gezogen — und ein belustigt schauendes Gesichtlein. Sie ist reizend und ich sehne mich nach ihr.
Sie wissen noch nichts von der kleinen Marquise Blanchefleure, die in allen Dingen recht hatte? Sie wissen noch nichts von der ridikülen Leidenschaft meines Urgroßvaters, [116] des Schweizers Thaller, dessen Emailbild jetzt unter dem ihren hängt, und nichts von der Taktlosigkeit der Jakobiner, dieser Menschen ohne Geschmack und Grazie! Nicht?
Nun, Marquise Blanchefleure hatte in allen Dingen recht. Sie hatte recht, daß sie als Ducheßlein auf die Welt kam: entfernt savoyisches Blut, also etwas weit hinten in der Rangliste von Versailles, aber doch eine kleine Herzogin, welche dereinst des Königs lächelndsten Marquis erhaschen würde. Sie hatte recht, daß sie ein besseres Wesen war, wie alle übrigen Geschöpfe auf ihres Vaters Schloß, Dorf und Landschaft: Musik- und Tanzlehrer, Verwalter, Bauer, Magd, Esel, Ochs, Knecht und alles, was sein war. Sie hatte recht, von der tiefgedrückten Not leibeigener Bauern zu leben. Denn sie lebte lächelnd und trällernd und alle Welt verneigte sich tief vor ihr, ihrem Glanz und ihrer Schönheit. Wie wenn der Wind über Kornfelder geht, so neigten sich große Versammlungen voll Menschen vor ihr: compliments en mille. Und sie hatte recht, den Marquis [117] Massimel de la Réole de Courtroy zu heiraten, über dessen Beschränktheit der Hof so sehr lachte, daß er dem Könige unentbehrlich wurde und bei jedem Lever, zur Erzeugung guter Morgenlaune, aufwarten mußte. Liebhaber wußte sie genug, aber Männer, welche so reich waren, sich eine Blanchefleure mit allen ihren Wünschen und Launen zu gönnen, davon gab es sehr wenige. So kam sie an den Hof und auch da behielt sie, wie gewohnt, sogar vor dem Könige recht.
Ihre lächelnde Kommandogewalt zeigt am schönsten folgender Fall:
Man weiß, daß es in der französischen Armee verboten war, bei Todesstrafe! — in Schweizer Regimentern den Kuhreihen zu blasen oder zu singen; weil dann die ungeschickten Kinder der deutschen Alpen herdenweise davonliefen oder vor Heimweh starben.
[118] Und mein Urgroßvater Primus Thaller hatte den Kuhreihen mitten in Paris gesungen! Auf dem Hofe der Schweizer Kaserne war er gestanden, im gelben Sand, auf dem die Abendsonne glühte und die Soldaten sich zum Ausgang in die Stadt rüsteten. Zugegangen war das auf solche Weise: Er hatte von seinem, um sechs Jahre jüngeren Bruder Quintus, Tambour beim Regiment „Prince d'Orléans“, einen Brief aus Amerika erhalten, den Brief eines achtzehnjährigen Jungen, der von Lafayette, Washington, Freiheit, Bürgertrotz und Bürgerstolz schrieb, so schön und dumm und heilig, wie das überhaupt nur ein achtzehnjähriger Junge zustande bringt. Der junge Quintus schrieb, daß die Regimenter der Lilie heimkehren würden; über ihren Häuptern aber würden unsichtbar feurige Zungen mitfahren, welche in Frankreich mit riesigem Loderbrande emporflammen müßten; große Flammenzungen, große Worte:
Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit!
Große Worte? Freiheit, Gleichheit? — Da gedachte mein armer, sehnsüchtiger Großvater, [119] daß da und dort in seiner Heimat dergleichen schon seit Jahrhunderten ohne große Worte zu Hause war ... in Appenzell etwa, von wo er gekommen war, um Ehre und Geld zu verdienen. Und er gedachte, daß man aus Amerika als gewaltig neue Sache die Menschensatzung wie eine Welterstaunlichkeit über das Meer bringen mußte, da sie doch zu Hause lange still und ganz vernünftlich ihr verständiges Blütchen getrieben hatte. Es könnten sie doch nur jene brauchen, denen sie eingewachsen war: stille Leute mit Schranken ringsum. Das große Menschengesetz ist weder Rausch noch großer Jubilo: es ist ein ehrlich kramendes Abwägen; es soll für die unendliche Menge sein, die Fleisch, Brot, Zimmer, Kammer und Küche, ein bißchen Sonne und ein bißchen Grünzeug, aber viel Arbeit braucht, damit die Mordbestie gut und tüchtig schlafe.
Warum diese Genies ihre Gesetze nur immer wieder für Genies machen?
In Appenzell zu Hause hatten sie schon lange das, wovon in Paris erst jetzt scheuheimlich geraunt wurde. Er dachte an seine [120] bedächtigen Onkel, an ihre Kühe und Kälber, an ihre Felder und Alpen. Es ist doch der Menschheit naturangemessenes Paradies, meine liebe Schwyz, hatte der Sergeant gedacht — — — und, ganz in tiefen Gedanken verloren, den Kuhreihen gesungen.
Da war es aus und geschehen.
Denn die amerikanische Kunde hatte viel ärger in den Herzen gehauset, als mein braver Urgroßvater Primus — vorn Ehrlichkeit und hinten Zopf — sich geträumt, und wenn's nicht schlimmere Leute getan hätten, so hätte die Pariser weibliche Dienstbotenschaft allein schon ihre Liebschaft aus der Schweizer Kaserne verdorben. Die Dienstbotenschaft war ein gutes Teil der großen Hefe, durch welche die große Revolution gärte.
Die Disziplin hatte längst schon gelitten. Es waren Landsknechtsnaturen im Regiment und ein Dutzend davon fielen in das sehnsuchtsvolle Piano meines Urgroßvaters mit trotzigen Kräften ein, so daß der Kuhreihen weithin erscholl. Es hatte ihn schon seit Jahrzehnten keiner mehr gesungen und war also auch keiner [121] bestraft worden. Nun aber war er ganz anders erklungen als ehedem. Nicht als der große Reißaus! Nicht als das allmächtige Heimweh! Nein, bloß als Trutzlied auf ein zopfiges Verbot. Sie jubelten und jauchzten den Kuhreihen, sie ahmten das Almhorn durch Nase und Kehle nach und hatten großen Jux: zehn oder zwölfe. Aber obgleich mein Großvater davongeschlichen war, als er sah, daß man ihm die Stimmung verdarb, und obgleich nur ein paar dumme Unterwaldner, Schwyzer und Appenzeller Kühbuben Heimweh davon bekamen und desertierten, — er war doch der erste gewesen und mußte als dreizehnter gelten. Man sperrte ihn ein; nach dem Gesetz war er dem Tode verfallen.
Nun war die Todesstrafe so ziemlich das einzige, was den entferntesten Untertan sogleich und direktement mit dem Könige verband — — ich weiß nicht recht, ob es heute nicht am Ende in euern Monarchien auch so ist?
Der König sollte das seltsame, veraltete, kriegsrechtliche Urteil bestätigen. Er war dick, behäbig und ehrlich und dachte bei einer der [122] nachdenklichen Handlungen, welche zum lever gehörten, ernsthaft über das Schicksal meines Urgroßvaters Primus nach. Als ihm dabei der Marquis Massimel de la Réole de Courtroy glückselig lächelnd nahe kam, fragte er ihn ziemlich einsilbig: Was soll man nun mit diesem Primus machen? Hat eine alte Vieherei (bêtise) neu zur Mode gebracht ...
Der Marquis wußte gar nicht, worum es sich handelte, sagte also geistesschnell: Wollen Sire mir, da es sich um Modesachen handelt, gestatten, meine Frau zu befragen?
Der ganze Hof lachte und Seine bequeme Majestät lächelte; sie hatte Aufschub, daher war es ihr genehm und so wurde das Schicksal meines Urgroßvaters in die reizenden Hände der Marquise Blanchefleure gelegt, welche zur gleichen Zeit an der Morgenhaube Marie Antoinettes nestelten. Das Lever der entzückend leichtfertigen Königin begann eine ganze Stunde später, aber der Marquis wurde als Mann seiner Frau und Bote des Königs sogleich vorgelassen. Er hatte sich inzwischen über [123] den Fall Primus Thaller orientiert und trug ihn den beiden Damen vor.
Madame Blanchefleure klatschte entzückt in die Hände. Ein Schweizer! Wie reizend! Ich erbitte ihn mir von der schönen Majestät Frankreichs, damit er mir auf meinem Gut in La Réole eine Alpe mit scheckigen Kühen herrichtet.
Die Königin lachte und sagte zu.
„Er wird echte Kuhglocken besorgen müssen und einen grauen Tuchrock mit roter Weste, blauen Strümpfen, Schäferhut und himmelblauen Bändern tragen müssen. Im Juni besucht unsere königliche Majestät unser Gut und da wird er uns auf einer reizenden Alpe, die wir inzwischen erbaut haben werden, den fatalen Kuhreihen zu aller Vergnügen vorsingen müssen. Nicht wahr, schöne Majestät?“
Wieder lachte die fröhliche, leichtsinnige Königin, stimmte zu und der König begnadigte meinen Urgroßvater mit aller Gravität, welche zu einer so erfreulichen Angelegenheit von Gerichts wegen gehört.
Dann hatte Herr Primus Audienz bei Madame [124] Blanchefleure, um sich für Leben und Freiheit zu bedanken.
Zum Soldaten hatte er sich unbrauchbar erwiesen, der Verführer aus spießbürgerlicher Sehnsucht; er war ausgestoßen worden und kam schon in appenzellerisch angehauchtem Bürgerkleide mit rundem Hut zu ihr. Madame Blanchefleure hatte vor Neugierde und Aufregung über die Sensation kalte Hände und heiße Wangen bekommen. Als das erbärmlich schlichte, graue Ereignis in Gestalt des armen Jungen eingelassen wurde, stand ihr der Atem still. Sie hatte sich, weiß Gott was für einen Gewaltigen vorgestellt, einen Aufrührer und Verführer des Volkes, dem die Rede in Flammenströmen aus dem Munde fuhr, und nun kam ein Gesetzbuch bürgerlicher Rechte herein: brav, still und ehrlich, ein rechter: Gib mir das, so hast du das.
Ahnt Ihr aber, was ihm Madame Blanchefleure gab?
Als er eintrat und ihr treuherzig sagte: Es war schön von Ihnen, Gnädigste, daß Sie [125] einem wildfremden armen Kerl Ihr gutes Herz zuwandten, da betrachtete sie, indem an seiner Kleidung und Gestalt wenig Erstaunliches war, sein Antlitz: er hatte unsere grauen, scharfen Augen, ein schmales, ehrliches Gesicht, hohe Schläfen, Hagernase, und nur die Jugend vermochte etwas Weichheit über diese unbequeme Catohaftigkeit zu gießen. Vor allem aber hatte er jenes ruhige Zentrum der Welt mitten in sich, welches den rechten Mann nicht einmal mit neun Maß Wein schwanken läßt, — nicht einmal im Verliebtsein, nicht einmal im politischen Kampf gewaltiger Zeiten. Es ist wahr, er stand wie das Symbol der Sicherheit vor ihr auf beiden gespreizten Beinen zugleich. Alte Gewohnheit der Schweizer, vererbt durch vieles Raufen.
Sie aber sah sich dieses unendlich sichere Antlitz an und dachte bei sich: Ich werde ihn dazu bringen, von mir zu sagen: elle me fait troubler.
Das war der Standpunkt, von dem aus sie Männer behandelte.
„Aber hören Sie,“ begann sie verwundert. [126] „Sie? Sie haben gesungen? Sie sehen doch ganz anders aus.“
„Ich kann auch nicht singen. Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken.“
„Wie haben Sie dann Ihren ranz de vache singen können?“
„Das war nur so — von innen!“
„Aus Heimweh wohl?“
„Ich hatte nur daran gedacht, daß Appenzell besser sei als Paris.“
„Mein Gott, und Sie wollen fort von hier? Was haben wir Ihnen getan? Es ist kränkend. Wir, wir lieben die Schweizer, sie sind uns wie ein ehrlicher Spiegel, in dem wir uns sehen können, wie wir sind. O bitte, sagen Sie mir eine Grobheit!“
„Ich kann nicht. Ich kenne Sie nicht näher.“
„O, so kennen Sie auch Paris nicht näher. Wie ist das nur möglich, daß man Sie hier nicht geliebt hat? In Paris wird jedermann von irgend jemand geliebt. Sogar die Soldaten haben ihre Mädchen. Wie konnte es geschehen, daß unsere hübschen Kinder und nun gar unsere Frauen bei Ihnen noch nicht für [127] Paris gebeten haben? Sie mußten doch einen Schatz haben? Oder mehrere? Zuviele wohl gar?“
Ach, mein guter Großvater hatte in Paris noch keinen Schatz, trotzdem, daß er Sergeant war. Er hatte sich immer eine mit recht lichtem Angesicht gewünscht und die gab es dort nicht; denn es mußte ein einziger Sonnenschein sein. Die Augen der Pariserinnen sind zwinkernde Sternlein bei Nacht über verstohlenen Gassenwinkeln; sie locken um die Ecke. Mein Urahn Primus ging immer geradeaus.
Das sagte er ihr; freilich in der viel besseren Sprache, die mein ehrlicher Urgroßvater sprach.
„Ja mein Gott,“ sagte Blanchefleure, „wie soll man's Ihnen recht machen? Ich hätte es vielleicht versucht, aber ich bin verheiratet.“
Da hob der arme Primus seine verwunderten grauen Augen empor, um sich einmal hinter all den erstaunlichen Dingen, Seide, Straußenfeder, Reifrock und dem vergoldeten Schnörkelstuhl das Frauenzimmer anzusehen, das dahinter steckte und also sprach. Und er [128] schaute tief, ehrlich und ahnungslos in ein zärtliches, leuchtendes Gesichtlein voll ungetrübter Freude an der hübschen Opernszene, die es da hervorgeplaudert hatte.
Er wurde ganz traurig, daß sie schon verheiratet war. Denn sie war wirklich ein einziger Sonnenschein.
„Sagen Sie denn gar nichts?“ bat Blanchefleure.
„Krüzigts Herrgöttli,“ staunte der arme Primus. „Die hättets just mit mir versuchen wollen?“
„Wie?“ fragte sie belustigt.
Da sprach er wieder französisch. Sie möge keinen Spaß mit einem armen Teufel machen.
„Aber nein,“ lachte sie. „Ich habe nur sagen wollen, daß es ein rechtes Unglück mit uns beiden ist. Denken Sie sich, ich habe auch noch keinen Geliebten und bin ganz so verlassen wie Sie.“
„Aber Sie haben doch den lustigen Marquis?“
„An den bin ich verheiratet worden,“ weinte sie beinahe, so sehr glaubte sie selbst an ihr Unglück. „Ahnen Sie denn, Sie aus der [129] Schweiz, wo jeder nach dem Herzen wählen kann, was es heißt, als savoyische Prinzessin mühsam, aber genau nach Taxwert losgeschlagen zu werden?“
„Ei, ja;“ meinte Primus Thaller. „Bei uns in Appenzell gibt kein Bauer von fünfzig Kühen seine Dirn einem schlechtern. Das ist Notwehr der Familie.“
„Gegen wen denn?“
„Gegens Armwerden.“
„Sie sind wohl sehr arm?“
„Ich wäre sonst nicht zu den Soldaten gelaufen.“
Das war der Augenblick, wo das Marquiselein die Bitte vorbrachte, Herr Primus möge ihr die Stallwirtschaft in La Réole nach Appenzeller Muster einrichten.
Mein Großvater drehte den runden Hut in den Händen und kämpfte den schwersten Kampf seines Lebens. Sein wackeres Schweizergemüt lag ganz und gar in der Frage, wieviel Lohn er bekommen sollte. Zweimal setzte er an, schaute in das Sonnengesichtlein und brachte die Geldfrage, die einzig ehrliche in der [130] Welt, nicht über die Lippen. Rundweg sagte er zu.
Sogar die Schweizer Rechenkunst hatte er in dieser süßen Audienz verlernt.
Er war in einer Viertelstunde verdorben worden, zu Paris, am 1. Mai des Jahres 1789.
Es war ein Glück, daß er niemals nach La Réole kam. Dort wäre eine stille Tragödie über ihn hinweggeschritten, an der niemand Freude gehabt hätte, als Madame Blanchefleure.
Die abscheulich große Revolution verhinderte Madames reizenden kleinen Plan.
Herr Marquis Massimel de la Réole de Courtroy genoß die chevalereske Ehre, daß ihm unmittelbar nach Seiner bequemen Majestät der Kopf abgeschlagen wurde, welcher Umstand ihn trotz aller Zweifel der Spötter das Leben kostete, — womit ein tiefer Beweis für die Gleichheit aller Menschen erbracht war —: und das wollte die Revolution.
Madame Blanchefleure wurde trotz der süßesten Tränen mit hundert Freunden und [131] Freundinnen des goldenen Gnadenbrunnens von Versailles zur Untersuchungshaft in die Keller des Temple eingeschlossen, wo außer unglaublich zahlreicher Adelsgesellschaft das erfolgreichste geistige Frankreich versammelt war: Professoren, Akademiker, Modemaler und entzückende Dichter. Das erlesenste Frankreich. Ein Heer von guter Geburt, von Karriere, gefährlicher Herrschaftskunde, aber auch (wenn die Revolution Augen für so etwas gehabt hätte) eine Versammlung fast sämtlichen in Frankreich zurzeit aufbringbaren Geistes, von Grazie, Lebensart, feiner Liebenswürdigkeit und göttlicher Lebensüberlegenheit.
Es war ein leuchtender Sieg über den Nationalkonvent, wie man sich hier unterhielt und wie man sterben ging. Da war Madame Blanchefleure nun zu Hause wie ein Schmetterling, den man bloß aus kalter Wintersnot ins Gewächshaus gebracht hätte. Sie war der Stolz, die Erhebung und das Entzücken der gesamten Adelswelt, welche hier das Unglaubliche zuwege brachte, mit graziöser Heiterkeit mutig zu sein, — was sonst wenigen gelingt. [132] Der Todesmut verwandelt den gewöhnlichen Menschen immer gleich in eine Tragödienfigur. Jene feinst konstruierten Leute aller Zeiten aber blieben beim geliebten Lustspiel. Sie starben stilgerecht, en rococo, wie sie gelebt.
Und nun mein Urahn Primus Thaller!
Der hatte seit jenem 1. Mai die kleine Blanchefleure mit ihrem besonnten Blumenantlitz nicht vergessen können. Zuerst dachte er, es sei Dankbarkeit und trug ihr Bild in sich herum, wie ein selbstübertäuschter Mönch jenes der Himmelsjungfrau.
Die Revolution fegte mit dem impertinent heiteren Versailles und dem Großadelsbesitz jede Hoffnung hinweg, in La Réole Milchmaier zu werden; aber sie erinnerte sich des guten Bürgers Primus Thaller, der beinahe den Tod durch die königlichen Kriegsartikel erlitten hätte. So wurde er Offizier; Kapitän vom Fleck weg. Er kam in ein Regiment, dessen gesamtes adeliges Korps zerstoben war und in dem an den Offiziersstellen Branntweinschänker, Laufburschen oder sonst welche Gamins, kurz die ganzen talentierten Nichtsnutzigkeiten [133] festsaßen, welche, durch die Revolution emporgewühlt, die großen Siege der Republik erfochten.
Es behagte ihm nicht sehr, aber er verzehrte seine Gage und das gefiel ihm. Immer aber gedachte er: wo mag die kleine Blanchefleure sein?
Da erfuhr er, daß man ihren Herrn Marquis-Gemahl geköpft habe und daß die kleine Witwe im Temple vielleicht gar auf ein ähnliches Ende warte.
Ach, ging da ein Frühlingsausbruch von Freiheiten in seiner Brust empor! Gleich wußte er jetzt, daß er verliebt war. Jetzt ist sie Wittib, jetzt ist sie ärmer als eine Appenzeller Kuhdirn, jetzt kannst du sie heiraten. Diese Logik stieß sich so überraschend in ihm empor, wie ein Maulwurfshaufen in beruhigt summender Wiese.
Sein Bruder vom ehemaligen Regiment Prince d'Orléans hatte Wache im Temple; zu dem lief er hin. „Du Quinteli! Ist bei euch nicht ein junges Frauenzimmer eingesperrt, mit einem geblümten Seidenrock, so [134] breit wie ein Imblikorb, und drei Straußfedern in den Haaren?“
„Nein,“ sagte der Leutnant Quintus, früher Tambour. „So welche haben wir nicht, sie müßte das Röckli am End ausgezogen haben. Wie heißt sie denn?“
Da sagte Primus den Namen und Quintus ärgerte sich. „Dieselbe kenn ich gar wohl“, schimpfte er. „Ein mudelsauberes Frauenzimmer, die mir neulich gesagt hätt', die Amerikaner verstünden nichts von unseren Feinheiten, und wie ich ihr unter das Kinn habe greifen wollen und gemeint habe, wir verstünden doch ein bißchen davon, hat sie gesagt: Der Mensch hat Augen, um sich zu freuen; selbst der Hund hat noch seine Nase, ich sei noch viel weiter dahinter: ein grauslicher Schneck, wenn ich überall nur gleich hintasten müsse, um was Hübsches zu begreifen. Aus Amerika käme nichts Feines.“
Eben wurde ein Herr Vicque d'Azyr in den Temple gebracht. Ganz nachdenklich hatte er sich von den Soldaten bis hierher führen lassen, jetzt hörte er das Gespräch der [135] beiden Brüder und sagte: „Das war richtig und geht noch tiefer. Man kann herzlich diese französische Revolution verachten, aber vor der amerikanischen, vernünftigen Bürgerkälte darf man Angst haben. Ein feiner Instinkt könnte prophezeien, meine Herren: Die Kultur Europas stirbt soeben an der Vernunft der Vereinigten Staaten. Wir werden seit eurer mißglückten Nachahmung eine geistige Kolonie Amerikas sein; nicht viel besser, als Griechenland seit Mummius dem unfeinen Rom gehörte. Unsere Künstler werden wie jene alten nur mehr zerbrochene, sehnsüchtige Flügel regen, aber nichts wird ihnen mehr glücken. Die Amerikaner aber werden mit heiliger Scheu die Ruinen unserer Kultur besuchen, die viel zu fein für sie ist.
Europa war zum letzten Male originell vor dem Mai 1789.“
So sagte er und dann stießen die Soldaten Herrn Vicque d'Azyr vorwärts. „Ich gehe schon ohne Hausknechtwink, meine Freunde,“ sagte er mild und verschwand in dem Keller des Temple.
[136] „Was meint der Narr?“ fragte Quintus.
Primus grübelte, begriff aber auch nichts Rechtes. Dann bat er den Bruder, ihm Zwiesprach mit der kleinen Bürgerin Witwe Massimel zu verschaffen.
„Du kannst hinuntergehen und sie im Keller besuchen,“ lachte Quintus. „Herauslassen darf ich niemand.“ Und Primus Thaller stieg zu den Gewölben hinab; die Wachen ließen ihn in den großen, feuchten Saal, in dem sich nur Kröten und Kellerasseln wohl zu fühlen vermocht hätten.
Er aber stand in Staunen gebannt, denn alle Phantasie ward aufs Haupt geschlagen bei dem, was hier geschah.
Eine ganz geheime, leise Musik von Violine, Flöte, Kniegeige und Baß schmeichelte sich an den schimmelfeuchten Wölbungen empor wie ein Kätzlein an seidenen Kleidern. Man spielte auf eingeschmuggelten Instrumenten! Die Violine hatte Herr Miradoux, erster Geiger des königlichen Opernhauses, die Flöte der Vicomte Chantigny, dessen Atem so viel Wunder zaubern konnte wie der Hauch des [137] Westwindes. Mit der Bratsche war der Straßburger Domherr Avenarius verwachsen und den Kontrabaß spielte mit nachdenklicher Grundgriffigkeit der berühmte Abbé Mervioli aus Florenz. Silberne Bestechung vermochte selbst in den Zeiten der Republik goldenen Wohllaut in die Keller des Temple zu bringen.
Mozarts kleine Nachtmusik!!
Sie wirkte Wunder, hier in dämmerndem Dunkel ..... Die alten Schloßbrunnen quollen und schluchzten in der Fliedernacht, die Paläste standen in alter, reicher Pracht und lauschten gnädig auf den liebenswürdigen Einfall des Salzburger Herrn Musikus. Die alte, stolze Zeit war hier versammelt, neu hervorgezaubert trotz Carmagnole und Marseillaise.
Rundum saßen Herren in Seidenstrümpfen und Damen mit Spitzentüchern, elegant in all der entsetzlichen Notdurft dessen, was man ihnen, den gefangenen Opfern der Volksrache, gelassen hatte. Knie über Knie geschlagen die Herren, graziöse Köpfchen in schlanke Hände gelegt die Damen, eine einzige große Erlauchtheit.
[138] Und darüber hin schmeichelte wie Weihrauchwolken Wolfgang Amadés wundervolle Grazie.
Es kommt gegen das Ende des Allegro eine Stelle ganz unvermittelt, lieblicher als aller bisheriger Fluß süßer Melodie, ganz wider Schule und Hergang, als dächte plötzlich einer der Spieler an ein leises Zofenhändchen, das ihm hinterrücks neckisch zärtelnd über die Wange streichelte. Als diese Stelle kam, hörte Herr Primus hinter sich ein wohlgefällig leises: Ah!
Er drehte sich um — Blanchefleure. Sie hatte ihn erkannt, hob aber sachte die Hand, nicht zu stören. Bald danach war der Satz zu Ende und während die Herren und Damen vom Adel entzückt zu den Spielern traten, reichte Herr Kapitän Thaller der armen, reizend blassen Blanchefleure seine ehrlichen Hände, um ihr seinen Antrag zu machen.
Sie hörte ihn mit hochgezogenen erstaunten Augenbrauen an, als er begann: „Sie sind jetzt Witwe und arm wie eine Appenzeller Kuhdirn, Gott sei Dank.“
[139] „Oh!“ zweifelte sie: „Ah?“
„In jetziger Zeit aber sind wir Soldaten alles. Die Revolution glaubt den Offizier zu vernichten und macht ihn zum Herrgott. Unsereins krabbelt es in den Händen, so stark sind wir jetzt! Ich werde Sie also aus dem Höhlenloch herausholen: wie, das werden Quintus und ich schon zuwege bringen.“
„Warten Sie,“ sagte Blanchefleure, „da kommt eine Menuett.“
Wirklich begannen die vier Musikanten einen jener reizenden Tänze der eleganten Zeit zu spielen, bei dem man sich mit Augen und Fingerspitzen Dinge sagte, für die sich der plebejisch umschlingende Walzer keinen Rat weiß. Und die ganz leichtsinnigen von den Herren und Damen ordneten sich zum Antritt.
„Es ist vielleicht die letzte Menuett,“ entschuldigte Blanchefleure mit reizendem Lächeln; „und ich würde es sehr beklagen, sie nicht getanzt zu haben: — mit Ihnen, Herr Kapitän,“ fügte sie herzbezwingend hinzu, als der arme Junge tiefbetrübt zurücktrat, und sie nahm ihn bei der Hand. „Scheuen Sie sich doch nicht,“ [140] fuhr sie fort. „Wir haben doch Egalité, Fraternité. Was, Sie glauben auch nicht recht daran? Immerhin; ich tanze gern mit Ihnen.“
Und der süße, schwermütig kokette Tanz des todesnahen Leichtsinns begann. Kein Totentanz war so wie der. So voll leichtfertiger Absage an das Ende. Es war die Melodie der Menuett aus dem Don Giovanni und sie spielte wie diese kurz vor dem ersten Zuschlagen des Schicksals; übermütig frivol und graziös wie diese.
Im Annähern fuhr Primus Thaller mit seiner ehrlich heißen Werbung fort. „Ich habe Sie lieb wie keine andere und Sie sollen meine Frau sein.“
Das neckische Zurückweichen des Tanzes der Koketterie führte Blanchefleure von ihm weg. Ihre Augen lachten, aber sie sagte: „Was Ihnen nicht einfällt. Sie sind geschmacklos, mein Freund.“
Wieder schwemmten sie die weichen Wogen des Tanzrhythmus zu ihm; ihre Hände umschlangen sich. „Mein Geliebter wären Sie vielleicht worden, dort unten in La Réole, [141] wo die Herdenglocken süße, befreite Natur predigen. Ich hatte immer meine Saison der Naturrückkehr.“
Und sie neigte sich zurück und schritt im neckenden Taktschritt davon, während das Herz des armen Primus in Flammen tobte, gebändigt vom Tanzgesetz, von der allgemeinen Grazie, innerlich aber unbändig, als ob die ganze Revolution in ihm gefesselt läge und gefoppt würde. Und wieder kam sie zurück: „Aber Madame Thaller zu werden — mein lieber, ehrlicher Freund aus Appenzell! Was denken Sie? Man könnte Sie küssen für so viel Naivetät! Ach, daß wir nicht mehr in La Réole unsere Komödie haben durften. Welche Bêtise! Nun müssen wir sogar auf den Kuß verzichten! Außer Sie wollten mit einem Handkuß vorlieb nehmen?“
Es kam nun die Stelle in der Menuett, da auf dem Theater der Wehschrei Zerlinens den süßen Leichtsinn zerreißt. Und obwohl die galanten Herren Miradoux, Vicomte Chantigny, Avenarius und Abbé Mervioli die Noten für eine kleine ununterbrochene Rückkehr [142] zu einem fröhlichen Dacapo überarbeitet hatten, gebot doch das Schicksal den Originalsatz. Die Tür wurde aufgerissen und eine arge Branntweinstimme zerriß das Blumengewinde eines kurzen Traumes.
„Ihr da, Bürger und Bürgerinnen! Ruhe im Namen der Republik!“
Der Reigen erstarrte zu Eis, hinhorchten Herren und Damen, denn jene Unterbrechung kannten sie. Es war die alltägliche Verlesung der Namen jener, welche vor Gericht geladen waren, um — recht oft — verurteilt zu werden. Aus dem Temple ging der Weg besonders leicht in die Sackgasse mit dem einzigen Fenster nach der Ewigkeit, dem Loch der Guillotine.
Diesmal wurde auch der Name der kleinen Bürgerin Massimel verlesen. „Hier,“ rief sie, aber sie war erbleicht.
„Denken Sie jetzt an meinen Antrag?“ fragte Primus Thaller, angstvoll hinter sie tretend.
Die arme, blasse Blanchefleure sah ihn mit ihren erschrockenen Augen an, über denen verwunderte Augenbrauen standen. „Ach Gott, [143] mein Freund,“ sagte sie kläglich. „Ihre Republikaner lassen einem nicht einmal sein bißchen Tanzfreude. Dort in der Ecke steht meine kleine Zofe, die sich mit mir einsperren hat lassen. Zénobe! Du darfst mit diesem Herrn weitertanzen. Bitte, entschuldigen Sie mich wegen dieser fatalen Verhinderung und nehmen Sie mit ihr vorlieb; sie ist ein reizendes Kind.
Adieu, mein Freund!“
Und Herr Miradoux, der Unverbesserliche des ancien régime, begann von neuem auf der Geige die Schmeichelweise Mozarts zu streichen, ganz piano ....., leise lachend ordneten sich etliche Paare, wie früher. Aber die kleine Zénobe wagte nicht, mit anzutreten. Sie weinte vor Schreck und meinem Großvater war es gar nicht um den Tanz mit der Zofe. Er drehte ihnen allen, schwerblütig fortwandelnd, den Rücken.
Das war die denkwürdige Menuett gewesen, die der bürgerliche Kapitän Primus Thaller in einer Reihe mit einem hochansehnlichen Adel getanzt hatte.
[144] Es war die letzte Menuett des Rokoko gewesen, mitten in ihrer graziösen Süßigkeit zerrissen durch den Ruf des Jakobinertribunals. In eigenartig gemischter Betrübtheit stieg Herr Kapitän Primus wieder in den Tag hinauf und auch die kleine Blanchefleure verließ ihr Gefängnis, um vor Gericht zu treten.
Dessen Barriere glich einem Branntweinschanktisch. Vier oder fünf unordentliche Rohlinge lauerten dort, schmutzig und bösartig wie gesträubte Bauernhunde.
„Bürgerin Blanchefleure Massimel? Witwe?“ knurrte sie einer an.
„Da Sie es so wünschen — — —“
„Vom ehemaligen Hofstaat der Bürgerin Antoinette Capet?“
„Wessen? Der Königin, wollen Sie sagen?“
„Ach, so? Notieren Sie das genau, Bürger Pouprac! Königin sagte sie.“
„Ich denke, das genügt schon,“ murrte Pouprac gleichmütig. Dann aber sah er boshaft auf. „Warum lächeln Sie, Bürgerin? Sie beleidigen das Gericht damit! Warum lächeln Sie?“
[145] „Mein Gott, wie sehen Sie denn aus!“ platzte die arme Blanchefleure tiefrot im ganzen Antlitz hervor. „Wenn man solche Pantalons anhat wie Sie!“ Und sie drückte die Hände vors Gesicht und lachte wie ein dummer Backfisch.
Pouprac warf einen Blick auf seine Hosen aus blau-weiß-rotgestreiftem Kattun, auf diese stolze Flagge und Schaustellung seiner republikanischen Gesinnung. Dann sprang er wütend auf seine beiden nationalgetigerten Beine: „Sie sind des Todes schuldig, Bürgerin Massimel,“ brüllte er. „Des Todes wegen Beleidigung der französischen Nationalfahne!“
Da zog die kleine Marquise die Hände von ihrem Antlitz und sah ihn an, hohe, erstaunte, drollige Augenbrauen, gerümpfte Nase: „Sie, Sie wollen mich richten! Waschen Sie sich und ziehen Sie Strümpfe an, bevor Sie mich nur bedienen wollen!“
Und sie ging. Sie hatte sich auf das Schafott gelacht.
Mein Großvater hörte nur noch von ihr, wie sie nicht zulassen wollte, daß man ihr die [146] Haare abschneide. „Meinen Sie,“ hatte sie den Gerichtsbeamten gefragt, „daß das unbedingt nötig ist? Der Mann auf dem Gerüst kann sie gebrauchen, um das Haupt daran in die Höhe zu heben: — nachher; wie das so eine Ihrer Gewohnheiten sein soll.“
Und als der Sansculotte mit grober Kürze darauf bestand, hatte sie die lieblichen Schultern gezuckt: „Meinetwegen. Ich wußte schon, als Sie kamen, mich zu köpfen, daß Sie keinen ästhetischen Sinn haben. Und ich habe recht behalten.“
Nach diesen letzten, befreit geistigen Worten starb sie aber dennoch als armes, zitterndes Weib.
Sie starben und alle, die um sie hätten weinen können, waren tot oder hatten an das eigene Sterben zu denken. So verstand keine Seele, was mit der schönen Blanchefleure zu Ende gegangen war, die ihr Lebelang recht behalten hatte.
Auch mein armer Großvater hat sie nie verstanden.
Nur ich, nur ich! Ich verstehe sie, der ich [147] ihr Bild erst vom Trödler loskaufen mußte, wie zur Rache des Nachgebornen an der, die durchaus nicht seine Urgroßmutter werden wollte.
Gut, daß sie es nicht wurde. Sie ist dabei jung geblieben, ewig jung und begehrenswert.
Und ich darf sie lieben, wie der ehrliche Primus Thaller sie liebte, nur besser noch: Verständiger, luxuriöser.
Sie hatte in allem recht und ich sehne mich nach ihr ...


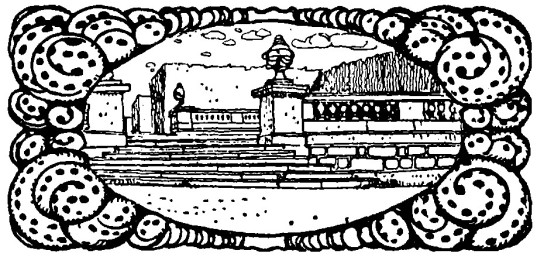
Es bedurfte in der Geschichte der Kultur des Herrn Chevalier von Landry, um zu beweisen, daß man, vom Königshofe Frankreichs an die frische Vogesenluft versetzt, sterben müßte.
Nur das Vorbild seines Oheims, des Kardinals und Erzbischofs von Straßburg, Rohan, hatte ihm vorläufig das Leben gerettet, jedoch nur auf kurze Zeit.
Rohan und der Chevalier waren vom Hofe weg nach dem Elsaß, dem ihrer Meinung nach brutalsten Lande der Welt, verbannt worden, in dem man kaum erst das Französische zu erlernen begann, geschweige denn die Sprache von Versailles. Die berüchtigte Halsbandgeschichte war schuld gewesen. Der [152] Kardinal und der Chevalier hatten beide die entzückend leichtfertige Königin sehr geliebt, und der Chevalier hatte gehofft, bald der Nachfolger des beschränkten Rohan in der Gunst Marie Antoinettes zu werden. Die reizende Geschichte war mit dem ärgerlichsten Skandalprozeß zu Ende gegangen, und weil der Kardinal in Bergzabern das Schloß seiner Väter aus größter Langeweile von neuem aufzubauen begann, folgte der Chevalier seinem Beispiel, den gewaltigen Versuch zu wagen, aus einem Stück Elsaß ein Stück Versailles zu machen.
Es war entsetzlich, zu Beginn der Verbannung!
Die Landry hatten ihren Stammsitz seit drei Generationen nicht gesehen. Großvater Landry, Vater Landry und Landry Sohn hatten, ähnlich den Seligen des Himmelreichs, im Angesicht des Königs Zeit und Ewigkeit vergessen. Louis quatorze, Louis quinze, Louis seize, vor jedem lächelte ein Landry, hinter jedem flüsterte ein Landry. Die Landry waren erbangesessen hinter dem oeil de boeuf. Alles, was ihnen von ihrem Vogesenbesitz bewußt war, [153] bildeten die hunderttausend Ecus jährlich: Hunderttausend fröhliche, leichtfertige Taler, die dem Elsaß gänzlich unnötig waren und die darauf brannten, an Karossen, Puder, Pferde, Sängerinnen, Samt, Tressen, Jagdpartien, Festschmäuse und Trinkgelder verwendet zu werden.
Und nun saß er, der erste Landry seit fast einem Jahrhundert, wieder auf dem Schlosse. Von der Wasserscheide der Vogesen bis weit ins ebene Land hinein gehörte ein Stück Erde ihm, schön, mild, reich und still wie eine Insel der Seligen. Er aber starb beinahe daran.
Er taufte sein Schloß um; er nannte es Schloß Patmos, weil Jean Evangeliste de Landry hier verbannt saß. Er, der niemals einen Berg erstiegen, ächzte dreimal die Woche zum Kamm der Vogesen empor, schaute nach Westen und wünschte im Graben der einzigen Straße Frankreichs sein Leben zu beschließen, der Straße von Paris nach Versailles.
Er sah sie: ein beständiger, leuchtender Königszug. Karosse an Karosse. Die hochfrisierten Damen mußten sich oft weit vorbeugen, [154] lachend oder vor Schreck aufschreiend, weil zwei Pferdehäupter hinter ihnen über dem Fond des Wagens nickten. So voll, so rauschend war der Verkehr. — Die ganze Straße war ein Trab, ein Geplauder, ein Lächeln, Winken, Nicken, sie war Frankreichs Salon, Stelldichein und einziger Ausflug ins Freie zugleich.
Nach einiger Zeit lernte Herr von Landry infolge der vielen Seufzer die Bergluft atmen und sie machte ihn etwas stärker. Er sagte mit einem Teil jenes Trotzes, der die Landry vor über hundert Jahren geziert hatte: Schön: Kann ich nicht nach Versailles kommen, so soll Versailles zu mir kommen. Hunderttausend Taler Rente bedeuten hier mitten in der Naivetät dieser Gegend das Dreifache. Ich will mir meine eigene Hofhaltung schaffen.
Nach einem Jahr stand Schloß Patmos da, wie aus Zucker und Tragant gebildet. Herr von Landry lud ein, was jemals im Leben einen Strahl von Versailles erhascht hatte, und ein unendlicher Jubel entstand unter dem französischen Pfründenadel zu Straßburg. Ach, [155] wie atmeten diese Franzosen auf! Mit den Elsässern war keine Anspielung und kein Lächeln zu tauschen. Sie verstanden kein Parfüm, keinen Schnitt, keine Mode, kein Kompliment und keine Bosheit. Eine reich bezahlte Stelle und ein sorgenloses Amt hatte viel entzückende Leute nach diesem Straßburg gelockt. Voll tanzender Hoffnung waren sie gekommen und sahen hier Menschen mit Rosetten an den Hosen, mit ungepudertem Haar, ja sogar Menschen in Stiefeln, Menschen, die den Hut dazu mißbrauchten, ihn auf den Kopf zu stülpen, statt ihn unter dem Arme zu tragen. Es waren hier Leute, die nicht einmal wußten, den Spazierstock graziös auf den Boden zu setzen, geschweige denn ihre Beine. Alles war aus!
Da eröffnete ihnen dieser schwermütige Halbgott Landry sein neu umgebautes, zuckernes, filigranes und brokatnes Patmos. Ein kleines Versailles, neuester Mode. Ach, die Welt war wieder wohnlich!
Es kamen in Scharen, die es mit Grazie verstanden, unnütz zu sein. Nicht ein Zimmer im Schlosse war unbesetzt, und was von den [156] Bewohnern nicht dem Adel angehörte, war mindestens Blumenstaub aus der feinsten Blüte des geistigen Frankreich. — Dichter, Musiker, Philosophen und zwei Maler waren von Paris verschrieben worden. Das leichte Geistesvolk weilte gern in Patmos. In Paris war große Rivalität und allzuviel Angebot; hier schmückte es Schloß und Park wie Halbgötter auf ehrfurchtsvollen Postamenten.
Nun hatte man schon das zweite Jahr im ältern Versailler Stil Konversation gemacht, hatte musiziert, getanzt, Komödie gespielt, gejagt und geliebt, da fuhr der Schreck in Herrn von Landry, ob man in Paris und Versailles nicht inzwischen längst eine neue Mode hätte?
Es war ein großes Wagnis; er fuhr trotz des königlichen Verbots in einer sehr vollkommenen Verkleidung nach Paris; als ein deutscher Gelehrter, um dort von den Intimsten seines Briefwechsels zu erfahren, wie man inzwischen seine Kleider, seinen Geist, seine Perücke und seine Gefühle trug.
Da ward ihm eine große Überraschung. [157] Schon seit Herr Benjamin Franklin dagewesen war, versuchte man sich ein wenig in Aufrichtigkeit; nun aber war Herr Jean Jacques Rousseau unwiderstehlich in Mode gekommen, und man spielte geradezu Natur! Man versuchte die Natur genau so zu sehen wie Herr Rousseau und entdeckte hiedurch mehr als ein Dutzend ungeahnte, gänzlich neue Gefühle. Ganz Paris und Versailles waren entzückt. Der König schob eigenhändig einen Bauernkarren aus dem Dreck, die Königin buk eine Omelette, ja Madame de France spielte einmal den guten, aufrichtigen Bauern unter der Dorflinde auf der Geige zum Tanz auf. In allen Salons bewunderten sie das Gefühlsleben der Kohlenbrenner und Wilddiebe, und der Herzog von Orléans brach in Freudentränen aus, als er in dem Dorfe Saint Léger ein bäurisches Ehepaar streiten fand und hierbei die erste Ohrfeige sah und hörte.
Mit einem köstlichen Gefühl eilte Chevalier Landry nach dem Elsaß zurück und brachte der reizendsten aller Gastgesellschaften den unerhörten Vorsatz mit, sie werde sich von nun an [158] der Natur gemäß zu verhalten und zu unterhalten haben.
Herren und Damen überboten sich von da ab in Erfindungen und Entdeckungen, aber vollkommen wurde man erst, als der Chevalier zur größten Ergötzung der erlauchten Gesellschaft ein Naturkind eingeladen hatte, das die Feinheiten der übrigen vergangnen Moden noch gar nicht erst kennen gelernt hatte.
Das war ein deutscher Jüngling.
Hans Georg von Hirschbach kam aus dem Thüringer Walde und hatte soeben in Straßburg die Philosophie zu Ende studiert. Er war ein Prachtjunge, aber nur für Deutschland. Aufmerksam und nachdenklich, von einer zusammengehaltenen Resolutheit, etwas schweigsam, etwas einsam, etwas holperig. Er hatte eine warme, tiefe, herzliche Stimme, lachte stets nur aus Freude und nie über Bosheiten, schlug und balgte sich ein wenig gern, scheute sehr die Damen, war hellbraun, krausköpfig, stämmig und hatte einen festen Nacken, schiefgeneigten Kopf, starke Stirne und starke Kinnbacken. Sein Teint war kräftig wie Roggenbrot, [159] sein Gang etwas werfend und schleuderhaft, wenn er allein die Landstraße maß, und höchst befangen und stolperbedroht in Gesellschaft.
Er hatte zu Hause nichts getrieben als Vogelfang und Pirschjagd. In Straßburg war er ein bißchen im Fechten, Schießen und Reiten fortgefahren, hatte das Zechen, das Singen und Radaumachen erlernt, war dann über die Bücher geraten und hatte sich mit seiner ganzen Waldburschenseele dem Shakespeare verschrieben.
Und gerade Hans Georg geriet in die diskrete, lächelnde, wespenboshafte und bis zum Überschwang liebenswürdige Gesellschaft im Schlosse des Chevaliers Landry!
Er geriet mit Wissen und Willen seiner Mama hinein, die außerordentlich viel auf die feingeschliffene Kultur von Versailles gab. Hans Georgs Mama war zärtlich, geistvoll, belesen und sprach das delikateste Französisch, alles mitten im Thüringer Wald. Sie wünschte sehr, daß ihr Sohn diese Eigenschaften von ihr geerbt haben möchte, die er an einer bessern Stelle verwerten sollte. Ihr Bittgesuch hatte [160] der alte Freund der Familie, ein Straßburger Gelehrter und Gast Landrys, dem Hausherrn von Schloß Patmos gebracht und eine Einladung voll Honigseim erfloß nach Straßburg „an den Chevalier Jean de Hirsbac“.
In der Fahrpost, in welcher der junge Thüringer nach dem Schlosse fuhr, saß nur noch eine Reisende, nebst unermeßlich vielen Koffern und Schachteln. Diese Dame war so jung, so graziös, so schön und in jeder Bewegung so sicher, daß Hans Georg vor Scheu fast die Beine unter sich auf den Sitz gezogen hätte. Denn es waren Beine, die in Stulpenstiefeln steckten, was ihn zum erstenmal sehr genierte. Wenn man zierlich sein wollte, dann trug man ohne Nachsicht Kniehosen und Seidenstrümpfe.
Er fürchtete sich vor ihrer Bekanntschaft. Er betrachtete sie lange Zeit nur ganz versteckt, gelegentlich aus dem Profil hinüberhuschend. Sie war königlich blaß, hatte eine kapitale Frisur, breiten Hut à la Schäferin, eine wunderbar reine Stirn, und der Mund wie das Profil waren fein und von gefaßtem Schwung. Die Augen hatte sie durch die stolz und nachlässig [161] geschlossenen Lider verdeckt, aber man sah durch diese zarten Lider, daß sie tief und groß und braun waren.
Das wird eine respektvolle, traurige Reise werden, dachte der junge Hirschbach, zog die Füße nach hinten, legte die Hände gleichmäßig auf die Knie und schaute den wundervollen, bläulich violetten Lichtreflex auf dem ungepuderten schwarzen Haar der jungen Dame an, der direkt vom Himmel durch das Fenster auf sie kam, bei jeder Pappel am Weg aufhüpfte, bei jeder Sonnenbiegung mit Goldbraun tauschte und langsam unter dem puderfeinen Straßenstaub erstickte.
In Molsheim fragte er den Postmeister, ob er über Schloß Patmos etwas wisse.
„Wir nennen es anders,“ sagte der Postmeister mürrisch. Der Herr von Landry war bei Bürger und Bauer gleich unbeliebt. Alles Geld ging nach Paris, die Handhabung der Gerichte war von den ärgsten Mißbräuchen begleitet, und die Bauern wurden von den Pächtern auf das empörendste ausgesogen, denn Landry brauchte entsetzlich viel Geld und [162] kümmerte sich trotz seines weichen Herzens ganz und gar nicht darum, woher es kam. Er wußte gar nicht, daß Geld manchmal sehr schwer wog, Lebenskraft und Blut bedeutete. Für ihn war der Louisdor eine Spielmarke.
Die Dame im Fond des Wagens blickte auf. „Ah, Sie wollen nach Patmos?“
„Ja, Madame,“ sagte der gute Junge ängstlich, da er soeben für den Postmeister eine Grobheit fertig hatte und nun nicht wußte, wohin damit.
„Als Gast?“
„Ja, Madame.“
„Da sind wir Kameraden.“
„Sie auch, Madame?“ Und Johann Georg Freiherr von Hirschbach übersetzte sich, seinen Namen und Titel ins Französische und stellte sich vor.
„Ei, Herr Baron. Und Ihr Alter?“
„Vierundzwanzig.“
„Nur?“ sagte die schöne Dame bedauernd. „Ich bin schon zwanzig. Ich habe auch schon sehr viel erlebt, denn ich bin Witwe.“
[163] „Ach, gnädigste Frau,“ rief der gute Georg in vorwurfsvollem Bedauern.
Sie erzählte kurz und ruhig ein wenig von ihrem Mann, der sehr alt, sehr elegant und graziös gewesen war. Herr Vicomte de Maintignon. Sie selbst heiße Dorette. Der Vicomte war stets leise parfümiert, stets zärtlich, von immer gleich gelassener Heiterkeit, zeigte es nie, wenn er krank war, liebte die Fröhlichkeit und sagte ihr einmal sehr unvermittelt: „Mein Kind, lebe lang und amüsiere dich,“ neigte sich danach hinten in seinen Stuhl und starb lächelnd, die letzte Prise Schnupftabak noch in der herabsinkenden Hand, welche von den zierlichsten Manschetten umrahmt war, die man in jenem Jahre trug.
Der junge Hirschbach stieß einen leisen Ruf der Hochachtung vor solcher Kultur aus und meinte, daß er selbst sich wie ein Wilder vorkäme. Die Dame lächelte und die weitere Fahrt ward sehr angenehm, da der junge Thüringer sehr schnell seine Scheu verlor. Es war das die Schuld ihrer Stimme; früher, beim Betrachten ihrer klar geschwungenen Linien [164] hatte er eine metallkühle, klavierharte Altstimme von ihr erwartet. Aber nein. Ihr Organ war weich, verdeckt und zutraulich; nicht hoch, aber warm.
Als zwei gute Freunde kamen sie in Patmos an und brachten den Kammerdiener des leichtfertigen Grafen in siedend heiße Verlegenheit. Es stand nämlich nur mehr ein Mansardenzimmer frei.
Die beiden unten im Flur hörten die Stimme des sorglosen Landry auf dem Balkon über der Einfahrt, von dem er ihnen schon entgegengewinkt hatte: „Aber dieses Mansardenzimmer hat ohnehin zwei Betten!“
„Gewiß,“ zögerte der Kammerdiener, „jedoch Madame de Maintignon und dieser junge Deutsche ...“
„Seht doch, sind sie nicht einen Tag lang in derselben Postkutsche gefahren?“ fragte der Graf.
„Allerdings, aber —“
„Vor dem Auge der Natur sind Tag und Nacht gleich. Wir dürfen hier in Patmos der Natur keine Schande machen.“
[165] Von den beiden Leuten unten war eines tief dunkelrot geworden, und das hieß Johann Georg. Er sah nach Dorette hinüber und nach ihrem ruhigen Lächeln.
„Madame!“ flehte er.
Dorette zuckte die Achseln. „Man hat jetzt diese Sitte, natürlich zu sein,“ sagte sie. „Ich, ich fürchte viel zu sehr, mich lächerlich zu machen, und finde überdies nichts Arges an dem Gedanken des Herrn von Landry. Hören Sie doch nur, daß man Kammerdiener sein muß, um Einwendungen zu machen.“
In der Tat erklang nochmals die verschüchterte Stimme des Dieners: „Ob aber die Dame einverstanden sein möchte?“
„Daß ihr beschränkten Tölpel auch gleich immer an das Schlimmste denken müßt,“ rief Landry. „Geh hinunter und du wirst sehen, daß sie sich als Leute von Welt gar nicht zieren werden.“
Wirklich machten weder die Dame noch der junge Baron aus Deutschland eine Einwendung. Sie begrüßten bald danach den Grafen, der sich mit der Abendtoilette etwas [166] verspätet hatte, im großen Salon und trafen ein Bürschlein von etwa zwölf Jahren bei ihm, sorgfältig frisiert, gepudert, Hut und Degen auf einem Tisch und ein aufgeschlagenes Buch vor sich. Es war ein außerehelicher Sohn des Kardinals Rohan, den Landry bei sich hatte.
Da Madame de Maintignon an ihrem Reifrock einen Schaden bemerkte, der beim Aussteigen durch Darauftreten eines Hirschbachschen Stiefels entstanden war, stellte Landry seinen Cousin dem jungen Deutschen zuerst vor.
Das kleine Herrlein machte eine Verbeugung, schlank, biegsam, fein und weltmännisch zum Staunen. „Sie beehren mich zur besten Stunde, mein Herr,“ hub er an, „da ich gerade des Tacitus Germania las und Sie mir also Gelegenheit gewähren, Ihnen meine Bewunderung für Ihre Vorfahren auszusprechen, und Ihren Vorfahren meine größten und entzücktesten Komplimente über einen Erben ihrer Tugenden zu machen, wie Sie es sind, mein Herr!“
Der gute Johann Georg stand wie vor einem Mirakel. Wenn ein zwölfjähriger Knabe also [167] mit ihm begann, wie würde er den Erwachsenen antworten müssen? Dorette war es, die ihn durch eine rasche Zwischenfrage des Stammelns und Suchens überhob.
Sie kam herbei und sagte freundlich: „Wie glücklich sind Sie, mein Herr, die Gedanken der alten Klassiker Ihr eigen nennen zu können. Darf ich fragen, welche von jenen bewundernswerten Dichtern sich schon Ihr Herz zu gewinnen verstanden?“
„Seit Sie vor mir stehen, Madame,“ sagte der Knabe mit einer reizend gespielten Verlegenheit und einem zärtlich schüchternen Blick, „weiß ich mich an keinen mehr zu entsinnen; es — es müßte denn Anakreon sein.“
Johann Georg machte, daß er davon kam. Er hatte eine Heidenangst vor den Überirdischen dieses Schlosses bekommen, die er noch kennen lernen würde.
Aber nein; es wurde reizend.
Johann Georg ward noch am selben Abend von den Damen umdrängt wie ein reifes Obstbäumlein, und sie hätten ihm sehr heiß gemacht, wenn nicht die großen Reifröcke gebieterisch [168] einen weiten Kreis bedingten, so oft nur vier oder fünf der reizenden Geschöpfe sich um ihn gruppieren wollten.
Herr von Landry hatte ihn als Meister in der Natur vorgestellt, und Johann Georg war überglücklich, den entzückten Schönen von den Köhlern des Thüringer Waldes, vom Hörselberg und vom Vogelfang mit Sprenkel und Dohne erzählen zu können. Alles war vor solchen Neuigkeiten außer sich: Johann Georg kam aus einer gänzlich andern Welt.
An diesem Abend standen herrlich getürmte Wolken fern über den Auen des Rheins, und die verliebte Abschiedsglut des Untergangshimmels jenseits vom Wasgau warf ihnen Rosen über Rosen hinüber. Formvoll und massig standen sie, ein Gekröse von Blaßblau, Veilchenhauch, Pfirsichblüte und zartem Fraise.
„Dort oben ist Traumburg und Schloß Glück. Dort wohnen die Seelen aller Gefangenen, und um die Taubenschläge dieser Luftschlösser fliegen als Vögel die Seufzer der Liebe, des Heimwehs und der Freiheit.“ Hans Georg hatte es leise zu Demoiselle Eliante gesagt [169] und dabei sehnsuchtsvoll nach Madame Maintignon geblickt, die heute Nacht mit ihm das Zimmer teilen würde. Aber die lebhafte Eliante schlug einen silbernen Jubel auf, rief das ganze Schloß herbei und erzählte ihnen, Wort für Wort, die wunderbaren Sätze des wilden, schwermütigen Waldjungen, der sich für einsame Stunden solchen Stil als eine Mischung von Shakespeare und Ossian angewöhnt hatte.
Die schöne Heloise brach in Tränen aus, die stolze Amante mit der stählernen Stimme rief „herrlich“, die zärtliche Céleste warf ihm einen süßen, schmachtenden Blick zu, und Glycère, die leise Zweideutige, flüsterte: „Ich gestatte Ihnen, Herr Baron, für dieses entzückende Gedicht noch kühnere Träume, als dort oben in den Wolken möglich sind.“
Frau Dorette neigte ganz reizend den hochfrisierten Kopf, der jetzt blühweiß vor Puder wallte, und sah ihn links an und sah ihn rechts an. Dem armen Jungen schwoll das Herz im Leib zu unerträglicher Größe an.
Nach Mitternacht dann führte er seine [170] Dame mit zitternden Knien und würgender Kehle in ihr Gemach.
Dort sah es inzwischen seltsam aus. Mitten durch das Zimmer war eine starke Kordel in Mannshöhe gespannt und daran hingen Reifröcke: fünf Reifröcke, einer hart an dem andern. Sie bildeten eine Mauer von sechs Fuß Dicke und waren undurchdringlich für jeden Blick. Madame Dorette schlüpfte dahinter und sagte dann: „Adieu, mein Freund. Erzählen Sie mir, bis ich eingeschlafen bin, hübsche Geschichten, und sodann gute Nacht.“
Der arme Georg setzte sich auf sein Bett, zog die Strümpfe herab und begann von Tannhäuser zu berichten, der im Venusberge mehr schöne Dinge erlebte, als ihm angenehm war. Er hörte hinter der Rockwand ein leises Schlürfen, ein Knistern von Seide, ein Rascheln von Wäsche und das Knicken eines Bettes. Als er eben Beziehungen zwischen dem glücklichen Sänger und seiner eignen, unfruchtbaren Lage beginnen wollte, hörte er den leisen, schnellen Atem der schönen Dorette. Sie war eingeschlafen.
[171] Er zerwarf und zerwühlte noch lange Zeit sein Lager. Endlich strafte er seinen bangen Durst, verehrte Dorettens Reinheit, verhielt sich still, dachte, sie ist ein Engel; ich will ihrer würdig sein, und schlief ein.
Am anderen Tage verzog er sich leise und schnell aus dem Zimmer, um Dorette bei den heiligen, langen Stunden der Toilette nicht zu stören. Im Garten weilte noch keine Seele, denn sie standen im Schlosse vor zehn Uhr nicht auf. Da setzte er sich auf die wölbige Rasenbank vor dem Bassin bei der arkadischen Tempelruine und horchte dem Rieseln des Wasserfädchens zu, das aus der moosgrünen Urne eines verliebten Götterpaares lief. Da seine Nachtruhe kurz gewesen war, schlief er wieder ein und wurde erst von dem verwunderten Gelächter eines ganzen Taubenflugs junger Damen und Herren geweckt, die eine halbe Stunde vor Mittag den schattigen Weg daherkamen.
„Reizend,“ sagte Landry. „Er hat recht, auch wir halten von heute ab nach dem Frühstück eine Siesta im Grünen.“
[172] Georg war sehr froh, daß sie ihn überrascht hatten. Wie, wenn er etwa gar mit Dorette am Arm vor die Gesellschaft hintreten hätte müssen? Nun hielten sie doch alle Dorette für seine Geliebte!
Aber kein Mensch schien sich viel um das kleine Ereignis zu kümmern; kaum daß ihn die zweideutige Glycère mit einem leisen Blitzlein unter seinen Augen prüfte. Der Deutsche erkannte bald, daß es überhaupt nur Pärchen gab auf Schloß Patmos. Diese behandelten sich zart und fein wie höfliche Fremde und nannten sich mit solch milder Ruhe „Sie“ und „Freund“ und „Freundin“, daß nur eine starke Neugierde vermocht hätte, hier mehr als bloße Kameradschaft zu erkennen. Aber es schien niemand neugierig; vielleicht, weil man genau wußte: Alles ist, wie ich bin.
Nur dieser Deutsche ahnte nicht, was die Mode über Menschen vermag. Das Kind Shakespeares glaubte wahrlich selbst hier noch an originale Charaktere und an Individualitäten!
Der heitere Landry nahm ihn ein wenig [173] beiseite und ließ Glycère, seine Freundin, mit der schönen Dorette in den Park ausschwärmen. „Heute nachmittag ist ländliches Fest,“ sagte er zu seinem Gast. „Besitzen Sie irgendein bukolisches Kostüm? Bauer, Schäfer oder ähnliches?“
„Ich habe meine deutsche Jägertracht,“ gestand der junge Baron zögernd.
Landry lachte. „Wo denken Sie hin, mein Freund? Ein Galarock, das geht doch nicht!“
„Ach, da ist nichts von Frack und Parforcepeitsche dran,“ erklärte ihm Georg. „Sehen Sie, teurer Chevalier, die französische Jagd, das ist die Jagd der Geselligkeit. Die deutsche Pirsch, das ist die Jagd des einsamen Träumers. Wir sind gekleidet wie das schattenleise, graue Wild, wie der tausendjährige Baumgreis, wie der uralte Fels. Wir fühlen uns am geselligsten, wenn wir allein sind; denn dann sind wir den stillen Geschwistern nahe; dem Busch und dem Stein, dem kleinen Waldestümpel, diesem dunklen Auge der träumenden Berghöhe, um das die scheuen, nächtigen Wildfährten geschrieben sind, die wir lesen als die [174] Schrift der Natur. Wir wissen alles, von der leisen, huschenden Dämmerungsvogelliebe in den Nächten Oculi und Lätare, bis zu den verschwiegenen Winternächten des Fuchses, von der Erregung des Rehs bis zu dem wilden Aufschrei des eifersüchtigen Hirsches. Wir hegen und pflegen diese Liebe und töten nur zögernd, als Bevollmächtige des großen Zeugers und Zerstörers allen Lebens. Bis in die Seele des Wildes schleichen wir, in sein geheimstes Weben. So sind wir einsam und dennoch reich gesellt.“
„Ach,“ rief der eifrige Landry, „das ist köstlich, das müssen Sie uns lehren. Bitte, zeigen Sie mir doch jenes waldfarbene Kostüm!“
Der junge Hirschbach nahm seinen Wirt mit sich, und während Landry schwermütig in den Anblick des Walles von aufgehängten Reifröcken versank, hinter dem sein junger Freund so glücklich sein mußte, packte der junge Deutsche sein graugrünes Jägerkleid aus.
„Wenn Sie gestatteten, daß ich mich darin sähe?“ bat Landry.
[175] Lachend half ihm Georg beim Anlegen jener Stücke.
Landry war ein schöner Kerl, und das schlichte Grau und Grün mit dem Federgesteck saß ihm keck und fein zugleich. Es ließ ihn frischer und dennoch nachdenklicher erscheinen, und mit unverhohlener Liebe besah sich der Chevalier in seiner Verkleidung vor dem Spiegel. Dann ging er in den Park, um von seinen Gästen lauten Jubel zu ernten. Er verkündete die entzückende Neuheit der deutschen Jagd. „Denken Sie sich, meine Freundinnen, es gibt da eine Methode, die heißt ‚der Anstand’. Diese werden wir üben, in den Vogesen. Jeder von den Messieurs nimmt sich die Dame, der es gefällig sein wird, und übt mit ihr in den stillen Hainen den Anstand. Sie sehen,“ wandte er sich zu dem entsetzten Hirschbach, „welche Reize wir Ihren Jagdmethoden abzugewinnen verstehen.“
„Aber so wird die Methode ganz erfolglos sein, ohne jede Beute,“ rief Georg.
„Meinen Sie,“ lächelte Landry.
Der arme Junge errötete. „Ich meinte, vom [176] Wilde werden wir nichts sehen, noch hören,“ verbesserte er sich.
„Ach, das ist doch Sache der gemeinen Jägerei,“ tröstete der Schloßherr.
So wurde entzückend viel Natur getrieben in den Waldhöhen über Schloß Patmos. Landry selbst war unerschöpflich in neuen Entdeckungen und sorgte eifrig, daß man dem lieblichen, schuldlosen Urzustande, wie er sagte, möglichst nahe kam.
„Die Urnatur ist weder lieblich, noch schuldlos,“ seufzte Georg bei solch einem Geplauder ernst; aber da kam er schön an. Herren und Damen bewiesen ihm an der Hand Rousseaus, daß die Kinderjahre der Menschheit in rührendster Eintracht und Reinheit hingeflossen seien. „Sehen Sie doch unsere guten, demütigen, redlichen und einfachen Bauern an,“ riefen sie ihm zu. „Wie sind sie glücklich, wie naiv, zufrieden, fromm und dankbar!“
„Und wer wagt es, Ihnen das zu sagen?“ staunte der Deutsche, der einzige von der ganzen [177] Versammlung, der die Bauern heimgesucht, beobachtet und ehrlich mit ihnen gesprochen hatte.
„Aber mein Gott, sie selber,“ hieß es.
Zum erstenmal fühlte sich der Deutsche nicht mehr klein und bedeutungslos vor dieser leuchtenden Gesellschaft. Er schwieg und dachte sich sein Teil.
Den Nachmittag verbrachte er mit Madame Dorette allein im Walde. Sie verzagte vor jeder Wurzel und fürchtete jedes Bächlein. Er mußte sie heben, stützen, tragen, und nur sehr langsam erlernten die kleinen Füßlein auf ihren hohen Absätzen im weichen Grunde das Gehen.
Sie hatte Angst; sie schalt, daß diese Natur ungefällig, unverständlich, rauh, verschlossen und dornig sei wie ein Deutscher. Nur wenn er sagte: „Aber Madame, sie ist jetzt modern,“ dann seufzte sie, nahm sich glatt zusammen und sagte wieder aufgerichtet: „Es ist wahr, Sie haben recht, lieber Baron.“
Als sie müde war, nahm er behutsam ihr Köpflein in seinen Schoß und ließ sie da schlummern. Ach, er liebte sie schon ein wenig. Aber seine scheue Art wagte keine Kühnheit.
[178] Beim Schlafengehen war es wie gestern. Er berichtete von den Tieren des Waldes und brachte sie mit der köstlichen Fabel von Reineke Fuchs dreimal, viermal zum Lachen. Aber als er erzählte, wie Reineke die Wölfin im Eise festfrieren und an der Wehrlosen seine Liebe ausließ, da tat sie empört, obwohl sie hinter ihren Reifröcken vor Lachen fast erstickte.
„So etwas konnte auch nur ein Deutscher erfinden,“ rief die drollig zornige Stimme aus ihrem Versteck.
„Dorette,“ bat Georg.
„Ach, gehen Sie mir.“
„Dorette!“ flehte Georg.
Sie schwieg.
„Schönste Dorette!“
„Gut Nacht,“ sagte sie kurz. Bald darauf schlief sie, und der aufgewühlte Junge atmete sich vor Verlangen nahezu die Brust in Stücke.
Allen bekam die neue Mode der Natur in den nächsten Tagen sehr gut, nur der Deutsche wurde blaß und übernächtig.
Landry glaubte ihn warnen zu müssen, sich mit Maß an der Güte der Natur zu freuen, [179] und Georg hätte beinahe vor Schmerz aufgeschrien. Jedoch schwieg er und überlegte: Was hat nur diese Dorette? Sie wußte, daß alle Welt sie für seine Geliebte hielt, und wurde es nicht.
Er machte sie darauf aufmerksam, was man von ihnen beiden dächte.
„Ach ja,“ lächelte sie, „aber man findet es äußerst nett, und ich hatte nie etwas dagegen, für nett gehalten zu werden.“
„Man, man, man!“ rief er verzweifelt. „Das ist ein Wort, das ich nur in Frankreich hörte und das mich tötet! Ich habe noch nie von einem so unheimlichen Tyrannen und Dämon aller Welt gehört, wie Ihr Begriff ‚man’ es ist.“
„Man schreit eine Dame auch nicht so an,“ sagte Dorette ruhig. „Sie sind gar nicht mehr nett, mein Freund. Man erträgt alles mit heiterer Gelassenheit; auch die Liebe. Man verbirgt es, wenn man erregt ist, und schließlich tröstet man sich anderswo.“
„Der erste gute Gedanke, den dieses ‚man’ hat,“ fuhr Georg wild heraus.
Und er begann der schwärmerischen, kleinen [180] Heloise den Hof zu machen. Aber wie ein Schatten glitt deren bisheriger Freund, der kleine Vicomte Bareilles, zu der schönen Dorette hinüber. Er dachte, Georg wolle tauschen, und war hierüber sehr zufrieden.
Nun hatte der arme Junge es obendrein mit der Eifersucht zu tun.
Inzwischen lief die ganze Gesellschaft fröhlich weiter auf den Fährten der Natur. Landry vergötterte seinen naiven Gast, dessen seltsames Wesen er für feinste Berechnung und künstliche Mode hielt.
„Ich bin so glücklich,“ gestand er ihm. „Sie reißen mich bis zu den originellsten Entdeckungen und Erfindungen hin. Wir schmausen und tafeln im Grünen, wir tanzen im Mondschein wie die Elfen ihres maître Chequespire, wir leben gesellig wie die wilden Kaninchen. Nach dem Mahle schlummern wir im Rauschen der Bäume und Quellen und beenden unsere Verdauung im trauten Busch, zwischen nickenden Wiesenhalmen und auf dem von Mohnblumen errötenden Feldrain, bis in ihre letzten Konsequenzen. Es ist das meine [181] glücklichste Erfindung. Weiter kann man sie doch nicht treiben, die Natur. Nicht wahr, Freund meiner Seele!?“
Zum ersten Male seit langen Tagen lachte Georg aus vollem Herzen über die Bemühungen seines Wirtes, der Natur näher zu kommen.
Und Landry lachte eitel, silbern und glücklich mit ihm.
Dann aber kamen trotz des Juli lange Regentage über Schloß Patmos, und mit der Natur war es aus für alle, außer für den einsamen Deutschen. Der stieg hinauf in die eintönig rauschenden Bergwälder und schaute nach versiegtem Regen mit einer Seele voll Brudergrüßen über die stille Landschaft, über Waldberge hinter Waldbergen, aus deren Falten sich der geisterstille Wolkenrauch erhob und langsam über die Fichtenhöhen hinstreifend rückkehrte zu den ziehenden, grauen und weißen Geschwistern der Luft.
Da fragte er auch wohl bei den Bauern umher und fand nichts vom „bon villageois“, von dem die lächelnden Damen schwärmten. [182] Finsterer Groll, abwartende Tücke, verhaltene Drohung, das war die Stimmung gegen die Gesellschaft in Schloß Patmos. Dieselbe schlichte, fast bürgerliche Kleidung, die dort unten Madame Dorette über ihn die reizenden Achseln zucken machte, führte ihn hier näher an das Geheimnis der Volksseele.
Furchtbares brütete da.
Er warnte oft seinen Gastherrn, warnte Dorette und die andern, aber man schalt ihn: „Sie Geisterseher, Sie Mondbewohner, wollen Sie nicht schweigen und mit aller Welt vergnügt sein, wie es sich schickt?“
Da schwieg er, aber er ließ sich Zeitungen kommen. In dieser ganzen Gegend von Straßburg bis Metz, bis Toul, Verdun und Nancy umher gab es kein Dutzend Zeitungen. Wozu auch?
Wie hätte es Zeitungen geben sollen, wenn keine Ereignisse da waren, sie zu füllen! Man amüsierte sich allerorten auf gleiche Weise; das wußte jedermann ohnedas. Zwar war die Nationalversammlung schon einberufen, und der Volkszorn begann dumpf aufzugrollen. [183] Aber solange die Revolution nur theoretisch blieb, wurden die Journale sehr langweilig gefunden. Man wußte ohnehin besser über Menschenrechte zu plaudern als darüber geschrieben werden konnte.
Erst die abgeschlagenen Köpfe machten Zeitungen notwendig.
Und während der junge Hirschbach in tiefer Bewegung von der Erstürmung der Bastille las, zupften die Damen in der Langeweile der grauen Regentage Goldscharpie. Es war das ein beliebter Zeitvertreib und zugleich eine angenehme Gelegenheit für junge Mädchen, sich ein kleines Nadelgeld zu schaffen. Jeder Herr hatte die Pflicht, alle Goldtressen von veralteten Garderobestücken letzter und vorletzter Mode an die Freundin abzuliefern, und den ganzen Tag über zerrten die kleinen Händchen an den feinen Golddrähten und häuften ganze Hügel von der edlen, graulich gekräuselten Metallwolle, aus der die hellgebliebenen Fädchen blitzten, wie feine Kinderhaare.
Georgs Erzählung von der Erstürmung der Bastille erregte nur lebhafte Genugtuung.
[184] „Ach Gott,“ sagte Dorette, „nun endlich können diese Ärmsten auch etwas modern werden, und den Wald und das Land genießen.“
Die schöne Heloise schluchzte vor Rührung, und die Herren applaudierten vor Freude über die vielen erlösten Opfer der Tyrannei.
Als ihnen dann Georg von den Aufständen der Bauern, von erstürmten Schlössern, von Adelsmorden und rauchenden Feudaltrümmern erzählte, meinten sie allesamt: „Gott, müssen die es arg getrieben haben, daß sie den gutmütigen Landmann so schwer zu reizen vermochten!“
„Und Sie, Chevalier,“ fragte Georg den guten Landry, „fürchten Sie denn nichts?“
„Mein Gott, ich tat doch niemandem etwas,“ lächelte der glänzende Seigneur beruhigt, „und überdies muß man mit den Tugenden der Menschen rechnen.“
Als zu Paris die Menschenrechte verkündigt waren, gab man den Bauern der Gegend ein prachtvolles Fest mit Feuerwerk und warf nach dem Gelage Konfekt, Obst und Geld zum Fenster hinaus unter das Volk.
[185] Georg war nicht beim Bankett. Er beobachtete das Bauernzeug, das sich um den Abfall der übermütigen Tafel balgte.
„So gut haben die's da oben,“ murrte der eine.
Und ein andrer summte: „Wir werden das alles bald besitzen. Das Schloß ist nicht so fest wie die Bastille.“
Diese ganzen drei Wochen mußte der ärmste junge Baron in einem Zimmer mit der blassen Dorette schlafen. Seine Hoffnung und seine Verzweiflung stiegen und fielen in regelmäßigen Gezeiten; nur seine Liebe wuchs beständig.
Dorette, die hatte gar wohl bemerkt, daß die zärtliche Heloise in süß schmachtender Neigung zu dem hübschen Deutschen entglommen sei und bangte ein wenig um ihren braven Schlafkameraden, so hoch sie auch sonst auf ihn herabsah, als auf das Kind einer minderwertigen Rasse. Nur Georg merkte nichts. An einem milden, dampfenden Abende stand er mit Dorette und Heloise an einem Fenster und [186] hörte, wie auf den Dächern der Ställe ein Kater inbrünstig um Liebe sang.
Das Mädchen, der Georg sehr gut gefiel, brach in Tränen aus.
„Was ist Ihnen nur, liebste Heloise?“ fragte der arme Hirschbach bestürzt.
„Ach die Natur, diese Natur! Sie ist zu erschütternd,“ schluchzte Heloise.
„Ja, die Natur,“ seufzte der junge Deutsche und sah mit dem sanftesten Vorwurf die feine, kühle Dorette an. Der Kater sang weiter, und Dorette lächelte.
Am Abend dann, als sie wieder hinter ihrer Festung von Reifröcken zu Bette gegangen war, bat er innigst, sie in allen Ehren besuchen zu dürfen.
„Da Sie mir das Wort eines Edelmanns verpfänden, nun denn, kommen Sie, mein Freund.“
Dorette in ihren Kissen, den Arm auf dem Herzen, im milden Rot der Ampel war schöner als je, und schluchzend fiel der arme Junge vor ihrem Lager auf die Knie.
„Ach, Madame, ich liebe Sie derart, daß [187] es mich verbrennt und auffrißt; und Sie, Sie machen sich gar nichts aus mir. Sie sehen mich wie einen Knaben an und darum, ja nur darum lassen Sie mich auch hier sein. Was ist es, das Sie so kühl gegen mich sein läßt!?“
„Sie sind so unmodern, wenn Sie erlauben, daß ich eine so schwere Sache ausspreche,“ seufzte Dorette und sah die Amoretten und Schäfer auf dem Plafond an, die sich geradezu frei benahmen.
„Aber Landry ruft mich doch als neueste Mode aus.“
„Ja, das ist im Wald und auf der Flur. Aber im Salon, mein Lieber! Diese drei Wochen Regen taten Ihnen sehr viel Schaden. Ich hätte Sie fast ein wenig lieb gewonnen, weil es wirklich schien, als seien Sie der Neueste des neuen Tages. Aber, mein Freund, Sie tragen eine Kleidung wie ein tüchtiger Kaufmannssohn, — die Locken sind nur lose gewickelt, das Haar zu schwach gepudert, und Sie erfinden eine Sprache, als ob die Académie française sich seit 1750 umsonst bemüht hätte; — eine Sprache voll altertümlicher Kraftworte, [188] wie ein Musketier Ludwigs des Dreizehnten. Mein Freund, das tut man nicht. Sie kompromittieren geradezu mich.“
„Soll ich Sie denn wirklich jenem Vicomte Bareilles überlassen und mein Glück bei Heloise versuchen?“ verzweifelte Hirschbach.
Dorette stützte sich plötzlich auf den schönen Arm und sah ihn tief und reizvoll an. „Wenn Sie es vermögen?“ sagte sie mit dunklem, warmen Ton.
Nun warf der Ärmste alle Fassung von sich, drückte den heißen Kopf, der voll tobender Gedanken war, gegen die Decke seiner Freundin und begann haltlos und erbärmlich zu weinen.
Sein Schluchzen und sein Zucken durchrieselten Madame als ein ungeheures Kompliment. Sie hatte einen Hauch, eine Ahnung von Zärtlichkeit für diesen Jungen, und sein Schmerz tat ihr unendlich wohl.
„Ah,“ sagte sie. „Hier dürfen Sie weinen. Hier dürfen Sie es, da niemand Ihnen eine Fassungslosigkeit zu verzeihen hat.“
Und die feinnervige Frau fing mit allen Poren den süßen Schmerz ihres jungen [189] Freundes auf und trank ihn, endlos geöffnet, in dürstender Schweigsamkeit. Sie zitterte leise vor rieselndem Wohlsein, und es war ein narkotischer Zauber, köstlich wie kein zweiter. Nie hatte ihr Liebe so gut getan, und sie ließ den Glühenden und Fiebernden über sich weinen, bis leise Lähmung über beide kam.
Halb in Zorn, halb in Hoffnung richtete sich Georg auf, als sie ganz still blieb. Schlief sie oder verstellte sie sich? O, wenn sie sich verstellte, dann war es ein Glück ohnegleichen. Angstvoll betrachtete er ihre durchscheinenden Lider und die wundervollen Wimpern. Zuckte sie nur einmal, so war sie wach.
Aber nein; Madame Dorette schlief. Süß und vertrauensvoll.
Da bettete er sich zu ihren Füßen wie ein Hund.
Am nächsten Morgen erlaubte sie ihm einen leisen, flüchtigen Kuß, und das war alles. Auch durfte er nie mehr zu ihr kommen. Er hatte sie das Gruseln gelehrt.
Nach dieser Lektion bemühte er sich, einen vollendeten Kavalier aus sich zu machen. Als [190] nach einigen Tagen die liebe Sonne wieder so innig aus blauem Himmel lachte, als wäre sie froh, nun endlich wieder das wunderliche grüne Erdensternlein zu küssen, da erschien der Herr Baron Johann Georg von Hirschbach in gänzlich neuer Verfassung auf dem Blumenparterre vor dem Schlosse. Er war angetan wie des Königs feinster Hofmann und strahlte vor Seide schöner als ein Nußhäher im Brautkleid. Gottes allerblaueste Seidenstrümpfe, die himmelfarbigsten Culots und die gelbbrokatenste Weste der ganzen Schöpfung umschlossen ihn; er war frisiert wie ein Dauphin, und sein Frack warf nach allen Seiten die stolzen Lichter verschwendungsjubelreicher Goldtressen.
Alle Damen brachen in ein entzücktes „Ah!“ aus, und Dorette blieb lächelnd stehen und sah ihn an wie eine neue, allergnädigst begrüßte Bekanntschaft.
Die kleine Heloise wäre beinahe abermals in Tränen ausgebrochen. Zur Unzeit aber geriet Eliante, es war die mit dem perlenden Lachen, auf eine reizende Idee. Kein Mensch [191] wußte, woher sie so schnell ihren Arbeitsbeutel hatte, aber sie wischte eilig mit ihrer Schere hervor und trennte dem Herrn Baron die schönste Tresse vom Rocksaum.
„Goldscharpie, Goldscharpie! Wie reizend!“ riefen alle jungen Damen durcheinander und stürzten sich auf Hans Georg. Ihre Reifröcke bogen sich aneinander und knickten, aber jede wollte die erste sein. Wie ein Gnadentum von heilwütigen Pilgern, so ward er am Kragen, an den Schultern, Schößen und Taschenklappen erfaßt und begeistert hin und her gezerrt. Die kleinen Scheren knippten behende, und in einem Hui war der Herr von Hirschbach tressenlos. Wie ein Flug Vöglein um einen Bussard waren sie herangezwitschert gekommen und wieder verflattert, — und kahl und gerupft stand der gute Deutsche da.
Dorette hatte die Arme sinken lassen, als die reizenden Freundinnen sich ihres Kameraden bemächtigten und hatte untätig und lächelnd zugesehen. Nun bekam sie den ersten, verlegenen Blick des Beraubten, der über die Gnade der jungen Damen sehr glücklich schien. [192] Lang schaute sie zu ihm hinüber mit willenlos gesenkten Armen.
Dann sagte sie nach tiefem und langsamem Atemzug: „Es ist Ihr Schicksal, mein Herr Baron, schlicht zu bleiben, in alle Ewigkeit.“
Und wahrlich, der Baron von Hirschbach blieb fortan schlicht und gut. Er verehrte die klare Dorette, die vor aller Augen als seine Geliebte galt, fortab so keusch und gefaßt und demütig, wie es kaum ein deutscher Herr in den blumenreinen Tagen des Herrn Walter Vogelweide vermocht hätte. Er bewachte ihren leichten, leisen Atemzug, wenn sie schlief, und war in entlegenster Waldeinsamkeit wie ein goldenes, zutrauliches Kind mit ihr.
Keine Bitte sagte er mehr und träumte auch keine. Sie war ihm durch ihre verständigen Worte tief heilig geworden: „Es ist Ihr Schicksal, schlicht zu bleiben.“
Die ganze Gesellschaft amüsierte sich also köstlich an ihrem Naturburschen. Er aber, nachdem es ihm mißglückt war, einem hochbegnadeten Adel die Augen für den trotzigen Blick der Bauern und die Ohren für das unterirdische [193] Volksgrollen zu öffnen, versuchte ihnen die Schönheit der ewig jungen Wiese und des ernsten, greisen Waldes, des seelenvoll bewegten Wassers und der ambrosischen Wolken zu erschließen.
Aber es verstanden ihn fast nur Heloise und Dorette. Heloise brach zumeist in Tränen aus, und Dorette schwieg lächelnd, aber ihre kleine Seele wuchs und wurde ernst und nachdenklich.
Dann, an einem Herbsttage bekam der Chevalier Landry einen sehr unerwarteten Brief.
Dieser Brief war von seiner Gattin aus Paris verfaßt, die dort, zum eignen Amüsement und dem ihrer Freunde, zurückgeblieben war. Herr von Landry hatte diese, seiner würdige Gattin seit der Halsbandgeschichte der Königin, seit über drei Jahren also, nicht gesehen!
Madame Landry schrieb, sie fürchte sehr, ihrem Herrn Gemahl ein Geständnis zuflüstern zu müssen. Was Herr von Landry darüber denke?
Herr von Landry sagte sich: Ei, wenn das [194] Geständnis nur flüstert und noch nicht selber schreit, dann ist alles gut, schmunzelte über die Unvorsichtigkeit seiner Frau Gemahlin, setzte sich mit graziöser Unbefangenheit an den Tisch und schrieb, ein Paladin der Galanterie bis in die Fingerspitzen, folgenden Brief:
„Meine Teure! Ich freue mich unendlich, von Ihnen zu vernehmen, daß die gütige Vorsehung endlich unsern Bund gesegnet hat! Ich werde mir die Ehre nehmen, Ihnen, Madame, noch in diesen Tagen meine Aufwartung zu machen in der Überzeugung, daß Sie die Güte gehabt haben werden, mich zu solch richtiger Zeit von der mir widerfahrenen Freude zu benachrichtigen, daß der künftige Erbe des Namens Landry das Wappen dieser Familie an seinem Coupé wird führen dürfen, ohne ein Lächeln zu erregen.
Beten wir zur Mutter Natur, Madame, daß es ein Sohn sei.
Tausend entzückte Grüße meinerseits. Bis dahin Ihr
ergebenster Diener
Jean Ch. de Landry.“
[195] Und der Chevalier rüstete sich von neuem zur Abreise nach Paris, indem er sich bei seinen Gästen entschuldigte, die neue Mode der Menschenrechte dort zu studieren. Er versprach, sie mitzubringen. Er bat seine Gäste, sich bis dahin gut zu unterhalten, und empfahl Glycère inzwischen der Zärtlichkeit seines jungen Freundes „'ans ioeurgue“, wie sämtliche Damen den Thüringer nannten, da sie den Namen Hirschbach nicht aussprechen konnten.
Herr von Landry kam nicht mehr zurück. Man hatte ihn in Paris erkannt, als einen der Mitwisser der Halsbandgeschichte in der Wohnung seiner Frau eingefangen, und tat ihm der König nichts, so köpften ihn die Jakobiner.
Er aber lächelte.
Es hieß, die Liebe zu seiner Gattin hätte ihn nach Paris getrieben, und der Name Landry war der Zukunft gerettet.
In Patmos wartete man vergebens auf den Bringer origineller Neuheiten. Statt seiner [196] kamen unversehens die Bauern. Die brachten noch ganz andere Überraschungen mit sich, als der delikate Chevalier.
Es geschah solches mitten in einem Schäferspiel, das die verwaisten Gäste arrangiert hatten, am Abend eines schönen Septembertages, nachdem soeben für dreihundert Taler bengalisches Licht verbrannt war.
Das Stück spielte im Freien, im Blumenparterre vor dem Schlosse, und von der Terrasse sah die übrige Gesellschaft zu.
Dorette gab sehr überzeugend eine Prinzessin, die Perlenstaat und Seidenrobe ablegt, um ihrem Schäfer in die Blumengefilde der schuldlosen Natur zu folgen, wie es in den hübschen Versen hieß.
Der Herr von Bareilles gab den Schäfer wie aus Zucker und Biskuit.
Hans Georg spielte den bösen Jägersmann, der des Schäfers Hündlein erschossen hatte und die süßen Tauben des Myrtenhaines bedrohte.
Heloise hinwiderum hatte diesen Jägersmann zärtlich zu zähmen.
In der dichtverhangenen Laube, wo sich [197] Dorette zum zweiten Akt als Bauernmädchen umkleiden sollte, ertappte sie den Hans Georg, der eben zwei Pistolen aus dem Dickicht hervorzog und zu sich steckte.
„Haben Sie denn mit Ihrer Flinte noch nicht genug?“
„Leider nein,“ sagte ihr Freund wortkarg und ernst. „Wir werden bald ein etwas wahrheitsgetreueres Spiel durchzumachen haben.“
Vom Schlosse her drang unbestimmter Lärm. Es war, als trampelten zahlreiche Menschen durch die Korridore.
„Sie wollen sich doch nicht schießen!?“ schrie Dorette.
„Still,“ herrschte der Thüringer.
Im Schlosse wurden erregte Stimmen laut, dann Hilferufe.
Die Darsteller des Schäferspieles, die der Terrasse näher standen, scharten sich zu einem Klumpen und schrien ihren Zuschauern Warnungen hinauf. Aber als ob sich die wunderlich verschnittenen Bux- und Taxusgetüme plötzlich in lebende Wesen verwandelt hätten, sprangen aus dem Dunkel des Parks Hunderte von [198] brüllenden Bauern auf die kleine Gruppe los. Dorette sah, wie der Vicomte von Bareilles nach einem Degen lief, jedoch nur, um ihn mit elegantem Achselzucken einem Lümmel zu überreichen, der dies Zeichen ritterlicher Ergebung mit einer immensen Maulschelle beantwortete.
Zwei ältere Herren und jener geistvolle Junge, der Tacitus und Anakreon kannte, waren die einzigen, die sich in elegante Fechterstellung warfen; aber im Nu waren ihre Degen zerknickt, und Prügelei und Roheit wären bis zum Totschlag angewachsen, wenn nicht über einen dieser Bauern, die im Parterre die Schauspieltruppe mißhandelten, starke Angst gekommen wäre, daß ihre tapferen Freunde, die das Schloß erstürmt hatten, ihnen alle schönen Dinge wegplünderten.
Er schrie: „Halt, halt! Die andern sind schon drin und stehlen uns alles vor dem Maul weg!“ Seine Kumpane brüllten laut auf vor Zorn und Angst, und nur einige verzweifelte Schlaumeier trieben die ganze Adelsgesellschaft: Damen, Herren mit ritterlicher Verteidigung [199] und Herren mit ritterlicher Übergabe, wie eine Herde Schafe hinweg, um ein erfreuliches Lösegeld von ihnen zu erpressen. Sie wußten, diese Leute hatten mehr Geld bei ihren Bankiers als in den Strümpfen verwahrt.
Inzwischen half Georg der fassungslosen Dorette sehr tatkräftig beim Umkleiden.
„Schnell in die Bauernkleider,“ rief er; und weil der Reifrock nicht sofort von den Hüften seiner Dame glitt, half er mit dem Hirschfänger nach. Sein ganzer Haß gegen das Gezücht der Reifröcke, deren sechs ihm so lange Zeit das Glück versperrt hatten, erwachte. Knack und ach, krachte das Fischbein, und umsonst schrie die weinende Dorette in Zorn und Weh über ihr Prachtstück. Sie mußte in ein Elsässerinnenkostüm hinein, und Hans Georg riß sie eilig mit sich.
Sie hastete und stolperte. Da verwies er ihr mit derben Worten ihre lächerlichen Stöckelschuhe. Mitten in der Halbnacht des Parks knirschte sein Hirschfänger durch die hohen Absätze, hob ein paar Lederschichten ab, und als die grobe Schusterarbeit geschehen war, konnte [200] Dorette laufen wie eine vernünftige Frau, die sich sehr fürchtet.
Sie wollte den Weg nach Straßburg einschlagen, aber Herr Georg zog sie etwas gewaltsam nach dem einsamen Bergwald.
„Die Bauern sind nicht so dumm wie Sie,“ rief er zornig. „Die bewachen alle Wege nach den nächsten Garnisonen, damit sie hier ungestört stehlen und sengen können.“
Ein seltsames, rötliches Licht überzog den Himmel über den Bäumen des Waldes, und da diese bräunliche Dämmerung Dorette zu sehen gestattete, gewann sie ihre Fassung wieder. Sie fiel aus ihrem Schreck in großen, ehrlichen Zorn.
„Herr, mein Herr,“ rief sie ihren eiligen Begleiter an. „Laufen Sie nicht so. Sie sind davongelaufen, Sie allein, während die andern als Edelleute fochten oder sich als Edelleute ergaben.“
„— aber nicht als solche behandelt wurden,“ lachte er.
„Sie sind davongelaufen, Sie waren grob gegen eine Dame, ja Sie haben sich an meiner [201] Krinoline und meinen Stöckelschuhen vergriffen. Wie, mein Herr, vermögen Sie diese Handlungsweise zu rechtfertigen?“
„Ei, das war Natur,“ lachte Georg, der sich oben im Walde sicher wußte.
„Natur, Natur, Sie Ungezogener,“ rief Dorette. „Beleidigen Sie nicht diesen erhabenen Namen.“
„Madame, noch ein paar Schritte bis zu jener Lichtung,“ bat Georg, „und nun, da wir auf der Höhe sind, bitte: sehen Sie dort unten die Bescherung an!“
Dorette erstarrte. Über den Nachthimmel krochen die roten Brandwolken eilig dahin, und als Dorette den Aussichtspunkt erreichte, sah sie das Schloß unter gierigen, grellen Flammen stehen. Düster ragten noch die Dachbalken in die blendende, bewegliche Zackenkrone über dem Gemäuer hinein, und aus zahlreichen Fenstern brachen die wahnsinnig emporstrebenden Feuerfahnen.
Bis zu ihnen aber drang das Jubelgebrüll und das Gekreisch von Tausenden entfesselter Bauern und Weiber. Sie füllten das ganze [202] Blumenparterre so dicht, in so zusammengedrängter Menge, daß Dorette zuerst glaubte, der ungeheure Raum vor dem Schlosse sei mit rosa Mohnblumen bepflanzt, bis sie erkannte, daß die zahllosen leuchtenden Halbkugeln Menschengesichter waren, die alle in die Glut starrten, wie in ein Weltenschauspiel.
So oft ein Dachsparren fiel, ging das ferne Gebrüll unten los, als würde ein Schotterkarren ausgeleert.
Georg lachte grimmig: „Da haben Sie die Natur, die plötzlich erwacht und auf ihre beiden Füße gesprungen ist. Da unten!
„Sie haben gewußt, daß diese Natur den Krieg, die Krankheit, den Haß und das Feuer, daß sie den Molch, die Otter, den Tiger und den Mörder schuf. Sie haben gewußt, daß die Menschen Schnaps brennen und im Schmutz leben. Sie sind im Wagen gesessen und fuhren an Häusern vorbei, deren Elend zum Himmel stank, und an den Betrunkenen des Straßengrabens, und Sie haben mit den Tugenden gerechnet? Sie?
„Da unten, da! In Brand und Rauch, [203] in Schnapsdunst und Mordlust, da ist die enthüllte Natur!“
Der junge Deutsche war fast begeistert; er war mehr erhoben und von trunkener Erkenntnisfreude erfüllt als zornig.
Der armen Dorette aber graute entsetzlich. Sie hatte stets nur Schäferspiele gelesen, Shakespeare verachtet, und nun bat sie fassungslos: „Mein Lieber, schweigen Sie! Retten Sie mich, mein Teurer!“
Da mußte die arme Dorette auf weitem Umwege gegen Bergzabern durch die Waldnacht hasten, und dennoch stießen sie am nächsten Fahrweg auf entgegendrohendes Geschrei, auf Fackeln, auf einen Posten der Bauern; denn in der Nähe brannte schon wieder ein Schloß.
„Halt! Ein Förster? Ein Herrenhund? Erschlagt ihn!“
Knüttel, Spieße und Sensen fegten auf sie los, aber da blieb der junge Deutsche stehen, legte die Büchse an, und vor dem herausknallenden Feuerstrahl schlug der schwerste von den rohen Burschen gewaltig auf den Rücken hin, mit hoch empor schnellenden Beinen. Aufschreiend [204] flohen die Bauern, denn tödliche Gegenwehr waren sie von den verweichlichten Herrschaften nicht gewohnt, und Dorette stand wie gelähmt in der Finsternis. Aber vor ihre geblendeten Augen war noch immer Strahl, Knall und Fall gebrannt, und das Überschlagen eines hinschmetternden Menschenleibes unter strampelnden Beinen. In der Nähe lag jetzt ein Toter.
„Nun haben Sie auch noch gemordet,“ sagte sie müd.
„Alles zu rechter Zeit,“ atmete er auf. „Was wollen Sie, Madame: der Tod im Kampf? — Natur!“
„Ach, das ist eine abscheuliche Pointe, Ihre Natur. Wir werden sie nun selbst mitmachen; wir werden sterben hier im Walde.“
„Was fällt Ihnen ein, ich mag nicht,“ rief er und zog sie mit sich.
Gegen Morgen war sie so müde, daß er sie im Dickicht schlafen ließ, indes er sich entfernte. Schon mit dem grauenden Tage kam er zurück, weckte sie und bot ihr Milch, Brot und Eier. Freilich mußte sie die letzteren roh austrinken.
[205] „Natur!“ sagte er lachend.
„Woher haben Sie das?“ fragte sie, als sie satt war.
„Gestohlen.“
„Gott behüte mich!“ Sie saß voll Abscheu auf der Erde.
„Natur!“ sagte er und zuckte die Achseln.
Den ganzen Tag mußte sie mausestill sein, sich ängstigen und langweilen. Ein Glück, daß er sie zum Schlafen nötigte. Ohne Umstände zu machen, streckte er sich neben sie aus und schlief ihr ein Stück vor, wie ein Bauer. Da legte auch sie sich weinend ins Gras, schlief ein, und er erhob sich und wachte.
In der zweiten Nacht durchquerten sie die Ebene bei Hagenau und erreichten den Rhein gegenüber von Rastatt. Diesmal hatte er gewagt, in Sesenheim ein wenig warme Kost für sich und die arme Flüchtige zu bestellen; den Tag über verbrachten sie in den Auen des Rheins, wo Dorette bis zur Verzweiflung von den Stechmücken litt.
In der Nacht verübte dann Johann Georg seinen letzten Diebstahl. Er band einen Fischernachen [206] los, zwang Dorette in das am Boden mit Wasser gefüllte Fahrzeug, stieß ab und biß sich zäh und langsam durch die ziehenden schluchzenden, eilig drängenden Wellen hindurch.
Dorette schwindelte vor Schwäche, Angst und Kälte. Sie war beleidigt, mißhandelt und gequält worden. Das sollte eine romantische Rettung sein? Nichts als widrige Kleinigkeiten: Hunger, Staub, Schweiß, schlechte Nahrung, Müdigkeit, Grobheiten, Stechmücken, nasse Schuhe, schmutzige Hände! Das einzige Artige war, daß er ihr am zweiten Tag im Felde scherzend das Haar in Zöpfe geflochten hatte; solche hatte sie noch nie getragen und so hatte sie ein bißchen gelacht, aber nur ein Augenblicklein lang. Dann hatte sie über die Sonne gescholten, die ihr den Teint verbrannte.
Und bei jeder Unritterlichkeit, bei Müdigkeit, Hunger, harten Eiern und schimmlichem Räucherfleisch, bei den Stechmücken, dem Schweiß, den nassen Schuhen und dem Schmutz an Händen und Haar hatte er gesagt: „Natur!“
Sogar als er den Kahn stahl: „Natur!“
[207] „Das ist die abscheulichste Pointe, die ich im Leben hörte,“ rief sie zehnmal und zwanzigmal, aber ebensooft schwieg sie und seufzte. Dann lachte er und sagte: „Ich gebrauche mein Lieblingswort dennoch nicht so oft, als Sie das Ihre.“
„Das meine?“
„‚Man’. Hätten Sie das vergessen?“
Da weinte sie bitterlich. Ach, diese selige, befreite, göttliche Gesellschaft, welche ‚man’ sagte. Wohin war sie zerstoben?
Das Boot ritt wie ein Pferd gegen die Wellen an. Die Nacht war sternlos, der Rhein tintenschwarz und voll tückischer Wirbel.
„Und das ist Ihr besungener Rhein!“
„Natur.“
Endlich, endlich stieß das Boot ans Ufer. Georg trug die arme Dorette ans Land, und nun durften sie sich wieder am hellen Tage zeigen. Sie waren auf deutschem Boden, und in Rastatt wurde der Herr von Hirschbach, nach dem ersten drohenden Anruf des mißtrauischen Postens und nachdem er sich ausgewiesen, wahrhaftig aufgenommen wie ein deutscher [208] Baron in der guten alten Zeit, und Dorette wie eine vornehme Emigrantin.
Der junge Hirschbach sorgte nun, daß sein armer Schützling alles bekam, was dessen Herz ersehnte. Ein herrliches Bett in einem gelb-tapetnen Zimmer, das hell war wie eine Ringelblume im Sonnenschein; Wasser, Seife, Parfüm, Toiletten, Schuhe, alles so gut und so schlecht man es eben in Deutschland hatte. Und lachend sah Dorette diese Nachahmungen an.
Sie war schon wieder getröstet.
Über den Rhein wollte sie nicht mehr zurück. In Frankreich drüben ging es wüst zu. Die Menschenrechte wurden sehr unangenehm ausgelegt, und der junge Hirschbach wagte viel, als er mit Briefen zum Straßburger Bankier reiste, um das Vermögen seiner Dame in Sicherheit zu bringen.
Da blieb denn die graziöse Gesellschaftsdame zum erstenmal in ihrem Leben allein und las die Zeitungen, die Georg ihr schicken ließ. Sie las von dem Kampf ums Dasein, von der Sünde des Reichtums und dem Elend der Welt. Sie las Krieg, Irrtum und Haß; sie las [209] vom großen Aufstand des Volkes, von brüllenden, trunkenen Sturmrotten, von der Not einer Königsfamilie und dem blutberauschten Jubel der Sanskülotten, und ihr armes, schwaches Herz lag ohnmächtig da, wie ein kleiner Nestvogel bei Schloßensturm.
Ach, wie so plötzlich hatte sich die Welt um sie verändert!
Ach, und wie war sie so plötzlich allein in solcher Welt!
Und sie dachte an den verachteten Bauernjunker aus dem Thüringer Wald, der für sie um sein Leben gelaufen, sie gezerrt und bedroht hatte, der für sie mordete, stahl, sich im Kot der Straße beschmutzte und ihr, selber todmüde, die treuen Knie zum Kopfkissen bot.
Was war, wenn er nicht wiederkehrte?
Aus den Tagen wurde eine Woche. Sie bebte nach ihm, sie weinte um ihn, sie rief aus der ganzen Macht eines angstvoll liebenden Herzens seinen Namen. Er blieb fern.
Aus der Woche wurden zwei, aus den vierzehn Tagen ein Monat. Sie bequemte sich, [210] das Deutsche zu erlernen, ihm eine Freude zu machen.
Endlich kam er und berichtete, wie er alle Behörden, zuletzt aber Drohung und Gewalt aufbieten hätte müssen, um den treulosen Bankier zur Herausgabe des Vermögens der Witwe Maintignon zu zwingen. In der Verwirrung dieser Zeitläufte hatte der Mann einen hübschen Gewinn zu machen gedacht. „Es ist in der Wildnis gerade so. Den kranken Hasen packt der Fuchs zuerst. Natur,“ schloß er wehmütig lächelnd, als er der glücklichen Dorette das Ihre einhändigte.
Dann, dann küßte er ihr die Hände, empfahl sich und ging fort; mit zuckendem Herzen und schweren, widerwilligen Knien.
Dorette lauerte, bis er die Türklinke erfaßte, und das dauerte eine ganze Zeit, obwohl er sich nicht mehr nach ihr umsah.
Dann aber lief sie ihm nach und warf sich ihm an den Hals.
Die Sonne ging unter und wieder auf. —
In der goldgelb tapezierten Stube trennte kein Wall von Reifröcken mehr zwei Glückliche.
[211] In der seligen Ruhe, die über beide kam, als sie sich endlich Geliebter und Geliebte nennen durften, lachte dann Dorette in seinen Armen sehr leise.
„O du Schönste, du!“ rief er und küßte sie. „Beginnst du schon wieder mich zu verspotten?“
„Ei freilick,“ lächelte sie. „Denn diesmal 'ast du vergeß' zu wieder'olen dein' Pointe.“
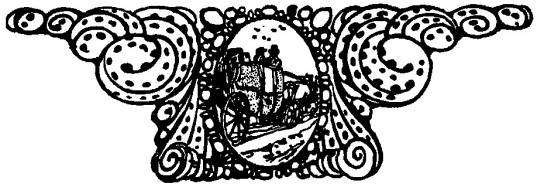


Diese Blätter bilden einen Teil der Memoiren, welche die Gesellschaftsdame der Admiralin Madame Reinezabelle de Vermillon hinterlassen hat. Es geht aus diesen Blättern hervor, daß Madame de Vermillon eine Freundin brauchte, die den Ruf guter Moral mit christlicher Duldung vereinigte und das Französische nicht weitgehend genug verstand, um allerfeinste Anspielungen, verdeckte Bitten, Zusagen und Versprechungen zu durchschauen. Demoiselle Babette Strüntzel aus Straßburg scheint all diesen Anforderungen entsprochen zu haben. Sie schreibt:
„Meine liebe Frau Admiralin war beständig Strohwitwe. Warum nur? Admiral Graf Vermillon, der in Marseille Hafenkommandant [216] war, hätte sich Urlaub genug verschaffen können, um nach dem allgemein begehrten Paris zu kommen. Jedoch er kam nur selten. War er bei Hofe übel angeschrieben? Weiß Gott! Er muß ein prächtiger Mann von großer Keuschheit gewesen sein, denn man hörte keineswegs von ihm jene Geschichten, durch welche die Herren des ancien régime in den Verdacht der Frivolität geraten sind. Im Gegenteil. Er fühlte sich nur wohl in der übermütigen Gesellschaft seiner jüngsten Kameraden und wurde von den Kadetten zur See geradezu angebetet.
Ich wünschte sehr, von Madame Reinezabelle de Vermillon erzählen zu können, wie auch sie nur in Gesellschaft junger Mädchen ihr Glück gesucht hätte. Aber nein. Madame vermied weiblichen Umgang — bis auf den meinen — nach Möglichkeit, und lud ihre hübschen Freundinnen nur ein, wenn sie, wie ich erst jetzt einsehe, sich von einer allzulange währenden Freundschaft eines ihrer liebenswürdigen Herren Gäste zu befreien wünschte.
Wenn man undankbar aus treuen Diensten [217] entlassen wird, so ist das, wie wenn man sich fortab einer schärferen Brillennummer bediente. Man sieht trotz der Milde eines guten Christen bedeutend mehr. Interessant.
Ach, wie ich in Madames Salon eintrat? Wären doch die Zeiten noch da! Wahrlich, es war lasterhaft, aber man benahm sich gut. Herr Phébus de Lagival las ein Novellchen aus dem Nachlaß von Crébillon fils in einem Manuskript vor, dessen Abdruck der tugendhafte König verboten hatte. Wir schämten uns sehr, Madame und ich. Das heißt, Madame benützte ihren Fächer, um dahinter vergnügt zu sein, und ich den meinen, um zu verdecken, daß ich nicht zu erröten vermochte, weil ich die zarte Sprache noch nicht gänzlich beherrschte.
Jedoch lernte ich dabei die Feinheit mehrdeutigen Ausdruckes ein wenig kennen und fürchten.
Am Schlusse jener Erzählung stand Madame in reizender Empörung auf. Sie liebte es, ihr lichtblondes Haar nur leise zu pudern, so daß Gold und Silber im Scheine des Kronleuchters übereinander rieselten, als sie das [218] helle Antlitz weit, weit weg nach seitwärts und nach hinten bog: sehr ablehnend, aber lächelnd.
„Es ist gänzlich unmöglich, die Verlegenheit einer Dame, die einer Erzählung zuhört, ärger zu steigern,“ rief sie aus. „Und es ist ebenso unmöglich, ihre gerechte Entrüstung darüber besser in Lachreiz zu verwandeln. Herr Crébillon fils hatte wenig Moral. Das vergäbe ich ihm ja, gestattete jedoch nicht, daß man solche Dinge vor mir lesen dürfte. Aber daß er uns dabei noch zum Lachen bringt, ist unverzeihlich, ist empörend, ist .... Er war eben einzig, dieser jüngere Crébillon. Keiner macht ihm das nach!“
„O, doch, Madame,“ lächelte Herr Phébus de Lavigal.
„Und wer, wenn ich Sie um das Recht der Anfrage bitten darf?“
„Ich.“
„Schämen Sie sich. Nicht wegen des Stils. Wegen Ihrer Vermessenheit, so reizend sein zu wollen!“
„Und wenn ich wette?“
„Dann hielte ich diese Wette.“
[219] „Was wollten Sie opfern?“ fragte Herr Phébus in jener leisen Art von Liebe, die damals bei der guten Gesellschaft gangbar war und von der man nie recht wußte, ob es nicht bloß leise Freundschaft war.
Madame neigte in tiefem Nachdenken die hohe Frisur über das hellblühende Antlitz und prüfte ihn unter den halbverdeckenden Augenlidern. Ich fürchte heute zu erraten, was sie Herrn Phébus antworten wollte. Aber Herr Obolon, der Hausarzt, rief dazwischen:
„Ein Diner!“
„Und ich will nach dem Herrn Chevalier ein Souper verdienen,“ rief der Marquis Armand Blancheron, ein Freigeist von größter Ruchlosigkeit der Gedanken, der es nur seiner großen Delikatesse und Liebenswürdigkeit gegen mich verdankte, daß ich ihn nicht haßte.
„Ah, auch Sie wollen mit Crébillon fils in Rivalität treten?“
„Für ein Souper, gern.“
„Gut. Meldet sich noch jemand?“
Wirklich! Es meldete sich ein geistlicher Herr. Der Abbé Lecocq-Choisel. Er verkaufte [220] allerdings seine geistliche Würde nur gegen ein Diner und ein Souper.
„Das wird reizend,“ lächelte meine schöne Herrin. „Wann wollen Sie mir Ihren mißlungenen Versuch bringen, Herr von Lavigal?“
„Wenn es eine Novelle sein darf, in drei Tagen.“
„Ah! Ei! In drei Tagen! Sie müssen mit dem Geiste solcher Dinge sehr stark gesegnet sein, Herr von Lavigal. Auf Wiedersehen also in drei Tagen, meine Herren! Bringen Sie Ihre Freunde mit.“
Es war eine liebenswürdige, intime Gesellschaft, die sich verabschiedete; alle freuten sich sehr.
Selbst ich freute mich halb und halb. Zur anderen Hälfte war mir bange. Bange, wie ich mich benehmen sollte. Und bange um das Heil meiner Seele; wirklich.
Es war reizend anzusehen, wie meine Gräfin ihre Wette verlor, und sie verlor sie an alle drei Herren. Denn jeder brachte es zustande, nichtsnutziger zu schreiben, als das von Herrn [221] von Crébillon fils in die Schreibtischlade gelegte und nachher vom König unterdrückte Werk war. Die Vorlesung des Herrn von Lagival verlief derart, daß die Frau Admiralin ehrlich rot wurde und dennoch vor innerlichem Lachen zitterte, wie ein Bäumchen, an dem die Säge frißt. Sie schenkte dem Sieger des Abends für kurze Zeit ihre Freundschaft. Aber Herr von Lagival war zu sehr geistreicher Plauderer, als daß meine hübsche, ränkevolle Dame längere Zeit an den einsamen Stunden Gefallen gefunden hätte, zu denen sie seinen Besuch erlaubte. „Er schwätzt auch da,“ sagte sie zu mir; „denken Sie, liebe Freundin, er ist auch da geistreich. Es heißt doch sonst stets: Vor das Publikum gehört die Theorie, vor die Tatsachen aber — — — Kurz und gut, Herr von Lagival weiß seine Verdienste nicht zu placieren.“
Ich verstehe heute noch nicht genau, was sie damit meinte.
Zur Vorlesung des Freigeistes Armand Marquis Blancheron ward Madame des Eucareilles geladen, die von einer süßen, ich möchte [222] sagen, zum Himmel singenden, jedoch tief und schüchtern zur Erde geneigten Schönheit war.
Madame des Eucareilles war mutig genug, mit ihrem Gebetbüchlein zu erscheinen. Sie hatte mir gesagt: „Wird's zu arg, so lese ich hier drinnen weiter und das Lachen einer Hölle soll mich nicht stören, ewige Harmonien zu hören, während die anderen sich am Tand eines leichtverwesbaren Frühlings ergötzen.“
Mein Gott, es wurde so arg, daß Madame des Eucareilles ihr Gebetbuch vergaß, das ich ihr am nächsten Tage bringen mußte; es wurde so arg, daß Herr von Lagival sie nach Hause begleitete, und daß mir am nächsten Tage die Demütigung widerfuhr, das Brevier ihrer Zofe einhändigen zu müssen, weil die des Eucareilles noch nicht in der Lage war, mir ihre Stirn zu zeigen — und mir in die Augen zu sehen.
Wenn ich nicht behaupte, daß Madame Reinezabelle an Blancheron mehr verlor als ein Souper, so hat dies seinen Grund in der einzigen Tugend dieses entsetzlichen Freigeistes: er scheute sich zwar nicht, mit dem, was wir alle glauben und hoffen, der Religion, [223] zu verfahren, wie mit dem Tabak, den ein Pächter in seine Pfeife stopft, um Rauchringel damit zu blasen, aber — Herrn von Blancheron meine ich — er schonte in jeder Weise die Unantastbarkeit einer Tugend (ich habe es an mir selbst erlebt) und begnügte sich bloß damit, in seiner heiteren Weise der Gegenstand des beständigen Entsetzens aller Damen zu werden. So wenigstens kannte ich ihn. Oder sollte ich hier verblendet gewesen sein?
Schade um ihn. Er wurde guillotiniert, noch ehe er daran dachte, sich zu bekehren, während Herr Phébus emigrierte und selbst in Deutschland bei lebendigem Leibe als nichtsnutzig verharrte — bis in sein hohes Alter.
Madame sprach seit jener Vorlesung lange Zeit nicht mehr über Herrn von Blancheron. Er schien für sie ausgetilgt zu sein; hoffentlich! Erst an dem Abende, als der Herr Abbé Pierre Lecocq-Choisel den dritten Preis für leichtsinnige Lektüre gewann, erst dann sagte sie: „Finden Sie nicht, daß dieser Blancheron bloß ein helles Blech hinter dem Lichte ist? Einer, der schlimmer aussehen möchte, als er zu sein [224] vermag? Sehen Sie: dieser Geistliche Lecocq, der ist das Gegenstück. Er sieht aus wie eine feierliche Wachskerze. Er ist es sicherlich, und er ruft dennoch beständig: Ich bin Unschlitt; nicht mehr als Unschlitt, glauben Sie mir, meine Damen! Es ist doch der Gipfelpunkt der Duckmäuserei, den Duckmäuser so vollkommen zu verstecken! Dahinter müßte man kommen.“
Seine Würden Lecocq hatte sich wahrhaftiglich ein wenig anders benommen, als es seinem Stande zukam. Mit gespreizten Beinen saß er an jenem Abende nach seiner Vorlesung da und kanzelte die Herren Phébus und Armand ab, den Kopf ziemlich kahl, die Perücke in der Hand um den Zeigefinger kreiselnd.
Er bewies ihnen, daß man derlei Dinge in zwei verschiedenen Zeitläuften schriebe; vor und nach der schönsten Lebenszeit. Seine beiden Vorgänger hätten die platonische Liebe zur Zweideutigkeit schon wieder, wie die Veilchen im Herbste abermals blühen. Das Gelöbnis der Enthaltsamkeit aber sichere ewigen Frühling.
Es wurde stark widersprochen, und an diesem Abend benützte die für Herrn von Blancheron [225] geladene Dame, die kleine Caçolles, den Fächer sehr eifrig. Aber nur weil sie allzu heftig lachen mußte und ihr ein Backenzähnchen fehlte.
Immerhin erreichte der Abbé, daß Madame Reinezabelle sich für ihn eine Zeitlang interessierte.
Aber es war damals die Soutane keineswegs modern. Die Bemühungen der Herren Rousseau, Voltaire und Diderot hatten bewirkt, daß man in jenen Jahren die Philosophie über alles andere stellte, was sonst in den Salons Geltung genoß, und wahrlich, es muß eine vorzügliche Philosophie gewesen sein, die sich ihren Weg über die dicksten Teppiche und in die ersten Salons der damaligen Zeit zu erobern vermochte! Kein deutscher Philosoph erreichte je Salonfähigkeit. Man bedenke!
Die Herren Rousseau, Voltaire und Diderot waren nun aber schon gestorben und vergessen, und zu unserer Zeit galt in Paris und mehr noch in Versailles Herr Jacques Lagratte für den erfolgreichsten Philosophen auf sämtlichen, in Betracht kommenden Teppichen von Frankreich.
Madame Reinezabelle hatte sich's unendliche [226] Mühe kosten lassen, den vor Berühmtheit leuchtenden Herrn an sich zu bringen. Endlich aber vermochte sie ihn zu sich einzuladen, und ich sehe heute noch den kostbar abgewogenen Hofknix, mit dem Madame ihn ehrte, als er eintrat. Sie war wegen dieser Art, sich zu verneigen, berühmt: als die einzige nach ihrer Lehrerin, der Marschallin von Luxembourg, in Betracht kommende Dame, und sie hatte diesen Knix dem Zeitgeiste angepaßt, erneuert und verfeinert. Ich hatte leider nicht Gelegenheit, ein solches Kunstwerk bei Hofe mitanzusehen, aber man versicherte mir von allen Seiten, daß Herr Jacques Lagratte sich des vollendetsten Komplimentes rühmen dürfte, daß Madame je knixte — die erlauchte Familie von Frankreich mit eingerechnet.
Und ich gehe an die Schilderung dieses Ereignisses.
Es brannten hiezu sechshundert Wachskerzen in dem Empfangszimmer Madames, und über dreißig Herren waren versammelt, nebst einem kleinen Dutzend Damen, die Madame diesmal als Freundinnen eingeladen hatte, um [227] Zeugen zu sein, daß Herr Lagratte in Fleisch und Blut ihren Salon beträte.
Herr Lagratte kam von allen Gästen zuletzt, aber er kam genau zu jener Zeit, da sich die Spannung der Gesellschaft so hoch gesteigert hatte, daß in den Herzen der Damen die erste, kleine schadenfrohe Hoffnung aufzischelte, er würde überhaupt nicht kommen. Diese richtige Erwägung der Minute seines Auftrittes allein würde hinreichen, die Größe seiner Philosophie zu beweisen.
Als die Türen aufflogen und die Diener schrien: „Jacques Lagratte“ — denn er hatte sich überall streng das Monsieur verboten — da zwang es uns allen die Herzen zur Kehle empor. Nur Madames schöne Augen strahlten in sanftester Heiterkeit gegen die Türe, durch die ein mittelgroßer, vorgeneigter, sehr magerer und etwas an sich gehaltener Herr eintrat, dessen Haar eine leichte Unordnung bewies und ein wenig an den Schläfen flatterte; es war nur schwach gepudert. Das Antlitz war unsagbar schmal und bestand eigentlich, außer einer großen Nase und den prächtig grauen, groß und festblickenden [228] Augen, nur aus zwei senkrechten Falten, die zu beiden Seiten von Nase und Mund bis unter das Kinn spannten.
Es lief ein Schauer durch die Gesellschaft. „Er ist ganz, wie Friedrich der Große aussah,“ hieß es.
Da trat ihm Madame entgegen. Auf eine Entfernung von ihm, daß sie sich kaum die Fingerspitzen zu reichen vermocht hätten, blieb sie stehen, die Augen demütig und anmutreich gesenkt. Sie bog die Knie, so daß sie fast um die Höhe ihrer golden und silbrig schimmernden Frisur kleiner wurde, und hielt leise ihren Reifrock mit den Handspitzen berührt. Im Augenblick danach griff sie mit dem rechten Füßchen langsam nach hinten aus und zog so ihre ganze junge Pracht leise rücklings mit sich fort, indem sie jetzt dem Gelehrten unendlich bescheiden und schmachtend in die Augen blickte, während sie sich wieder aufrichtete.
Herr Lagratte war ein ganzer Philosoph. Er wußte so viel Grazie, guten Ton und Feinheit nicht anders zu schätzen, als indem er Fassungslosigkeit spielte. Ich glaube, er verliebte sich [229] in diesem Augenblick in sie, als sie sich vor ihm mit solch olympischem Kompliment verneigte.
Madame stellte ihn sofort der Gesellschaft vor. „Ah, meine Freunde,“ sagte sie, „was werden Sie von mir denken! In meiner Freude vergaß ich den Namen, den der kleinste Küchenjunge von Paris kennt. Wie soll ich ihn nennen? Unser Philosoph, unsere Girandole, mein Kronleuchter? Nein. Die Sonne dieses Erdballs, heute eingefangen, um unserem Salon allein zu leuchten.“
Nun muß ich weiter berichten. Herr Lagratte war sicherlich ein großer Philosoph, da sich ihm sonst die Salons nicht geöffnet hätten — aber er war selbst für die damalige Zeit etwas stark modern ... sagen wir einfach atheistisch.
Schon als das Eis, von Künstlerhand zur Gestalt des Liebesgottes formiert, kam, war er dabei, niemand Geringeren als den lieben Gott auf die niedlichste Art aus der Welt fort zu beweisen, und am Zerfließen der vergänglichen Creme demonstrierte er die Unsterblichkeit der Seele.
„Hier, meine Verehrtesten,“ rief er aus und [230] deutete auf seine Eisschale, „hier sehen Sie das Bild des Lebens ins Negative übersetzt. Ja, übrigens, was ist negativ? Was positiv? Dem Eisbären ist die Kälte das Positive.
„Dieses Eis war noch vor kurzem Formung; es stellte Amor dar. Es war Leben, so lange es Eis war. Ja, was ist Eis? Was ist Leben? Ein beliebig angepaßter Temperaturgrad der Natur, energisch genug, um einen Körper, das heißt, eine Körperschaft zusammenzuhalten. Laßt einen Zephyr wehen — der notwendige Grad entflieht, und die Teile sagen sich auseinanderfließend genau so Adieu, wie hier bei diesem weiland reizenden, zu Eiscreme verkrusteten Amor, den mir unsere liebliche Wirtin zugedacht hatte und über dessen Kälte mich nur seine Vergänglichkeit zu trösten vermag.
Zu rechter Zeit genießen, das ist alles; — die Temperatur wahrzunehmen, das ist die Aufgabe.“
So bewies der berühmte Herr Lagratte seine Philosophie, die lächelnden, großen, klar grauen Augen auf Madame gerichtet, die Stimme von hoch herab, als käme sie von Gottes Thron, [231] und die Eisschale in der Hand. Man sagte allgemein, daß der Grad seiner Neigung zu Frau Reinezabelle von Vermillon ein hoher gewesen sein müßte, da er schon seit langem nicht mehr so hinreißende und reizvolle Beweise auf den Teppich gebracht hätte.
Immerhin: die Ewigkeit siegt stets; auch über ihre geistvollsten Leugner. Das Verhältnis Madames zu dem Philosophen war nicht von langer Dauer. „Ähnlich wie es das Verhältnis der Völker zu den Philosophien zu sein pflegt,“ sagte sein Nachfolger, ein exakter Chemiker.
Ich entsinne mich nicht mehr genau der Jahreszahlen, aber mir ist, als sei jener unwiderlegbare Chemiker zur Zeit aufgetaucht, als der Graf von Cagliostro hier seine Wunder wirkte: kurz vor der Halsbandgeschichte der Königin. Auch wir hatten solch eine kleine Halsbandgeschichte mit ihm, mit Herrn Theophil Bouffler nämlich.
Man wußte damals nicht, ob der Diamant schmelzbar sei. Nun war es Madames Lieblingswunsch, die vierundzwanzig mittelgroßen Rauten ihres Halsschmucks zu einem großen Stein ineinander zu schmelzen und einen Brillanten [232] daraus zu schleifen, der dann, wie Herr Bouffler versicherte, das Vierundzwanzigfache des Halsbandpreises zum Quadrat erhoben, wert sein würde.
Nun weiß ich nicht: mißlang das Experiment wirklich oder hatten später die bösen Zungen recht, die behaupteten, Herr Theophil Bouffler hätte die Diamanten in Wechsel auf die Bank von London umgeschmolzen — kurz, Herr Bouffler stürzte eines Tages in größter Aufregung zu Madame und schrie sie an: „Das Halsband verflüchtigte sich!“
„Wer! Wo! Wie?“
„Das Halsband! Zu Feuer! Zu magnetischer Luft!“
„Mein Halsband! Mein schönes Halsband?“
„Denken Sie sich, Madame: Was die Wissenschaft bisher noch gar nicht ahnte: daß der Diamant nicht schmelzbar wäre, das habe ich, ich entdeckt. Flüchtig ist er! Flüchtig! Haben Sie einen Brillantbouton? Geben Sie her. Begeben wir uns in unser Laboratorium.“
In dem kleinen Zimmer, das Madame dem Chemiker eingerichtet hatte, bewies Bouffler der [233] unglücklichen Reinezabelle, daß der Diamant unter dem Brennspiegel vollständig verlodere. Herr Bouffler wollte in seinem Experimenteifer auch noch Madames andern Ohrknopf verbrennen, aber sie weinte sehr und gab ihn nicht mehr her.
„Trösten Sie sich, Verehrte,“ sagte ihr der Chemiker. „Ihr Halsband ist ebensogut dem Äther zugeschwebt, wie es etwa der Seele Ihres Herrn Gemahls oder der meinen in jedem Augenblick ähnlich widerfahren kann. Das sind Erscheinungen dieser armseligen Zeitlichkeit ...“
„Armselig?“ rief die schwergeprüfte Reinezabelle. „Es kostete zehntausend Franks!“
„... aber Sie haben sich die Ewigkeit damit erkauft — Madame,“ fuhr Bouffler unbeirrt fort. „Ich werde der Akademie der Wissenschaften berichten, daß ich durch Ihre Munifizenz die weltbewegende Entdeckung machen und den Beweis erbringen konnte, daß der Diamant verbrennlich ist, und ich werde vorschlagen, daß man diese seltene und kostbare Art der Verflüchtigung für ewige Zeiten ‚vermillionisieren’ nennen solle.“
[234] Meine gütige, junge Herrin lächelte schon wieder ein wenig.
„Sie haben recht,“ sagte sie. „‚Reinezabellisieren’ klänge lange nicht so gut.“
Freilich fiel uns nachher ein, daß Herr Bouffler wiederholt die Taktlosigkeit begangen hatte, unsere Herrin um ein Darlehen zu bitten, um dessen Rückerstattung er sich niemals bekümmert hatte. Nun, wer Geld braucht, kann auch Diamanten brauchen, schlossen wir. Aber es war zu spät. Herr Bouffler und vielleicht auch das Halsband waren schon in England.
Dennoch versuchte Madame es noch einmal mit der Wissenschaft. Denn, Gott hat es angesehen: Als die Lebenskundigen und die Herren von Esprit und die Freigeister ihre Walze in den Salons abgespielt hatten, als selbst der Zynismus nicht mehr verfing und die Philosophie all ihre Prismen verspiegelt hatte, da hielt sich die Wissenschaft merkwürdig lange Zeit fest in den Gemütern, und wer modern sein wollte, mußte wenigstens in den Volkswirtschaften [235] irgendwie werkgeübt sein. Sogar der König feilte und schlosserte. Es war zwar keine Wissenschaft, aber was ähnliches.
Nun kam Madame mit Maitre Pierre Savonnard zusammen, und endlich fand es sich, daß sie mit einem Manne etwas Besseres gemeinsam hatte als den Geschlechtsunterschied. Denn die Freude am Experimentieren, die meine schöne Gräfin zum Chemiker gedrängt hatte, verriet damals schon die Neugierde eines Kindes. Und dieselbe kindliche Begierde zur Forschung, ja ich möchte sagen, dieselbe Kinderei des ganzen Wesens, trieb unseren guten Doktor an. Es war rührend zu sehen, wie diese beiden Leute, meine Herrin, klar und schön wie eine Lilie, und der lebhafte Doktor, stark, ansehnlich und frisch, diese Leute, die so leicht Geliebter und Geliebte sein hätten können, sich nur als Kinder fanden.
Ach und wie glücklich waren sie dabei! Alles, was sie als große Leute tun gelernt hatten, vergaßen sie aneinander und lebten wie Kameraden von neun Jahren, denen vom Leben noch nichts anderes gehört — als die ganze [236] Welt, mit Ausnahme ihrer Unruhe. Wie steckten sie die Köpfe über ihrem Mikroskop — nein: über ihrem Spielzeug, zusammen und riefen mich zu sich hin! Die, die dachten nicht daran, sich zu küssen! Aber sie liebten sich viel längere Zeit, als Madame mit den fünf anderen Herren verloren hatte, die ich seit meinem Dienstantritte kommen und gehen zu sehen die Ehre gehabt hatte. Pierre war ein Kind wie sie; das war es.
Wer weiß, wie lange und wohin sich dieses wahrhaft paradiesische Verhältnis fortgespielt hätte, wenn nicht so ein Idealist vom Beginn der Neunzigerjahre hinzugetreten wäre.
Robert Ducrac kam und griff erst Madames vorvergangenen, aber noch immer berühmten Freund Lagratte an. Es waren gewaltige Lufthiebe, die er tat, aber sie freuten uns sehr, weil er auf einen Abgetanen eifersüchtig war; also auf einen Unbesieglichen.
„Darf es für einen Philosophen, der das Leid der Welt durchschaut, das Ereignis seiner Tage bilden, im Kreise von Modeleuten zu regieren und jeden Abend anderswo zum [237] Speisen eingeladen zu sein? Herr Lagratte wird mir antworten, er erzöge Menschen. Was für Menschen, wenn ich bitten darf? Sie sind auf alles neugierig und zu nichts herangebildet. Sie kümmern sich gar nicht um unsere Gedanken: Sie leben in den Tag hinein und reden nicht der Philosophie zuliebe, sondern philosophieren, um zu plaudern.“
„Aber man lebt doch, um zu plaudern; nicht?“ fragte ihn Reinezabelle.
„Sie verdienen nicht, um besserer Dinge willen zu leben,“ schrie sie Ducrac mit seinem dicken Gesichte an. Er war ein großer Idealist, aber kurz, fest, rot, fett und heftig. Er war böse wie ein Luchs, war gefährlich und stets zum Zuschlagen gespannt, wie ein Tellereisen, liebte niemand als sich selber, und das nicht einmal genügend, daß er seine Hände und Haare in Ordnung gehalten hätte. Er ging seit der Erstürmung der Bastille in langen Hosen, nannte Madame und mich Bürgerin und war entsetzlich grob.
Aber was tun? Vor einem Jahre noch mußte jeder Salon von Geltung seinen Hausphilosophen [238] haben, nun waren die Republikaner Sensation, und wer nicht lächerlich oder gar gefährdet sein wollte, hielt große Stücke auf einen Hausrevolutionär. Der unsere war sehr unangenehm zu ertragen, denn es hatte ihn, wie alle unsere Gäste, die Neigung zu Frau Reinezabelle ergriffen. Was aber bei den anderen infolge bester Erziehung oder großer Kühle der Gemütsart ein leichtes Spielchen war, wurde bei ihm gleich zur Sache der Republik, und als Madame nicht augenblicklich der Stimme der Natur folgen wollte, wie er ihr zumutete, ward er auf Herrn Savonnard wolfsböse.
Zu allem Unglück ertappte er den armen Pierre mit Reinezabelle in dem Augenblick, als er ihren schönen Amazonenpapagei, der eingegangen war, mit ihr sezierte, nachdem er dessen Ende auf das innigste mit ihr betrauert hatte. Madame glaubte, er sei an gebrochenem Herzen gestorben, weil seit einigen Monaten der allgemeine Umgangston lauter und kreischender geworden sei, als seine eigenen Stimmmittel ihm nachzuahmen gestatteten.
[239] Pierre legte mit dem Skalpell das kleine Herz des Vogels bloß und löste es heraus. Er zeigte ihr, daß dieses leidenschaftliche Geschöpf nur drei Herzkammern gehabt habe, während der Mensch deren vier besäße.
Als nun meine schöne Herrin bei der Erwähnung dieses kleinen, unvollkommenen Herzens zu weinen begann, weil es sie an ihr eigenes erinnerte, und Savonnard ihr wie ein guter Kamerad tröstend den Arm über den Rücken legte, trat Ducrac unangemeldet ein. Er hatte mich im Nebenzimmer einfach an die Wand gerannt, sah die beiden zornerfüllt an und schrie: „Bürger Savonnard, Sie konspirieren mit dem Adel!“
Dann drehte er sich um und fuhr polternd ab wie ein Schotterkarren.
Madame lachte sehr und Savonnard auch. „Nun sind wir kompromittiert,“ rief sie fröhlich, und er schmunzelte: „Ja, wirklich, das hätte ich mir wahrhaftig nicht träumen lassen!“
So harmlos nahmen sie es; aber mir bangte, denn ich hatte vom Blutdurste Ducracs schon üble Dinge gehört.
[240] Um diese Zeit, als die französische Tagesliteratur sich in unglaublicher Weise verschlechtert hatte, brachte ich Reinezabelle endlich dazu, auch einmal einen der deutschen Dichter zu lesen, von denen sie eine sehr geringe Meinung hatte. Ich hatte schon vor über einem Jahrzehnt den „Werther“ in der Sprache meiner Straßburger Heimat gelesen, und er lag mindestens ebenso lange in einer vortrefflichen Übersetzung vor. Ich hatte diesen Band wiederholt meiner schönen jungen Frau Admiral auf das Taburett neben das Sofa gelegt, aber sie hatte ihn gar nicht aufgeschlagen.
Damals nun sollte Madame einen Ball besuchen, der um 10 Uhr abends begann. Durch die einfachere Tracht jener Saison wurde sie um eine halbe Stunde früher fertig und langweilte sich nun, während ihr Wagen unten erst aus der Remise gezogen und hergerichtet wurde.
Da entdeckte sie den „Werther“, setzte sich zum Licht und begann zu lesen.
Der Kutscher ließ melden, es sei angeschirrt. Sie sagte: „Gleich, gleich!“ und las weiter.
Die Pferde standen und scharrten, der [241] Portier brummte, der Kutscher schlief auf dem Sitze ein, sie oben hatte alles vergessen. Ball und Wagen, Bediente und mich, die ich mit meiner Stickerei hinter ihr saß und nichts hörte als ihren jähen, schnellen Atem, das hastige Herumreißen der gelesenen Blätter und immer wieder das leichte Aufschlagen einer Träne auf das Papier. Es klang, wie wenn der Föhnwind mit einzelnen verirrten Regentropfen gegen ein Fenster tippt.
Und zwei- oder dreimal hörte ich sie ganz leise und innerlich schluchzen, wobei die liebe Stimme so hoch und rein dahinzog wie der Ton einer Geige.
Gegen Mitternacht ließ sie den Wagen abschirren. Sie las weiter bis 2 oder 3 Uhr; bis zur letzten Seite und war dann so erregt, blaß und unglücklich, und doch so beseligt und schön, daß ich mich wunderte, warum noch kein Mann um dieser Frau willen gestorben sei.
„Ach,“ sagte sie mir unter Tränen. „Ich habe ja bis heute niemals gewußt, was Liebe ist! O könnte ich leiden um der Liebe willen! O gebenedeiter Monsieur Werther, o beneidenswerte [242] Lotte! Seliges Unheil! Wie geheiligt ich bin! Sagen Sie doch: Wie sieht dieser Monsieur Goethe aus? Was erzählt man sich von ihm?“
Seit jener Nacht wünschte Madame dringlichst, einmal in ihrem Leben eine wirkliche Liebe zu erleiden.
Und es kam, wie sie wünschte.
Unter ihre Gäste hatten sich in jener Zeit viele jüngere Leute gefunden, die ihre Augen sicherlich nicht zu der schönen Herrin des Salons zu erheben wagten. Es waren beflissene und ehrgeizige Menschen, die bei dem einflußreichen Bekanntenkreise Madames Gelegenheit zu einer erfolgreichen Karriere zu finden gedachten. Zu diesen Leuten gehörte auch ein junger Artillerieleutnant, der eine recht armselige Uniform trug; ein Mensch mit gelbem, magerem Gesicht, wirren Haaren und wirren Reden, die er, stets aufgeregt, in einem nicht sehr gewählten Französisch von stark italienischer Aussprache hervorstieß.
Da sein Taufname ungemein fremdartig [243] war und durch die korsische Aussprache noch viel lächerlicher klang, so nannte ihn die stets lachlustige Reinezabelle nie anders als mit diesem Namen: Leutnant Naboulione.
Der arme Teufel war wegen eigenmächtiger Entfernung aus der Armeeliste gestrichen worden, besaß nicht mehr als seine Uniform und lebte von den Soupers, zu denen man ihn einlud und die er eifrig besuchte. Er war erst seit kurzem in Paris und wünschte sehr, ein wenig in die Höhe zu kommen.
Ducrac, um dessen Freundschaft er sich neben jener des jüngeren Robespierre eifrig bewarb, versicherte mir: „Glauben Sie nur nicht, daß Leutnant Naboulione, für dessen Armut und Originalität sich die sentimentale Reinezabelle so sehr interessiert, um ihretwillen diesen Salon besucht. Ihr Mann, der Admiral, ist Hafenkommandant von Marseille, und der verabschiedete Leutnant benötigt dort dringend eine Stelle. Verweigert sie ihm, und er wirft euch seinen Hut ins Gesicht und geht anderswohin. Sagen Sie das der Bürgerin.“
Ich tat es; Reinezabelle lachte sehr und sagte:
[244] „Nun ist Ducrac auch auf Naboulione eifersüchtig. Ich muß mir den doch genauer ansehen.“ Und sie begann den gelben, ungeschliffenen Knirps mit dem zerrauften Haar zu bevorzugen, was diesem nur selbstverständlich schien. Er wurde nicht sehr viel wärmer, außer wenn er Madame von dem Glück erzählte, das ein Oberst der Artillerie in Marseille genösse.
Sie aber lachte und sagte: „Nein, wir wollen Sie in Paris haben.“
„Madame wüßten eine Stelle für mich?“
„Die beste. Alle Abend hier in meinem Salon.“
Naboulione lächelte sauer, bemühte sich aber sehr, es in verbindlicher Weise zu tun. Damals fragte ich mich empört: „Wo hat der Kerl nur seine Augen?“
Heute weiß ich freilich, wo er sie hatte.
Eines Abends war man ungemein aufgeregt. Der König war hingerichtet worden, und Ducrac gab im Salon, Frau v. Vermillon zuliebe, die Generalprobe zu einer fürchterlichen Rede, [245] die er kommenden Tages im Parlament zugunsten weiterer Adelsguillotinierungen halten wollte. Es war schaurig schön; alles applaudierte und prophezeite seiner Rede den besten Erfolg.
Naboulione stand tiefbefriedigt nebenbei. In manchen Dingen erwies er sich schon damals als der geniale Mensch, der später auch den praktischen Erfindungen seiner Zeit weit vorauseilte. Damals hatte er, im stürmischen Drang, seinen Hunger zu stillen und dennoch den Gaumen mit all den reizvollen Genüssen zu bedienen, die man hier als Erfrischungen umherbot, auf einem Brötchen folgende Dinge zusammengestopft: ein Stückchen Käse, ein Stück Salmen vom Schwanzteil, einen Essigpilz, etwas Räucherfleisch, eine Olive und ein wenig Butter1.
Daran fraß er, beständig abbeißend. Nur die Revolution machte solche Unsitten salonmöglich.
[246] Als nun Herr Ducrac seine Rede beendet hatte, versicherte Madame mit großer Lebhaftigkeit, es sei die höchste Zeit, daß die Adeligen ihre Stellen räumten, um sie den unverbrauchten Kräften der Republik abzutreten. Sie selbst habe, teils aus Überzeugung, teils aus Sorge um den Kopf ihres Mannes, den Admiral de Vermillon bewogen, seine Stelle niederzulegen und sich ins Privatleben zurückzuziehen.
„Unmöglich!“ schrie entsetzt Leutnant Naboulione dazwischen.
Reinezabelle fragte ihn, warum er so böse sei?
„Weil ein Mann auf seinen Posten gehört. Weil es von einem Kommandanten schändlich ist, aus Sorge um seinen Kopf sich den Pflichten zu entziehen, die er noch nicht einmal erfüllt hat! Marseille ist schlecht armiert. Es mangelt dort an Artillerieoffizieren. In Marseille ist Admiral Vermillon notwendig, in Paris als Privatier höchst überflüssig!“
„Aber mir ist er nicht überflüssig,“ sagte Madame, der es Freude machte, ihn mit ihrem [247] Manne zu necken, in schuldlosem Ton. „Ich habe ihm selbst geschrieben, zu mir zu eilen in einer Zeit, wo Liebe, Treue und zartes Gefühl teuer zu werden beginnen. Ich habe ihm heute bei der Nationalversammlung sein Entlassungsdekret erwirkt. Aber, Herr Leutnant! Sehen Sie mich nicht so böse an. Sie werden mein täglicher Freund bleiben, auch wenn der Admiral zu Hause ist.“
„Sie zerreißen das Entlassungsdekret! Nicht wahr, Ducrac, es ist doch zu annullieren?“ bat der tolle, kleine Mensch.
„Aber im Gegenteil,“ rief Reinezabelle. „Ich habe es heute mit der Eilpost abgeschickt und ...“
Naboulione schnitt ihr das Wort auf eine Weise ab, wie sie unmöglich in Korsika, ja nicht einmal auf den Südseeinseln üblich sein konnte! Er warf ihr die noch unverzehrte Hälfte seines belegten Brötchens an den Kopf.
Reinezabelle schrie laut auf vor Schreck, und wir waren alle zerdonnert, ja geradezu in Salzsäulen verflucht.
Dieses war die ungeheuerlichste Tat der [248] Republik. Der Kopf des Königs wog nicht so schwer als diese brutale Mißhandlung einer schönen Frau.
Naboulione entfernte sich in großer Bewegung, und mit einem Ausdruck voll Schreck, Sorge und ausbrechender Liebe sah ihm Reinezabelle nach. Im blonden Haar steckte ihr das Schweifstück des Salmen, am Ohrgehänge hatte sich ein Bissen Räucherfleisch verfangen, und die Butter befleckte ihr sonst stets lächelndes Grübchenkinn. Aber sie machte keine Bewegung, sich zu reinigen.
Es war ein entsetztes Stillschweigen hinter dem wilden kleinen Artilleristen. Erst als Ducrac die Roheit hatte, Bravo zu sagen, ging das Gezeter über Naboulione los. Man fand, das Maß der Schrecken habe seinen Höhepunkt erreicht, und während ich Madame abputzte, sagte ein Orientalist, daß solches bei den Türken unmöglich wäre, und zitierte einen arabischen Spruch hierzu:
Reinezabelle aber sagte, während ich sie [249] abwischte, nur immer verklärt: „Welche Leidenschaft! Welche Leidenschaft! Und bloß, weil mein Mann zu mir kommen soll. Nein, diese Leidenschaft! Das ist korsisch, meine Liebe!“
Ich glaube, sie hätte den kleinen, schlimmen Leutnant in allen Gassen von Paris suchen lassen, wenn sich nicht am nächsten Tage Ducrac ebenso abscheulich benommen hätte. Er hatte seine Rede gehalten. Ein brüllender Aufruhr fegte durch die Gassen; aus dem wimmelnden Volkstrott ragten auf Stangen gespießte Köpfe. Eben zog sich Reinezabelle, die neugierig ans Fenster geeilt war, mit den Worten zurück: „Kommen Sie, liebe Babette, ich sehe dergleichen immer noch nicht gerne,“ da flog ein abgeschlagenes Menschenhaupt auf den Balkon herauf, kollerte in das Zimmer und eine Stimme rief: „Besuch von Herrn Savonnard! Souvenir der Revolution!“
Madame war leichenblaß geworden. „Nein,“ sagte sie dann, „das wird zu arg! Diese Leute beginnen geschmacklos zu werden mit ihren Köpfen. Räumen Sie das hinaus und lassen Sie sofort meine Koffer packen.
[250] Wir wandern aus. Die Sitten sind hier zu frei. Nicht wegen dem belegten Brötchen, o nein. Aber an die Art dieses Ducrac werde ich mich niemals gewöhnen. Er hat mir alle Freude an Paris verdorben.“
Im Exil zu Köln verbrachte sie sehnsuchtsvolle Jahre. Sie konnte den kleinen, rohen Naboulione seit seiner Schandtat nicht mehr vergessen. Als dann der kleine Leutnant bei Lodi und Novi, bei den Pyramiden und bei Marengo zum großen General wurde und die Welt auch am Konsul Bonaparte noch immer nicht genug erlebt hatte, als er, der Kaiser, seinen drolligen Taufnamen wieder hervorsuchte, nur daß er ihn jetzt in besserem Französisch zu nennen wußte, da weinte die unglückliche, einsame Frau vor leidenschaftlicher Liebe nach ihm, dem sie nie mehr wieder nahetreten sollte.
„Ach,“ klagte sie. „Ich hatte die ganze Geschichte des Rokoko und der Revolution in Gestalt von Freunden durchgeliebt und sie gaben sich in allen Nüancen dieser wechselreichen Zeit; aber mißhandelt hat mich keiner.
[251] Er aber, er hat Völker, Könige, Ideen, Religionen, Philosophien und Gelehrte geschlagen. Alle mit anderen Mitteln, mich aber, allein von allen, durch den Schwung seiner zornigen Hand. Mir bestätigte er seine Eigenart am persönlichsten.
Und nun ist er Kaiser; er heiratet diese Marie Louise und ich hätte ihn so gut verstanden.
Schade! O schade!“

End of Project Gutenberg's Vom sterbenden Rokoko, by Rudolf Hans Bartsch
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VOM STERBENDEN ROKOKO ***
***** This file should be named 57765-h.htm or 57765-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/7/7/6/57765/
Produced by Franz L Kuhlmann, Norbert H. Langkau, Jana
Srna and the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.