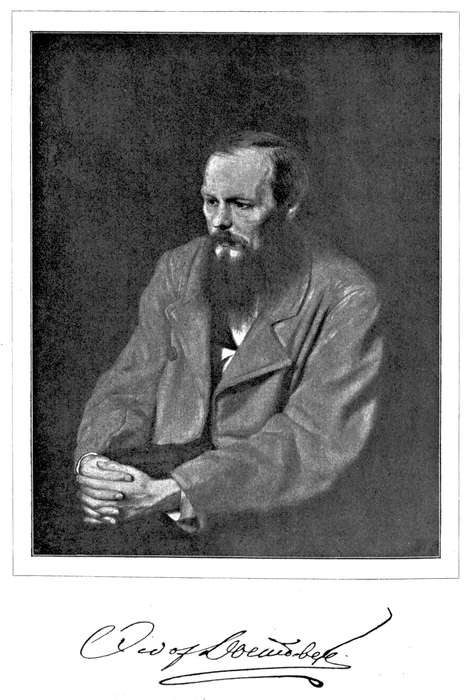
The Project Gutenberg EBook of Th. M. Dostojewsky, by Nina Hoffmann
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Th. M. Dostojewsky
Eine biographische Studie
Author: Nina Hoffmann
Release Date: June 9, 2016 [EBook #52283]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TH. M. DOSTOJEWSKY ***
Produced by Peter Becker, Jens Sadowski, and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This
file was produced from images generously made available
by The Internet Archive.
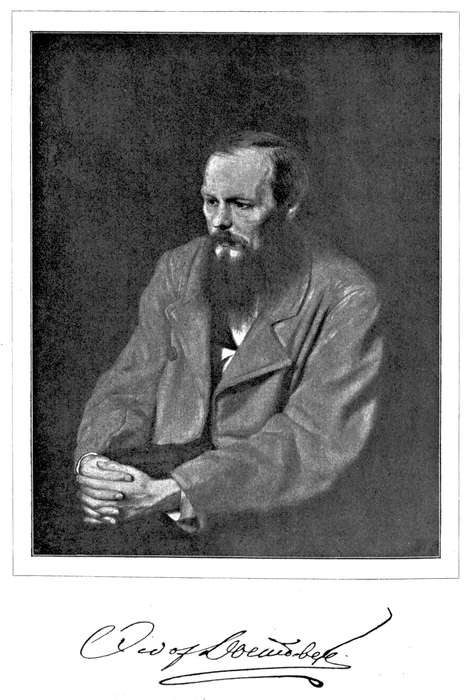
Eine biographische Studie
von
N. Hoffmann.
Mit Bildnis.

Berlin.
Ernst Hofmann & Co.
1899.
Nachdruck verboten.
Übersetzungsrecht vorbehalten.
Meinen russischen Freunden
gewidmet.
Δαίμων.
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Goethe.
| Seite | ||
| I. | Das Milieu | 1 |
| II. | Kindheit und Jugend | 17 |
| III. | Katastrophe | 59 |
| IV. | Semipalatinsk | 130 |
| V. | Petersburg | 171 |
| VI. | Publizistik | 191 |
| VII. | Zweite Vermählung. Schuld und Sühne. Abreise | 252 |
| VIII. | Vierjähriger Aufenthalt im Auslande | 276 |
| IX. | Briefwechsel aus der Fremde | 300 |
| X. | Petersburg; die letzten zehn Jahre | 405 |
| Anhang. Bibliographische Übersicht | 443 | |
| Personen- und Sach-Verzeichnis | 446 |

„Vorreden sind immer Entschuldigungen“, hat jüngst ein geistvoller Schriftsteller in einer der seinigen gesagt. Der Verfasser des vorliegenden Buches geht weiter. Er erhebt Einspruch dagegen, dass seine Arbeit als ein litterarhistorisches Werk angesehen werde; er will sie durchaus nur als Lebensdokument einer ungeheuren Persönlichkeit betrachtet wissen, und wünscht als einzigen Erfolg dieses Buches, dass etwas von dem zwingenden und zugleich versöhnenden Geiste des grossen Dichters durch seine Blätter wehe und die Gemüter in seinem Sinne erfasse. Eine Entschuldigung allerdings wäre am Platze: dem Dichter und dem unerschöpflichen Material gegenüber, das ganz zu bewältigen dereinst die Arbeit Vieler ausmachen wird.
Einige orientierende Bemerkungen sollen jedoch hier ihre Stelle finden. Im grossen Ganzen habe ich den Stoff chronologisch geordnet. An einigen Stellen indes schien es mir notwendig, um ein Ereignis von allen Seiten plastisch hervortreten zu lassen, spätere briefliche Äusserungen des Dichters sofort heranzuziehen.
Die Werke der ersten Periode, welche ich, mit Ausnahme der „Armen Leute“, in die Periode des Tastens und der Nachahmungen einreihen muss, habe ich nicht im Einzelnen besprochen, da sie mir unter denselben Gesichtswinkel zu fallen scheinen und sich, bei aller Vortrefflichkeit und Feinheit psychologischer Einzelheiten — vom Standpunkt der russischen breiten Ethik aus, den allein ich festhielt —, nicht allzusehr von einander differenzieren.
Die Werke der zweiten, nachsibirischen Periode, ebensoviele Etappen auf dem Wege zur Vollendung seines Apostolats, habe ich nach Massgabe ihrer Ausgeprägtheit und ihres Verstandenseins durch den westeuropäischen Leser mehr oder weniger breit behandelt.
Inbetreff der Fussnoten, welche eine Arbeit haben muss, die aus vielfachem Material geschöpft hat und auf Glaubwürdigkeit Anspruch erheben darf, befand ich mich in einiger Verlegenheit. Für den deutschen Leser wären Orts- und Seitenangabe meiner Quellen wertlos gewesen, da ich aus unübersetzten russischen Autoren schöpfte. Auch die den Werken des Dichters entnommenen Stellen könnte der deutsche Leser nicht in den umlaufenden Ausgaben nachschlagen, da ich sie selbst nach meinem Verständnisse aus dem Original übersetzte. Der russische Leser aber kennt alles, was über Dostojewsky geschrieben worden, sofern er sich für diesen Dichter und seine Richtung interessiert, vortrefflich und findet in den Namen und Quellen, die ich im Texte reichlich angab, genug Anhaltspunkte zum Nachschlagen. So verzichtete ich denn auf Nachweise, die mir in diesem Falle als eine Spiegelfechterei erscheinen mussten.
Wien, Januar 1899.
N. Hoffmann.

Über Theodor Michailowitsch Dostojewsky in seiner Gesamt-Erscheinung als Dichter, Psychologe, als Ethiker und Mensch zu sprechen, ein erschöpfendes Bild seines Lebens und seiner künstlerischen, sowie vor allem seiner seelenzwingenden Wirksamkeit zu geben, das wäre heute, sogar in Russland unter seinen Landsleuten, ein gewagtes Unternehmen. Einerseits ist er der gegenwärtigen Generation noch zu nahe; alles was über ihn gesagt werden könnte, stünde noch im Zeichen des Kampfes. Er hat ja, wie alle mächtig ausgeprägten Individualitäten, im Leben bis zu seinem letzten Atemzuge heftig gekämpft und Kampf erzeugt.
Anderseits leben seine nächsten Angehörigen, seine Freunde noch, und diese sind im Besitze der intimeren Erinnerungen und Äusserungen seines persönlichen Lebens, die sie begreiflicherweise heute schon preiszugeben nicht geneigt sein können; ganz abgesehen davon, dass die Ausnützung intimer Lebensverhältnisse zum Zwecke des Litteraturklatsches, ohne Hinblick auf die inneren Zusammenhänge und die Einheitlichkeit des Wesens, dem man nahe zu kommen trachtet, nicht scharf genug als müssige Indiskretionen gebrandmarkt und verpönt werden können.
Wir Europäer hinwieder bringen dem Dichter eines uns in hohem Grade interessierenden Volkes eine Art unbehaglicher, verblüffter Neugierde entgegen, zu der uns der grosse Seelen- und Krankheitskenner und Maler wohl zwingt, lehnen aber die nähere Bekanntschaft seines tiefen Zusammenhanges mit jenem Volke aus Bequemlichkeit, aus Furcht vor dem Fremdartigen dieses Volkes ab, das, wie Nietzsche sagt, „die allerstärkste und erstaunlichste Kraft, zu wollen, in sich aufgespeichert hat, mit der ein Denker der Zukunft wird rechnen müssen“. Dazu tritt noch, dass unser grosses Publikum alles, was von Russland kommt, unserer heutigen Ideenrichtung nach nur dann besonders fesselt, wenn es die Äusserungen sozialistischer, revolutionärer, atheistischer Anschauungen einer unter harter Despotie seufzenden Intelligenz vermittelt. Äusserungen, deren Intensität im Gegensatze zu den sie hervorrufenden Zuständen, es fast als litterarische Pikanterie geniesst.
Aber mit der eigentümlichen Erscheinung eines Dichters, der zugleich lebensvoll (nicht asketisch wie Tolstoi) und mystisch religiös, der durchaus demokratisch und dabei durchaus konservativ ist, wissen wir nichts anzufangen.
Dostojewsky ist, wenn nicht der einzige, so doch der grösste Repräsentant dieser merkwürdigen Konstellation, und wir müssen die scheinbaren Widersprüche, die darin liegen, in der Grösse seines Genies und seines Herzens auflösen und etwa so ansehen, wie wir die Widersprüche der Natur ansehen, welche Tag und Nacht, Ost und West mit einem grossen Ringe umspannt. Vor allem dürfen wir Dostojewsky nicht litteraturmässig auffassen, sondern als einen grossen, seelenbewegenden Schöpfer „in einem ungeheuern Reich, mit einem ungeheuern Willen“. Unter uns hört man oft den Ausspruch: „Dostojewsky ist ein grosser Künstler, aber sein mystisches Christentum ist sehr störend“. So angesehen zerfällt sein Bild sofort in einzelne Teile. Man muss vielmehr sagen: er ist ein Apostel des Glaubens an die Mission der Volksseele, an die Läuterung auch Europas durch das russische Volk, und er kann, vermöge seines unvergleichlichen Dichtergenius, seine Wahrheiten nicht anders hinausrufen, als in Werken von hohem künstlerischen Werte.
So gefasst bleibt uns seine Erscheinung eine Einheit, die wir in allen seinen Werken wiederfinden, so fest und kompakt wie etwa ein Urgestein, das bei dem kleinsten Bruch dieselbe Krystallgestalt zeigt.
Wir werden also vor allem diese ethische Einheit im Auge haben, wenn wir es versuchen, an der Hand lückenhafter russischer Biographieen, sowie des Materials, das uns seine Tagebücher, die Aufzeichnungen seiner Gattin, seiner Freunde und Mitarbeiter und vor allem seine Werke vermitteln, ein, soweit es möglich ist, getreues Bild seines Lebens und Wirkens einem deutschen Leserkreis zu geben.
Ehe wir aber das biographische Material ausgestalten, müssen wir einige Vorbemerkungen über das Milieu einschalten, dem der Dichter entsprossen ist.
Wenn wir nämlich die Werke französischer, englischer, italienischer, kurz europäischer Schriftsteller lesen, so bringen wir ihrem Milieu so viel Kenntnis und Anpassungsvermögen entgegen, dass wir ohne weiteres sagen, der oder jener schildere die Menschen so oder so. Lesen wir indes russische Werke, so ist unser Urteil steuerlos; wir sehen ein fremdartiges, uns sehr unbequemes Milieu und darin — einen Russen, den wir uns erst in unser Menschliches übersetzen müssen, wobei wir oft unsere liebe Not haben. Das hat seine tiefe Bedeutung. Wir haben da wohl mit Halbbarbaren zu thun, aber mit jungen, ungebrochenen Kräften, mit einem Volke, das wir erst kennen lernen, demgegenüber wir manches „umlernen“ müssen.
Allerdings kann ein Nichtrusse, namentlich, wenn er sich nicht eine lange Zeit im Lande selbst umgesehen hat, kein lebendiges und ganz zutreffendes Bild von Russland und seinem Volke entwerfen. Lässt ja Dostojewsky selbst in einem seiner Romane zwei gute Patrioten ein Gespräch miteinander führen, in dem der eine ungefähr sagt: „Der M. N. giebt vor, zu wissen, was Russland ist — ja wissen wir es denn selbst?“
Nun aber kann ein Fremder, der sich die Sprache so zu eigen gemacht, dass er ihre intimen Nüancen, die familienhafte Unmittelbarkeit ihrer Laute nachempfindet, ein solcher Fremder kann wohl mit frischem Blicke und ganz unbefangen gewisse Hauptmerkmale der Volksseele, die diese Sprache ausdrückt, gewahr werden. Dies ist hier um so leichter der Fall, als alles Russische ein so durchaus uneuropäisches Gepräge an sich trägt.
Was uns als ein durch alle Schichten dieses Volkes gehender Zug vor allem auffallen muss, ist die familienhafte Zusammengehörigkeit und Brüderlichkeit aller mit allen. Dies drückt sich schon in der Sprache aus: Väterchen, Mütterchen, du mein Verwandter, oder: du meine Verwandte sind die gebräuchlichsten Formen der Anrede. Dieses Familiengefühl geht von unten hinauf, nicht umgekehrt, allein das ist es, was ihm ewige Dauer sichert. Dadurch, dass der Sprachgebrauch in der direkten Anrede keine Titel und keinen Geschlechtsnamen, nur Taufnamen mit dem höflichen Zusatz des Vatersnamens zulässt, geht eine, wenigstens formale Intimität durch die ganze Nation, von welcher sich kein modern „demokratisches“ Volk etwas träumen lässt. Nicht nur der Bauer, sondern auch der Hoflakai führt für den Kaiser oder Grossfürsten keine andere Benennung oder Anrede im Munde als etwa: „Nikolai Alexandrowitsch, Helene Pawlowna lässt Euch bitten“ oder ähnliches. Für das Volk ist diese Form eine intime Herzenssache, für die „Gesellschaft“ hat sie nur den Wert einer patriarchalischen Reminiscenz, und das Volk selbst als „Brüder“ zu betrachten, ja einen wie immer beschaffenen Massstab an seine Leiden und Freuden zu legen, hat die Gesellschaft der oberen Zehntausend bis heute noch nicht geträumt. Darin liegt wohl, wie es scheint, die scharfe Trennung der konservativen russischen Kreise von den neueren liberalen. Allerdings wachsen auf diesem Gebiete Missverständnisse wie die Disteln empor. Denn, indem sich viele energische Liberale nicht auf die Vermenschlichung ihrer Beziehungen zum Volke, auf den guten Einfluss der Bildung allein beschränken, die sie diesem hochintelligenten, aber in tiefe, abergläubische Religiosität eingesponnenen Kinde vermitteln, so fallen ihnen andere Wohlmeinende in die Hände, welche von der Vernichtung der Unwissenheit und des Aberglaubens auch jene des Glaubens und der Ehrfurcht befürchten; so wird die Beziehung der Intelligenz zum Volke in ein Gebiet übergeleitet, das sich von den ursprünglichen Absichten allmählich und unbemerkt entfernt.
Ein anderer Zug, welcher durch alle Schichten des russischen Volkes geht (die Gesellschaft als solche aus dem Spiel gelassen), ist eine Fähigkeit zum Leiden und Mit-Leiden, das sich auf den Schuldigen und Verbrecher erstreckt. Auch hier giebt uns die Sprache bedeutsame Fingerzeige; das Volk nennt jeden Verbrecher einen „Unglücklichen“, und die Sprache selbst, welche für das Menschliche drei Ausdrücke streng unterscheidet, nämlich: „Menschlich“, „Allgemeinmenschlich“ und „Allmenschlich“, sie hat für die Nüancen der Schuld, die wir dreifach besitzen: „Übertretung“, „Vergehen“, „Verbrechen“, ausser dem Worte Schuld nur das eine Wort „Übertretung“ (Prestupljenie).
Wir sehen hier, dass wir es mit etwas anderem zu thun haben, als mit unserem europäischen Mitleid, das die Franzosen unter anderem „une fonction purement cérébrale“ nennen, eine reine Gehirnangelegenheit, im Gegensatze zur allmächtigen und allberechtigten „passion“. Hier ist eine Kluft zwischen den Ausgangspunkten der ethischen Anschauungen von Ost und West, die man nicht ernst genug betrachten kann.
Ein anderer auffallender Zug der russischen Natur ist die mit tiefer Religiosität verbundene Demut des Russen, die auch da erhalten bleibt, wo, wie in den Kreisen der dem Westen nachstrebenden Intelligenz, jede Spur von Glauben gewichen ist. Der Russe ist sehr schnell bereit, sein Unrecht einzusehen und auch einzugestehen, sowie sich um deswillen vor Freund und Feind zu demütigen oder anzuklagen. Da nun ein solcher Einsichtswechsel bei seiner nervösen, grübelnden und immerfort „die Wahrheit“ suchenden Natur sehr oft vorkommt, so bietet er uns Westländern, die wir Dekadenten, d. h. mit unseren Gebrechen kokettirende Menschen sind, ein Bild feiger Selbsterniedrigung. Denn der Westen versteht heute zumeist unter dem Begriff „Charakter haben“, dass man nichts verzeihen und nichts zugeben solle, und es ist ihm um viel realere Güter zu thun, als um die bei den Russen in jeder Lebenslage auftauchende Sorge und Frage „wie soll mein Leben sein?“
Ein dritter, hervorstechender Zug, der uns bei dem Russen auffällt, ist das, was wir Deutsche Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit, Regellosigkeit nennen müssen. Wenn man die Unmöglichkeit erprobt hat, ein echtes Kind der russischen Erde zu einer festgesetzten Zeit an einen bestimmten Ort zu bekommen, oder in seinem Hause, seiner Tageseinteilung auch nur das geringste System oder die geringste Ordnung zu finden oder zu schaffen, so möchte man fast das bekannte Sprichwort erweitern und sagen: „Dem Glücklichen, sowie dem Russen, schlägt keine Stunde“. Russen können zu jeder Stunde des Tages ihr Lager aufsuchen, wenn sie etwa verstimmt sind, zu jeder Stunde der Nacht Thee trinken und Freunde besuchen. (Dabei spielt wohl der Einfluss der hellen, den Schlaf bannenden Nächte eine grosse Rolle.) Aber nicht das allein. Sie bringen ihre Freunde zu anderen Freunden, ohne Anfrage, ohne Umstände, zu allen Mahlzeiten, mitten in der Nacht. Diese Freunde der Freunde sind etwa krank, erkranken dort in fremdem Hause, oder sie erhalten dort eine schwere Nachricht — so ist das ganze fremde Haus, das nun nicht mehr ein fremdes ist, in Mitleidenschaft gezogen. Man bleibt zusammen auf, man quartiert den Freund des Freundes und sich im eigenen Hause wie in einem Bivouac ein, das man zum erstenmal bezogen, kurz es ist eine selbstverständliche Lebensgemeinschaft. Ein Russe, dem man einmal seine absolute Unpünktlichkeit vorwarf, erwiderte mit vielem Ernste: „Ja, das Leben ist eine schwere Kunst! es giebt Augenblicke, die richtig gelebt sein wollen und viel wichtiger sind, als das pünktlichste Worthalten.“
Und nun die russischen Frauen. Sie leben und weben von innen heraus, sie haben grosse Ziele, ernste Interessen, ein offenes Auge für die Aussenwelt, für das, was sie umgiebt und was not thut. Die russische Frau verbindet die Reinheit und den Enthusiasmus eines jungen Mädchens mit der Klarheit und der Vorurteilslosigkeit des Mannes; sie hat etwas Jünglinghaftes an sich. Dabei nimmt sie es allerdings mit der bis ins kleinste gehenden Akkuratesse einer deutschen Hausfrau, oder mit der bis in die feinste Abschattung durchgeführten Eindrucks-Delikatesse der Französin nicht auf. Das Daheim einer echten Russin wird mitunter ein Chaos aufweisen, das unsere Landsmänninnen, namentlich jene des Nordens, abschrecken müsste. Doch auch die Russin wird uns auf unsere Vorstellungen über Genauigkeit und Ordnung antworten: „Ja, jeder Augenblick will richtig gelebt werden, das Kleine darf das Grosse, das Detail nicht das Allgemeine verbauen“, und wir hörten einmal eine Russin sagen, dass die Petersburger Frauen und Mädchen auf der Strasse sehr eilig gehen und in die Ferne schauen, so dass man sehen könne, wie sie einem Ziele entgegen gehen, während die Frauen europäischer Grossstädte so gehen, als wäre die Strasse selbst das Ziel. Es ist eben die „breite russische Natur“ („schirokaia russkaia natura“), wie sie es nennen, was sich überall geltend macht, und wir möchten uns, gerade auf diese so unharmonisch scheinende Verbindung gestützt, der Anschauung Dostojewskys anschliessen, welcher sagt, dass die nächste Zukunft des Menschengeschlechtes in der Hand der Russin liegt.
Hier muss jedoch sofort betont werden, dass diese Umgestaltung nicht auf dem Wege der Frauenbewegung als vor sich gehend gedacht werden darf. — Die russische Frau hat ihre ethische und soziale Befreiung längst vollzogen und zwar — wenn wir die Spezies Nihilistin ausnehmen — ganz organisch, von einem rein natürlichen Standpunkt aus in Angriff genommen, von dem der Mütterlichkeit. Sie will und muss die Gefährtin, ja Führerin ihrer männlichen Hausgenossen sein, ihre Interessen teilen, in ihrem Rate eine vollwichtige Stimme haben. Ferner wirkt im Gemüte der russischen, von Vorurteilen befreiten Frau vor allem der Wunsch, nützlich zu sein, ihrem Volke zu dienen. So ist es gekommen, dass die Russin heute ihre Fähigkeit zu Freiheit und Kultur schon durch ihr Leben bewiesen hat, während die europäische bewegte Frau ihre Freiheit und Kultur mittels des Beweises anstrebt, dass sie fähig sei, abseits von der Familie zum Leben zu gelangen. Dies ist ein grundlegender Unterschied.
Den genannten Hauptcharakterzügen des Russen gesellt sich ein unausrottbares Misstrauen in allen seinen Beziehungen zum Nebenmenschen bei, allein ein Misstrauen, das viel mehr dem immerwachen Gefühle der eigenen Unzulänglichkeit und „Sündhaftigkeit“ entspringt, als dass es sich auf den Unwert des anderen bezöge. Es ist das Misstrauen der Demut im Gegensatze zum Misstrauen der Routine.
Sehen wir uns dazu den geographischen und historischen Hintergrund an, aus dem heraus sich diese Volkspersönlichkeit entwickelte, so finden wir ein ungeheures, kompaktes Reich mit uferlosen Steppen und einem unermesslichen Horizont, wo das träumende Auge des Steppenbewohners in eine grenzenlose Einsamkeit hinausblickt, dünn bevölkert, ohne bedeutende Küstenentwicklung, ohne namhaften Welthafen — „ein Riese in einer grossen, niedern Stube“, wie Dostojewsky sagt. Diese kolossale Einheit ist einer Sprache, eines Glaubens, sie hat keine durchgreifenden Mischungen und sprachlichen Umbeugungen erlitten, kein fremdes Blut, es sei denn finnisches, hat diesen Riesenkörper durchädert. Sein „weisser Kaiser“ ist ihm Vater, hoher Priester, Herr, zu dem es als zu dem Helfer in aller Not blind vertrauend aufblickt. Dieses Volk macht seine Entwickelungsprozesse langsam durch, steht heute in seiner Kindheit und wandelt seinem Mittelalter zu. Ackerbau und Viehzucht sind noch heute seine vornehmlichen Lebensquellen, die Städte sind dünn gesäet, der Kleinhandel ist in den Händen des moskowitischen Kleinbürgers, Grosshandel und Industrie ebenfalls in den Händen des grossen Moskauer Kaufherrn, sowie in denen des Ausländers und des Juden. So giebt es denn kein eigentliches grosses Bürgertum, und die Gesellschaft, die wir heute Bourgeois nennen, setzt sich aus dem kleinen Landsassen — Gutsbesitzer — und dem Beamtenstande zusammen.
Dieses höchst langsame, doch organische Wesen der Volksentwickelung hat Peter der Grosse mit seinen Reformen durchrissen. Ein mit unermesslichen Mühen und Opfern dem Meere abgerungenes Stadtgebiet ist der Beginn und gleichsam das Symbol seiner zivilisatorischen Thätigkeit. Petersburg, das „ausgebrochene Fensterchen“ gegen Europa zu, hat europäische Luft und europäisches Wesen, Europas Sitten und Unsitten, Europas Philosophie, Aufklärung und Dekadenz, kurz den „Europäismus“, wie sich Dostojewsky ausdrückt, hereindringen lassen. Die kompakte Masse des Volkes indessen ist von diesen Neuerungen nicht berührt worden, und wenn auch hie und da in den Städten der altrussische Bart der europäischen Schere, und der Zipun, der altrussische Kittel, dem europäischen Kleide zum Opfer gefallen ist, so ist doch der Bauer bis auf den heutigen Tag nicht zum Bewusstsein seiner Bürgerrechte im europäischen Sinne erwacht. Gleichwohl ist er im Besitze gewisser alter Gemeinderechte und -freiheiten (Obščina, Mir), welche in den Augen vieler zeitgenössischer Agrarier als die einzige Lösung aller Schwierigkeiten des Grundbesitzes und als das einzige Arcanum gegen die Proletarisierung des Bauernstandes erscheinen. Ob dies eine richtige Anschauung sei, können wir hier nicht untersuchen.[1] Auch über die wichtigste Streitfrage, welche die führenden Geister Russlands seit der nachpetrinischen Zeit bewegt hat und noch heute bewegt, wiewohl sie im Erlöschen zu sein scheint, können wir hier nur ganz kurz sprechen, müssen sie jedoch berühren, weil die zwei Hauptströmungen des russischen Lebens aus ihr entspringen und dem Europäer nur durch den Einblick in diese Frage das Verständnis für Russland und sein künftiges Werden aufzugehen vermag. Es ist dies die Frage, die v. Reinholdt in seiner „Geschichte der russischen Litteratur“ folgendermassen formuliert: „Wie verhält sich die orthodoxe Kirche zur römischen und protestantischen? als ursprüngliche Gemeinschaft anfänglicher Unterschiedslosigkeit, aus welcher, auf dem Wege späterer Entwickelung und des Fortschritts andere, höhere Formen religiöser Weltanschauung sich entwickelten, oder als ewig dauernde und ungeschmälerte Vollkommenheit der Offenbarung, welche in der occidentalen Welt der römisch-germanischen Anschauungen sich unterworfen, und infolgedessen in entgegengesetzte Pole sich spaltete“? Endlich: „Worin besteht der Gegensatz zwischen der russischen und der westeuropäischen Zivilisation? — bloss in der Entwickelungsstufe oder in der Eigentümlichkeit der Bildungselemente? Steht es der russischen Zivilisation bevor, nicht allein von den äusseren Resultaten, sondern auch von den Grundlagen der westeuropäischen Bildung durchdrungen zu werden? — oder wird sie, nachdem sie ihr eigenes orthodox-russisches geistiges Leben tiefer erfasst, die Grundlagen einer neuen, künftigen Phase allgemein menschlicher Bildung abgeben?“
Die Anhänger der westlichen Einflüsse bejahen den ersten Teil dieser Frage, die Slavophilen den zweiten. Einige Slavophilen, darunter J. Kirejewsky, erwarten von einer Synthese beider, einander so widersprechender Bildungsformen das Heil künftiger Menschheitsentwickelung und zwar so, dass die westliche Kultur die Gedankenwelt des Ostens entwickele und kläre, die östliche tiefe Seeleneinheitlichkeit hinwieder die Gefühlswelt und Ethik des Westens mit ihrer „Allmenschlichkeit“ befruchte. Und in der That, wer seine Hoffnungen und Schlüsse für die Zukunft des grossen Volkes mit der „erstaunlichen Kraft zu wollen“ nicht nur auf seine Historie, sondern auf diese in jedem Russen zu findende latente und eigenartige Menschheitskraft und Fähigkeit aufbaut, der muss, unbefangen urteilend, finden, dass nicht sowohl Russland von unserer Zivilisation etwas Umgestaltendes zu erwarten hat, als dass vielmehr wir von seiner Kraft eine Rückkehr zur Natur, eine Neu-Vermenschlichung zu empfangen gewärtig sein können.
Es ist hier, wie angedeutet, nicht der Ort, die bedeutenden Führer im Streite ihre Sache selbst führen zu lassen. Die slavophile Richtung wurde zum erstenmale theoretisch formuliert durch den unter Katharina II. lebenden Geschichtschreiber, Fürsten Michael Schtscherbatow, um das Ende des 18. Jahrhunderts herum; die bedeutendsten späteren Vertreter dieser Richtung sind Kirejewsky,[2] Chomjakow, die Brüder Aksakow u. a. Die westlichen Einflüsse vertreten vornehmlich Belinsky, A. Herzen, Granowsky u. a.
Am eindringlichsten und tiefsten ward diese Frage durch Dostojewsky behandelt, wie wir dies in seinem Leben und seinen Werken erkennen. Indessen geht schon durch die ganze russische Litteratur neben der Frage nach dem Werte der westlich-östlichen Kultur, ja als Wurzel dieser Frage die Sorge des russischen Menschen hindurch: „wie soll mein Leben sein?“ — Dostojewsky hat in seiner berühmten Puschkin-Rede im Jahre 1880 in Moskau die Bedeutung Puschkins, dessen Standbild man eben enthüllte, dahin erklärt, dass dieser Dichter — nachdem mehr als ein Jahrhundert nach Peters Reformen verflossen war, ehe sich der Keim einer russischen Litteratur entwickelte — nicht nur, wie Gogol gesagt hatte, des russischen Geistes grösste und einzige, sondern auch seine prophetische Offenbarung gewesen sei. Dostojewsky führt in dieser Rede den Gedanken aus, dass Puschkin schon in seiner früheren Periode der Nachahmung André Cheniers und Byrons plötzlich einen neuen, ganz und nur russischen Ton gefunden hat, die echt russische Antwort auf die Frage, die „verfluchte Frage“, wie er sie anführend nennt, „nach dem Glauben und der Wahrheit des Volkes“. Diese Antwort laute: „Demütige dich, stolzer Mensch, und vor allem brich deinen Hochmut, demütige dich, eitler Mensch, und vor allem mühe dich auf heimatlichem Boden“ — und weiter: „nicht ausser dir ist deine Wahrheit, sondern in dir selbst; finde dich in dir und du wirst die Wahrheit schauen“.
Wir haben diese Stelle wörtlich angeführt, weil sie für Dostojewskys Stellung in der Litteratur und seine Auffassung vom Apostolat des Dichters und namentlich des Publizisten von grosser Wichtigkeit ist.
Der Herausgeber von Dostojewskys gesammelten Werken, K. Slutschewsky, sagt in seiner Vorrede ganz im Sinne Dostojewskys: „Mit ganz besonderer Schärfe treten in unserem Volke drei grundlegende, wesentliche, ausschliesslich ihm zukommende Züge hervor. Schon im Jahre 1861, in der Anzeige von der Ausgabe der „Wremja“ hat Dostojewsky gesagt, dass vielleicht die russische Idee die Synthesis aller jener Ideen sein werde, welche Europa entwickelt hat, weil wir nicht umsonst alle Sprachen sprechen, alle Zivilisationen begreifen, an den Interessen aller europäischen Nationen Anteil nehmen, was unbedingt bei keiner anderen Nation vorkommt. Unser zweiter, ausschliesslich uns gehöriger Zug, den Dostojewsky wiederholt dargelegt und mit Zähigkeit in That und Wort durchgeführt hat, das ist die in unserem Volke lebendige Erkenntnis seiner „Sündigkeit“, eine Erkenntnis, welche es sehr gut erklärt, warum wir so leicht verzeihen, so geneigt zur Selbstgeisselung sind, warum wir unsere Unvollkommenheit nicht in ein Gesetz zu bringen, die sogenannten „Rechtsverhältnisse“ nicht anzuerkennen vermögen und gerne das Kreuz innerer Reinigung und äusserer schwerer That tragen mögen, sei es auch unserem eigensten Ich zum Trotz. Der dritte Zug ist unsere rechtgläubige Religion, die niemals und nirgends, wie etwa der Katholizismus und Protestantismus (von den anderen zu schweigen), als streitende Kirche aufgetreten ist.“
Fügen wir noch zwei kleine, sehr bezeichnende Episoden aus Dostojewskys Erlebnissen hinzu, die hierher gehören, so haben wir annähernd ein Bild von dem Milieu gewonnen, aus dem heraus sich dieser Dichter-Genius entwickelt und auf das er hinwieder gewirkt hat.
K. Aksakow erzählt im März 1881, schon nach Dostojewskys Tode, folgendes: Auf einer Durchreise Dostojewskys geschah es, dass er sich in Moskau aufhielt und uns besuchte. Er begann unter anderem mit einer Art Begeisterung von dem verstorbenen Kaiser Nikolaus Pawlowitsch zu sprechen; davon, wie sich auf dem Hintergrunde der Vergangenheit das historische Bild dieses Monarchen grossartig abhebt, eines Monarchen, der fest an seine Würde, an sein Recht glaubte, und wie sympathisch ihm, Dostojewsky, dieses Bild sei. Während unseres Gespräches trat der englische Reisende Mackenzie Wallace bei uns ein, welcher schon einmal drei Jahre in Russland gelebt hatte, das Russische vortrefflich sprach und mit der russischen Litteratur sehr vertraut war. Als er erfuhr, dass er Dostojewsky vor sich habe, entbrannte seine Neugierde und er lauschte gespannt dem bei seinem Eintritte unterbrochenen und von Dostojewsky wieder aufgenommenen Gespräch über Nikolaus Pawlowitsch. Dostojewsky führte seine Rede zu Ende, ohne den Engländer im geringsten zu beachten, und entfernte sich bald darauf.
„Sie sagen, dies sei Dostojewsky,“ fragte uns der Engländer. „Ja wohl.“ „Der Verfasser des ‚Totenhauses‘?“ „Derselbe.“ „Das kann nicht sein; er ist ja doch zur Zwangsarbeit verschickt gewesen.“ „Ganz richtig, was weiter?“ „Ja, wie kann er denn einen Menschen loben, der ihn zur Zwangsarbeit verurteilt hat?“ „Euch Ausländern ist das schwer zu begreifen,“ antworteten wir, — „uns aber ist es als ein durchaus nationaler Zug begreiflich.“
Als zweites, den nationalen Zug bezeichnendes Erlebnis erzählt K. Slutschewsky, Dostojewsky sei einige Monate vor seinem Tode auf einen Ball in irgend eine höhere Schule gekommen. Die Jugend, auf die er damals schon grossen Einfluss gewonnen hatte und die er immer aufrichtig liebte, war hoch erfreut und drängte sich dicht um ihn.
„Wir fingen zu plaudern an,“ erzählt er selbst, „und sie begannen eine Diskussion. Sie baten mich, ich solle von Christus reden. Ich fing an zu sprechen und sie lauschten mit grosser Aufmerksamkeit.“ „Eine Predigt über Christus auf einem Balle und nicht im geringsten durch die Musik und den Tanz zurückgeschreckt — fährt Slutschewsky fort — das Lob des Machthabers, der uns zur Zwangsarbeit verurteilte — wo könnte das jemals vorkommen als in Russland?“
Und nun wenden wir uns dem Lebenslauf des Dichters zu. Wir verdanken, was wir davon wissen, den zu einem Buche vereinigten Aufzeichnungen zweier seiner nächsten Bekannten, welchen die Witwe des Dichters die Durchsicht seiner Papiere und Briefe anvertraute, dem Litterarhistoriker Orest Miller, welchem auch ein bedingter Einblick in die Papiere des Prozesses Petraschewsky zugestanden wurde (was er jedoch nicht auszunutzen verstand) und dem mehrjährigen publizistischen Mitarbeiter Dostojewskys, Kritiker Nikolai Nikolaiewitch Strachow, ferner den Erzählungen seiner Witwe, Anna Grigorjewna Dostojewskaia, alter Bekannter, guter Freunde und Feinde, vor allem aber dem „Tagebuch eines Schriftstellers“, jenem Blatte, das der Dichter in seinen letzten Lebensjahren allein besorgte und das sehr viel autobiographisches Material enthält.
Orest Miller und Nik. Strachow haben sicher mit grosser Pietät alles zusammengetragen, was sie teils selbst miterlebten, teils durch Mitteilungen anderer, namentlich eines jüngeren Bruders, Andreas, sowie der Gattin des Dichters erlangten. Allein es will uns, besonders nach einigem Einblick in die intimere Korrespondenz des Dichters scheinen, als ob sie bei der Wahl jener Briefe, die sie der Öffentlichkeit übergaben, schlecht beraten gewesen seien und manchen intimen Brief ganz unbeschadet der Diskretion mit anderen hätten vertauschen sollen, die sich in immerwährenden Wiederholungen der Geldnot und Schuldenkalamitäten bewegen. Es ist, als hätte ein neidischer Geist heimlich da seinen Spuk getrieben, um einen Dichter, dessen Tod von Hunderttausenden öffentlich betrauert wurde, dessen Leichenzug ganz Petersburg war, dessen Hülle 63 Deputationen Kränze brachten und der Hof die letzte Ehre erwies, nicht allzusehr aufkommen zu lassen, sondern all diese Teilnahme lieber als einzelnes, die Leiden eines Kämpfenden verherrlichendes Faktum hinzustellen, als sie zu Ungunsten lebender Dichter auch noch durch eine bedeutende Korrespondenz zu bestätigen. Indessen sind auch die veröffentlichten Briefe interessant genug, um auszugsweise daraus Lebensdokumente herzuholen, was im weiteren Verlaufe unserer Aufzeichnungen an seiner Stelle geschehen wird. Die erwähnten Wiederholungen schildern, wie schon gesagt, unzählige immer wiederkehrende Sorgen, zeugen von Geldverlegenheiten, von einer unglaublich sich fortspinnenden Misere, einem ewigen Ringen um die Bestreitung des täglichen Unterhaltes für sich und die Seinen. Wir bekommen durch sie einen Blick in die unaufhörlichen Kämpfe mit Not, Krankheit, Widerwärtigkeiten aller Art, und staunen immer wieder über die ausserordentliche Kraft, die das alles überwand.
Theodor Michailowitsch Dostojewsky war der Sohn eines in Civildienste übergetretenen Militär-Arztes, welcher unter dem Titel eines Stabsarztes im Moskauer Armenspital angestellt war, wo er mit seiner zahlreichen Familie eine aus zwei, später drei Zimmern, einem Vorzimmer und einer Küche bestehende Wohnung einnahm. Bei der Knappheit der Räumlichkeiten half man sich, wie man sich in den minder wohlhabenden Familien in Russland zu helfen pflegt, mit dem Holzverschlag. Ein solcher Holzverschlag teilte das Vorzimmer in zwei Teile, wovon der vordere, mit dem Fenster versehene als Entrée, der rückwärtige, halb finstere Teil als Schlafzimmer der beiden ältesten Kinder, Michael und Theodor, diente.
Theodor M. Dostojewsky wurde am 30. Oktober 1821 geboren. Zu seinen ersten Erinnerungen gehört jene aus seinem dritten Lebensjahre, dass er einmal von der Kinderfrau in die gute Stube geführt und veranlasst worden war, hier, vor der „heiligen Ecke“ kniend, in Gegenwart einiger Freunde der Eltern sein tägliches Abendgebet aufzusagen. Das Gebet lautete: „Alle Zuversicht, Herr, lege ich auf dich, Mutter Gottes, nimm mich unter deinen Schutz.“ Den Wortlaut dieses Gebets hat er sein Leben lang bewahrt und dieses später seinen Kindern übermittelt. Vier Jahre alt wurde er schon ans Buch gesetzt. Den ersten Unterricht im Buchstabieren nach alter Methode besorgte die Mutter, später bekamen die Knaben einen Lehrer für französische Sprache und die üblichen Schulgegenstände, sowie als Religionslehrer einen Diakon, welcher ihnen „die hundertundvier Geschichten des alten und neuen Bundes“ vortrug und damit den grössten Eindruck auf sie machte.
Man muss hier beide Brüder immer zusammen nennen, denn es verband sie ausser der Kameradschaft so naher Altersgenossen (sie waren nämlich nur um ein Jahr im Alter von einander getrennt) ein Band innigster Freundschaft, das ihr ganzes Leben hindurch währte. Der ältere, Michael, war jedoch durchaus anders veranlagt als Theodor, welcher überschäumend von Temperament war, „das reine Feuer“, wie ihn die Eltern nannten. Er war natürlich Angeber und Anführer in allen Spielen, während sich Michael ihm widerstandslos unterwarf. An Winterabenden war es zumeist ein Kartenspiel, das sie nach ihrem streng verbrachten Arbeitstage vornahmen, wobei Theodor, in seiner Ungeduld zu gewinnen, sehr oft betrog.
Im Sommer spielten sie, wenn die Familie ihr kleines Landgütchen bezogen hatte, im nahegelegenen Birkenwäldchen meist „Indianer“; sie kleideten sich dazu ganz aus, tättowierten sich, schmückten sich mit Laubgürteln und Hahnenfedern, fabrizierten Pfeile und Bogen und führten erbitterte Kämpfe. Der Gipfel des Vergnügens war erreicht, wenn die Mutter an einem heissen Sommertage ihnen erlaubte zu Mittag im Walde zu bleiben, und ihnen unter irgend ein Gebüsch ihr Essen stellen liess, das sie ohne Benutzung von Gabel und Messer verzehrten, sodass sie bis in den späten Abend hinein „wild“ bleiben durften. Ein Übernachten im Walde jedoch, das sie so sehr wünschten, wurde ihnen niemals gestattet. Als die Knaben grösser wurden, übernahm der Vater den vorbereitenden Lateinunterricht für das Gymnasium. Das war eine harte Plage. Der Vater nahm sie gewöhnlich abends nach seiner zweiten Runde bei den Patienten vor. Der Unterricht währte meistens eine Stunde, wobei die Schüler, nicht nur sich nicht setzen, sondern sich auch nicht einmal an den Tisch lehnen durften. In dieser Zeit verschlang Theodor viele Bücher. Namentlich begeisterte ihn Walter Scott, dessen Quentin Durvard er unzählige Male las. Als sie dann in ein vortrefflich geleitetes Privat-Pensionat kamen (die Eltern zogen dies, obwohl es sie grosse Opfer kostete, dem übel beleumundeten Gymnasium vor), wurden sie an jedem Sonnabend nach Hause gebracht und kramten sofort bei Tische den ganzen Schulklatsch aus; namentlich erzählten sie gerne die schlechten Streiche ihrer Kameraden. „Dabei gab unser Vater,“ so erzählt Andreas Dostojewski, „den Brüdern keinerlei Lehren. Bei der Erzählung verschiedener Streiche, die in der Klasse verübt worden waren, sagte er nur: ‚Ei, der Nichtsnutz, ei, der Elende‘ — — —, allein er sagte nicht ein einziges Mal: ‚sehet zu, dass ihr es nicht auch so macht.‘ Damit sollte angedeutet werden, dass der Vater solche Schelmenstücke auch nicht im entferntesten von ihnen erwartete.“
Die Brüder lasen fortwährend sehr viel. Michael, der zumeist Gedichte las, versuchte sich auch poetisch, Theodor war zu ungeduldig, um jemals etwas in gebundener Rede auszuarbeiten. Er zog auch im Lesen die Prosa vor und las, wenn nichts Neues da war, Karamsins russische Geschichte immer wieder. In Puschkin aber einigten sich die Brüder und es gab keine damals bekannte Dichtung Puschkins, welche sie nicht auswendig gekannt hätten, wie denn auch Theodor überhaupt ein leidenschaftlicher Deklamator war, dessen Vortrag die Grenzen künstlerischer Mässigung immer überschritt. Im Jahre 1837 starb die Mutter, und die Söhne verliessen die Vaterstadt, um in die höhere Militär-Ingenieurschule in Petersburg einzutreten. Der Vater rechnete hierbei auf die Protektion eines Verwandten, der Generallieutenant im Armee-Inspektorat war und so den Jünglingen zu einer, bei ihren geringen Mitteln sehr wünschenswerten, schnelleren Karriere helfen konnte.
Nun traf es sich aber, dass der sie untersuchende Arzt den älteren Bruder, der kerngesund war, für krank erklärte, während er Theodor, der von Kindheit an kränklich und schwächlich war, für tauglich annahm. Das führte die Trennung der Brüder herbei. Michael kam in die medizinische Akademie nach Reval, während Theodor in Petersburg blieb. Um diese Zeit besuchte ihn ein Freund des Hauses, Dr. Riesenkampf, der uns sein Äusseres folgendermassen schildert: „Ein ziemlich runder, voller, heller Blondin mit einem runden Gesicht und etwas aufgestülpter Nase ... die hellkastanienfarbigen Haare waren kurz geschoren. Unter einer hohen Stirne und schwachen Augenbrauen waren kleine, tiefliegende graue Augen wie verborgen; die Wangen waren bleich, mit Sommersprossen besäet, die Gesichtsfarbe war krankhaft, erdig, der Mund etwas wulstig. Theodor war bedeutend lebhafter, beweglicher, heftiger als sein gesetzter Bruder.“ ... Die kränkliche Gesichtsfarbe war das Begleitsymptom einer sehr früh gesteigerten nervösen Reizbarkeit, die, wie wir wissen, noch vor seiner Gefängniszeit in Epilepsie ausartete. Schon als Kind hatte er manchmal Hallucinationen gehabt, an deren eine er die Erinnerung an den Bauer Marej knüpft. Er erzählt diese Geschichte in seinem „Totenhause“, und ein zweites Mal im Januarheft 1876 seines „Tagebuchs eines Schriftstellers“ mit derselben Betonung der „Volkswahrheit“ wie dort.
Wir fügen hier diese kleine Begebenheit samt den Betrachtungen ein, welche der Dichter 46 Jahre später daran knüpft. Er beginnt damit, wie er in der Strafkaserne in Sibirien oft von Erinnerungen an die Kinderzeit heimgesucht worden war, und fährt fort: „Ich erinnerte mich an einen August in unserem Dorfe. Der Tag war hell und trocken, doch etwas kühl und windig; der Sommer ging zur Neige und nun hiess es: bald nach Moskau zurück und wieder den ganzen Winter hindurch über den französischen Lektionen sitzen. Und mir wars so leid, das Dorf zu verlassen. Ich ging um die Scheunen herum, stieg in den Hohlweg hinab und wieder durch die „Schlucht“ hinauf; so wurde ein dichtes Strauchwerk von uns genannt, das jenseits des Hohlweges bis zum Wäldchen hinanstieg. Da verlor ich mich tiefer ins Gebüsch und hörte, wie, ungefähr 30 Schritte von mir, auf einer Waldwiese ein Bauer ganz allein die Pflugschar führte. Ich erkenne, dass er gegen die steile Höhe hinauf pflügt, dass das Pferd mühsam hinaufklimmt, und höre, wie hie und da des Bauern Zuruf „Nu, nu!“ zu mir herüberklingt. Ich kenne fast alle unsere Bauern, nur weiss ich nicht, welcher von ihnen eben pflügt. Aber es ist mir ganz gleich, denn ich bin ganz in meine Arbeit vertieft, denn auch ich bin beschäftigt; ich breche mir eine Haselnuss-Staude, um damit die Frösche zu peitschen. Die Haselstauden sind so schön, aber so unhaltbar — ganz anders als die Weidengerten! Auch die hartgeflügelten Käferchen interessieren mich, ich sammle sie, es giebt sehr zierliche darunter. Ich liebe auch die kleinen, behenden, hellgelben Eidechsen mit den schwarzen Fleckchen, aber die kleinen Schlangen fürchte ich. Übrigens trifft man die Schlänglein bei weitem seltener an als die Eidechsen. Schwämme giebt es hier wenige. Nach Schwämmen muss man ins Birkenwäldchen gehen und ich mache mich auf den Weg dahin. Nichts in der Welt liebe ich so sehr, wie den Wald mit seinen Schwämmen und wilden Beeren, mit seinen Käfern und Vögelchen, den Igelchen und Eichhörnchen und dem mir so angenehmen feuchten Geruch verwesender Blätter. Und jetzt auch, da ich dieses schreibe, habe ich den Duft unseres Birkenwäldchens leibhaftig verspürt. Diese Eindrücke bleiben fürs Leben. Plötzlich, mitten in das tiefe Schweigen hörte ich laut und deutlich einen Schrei: „Der Wolf kommt“. Ich schrie auf und lief ausser mir und schreiend geradeaus nach der Wiese auf den pflügenden Bauer los.
Das war unser Bauer Marej. Ich weiss nicht, ob es einen solchen Namen giebt, aber alle nannten ihn Marej. Es war ein Bauer von etwa fünfzig Jahren, stämmig, ziemlich gross, mit einem breiten, stark gesprenkelten dunkelblonden Barte. Ich kannte ihn, doch hatte es sich bis dahin nicht ereignet, dass ich mit ihm gesprochen hätte. Er brachte sein Pferdchen zum Stehen, als er mein Schreien gehört hatte, und als ich im vollen Anlauf mit einer Hand mich an die Pflugschar, mit der zweiten an seinen Ärmel hing, da erkannte er mein Entsetzen.
„Der Wolf kommt,“ schrie ich atemlos.
Er wendete den Kopf und sah sich unwillkürlich ein wenig im Kreise um, mir einen Augenblick fast glaubend.
„Wo ist der Wolf?“
„Man hat gerufen ... jemand hat eben gerufen: der Wolf kommt,“ stammelte ich.
„Was sagst du, was sagst du, was für ein Wolf — geschienen hat es dir, geh! Was soll hier für ein Wolf sein!“ murmelte er, mich beruhigend. Allein ich zitterte noch immer und klammerte mich noch fester an seinen Zipun und muss sehr blass gewesen sein. Er sah mich mit einem beunruhigten Lächeln an und war offenbar um mich in Angst und Sorge.
„Geh, schau, bist erschrocken, aj, aj!“ sagte er kopfschüttelnd. „Genug, mein Trauter. Geh, Kleiner, aj!“
Er streckte die Hand aus und streichelte mir plötzlich die Wange.
„Nu, genug doch, nu, Christus ist mit dir, mach das Kreuz.“ Allein ich bekreuzte mich nicht; meine Mundwinkel zuckten und das scheint ihn besonders ergriffen zu haben. Er streckte seinen dicken, mit Erde beschmutzten Daumen mit dem schwarzen Nagel leise aus und berührte damit ganz leise meine zuckenden Lippen.
„Geh doch, aj,“ lächelte er mich mit einem mütterlichen, auf seinen Lippen verweilenden Lächeln an. „Herrgott, was ist denn das, geh doch, aj, aj!“
Ich begriff endlich, dass kein Wolf da war, und dass mir etwas wie ein Schrei „der Wolf kommt“ nur so geklungen hatte. Der Schrei war übrigens sehr laut und deutlich gewesen, allein solche Schreie (nicht nur von Wölfen) hatte ich schon früher ein- oder zweimal zu vernehmen geglaubt und ich wusste davon. (Später vergingen diese Hallucinationen mit den Kinderjahren.)
„Nun werde ich gehen,“ sagte ich fragend und schaute ihn furchtsam an.
„Geh du nur, ich werde dir schon nachschauen. Ich werde dich schon dem Wolf nicht geben!“ fügte er hinzu, indem er mir immer noch mütterlich zulächelte, „nu, Christus sei mit dir, nu geh,“ und er machte das Zeichen des Kreuzes über mich, dann über sich selbst.
Ich ging weiter und schaute mich fast bei jedem zehnten Schritte um. Marej blieb, so lange ich ging, mit seinem Pferdchen immer da stehen und schaute mir nach, mir, so oft ich mich umsah, mit dem Kopfe zunickend. Offen gestanden schämte ich mich ein wenig vor ihm, darüber, dass ich solche Furcht gehabt hatte, allein sie erfasste mich auch im Gehen noch hie und da, ehe ich nicht zur ersten Riege des Abhanges gelangt war. Hier verliess mich die Angst schon ganz; und plötzlich, wie vom Boden heraus, sprang mir unser Hofhund Wölfchen entgegen. Mit ihm an meiner Seite wurde ich schon ganz mutig und wendete mich zum letzten Male nach Marej um. Sein Gesicht konnte ich nicht mehr genau unterscheiden, aber ich fühlte, dass er mich noch immer mit demselben zärtlichen Lächeln ansah und mit dem Kopfe nickte. Ich winkte ihm mit der Hand, auch er winkte mir zu und dann trieb er sein Pferdchen an.
„Nu, nu!“ hörte man in der Ferne wieder seinen Zuspruch, das Pferdchen zog wieder an seiner Pflugschar. —
Als ich damals von Marej nach Hause kam, erzählte ich niemand mein Erlebnis. Ja, was war es denn auch für ein Erlebnis? Auch Marej habe ich damals sehr bald vergessen. Wenn ich ihn später seltene Male traf, so sprach ich gar nie mit ihm, weder vom Wolf, noch überhaupt. Und plötzlich jetzt, zwanzig Jahre später in Sibirien, fiel mir diese ganze Begegnung mit einer solchen Klarheit, bis in das kleinste Detail ein. Das heisst also, dass sie sich in meine Seele festgesetzt hatte, unbewusst, ganz allein und ohne meinen Willen, und plötzlich ist sie dann aufgetaucht, wann sie nötig war.
Es tauchte dieses sanfte, mütterliche Lächeln des armen leibeigenen Bauern in mir auf; seine Kreuze, sein Kopfschütteln, sein „Geh schon, bist erschrocken, Kleiner!“ Und besonders sein dicker, mit Erde beklebter Finger, mit welchem er still und mit sanfter Zärtlichkeit meine zuckenden Lippen berührt hatte. Gewiss hätte ein jeder einem kleinen Kinde Mut zugesprochen, allein hier in dieser einsamen Begegnung geschah etwas von gleichsam ganz anderer Art, und wenn ich sein leiblicher Sohn gewesen wäre, so hätte er mich nicht mit einem von hellerer Liebe leuchtenden Blicke ansehen können — wer aber hat ihn dazu genötigt? Er war unser eigener Höriger, ich aber war immerhin sein junges Herrchen; das hätte niemand erkannt, als er mich streichelte und mich es nicht fühlen liess. Liebte er etwa so sehr die kleinen Kinder? Solche giebt es. Die Begegnung war in völliger Abgeschiedenheit erfolgt, auf einem öden Feld, und nur Gott sah vielleicht von oben, mit welchem tiefen und heiligen Menschheitsgefühl, und mit welcher feinen, fast weiblichen Zartheit das Herz manches groben, tierisch unwissenden, leibeigenen russischen Bauern erfüllt sein kann, eines solchen, der seine Befreiung auch nicht einmal erwartete, nicht ahnte. — Sagt mir, ist es nicht das, was Konstantin Aksakow verstand, als er von der hohen Bildung unseres Volkes sprach?
Und sieh da, als ich von meiner Pritsche herunterstieg und mich rings umsah, da, ich erinnere mich dessen, fühlte ich plötzlich, dass ich mit ganz anderen Blicken auf diese Unglücklichen zu schauen vermochte, und dass mit einem Male, wie durch ein Wunder, jeder Hass und jeder Zorn in meinem Herzen ausgelöscht war. Ich ging umher und schaute in die Gesichter der mir Begegnenden. Jener geschorene und entehrte Bauer, gebrandmarkt, berauscht, der da sein betrunkenes heiseres Lied brüllte, das kann ja ebenfalls der nämliche Marej sein; ich kann ja nicht in sein Herz hineinschauen.“
Bald nach dem Tode der Mutter gelangte zu den Jünglingen die Nachricht vom tragischen Ende Puschkins. Hätten sie nicht schon Trauergewänder getragen, so hätten sie um die Erlaubnis gebeten, solche nach Puschkin anlegen zu dürfen. In jedem Falle verabredeten sie sich auf der Reise nach Petersburg, sofort nach ihrer Ankunft den Ort aufzusuchen, wo das Duell stattgefunden, und die Stube, wo der Dichter seinen Geist ausgehaucht hatte.
Diese Fahrt in langen Tagereisen, mit unterlegten Pferden und wechselnden Fuhrleuten, war reich an Hoffnungen und poetischen Stimmungen, namentlich des älteren Bruders, der: „täglich etwa drei Gedichte machte, auch unterwegs“ —, wie Theodor in seinem Tagebuche 1876 erzählt. Er selbst dachte wohl ebenfalls nicht an die Aufnahmeprüfung in der Mathematik: er deklamierte, disputierte und ereiferte sich über poetische Fragen, hatte aber doch offene Sinne für alles, was um ihn her vorging. So machte ihm eine Scene Eindruck, die er vom Fenster des Einkehrhauses eines kleinen Dorfes beobachtete. Es war an das Stationsgebäude eine Kurier-Trojka herangeflogen, ein betresster und befiederter Feldjäger sprang herab, trank ein Gläschen Schnaps und schwang sich auf die Telega zurück, wo indessen der neue Kutscher, ein junger Bursche, ein neues armseliges Dreigespann angebracht hatte. Kaum hatte sich dieser Junge auf seinen Platz geschwungen, als der Feldjäger aufstand und ihm ohne jegliche Erregung, ohne ein Wort zu reden, mit der Faust einen wuchtigen Hieb in den Nacken verabfolgte. Unmittelbar darauf setzte der Kutscher diesen Hieb in einen Knutenstreich auf die Pferde um. Das wiederholte sich so lange, als der Zuschauer das Gefährt nicht aus dem Auge verlor, so dass gleichsam aus jedem Faustschlag, wie durch eine Feder geschnellt, der Knutenhieb hervorsprang. Dostojewsky erwähnt in späten Jahren diese Begebenheit gelegentlich eines Artikels über den Petersburger Tierschutzverein, dem er diesen Vorgang als Emblem auf das Petschaft gravieren lassen möchte.
Die Trennung vom Hause und dem Bruder ruft die erste Korrespondenz hervor. Wir finden darin die erste reale Misère um einiger Kopeken willen und den ersten philosophischen Weltschmerz, der sich jedoch schon in der, Dostojewsky eigentümlichen, mystischen Weise ausdrückt. So sagt er in einem Briefe an den Bruder: „Ich weiss nicht, ob meine traurigen Gedanken je verstummen werden — mir scheint unsere Welt ist ein Fegefeuer himmlischer Seelen — die ein sündiger Gedanke verwirrt hat — aus der hohen, herrlichen Seelenhaftigkeit ist — eine Satire herausgekommen.“ — — — Weiter sagt er: „Sehen, wie unter einer spröden Hülle sich eine Welt in Qualen windet, wissen, dass ein Willensausbruch genügt, sie zu zerbrechen, und mit der Ewigkeit zusammenzufliessen, das wissen und dem niedersten der Geschöpfe gleich sein — — schrecklich! Wie armselig ist doch der Mensch! Hamlet, Hamlet!“ Weiter heisst es: „Pascal sagt einmal: Wer gegen die Philosophie protestiert, ist selber ein Philosoph“ — eine traurige Philosophie das!“ —
Wir sehen unter anderem aus diesem Briefe, dass seine Lektüre sich den Franzosen zugewendet hat; er zählt einmal auf, was er im Übungslager alles gelesen hat: „Mindestens nicht weniger, als Du“, ruft er dem Bruder zu. Den ganzen Hoffmann, den ganzen Victor Hugo, den er unter anderem mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit mit Homer vergleicht, einen Homer in „christlichem, engelhaftem Sinne“ nennt. Einen ganz ausserordentlichen Eindruck macht auf ihn George Sand, „eine der hellsehendsten Ahnenden, einer die Menschheit erwartenden glücklichen Zukunft.“ So drückt er sich im Jahre 1876 im Junihefte seines Tagebuches aus. In der Nachschrift eines Briefes finden wir eine Verteidigung der französischen Klassiker in folgenden hitzigen Worten: „Hast du Cinna gelesen? Armseliger, wenn du ihn nicht gelesen hast! Besonders das Gespräch Augusts mit Cinna, wo er ihm den Verrat verzeiht ... Du wirst sehen, so sprechen nur beleidigte Engel ... Hast du Le Cid gelesen? Lies ihn, erbärmlicher Mensch, und sinke in den Staub vor Corneille ..... Übrigens“, schliesst er begütigend, „sei mir um meiner beleidigenden Ausdrücke nicht böse .....“
Sehr merkwürdig ist seine Beurteilung des Vaters. „Mir ist leid um den armen Vater. Ein seltsamer Charakter! Ach, wieviel Unglück hat er nicht schon ertragen! Es ist bis zu Thränen bitter, dass man ihn mit nichts erfreuen kann! — Und, weisst du? — Papachen kennt die Welt ganz und gar nicht; er hat fünfzig Jahre darin gelebt und ist bei der Meinung über die Menschen geblieben, die er dreissig Jahre vorher von ihnen gehabt hat. Glückliche Unwissenheit! — Allein er fühlt sich sehr enttäuscht, das scheint unser allgemeines Los zu sein.“ Hier bietet sich schon ein Stück echt Dostojewskyscher psychologischer Feinheit, welche im Vater die Enttäuschung über die Welt und zugleich die Unfähigkeit sieht, daraus Nutzen zu ziehen und anderer Meinung über die Menschen zu werden.
Übrigens finden wir nur in den Jugendbriefen und erst wieder in den Briefen aus des Dichters letzten Jahren Ausbrüche persönlichster Innerlichkeit, wie wir das nennen möchten. Dies ist indessen zum grossen Teil auf die unglückliche Auswahl der zu publizierenden Briefe zurückzuführen, deren wir oben erwähnten. Es ist da, als ob die Herausgeber durch diese Zusammenstellung die Armut und die ewigen Nahrungssorgen des Dichters so recht herauskehren wollten. Sein späterer Briefwechsel mit seiner Gattin Anna Grigorjewna (er schrieb ihr während seiner kleinsten Abwesenheiten täglich, so dass sie, die immer nur sehr kurz von ihm getrennt war, 464 Briefe von ihm besitzt), den die Witwe aus begreiflichen Gründen zurückhält, ist voll von solchen Ausbrüchen. Allein wir würden irren, wenn wir annähmen, dass es schwunghafte Dichterbriefe seien. Nein, so schlicht, dabei gegenständlich bis ins kleinste, so voll von Zweifeln an sich selbst, berauschtem Stolz über einen Erfolg, Kleinmut und Zerknirschung, wenn er wieder so nichtswürdig schwach gewesen, alles zu verspielen, mit einem Wort, so unlitterarisch sind sie, wie jene, die wir vor uns haben. Auch so naiv in einem gewissen Sinne. So frägt er in einem Briefe aus Moskau, wohin er zur Puschkinfeier gereist ist, am Tage dieser Feier: Was meinst du, soll ich im Frack erscheinen oder im Gehrock? Doch von dieser Korrespondenz später.
Eine andere sehr wertvolle Korrespondenz, welche mir vom Besitzer zur Verfügung gestellt wurde, ist leider im Schlosse des Grafen Alexis Tolstoi, dessen Gast jener war, bei einem Brande, dem das ganze Schloss zum Opfer fiel, zu Grunde gegangen. In dieser Korrespondenz hätten wir wohl viel Polemisches, vieles über des Dichters politische Anschauungen ausgedrückt gefunden, allein sicher nicht mehr Andeutungen über Arbeitspläne, als jene Briefe enthalten, die wir vor uns haben. Dostojewsky hatte eine Art darüber in Briefen zu schweigen, welche die Annahme nicht zulässt, als habe er dies nur je nach der Person und dem Augenblick gethan. Zur Zeit seiner grössten litterarischen Thätigkeit bewegen sich viele seiner Briefe zumeist um Äusserliches. Doch auch davon später.
Auch im Verkehr mit den Kameraden war Dostojewsky sehr zurückhaltend; er schloss sich immer ab, mischte sich nicht in die gemeinsamen Unternehmungen und teilte sich niemand mit. Die Schwächeren, namentlich die Neueintretenden, welche Spott und Unbill zu erleiden hatten, verteidigte er energisch. In den Unterrichtsfächern blieb er im geometrischen Zeichnen und im Reglement zurück, so dass er ein Jahr wiederholen musste, was ihn um des Vaters willen sehr kränkte. Seine Briefe an diesen letzteren sind zumeist Schulberichte, Bitten um Geld und Aufzählung seiner notwendigsten Ausgaben. An den Bruder schreibt er einmal: „Du beklagst dich über deine Armut — — auch ich bin nicht reich — da ist nichts zu sagen — wirst du mir glauben, dass ich, als wir das Lager verliessen, nicht eine Kopeke hatte? Auf dem Marsche erkrankte ich infolge Erkältung und Hunger (es regnete den ganzen Tag und wir gingen blank) und ich hatte keinen Groschen, um mir die Kehle mit einem Schluck warmen Thees anzufeuchten. Aber ich wurde wieder gesund. Doch auch im Lager war mein Zustand ein erbärmlicher, bis ich Väterchens Geld bekam. Da bezahlte ich die Schulden und behielt das Übrige zurück. Aber die Beschreibung deines Zustandes übersteigt alles. Kann man denn wirklich fünf Kopeken nicht haben, sich mit Gott was füttern müssen, und nur mit lüsternen Blicken die herrlichen Beeren betrachten, die du sehr liebst!“ Er hat eben erst erzählt, dass er, hungrig und krank, keinen Groschen zu einem Schluck warmen Thees gehabt; dies scheint er aber in der Entrüstung darüber, dass sich der Bruder die geliebten Beeren nicht kaufen kann, ganz zu vergessen.
Um diese Zeit liest er viel Schiller und schreibt einmal an den Bruder, der ihm vorwirft, Schiller nicht zu kennen: er habe ihn mit einem teuern Freunde gelesen, der nun fort sei, und dies sei der Grund, warum auch der Name Schiller ihm wehe thue, nicht über seine Lippen komme. Er bearbeitet Maria Stuart in seinem Sinne, ebenso auch Puschkins Boris Godunow; beide Manuskripte sind in Verlust geraten. Überhaupt sieht man ihn viel heimlich schreiben, Nächte hindurch, und einige seiner Biographen sind der Meinung, er habe seinen am sorgfältigsten ausgearbeiteten Roman „Arme Leute“ in der ersten Fassung schon in der Akademie begonnen.
Am 5. August 1841 wurde er zum Unteroffizier ernannt, mit Belassung in der Anstalt, um den Offizierskurs zu vollenden, und am 11. August 1842 wird er nach bestandener Prüfung in die Offiziersklasse versetzt. In dieser Zeit scheint er schon auswärts gewohnt, nach dem Tode des Vaters seine Erbschaft angetreten und den jüngeren Bruder Andreas bei sich beherbergt zu haben, was ihn sehr einengt und worüber er sich gegen Michael beklagt.
Im Jahre 1843 trat Dostojewsky aus dem höheren Offizierskurs aus und wurde dem Petersburger Kommando des Ingenieurkorps zugeteilt. Nun scheint ein freies, genusssüchtiges und sehr kostspieliges Leben für ihn begonnen zu haben. Seine Jahreseinkünfte waren durchaus nicht gering; er bezog eine jährliche Rente und einen Offiziersgehalt, die zusammen 5000 Rubel ausmachten. Allein, da er einerseits seinen Neigungen lebte, andererseits ausserordentlich unpraktisch in der Einteilung seiner Finanzen war, geriet er bald in Schulden. Er besuchte sehr fleissig das Theater, „auch das Ballett“, sagt Orest Miller, alle kostspieligen Konzerte etc. Zudem mietete er eine geräumige Wohnung, nur weil ihm das Gesicht des Hausherrn sympathisch war und er sah, dass ihn dieser Mann nie stören würde. Freilich standen in der grossen Wohnung nur ein Bett, ein Divan, ein Tisch und einige Stühle. Dazu zeigte sichs bald, dass nur sein Arbeitskabinett heizbar war, also lebte er in diesem, behielt jedoch die ganze Wohnung weiter. Eine andere Ursache der Verwirrung seiner Geldangelegenheiten war die, dass er einen Diener bei sich behielt, der ihm auch so sympathisch war, dass keine Mahnung, er solle ihn weggeben, da er ihn bestehle, bei ihm Eingang finden konnte. „Mag er mich doch bestehlen,“ sagte Dostojewsky, „er wird mich nicht ruinieren.“ Thatsächlich, erzählt O. Miller, ruinierte dieser Diener ihn doch, denn er hatte eine Geliebte mit grosser Familie, die schliesslich alle auf Kosten seines Herrn lebten, bis es nicht mehr weiter ging, dieser in Schulden geriet und endlich doch die Wohnung aufgeben musste. Als es anfing schief zu gehen, zog sich Dostojewsky von allem zurück, schloss sich in sein Arbeitszimmer ein und verkehrte mit niemand. Nach den Mitteilungen des Doktors Riesenkampf, der ihn zu jener Zeit oft besuchte, war er sehr in sich gekehrt, verschlossen, sehr leidend, ohne es zugeben zu wollen. Seine Stimme war infolge einer schweren Halskrankheit, die er noch im Elternhause durchgemacht hatte, beständig heiser, seine Gesichtsfarbe erdfahl.
Hier beginnt seine intensive Beschäftigung mit der Litteratur; er liest viel französisch: Balzac, George Sand, Victor Hugo, Lamartine, Soulié. Entwürfe zu Erzählungen jagten einander nur in seinem Kopfe. Bei diesen Beschäftigungen war ihm sein militärischer Beruf eine grosse Last, die er indes nicht abzuschütteln wagte, weil der Vormund ihm mit Entziehung seiner Rente drohte.
Wie wechselnd Schicksal und Laune des Dichters zu jener Zeit waren, davon giebt uns die Erzählung Dr. Riesenkampfs ein drastisches Bild. Zur Zeit der grossen Fasten im Jahre 1842 sei plötzlich ein Geldzufluss bei Dostojewsky sichtbar geworden. Er besuchte die Konzerte Liszts, der eben angekommen war, sowie die des Sängers Rubini und eines berühmten Klarinettisten. Nach Ostern traf ihn Riesenkampf in einer Aufführung von Puschkins „Ruslan und Ludmila“. Im Mai aber schloss er sich abermals ein und versagte sich jedes Vergnügen, um sich zur letzten Prüfung vorzubereiten. Zu gleicher Zeit hatte sich Riesenkampf zur medizinischen Prüfung vorbereitet, erkrankte infolge zu grosser Anstrengung und hütete noch am 30. Juni das Bett. Da erscheint plötzlich Dostojewsky an seinem Lager, bis zur Unkenntlichkeit verändert; strahlend, gesund aussehend, mit sich und dem Schicksal zufrieden, denn er hatte eben die Prüfung sehr gut bestanden, war als Lieutenant aus der Anstalt entlassen; hatte überdies vom Vormund eine so grosse Geldsumme erhalten, dass er imstande war, seine Schulden zu bezahlen. Zudem hatte er einen längeren Urlaub bekommen, den er benutzen wollte, um seinen Bruder, welcher sich inzwischen verheiratet hatte, in Reval zu besuchen, was er am folgenden Morgen zu unternehmen gedachte. Nun zerrt er den Freund aus dem Bette, kleidet ihn an, setzt ihn auf einen Wagen und führt ihn in eines der ersten Restaurants am Newsky Prospekt. Hier verlangt er ein gesondertes Zimmer mit einem Flügel, bestellt ein lukullisches Mahl mit kostbaren Weinen und nötigt den kranken Freund, mit ihm zu essen und zu trinken. Diese zwingende Heiterkeit wirkte wohlthätig auf den Kranken; er ass und trank, musizierte und — wurde gesund. Am anderen Morgen begleitete er den Freund zum Dampfer!
In Reval scheint Dostojewsky durch Herrnhutersche Unduldsamkeit einen sehr üblen Eindruck empfangen zu haben, der ihn Zeit seines Lebens gegen die Deutschen, denen er höhere Kultur zugeschrieben hatte, verstimmt liess.
Der Bruder Michael hatte indessen mit Hilfe seiner Frau Theodor mit neuer Wäsche und Kleidern ausgestattet und bat nun Riesenkampf, welcher auch nach Reval gekommen war, er möge, da er sich in Petersburg niederlasse, gemeinschaftlich mit dem Bruder wohnen, damit er, der niemals etwas über den Stand seiner Habe wisse, sich an dessen deutscher Ordnungsliebe ein Beispiel nehme. Als Riesenkampf im September 1843 nach Petersburg zurückkam, erfüllte er diesen Wunsch. Er fand Theodor ohne eine Kopeke, von Milch und Brot, und das sogar auf Kredit, lebend. „Theodor Michailowitsch,“ schliesst er den Bericht, „gehört zu jenen Personen, neben denen zu leben allen wohl wird, die aber selbst immer in Not sind.“ Man bestahl ihn unbarmherzig, allein bei seiner Vertrauensseligkeit und Güte wollte er den Dingen weder auf den Grund gehen noch seine Diener samt Anhang beschuldigen, die sich seine Harmlosigkeit zu nutze machten. Ja, sogar das Zusammenleben mit dem Arzte war ein neuer Anlass zu vergrösserten Auslagen. „Jeden armen Teufel nämlich, der um ärztlichen Rat zum Doktor kam, nahm er wie einen teuren Gast auf,“ erzählt Orest Miller. — Darüber zurecht gewiesen, antwortete er entschuldigend: „Da ich mich daran mache, die Lebensweise armer Leute zu beschreiben, so bin ich froh, dass ich Gelegenheit habe, das Proletariat der Hauptstadt näher kennen zu lernen.“ Bei Abschluss der Monatsrechnungen fand sich, dass eine ganze Herde von Menschen ihren Vorteil aus Dostojewskys Sorglosigkeit gezogen hatte; nicht nur Bäcker und Krämer, sondern auch Schneider und Schuster reichten unerhörte Rechnungen ein. Dazu war die Wäsche und Garderobe, die bei jedem Geldzufluss immer wieder neu hergestellt wurde, immer ganz zusammengeschmolzen. Seine äusserste Not dauerte um diese Zeit zwei Monate. Da plötzlich fand ihn der Doktor eines Tages laut, selbstbewusst und stolz im grossen Saale auf und ab gehen — er hatte aus Moskau 1000 Rubel erhalten. „Am anderen Morgen aber,“ erzählt Dr. Riesenkampf, „kam er wieder in seiner gewöhnlichen stillen, sanften Weise in mein Schlafzimmer und bat mich, ihm 5 Rubel zu leihen.“ Der grösste Teil des Geldes war zur Tilgung von Schulden aufgegangen, und das, was übrig blieb, hatte er zum Teil im Billardspiel verloren; die letzten 50 Rubel waren ihm von einem Fremden, den er zu sich gerufen und in seinem Zimmer allein gelassen hatte, gestohlen worden.
Im März 1844 musste Dr. Riesenkampf von Petersburg scheiden und Theodor Michailowitsch zurücklassen, ohne dass sein deutsches Beispiel etwas gefruchtet hätte.
Um diese Zeit herum beschäftigt sich der Dichter, um Geld zu verdienen, mit Übersetzungen. Er übersetzt Eugenie Grandet von Balzac, Schillers Don Carlos und George Sand, wofür er 25 Papierrubel für den Druckbogen erhält. Nun reicht er um Entlassung aus dem Militärdienst ein, „denn“, schreibt er an den Bruder, „ich bin des Dienstes überdrüssig, überdrüssig wie einer Kartoffel“ — — —
In einem Briefe vom 30. September 1844 sagte er: „Ich habe einen Roman geschrieben, im Umfange der Eugenie Grandet; bis zum 14. (der Termin seiner Dienstentlassung) werde ich gewiss schon Antwort darüber haben. Er ist ziemlich originell.“
Den Geldverlegenheiten hofft Theodor Michailowitsch so zu begegnen, dass er auf seinen Gutsanteil verzichtet, wenn man ihm 500 Silberrubel sofort, später abermals 500 in monatlichen Raten sendet. Er ist immer „verloren“, wenn man ihm nicht hilft, ihn nicht rettet, fleht um aller Heiligen willen, der Bruder möge ihm helfen, sonst müsse er ins Gefängnis. „Chlestakow“ (aus Gogols „Revisor“), sagt er, „erklärt sich bereit ins Gefängnis zu gehen, wenn nur in nobler Weise. Wie soll ich aber nobel ins Gefängnis gehen, wenn ich keine Hosen habe?“ Dabei ist der Brief noch immer aus der kostspieligen Wohnung datiert. In der Nachschrift heisst es: „ich bin mit meinem Roman ausserordentlich zufrieden“. Er blickt auf diesen Roman als auf seinen Rettungsanker. Er sieht in ihm den Probierstein seiner dichterischen Kraft, und nun, nachdem er ihn dem Dichter Njekrássow übergeben, welcher damals an der Redaktion des „Zeitgenossen“ teilnahm, kommt für ihn die bedeutende grosse Lebenswende, die er uns 30 Jahre später in seinem Tagebuch eines Schriftstellers folgendermassen erzählt, wobei begreiflicherweise im Gedächtnis des Dichters eine kleine Verschiebung bezüglich des Zeitpunktes stattfindet.
„Es geht manchmal eigentümlich zu mit den Menschen; wir haben einander [hier ist der Dichter und Njekrássow gemeint] nicht oft im Leben gesehen, es hat auch Missverständnisse zwischen uns gegeben — aber etwas hat sich doch mit uns ereignet, eine Begebenheit, die ich niemals habe vergessen können. Und nun, als ich unlängst Njekrássow besuchte, fing er, der Kranke und Erschöpfte, beim ersten Worte an, von diesen Tagen zu sprechen. Damals (es sind nun 30 Jahre her) geschah etwas so jugendliches, frisches, hübsches, eine der Begebenheiten, die für immer im Herzen der Beteiligten fortleben. Wir waren damals etwas über zwanzig Jahre alt. Ich lebte nach meinem Austritt aus dem Ingenieurkorps schon ein Jahr in Petersburg, ohne zu wissen, was ich anfangen würde, voll von dunklen, unbestimmten Zielen. Es war im Mai des Jahres 1845. Anfangs des Winters hatte ich plötzlich meine Erzählung „Arme Leute“ begonnen, ohne vorher je etwas geschrieben zu haben. Als ich diese Erzählung beendet hatte, wusste ich nicht, was ich damit anfangen, wem ich sie übergeben sollte. Litterarische Bekanntschaften hatte ich absolut gar keine, ausser etwa D. W. Grigorowitsch, aber dieser hatte damals selbst ausser einer kleinen Erzählung für eine Sammlung (die Erzählung hiess „Petersburger Leiermänner“) noch nichts geschrieben. Ich glaube, er war damals im Begriff nach seinem Landsitz hinauszufahren; vorläufig wohnte er für einige Zeit bei Njekrássow. Als er einmal zu mir kam, sagte er: „Bringen Sie doch Ihr Manuskript (er hatte es selbst noch nicht gelesen); Njekrássow will zum nächsten Jahr ein Sammelwerk herausgeben, und da will ich ihm das Manuskript zeigen.“ Ich brachte es ihm, sah Njekrássow etwa eine Minute — wir reichten einander die Hand. — Ich schämte mich bei dem Gedanken mit meinem Werke gekommen zu sein und ging so schnell als möglich fort, fast ohne mit Njekrássow ein Wort gesprochen zu haben. Ich dachte wenig an Erfolg und vor dieser „Partei der Vaterländischen Annalen“ (eine Zeitschrift, welche damals von einer Anzahl vortrefflicher und gesinnungstüchtiger Schriftsteller und Kritiker herausgegeben wurde), wie man sie damals nannte, fürchtete ich mich. Belinsky las ich schon seit einigen Jahren mit Bewunderung, aber er erschien mir fürchterlich, dräuend und — der wird meine „Armen Leute“ verlachen — dachte ich manchmal bei mir. Aber nur manchmal. Ich hatte die Erzählung mit leidenschaftlicher Glut, ja fast unter Thränen geschrieben. Sollte denn alles dies, sollten all diese Augenblicke, die ich mit der Feder in der Hand bei dieser Erzählung verlebt hatte, sollte das alles Lüge, Gaukelei, unwahre Empfindung gewesen sein? Doch dachte ich nur für Augenblicke so, und die Zweifel kehrten immer gleich wieder.
Am Abend desselben Tages nun, da ich die Handschrift abgegeben hatte, ging ich irgendwo hin, weit fort, zu einem ehemaligen Kameraden; wir sprachen die ganze Nacht durch über die „toten Seelen“; wir lasen darin, ich weiss nicht zum wievieltenmale; das war damals so unter den jungen Leuten. Es kommen zwei, drei zusammen: „Wollen wir nicht etwas im Gogol lesen, meine Herren?“ Sie setzten sich und lasen — wohl meist die ganze Nacht durch. Damals gab es unter den jungen Leuten sehr, sehr viele, die von irgend etwas durchdrungen waren, die irgend etwas erwarteten. Ich kehrte nach Hause zurück — es war schon vier Uhr morgens, eine weisse, taghelle Petersburger Nacht. Es war herrlich warmes Wetter, und als ich in meine Wohnung gekommen war, legte ich mich nicht zu Bette, sondern öffnete das Fenster und setzte mich daran. Plötzlich höre ich zu meinem grössten Erstaunen die Thürklingel ertönen — und da stürzen auch schon Gregorowitsch und Njekrássow über mich her, umarmen mich in voller Entzückung, und es fehlt nur noch, dass sie beide zu weinen anfangen. Sie waren am Vorabend zeitig heimgekehrt, hatten mein Manuskript in die Hand genommen und zur Probe zu lesen angefangen — „nach zehn Seiten wird man schon sehen“. — Aber nachdem sie zehn Seiten gelesen hatten, beschlossen sie weitere zehn zu lesen, und darauf lasen sie schon ohne Unterbrechung die ganze Nacht durch, laut, einer den andern ablösend, wenn dieser ermüdet war. „Er liest vom Tode des Studenten“, erzählte mir später, als wir allein waren, Gregorowitsch, „und da, an der Stelle, da der Vater dem Sarge nachläuft, merke ich, wie Njekrássows Stimme umschlägt, einmal, das zweite Mal, und plötzlich hält er’s nicht aus und schlägt mit der flachen Hand auf das Manuskript „Ach! dass ihn doch! — damit meinte er Sie, und so gings die ganze Nacht“.
Als sie geendet hatten (es waren sieben Druckbogen!), da beschlossen sie einstimmig, sofort zu mir zu gehen. „Was liegt daran, dass er schläft, wir wecken ihn auf, das ist mehr wert als der Schlaf!“ — Wenn ich später den Charakter Njekrássows betrachtete, wunderte ich mich öfters über diesen Augenblick. Sein Charakter ist verschlossen, misstrauisch, vorsichtig, wenig mitteilsam. So wenigstens ist er mir immer erschienen, sodass dieser Augenblick unserer ersten Begegnung in Wahrheit die Offenbarung einer tiefen Empfindung bedeutete. Sie blieben damals etwa eine halbe Stunde bei mir. In dieser halben Stunde sprachen wir, weiss Gott was alles durch, einander in halben Worten verstehend, in Ausrufungen, hastig — — Wir sprachen von Poesie und Wahrheit, von der „damaligen Lage“, natürlich auch von Gogol, indem wir Stellen aus seinem Revisor, aus seinen „toten Seelen“ citierten. Aber hauptsächlich sprachen wir von Belinsky. „Noch heute bringe ich ihm Ihre Erzählung, und Sie werden sehen — ja das ist ein Mensch, o was für ein Mensch ist das!“ rief Njekrássow mit Entzücken, indem er mich mit beiden Händen an den Schultern fasste und schüttelte. „Nun aber gehen Sie schlafen, schlafen Sie, wir gehen fort und morgen — zu uns“. Wie hätte ich daraufhin einschlafen können! Welches Entzücken, was für ein Erfolg! und vor allem das kostbare Gefühl, ich erinnere mich dessen sehr gut: hat ein anderer Erfolg, nun man lobt ihn, man beglückwünscht ihn, man kommt ihm entgegen — aber seht, diese kommen mit Thränen in den Augen herbeigelaufen, um vier Uhr morgens, um mich zu wecken, „weil das mehr wert ist, als der Schlaf“! — Ach! wie schön! so dachte ich; wo wäre da Schlaf gekommen?
Njekrássow brachte das Manuskript den selben Tag zu Belinsky. Er betete Belinsky an und es scheint, dass er ihn sein lebenlang mehr geliebt hat, als alle andern. Damals hatte Njekrássow noch nichts von der Bedeutung geschrieben, wie dies ihm im nächstfolgenden Jahre gelingen sollte. Njekrássow befand sich, soviel mir bekannt ist, ungefähr sechzehn Jahre in Petersburg. Er schrieb ungefähr schon seit seinem sechzehnten Jahre. Über seine Bekanntschaft mit Belinsky weiss ich wenig, aber dieser hat ihn gleich anfangs richtig taxiert und hat wahrscheinlich grossen Einfluss auf seine Dichtung genommen. Ungeachtet des damals noch jugendlichen Alters Njekrássows und des grossen Altersunterschiedes, der zwischen ihnen bestand, waren sicherlich auch damals solche Augenblicke vorgekommen und solche Worte zwischen ihnen gefallen, welche auf das ganze Leben Einfluss nehmen und unlösbare Bande knüpfen.
„Ein neuer Gogol ist erstanden“, rief Njekrássow, als er, die „armen Leute“ in der Hand, bei Belinsky eintrat. „Bei Euch wachsen die Gogols wie die Pilze“, antwortete ihm strenge Belinsky, — aber er nahm das Manuskript. — Als Njekrássow wiederkam, da kam ihm Belinsky entgegen „geradezu bewegt“: bringen Sie ihn her, bringen Sie ihn schnell!
Und da brachten sie mich (schon am dritten Tage) zu ihm. Ich erinnere mich, dass mich beim ersten Anblick sein Äusseres sehr frappiert hat; seine Nase, sein Kinn — ich hatte mir ihn, Gott weiss warum, durchaus anders vorgestellt, diesen schrecklichen, diesen furchtbaren Kritiker. Er begegnete mir mit ausserordentlichem Ernst und grosser Zurückhaltung. „Nun es muss ja auch so sein“, dachte ich bei mir; allein es verging kaum eine Minute und alles hatte sich verwandelt. Es war nicht der Ernst einer bedeutenden Persönlichkeit, eines grossen Kritikers, welcher einem 22jährigen Jünglinge entgegen kam, der eben seine schriftstellerische Laufbahn betritt, sondern dieser Ernst floss sozusagen aus der Achtung vor jenen Gefühlen, die er so schnell als möglich in mich giessen wollte, vor jenen wichtigen Worten, die er mir zu sagen sich gedrängt fühlte. Er redete mich nun leidenschaftlich, mit leuchtenden Augen an: „Ja, verstehen Sie denn selbst — wiederholte er mehreremale, nach seiner Gewohnheit schreiend —, was Sie da geschrieben haben?“ Er schrie immer, wenn er in starker Bewegung sprach, „das haben Sie nur durch unmittelbares Gefühl, nur als Künstler schreiben können. Aber haben Sie denn selbst die schreckliche Wahrheit bedacht, auf die Sie uns hingewiesen haben? Es kann nicht sein, dass Sie mit Ihren 20 Jahren das verstehen könnten. Ja, dieser Ihr unglücklicher Beamte, ja, der ist schon dahin gekommen und hat sich selbst schon dahin gebracht, dass er sich selbst aus Erniedrigung sogar nicht mehr einen Unglücklichen zu nennen wagt und die geringste Klage als eine Freidenkerei ansieht; der es nicht einmal wagt, sich das Recht zuzusprechen, unglücklich zu sein, und als ihm der gute Mensch, der General, jene 100 Rubel giebt, ist er ganz zermalmt, ganz vernichtet vor Verwunderung, dass „ihre Excellenz haben“ einen solchen, wie er ist, bemitleiden können, „ihre Excellenz haben“, wie Sie ihn sich ausdrücken lassen, nicht „seine Excellenz hat“. Und der abgerissene Knopf, und der Augenblick, da er dem General das Händchen küsst, ja, da ist nicht mehr Mitleid mit einem Unglücklichen, da ist Grauen! Grauen! In dieser Dankbarkeit liegt etwas Grauenhaftes, das ist eine Tragödie. Sie haben das innerste Wesen der Sache getroffen, das allerwichtigste mit einem Strich gezeigt. Wir Publizisten und Kritiker beurteilen nur, wir trachten das Ding mit Worten zu erklären, aber Sie, der Künstler, stellen mit einem Strich die tiefste Wesenheit der Sache im Bilde hin, so dass man es auf einmal fassen kann, dass dem urteilslosesten Leser mit einem Male alles begreiflich werde. Da haben Sie das Geheimnis des Künstlertums, da haben Sie die Wahrheit in der Kunst. So dient Ihr der Wahrheit. Ihnen ist sie offenbart und verkündet als einem Künstler; Sie haben sie als ein Geschenk empfangen. — Schätzen Sie also diese Gabe hoch, bleiben Sie ihr treu, und Sie werden ein grosser Künstler werden!“
Alles dieses sagte er mir damals, alles dieses sagte er auch später über mich vielen anderen, die jetzt noch leben und es bezeugen können. Ganz berauscht ging ich von ihm fort; ich blieb an der Ecke seines Hauses stehen, sah den Himmel über mir, sah den hellen Tag, die Vorübergehenden, und fühlte mit meinem ganzen Wesen, dass in meinem Leben ein feierlicher Augenblick eingetreten war, ein Durchbruch nach der Ewigkeit, etwas ganz Neues; aber etwas, das ich damals auch in meinen leidenschaftlichsten Träumen nicht vermutet hatte (und ich war damals ein schrecklicher Träumer!). „Wär’ es möglich, bin ich in Wahrheit so gross?“ — dachte ich schamhaft, in einer Art schüchterner Entzückung, bei mir. O, lachet nicht! Niemals nachher habe ich gedacht, dass ich gross sei, aber damals — konnte man denn das ertragen! O, ich werde dieses Lobes würdig sein! — Und was für Menschen, was für Menschen! Ich werde es verdienen, ich werde trachten so prächtig zu werden wie sie, ich werde ausharren, getreu sein! O, wie bin ich doch leichtsinnig! Wenn Belinsky nur sähe, was für niedere, schändliche Dinge in mir sind! Übrigens giebt es solche Leute nur in Russland, sie stehen allein, aber bei ihnen allein ist Wahrheit; und diese, das Gute und Wahre siegen und triumphieren überall. — So werden wir über das Böse und das Laster siegen — o, zu ihnen also, mit ihnen! ......
Das alles dachte ich, ich erinnere mich des Augenblicks in seiner ganzen Klarheit, und niemals habe ich ihn später vergessen können; das war der hinreissendste Moment meines ganzen Lebens.
Mit dieser Erzählung „Arme Leute“, sagt N. Strachow, „hat Dostojewsky einen neuen Ton in die russische Litteratur gebracht. Die Situation und die Figur des armen Helden, welche eine gewisse Ähnlichkeit mit der Hauptfigur aus Gogols „Mantel“ hat, weist Züge rührender Schönheit und Herzenseinfalt auf, während Gogol nur das Factum, das Erniedrigende und Lächerliche desselben darstellt“. Dass Dostojewsky mit vollem Bewusstsein diesen grossen Schritt gethan und diesen echt russischen Zug von Teilnahme und Liebe zu den Unbegabten und Erniedrigten in die Litteratur gebracht hat, beweist die Stelle, wo Makar Djewuschkin (der Held), dem das geliebte Mädchen Bücher leiht und einmal Gogols „Mantel“ zu lesen anrät, diese Erzählung als ein böswilliges Pasquill auf alle Armen aufnimmt, „die man ja jetzt auf der Strasse erkennen kann“, und sich in seiner Verzweiflung zum ersten Male im Leben — einen Rausch antrinkt. Es ist dies Dostojewskys schärfste Kritik Gogols, den er im übrigen unendlich bewundert und den er sich infolge ähnlicher Anlage zum Humor eine Zeit lang äusserlich zum Muster nimmt. — Wir mussten länger bei dieser Erzählung verweilen, weil sie eigentlich schon das „Leitmotiv“ der litterarischen Thätigkeit von Dostojewskys ganzem Leben anstimmt. Im Gegensatze zu anderen Dichtern, welche in ihren Erstlingswerken höchst unoriginal sind und erst später zu sich selbst kommen, setzt Dostojewsky kräftig und zielbewusst mit dem Ton an, der durch alle seine Werke geht, den er in der Seele hört, und um deswillen allein er schreibt. Seine Biographen und Arbeitsgenossen nennen vier Anlässe oder Anläufe des Dichters, welche seine vier, nach ihrer Grundidee bedeutendsten Werke hervorgerufen haben, gleichsam grosse Etappen auf seiner Dichterlaufbahn. N. N. Strachow, des Dichters Freund und Mitarbeiter, sagt in seinem Nachruf: „In seiner litterarischen Thätigkeit hat Dostojewsky eine Lebenskraft und Energie gezeigt, wie kein Zweiter. Er hatte Perioden der Erschlaffung, gleichsam des Verfalles — dann aber hat er sich immer wieder höher aufgeschwungen als je zuvor und sich immer wieder von einer neuen Seite gezeigt. Man kann vier solche neue Krafterhöhungen bei ihm nachweisen: 1. „Arme Leute“, 2. „Das Totenhaus“, 3. „Schuld und Sühne“ und endlich 4. „Das Tagebuch eines Schriftstellers“.
Uns scheint diese Einteilung eine ziemlich äusserliche zu sein. Die vier Grundideen, welche sich in diesen vier Werken äussern, sind durchaus einheitlich und nur verschiedene Äusserungen des in „Arme Leute“ angeschlagenen Themas. Hat man aber dieses Grundthema herausempfunden, so wird man, nämlich seiner Wirkung nach aussen nach, finden, dass zwei andere Werke es noch kräftiger, eindringlicher, zwingender durchführen. Diese Werke sind: „Der Idiot“ und „Die Brüder Karamasow“. Wir werden bei der Besprechung jedes einzelnen eingehender darauf zurückkommen. Gleichwohl wird der aufmerksame Leser von Dostojewskys Werken in Bezug auf seine litterarische Entwickelung zwei Epochen seiner schriftstellerischen Thätigkeit unterscheiden. Die erste Phase, welche gleich nach dem herrlich sicheren Ansetzen des Lebensthemas in „Arme Leute“ beginnt, hat etwas Tastendes, sowohl was die Wahl der Stoffe, als was die Wahl der Form anlangt. Unmittelbar nach dem Erfolge der „Armen Leute“, die indessen noch nicht im Druck erschienen waren, da Njekrássow die Sammlung, in welcher der Roman untergebracht werden sollte, erst 1846 herauszugeben dachte — also im Jahre 1845 macht sich Dostojewsky daran, den „Doppelgänger“, den er schon lange mit sich herumgetragen und von dem er sich anfangs viel versprochen hatte, auf Papier zu bringen. Durch das Auf und Ab seiner eigenen Verhältnisse gequält, schreibt er, wahrscheinlich nach seinem Besuch in Reval, an seinen Bruder:
.... „Wie traurig war es mir zu Mute, als ich nach Petersburg hineinfuhr ...... Wenn mein Leben in diesem Augenblicke abgerissen wäre, so wäre ich, scheint mir, mit Freuden gestorben .... Mein Diener hat sich zu Hause nicht gezeigt, der Hausmeister gab mir den verwaisten Schlüssel meines 600 Rubel-Quartiers, dessen Zins ich schuldig bin ... Gregorowitsch und Njekrássow sind nicht in Petersburg .... Sie werden kaum bis zum 15. September da sein ... Wie schade, dass man arbeiten muss, um zu leben. Meine Arbeit verträgt keinen Zwang ... Ich bin jetzt selbst der wahrhaftige Goljadkin, mit dem ich mich übrigens gleich morgen beschäftigen werde. Goljadkin, der abscheuliche Schuft, will durchaus nicht vorwärts, will durchaus vor der Hälfte November seine Carriere nicht vollenden“ ....
Am 16. November 1845 schreibt Dostojewsky: „Überall unglaubliche Ehrerbietung, überall eine schreckliche Neugierde in Bezug auf mich: Fürst Odojewsky bittet mich, ihn mit meinem Besuch zu beglücken, und Graf Sologub reisst sich in Verzweiflung die Haare aus; Panajew hat ihm gesagt, dass ein Talent da ist, welches sie alle in den Staub tritt“. Weiter schreibt er: „Dieser Tage war ich ohne einen Groschen; Njekrássow hat indessen „Zuboskala“, einen prächtigen humoristischen Almanach, ins Leben gerufen, dessen Vorrede ich geschrieben habe. Diese Vorrede hat Lärm gemacht ... Dieser Tage, als ich kein Geld hatte, ging ich zu Njekrássow, und als ich so bei ihm sass, kam mir die Idee eines Romans in neun Briefen. Nach Hause gekommen, schrieb ich diesen Roman in einer Nacht; er wird in der ersten Nummer der Zuboskala gedruckt werden. Du wirst schon selbst sehen, ob dies schlechter ist, als Gogol“. Weiter schreibt er: „Ich denke, ich werde Geld bekommen; Goljadkin wird vortrefflich — er wird mein chef d’oeuvre sein“. Als Nachschrift heisst es: „Belinsky schützt mich vor den Unternehmern“. Eine zweite Nachschrift lautet: „Ich habe meinen Brief überlesen und finde mich erstens ungrammatikalisch und zweitens einen Prahler“. Eine letzte Nachschrift sagt: „Die Minnuschkas, Claruschkas und Mariannen etc. sind unglaublich schöner geworden, kosten aber schrecklich viel Geld. Neulich waren Turgenjew und Belinsky da und haben mich über mein unordentliches Leben ausgescholten“. In einem Briefe vom 1. Februar 1846 teilt Dostojewsky seinem Bruder mit, dass er endlich am 28. des vorhergegangenen Monates „seinen Schuft Goljadkin“ vollendet habe. Dann weiter: „Für Goljadkin habe ich rund 600 Silberrubel bekommen; ausserdem erhielt ich noch einen Haufen Geld, so dass ich nach meinem Abschied von Dir schon 3000 ausgegeben habe. Ich lebe eben sehr unordentlich und das ist die ganze Geschichte. Ich bin ausgezogen und habe zwei sehr schön möblierte Zimmer bei Vermietern genommen. Ich lebe sehr gut“. (Folgt die Adresse, zufällig dasselbe Haus, in dem er starb.) Zum Schluss schreibt er: „Ich bin nervenkrank und fürchte ein Nervenfieber; regelmässig leben kann ich nicht, so sehr bin ich unordentlich“.
Zwei Monate später, am 1. April, schreibt er:
„In meinem Leben giebt es jeden Tag soviel Neues, so vieles, das für mich gut und angenehm ist, soviel Unangenehmes und Widerwärtiges auch, dass ich selbst nicht Zeit habe, darüber nachzudenken. Erstens bin ich sehr beschäftigt, Ideen eine Unzahl, und schreibe unaufhörlich. Denke nicht, ich sei auf Rosen gebettet, Unsinn. Erstens habe ich gerade 4500 Rubel verbraucht seit der Zeit, da wir uns trennten, und habe um 4000 Papierrubel von meiner Ware voraus verkauft; ... aber das ist nichts, mein Ruhm hat seinen Höhepunkt erreicht. Innerhalb zweier Monate wurde 35 mal in verschiedenen Werken von mir gesprochen ... aber was widrig und quälend ist, ist das: die Meinen, die Unsern, alle sind mit meinem Goljadkin unzufrieden. Der erste Eindruck war massloses Entzücken, Reden, Lärm, Auseinandersetzungen, dann Kritik: Alle, das heisst die Unsern und das ganze Publikum, haben gefunden, dass Goljadkin so langweilig und fade, so in die Länge gezogen ist, dass es unmöglich ist, ihn zu lesen.“ Weiter sagt er zu seinem eigenen Troste: „Alle sind zornig über diese Längen, und alle lesen es doch über Hals und Kopf und lesen es wieder über Hals und Kopf.“ Noch weiter sagt er: „Ich habe ein schreckliches Laster: eine unbegrenzte Eigenliebe und Ehrliebe ... mir ist jetzt Goljadkin widerwärtig; vieles darin ist in Hast und Ermüdung geschrieben. Die erste Hälfte ist besser als die letzte; auf glänzend geschriebene Seiten folgt ein abscheulicher Schund, dass es einem die Seele umdreht und man nicht weiter lesen will. Das ist es, was mir in der ersten Zeit zur Hölle wurde, und ich bin aus Kummer krank geworden.“
Man sieht aus diesen überschwänglichen Mitteilungen, wie sehr der erste Erfolg dem 24jährigen Dichter zu Kopf gestiegen war und seine Selbstkritik geschädigt hatte, da er den Roman in neun Briefen „eine Perle, nicht schlechter als Gogol“ und den Doppelgänger sein chef d’oeuvre nennt. Bald jedoch, und das wieder von aussen angestossen, fällt sein Selbstbewusstsein, da „Alle, alle, die Unsern, sowie das Publikum über den Doppelgänger losziehen.“
Es ist für den Dichter eben jetzt erst die Zeit der Nachahmung und des Suchens nach seinem Stil angebrochen, ein Herumtasten, das ihn einerseits auf die Wege Gogols und der Humoristen führte, denen er seiner Anlage nach sehr nahe stand, andererseits den Spuren Balzacs und George Sands nachgehen hiess, wozu ihn der überwuchernde Reichtum seiner ethischen Phantasie und namentlich die Lust an Scenen- und Situationenwechsel verführen mochte. Dieser Periode des Tastens entsprangen ausser dem Doppelgänger und dem Roman in neun Briefen sehr bemerkenswerte kleinere und grössere Erzählungen, auf die wir an ihrer Stelle im einzelnen zurückkommen werden. Ihre Hauptmerkmale sind: Eine unwiderstehliche Situationskomik, wie in der „Frau des Andern“, „Eine heikle Geschichte“, ferner ein kräftig satirischer Zug, wie in „Das Krokodil“, und eine unendliche Zartheit und ehrfürchtige Jugendlichkeit in der Zeichnung weiblicher Gestalten, wie in „Njetotschka Njezwanowa“ und „Helle Nächte“. Es ist sehr zu bedauern, dass es keine Gesamtausgabe von Dostojewskys Schöpfungen in deutscher Sprache giebt, welche sie in der Reihenfolge ihrer Entstehung und damit ein übersichtliches Bild der inneren und äusseren Entwickelung des Dichters brächte. Es würden daraus dem eindringenden Leser die zwei Phasen vor und nach Sibirien sofort erkennbar werden; es würde daraus erhellen, wie der Dichter allmählich sich wieder findet, auf die glänzendste Komik und die reichste Ausgestaltung der Fabel sehr oft, nicht nur aus Hast und Geldmangel, oder weil ihm der Humor ausgegangen wäre, verzichtet, und immer kräftiger, unentwegter auf das Ziel seiner Lebensaufgabe lossteuert, bis er zuletzt zum „Tagebuch eines Schriftstellers“ gelangt, das ihm ermöglicht, ganz subjektiv, ohne Umschweife und künstlerische Umwege, rein publizistisch „die Wahrheit“ zu verkünden. — „Denn“, sagt er immer wieder, „ein Journal ist eine grosse Sache“.
Wir haben diese Abschweifung für notwendig erachtet, weil mit dem Hinweis auf die einheitliche Grundidee seines ganzen Lebenswerkes, die sich so mächtig in seinen Arbeiten vor uns auslegt, ein Punkt gewonnen ist, von wo aus wir sowohl sein Leben, als seine Thätigkeit und sein Streben bis ans Ende klar überblicken können.
„Der Doppelgänger“ schildert den Zustand eines im Grunde mittelmässigen Menschen, welcher aus dem Unvermögen heraus, das wirklich darzustellen, zu thun, zu fordern, zu sein, was er darstellen, thun, sein und fordern will, wahnsinnig wird. Anfangs zwingt er sich zu allen jenen mutigen Lebensäusserungen, die seinem eigentlichen Wesen fehlen, da er sie aber an unrechtem Ort, zu unrechter Zeit und in unziemlicher Weise verübt, so ist Spott und Verachtung und niedrigste Entehrung sein Lohn, so dass er, nun in Wahnvorstellungen versunken, jenes andere Ich, das, er sein möchte, als Hallucination fortwährend an seiner Seite sieht, bis am Schluss sein Wahnsinn offenkundig und er in ein Irrenhaus gebracht wird. Nun wäre dieser Vorgang an sich verständlich und mit der feinen Dostojewskyschen Motivierung ergreifend, deutlich, wenn der Dichter hier nicht eine Gewaltsamkeit verübt hätte, welche die Einheit des Werkes und dadurch dessen Klarheit zerstört. Er stellt nämlich da, wo es zum Ausbruch der Katastrophe kommt, einen wirklichen, allen anderen sichtbaren Doppelgänger und zugleich Namensvetter des Herrn Goljadkin mitten in seine Karriere hinein, an Goljadkins Arbeitspult, unter Goljadkins Kollegen und Vorgesetzte und lässt in Wirklichkeit den Narren durch seinen klugen, streberhaften Doppelgänger verdrängen. Es ist, als ob der Dichter kein anderes Mittel gefunden hätte, um uns zu zeigen, dass oft kluge Routine allein sich an die Stelle dessen setzt, dessen Kraft nicht ausreicht, um in der Erscheinung ein Charakter zu werden. Man wüsste sonst nicht, warum dieser gewaltsam hingesetzte deus ex machina auftaucht, dessen es nicht bedurft hätte, um die Tragödie eines isolierten Charakters, wie ein geistvoller Essayist den Doppelgänger nennt, darzustellen.
In mehreren Briefen Dostojewskys finden wir Andeutungen darüber, dass das Buch ein „Bekenntnis“ und ein specifisch russisches Bekenntnis ist, dass es einem Grundfehler des „russischen Menschen“ an den Leib geht und dass es auch den Finger auf die Stelle legt, wo geistige Zerrüttung beginnt, die im Wahnsinn endet.
Der „Roman in neun Briefen“ entstand, wie wir gesehen haben, ebenfalls in der ersten Epoche von Dostojewskys schriftstellerischer Thätigkeit und, wie wir ja aus seinem Briefe an den Bruder sehen, in einer Nacht. Er ist nichts weiter, als eine psychologische Spielerei, in welcher der Dichter mit Meisterschaft die ebenbürtige, wenn auch sehr verschieden nuancierte Niederträchtigkeit von fünf Personen in knappster Weise in neun Briefen heraus arbeitet.
Im Dezember 1845 kommt der Dichter in einem Brief an den Bruder noch einmal auf den unglücklichen Goljadkin zurück und erzählt, Belinsky habe eigens einen Leseabend veranstaltet, zu welchem auch Turgenjew eingeladen gewesen sei, damit er einige Kapitel dieser Erzählung höre. Allein Turgenjew entfernte sich sehr bald nach Beginn der Vorlesung, äusserte sich sehr lobend, war aber sehr eilig fortzukommen. Drei oder vier Kapitel hätten Belinsky sehr gefallen, „obwohl sie es nicht wert waren“, wie Dostojewsky sich ausdrückt, worauf er sagt, dass diese Erzählung, der eine der ernstesten Ideen zu Grunde liege, welche der Dichter bis heute in die Litteratur eingeführt habe, dennoch misslungen sei. Er hat sie nach 15 Jahren einer gründlichen Umarbeitung unterzogen, sie aber dann noch als eine „völlig misslungene Sache“ bezeichnet. —
Des Dichters äussere Verhältnisse zeigen in dieser Zeit immer dasselbe Bild grösster Veränderlichkeit und Unordnung, dem immer auch ein Wechsel in der Stimmung entspricht. Eines aber ist bleibend: sein grosses Selbstgefühl. So sagt er in einem Briefe vom 1. April 1845: „Ein ganzer Schwarm neuer Schriftsteller ist aufgetaucht“. Die bedeutendsten darunter scheinen ihm Gontscharow und Herzen zu sein. „Man lobt sie ausserordentlich“, fährt er fort „der Vorrang aber bleibt vorläufig noch mir und wird wohl immer mir bleiben“.
Allerlei Pläne schwirren in seinem Kopfe herum. Er beginnt für Belinskys „Vaterländische Annalen“ zwei kleine Geschichten: „Der rasierte Backenbart“ und „Die zerstörten Kanzleien“. — Diese letztere dürfte wohl die unter dem Namen „Herr Prohartschin“ später erschienene Geschichte sein. „Beide“, sagt er, „haben ein erschütterndes, tragisches Interesse und sind — dafür stehe ich Dir gut — schneidig bis aufs äusserste“. Auch eine gemeinsame Übersetzung von Goethes Reineke Fuchs schlägt er dem Bruder vor.
Nach einem zweiten Besuch in Reval kündigt er dem Bruder an, dass er abermals ausziehen werde, zwei kleine, möblierte Zimmer in Aftermiete genommen habe, wohin er indes, wie wir später sehen werden, gar nicht übersiedelt. Er erzählt ferner, dass im „Zeitgenossen“, einer von Njekrássow redigierten Zeitschrift, Gogols geistiges Vermächtnis erscheine, worin dieser sich von allen seinen Werken lossage. „Also,“ fügt er hinzu, „ziehe selbst den Schluss daraus.“ — Dass man seinen Prohartschin in der Zeitschrift Njekrássows zu besprechen beginne, teilt er auch mit und schliesst abermals mit einem Ausbruch von Trauer und Melancholie, „wo es am besten sei zu schweigen“. Es ist diese Stimmung nämlich die Folge eines rivalisierenden Geplänkels der Redakteure, denen er sich abwechselnd verdingen muss, um schnell zu Geld zu kommen. Namentlich scheint Njekrássow immer in sehr kaufmännischer Weise alle Transaktionen geleitet zu haben. Ein bedeutendes Aufschnellen von Dostojewskys Stimmung tritt jedoch wieder ein, als der junge Dichter einen Kreis von Freunden findet, die festigend und ordnend in sein äusseres Leben eingreifen. Es sind die Brüder Beketow, vor allem aber S. D. Janowsky, mit dem er noch nach vielen Jahren in Korrespondenz stehen sollte. Nun schreibt er an den Bruder voll Vertrauen und Hoffnung, sich unabhängig zu machen, und voll Durst nach heiliger Kunst, nach einer reinen, heiligen Arbeit, mit der ganzen Aufrichtigkeit eines Herzens, „das noch nie in ihm so heftig erbebt habe, wie jetzt, da so viele neue Bilder in seiner Seele erstehen. Bruder,“ sagt er, „ich bin in einer Wiedergeburt begriffen, nicht nur geistig, sondern auch physisch; noch niemals habe ich eine solche Fülle und Klarheit in mir getragen, so viel Gleichmässigkeit des Charakters, so viel physische Gesundheit empfunden. Darin bin ich meinen teueren Freunden Beketow und — anderen tief verpflichtet, mit denen ich lebe. Das sind thätige, gescheite Menschen, Menschen, die ein vortreffliches Herz, Seelenadel, Charakter haben ... sie haben mich durch ihre Genossenschaft gesund gemacht. Zuletzt habe ich ihnen vorgeschlagen, dass wir miteinander wohnen sollten; wir haben eine grosse Wohnung aufgenommen, und die Gesamtauslagen für die Erhaltung jedes einzelnen übersteigen nicht 1200 Rubel jährlich. So gross ist die Wohlthat der Association.“
Dieser Schluss dürfte, wie Orest Miller richtig bemerkt, wohl schon im Zusammenhang mit Dostojewskys neuester Beschäftigung stehen, mit dem Sozialismus:
Ein tiefer gehendes Merkmal dieser Beschäftigung mit dem Sozialismus ist wohl der Umstand, dass sich der Dichter nachträglich in seiner eigenen Beurteilung der „Armen Leute“ von der rationalistischen Anschauung Belinskys beeinflussen lässt, welcher die positiven Schönheiten dieses Buches durchaus nicht in den weichen Schatten sieht, welche „Armut im Geiste“ über die Gestalt des Helden breitet, sondern ganz einfach in gewissen, schärfer hervortretenden, gleichsam das Mitleiden escomptierenden Zügen dieser missbrauchten, zertretenen Figur. Dostojewsky selbst schliesst sich, vermöge der seinen Geist jetzt beschäftigenden Ideen von Kollektivismus und Association, dieser flacheren Betrachtung an, und wir werden später sehen, wie er sich, seinem innersten Wesen nach, wieder davon lossagt.
Über des Dichters Leben in den Jahren 1846 und 47 geben uns sowohl die Berichte N. Strachows, Dr. Granowskys und anderer Freunde, als auch seine stets die Stimmung des Augenblicks malenden Briefe an den Bruder ein ziemlich klares Bild. Obwohl er noch immer im Verein mit den Freunden lebt, „angenehm und ökonomisch,“ wie er sagt, leidet seine nervöse Konstitution doch schwer unter den doppelten Qualen eines schöpferischen Dranges, die Probleme, die ihn förmlich bestürmen, auszulösen, sie mit allerfeinster analytischer Genauigkeit herauszuarbeiten, und der misstrauischen Ängstlichkeit, mit welcher er auf den Eindruck lauert, den seine Arbeiten hervorrufen; wobei seine Eigenliebe bald den Gipfel des entzückten Triumphes und der Selbstüberschätzung erklimmt, bald abgrundtief in Kränkung und melancholischen Unwillen versinkt. Zudem plagt ihn das Ungeordnete, das dem Schriftsteller-Handwerk durch die Zahlungs-Verhältnisse zwischen Dichter, Redakteur und Verleger an und für sich anhaftet, doppelt. Dennoch finden wir nicht einen Augenblick wirklicher Mutlosigkeit oder eines Nachlasses in der Arbeit, und wir sehen von hier an, wo sich sein schriftstellerischer Beruf ihm und aller Welt schon klar gezeigt hat, eine immer gesteigerte Arbeitskraft, die alle Widerwärtigkeiten, die schwere, sich entwickelnde Epilepsie und die daraus entstehende Gedächtnisschwäche überwindet und geradezu verblüffende Leistungen schafft. Im Dezember 1846 teilt er dem Bruder mit, dass er ganz in Arbeit versunken ist. Er schreibt Tag und Nacht, erholt sich nur hie und da, wie er gleichsam als Entschuldigung zufügt, an der italienischen Oper. Er schreibt an der Erzählung „Njetotschka Njezwánowa“ — „auch eine Beichte“, sagt er, „wie Goljadkin, wenn auch in einem andern Tone. Mir scheint immer“, fährt er fort, „als führte ich einen Prozess gegen unsere gesamte Litteratur; und mit den drei Teilen meines Romans, die in den Vaterländischen Annalen erscheinen werden, stelle ich auch für dieses Jahr meinen Vorrang gegenüber meinen Neidern fest.“ Anfangs 1847 drückt er dem Bruder sein Bedauern darüber aus, dass dieser „ohne Umgebung“ lebe. Wir haben oben gesehen, wie sehr ihm die Deutschen der Ostseeprovinzen missfielen. Doch tröstet er ihn mit Worten, welche gleichfalls die neue, seinem ursprünglichen Wesen widersprechende Richtung kennzeichnen. Weiter berichtet er in überschwenglichen Ausdrücken über seine „Wirtin“, die er eben schreibt, gerade so selbstzufrieden, als mit dem Roman in neun Briefen. „Diese Erzählung wird besser, als die „Armen Leute“, sie ist in derselben Art“, meint er. „Meine Feder treibt eine Quelle der Inspiration, nicht so wie bei Prohartschin, an dem ich mich einen ganzen Sommer lang herumquälte.“
„Herr Prohartschin“ ist eine jener Erzählungen aus der Zeit einer, wie wir oben gesagt, tastenden Nachahmung. Eine lächerliche, armselige Gestalt unter anderen armseligen und ungebildeten Menschen, bei einer armen Witwe „in Kost und Wohnung“ und von den anderen durch allerlei abgekartete Mystifikationen in die Flucht und dadurch in Krankheit und Tod geschreckt; dies wird namentlich durch die Angst Prohartschins gefördert, dass man sein durch zwanzig Jahre zusammengeknausertes Kapital von kleinen Münzen nicht in der schmutzigen Matratze vermute, die er in allen Mussestunden mit seinem Leibe deckt.
Die Aufhäufung menschlicher Schwächen und Lächerlichkeiten im Raum eines Druckbogens, dabei ein absichtliches Fernhalten aller jener Züge im Helden, welche Teilnahme erwecken müssten, also ein forcierter, bis ins Groteske gehender Humorismus mit Anklängen an Gogol und Dickens, und Stellen feiner Detailschilderung, die jener würdig wären, kennzeichnen diese Erzählung, an welcher sich der Dichter „einen Sommer lang herumquälte“.
„Die Wirtin“ wurde von Belinsky, wie wir später erfahren, sehr abfällig kritisiert. Es scheint uns diese Ablehnung gerade von Belinskys Seite erklärlich genug. Vor allem konnte dem scharfen Progressisten und Vertreter der sozialen Richtung in diesen Tagen der Bewegung ein Buch ohne Tendenz oder eine tendenziös auszunutzende Pointe nicht genügen. Andererseits war sein Geschmack zu fein, um jene Unebenheiten, jene Ungleichheiten im Ton derselben, sowie den jugendlich unrealen Romantismus, der im Hauptteil der Erzählung zu Tage tritt, nicht zu empfinden. Er hätte diese Mängel allenfalls milder beurteilen können, wenn sich dahinter eine zeitgemässe Forderung oder Anspielung verborgen hätte. Wie dem auch sei — wir sind trotz jener Fehler von diesem Jugendwerke hingerissen und erschüttert.
Die Gestalt des Alten, des eigentlichen Helden der Erzählung, wirkt auf den Leser mit derselben abstossenden Anziehung, wie sie nach der Schilderung Katharinas auf alle, die in seine Nähe kommen, wirkt. Wir begreifen seinen mystisch-verbrecherischen Sieg über das „schwache Herz“, das sich an seiner Seite vergeblich nach junger Liebe, jungem Leben sehnt, das sich losmachen möchte und ihm doch immer wieder anheimfällt. Ein Grauen durchbebt uns bei dem nächtlichen Bekenntnis Katjas, das in der geheimnisvoll-süssen Sprache der Primitiven mehr verschweigt als enthüllt, und die Schilderung der Brandnacht, jene der Flucht auf der Wolga mit dem Boot, das im Sturme „nicht dreie tragen kann“, hüllen uns, eine ossianische Ballade, in alle Schauer altnordischer Poesie. Die Herrlichkeit dieser Sprache, die Anschaulichkeit dieser Bilder, die ganz rein dichterisch wirken — das hat sich bei Dostojewsky nie mehr in dieser Art wiederholt. Was Belinsky darin gefehlt haben mochte, war wohl jene reife, frühreife Menschenkenntnis, die er in den „Armen Leuten“ so sehr bewundert hatte. Ihn mochte der Taumel des 26jährigen, „von einer Quelle der Inspiration getriebenen“ Dichters enttäuschen, dem Himmel und Hölle aus diesen zwei Menschenangesichtern entgegenschlugen. Auch konnte er unmöglich darüber hinwegsehen, dass Ordynow, der nominelle Held der Liebesgeschichte, nichts anderes ist, als ein Deus ex machina, eine Entladungsstelle für die elektrischen Pole Muryn und Katharina. Ordynow ist kein Mensch mit Fleisch und Knochen, sondern ein Bündel Nerven, an dem die Geschichte ausgeht. Auch könnte ein realistischer Kritiker durch die meisterhafte Zeichnung der Nebenfigur Jaroslaw Ilitsch, in welcher sich Dostojewskys ganze realistische Kraft mehr verrät als zeigt, nicht über das Schattenhafte alles übrigen ausgesöhnt werden. Wir aber finden in diesem Romantismus Stellen einer tiefen Seelenahnung auch vom Wesen der Frau — an welches der Dichter in der ersten Periode seines Schaffens überhaupt mit ehrfürchtiger Scheu herantritt. Am Schlusse der Erzählung spricht der Dichter durch den Mund Ordynows an folgender Stelle seinen Hauptgedanken aus:
„Es schien ihm (Ordynow), dass Katharinens Geist nicht gestört war, dass aber Muryn in seiner Weise Recht hatte, als er sie ein schwaches Herz nannte. Es schien ihm, dass ein Geheimnis sie mit dem Alten verbinde, dass aber Katharina, ohne ihre Schuld zu erkennen, so rein wie eine junge Taube, in seine Macht gekommen war. Wer waren sie? Er wusste es nicht; allein ihm träumte unaufhörlich von der tiefen, unentrinnbaren Tyrannei über ein armes, schutzloses Wesen. Und sein Herz wurde unruhig und pochte in ohnmächtiger Entrüstung in seiner Brust. Es schien ihm, dass man vor die erschreckten Augen der plötzlich erwachenden Seele hinterlistig ihren Fall hingestellt, in listiger Weise ihr armes, schwaches Herz gequält, Wahres und Falsches vor ihr vermengt hatte, da, wo es nötig schien, ihre Blindheit absichtlich unterhielt, in schlauer Weise den unerfahrenen Neigungen ihres aufstürmenden, beunruhigten Herzens schmeichelte; dass man nach und nach die Flügel ihrer fessellosen, freien Seele stutzte, so dass sie zuletzt nicht mehr fähig war, sich aufzurichten, noch ihren freien Schwung zu nehmen in das Leben der Wirklichkeit.“
Vielen Lesern dieser Erzählung hat sie unklar und unvollendet geschienen. Dies muss auch bei jenem französischen Übersetzer der Fall gewesen sein, welcher den Mut hatte, sie mit der 17 Jahre später geschriebenen Erzählung „Memoiren aus einem Souterrain“[3] (deutsch: Aus dem dunkelsten Winkel einer Grossstadt) zusammenzuschweissen und unter dem Titel „l’Esprit souterrain“ zu veröffentlichen. Derselbe französische Übersetzer hat es auch gewagt, die „Brüder Karamazow“ einer Verstümmelung zu unterziehen, indem er den Roman beim zweiten Buche beginnen lässt. Traduttori traditori!
Die „Wirtin“ wurde also von Belinsky sehr übel behandelt, was den Dichter tief kränkte, obwohl er sich gar nicht schriftlich darüber geäussert hat. Seine nächsten Mitteilungen an den Bruder sind wieder Berichte über angestrengte Thätigkeit, bestellte Arbeit, die man mit Vorschüssen sichert, „kurz eine Hölle“. Hier muss erwähnt werden, was er in allen seinen Briefen während der ganzen Dauer seiner Laufbahn immer wieder betont: „Auf Bestellung arbeiten werde ich niemals; ich habe es mir zugeschworen. Von solcher Arbeit würde ich zu Grunde gehen!“ — Der einzige Weg, den er einschlug, um durch seine Arbeit zu Gelde zu kommen, war der, dass er von den vielen Plänen und fertigen Entwürfen, die er immer mit sich herumtrug, einen oder den anderen den bekannten Redakteuren vorschlug und einen Termin angab, bis zu welchem er die Arbeit vollenden könnte. Meistens wusste er von vornherein fast ganz genau, wieviele Druckbogen sie ausmachen würde, und überschritt selten das selbst gestellte Mass. Um diese Zeit gestaltet sich Dostojewskys äusseres Leben sehr bewegt. Nach der einen Seite findet er im Hause des Malers Maikow, eines Bruders des bekannten Dichters dieses Namens, Anregung und Förderung durch den Verkehr mit Schriftstellern und bedeutenden Menschen, worunter Gontscharow, Dudyschkin, A. Maikow und andere. Er hat Gelegenheit, dort die Werke Gogols und Turgeniews bis in das kleinste Detail der Charakteristik analysierend zu besprechen, auch seinen Prohartschin herauszuarbeiten, welcher „den meisten Lesern unverständlich“ war, findet aber auch im Ehepaar Maikow thatkräftige Freunde, welche ihm bei seinen Geldkalamitäten hilfreich beispringen.
Nach der andern Seite tritt er in den Verkehr mit einem Kreis junger Leute, welche den neuen Ideen huldigen. Ein Brief aus dieser Epoche vom 9. September 1847 spricht nur eine energische Zustimmung zu des Bruders Absicht aus, seinen Abschied zu nehmen. Er rät ihm, gemeinsam eine Gesamtausgabe von Schillers Dramen, die er ja übersetzt habe, zu veranstalten, und schliesst mit den Worten: „Warte nur, Bruder, wir werden schon hinauf kommen; es ist unmöglich, dass wir beide uns nicht durchschlagen.“ Am Rande schreibt er: „Siehst Du, was Association bedeutet? Arbeiten wir getrennt, so gehen wir unter, zusammen aber gehen wir einem grossen Ziele entgegen — das ist etwas ganz anderes!“
Hier haben es die Herausgeber für angebracht befunden, eine Lücke von nahezu zwei Jahren in die Korrespondenz zu reissen, welche allerdings nicht sehr ausgiebig und nicht sehr expansiv gewesen sein dürfte. Die „neuen Ideen“ Sozialismus, Fourierismus hatten den Feuerkopf ergriffen. Er schloss sich um diese Zeit jenem Kreise sehr nahe an, in welchem über die künftigen Umgestaltungen Russlands, über eine Änderung der Staatsverfassung lebhaft debattiert wurde. Dies war aber zu einer Zeit, da es geradezu gefährlich sein mochte, sich eine Ansicht über den Umschlag des Wetters, eine Prognose zu erlauben. Sprach man schon im Kreise von Freunden und Gesinnungsgenossen, so hütete man sich wohl, die Worte, die gefallen waren, nach aussen auszusprechen oder aufzuschreiben; so kann es wohl sein, dass nicht viele Briefe Dostojewskys an seinen Bruder in Gang kamen. Theodor Michailowitsch war an und für sich nicht mitteilsam; wo er sich mitteilte, geschah es zumeist in nervöser, durch Gegensatz und Widerspruch oder durch eine aufgestachelte Lust am Paradoxen hervorgerufene Kampfstimmung.
Indessen sind aus dieser Zeit noch einige Briefe im Besitze der Rechtsnachfolger, welche sich noch heute in der schwierigen Lage befinden, den Dichter lavierend nach beiden Seiten hin schützen und immer fürchten zu müssen, ihn nach rechts oder nach links zu kompromittieren. Es wäre zu untersuchen, ob nicht ein kühnes Durchbrechen dieser Schwierigkeiten durch offene Darlegung des Sachverhalts, Veröffentlichung auch der „gravierendsten“ Briefe, mit einem Schlage die Luft um seine Erscheinung von allen Miasmen der Missgunst, des stillen Grolls und der Verurteilung zu reinigen vermöchte.
Der Verkehr mit jenem Kreise junger Politiker, mit neuen Ideen führte Dostojewsky immer tiefer in dieselben ein, und die vielen, wenn auch sicher fruchtlosen, so doch von aufrichtiger Glut für Freiheit, Menschen- und Bürgerrechte beseelten Debatten im Hause des Ministerialbeamten Petraschewsky und dem des Kollegien-Assessors und Litteraten Durow beschleunigten die Katastrophe, welche für 23 Männer verschiedenen Alters und Berufs verhängnisvoll werden sollte. Für Dostojewskys Leben, seine weitere Charakter-Entwickelung, sowie für sein künstlerisches Lebenswerk sollte diese Katastrophe von den entscheidendsten Folgen sein.
In einem, wie O. Miller sagt, leider spurlos verschwundenen Artikel: „Meine erste Bekanntschaft mit Belinsky“, nennt der Dichter diese Epoche seines Lebens „eine schwere, schicksalsvolle Zeit.“ Es muss angenommen werden, dass er von Belinsky in die Lehre vom Sozialismus eingeführt worden sei, die er sich, wie er sich selbst ausdrückt, „leidenschaftlich zu eigen gemacht hat“, obwohl ihm Belinsky von vornherein das Axiom entgegenschleudert: „die Revolution hat vor allem das Christentum zu vernichten, denn sie ist vor allem auf den Atheismus gegründet“. Dostojewsky scheint sich der bestrickenden Persönlichkeit Belinskys doch so weit hingegeben zu haben, dass er den Bestrebungen jenes Kreises nahe trat; allein wir finden noch 22 Jahre später in einem Briefe an N. Strachow, sowie in einem Artikel seines „Dnewnik Pisatela“ (Tagebuch eines Schriftstellers) heftige Ausfälle gegen Belinsky, gleichsam unter dem unverwischten Eindruck der Entrüstung, welche jener Streit für und wider das Christentum im Dichter hervorgerufen hatte. „Dieser Mensch“ — sagt er da — „hat Christum vor mir beschimpft, dabei ist er doch niemals imstande gewesen, sich selbst oder irgend einen von allen Führern der ganzen Welt vergleichend an Christi Seite zu stellen; er vermochte nicht es zu sehen, wie viel kleinliche Eigensucht, Zorn, Ungeduld, Reizbarkeit, Kleinheit, vor allen aber Eigensucht in ihm selbst und in allen anderen vorhanden ist. Als er Christum beschimpfte, sagte er sich niemals: was werden wir denn an seine Stelle setzen? etwa uns, die wir so hässlich sind? — nein, er hat sich auch niemals darauf besonnen, dass er hässlich ist, er war im höchsten Grade mit sich zufrieden“.
Aus alledem können wir uns eine Vorstellung davon machen, wie Dostojewsky sich mit den Lehren der vierziger Jahre beschäftigte, und wie klar doch bei alledem in ihm die Grenze vorgezeichnet war, die er vermöge seiner innersten Wesenheit nicht zu überschreiten vermocht hätte, so dass er sich uns als das darstellt, was wir heute einen christlichen Sozialisten im reinsten Sinne nennen möchten.
Um diese Zeit, oder vielmehr einige Jahre früher, hatten sich aus dem Schosse der Universität heraus mehrere Studentenkreise gebildet, die ein ernsteres Streben vereinigte, als die Lust an Skandal, Mensuren etc. Sie bildeten Lesekreise, legten eine gesonderte Studenten-Bibliothek an, wobei wissenschaftliche Werke des In- und Auslandes, darunter nicht wenige eingeschmuggelte Bücher, erworben wurden. So machten sie sich mit den Werken L. Steins, Jaxthausens, sowie denen Fouriers, Louis Blancs, Proud’hons bekannt. Diese Lesekreise nun benutzt jener ehemalige Student, nunmehrige Angestellte im Ministerium des Äusseren Butaschewitsch-Petraschewsky dazu, um die sogenannte „Gesellschaft der Propaganda“ durch alle möglichen Elemente zu vergrössern. Es sollten die einzelnen Kreise wieder Kreise bilden, nach dem System der „Fünf“ eines, dem bei uns unter dem Namen „Schneeballen“ bekannten, ähnlichen Vorganges. Die Teilnehmer der einzelnen Kreise sollten einander nicht persönlich kennen, jedoch alle mit dem Leiter Petraschewsky in Fühlung sein. In den Notizen, welche Anna G. Dostojewskaja aus den letzten Lebensjahren ihres Gatten aufbewahrt hat, finden wir die Stelle: „die Sozialisten (die russischen nämlich) sind aus den Petraschewzen hervorgegangen; die Petraschewzen haben viele Samen ausgestreut“. „Ebenso glaubten sie“ — diktierte er weiter — „dass das Volk mit ihnen sei und“ — fügt er hinzu — „sie hatten eine Grundlage dafür, denn das Volk war leibeigen.“
Dieser letzte Satz scheint mir der Schlüssel dafür zu sein, warum sich Dostojewsky überhaupt an den Besprechungsabenden des Petraschewskyschen Kreises bei diesem und bei Durow beteiligte. Ihn interessierte von jeher das Volk, er nahm tiefen Anteil an seinem Schicksal und hoffte und wünschte nichts sehnlicher, als die Aufhebung der Leibeigenschaft. Alle seine Reden hatten vornehmlich dies zum Gegenstande, und so erzählt einer der Teilnehmer in einem dieses Thema behandelnden Roman von einem Genossen, dem er Dostojewskys Worte in den Mund legt. Er sagte still und langsam: „die Befreiung der Bauern wird unbedingt der erste Schritt in unsere grosse Zukunft sein“.
Verschiedene Zeugen dieser Zeit schildern Dostojewsky sehr lebendig als einen, „dessen ganzes Wesen sich zum Verschwörer geeignet habe; still, einsilbig, nicht mitteilsam, nur fähig, sich unter vier Augen auszusprechen“, sei er, wenn er ins Feuer geriet, von einer hinreissenden, alle besiegenden Beredsamkeit gewesen. So ward er denn bei all seiner christlichen Richtung, welche dem Wesen des Sozialismus, wie die anderen es verstanden, zuwiderlief, vermöge der Macht seiner Persönlichkeit doch die Hauptperson des Petraschewskyschen Kreises, sowie jenes andern, der bei Durow zusammen kam. Merkwürdigerweise liess man diese Studenten-Vereinigungen sehr lange gewähren, zum Teil darum, weil man lange kein geeignetes Individuum fand, welches genug Wissen besessen hätte, um an den Diskussionen der Mitglieder ebenbürtig teilnehmen zu können, und das über dem „Vorurteile“ erhaben wäre, welches den Namen eines Angebers brandmarkt. — Endlich fand man einen, diesen „erhabenen Standpunkt“ einnehmenden Menschen in einem Beamten des auswärtigen Amtes, Antonelli, welcher durch diesen Umstand leicht mit Petraschewsky bekannt werden konnte. Dostojewsky selbst stand mit diesem in keiner nahen persönlichen Verbindung, obwohl er seine Freitagsabende besuchte, wo von der Aufhebung der Leibeigenschaft und der Unvermeidlichkeit eines Aufruhrs zur Befreiung der Bauern gesprochen wurde. Dostojewsky sprach die Ansicht aus, dieser Schritt müsse von oben gemacht werden. „Wenn er aber nicht geschieht?“ warf man ein, — „ja dann meinetwegen mit Gewalt.“ Bei Durow hingegen wurde die Frage einer geheimen Druckerei aufgeworfen und von Dostojewsky befürwortet, allein von der Versammlung abgelehnt.
In der Nacht vom 22. auf den 23. April 1849 wurden die Hauptpersonen dieses Kreises, 34 an der Zahl, unter ihnen Th. M. Dostojewsky, sowie irrtümlicherweise auch sein Bruder Andreas von der Gendarmerie abgeholt und nach dem Hause der „dritten Abteilung“ der geheimen Polizei abgeführt. Wir haben, um, wenn es möglich wäre, authentische Daten über diesen Prozess, soweit er Dostojewsky angeht, zu erhalten, den Versuch gemacht, an Ort und Stelle wenigstens einen Teil der amtlichen Dokumente desselben kennen zu lernen. Man sagte uns, es würden keine allzugrossen Schwierigkeiten gemacht werden, da einerseits nahezu ein halbes Jahrhundert verstrichen sei und jetzt die Zustände andere und andere Personen am Ruder seien, zudem jener Briefwechsel Belinskys mit Gogol, welcher den Anklagepunkt für Dostojewsky abgegeben, längst publiziert und aller Welt bekannt sei. Ausserdem habe man die Archive des Ministeriums des Innern immer bereitwillig jenen geöffnet, welche in einem litterarischen Interesse irgend ein Dossier studieren wollten. So hat der Litteraturhistoriker Professor Storoschenko, Direktor der reichen Bibliothek des Museums Rumianzew in Moskau, eine Studie über den kleinrussischen Dichter Schewtschenko auch in jenen Archiven vervollständigt.
Man kam uns, soweit dies möglich war, von Seiten des Ministeriums des Innern und des Kriegsministeriums (da der Prozess dem Kriegsgericht übergeben worden war) bereitwilligst entgegen und stellte uns eine Reihe von Dokumenten zur Verfügung, welche die Verhaftung Dostojewskys, seine Verurteilung, amtliche Zeugnisse seines „Verhaltens“ im Gefängnis, seine Befreiung, sein Avancement zum Fähnrich, die Wiedererlangung des Adels und seine endliche vollständige Befreiung, mit der Erlaubnis nach Petersburg zurückzukehren, betreffen. Auch der Wortlaut seiner Verteidigungsschrift wurde uns ohne Umstände, nachdem er 50 Jahre im Aktenstaube vergraben gewesen und vorerst von den massgebenden Personen mit grossem Interesse gelesen worden war, zur Veröffentlichung überlassen. Wir bringen einige der wichtigsten Dokumente, je an ihrer Stelle, hier im Anschluss.
Kopie.
III. Abteilung
von Sr. Majestät des
Kaisers Privatkanzlei. —
Expedition St. Petersburg,
22. April 1849.
No. 675.
Geheim.
Dem Herrn Major der Petersburger
Gendarmerie-Division
Tschudin.
Auf allerhöchsten Befehl erteile ich Euer Hochedelgeboren (Wysokoblagorodie) die Weisung, morgen um 4 Uhr nach Mitternacht, den verabschiedeten Ingenieur-Lieutenant Theodor Michailowitsch Dostojewsky, welcher an der Ecke der kleinen Morskaia und des Wosnesensky-Prospekt, im Hause Schill auf der dritten Etage in der Wohnung Ginner wohnt, zu arretieren, alle seine Papiere und Bücher zu versiegeln und diese zugleich mit ihm nach der dritten Abteilung von Sr. Majestät Privatkanzlei zu bringen.
Bei dieser Gelegenheit haben Sie streng darüber zu wachen, dass von den Papieren Dostojewskys nichts versteckt werde.
Es kann sein, dass Sie bei Dostojewsky eine grosse Menge von Papieren und Büchern vorfinden, so dass es nicht möglich sein wird, sie sofort in die dritte Abteilung zu befördern. In diesem Falle sind Sie gehalten, eines wie das andere in eine oder zwei Stuben, je nach dem es nötig ist, niederzulegen, diese Stuben zu versiegeln und Dostojewsky selbst unverweilt in der dritten Abteilung abzuliefern.
Im Falle Dostojewsky bei dem Versiegeln der Papiere und Bücher aussagen sollte, dass einige darunter irgend einer anderen Person gehören, so haben Sie dieser Aussage keine Beachtung zu schenken, sondern auch diese zu versiegeln.
In Ausführung dieses Befehls haben Sie die grösste Achtsamkeit und Vorsicht (Ostoroshnost) anzuwenden.
Der Herr Stabs-Kommandant des Gendarmerie-Corps, General-Lieutenant Dubelt, verfügt, dass sich in Ihrer Begleitung befinden sollen: ein Offizier der Petersburger Polizei und die unumgänglich nötige Anzahl von Gendarmen.
Der General-Adjutant
Graf Orloff.
Der Bericht an Graf Orloff über die aufgegriffenen Papiere lautet:
Geheim 148/6.
Hochgeehrter Herr!
Iwan Alexandrowitsch!
Nach Durchsicht der Dostojewsky betreffenden Papiere hat sich nichts gefunden, das direkt Bezug auf die Sache hätte. Es wurde nur gefunden: ein Brief von Belinsky, enthaltend eine Einladung zu einer Gesellschaft bei einer Person, mit der er noch nicht bekannt war, ein Brief aus Moskau von Pleschtschejew, in welchem er von seinem Eindruck bei der Ankunft der kaiserlichen Familie in Moskau spricht und beauftragt, jenen Personen seinen Gruss zu bringen, welche der bekannten Gesellschaft angehören. Zwei Bücher unter dem Titel: Le berger de Cravan und La consécration du Dimanche.
16. Mai 1849.
Fürst Alex. Galitzin.
Nabokow, Präsident der Untersuchungs-Kommission.
„In Ergänzung meines Berichtes habe ich die Ehre, Euer Excellenz den Abschied (Ukas ob otstawkie), welcher sich unter den bei Dostojewsky gefundenen Papieren befand, zu übermitteln.
17. Mai 1849.
Nabokow.“
Hier ist zu ergänzen, dass das unvollendete Manuskript, d. h. der III. Teil desselben, eben Krajewsky, dem Redacteur der „Vaterländischen Annalen“ übergeben worden war, wo es im Maiheft 1849 erschien; jedoch, laut Verfügung (vom 28. April) der III. Abteilung, „ohne Unterschrift des Verfassers“. Diese Erzählung, Njetotschka Njezwanowa, ist nie vollendet worden.
Diese Berichte über die vorgefundenen Papiere sind insofern richtig, als für die betreffenden Behörden nur solche Papiere ins Auge gefasst worden waren, welche zugleich persönliche und politische Beziehungen anzeigten. Nach den Aussagen der Witwe des Dichters, Anna Grigorjewna Dostojewskaja, mussten, da er nicht im geringsten auf den Besuch der Polizei vorbereitet war, also nichts wegräumen konnte, verschiedene belletristische Schriften, namentlich das Fragment eines Dramas, sich zu jener Zeit bei ihm gefunden haben. Der Brief Pleschtschejews und der Zettel Belinskys waren solche nennenswerte Papiere, weil sie diese Namen trugen. Anderes mag wohl durchgeblättert worden und als wertlos in Verstoss geraten sein. Wir erhielten diese zwei Schriftstücke zur Ansicht mit der Bitte, übrigens recht harmlose, Stellen aus dem Briefe Pleschtschejews nicht zu kopieren, was wir auch in Anbetracht der Bereitwilligkeit, mit welcher uns die Dossiers gezeigt wurden, zusagten. Dieser Brief ist im übrigen für uns nicht von genügendem Interesse, um ihn hier zu bringen, es wäre denn die Stelle, wo an mehrere namentlich aufgezählte Freunde, die zu Durow kommen, „salut et fraternité“ entboten wird.
Dostojewsky selbst erzählt den Vorgang dieser Verhaftung mit einem gewissen Humor in einem Blatte, das er 1860 der Tochter seines Freundes, des Schriftstellers A. Miliukow, widmet:
„Am 22., oder besser gesagt, am 23. April kam ich gegen 4 Uhr morgens von Grigorjew nach Hause, legte mich zu Bette und schlief sofort ein. — Nicht später als nach einer Stunde etwa merkte ich durch den Schlaf hindurch, dass irgendwelche ungewöhnliche und verdächtige Leute in meine Stube getreten waren.
Es klimperte ein Säbel, der unversehens an irgend etwas gestreift hatte. Was geht da Seltsames vor? Ich öffne mit Mühe die Augen und höre eine weiche, sympathische Stimme: „Stehen Sie auf!“ — Ich schaue: da steht der Quartals-Aufseher oder irgend ein besonders Kommandierter mit hübschem Backenbart. Allein er hatte nicht gesprochen. Es hatte ein blau gekleideter, mit Oberstlieutenants-Epauletten geschmückter Herr gesprochen.
„Was ist geschehen?“ frage ich, mich aufrichtend. — „Auf Befehl“ ... — Ich schaue: richtig „auf Befehl“. In der Thüre steht ein Soldat, ebenfalls blau. Sein Säbel war es gewesen, der geklimpert hatte ... Aha! also das ist’s ... dachte ich bei mir.
„Erlauben Sie mir doch ...“ begann ich — „Macht nichts, macht nichts! kleiden Sie sich an. Wir werden warten,“ sagt der Oberstlieutenant mit noch sympathischerer Stimme. — Während ich mich ankleide, verlangen sie die Bücher und beginnen sich hinein zu wühlen — sie fanden nicht viel, wühlten aber alles durch. Die Bücher und Schriften banden sie ordentlich mit einem Stricklein zusammen. Der Kommandierte zeigte bei dieser Gelegenheit sehr viel Umsicht: er kroch in meinen Ofen und stöberte mit meinem Tschibuk in der kalten Asche herum. Der Gendarmerie-Unteroffizier stieg auf sein Geheiss auf einen Stuhl, kroch auf den Ofen, glitt aber vom Gesimse ab, fiel auf den Stuhl und mit diesem auf die Erde. Da überzeugten sich die umsichtigen Herren, dass sich nichts auf dem Ofen befand. Auf dem Tische lag ein altes verbogenes Fünf-Groschenstück. Der Pristaw betrachtete es aufmerksam und winkte endlich dem Oberstlieutenant zu: „Ist’s am Ende ein falsches?“ fragte ich. „Hm, das muss man doch auch untersuchen,“ murmelte der Pristaw und endigte damit, dass er auch dieses Stück dem Beweismateriale hinzufügte. Wir traten hinaus. Uns begleitete die erschreckte Hausfrau und ihr Diener Iwan, der zwar auch erschrocken war, jedoch mit einer Art stumpfer, dem Ereignis angemessener Feierlichkeit dreinschaute; übrigens einer nichts weniger als feiertägigen Feierlichkeit. In der Einfahrt stand eine Kutsche, zuerst stieg der Soldat ein, dann ich, der Pristaw und der Oberstlieutenant. Wir fuhren zur Fontanka nach der Kettenbrücke beim Sommergarten. Dort gab es viele Leute und ein bewegtes Kommen und Gehen. Es begegneten mir viele Bekannte, alle waren verschlafen und schweigsam. Irgend ein Herr, ein Staatsbeamter, einer von hohem Range, besorgte den Empfang ...... ununterbrochen kamen blaue Herren mit neuen Opfern herein ...... Wir umringten nach und nach den ministeriellen Herrn, der eine Liste in der Hand hielt. Auf dieser Liste stand mit Bleistift geschrieben: „Agent der aufgedeckten Sache: Antonelli“. — So, also Antonelli ist es — dachten wir. — Man postierte uns in verschiedene Winkel, in der Erwartung der endgiltigen Anordnung, wohin man einen jeden unterbringen sollte. Im sogenannten weissen Saale waren unser siebzehn, da kam Leonty Wassiljewitsch (Dubelt), der Untersuchungs-Richter, herein — aber hier unterbreche ich meine Erzählung. Es wäre viel zu erzählen. Aber ich versichere Sie, dass Leonty Wassiljewitsch ein höchst angenehmer Mensch war.“
Andere Augenzeugen, so A. P. Miliukow und namentlich des Dichters Bruder Andreas erzählen sehr eingehend den weiteren Verlauf der Haft, des Verhörs, der ganzen Untersuchung und Verurteilung der Angeklagten. Wir nehmen daraus folgende charakteristische Daten: Von den oben erwähnten 34 Verhafteten wurden jene ausgewählt, welche auch zu Petraschewsky kamen — es waren 23, darunter sechs Offiziere, zwei Gutsbesitzer — die übrigen waren Studenten, Universitäts-Kandidaten, Schriftsteller und Beamte im asiatischen Departement. Andreas Dostojewsky war, wie schon oben gesagt, nur irrtümlicherweise verhaftet worden und das anstatt des ältesten Bruders Michael M. Dostojewsky, welcher zwar durchaus nicht zum Kreise Petraschewskys gehörte, ja diesem sehr antipathisch gegenüberstand, jedoch durch Durow einige Bücher aus dieser Gesellschaft entliehen hatte, was offenbar unter falschem Vornamen angegeben worden war. Andreas war also auch in der Nacht in den weissen Saal gebracht worden, wo plötzlich sein Bruder Theodor auf ihn zuläuft und ihn erstaunt fragt: „Was machst denn du da, Bruder?“ Allein er konnte nicht antworten, da ein Gendarm sie trennte. Andreas bleibt nun, ohne zu ahnen warum, in Untersuchung, wird in eine feuchte Kasematte gesperrt und fängt allmählich zu begreifen an, um was es sich wohl handeln mag.
Das Verhör, bei welchem er auf die Frage des Untersuchungsrichters, in was für Beziehungen er zu Butaschewitsch-Petraschewsky stehe, ganz naiv die Gegenfrage stellt: „Petraschewsky kenne ich nicht, und wer ist denn der zweite?“ bringt seine Unschuld an den Tag, und man hält ihn nur noch zurück, damit er in der Stadt nicht mit Leuten zusammen komme, „die er nicht zu treffen habe“. Es stellt sich heraus, dass man auf den Richtigen gekommen war, auf den Bruder Michael Dostojewsky, den man am 5. Mai arretiert, worauf man Andreas am 6. frei gibt. Eine Stelle aus einem Briefe Theodor Michailowitschs an den Bruder Andreas drückt noch, nach einem Zeitraum von 13 Jahren, seine Freude darüber aus, dass dieser das Missverständnis nicht früher aufgeklärt habe. „Ich erinnere mich daran,“ sagt er, „du mein Teurer, erinnere mich, wie wir einander, es war wohl das letzte Mal, im weissen Saale begegneten. Es kostete dich damals nur ein Wort, das du an betreffender Stelle hättest sagen können, und du wärst sofort, als irrtümlich statt des älteren Bruders festgenommen, frei gelassen worden. Aber du folgtest meinen Vorstellungen und Bitten, du gingst grossmütig in die Thatsache ein, dass der Bruder in sehr engen Verhältnissen lebe, dass seine Frau eben erst in den Wochen gewesen sei und sich noch gar nicht erholt habe — du begriffst das alles und bliebst im Gefängnis, um den Bruder Zeit zu lassen, seine Frau vorzubereiten und sie nach Möglichkeit für eine vielleicht lange Zeit seiner Abwesenheit sicherzustellen.[4]
„Wenn du einmal so grossmütig und ehrenhaft gehandelt hast“, fährt Dostojewsky fort, „so konnte ich dich ja auch nicht vergessen und musste ich ja deiner, als eines ehrenhaften und guten Menschen, gedenken.“
Zum Verlauf der Untersuchung zurückkehrend, erzählt Orest Miller, dass der General Rostowzew Dostojewsky nahe gelegt habe, „alles zu erzählen“. Dieser beantwortete aber alle Fragen der Kommission ablehnend. Da wendete sich Rostowzew mit den Worten an ihn: „Ich kann nicht glauben, dass ein Mensch, welcher „Arme Leute“ geschrieben hat, mit diesen lasterhaften Menschen gemeinsame Sache machen könne. Das ist unmöglich. Sie sind nicht sehr in die Sache verwickelt und ich bin im Namen des Kaisers bevollmächtigt, Sie zu begnadigen, wenn Sie die ganze Sache erzählen.“ Ich schwieg, erzählte Theodor Michailowitsch. Darauf bemerkte General-Lieutenant Dubelt, einer der Untersuchungsrichter, gegen Rostowzew gewendet lächelnd: „Ich habe es Ihnen ja gesagt“, worauf dieser schrie: „Ich kann Dostojewsky nicht mehr sehen“, in die nächste Stube lief und von da heraus rief: „Ist Dostojewsky schon hinausgegangen? Sagt mir, wenn er hinausgeht, ich kann ihn nicht sehen“. Dies alles schien Dostojewsky sehr übertrieben zu sein.
Aus den Protokollen in den Archiven der dritten Abteilung entnehmen wir, dass am 23. April eine Untersuchungs-Kommission unter Vorsitz des General-Adjutanten Nabokow eingesetzt wurde, welche der Prüfung dieser Sache vom 26. April bis zum 17. September 1849 neunzig Sitzungen widmete. Die Kapitalanklage gegen Petraschewsky lautete auf: „Verbrecherische Versuche, die bestehende Staats-Verfassung in Russland zu stürzen, Heranziehung von Leuten verschiedenen Berufs und jugendlichen Alters zu den bei ihm abgehaltenen Zusammenkünften, Verbreitung schädlicher Ideen über die Religion, Erweckung von Hass gegen die Obrigkeit, und endlich Versuch, eine geheime Gesellschaft zur Erreichung dieser verbrecherischen Ziele zu gründen“.
Die Anklage gegen Dostojewsky lautete: „dass er ebenfalls (gleich Durow) an diesen verbrecherischen Plänen teilgenommen, dass er einen Brief Belinskys an Gogol verbreitet habe, der voll frecher Ausdrücke gegen die rechtgläubige Kirche und die Obrigkeit gewesen sei, und dass er den Versuch gemacht habe, zur Verbreitung von Schriften gegen die Obrigkeit im Verein mit anderen eine geheime Lithographie herzustellen.“
Dostojewskys nervöser Zustand, der schon vor der Arretierung ihm sehr beschwerlich gewesen war, wurde nach seiner acht Monate währenden Untersuchungshaft bedeutend schlimmer durch die wiederholten Verhöre und das eindringliche Zureden, er möge in seinen mündlichen und schriftlichen Antworten die Genossen angeben, so dass er endlich, dessen müde, sich selbst einen bedeutend grösseren Anteil bei der Sache vindicierte, als er in der That daran genommen hatte, und so hoffte, dieselben Qualen des Verhörs von den Mitangeklagten abzulenken.
Seine eingehendste schriftliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen lassen wir hier in getreuer Übersetzung des Original-Manuskripts folgen. Oberflächlichen Kennern Dostojewskys, welche jedoch über die Thatsachen dieses Prozesses vortrefflich unterrichtet sind, ist der Inhalt dieser, im August 1898 in der „N. Fr. Presse“ durch uns veröffentlichten Verteidigungsschrift lediglich ein „advokatorisches Meisterstück“. Wer des Dichters Grundnatur und seinen inneren Entwickelungsgang näher kennt, wird dies nicht schlankweg annehmen. So sehr auch Dostojewsky „das Zeug zum Verschwörer“ haben mochte, wie man von ihm sagte, und so oft er selbst von einer „Umkehr“ spricht, lag doch der slavisch-mystische Wesenskeim zu tief in seiner Natur, um nicht bei der ersten Erschütterung seiner revolutionären Anwandelungen entschieden und endgiltig in seine Rechte zu treten. Ja, der Atheismus, welchem er sicher um jene Zeit gehuldigt haben muss, und der sich dreissig Jahre später im herrlichen Kapitel „Der Grossinquisitor“ wiederspiegelt, dieser Atheismus ist nichts als die Kehrseite eines heissen Gottesdurstes und hat nichts gemein mit dem kühlen Indifferentismus in Glaubenssachen, wie er das endgiltige Merkmal des echten Revolutionärs ist. Wenn wir hier diesen Standpunkt festhalten, wenn wir darauf hinweisen, dass in dieser Verteidigungsschrift bei aller Gewandtheit und berechnenden Wahrheitskühnheit auch viel wirkliche Wahrheit enthalten ist, namentlich an jener Stelle, wo Dostojewsky die bekannte Aksakowsche Geschichts-Anschauung entwickelt, wenn wir sogar gegen seinen eigenen Ausspruch über sich protestieren, so geschieht dies nicht, um ihn „rein zu waschen“ oder „päpstlicher als der Papst“ zu sein, sondern um den Wendungen und Windungen dieser höchst komplizierten Natur nachzugehen, die sich oft „zur Wahrheit durchlog“, mit der Wahrheit spielte und der es doch heiliger Ernst und Wahrheit war, womit der ewig bewegte Geist nicht anders als spielen konnte. Die Verteidigungsrede lautet wie folgt:
Th. M. Dostojewskys Rechtfertigungsschrift im Prozesse Petraschewsky, verlesen in der 42. Sitzung der Untersuchungs-Kommission unter dem Vorsitze des General-Adjutanten Nabokow am 20. Juni 1849.
„Man verlangt von mir, dass ich alles, was ich über Petraschewsky und über jene Leute, welche seine Freitags-Abende besuchten, weiss, aussagen soll, das heisst, man verlangt meine Aussage über Fakten und meine persönliche Meinung über diese Fakten.
Wenn ich die heutigen Fragen mit dem ersten Verhöre zusammenhalte, so schliesse ich, dass man von mir eine genaue Antwort auf folgende Punkte fordert:
1. Darauf, was für einen Charakter Petraschewsky als Mensch im allgemeinen und als Politiker im besonderen hatte.
2. Was an jenen Abenden, welchen ich beiwohnte, bei Petraschewsky vorging, sowie meine Meinung über diese Abende.
3. Ob nicht irgend ein geheimes, verborgenes Ziel der Gesellschaft Petraschewsky zu Grunde lag? Ob Petraschewsky selbst ein für die Gesellschaft schädlicher Mensch und in welchem Grade er es war.
Ich bin niemals in sehr nahen Beziehungen zu Petraschewsky gestanden, obwohl ich an Freitags-Abenden zu ihm kam und auch er mich besuchte.
Dies ist eine jener Bekanntschaften, an denen mir nicht allzu viel gelegen war, da ich weder im Charakter noch in vielen Anschauungen mit Petraschewsky übereinstimmte. Darum erhielt ich diese Beziehung nur insoweit, als es die Höflichkeit verlangte, das heisst, ich besuchte ihn etwa jeden Monat einmal, manchmal auch seltener. Ihn aber vollständig aufzugeben, hatte ich keinerlei Ursache; überdies war es mir manchmal interessant, seine Freitage zu besuchen.
Mich haben immer viele Excentrizitäten und Absonderlichkeiten im Charakter Petraschewskys frappiert. Unsere Bekanntschaft begann sogar damit, dass er bei der ersten Zusammenkunft durch seine Absonderlichkeiten meine Neugierde erweckte. Ich fuhr jedoch nicht oft zu ihm; es geschah, dass ich manchmal ein halbes Jahr nicht bei ihm war. Im vorigen Winter war ich vom September angefangen nicht mehr als achtmal bei ihm. Wir waren niemals intim mit einander, und ich glaube, dass wir während der ganzen Zeit unserer Bekanntschaft niemals mehr als eine halbe Stunde unter vier Augen mit einander gesprochen haben. Ich habe sogar entschieden bemerkt, dass er, indem er zu mir kam, gleichsam eine Pflicht der Höflichkeit erfüllte, dass aber zum Beispiel ein langes Gespräch mit mir ihm lästig war. Bei mir war dasselbe der Fall, da wir, wie ich wiederhole, weder in den Ideen noch in den Charakteren Vereinigungspunkte hatten. Wir fürchteten beide, länger mit einander zu sprechen, da wir vom zehnten Worte an mit einander gestritten hätten, dies aber uns beiden zuwider war. Es scheint mir, dass unsere gegenseitigen Eindrücke die gleichen waren; wenigstens weiss ich, dass ich zu seinen Freitags-Abenden sehr oft nicht sowohl um seiner selbst willen und wegen der „Freitage“ fuhr, als um dort manche Leute zu treffen, die ich, obwohl ich mit ihnen bekannt war, ausserordentlich selten sah und welche mir gefielen. Übrigens habe ich Petraschewsky immer als einen ehrenhaften und edlen Menschen geachtet.
Über seine Excentrizitäten und Absonderlichkeiten sprechen viele, fast alle, welche ihn kennen oder von ihm gehört haben, und beurteilen ihn sogar danach. Ich habe mehreremale die Meinung äussern hören, dass Petraschewsky mehr Geist als Vernunft habe; thatsächlich wäre es sehr schwer, sich viele seiner Sonderbarkeiten zu erklären. Es geschah nicht selten, dass man ihn bei einer Begegnung auf der Strasse fragte, wohin er gehe und was er vorhabe, worauf er etwas so Absonderliches antwortete, einen so sonderbaren Plan mitteilte, den er soeben auszuführen ginge, dass man nicht wusste, was man vom Plan und von Petraschewsky selbst denken sollte. Um einer Sache willen, welche keinen Deut wert ist, machte er so viel Wesens, als ob es sich um sein ganzes Vermögen handle. Ein andermal eilt er auf eine halbe Stunde irgend wohin, um ein ganz kleines Geschäftchen abzumachen, beendet aber dieses „kleine Geschäftchen“ ungefähr in zwei Jahren. Er ist ein Mensch, der sich fortwährend etwas zu schaffen macht, immer in Bewegung ist, den immer irgend etwas treibt. Er liest viel, schätzt das System Fouriers und hat es sich bis ins Detail angeeignet. Ausserdem beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem Studium der Gesetzgebung. Dies ist alles, was ich von ihm als Privatperson nach Daten weiss, welche zu unvollständig sind, um einen Charakter solcher Art vollkommen zu beurteilen. Denn das wiederhole ich noch einmal, ich habe niemals in all zu nahen Beziehungen zu ihm gestanden.
Es ist schwer zu sagen, dass Petraschewsky (als politische Person betrachtet) irgend ein bestimmtes System in seinen Meinungen, irgend eine bestimmte Anschauung in politischen Dingen gehabt hätte. Ich habe bei ihm nur Ein folgerichtiges System bemerkt, und dieses war nicht das seine, sondern das Fouriers. Es scheint mir, dass besonders Fourier es ist, welcher ihn daran hindert, die Dinge selbständig anzusehen. Ich kann übrigens unbedingt sagen, dass Petraschewsky weit entfernt von der Idee ist, dass eine unmittelbare Anwendung des Fourierschen Systems auf unsere gesellschaftlichen Zustände möglich sei. Davon war ich immer überzeugt.
Die Gesellschaft, welche sich an Freitag-Abenden bei ihm versammelte, bestand fast ausschliesslich aus seinen nahen Freunden oder alten Bekannten; so denke ich wenigstens. Übrigens tauchten auch manchmal neue Personen auf. Dies war jedoch, so viel ich bemerken konnte, ziemlich selten der Fall. Von diesen Leuten kenne ich nur einen sehr kleinen Teil genauer. Andere kenne ich nur darum, weil ich drei- bis viermal im Jahre Gelegenheit hatte, mit ihnen zu sprechen. Viele der Gäste Petraschewskys kenne ich fast gar nicht, obwohl ich schon seit einem oder zwei Jahren an Freitagen mit ihnen zusammenkomme. Allein, obwohl ich nicht alle Personen gut kenne, habe ich doch manche ihrer Meinungen gehört. Alle diese Meinungen zusammen bilden geradezu eine Dissonanz; die eine widerspricht der anderen. Ich habe keinerlei Einheit in der Gesellschaft Petraschewskys gefunden, keinerlei Richtung, keinerlei gemeinschaftliches Ziel. Man kann unbedingt sagen, dass man dort nicht drei Menschen fände, welche in irgend einem Punkte über ein beliebig aufgegebenes Thema übereinstimmten. Daher gab es viele Debatten, daher der ewige Streit, die ewigen Meinungsverschiedenheiten! An einigen dieser Streitigkeiten habe auch ich teilgenommen.
Allein ehe ich sage, aus welcher Ursache ich an diesen Streitigkeiten teilgenommen habe und über welches Thema ich hauptsächlich sprach, muss ich einige Worte über das sagen, wessen man mich anklagt. Eigentlich weiss ich bis heute noch nicht, wessen man mich beschuldigt. Man hat mir nur mitgeteilt, dass ich an den gemeinschaftlichen Besprechungen bei Petraschewsky teilgenommen, dass ich wie ein Freidenker gesprochen und zuletzt einen Artikel vorgelesen habe: „Briefwechsel Belinskys mit Gogol“. Ich sage aus reinem Herzen, dass es für mich bis heute das Schwerste auf der Welt war, das Wort Freidenker, Liberaler zu definieren. Was versteht man unter diesem Worte: Einen Menschen, welcher ungesetzlich spricht? Ich habe aber Menschen gesehen, für die es gesetzwidrig sprechen heisst, wenn sie bekennen, dass sie der Kopf schmerze, und ich weiss, dass es auch solche giebt, welche im stande sind, auf jedem Kreuzweg alles zu sprechen, was nur ihre Zunge herunterzudreschen vermag. Wer hat meine Seele gesehen? Wer hat den Grad von Treubruch, von schlechtem Einfluss und Aufhetzung bestimmt, dessen man mich beschuldigt? Nach welchem Massstab ist diese Bestimmung gemacht worden? Es kann sein, dass man nach einigen Worten urteilt, welche ich bei Petraschewsky gesagt habe. Ich habe dreimal gesprochen: zweimal habe ich über Litteratur und einmal über einen durchaus nicht politischen Gegenstand gesprochen: über Persönlichkeit und menschlichen Egoismus. Ich erinnere mich nicht, dass irgend etwas Politisches oder Freidenkerisches in meinen Worten gewesen sei. Ich erinnere mich nicht, dass ich mich irgend einmal bei Petraschewsky ganz ausgesprochen und mich gezeigt hätte, wie ich in der That bin. Allein ich kenne mich, und wenn man meine Anklage auf einige Worte gründet, die man im Fluge erhascht und auf einen Fetzen Papier geschrieben hat, so fürchte ich auch eine solche Anschuldigung nicht, obwohl sie von allen Beschuldigungen die gefährlichste ist; denn es giebt nichts Verderblicheres, Verwirrenderes und Ungerechteres als einige in der Geschwindigkeit aufgeschriebene Worte, welche von weiss Gott wo herausgerissen sind, sich auf weiss Gott was beziehen, im Fluge gehört und im Fluge verstanden worden, am alleröftesten jedoch gar nicht verstanden worden sind. Aber ich wiederhole, ich kenne mich und fürchte sogar eine solche Anschuldigung nicht.
Ja, wenn das Bessere wünschen Liberalismus, Freidenkerei ist, so bin ich vielleicht in diesem Sinne ein Freidenker. Ich bin ein Freidenker in dem Sinne, in welchem auch jeder Mensch ein Freidenker genannt werden kann, der in der Tiefe des Herzens sein Recht empfindet, ein Staatsbürger zu sein, das Recht empfindet, seines Vaterlandes Wohl zu wünschen, da er in seinem Herzen sowohl die Liebe zum Vaterlande als auch das Bewusstsein trägt, dass er es niemals und durch nichts schädigen werde.
Aber dieser Wunsch nach dem Besseren, bezog er sich auf das Mögliche oder das Unmögliche? Mag man mich auch beschuldigen, die Veränderung, den Umsturz auf gewaltsamem, revolutionärem Wege, durch Aufreizung zu Erbitterung und Hass gewünscht zu haben! Ich fürchte nicht, dessen überführt zu werden, denn keine Angeberei der Welt wird mir etwas geben oder etwas nehmen: keine Denunziation wird mich zwingen, ein anderer zu sein, als ich thatsächlich bin. Besteht meine Freidenkerei darin, dass ich laut von Dingen gesprochen habe, über welche zu schweigen andere als ihre Pflicht erachten, nicht etwa, weil sie sich fürchten, etwas gegen die Obrigkeit zu sagen (das kann man ja auch nicht im Gedanken!), sondern weil nach ihrer Meinung der Gegenstand ein solcher ist, von dem es einmal angenommen ist, dass man ihn nicht laut bespricht. Ist es das? Mich aber hat sie sogar immer verletzt, diese Furcht vor dem Worte, die eher imstande ist, die Obrigkeit zu beleidigen, als ihr angenehm zu sein. Das heisst ja annehmen, dass die Gesetze der Persönlichkeit nicht genügenden Schutz gewähren, und dass man um eines leeren Wortes, um einer unvorsichtigen Phrase willen verloren sein konnte.
Aber warum haben wir denn selbst alles so gestimmt, dass man ein lautes, offenes Wort, das halbwegs einer Meinung ähnlich sieht und geradaus, ohne Hinterhalt, ausgesprochen wurde, als eine Excentricität betrachtet! Meine Meinung ist, dass es für uns selbst bedeutend besser wäre, wenn wir alle der Obrigkeit gegenüber aufrichtiger wären. Es hat mir immer Kummer gemacht, dass wir alle gleichsam instinktiv uns vor irgend etwas fürchten, dass, wenn wir zum Beispiel als Menge auf öffentlichen Plätzen zusammenkommen, einer den anderen misstrauisch, finster anschaut, ihn von der Seite misst und wir immer irgend jemanden verdächtigen. Fängt zum Beispiel irgend wer von Politik zu reden an, so wird er unfehlbar flüsternd und mit geheimnisvoller Miene sprechen, läge auch die Republik seinen Gedanken so fern wie Frankreich. Man wird sagen: „Es ist auch besser, dass man bei uns nicht auf dem Markte schreit.“ Ohne Zweifel wird niemand ein Wort dagegen einzuwenden haben, allein ein übertriebenes Schweigen und eine übermässige Angst werfen auf unser Alltagsleben ein düsteres Kolorit, welches alles in einem freudlosen, unfreundlichen Lichte erscheinen lässt, und was das Beleidigendste ist, dieses Kolorit ist ein falsches, diese ganze Angst ist gegenstandslos, unnütz (ich glaube daran), alle diese Befürchtungen sind weiter nichts als unsere eigene Erdichtung, und wir beunruhigen nur selbst unnützerweise die Obrigkeit durch unsere Geheimthuerei und unser Misstrauen. Denn aus diesem gespannten Zustande entsteht oft viel Lärm um nichts. Da erhält das gewöhnlichste laut ausgesprochene Wort bedeutend mehr Gewicht, und das Faktum selbst nimmt durch die Excentricität, in der es da erscheint, manchmal kolossale Dimensionen an und wird unrichtigerweise anderen (ungewöhnlichen und nicht wirklichen) Ursachen zugeschrieben. Ich bin immer der Ansicht gewesen, dass eine bewusste Überzeugung besser, fester sei als eine unbewusste, die nicht widerstandsfähig, schwankend ist und von jedem Winde umgeworfen wird, der sich erhebt. Das Bewusstsein aber reift nicht, lebt sich nicht aus, wenn du schweigst. Wir gehen der Gemeinschaft aus dem Wege, wir zerbröckeln uns in kleine Zirkel oder vertrocknen in Vereinsamung. Wer trägt aber an diesem Zustande die Schuld? Wir, wir selbst und kein anderer — ich habe immer so gedacht.
Obwohl ich nun unsere gesellschaftlichen Gespräche als Beispiel angeführt habe, so bin ich doch selbst weit entfernt davon, ein Schreier zu sein; dies wird jeder von mir sagen, der mich kennt. Ich liebe es nicht, viel und laut zu sprechen, sei es auch mit Freunden, deren ich sehr wenige habe; umsoweniger rede ich in der Gesellschaft, wo ich auch den Ruf eines einsilbigen, schweigsamen, ungeselligen Menschen habe. Ich habe sehr wenig Bekanntschaften; die Hälfte meiner Zeit nimmt die Arbeit ein, welche mich ernährt, die zweite Hälfte raubt mir die Krankheit, die in hypochondrischen Anfällen besteht, an welchen ich schon nahezu drei Jahre leide. Es bleibt kaum ein wenig Zeit, um zu lesen und zu erfahren, was in der Welt vorgeht. Für Freunde und Bekannte bleibt daher äusserst wenig Zeit übrig. Wenn ich daher jetzt gegen das System des allgemeinen, gleichsam systematischen Schweigens und Heimlichthuns schreibe, so geschieht es darum, weil ich den Wunsch hatte, meine Überzeugung auszusprechen, aber durchaus nicht, um mich zu verteidigen. Allein wessen klagt man mich denn an? Man klagt mich an, dass ich über Politik, über den Westen, über die Zensur usw. gesprochen habe. Aber wer spricht denn nicht in unserer Zeit über diese Fragen, wer denkt nicht an sie? Wozu habe ich denn gelernt, warum ist durch das Studium Wissbegierde in mir erweckt worden, wenn ich nicht das Recht haben soll, meine persönliche Ansicht auszusprechen, oder mich im Widerspruch zu einer anderen Ansicht zu befinden, welche von vornherein eine Autorität ist? Im Westen gehen schreckliche Dinge vor, spielt sich ein ungeheures Drama ab; es kracht und zerbröckelt sich die Jahrhunderte alte Ordnung der Dinge. Die allerwichtigsten Grundlagen der Gesellschaft drohen jeden Augenblick zusammenzubrechen und die ganze Nation bei ihrem Einsturz mit sich zu reissen. 36 Millionen Menschen stellen jeden Tag buchstäblich ihre ganze Zukunft, ihren Besitz, ihre und ihrer Kinder Existenz auf das Spiel! Und ist dieses Bild nicht ein solches, um Aufmerksamkeit, Interesse, Wissbegierde zu erwecken, die Seele zu erschüttern? Dies ist dasselbe Land, welches uns Wissenschaft, Bildung, europäische Zivilisation gegeben hat. Ein solcher Anblick ist eine Lehre! Das ist schliesslich Geschichte; die Geschichte aber ist die Lehre von der Zukunft. Kann man uns nach alledem beschuldigen, uns, denen man einen gewissen Grad von Bildung gegeben, in denen man den Durst nach Kenntnissen und Kultur geweckt hat — kann man uns denn dafür anklagen, dass wir so viel Interesse daran hatten, hie und da über den Westen, über die politischen Ereignisse zu sprechen, die Bücher vom Tage zu lesen, der Bewegung des Westens zuzusehen, ja sie nach Möglichkeit zu studieren? Kann man mich denn deswegen anklagen, dass ich mit einem gewissen Ernst diese Krisis betrachte, welche das unglückliche Frankreich in Trauer stürzt und zerreisst, dass ich vielleicht diese historische Krisis für unumgänglich halte, als einen Übergangszustand (wer kann es jetzt beurteilen?) im Leben dieses Volkes betrachte, welcher endlich eine bessere Zeit einleitet? Weiter als diese Meinung, weiter als solche Ideen hat sich meine Freidenkerei über den Westen und die Revolution niemals erstreckt.
Wenn ich nun über den französischen Umsturz gesprochen habe, wenn ich mir erlaubt habe, über die gegenwärtigen Ereignisse zu urteilen, folgt daraus, dass ich ein Freidenker bin, dass ich republikanische Ideen hege, dass ich ein Gegner der Alleinherrschaft bin, dass ich diese untergrabe? — Unmöglich! Für mich hat es niemals einen grösseren Unsinn gegeben, als die Idee einer republikanischen Staatsform in Russland. Allen, welche mich kennen, ist meine Meinung darüber bekannt; ja, endlich wird auch eine solche Anschuldigung allen meinen Überzeugungen, meiner ganzen Bildung entgegen sein. Es kann sein, dass ich mir noch die Revolution des Westens und die historische Unumgänglichkeit der Krisis, welche sich dort vollzogen hat, zurechtlege: Dort hat sich einige Jahrhunderte, mehr als ein Jahrtausend lang, ein hartnäckiger Kampf der Gesellschaft gegen eine Autorität hingezogen, welche sich durch Eroberung, Gewaltsamkeit und Unterdrückung auf einer Fremdkultur gründete. Und bei uns? Unser Land hat sich nicht wie der Westen gebildet, davon haben wir historische Beispiele vor Augen: 1. das Sinken Russlands vor der Tatarenherrschaft infolge der Schwächung und Zerbröckelung der Autorität; 2. die Missstände der Nowgorodschen Republik, einer Republik, welche sich durch mehrere Jahrhunderte auf slavischer Grundlage zu erhalten versuchte, und endlich 3. die zweimalige Rettung Russlands durch die Macht der Autorität, durch die Macht der Alleinherrschaft: das erste Mal durch die Vertreibung der Tataren, das zweite Mal in der Reform Peters des Grossen, da nur der warme kindliche Glaube an seinen grossen Lenker Russland in den Stand setzte, einen so starken Umschwung zu einem neuen Leben zu ertragen. Ja, und wer denkt denn bei uns an Republik? Wenn auch Reformen bevorstehen, so wird es sogar für jene, welche sie wünschen, klar sein wie der Tag, dass diese Reformen gerade von einer für diese Zeit noch kräftigeren Autorität ausgehen müssen, wenn sie nicht in revolutionärer Weise vor sich gehen sollen. Ich denke nicht, dass in Russland ein Liebhaber des russischen Aufstandes gefunden werden könnte. Es sind wohl Beispiele davon bekannt und bis heute erinnerlich, obwohl es schon lange her ist, dass sie sich zutrugen. Zum Schlusse habe ich mich jetzt an meine eigenen oft wiederholten Worte erinnert, dass alles Gute, das es nur jemals in Russland gegeben hat, von Peter dem Grossen angefangen, immer von oben herab, vom Throne ausgegangen ist, von unten aber noch nichts aufgetaucht ist als Eigensinn und Rohheit. Diese meine Meinung wissen viele, die mich kennen.
Ich habe über die Zensur gesprochen, über ihre masslose Strenge in unserer Zeit; ich habe darüber geklagt, denn ich habe gefühlt, dass da ein Missverständnis sich gebildet hat, aus welchem ein für die Litteratur schwerer und gespannter Zustand hervorgegangen ist. Es war mir ein Kummer, dass der Beruf eines Schriftstellers in unseren Tagen durch eine Art dumpfen Misstrauens vernichtet wird; dass die Zensur den Schriftsteller, noch ehe er etwas geschrieben hat, als eine Art natürlichen Feind der Obrigkeit ansieht und sich daran macht, seine Manuskripte mit einer offenbaren Voreingenommenheit zu zergliedern. Es macht mich traurig, zu hören, dass man manches Werk verbietet, nicht weil man darin irgend etwas Liberales, Freidenkerisches, der Obrigkeit Widerstreitendes fände, sondern zum Beispiel darum, weil die Erzählung oder der Roman allzu traurig endet, weil ein allzu düsteres Bild darin aufgerollt worden, obwohl dieses Bild niemanden in der Gesellschaft anklagt oder verdächtigt, und obwohl die Tragödie selbst auf eine durchaus zufällige und äusserliche Weise vor sich gegangen. Man möge doch alles durchsehen, was ich geschrieben, sei es gedruckt oder ungedruckt, man möge die Handschriften meiner schon gedruckten Werke durchlesen, da wird man sehen, wie sie vor der Übergabe an die Zensur beschaffen waren; man suche nur darin irgend ein Wort, das gegen die Sittlichkeit und die festgestellte Ordnung der Dinge gerichtet wäre. Und dennoch wurde ich einem solchen Zensurverbot unterworfen, einzig nur darum, weil das Bild, das ich entwarf, mit allzu düsteren Farben gemalt war. Wenn sie aber wüssten, in welche traurige Lage der Autor dieses verbotenen Werkes dadurch versetzt war! Er stand vor der Unvermeidlichkeit, volle drei Monate ohne Brot dazusitzen, schlimmer als das, denn die Arbeit gab mir die Mittel zu meiner Erhaltung.
Ja, überdies musste ich bei allen Entbehrungen, bei allem Harm, ja fast in Verzweiflung (denn von der Geldfrage ganz abgesehen, ist es bis zur Verzweiflung unerträglich, das Werk, das man geliebt hat, daran man Arbeit, Gesundheit, die besten Kräfte der Seele gewendet, aus Missverständnis, aus Misstrauen verboten zu sehen), ich musste also überdies bei Entbehrung, Traurigkeit, Verzweiflung so viele leichte, heitere Stunden finden, um in dieser Zeit eine litterarische Arbeit mit heiteren, rosenfarbigen, angenehmen Farben hinzumalen. Und schreiben musste ich unbedingt, weil ich leben musste. Wenn ich geredet habe, wenn ich mich ein wenig beschwert habe (und ich habe mich so wenig beklagt!) — war ich darum ein Freidenker? Und über was habe ich mich beschwert? Über ein Missverständnis! Gerade dagegen habe ich mich mit allen Kräften gewehrt, indem ich nachwies, dass jeder Schriftsteller schon von vornherein verdächtigt wird, dass man ihn ohne Verständnis, mit Misstrauen ansieht, und habe gegen die Schriftsteller selbst den Vorwurf erhoben, dass sie selbst nicht nach den Mitteln suchen, dieses verderbliche Missverständnis zu zerstören. Verderblich darum, weil es für die Litteratur schwer ist, in einer so gespannten Lage zu bestehen. Ganze Kunstarten müssen auf diese Weise verschwinden. Die Satire, die Tragödie können nicht mehr dabei aufkommen. Es können bei der Strenge unserer jetzigen Zensur keine Gribojedows, von Wisin, ja sogar keine Puschkins bestehen. Die Satire verspottet das Laster und meistens das Laster, das unter der Tugendmaske einhergeht. Wie kann man sich jetzt auch nur die geringste Freiheit herausnehmen! Der Zensor sieht in allem eine Anspielung, mutmaasst, dass etwas Galliges dahinter sei, dass das vielleicht vom Autor auf irgend eine Persönlichkeit, auf irgend eine Ordnung der Dinge gemünzt sei. Mir selbst ist es oft geschehen, dass ich, alles Harms vergessend, über das herzlich gelacht habe, was der Zensor in meinen oder anderer Autoren Schriften als für die Gesellschaft schädlich und für den Druck unzulässig erachtete. Ich lachte darum, weil in unserer Zeit ähnliche Verdachtsgründe gar niemandem als dem Zensor in den Kopf kommen konnten. Im unschuldigsten und reinsten Satze wittert man den verbrecherischesten Gedanken, dem der Zensor sichtlich mit der Anstrengung aller seiner geistigen Kräfte wie einer ewigen unwandelbaren Idee nachjagt, die sein Kopf nicht lassen kann, die er selbst erschaffen hat, die er, zwischen Furcht und Misstrauen schwankend, selbst in seiner Phantasie in Fleisch und Blut hat treten lassen, selbst mit furchtbaren, nie dagewesenen Farben ausgemalt hat, bis er zuletzt sein Phantom mitsamt der unschuldigen Ursache seines Schreckens, dem ersten harmlosen Satz des Autors, vernichtet. Es ist, als ob man, indem man das Laster und die traurige Seite des Lebens verdeckt, damit vor dem Leser auch das wirkliche Laster und die traurigen Seiten des Lebens verdeckte. Nein! Der Schriftsteller wird, wenn er auch diese traurige Seite des Lebens vor dem Leser systematisch verhüllt, diesem nichts verdecken, sondern vielmehr in ihm den Verdacht erwecken, dass er nicht aufrichtig, nicht gerecht sei. Ja, kann man denn mit hellen Farben allein malen? Wie kann denn die helle Seite des Bildes sichtbar werden ohne dunklen Hintergrund? Kann es ein Bild geben, das nicht zugleich Licht und Schatten hätte? Wir haben vom Lichte nur darum einen Begriff, weil auch Schatten vorhanden ist. Man sagt: man beschreibe nur Vorzüge und Tugenden. Aber wir erkennen ja die Tugend gar nicht ohne das Laster; die Begriffe selbst vom Guten und Bösen sind daraus entstanden, dass das Gute und das Böse immer nebeneinander dagewesen sind. Wollte ich aber nur daran denken, Rohheit, Laster, Missbrauch, Hochmut auf die Scene zu bringen, sofort wird der Zensor gegen mich Verdacht schöpfen, wird denken, dass ich dies alles überhaupt auf alles ohne Ausnahme anwende. Ich bin nicht auf die Schilderung des Lasters und der düsteren Seiten des Lebens erpicht! Diese sowie jenes sind mir nicht angenehm. Aber ich spreche einzig und allein im Interesse der Kunst; da ich sah und mich davon überzeugte, dass zwischen der Litteratur und der Zensur ein Missverständnis bestehe (nur Missverständnis, weiter nichts), habe ich darüber geklagt, habe inständig gebeten, dass dieses Missverständnis so schnell als möglich gehoben werde, weil ich die Litteratur liebe und nicht umhin kann, mich für sie zu interessieren, weil ich weiss, dass die Litteratur ein Ausdruck des Volkslebens, ein Spiegel der menschlichen Gesellschaft ist. Mit der Kultur und Zivilisation treten neue Begriffe auf, welche eine Bestimmung, eine russische Benennung brauchen, um dem Volke vermittelt zu werden; denn nicht das Volk ist es, das ihnen in diesem Falle einen Namen zu geben vermöchte, da die Zivilisation nicht von ihm ausgeht, sondern von oben. Nur jene Gesellschaft vermag den neuen Begriffen einen Namen zu geben, welche die Zivilisation vor dem Volke angenommen hat, das heisst jene Schichte der Gesellschaft, jene Klasse, welche schon durch diese Ideen kultiviert worden ist. Wer ist es denn, der die neuen Ideen in eine solche Form giesst, dass das Volk sie verstehe? Wer anders als die Litteratur! Ohne sie wird die Reform Peters des Grossen nicht so leicht vom Volke aufgenommen werden, welches auch nicht begriffe, was man von ihm will. Wie war die russische Sprache zur Zeit Peters des Grossen beschaffen? Halb russisch und halb deutsch, da deutsches Leben, deutsche Begriffe, deutsche Sitten die Hälfte des russischen Lebens ausmachten. Allein das russische Volk spricht nicht deutsch, und das Erscheinen Lomonossows sofort nach Peter dem Grossen ist kein Zufall. Ohne Litteratur kann die Gesellschaft nicht bestehen, und ich sah, dass sie im Erlöschen war, und ich wiederhole es zum zehntenmale: das Missverständnis, das zwischen der Litteratur und den Zensoren entstanden war, regte mich auf, quälte mich. Da redete ich — allein ich redete nie von Übereinstimmung, von Vereinigung, von der Vernichtung des Missverständnisses. Ich hetzte niemanden um mich herum auf, da ich ein Glaubender war. Ja, und ich sprach davon nur mit meinen nächsten Freunden, mit meinen litterarischen Berufsgenossen. Ist das eine schädliche Freidenkerei?
Man klagt mich an, dass ich an einem der Abende bei Petraschewsky den Artikel „Korrespondenz Belinskys mit Gogol“ vorgelesen habe. Ja, ich habe diesen Artikel gelesen, kann aber derjenige, welcher mich angezeigt hat, sagen, für welche der beiden korrespondierenden Personen ich Partei genommen habe? Er möge sich nur erinnern, ob etwa in meinen Ansichten (die ich übrigens zurückhielt), oder etwa in meiner Intonation, in meinen Gesten etwas lag, das kundgegeben hätte, ob ich mich der einen oder der anderen Person gegenüber parteiischer verhalten habe! Natürlich wird er das nicht sagen. Belinskys Brief ist allzu seltsam geschrieben, als dass er irgend welche Sympathie erwecken könnte. Schmähungen stossen die Herzen ab, anstatt sie uns zuzuwenden, der ganze Brief aber ist von Schmähungen und Galle erfüllt. Endlich ist der ganze Brief ein Beispiel ohne Beweiskraft — ein Mangel, den Belinsky in seinen kritischen Artikeln niemals ablegen konnte und der im Verhältnisse zur Erschöpfung seiner physischen und geistigen Kräfte durch die Krankheit immer zunimmt. Diese Briefe sind im letzten Jahre seines Lebens zur Zeit seines Aufenthaltes im Auslande geschrieben worden. Eine gewisse Zeit lang war ich ziemlich nahe mit Belinsky bekannt. Er war, als Mensch betrachtet, einer der vortrefflichsten. Allein die Krankheit, welche ihn niederwarf, hat auch den Menschen in ihm gebrochen. Sie hat seine Seele grausam und starr gemacht und sein Herz mit Galle erfüllt. Seine zerrüttete, überspannte Einbildungskraft vergrösserte alles ins Kolossale und zeigte ihm Dinge, die nur er allein zu sehen vermochte. Es traten bei ihm Mängel und Fehler auf, von welchen im gesunden Zustande auch keine Spur vorhanden war. Unter anderem zeigte sich eine äusserst reizbare und empfindliche Eigenliebe. In der Zeitschrift, zu deren Mitarbeitern er zählte und wo er seiner Krankheit wegen sehr wenig arbeitete, hatte ihm die Redaktion die Hände gebunden und liess ihn nicht allzu ernste Artikel schreiben. Das verletzte ihn. In dieser Stimmung nun war es, dass er seinen Brief an Gogol schrieb. In der Schriftstellerwelt ist sehr vielen mein Streit und meine endgiltige Entzweiung mit Belinsky im letzten Jahre seines Lebens nicht unbekannt. Es ist auch die Ursache dieser Auseinandersetzung bekannt: es handelte sich um Ideen über Litteratur und um die Richtung derselben. Meine Anschauung war derjenigen Belinskys diametral entgegengesetzt. Ich machte ihm den Vorwurf, dass er sich bemühe, der Litteratur eine besondere, ihrer nicht würdige Bestimmung zu geben, indem er sie nur zur Beschreibung — wenn man so sagen darf — von Zeitungsfakten oder skandalösen Vorkommnissen herabzog. Ich entgegnete ihm namentlich, dass man mit Galle niemanden an sich ziehe, sondern vielmehr alle und jeden tödlich langweilen werde, wenn man jeden erstbesten, der uns in den Weg läuft, anpackt, jeden Vorübergehenden am Knopfe seines Rockes festhält, ihm gewaltsam eine Predigt halten und ihn eines Besseren belehren will.
Belinsky wurde böse auf mich, und so gingen wir endlich von Erkältung zu förmlichem Bruch über, so dass wir uns im ganzen Verlaufe seines letzten Lebensjahres nicht mehr sahen. Ich hatte lange den Wunsch gehabt, diese Briefe zu lesen. In meinen Augen ist diese Korrespondenz ein ziemlich bemerkenswertes litterarisches Gedenkblatt. Sowohl Belinsky als Gogol sind höchst bedeutende Persönlichkeiten. Ihre Beziehungen zu einander sind sehr interessant — umsomehr für mich, da ich mit Belinsky bekannt gewesen war. Petraschewsky hatte diese Briefe zufällig in meiner Hand erblickt und gefragt: Was ist das? Da ich keine Zeit hatte, ihm sie sogleich zu zeigen, versprach ich ihm, sie ihm am Freitag zu bringen. Ich hatte mich selbst dazu angetragen und musste nun mein Wort halten. Ich habe diesen Artikel wie ein litterarisches Gedenkblatt, nicht mehr, nicht weniger, vorgelesen, fest überzeugt, dass er niemanden verlocken könne, obwohl er eines gewissen litterarischen Wertes nicht ermangelt. Was mich anbelangt, so bin ich buchstäblich nicht mit einer einzigen der Übertreibungen einverstanden, die sich darin befinden. Und nun bitte ich, folgenden Umstand in Erwägung zu ziehen: Würde ich es denn unternehmen, den Artikel eines Menschen vorzulesen, mit welchem ich gerade um seiner Ideen willen im Streite gelegen hatte (das ist kein Geheimnis, es ist vielen bekannt), ja noch dazu einen im kranken Zustande, in geistiger und seelischer Zerrüttung geschriebenen Artikel, würde ich es unternehmen, diesen Artikel zu lesen, ihn als ein Vorbild, eine Formel aufzustellen, der man nacheifern muss? Ich habe erst jetzt begriffen, dass ich damit einen Irrtum begangen habe, und dass es nicht in der Ordnung war, diesen Artikel laut vorzulesen; aber damals habe ich mich nicht besonnen, denn ich habe auch nicht geahnt, wessen man mich beschuldigen kann, habe keine Sünde darin vermutet. Aus Achtung für einen schon dahingeschiedenen, in seiner Zeit bedeutenden Menschen, dessen Urteil man um einiger litterarisch-ästhetischer Artikel willen schätzt, die thatsächlich mit grosser Kenntnis der Litteratur geschrieben sind; endlich aus dem heiklen Gefühl, welches gerade durch meine Entzweiung mit ihm um dieser Ideen willen (welche vielen bekannt sind) in mir verursacht wurde, las ich die ganze Korrespondenz, mich jeder Bemerkung enthaltend und mit vollständiger Unparteilichkeit.
Ich habe erwähnt, dass ich über Politik, über Zensur und anderes gesprochen habe; aber da habe ich unnütz über mich ausgesagt. Ich wollte damit nur ein Bild meiner Ideen entwerfen. Niemals habe ich bei Petraschewsky über diese Gegenstände gesprochen. Ich habe bei ihm nur dreimal oder, besser gesagt, zweimal gesprochen: einmal über Litteratur anlässlich eines Streites mit Petraschewsky über Krylow, und ein zweitesmal über Persönlichkeit und über Egoismus. Im allgemeinen bin ich kein redseliger Mensch und liebe nicht, an Orten laut zu sprechen, wo mir fremde Personen gegenwärtig sind. Meine Denkungsart, sowie meine ganze Person sind nur sehr wenigen, nur meinen Freunden bekannt. Grossen Streitigkeiten gehe ich aus dem Wege und gebe gern nach, nur um in Ruhe gelassen zu werden. Aber ich wurde zu diesem litterarischen Streite herausgefordert durch ein Thema, welches von meiner Seite aus hiess, dass die Kunst keiner Tendenzrichtung bedarf, dass die Kunst sich selbst Zweck ist, dass der Autor sich nur um das Künstlerische zu kümmern habe; die Idee werde schon selbst erscheinen, denn sie ist die unumgängliche Bedingung des Künstlerischen. Mit einem Worte: es ist bekannt, dass diese Richtung dem Zeitungswesen und der Brandstiftung diametral entgegengesetzt ist. Ebenso ist es vielen bekannt, dass ich diese Richtung schon durch mehrere Jahre vertrete. Endlich haben alle bei Petraschewsky unseren Streit gehört, alle können das bezeugen, was ich gesprochen habe. Es hat damit geendigt, dass es sich zeigte, dass Petraschewsky dieselben Ideen über Litteratur hatte, wie ich, dass wir einander aber nicht verstanden. Dieses Resultat unseres Streites haben viele gehört, und ich habe bemerkt, dass der ganze Streit teilweise aus Eigenliebe entstanden war, weil ich einmal Petraschewskys genaue Kenntnis dieses Gegenstandes bezweifelte. Was nun das zweite Thema anbelangt, über Persönlichkeit und Egoismus, so wollte ich darin nachweisen, dass unter uns mehr Ehrgeiz als wirkliche menschliche Würde vorhanden sei, dass wir in Selbstverkleinerung, in die Zerbröckelung der Persönlichkeit verfallen, und zwar aus kleinlicher Eigenliebe, aus Egoismus und aus der Ziellosigkeit unserer Arbeiten. Dies ist ein rein psychologisches Thema. Ich habe gesagt, dass in der Gesellschaft, welche bei Petraschewsky zusammenkam, nicht das geringste Zielbewusstsein, nicht die geringste Einheit, weder in den Gedanken noch in der Gedankenrichtung, vorhanden war. Das schien ein Streit zu sein, der einmal begann, um niemals beendet zu werden. Um dieses Streites willen kam auch die Gesellschaft zusammen, um sich durchzustreiten; denn fast jedesmal ging man auseinander, um das nächstemal den Streit wieder mit erneuerter Kraft aufzunehmen, da man fühlte, dass man auch nicht den zehnten Teil dessen gesagt habe, was man hätte sagen mögen. Ohne Debatten wäre es bei Petraschewsky höchst langweilig gewesen, weil nur Streit und Widerspruch diese Leute von so verschiedenem Charakter zu verbinden vermochten. Man sprach über alles, aber über nichts ausschliesslich, und man sprach so, wie man in jedem Kreise spricht, der sich zufällig zusammenfindet. Ich bin überzeugt davon. Und wenn ich manchmal an Streitigkeiten bei Petraschewsky teilgenommen habe, wenn ich zu ihm ging und nicht erschrak, wenn ein hitziges Wort gesprochen wurde, so geschah dies deshalb, weil ich vollkommen überzeugt war (und das bin ich noch heute), dass die Sache hier familienhaft, im Kreise gemeinschaftlicher Freunde Petraschewskys, aber nicht öffentlich vor sich ging. So war es thatsächlich, und wenn man jetzt eine so ausschliessliche Aufmerksamkeit dem zuwendet, was bei Petraschewsky vorging, so ist das darum der Fall, weil Petraschewsky durch seine Sonderbarkeiten und Excentricitäten fast ganz Petersburg bekannt war und daher auch seine Abende bekannt waren. Ich aber weiss unbedingt, dass das Gerede ihre Bedeutung übertrieb, obwohl im Gerede der Leute mehr Spott über Petraschewskys Abende enthalten war als Besorgnis.
Darüber, dass manchmal ziemlich offen gesprochen wurde (aber immer im Sinne des Zweifels und so, dass Streit daraus entstand), war ich nicht beunruhigt, weil es nach meiner Idee besser ist, dass irgend ein hitziges Paradoxon, irgend ein Zweifel vor das Urteil der anderen tritt (natürlich nicht auf dem Marktplatze, sondern im Freundeskreise), anstatt im Innern des Menschen ohne Ausgang zu bleiben, sich in seiner Seele zu verhärten und einzuwurzeln. Gemeinsamer Streit ist nützlicher als Vereinsamung. Die Wahrheit kommt immer zu Tage, und der gesunde Verstand wird den Sieg davontragen. So habe ich diese Versammlung betrachtet und bin auf Grund dieser Anschauung manchmal hingegangen. Die Erfahrung hat mir recht gegeben, da man z. B. ganz aufhörte, über den Fourierismus zu sprechen, denn dieser wurde, auch als Lehre betrachtet, von allen Seiten mit Spott überschüttet. Wenn aber bei Petraschewsky irgend jemand es unternommen hätte, über eine Anwendung des Fourierschen Systems auf unser gesellschaftliches Leben zu sprechen, so hätte man ihm sofort ohne alle Umstände ins Gesicht gelacht. Ich spreche so, weil ich von der Wahrheit meiner Aussage überzeugt bin.
Zur Beantwortung der Frage, ob nicht irgend ein geheimer Zweck von der Gesellschaft Petraschewskys verfolgt wurde, kann man auf das nachdrücklichste sagen, dass in Anbetracht dieses ganzen Durcheinanders von Meinungen, dieser ganzen Vermischung von Begriffen, Charakteren, Persönlichkeiten, Spezialitäten, dieser Streitigkeiten, welche fast bis zur Feindseligkeit gingen und nichtsdestoweniger nur Debatten blieben, in Anbetracht also alles dieses kann man auf das nachdrücklichste sagen, dass unmöglich ein geheimer, verborgener Zweck in diesem Chaos vorhanden sein konnte. Hier war auch nicht der Schatten einer Einheit und könnte auch keiner bis an das Ende aller Zeiten vorhanden sein. Und obwohl ich nicht alle Männer und Frauen der Gesellschaft Petraschewskys kannte, so kann ich unbedingt nach dem, was ich gesehen habe, sagen, dass ich mich nicht irre.
Jetzt komme ich zur Beantwortung der letzten Frage, zur Antwort, welche meine Rechtfertigung abschliesst; es ist diese: Ist Petraschewsky selbst ein gefährlicher Mensch und bis zu welchem Grade ist er der Gesellschaft schädlich?
Als man mir diese Frage das erste Mal vorlegte, konnte ich sie nicht geradeaus beantworten. Ich hätte vorher in mir eine ganze Reihe von Fragen und Zweifeln entscheiden müssen, welche sofort in meinem Geiste entstanden, welche ich aber nicht auf der Stelle beantworten konnte, welche einen bestimmten Grad von Sammlung forderten, und darum stand ich da, ohne zu wissen, was ich antworten sollte. Jetzt, da ich mir alles klargemacht habe, will ich sowohl meine vorausgegangenen Erwägungen, als auch schliesslich die Antwort auf die mir gestellte Frage als Schlussfolgerung dieser Erwägungen hier vorlegen.
Wenn man mich gefragt hat, ob Petraschewsky der Gesellschaft schädlich sei, so verstehe ich darunter vor allem, ob er es als Fourierist, als Anhänger und Verbreiter der Lehre Fouriers sei. Man hat mir ein eng beschriebenes Heft gezeigt und mir gesagt, dass ich wahrscheinlich die Schrift darin erkennen würde. Ich kenne Petraschewskys Handschrift nicht, ich habe nie mit ihm korrespondiert und ich habe unbedingt nicht vermutet, dass er sich mit Schriftstellerei befasst (ich spreche mit Überzeugung); darum weiss ich unbedingt nichts von ihm, als einem Verbreiter der Lehre Fouriers. Ich kenne nur seine theoretischen Überzeugungen, ja und diese kaum, da wir auch ein theoretisches Gespräch über Fourier selten, fast niemals anknüpften, da unsere Gespräche sich sofort in Streit verwandelten. Das wusste er sehr gut. Von Plänen aber und Anordnungen hat mir Petraschewsky niemals etwas mitgeteilt, und ich weiss endgiltig nicht, hat er solche gehabt oder nicht. Ausserdem, wenn er auch solche gehabt hätte, was ich durchaus nicht weiss, so würde er sie, da er mit mir in keinerlei nahen Beziehungen stand und keine grosse Freundschaft uns verband, sicherlich (ich bin davon überzeugt) alles vor mir verborgen und mir kein Wort mitgeteilt haben. Ich aber meinerseits hatte auch niemals den Wunsch, seine Geheimnisse kennen zu lernen. Deshalb kann ich unbedingt nichts über Petraschewsky als Fourieristen sagen, ausser in einem rein wissenschaftlichen Sinne.
Ich weiss, dass Petraschewsky das System Fouriers schätzt; als Fourierist kann er natürlich nichts anderes wünschen, als dass man mit ihm sympathisiere. Aber man hat mich gefragt, ob er Proselyten mache. Zieht er nicht Lehrer verschiedener Unterrichtsanstalten an sich in der Absicht, nachdem er sie bekehrt, durch sie die Verbreitung der Fourierschen Lehre in der Jugend zu bewirken? Ich erwidere: ich kann unbedingt nichts über diese Sache sagen, weil ich keine genügenden Daten habe und die Geheimnisse Petraschewskys durchaus nicht kenne. Man hat mir gesagt, dass unter Petraschewskys Freunden ein gewisser Lehrer Toll sich befinde. Allein Toll ist mir vollkommen unbekannt, und dass er ein Lehrer sei, habe ich erst kürzlich erfahren. Was aber Jastrzembski anbelangt, so habe ich erst erfahren, dass er Lehrer ist, als er über politische Ökonomie sprach. Sonst kenne ich keinen Lehrer. Da ich nicht nur in keinerlei nahen, sondern in sehr lockeren Beziehungen zu Toll stehe, so kenne ich weder die Geschichte seiner Bekanntschaft mit Petraschewsky noch den Zeitpunkt, wann sie einander kennen lernten, noch die Beziehungen, in welchen sie zu einander standen; mit einem Worte, es war mir ganz uninteressant, das zu wissen. Was nun Jastrzembski anbelangt, so habe ich keine Gelegenheit gehabt, die Art seiner ökonomischen Ideen kennen zu lernen, da ich nur zweimal in der Lage war, ihn zu hören. Er ist, so viel mir scheint, ein Ökonomist der neuesten Schule und lässt den Socialismus soweit zu, als dies die strengsten Professoren thun. Denn der Socialismus seinerseits hat durch seine kritischen Ausarbeitungen und den statistischen Teil seiner Arbeit viel wissenschaftlich Nützliches geleistet. Mit einem Worte, ich nehme an, dass Jastrzembski weit davon entfernt ist, ein Fourierist zu sein, und dass er von Petraschewsky nichts zu lernen hat. Ich muss aber bemerken, dass ich Jastrzembski als Menschen gar nicht kenne, dass ich niemals ein Gespräch mit ihm angeknüpft habe, und es scheint, dass auch er sich in der gleichen Beziehung zu mir befunden hat. Ein vollkommenes Bild seiner Ideen habe ich nicht, ebenso wie er keines von den meinen hat. Also kann ich über Petraschewsky als Verbreiter einer Lehre nur nach Mutmassungen und Vorstellungen urteilen.
Aber nach Mutmassungen kann ich nichts sagen. Ich weiss, dass meine Aussage nicht als eine endgiltige, grundlegende angenommen wird; immerhin wird sie eine Aussage bleiben. Wie nun, wenn ich mich irre? Der Irrtum wird schwer auf meinem Gewissen lasten. Man hat mir eine Handschrift gezeigt, von deren Vorhandensein ich früher nichts wusste. Ich habe einen Satz dieser Handschrift gelesen. In diesem Satze ist der heisse Wunsch ausgesprochen, dass das System Fouriers so schnell als möglich siegen möge. Wenn die ganze Handschrift in diesem Sinne geschrieben ist, wenn Petraschewsky sie als die seine anerkannt hat, so hat er natürlich die Verbreitung des Fourierschen Systems gewünscht. Ob er jedoch thatsächlich irgend welche Massnahmen dazu getroffen hat, ist mir bis zum heutigen Tage unbekannt. Mir sind seine Geheimnisse unbekannt. Ich denke, dass man mir endlich Glauben schenken kann. Niemand wird aussagen können, dass ich jemals mit Petraschewsky in sehr nahen Beziehungen gestanden hätte. Ich kam an Freitagen als Bekannter zu ihm, doch nicht mehr. Ich kenne keinen seiner Pläne und habe zum ersten Male diese Handschrift gesehen, deren Inhalt ich ausser einem Satze durchaus nicht kenne. Und so vermag ich nichts darüber zu sagen, ob er irgend etwas gethan, ob er Massnahmen getroffen habe. Allein man möge mir erlauben, einige meiner eigenen Gedanken darzulegen, welche meine tiefsten Überzeugungen ausmachen, über welche ich lange nachgesonnen habe, welche mir früher ebenso erschienen sind wie jetzt, und infolge welcher endlich ich bei der ersten Frage über die Strafbarkeit Petraschewskys keine endgiltige Antwort geben konnte. Ich begriff, wie wichtig in den Augen der Richter Petraschewskys solche Beweise sein müssen, wie Bücher, Handschriften und Reden, welche abrissweise niedergeschrieben worden sind. Da man mich aber über ihn befragt, so möge man mir erlauben, meine Ansichten über seine ganze Angelegenheit hier auszusprechen.
Petraschewsky glaubt an Fourier. Das System Fouriers ist ein friedliches; es bezaubert die Seele durch seine Schönheit, es bestrickt das Herz durch jene Menschenliebe, welche Fourier beseelte, als er sein System schuf, versetzt den Geist in Erstaunen durch seine Harmonie und zieht nicht durch bittere Ausfälle an sich, sondern beseelt jeden mit der Liebe zur Menschheit. In diesem System gibt es keinen Hass. Politische Reformen setzt sich Fourier nicht vor. Seine Reform ist eine ökonomische. Sie greift weder die Obrigkeit noch den Besitz an, und in einer der letzten Sitzungen der Kammer hat Victor Considérant, der Repräsentant der Fourieristen, feierlich jeden Angriff auf die Familie abgelehnt. Endlich ist dieses System ein theoretisches und wird niemals populär werden.
Die Fourieristen sind während der ganzen Zeit der Februar-Revolution nicht ein einziges Mal auf die Gasse herabgestiegen, sie sind in der Redaktion ihres Journals geblieben, wo sie ihre Zeit schon mehr als 20 Jahre mit Träumen von der zukünftigen Schönheit der Phalanstère zubringen. Allein dieses System ist zweifellos schädlich, erstens schon darum allein, weil es ein System ist; zweitens, wie schön es auch sei, bleibt es immer eine wesenlose Utopie, aber der Schaden, den diese Utopie anrichtet, ist, wenn man mir erlaubt, mich so auszudrücken, eher komisch als schreckenerregend. Es gibt kein sociales System, das in einem so hohen Grade unpopulär, das so belacht und ausgepfiffen worden wäre, wie das System Fouriers im Westen. Es ist schon lange tot, und seine Führer bemerken selbst nicht, dass sie nichts mehr sind als lebendig Tote. Im Westen, in Frankreich, ist in diesem Augenblicke jedes System, jede Theorie der Gesellschaft schädlich, denn die hungrigen Proletarier ergreifen in der Verzweiflung jedes Mittel, und aus jedem Mittel sind sie imstande, sich ein Panier zu machen. Man ist in diesem Augenblick dort beim Äussersten angelangt; dort treibt der Hunger die Leute auf die Gasse, den Fourierismus aber hat man aus Geringschätzung vergessen. Und sogar der Cabetismus, der das Unsinnigste auf der Welt ist, erweckt bedeutend mehr Sympathien. Was aber uns anbelangt, Russland, Petersburg, so braucht man nur zwanzig Schritte auf der Strasse zu machen, um sich zu überzeugen, dass der Fourierismus auf unserem Boden nur bestehen könnte: entweder in den unaufgeschnittenen Blättern eines Buches, oder in einer weichen, sanftmütigen, träumerischen Seele, aber nicht anders als in der Form einer Idylle, oder wie etwa ein Poem in vierundzwanzig Gesängen. Der Fourierismus kann keinen ernstlichen Schaden bringen. Erstens, wenn er auch ein ernstlicher Schaden wäre, so wäre seine Ausbreitung allein schon eine Utopie, denn sie würde sich bis zur Unglaublichkeit langsam vollziehen. Um das System Fouriers vollkommen zu begreifen, muss man es studieren; das aber ist eine ganze Wissenschaft: man muss etwa ein Dutzend Bände durchlesen. Kann denn ein solches System populär werden? Vom Katheder herunter durch die Lehrer? Das aber ist physisch unmöglich, schon wegen des Umfanges der Fourierschen Lehre. Aber ich wiederhole, ein ernstlicher Schaden kann nach meiner Meinung durch das System Fouriers nicht entstehen, und wenn ein Fourierist Schaden bringt, so thut er es höchstens sich selbst, in der öffentlichen Meinung, bei denen, welche gesunden Menschenverstand besitzen; denn für mich ist die höchste Komik — eine niemandem nützliche Thätigkeit. Der Fourierismus aber und mit ihm jedes System des Westens sind für unseren Boden so unbrauchbar, unseren Umständen so entgegen, dem Charakter unserer Nation so fremd, andererseits aber so sehr eine Geburt des Westens, so sehr ein Produkt des dortigen abendländischen Standes der Dinge, in welchem die proletarische Frage um jeden Preis entschieden wird, dass der Fourierismus mit seiner eindringlichen Unvermeidlichkeit jetzt bei uns, wo es kein Proletariat gibt, höchst lächerlich, seine Thätigkeit die allerunnützeste, in ihren Folgen die allerkomischeste wäre. Dies ist es, warum ich nach meiner Mutmassung Petraschewsky für gescheiter halte und ihm niemals ernstlich zugetraut hätte, weiter als bis zu einer theoretischen Schätzung des Fourierschen Systems gegangen zu sein. Alles übrige war ich thatsächlich bereit, für einen Scherz zu halten. Der Fourierist ist ein unglücklicher, kein strafbarer Mensch — das ist meine Meinung. Endlich hat meiner Ansicht nach auch nicht ein Paradoxon, so viele ihrer auch gewesen seien, sich von selbst, aus eigenen Kräften halten können; so lehrt uns die Geschichte. Ein Beweis davon ist, dass in Frankreich im Verlaufe eines Jahres fast alle Systeme fielen, und zwar durch sich selbst fielen, sowie die Sache nur an die geringste Bekräftigung herankam. Alles dieses zusammenfassend, muss ich sagen, dass ich, wenn ich auch wüsste (was ich nicht weiss, ich wiederhole es noch einmal), dass Petraschewsky, vor keinerlei Spott zurückschreckend, sich noch immer um die Verbreitung des Fourierschen Systems bemühe, mich dennoch davon zurückhalten würde, ihn für schädlich, der Gesellschaft Schrecken bringend, zu bezeichnen. Erstens, in welcher Weise könnte Petraschewsky als Verbreiter des Fourierismus schädlich sein? Das geht über meine Begriffe; lächerlich, aber nicht schädlich. Dies ist meine Meinung. Und dies ist, was ich nach meinem Gewissen auf die mir gestellte Frage antworten kann. Endlich ist in mir noch eine Erwägung aufgetaucht, die ich nicht verschweigen kann, eine Erwägung rein menschlicher Natur, wie sie das Leben mit sich bringt. Ich habe lange die Überzeugung in mir getragen, dass Petraschewsky von einer gewissen Art von Eigenliebe ergriffen sei. Es war Eigenliebe, die ihn veranlasste, die Freitagsabende einzurichten, es war auch Eigenliebe, dass ihm die Freitage nicht überdrüssig wurden. Aus Eigenliebe schaffte er viele Bücher an und gefiel es ihm offenbar, dass man wisse, er besitze seltene Bücher. Übrigens ist das nicht mehr als eine persönliche Beobachtung von mir, eine Mutmassung, denn, ich wiederhole es, alles, was ich über Petraschewsky weiss, weiss ich unvollständig, nicht vollkommen, sondern nur nach Vermutungen über das, was ich gesehen und gehört habe.
Dieses meine Antwort, ich habe die Wahrheit gesprochen.
Theodor Dostojewsky.
Als endlich das Todesurteil, welches am 19. Dezember vom Kaiser unterschrieben worden war, verlesen wurde, war keiner unter ihnen, der Reue empfunden hätte. Sein persönliches Verhalten in dieser „längst vergangenen Geschichte“, sagt er in seinem „Tagebuche“, änderte sich erst viel später.
Die Zeit im Gefängnisse während der achtmonatlichen Untersuchungshaft verlief verhältnismässig günstig, was die äusseren Umstände betrifft. Er war im Alexejschen Ravelin der Festung eingeschlossen, durfte täglich auf eine Viertelstunde im kleinen Hofe allein, aber unter Bedeckung, spazieren gehen, in den letzten Monaten schreiben und lesen. Seine Gesundheit wurde merkwürdigerweise gerade in dieser Zeit fester. Sein ganzes Wesen war durch das Ereignis so erschüttert und nach innen gekehrt, dass er, der in der vorhergegangenen Zeit eine fast bis zum Wahnsinn gehende Ängstlichkeit und Hypochondrie bekundete, — derart, dass nach den Aussagen seines Bruders Andreas fast jede Nacht auf seinem Tischchen ein Zettel lag, worauf geschrieben stand: „heute kann ich in lethargischen Schlaf verfallen; nicht vor so und so viel Tagen begraben!“ — jede Angst und Sorge um sein Leben und seine Gesundheit verlor und schon dadurch widerstandsfähiger wurde. Seine innere Stimmung war zwar wechselnd, doch siegte über alles sein aus der unerschöpflichen Arbeitskraft quellender Lebensmut. So schreibt er an den Bruder am 18. Juli: „Ich bin durchaus nicht herabgestimmt .... manchmal fühlst du sogar, als seist du an dieses Leben schon gewöhnt und es sei alles eins ... aber ... ein anderes Mal stürmt das frühere Leben mit allen seinen Eindrücken förmlich in die Seele ein ... jetzt sind helle Tage, und es ist etwas freundlicher geworden ... auch habe ich Beschäftigung. Ich habe die Zeit nicht vergeudet, habe drei Erzählungen und zwei Romane ausgedacht; an einem derselben schreibe ich jetzt.“
Dieser „Roman“ war nach Dostojewskys späteren Aufzeichnungen die Erzählung „Ein kleiner Held“, welche in den „Vaterländischen Annalen“ anonym erschien, und zwar erst im Jahre 1857, also zu einer Zeit, da der Dichter noch nicht aus Sibirien zurückgekehrt war. Bruder Michael hatte das Manuskript eingereicht. Theodor Michailowitsch fügt seinen Aufzeichnungen die Notiz bei: (dort konnte man nur das Unschuldigste schreiben). Der Biograph O. Miller fügt hier hinzu, dass der Dichter bei aller Unschuld dieser Erzählung doch eine ihm sehr antipathische Figur aus dem Petraschewskyschen Kreise hineingeflochten habe, und führt eine sehr charakteristische Stelle aus dieser Personalbeschreibung an. Sie lautet: „Auf alles hat er eine fertige Phrase in Bereitschaft ... ganz besonders versehen sich diese Leute mit Phrasen, um ihre tiefe Sympathie für die Menschheit darzulegen ... endlich, um unumstösslich die Romantik zu geisseln, d. h. zum öfteren alles Schöne und Wahre, von welchem jedes Atom kostbarer ist, als ihre schleimige Polypen-Natur.“
Von der Untersuchungskommission ging die Angelegenheit in die Hände einer eigenen, im Namen des Kaisers amtierenden Gerichtskommission unter dem Vorsitz des Generals Perowsky, welcher beschliessen wollte, alle Angeklagten aus Mangel an Beweisen freizusprechen. Die Sache ging jedoch an das General-Auditoriat über, wo sie kriegsrechtlich behandelt wurde. Sie wurde also kraft der kriegsrechtlichen Gesetze in der Weise beendet, dass alle Angeklagten, mit Ausnahme eines einzigen, Palm, ohne Unterscheidung ihrer Schuld, ob sie nun die Aufhebung der Leibeigenschaft auf gesetzlichem Wege oder mit revolutionären Mitteln angestrebt hatten, ob sie überhaupt einen Umsturz der Staatsverfassung angestrebt, oder, wie Dostojewsky, einen Brief „voll frecher Ausdrücke gegen Kirche und Staat“ vorgelesen hatten — zum Tode durch Füsilieren verurteilt wurden.
Keiner der Angeklagten hatte indes Kenntnis davon, wann das Urteil verlesen werden würde. Am frühen Morgen des 22. Dezember — so erzählt O. Miller — bemerkten sie eine lebhaftere Bewegung am Korridor und ahnten, dass irgend etwas Ungewöhnliches vorgehe. Einer der Gefangenen, Speschnew, erzählte mit Genauigkeit, dass dies um 6 Uhr war, und um 7 Uhr setzte man sie auf die Wagen und führte sie fort. Nach den Worten Dostojewskys hatte man sie vorher dazu verhalten, ihre eigenen Gewänder anzuziehen, wozu sie unter Begleitung eines Aufsehers geschickt wurden. Speschnew, welcher nicht begreifen konnte, wohin man sie führe, vermutete, man wolle ihnen den Urteilsspruch vorlesen, da man sie aber kriegsrechtlich aburteilte, setzte er voraus, dies werde im Ordonnanzhause geschehen.
Indessen war die Fahrt eine sehr langwierige. Speschnew fragte unterwegs den Soldaten: „wohin führt man uns?“ Dieser antwortete: „Es ist nicht befohlen zu sagen“. Es war starker Frost und so konnte man durch die beeisten Fenster der Wagen nicht gut unterscheiden, auf welcher Strasse man fahre .... Um sich davon zu überzeugen, wohin er geführt werde, versuchte Speschnew mit dem Finger das Fensterglas durchsichtig zu machen, allein der Soldat sagte: „Thun Sie das nicht, sonst schlägt man mich“. Da verzichtete Speschnew darauf, seine so begreifliche Neugierde zu befriedigen. Es wurde schon oben gesagt, dass der Gedanke an die Todesstrafe ihnen gar nicht in den Sinn gekommen war. Sie dachten auch daran nicht, dass der Urteilsspruch, welcher gefällt und durch den Kaiser abgeändert worden war, ihnen nichtsdestoweniger vorgelesen werden würde, zum Zwecke, ihnen einen tiefen Eindruck, einen Schrecken zu verursachen. Aber da, nach einer ihnen endlos scheinenden Fahrt, brachte man sie auf den Semenowskyschen Platz und führte sie in einer gewissen Ordnung hinaus. Darauf führte man sie auf das Schaffot, und wie Theodor Michailowitsch erzählt, stellte man neun von ihnen auf eine und elf auf die andere Seite.
Ich ziehe es vor, hier Stellen aus dem Briefe einzufügen, den Dostojewsky selbst sofort nach der Urteilsverkündigung an den Bruder schreibt. Es giebt nichts Charakteristischeres als diese knappe Darlegung des erschütterndsten Augenblicks in seinem Leben. Sie lautet:
„Heute, den 22. Dezember, hat man uns auf den Semenowsky-Platz hinausgeführt, dort hat man uns allen das Todesurteil vorgelesen und das Kreuz zu umfassen gestattet, hat über unseren Häuptern die Degen zerbrochen und uns mit der Sterbetoilette (dem weissen Hemde) bekleidet. Darauf hat man drei von uns zur Vollstreckung des Todesurteils an den Pfahl gestellt. Ich stand als sechster in der Reihe; man rief je drei und drei heraus, folglich sollte ich in der zweiten Abteilung daran kommen, und es blieb mir nicht mehr als eine Minute zum Leben. Ich dachte an dich, Bruder, an alle die Deinen. Im letzten Augenblicke warst du, du allein in meinem Geiste gegenwärtig; da erst erkannte ich, — wie sehr ich dich liebe, teurer Bruder! Ich konnte auch noch Speschnew, Durow, die neben mir standen, umarmen und mich mit ihnen verabschieden. Endlich blies man Retraite, die an den Pfahl Gebundenen führte man zurück und las uns vor, dass Seine kaiserliche Majestät uns das Leben schenkt. Dann folgten die eigentlichen Verurteilungen. Der einzige Palm ist begnadigt und behält seinen Rang in der Armee.“
In wie künstlerischer Weise der Dichter diese Scene nach Jahren verwertet hat, können wir in der Erzählung des Idioten, im Roman dieses Namens ersehen.
Die Abänderung des Todesurteils in grössere und geringere Kerkerstrafen war schon früher eigenhändig vom Kaiser bei jedem einzelnen Urteile an den Rand des Blattes geschrieben worden. Umso grausamer muss uns diese Komödie erscheinen. Die für Dostojewsky vorgeschlagene Strafumwendung in achtjährige Zwangsarbeit wurde in eine vierjährige Frist mit nachträglicher Einreihung in den Liniendienst umgewandelt.
Wir lassen hier die betreffenden Dokumente folgen.
No. 522.
24. Dezember 1849.
An den Herrn General-Adjutanten
Graf Orloff.
Rapport.
Die in der Festung St. Petersburg inhaftiert gewesenen Verbrecher wurden: laut der von Seiner Majestät beschlossenen Urteilsbestätigung nach Auslöschung ihrer Namen auf der Arrestantenliste heutigen Datums, abends, abgefertigt: Durow, Dostojewsky und Jastrzembski in Ketten geschmiedet nach Tobolsk[5] in Begleitung des Lieutenants Prokofjew vom Feldjäger-Corps und dreier Gendarmen, Pleschtschjew nach Orenburg in Begleitung des Fähnrichs im Feldjäger-Corps Leiter, und Achscharumow nach Cherson in Begleitung des Fähnrichs im Feldjäger-Corps Wierander mit je einem Gendarm, wovon ich die Ehre habe Euer Durchlaucht Mitteilung zu machen.
Der Festungs-Kommandant,
General-Adjutant Nabokow,
der Kollegien-Sekretär Wassiljitsch.
Das Dokument, welches dem Moskauer Adel die Verurteilung Dostojewskys und den Verlust aller bürgerlichen Rechte mitteilt, befindet sich in den Moskauer Adelsarchiven und lautet:
Archiv des Moskauer Adels.
Journal der Deputaten-Versammlung 1850, No. 92, b, Z II
(September 1850).
Verordnung des Herrn Ministers des Innern, folgenden Inhalts: Der dirigierende Senat ordnet, nach Entgegennahme des Rapports des Herrn Kriegsministers vom 23. Dezember des vorigen Jahres — enthaltend den von Seiner kaiserlichen Majestät bestätigten Bericht über die, durch das Kriegsgericht als Kriminal-Feldkriegsrat wegen verbrecherischer Absichten gegen die Obrigkeit laut Ukas vom 30. Dezember desselben Jahres verurteilten Verbrecher — hiermit an: dass, unbeschadet der erflossenen Bestimmung über den Abdruck des obenerwähnten Allerhöchsten Befehls in den Senatsberichten (w Senatskich wjedomostjach), die Adelsmarschälle (natschalnik gubernii) jener Gubernien davon in Kenntnis zu setzen sind, welchen die genannten Verbrecher zugehörten. Aus der Zahl dieser Personen wurden verurteilt: der nicht gedient habende Edelmann (dworjanin) Alexei Pleschtschjew und der verabschiedete Ingenieur-Lieutenant Theodor Dostojewsky, welche durch das General-Auditoriat zum Tode durch Füsilieren verurteilt worden waren. Jedoch hat der Kaiser (Gossudar Imperator) am 19. Dezember 1849 den allerhöchsten Befehl zu erteilen geruht, dass anstatt der Todesstrafe Pleschtschjew nach Verlust aller seiner Standesrechte als Gemeiner in das Orenburgsche Linien-Infanterie-Bataillon eingereiht, Dostojewsky aber, nach Verlust seiner Standesrechte, auf vier Jahre Zwangsarbeit auf die Festung geschickt und danach als Gemeiner in den Felddienst eingereiht werde.
Echt Dostojewskysch ist jene Stelle in seinem „Tagebuche eines Schriftstellers“ aus dem Jahre 1873, wo er, auf diesen Tag zurückkommend, sagt: „Wir Petraschewzen standen auf dem Schaffot und hörten unser Todesurteil an, ohne die geringste Reue. Ich kann natürlich nicht für alle Zeugnis ablegen, allein ich denke mich nicht darin zu irren, dass damals, in jener Minute, wenn nicht alle, so doch mindestens die grosse Mehrzahl der Unseren es als eine Ehrlosigkeit betrachtet hätte, seine Überzeugung zu verleugnen .... Das Urteil, das uns zum Tode durch Füsilieren verurteilte, wurde uns durchaus nicht zum Scherz vorgelesen. Fast alle Verurteilten waren fest überzeugt, dass es vollstreckt werden würde, und verlebten mindestens zehn furchtbare Minuten der Todeserwartung. In diesen letzten Minuten stiegen manche von uns instinktiv in die Tiefe ihrer Seele hinab (ich weiss das bestimmt), und indem sie ihr noch so junges Leben in einem Augenblicke prüften, mochten sie wohl manch ein schweres Vergehen bereuen (von jenen, welche bei jedem Menschen sein ganzes Leben hindurch in den Tiefen des Gewissens ruhen); aber die Sache, um derentwillen wir verurteilt wurden, die Gedanken, die Anschauungen, welche in unserem Geiste walteten — sie stellten sich uns nicht nur als keine Reue herausfordernd dar, sondern sogar als etwas Reinigendes, als ein Märtyrertum, um dessentwillen uns vieles verziehen würde.“ Uns scheint diese klare Bezugnahme auf die „längstvergangene Geschichte“ ein sehr wichtiger Beleg für die Freiheit und Reinheit seiner „Umkehr“; denn hätte ihn Feigheit, Opportunität oder irgend eine Schwäche zu dieser sogenannten Umsattelung, die ihm die ehemaligen Parteigenossen und jüngeren Propagandisten vorwarfen, veranlasst, so würde er nicht nach 24 Jahren so kühn und frei seines überzeugten Handelns gedenken können. Ebenso frei spricht er sich direkt und später in allen seinen Werken in unzweideutiger Weise über seine Umkehr aus, am prägnantesten, wo er sagt: „Es ist uns recht geschehen mit dieser Verurteilung, sonst hätte uns das Volk verurteilt.“
Dieser Ausspruch bedürfte eines Kommentars, um von europäischen Lesern richtig aufgefasst zu werden, eines längeren und eingehenderen Kommentars, als unser Versuch einer Lebens-Erzählung rechtfertigen könnte, ja als er ihn leisten dürfte. Man muss als Ausländer mit Russland so vertraut sein, wie etwa Anatole Leroy-Beaulieu, um jene Beobachtungen historisch und psychologisch zu erhärten, welche auch dem „Gast auf eine Weile“ nicht entgehen und geeignet sind, dies Wort Dostojewskys zu erklären. Indessen müssen wir hier doch mit einigen Worten andeuten, welches Missverständnis die Anschauungen des Westens in die Beurteilung des russischen Volkes, in seine Wünsche für dasselbe hineintragen. Das Volk „mit dem ungeheuren Willen, mit dem ein Denker der Zukunft wird zu rechnen haben“, dieses Volk im Namen unserer verbrauchten Ideen, unserer Speisehaus-Ideale revolutionieren zu wollen, ist wirklich mehr als ein Verbrechen, es ist lächerlich. Ja, auch Reformen, einschneidende, im europäischen Sinne wahrhaft befreiende, Reformen von jener Stelle aus, die dem russischen Volke die heiligste ist, vom Kaiserthrone aus, würde es nicht verstehen, und einem Kaiser Josef auf dem Throne würde es einen passiven Widerstand leisten, der dräuender und gefährlicher wäre, als jede Revolution. Einmal, in Jahrhunderten vielleicht, wenn die breiten, schweren Massen zum Bewusstsein dieser „Kraft zu wollen“ kommen werden, nach einem Kulturwege, der ausser unserer Berechnung liegt (denn es ist höchst intelligent und beharrlich, ja hartnäckig daneben), da wird es seine eigene Revolution machen, seine Revolution innerhalb des Glaubens, und dem staunenden Europa etwas neues, erdfrisches als Frucht seiner Kultur in den Schoss werfen. Das Volk, von dem ein grosser Teil, bei aller kindlichen Liebe für sein Väterchen, den Zar für den Antichrist hält, und die vom Staate anerkannte Kirche für zu neu ansieht[6], ein solches Volk wurzelt in anderem Boden, als in dem verwitternden missverstandener Historien, und es bedarf heute und für alle Zeiten (das bedingt seine Lage) anderer Lebensquellen, als es deren, vom Wissen abgesehen, je bei uns finden könnte, Quellen, die es sich in seiner reichen Erde wird selbst auffinden müssen. Dann wird es wohl in ganz selbstverständlicher Weise in das Staatsleben eintreten und ein Wort mitsprechen bei der Entscheidung seines eigenen Geschickes.
Am besten beleuchten Thatsachen. Dass das russische Volk heute revolutionäre Bestrebungen auch wirklich richtet, beleuchtet unter anderem auch die Geschichte jenes Aufruhrs in Moskau im Jahre 1877, als man eine Partie Staatsgefangener von Kiew dahin brachte, um sie von da weiter an ihre Bestimmungsorte zu bringen. Die Moskauer Studenten vereinigten sich zu einer grossen Demonstration zu Gunsten der Gefangenen. Sie holten diese auf dem Bahnhofe ein und gaben ihnen das Geleite durch die Stadt. Als sie auf den grossen Marktplatz, den Ochotnyi rjad (alte Jägerzeile) kamen, da rottete sich das Marktvolk zusammen und fiel über die Studenten her. Es entstand ein blutiger Kampf, ein Gemetzel, das zwei Stunden währte, sich bis an den Abfahrts-Bahnhof hinzog und nur durch das Einschreiten der Polizei niedergeschlagen werden konnte. Die Moskauer Studenten, welche Dostojewskys „Tagebuch eines Schriftstellers“ kannten, wohl wussten, dass der Herausgeber dieses Blattes ein ehemaliger Student und „abgestrafter Staatsverbrecher“ sei, und volles Vertrauen in sein Urteil setzten, wandten sich mit der Bitte an ihn, er möge ihnen seine Anschauung über diese Sache in einem offenen Briefe mitteilen.
Was Dostojewsky den jungen Leuten in seinem Briefe aus Petersburg antwortet, ist zu charakteristisch, um nicht hier seine Stelle zu finden. Der Brief lautet:
„Petersburg, am 18. April 1878.
Sehr geehrte Herren Studenten.
Verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen so lange nicht antwortete; ausser meinem thatsächlichen Unwohlsein haben auch andere Umstände meine Antwort verzögert. Ich wollte Ihnen durch einen offenen Brief in den Tagesblättern antworten; allein es zeigte sich plötzlich, dass das aus Gründen, welche nicht von mir abhängen, unmöglich sei, wenigstens dass es unmöglich sei, ihn gebührend ausführlich zu beantworten. Zweitens dachte ich: wenn ich Euch nur schriftlich antworte, was kann ich Euch da beantworten? Eure Fragen umfassen alles — unbedingt das ganze interne Leben Russlands. Also ein ganzes Buch schreiben? — eine profession de foi?
Ich habe mich endlich entschieden, Euch dieses kleine Briefchen zu schreiben, auf die Gefahr hin, Euch im höchsten Grade unverständlich zu sein. Das aber wäre mir sehr unangenehm.
Ihr schreibt mir: Am allernötigsten ist es für uns, die Frage zu lösen, inwieweit wir selbst, die Studenten, schuldig sind, was für Schlüsse sowohl die Gesellschaft, als auch wir selbst aus diesem Geschehnis ziehen sollen?
Des weiteren habt Ihr die wesentlichsten Züge in den Beziehungen der heutigen russischen Presse zur Jugend sehr richtig und genau gekennzeichnet. In unserer Presse herrscht ersichtlich ein Ton „vorbeugender herablassender Entschuldigung“ (Euch gegenüber, heisst das). Das ist sehr richtig; ein namentlich vorbeugender, für alle Fälle nach einer gewissen Schablone vorher zurecht gelegter, schon sehr abgegriffener Occasionston.
Und weiter schreibt Ihr: Es ist klar, wir haben von diesen Leuten nichts zu erwarten, welche von uns nichts erwarten, sondern sich abwenden, um ihr unwiderrufliches Urteil den „wilden Völkern“ zu künden (dikim narotam).
Dies ist vollkommen richtig, namentlich sie wenden sich ab, ja und sie haben (die Mehrzahl wenigstens) gar nichts mit Euch zu schaffen. Allein es giebt Leute, und derer nicht wenige, sowohl in der Presse, als in der Gesellschaft, welche der Gedanke niederdrückt, dass die Jugend sich vom Volk entfernt hat (das ist die Hauptsache und das erste) und dann, d. h. jetzt, auch von der Gesellschaft. So ist es auch. Sie lebt in Träumereien und abstrakt, geht fremden Lehren nach, will nichts in Russland wissen und bemüht sich, ihrerseits Russland zu lehren. Zuletzt aber, jetzt, ist sie unzweifelhaft irgend einer ganz aussen stehenden (wnjeschnej) führenden, politischen Partei in die Hände geraten, die mit der Jugend schon so gut wie gar nichts zu schaffen hat und sie nur als Material und panurgische Herde für ihre äusserlichen und besonderen Ziele benutzt. Denkt nicht das zu leugnen, meine Herren; es ist so.
Ihr fraget, meine geehrten Herren: „inwiefern Ihr selbst, die Studenten, schuldig seid?“ Hier meine Antwort: Ihr seid, meiner Meinung nach, in gar nichts schuldig. Ihr seid nur Kinder derselben Gesellschaft, die Ihr jetzt hinter Euch lasset und welche „eine Lüge nach allen Seiten“ ist. Aber indem er sich von ihr losreisst und sie hinter sich lässt, wendet sich unser Student nicht zum Volke, sondern irgendwohin ins Ausland, in den „Europäismus“, in das abstrakteste Reich eines niemals dagewesenen Kosmopoliten, und bricht auf diese Weise auch mit dem Volke, indem er es verachtet und verkennt, als richtiger Sohn jener Gesellschaft, von der er sich ebenfalls losgerissen hat. Indessen aber ruht im Volke unser ganzes Heil (das ist aber ein langwieriges Thema) ... die Losreissung aber vom Volke kann ebenfalls nicht strenge in das Schuldbuch der Jugend gesetzt werden. Wie sollte sie denn, ehe sie lebte, das Volk erdenken (dodumatsoja do nawka)?
Dabei aber ist das allerschlimmste, dass das Volk die Losreissung der intelligenten russischen Jugend gesehen und bemerkt hat; und das schlimmere dabei ist, dass es die von ihm bemerkten jungen Leute Studenten nennt. Es hat schon lange begonnen sie zu beachten, schon zu Anfang der 60er Jahre; darum hat all dieses Ins-Volk-gehen beim Volke selbst nur Widerwillen erweckt.
„Junge Herrchen“, sagt das Volk (diese Benennung kenne ich; ich garantiere es Euch, es nannte sie so). Dabei aber besteht im wesentlichen ja ein Irrtum auch von Seite des Volkes, weil es noch niemals bei uns, in unserem russischen Leben eine solche Epoche gegeben hat, da die Jugend (gleichsam ahnend, dass ganz Russland auf einem Wendepunkt, über einem Abgrund schwankend stehe) in ihrer ungeheueren Mehrzahl mehr als jetzt aufrichtig, reinen Herzens, mehr nach Wahrheit dürstend, mehr als jetzt bereit war, alles, sogar das Leben für die Wahrheit und das Wort der Wahrheit hinzugeben; die wirkliche, die echte grosse Hoffnung Russlands. Dies fühle ich schon lange und habe schon seit langem begonnen darüber zu schreiben. Da, plötzlich, was kommt heraus? Dieses Wort der Wahrheit, wonach die Jugend dürstet, das sucht sie weiss Gott wo, auf seltsamen Stätten (darin ebenfalls mit der angefaulten Gesellschaft, die sie erzeugte, zusammentreffend), aber nicht im Volke, nicht im Heimatsboden. Es endigt damit, dass in einem gegebenen Augenblicke weder die Jugend, noch die Gesellschaft das Volk kennen werden. Anstatt mit seinem Leben zu leben, gehen die jungen Leute, nichts im Volke kennend, sondern, im Gegenteil, seine Grundlagen tief verachtend, zum Beispiel den Glauben, in das Volk — nicht um es zu studieren, sondern um es zu lehren, von oben herab, mit Geringschätzung — ein rein aristokratischer Herrenstreich! „Junge Herrchen“, sagt das Volk und es hat recht. Seltsam: überall und immer sind die Demokraten fürs Volk gewesen; nur bei uns hat sich unser intelligenter russischer Demokratismus mit den Aristokraten gegen das Volk verbündet; sie gehen ins Volk, „um ihnen Gutes zu thun“, und verachten dabei seine Sitten und seine Grundlagen. Geringschätzung führt nicht zur Liebe!
Im vorigen Winter, in Kasan, beschimpft ein Haufen junger Leute den Tempel des Volkes, raucht darin Zigarretten, macht Skandal. „Höret, würde ich diesen Kasanern sagen (ja ich habe es auch einigen ins Gesicht gesagt), Ihr glaubt nicht an Gott, das ist Euere Sache; warum aber kränkt Ihr das Volk, indem Ihr seinen Tempel beschimpft? Und das Volk nannte sie noch einmal „Jungherrchen“ (Bartschenki) und, schlimmer als das, gab ihnen den Namen „Studenty“, obwohl viele Hebräer und Armenier darunter waren (die Demonstration war, wie es sich erwies, eine politische, von aussen hineingetragene). So hat, nach der That der Sassúlitsch, unser Volk abermals die Revolvermänner der Strasse „Studenten“ genannt. Das ist hässlich, wenn auch ohne Zweifel Studenten dabei waren. Hässlich ist es, dass das Volk sich schon merkt, dass Hass und Zwietracht begonnen haben. Nun, und jetzt nennt Ihr selbst, meine Herren, das Moskauer Volk „Fleischer“, sowie die ganze intelligente Presse sie nennt. Was heisst denn das? Warum gehören Fleischer nicht zum Volk? Das ist Volk, wirkliches Volk, auch Minin war ein Fleischer.[7] Die Entrüstung lodert nur über die Art auf, wie sich das Volk geäussert hat. Aber wisset, meine Herren, dass, wenn das Volk gekränkt wird, es sich immer so äussert. Es ist ungehobelt, es ist ein Bauer. Gerade hier lag die Lösung des Missverständnisses, allerdings eines alten, angehäuften Missverständnisses (was sie nicht merkten) zwischen dem Volke und der Gesellschaft, d. h. jenem Teile der Gesellschaft, der am hitzigsten und flinksten zu seiner Lösung ginge — der Jugend. Die Sache ging allzu hässlich und durchaus nicht so regelrecht, wie sie hätte ausgehen sollen; denn mit den Fäusten kann man nie und nirgends etwas beweisen. So aber war es immer und überall, in der ganzen Welt beim Volke. Das englische Volk setzt auf seinen meetings gar oft die Fäuste gegen seine Gegner in Aktion, und in der französischen Revolution brüllte das Volk vor Freude und tanzte vor der Guillotine, während sie thätig war. Das ist alles, das versteht sich, abscheulich. Allein das Faktum ist dieses, dass das Volk (das Volk und nicht nur die Fleischer; da giebt es kein Sichtrösten mit einem oder dem anderen Wörtchen) gegen die Jugend aufgestanden ist und sich die Studenten angemerkt hatte; andererseits aber ist das Elend das (und das ist bezeichnend), dass die Presse, die Gesellschaft und die Jugend sich dazu vereinigt haben, das Volk nicht zu erkennen (ne usnatj naroda): „das ist ja nicht Volk, das ist Pöbel!“
Meine Herren, wenn etwas in meinen Worten ist, das nicht mit Euch übereinstimmt, so werdet Ihr besser daran thun, nicht böse zu werden. Es giebt ohnedies des Kummers genug. In der verfaulten Gesellschaft ist Lüge nach allen Seiten. Allein kann sie sich nicht halten. Fest und mächtig ist nur das Volk; allein im Volk hat sich seit den letzten zwei Jahren eine Dissonanz mit uns (raslad) gezeigt. Unsere Sentimentalen haben, indem sie das Volk vom Zustande der Hörigkeit befreiten, mit Rührung daran gedacht, dass es nun auch sofort in ihre europäische Lüge eintreten werde, in die Aufklärung, wie sie es nannten. Aber das Volk hat sich selbständig gezeigt und, was die Hauptsache ist, es beginnt mit Bewusstsein die Lüge der oberen Schichten des russischen Lebens zu begreifen. Die Ereignisse der letzten zwei Jahre haben es erleuchtet und neu gestärkt. Aber es macht einen Unterschied nicht nur unter seinen Feinden, sondern auch unter seinen Freunden. Es kamen traurige, quälende Fakten, die herzliche, ehrliche Jugend ging, nach Wahrheit strebend, ins Volk, um seine Leiden zu erleichtern. Aber was geschieht? Das Volk treibt sie fort und anerkennt ihre redlichen Bemühungen nicht, weil diese Jugend das Volk nicht für das nimmt was es ist, seine Grundlagen hasst und geringschätzt und ihm Arzneien reicht, die in seinen Augen roh und sinnlos sind.
Bei uns hier in Petersburg geht es zu, der Teufel weiss wie. Unter der Jugend wird der Revolver gepredigt und herrscht die Überzeugung, dass die Obrigkeit sie fürchtet. Indem sie das Volk aber nach wie vor gering schätzen, halten sie es für gar nichts und merken nicht, dass dieses sie wenigstens nicht fürchtet und niemals den Kopf verlieren wird. Was dann, wenn weitere Zusammenstösse erfolgen? Wir leben in einer schweren Zeit, meine Herren!
Meine Herren! Ich habe Ihnen geschrieben, was ich konnte. Wenigstens antworte ich offen, wenn auch nicht vollständig auf Euere Frage: nach meiner Meinung sind nicht die Studenten schuldig; im Gegenteil, niemals ist unsere Jugend aufrichtiger und ehrlicher gewesen (was kein kleines Faktum, sondern ein wunderbares, grosses, ein historisches ist). Allein das Übel liegt darin, dass unsere Jugend die Lüge der ganzen zwei Jahrhunderte unserer Geschichte auf sich trägt. Es fehlt ihr folglich die Kraft, die Sache in ihrer Ganzheit zu untersuchen, und man kann ihr keine Schuld beimessen; um so weniger, wenn sie plötzlich selbst als parteiische (und schon beleidigte) Teilnehmerin der Sache aufgetaucht ist. Allein, wenn auch die Kraft fehlt, glücklich sei derjenige, glücklich diejenigen, denen es auch jetzt noch gelingt, den rechten Weg zu finden! Die Losreissung vom Milieu muss bei weitem stärker sein, als z. B. nach der socialistischen Lehre die Trennung der künftigen Gesellschaft von der heutigen. Stärker, denn um in das Volk zu gehen und mit ihm zu bleiben, dazu gehört vor allem, dass man verlerne es zu verachten, und das ist unserer oberen Gesellschaftsschicht bei ihren Beziehungen zum Volke fast unmöglich. Zweitens muss man zum Beispiel auch den Glauben an Gott gewinnen, und das ist nun schon endgiltig unserem Europäismus nicht möglich (obgleich man in Europa an Gott glaubt).
Ich grüsse Euch, meine Herren, und wenn Ihr es gestattet, so schüttele ich Euch die Hand. Wenn Ihr mir ein grosses Vergnügen machen wollt, so haltet mich um Gotteswillen nicht für irgend einen Lehrer oder Prediger von oben herab. Ihr habt mich herausgefordert, die Wahrheit nach meinem Herzen und Gewissen zu sagen: ich habe sie ausgesprochen, wie ich sie dachte, wie ich sie zu denken vermag. Es kann ja niemand mehr thun, als seine Kräfte und Fähigkeiten es erlauben.
Ganz der Ihre
Theodor Dostojewsky.
Der Gedanke an eine so lange Zeit der Zwangsarbeit muss für Dostojewsky anfangs etwas Furchtbares gehabt haben. Eine andere Stelle des oben zitierten ersten Briefes nach seiner Verurteilung, der leider in Verlust geraten ist und nur in einzelnen Abrissen im Jahre 1881 in einer Zeitschrift abgedruckt wurde, lautet: „Besser wär’s, 15 Jahre mit der Feder in der Hand in den Kasematten; der Kopf, welcher geschaffen hat, welcher ein höheres Leben der Kunst in sich getragen, welcher sich an die erhöhten Bedürfnisse des Geistes gewöhnt hatte, er ist mir jetzt schon von den Schultern geschlagen.“ Beim Abschied vom Bruder, wozu man ihnen eine halbe Stunde gestattet hatte, war er der Ruhigere von Beiden, wie ein Freund berichtet, und sagte zum Bruder: „Auch im Strafhaus sind nicht wilde Tiere, sondern Menschen, vielleicht bessere als ich, vielleicht würdigere als ich ... Ja, wir werden uns noch sehen, ich hoffe es, ich zweifle nicht daran ... Schreibt ihr mir nur und schickt mir Bücher, ich werde euch schon schreiben welche; man wird ja lesen können. (Dies war wohl eine fromme Lüge, um den Bruder zu trösten.) Wenn ich aber heraus komme, so fange ich zu schreiben an ... in diesen Monaten habe ich viel durchlebt, und was werde ich erst in der Zeit, die vor mir ist, sehen und durchleben! es wird genug Stoff zum schreiben geben“.
Über die Beschwerden des langwierigen Transports nach Sibirien bei vierziggradigem Frost, über erfrorene Hände und Füsse, einen bösen Ausschlag, welcher infolge der verpesteten Luft im Kasematten-Gefängnis auf des Dichters Gesicht und in seinem Munde herausgetreten war, über die Unmöglichkeit, auf diesem langen Leidenswege einen Schluck Thee zur Erwärmung zu beschaffen, über das Benehmen der Aufseher und Zugführer, die schmutzigen, finsteren, engen Räume, in denen sie mit allerlei schimpfenden und fluchenden Verbrechern auf den Etappen zusammengepfercht waren, davon erfahren wir nichts durch ihn selbst — erst viele Jahre später bezieht er sich auf diese Zeit in seinem „Tagebuch eines Schriftstellers“, und nur in seinem Buche „Memoiren aus einem Totenhause“ hat er diese Leidensgeschichte mit künstlerischer Vollendung, als die Erzählung einer dritten Person herausgearbeitet. Tolstoj nennt in einem Briefe dieses Buch „das beste, das bis nun in Russland geschrieben worden, Gogol nicht ausgenommen.“ Der Dichter wurde später in Russland oftmals aufgefordert, einige Kapitel aus diesem Buche in Gesellschaft vorzulesen. Er that es immer sehr ungern und lehnte es ab, wo es nur anging, weil es ihm peinlich war, dass man dies „als eine Anklage betrachten könnte“.
Von den oben erwähnten Mühsalen haben wir durch einen Leidensgenossen Kunde, J. L. Jastrzembski, welcher sehr eingehend über diese Erlebnisse berichtet hat. Er fügt das Bekenntnis hinzu, er habe schon in Petersburg gewisse Vorbereitungen getroffen, allen Qualen ein Ende zu machen, und sei fest entschlossen gewesen, dieses Vorhaben auszuführen. Die nähere Bekanntschaft mit Dostojewsky aber, sein sanftes Wesen, der stille, eindringliche Ton seiner Stimme habe so heilend auf ihn gewirkt, dass er seine selbstmörderischen Gedanken von da an für immer von sich gewiesen habe.
Eine Episode vom Etappenwege erwähnt Dostojewsky ausser in den „Memoiren aus einem Totenhause“ in seinem „Tagebuch eines Schriftstellers“ aus dem Jahre 1873 eingehender, weil sie einen sehr nachhaltigen Einfluss auf ihn ausgeübt hat. Es heisst da: „Als wir in Tobolsk in Erwartung einer nachkommenden Partie im Festungshofe sassen, erbaten sich die Frauen der Dezembristen (der Teilnehmer an der 1825 von Netschajew geleiteten Verschwörung) beim Gefängnis-Direktor die Erlaubnis, in seiner Wohnung eine Zusammenkunft mit uns zu veranstalten. (Es waren dies, nach den Worten Jastrzembskis, die Frauen Murawiew, Annenkow mit ihrer Tochter und von Wisin, welche den Sträflingen auch ein ausgesuchtes Mittagessen mit Weinen vorsetzten.) Da sahen wir also diese grossen Dulderinnen, welche ihren Gatten freiwillig nach Sibirien gefolgt waren ... Selbst in gar keine Schuld verwickelt, haben sie in langen 25 Jahren alles ertragen, was ihre verurteilten Gatten hatten ertragen müssen. Unser Beisammensein dauerte eine Stunde. Sie segneten uns zu unserem weiteren Weg, machten das Zeichen des Kreuzes über uns und beschenkten jeden von uns mit einem Evangelium — dem einzigen Buche, welches im Gefängnis erlaubt war. Vier Jahre hat es unter meinem Kopfkissen im Strafhaus gelegen. Ich habe darin gelesen, manchmal auch anderen daraus vorgelesen. Ich habe auch einen Sträfling aus diesem Buche lesen gelehrt.“
Wenn wir uns ein genaues Bild von dem äusseren Leben des Dichters während der vier Jahre der Zwangsarbeit machen wollen, müssen wir uns eben an die detaillierten Schilderungen halten, welche in den „Memoiren aus einem Totenhause“ niedergelegt sind. Sie sind bis in alle Einzelheiten so drastisch, so klar und zwingend, dass wir sofort wissen: all dies ist wirklich erlebt; dabei sind sie so vollendet künstlerisch und objektiv, ja fast feindesliebevoll herausgearbeitet, dass wir sofort empfinden, das ist eigenartig, es ist echt Dostojewskysch erlebt. Hier drängt sich uns Deutschen unwillkürlich eine Parallele auf, die sich wie ein Einwand geberdet. Wir denken an Fritz Reuters Schilderungen seiner siebenjährigen Festungszeit, eine Schilderung, die sich zum Humor erhebt, und sind geneigt, ein solches Fertigwerden mit schweren persönlichen Erlebnissen künstlerisch, ja ethisch höher zu stellen. Bei tieferer Fassung des Problems stellt sich die Sache jedoch durchaus anders dar. Ganz abgesehen davon, dass Fritz Reuter nur mit Seinesgleichen eingeschlossen war, Stunden des Alleinseins und wieder solche des Gedankenaustausches mit Gleichgesinnten hatte, während Dostojewsky mit ungefähr 200 Verbrechern aller Kategorien vom Falschspieler und Falschmünzer angefangen bis zum achtfachen Mörder in ununterbrochener Gemeinschaft lebte und während seiner vierjährigen Haft auch nicht eine Stunde des Alleinseins haben konnte, liegt im inneren Erleben des ähnlichen äusseren Schicksals ein grosser Unterschied. Dostojewsky erlebte alles intensiv, ganz subjektiv, aber doch eigentlich gleichsam unpersönlich; für die Menschheit und zu ihrem Wohle. Er war sich selbst ein Gefäss für die grosse Wahrheit, die ihm das Leben offenbarte, ein Brunnen, der diese Wahrheit unaufhörlich hervorsprudeln musste. Da ihm aber nun, wie wir in seinen Aufzeichnungen sehen, gerade in dieser schwersten Lebenszeit die grosse Wahrheit, seine und „seines Volkes Wahrheit“ durch diese Verbrecherwelt aufgegangen war, sich erst da deutlich formuliert hatte, was als Ahnung von Anbeginn in ihm gelegen und sich in den „Armen Leuten“ ausgesprochen hatte, so handelte es sich für ihn gerade von da an um den heiligsten Ernst seines Apostolats, und wir sehen ihn gerade von da an seine humoristische Ader versiegen lassen, im Vollgefühl dessen, dass der Humor für die grössten Aufgaben und Probleme nicht ausreicht. Ganz charakteristisch ist es jedoch, wie sich diese reiche Ader jedesmal zu Tage drängt, wo der schweren Nötigung, seinen Hörern in Wort und Bild die Wahrheit aufzuzwingen, gleichsam Genüge geschehen ist, und sich der alte Schalk kichernd zwischen den schweren Falten der Wirklichkeit hervorwagt. Es ist eben die unbesiegbare Kraft und Macht seines künstlerischen Reichtums, der immer wieder hervorbricht.
Die Herausgeber der „Materialien“, namentlich O. Miller, schöpften bei der Schilderung dieses Lebensabschnittes des Dichters aus der einzig authentischen Quelle, die wir oben anführten: den „Memoiren aus einem Totenhause“. Sie schöpfen das Richtige heraus, mit Wärme, Bewunderung, Ehrlichkeit und — Geschick. Denn es ist wohl nicht leicht, heute als Russe ein erlaubtes Buch zu schreiben, das die krasse Barbarei russischer Zustände hervorhebt, das dem Dulder zugleich und dem Peiniger „gerecht“ wird. Es ist dies umso schwerer, als der Biograph, sowie er sich an die künstlerische Objektivität seines Gewährsmannes hält, welcher hier Dostojewsky heisst, sich leicht an dem Gepeinigten versündigt, in dessen Ton er nicht einfallen, dessen Objektivität er nicht zur seinen machen kann noch darf. O. Miller hat sich bei Beginn seiner Schilderung, wie schon gesagt, mit Geschick aus der Schwierigkeit gezogen, und wir fügen hier die Stelle ein, welche gleichsam als Passepartout für alles Gräuliche und Qualvolle gelten kann, dem er in derselben doch Eingang verschaffen will. Er erzählt, Dostojewsky habe auf eine Anfrage vom Auslande eine biographische Skizze diktiert, wo es unter anderem heisst: „Die „Memoiren aus einem Totenhause“ sind von ganz Russland gelesen worden und werden bis auf den heutigen Tag sehr hoch geschätzt, obwohl die Gepflogenheiten und Sitten, welche in diesen Memoiren beschrieben wurden, in Russland schon lange abgeändert sind.“ „Theodor Michailowitsch“ — fährt O. Miller fort — „fand es für nötig, im Auslande auf diese Veränderungen hinzuweisen und sie hier mit allen jenen mannigfaltigen Änderungen in Verbindung zu bringen, die wir dem Kaiser Alexander Nikolajewitsch verdanken. Schon allein die Drucklegung der „Memoiren aus einem Totenhause“ wäre vor der Regierung Alexanders II. undenkbar gewesen. Eine mit vernichtendem Realismus ausgeführte Beschreibung eines eben erst unter den Stockstreichen hervorgekommenen Menschenrückens, wie ihn Dostojewsky im Festungshospital gesehen, konnte man nur unter einem Kaiser wagen, welcher die Stockschläge abgeschafft hatte.“ Nach diesem Eingange, welcher für uns die Konjektur offen lässt, wie weit die Gepflogenheiten einer willkürlichen Bureaukraten-Verwaltung und die Handhabung auch des mildesten Gesetzes durch rohe Subalterne heute noch diesem thatsächlich entspricht,[8] ist es dem Biographen möglich geworden, die furchtbaren Episoden dieses Gefängnislebens aus den Schilderungen der Memoiren herauszuheben und dadurch die Wunden schärfer, brennender zu zeigen, die sie dem Dichter schlugen, als dieser selbst es je gethan hätte.
Wir können auch hier den Aufzeichnungen O. Millers folgen, der zumeist des Dichters eigene Worte anführt.
„Ich erinnere mich deutlich daran — sagt Dostojewsky — dass mir vom ersten Schritte in diesem Leben das auffiel, dass ich darin gleichsam nichts Auffallendes, nichts Aussergewöhnliches, oder besser gesagt, nichts Unerwartetes finden konnte .... es schien mir, als sei es viel leichter im Gefängnis zu leben, als ich mir dies auf dem Wege dahin vorgestellt hatte. Selbst die Arbeit erschien mir nicht so schwer, nicht so zwangsarbeitsmässig, und erst ziemlich viel später kam ich darauf, dass die Schwere und Zwangsarbeitsmässigkeit dieser Arbeit nicht so sehr in ihrer Mühsal und Ununterbrochenheit liege, als darin, dass sie eine gezwungene, aufgenötigte, vom Stock dirigierte Arbeit war.“
„Zur zweiten Kategorie von Strafarbeitern, in welcher sich Dostojewsky befand, gehörten Arrestanten“ — fährt O. Miller fort —, „welche unter kriegsrechtlicher Aufsicht standen, und diese Kategorie war, nach seinen eigenen Worten, unvergleichlich schwerer und strenger gehalten, als die anderen zwei Arbeits-Abteilungen, nämlich die dritte, die beim Bau, und die erste, die in den Bergwerken arbeiteten. Diese Arbeit war nicht nur für die Edelleute schwer, sondern für alle Arrestanten, besonders darum, weil Kommando und Organisation ganz militärisch und denjenigen der Arrestanten-Rotten in Russland sehr ähnlich waren ... immer in Ketten, immer unter Bedeckung, immer unter Schloss und Riegel. In den zwei anderen Abteilungen aber war das nicht in solchem Masse durchgeführt ... die ersten drei Tage stellte man die Neuangekommenen noch nicht an die Arbeit; später aber hatten sie viel unter dem Vorwurf zu leiden — und das nicht von der Obrigkeit, sondern von den Gefährten, dass sie diesen nicht ordentlich zu helfen vermochten, da sie nicht so viel Kraft besassen als sie.“ „Was mich anbelangt, erwähnt Theodor Michailowitsch, so habe ich einen besonderen Umstand bemerkt: wo immer ich auch zugriff, um ihnen bei der Arbeit zu helfen, überall war ich ihnen im Wege, überall störte ich sie, überall jagten sie mich mit Thätlichkeiten davon.“ Nichtsdestoweniger fühlte er, dass die Arbeit ihn retten, seine Gesundheit, seinen Körper stärken könne. Die Hauptarbeit, zu welcher Dostojewsky verwendet wurde, war das Brennen und Stossen des Alabasters, was ihm eigentlich leicht erschien. „Eine andere Arbeit, zu der man mich beorderte,“ sagt er weiter, „war in der Werkstätte das Drehen des Schleifsteines; das war schon eine schwerere Sache, aber sie verschaffte eine vortreffliche Motion.“ Eine Arbeit, die er besonders zu verrichten liebte, war das Schneeschaufeln, wie denn überhaupt die Winterbeschäftigungen leichter waren als jene, die man im Sommer vornahm. Im Sommer musste man durch ungefähr zwei Monate täglich von dem Ufer des Irtisch bis zu dem etwa siebzig Klafter davon entfernten Bau einer neuen Kaserne über den Festungswall hinüber Ziegel tragen. „Diese Arbeit,“ sagt Dostojewsky, „gefiel mir sogar, obwohl der Strick, an dem man die Ziegel tragen musste, mir immer die Schultern wund rieb. Aber mir gefiel das, dass sich meine Kraft in der Arbeit augenscheinlich entwickelte.“ Anfangs war er nur imstande, acht Ziegel zu zwölf Pfund ein jeder, zu tragen, später aber brachte er es zu zwölf und fünfzehn. „Physische Kraft“, fährt er fort, „ist im Gefängnis nicht weniger nötig, als moralische, um alle materiellen Beschwerden dieses verfluchten Lebens zu ertragen.“
Die Kost, meint Dostojewsky, war erträglich, das Brot sogar in der Stadt geschätzt; dafür war die Kohlsuppe sehr dünn und wimmelte von Küchenschaben. Wer ein paar Groschen eigenes Geld haben und es vor Diebereien der Mitgefangenen oder der Konfiskation durch die Aufseher schützen konnte, war in der Lage, sich seine Kost durch kleine Beigaben von Thee usw. aufzubessern.
Wenn die unmittelbar Vorgesetzten den Edelleuten unter den Sträflingen, da sie von Haus aus von zarter Konstitution und verwöhnter waren, gewisse Erleichterungen verschaffen wollten, sie zum Beispiel als Schreiber in die Kanzleien kommandierten, so gab es so viele Kabalen, Intriguen und Angebereien ringsherum, dass eine solche Besserung ihres Loses niemals länger als Tage anhielt.
Das ganze erste Jahr seines Eingeschlossenseins war nach den Worten des Dichters das furchtbarste Jahr seines Lebens. Jene Wandlung, welche sich in ihm der Anlage seines Wesens nach einheitlich vollziehen sollte, nämlich das völlige Aufgehen in der Volksseele, ging nicht ohne bittere Schmerzen, Enttäuschungen und Demütigungen gerade von Seiten jener vor sich, die er ans Herz drücken wollte. Die gemeinen Verbrecher rechneten ihn, den Edelmann, wie sehr er sich auch zu ihnen gesellte, wie sehr er aller Lasten dieses „verfluchten Lebens“ mit ihnen gleich teilhaftig war, nicht zu den ihrigen, sie begegneten ihm mit Widerwillen, Misstrauen. Als er mit einigen anderen „Politischen“ sich ihnen einmal anlässlich einer allgemeinen Pretensija, das heisst Generalklage, wegen der schlechten Kost anschloss, so sagte einer von ihnen, der ihm etwas geneigter war: „ja warum schliesst Ihr Euch denn der Klage an? Ihr esst ja doch vom Eigenen?“ — „Ach mein Gott! auch unter Euch giebt es ja solche, die vom Eigenen essen und haben sich doch angeschlossen — nun und da mussten wir doch auch — aus Kameradschaft.“
„Ja, was seid Ihr denn für Kameraden?“ fragte er erstaunt.
„Ich dachte“, fährt der Dichter fort, „ob nicht irgend eine Ironie, ein Zorn, ein Spott in diesen Worten liege — aber nein, einfach: keine Kameradschaft, weiter nichts.“
Dass aber Dostojewsky diese Kameradschaft mit gemeinen Verbrechern angestrebt hat, kann uns nicht wundernehmen, wenn wir seine sich immer vertiefende Überzeugung von der Generalschuld der Menschheit bedenken, an der er seinen eigenen Anteil immer klarer empfand, jenes echt russische, doch ihm allein in so hohem Masse eigene Schuldgefühl, das jedoch mit der greisenhaften Askese Tolstojs ebensowenig gemein hat, als mit einem jener Zustände, die sich beim Katholiken dem Schuldgefühl anschliessen: entweder fanatische Härte gegen sich und andere, oder die schwelgerische Zerknirschung, welche sich mit dem Bekenntnis loskauft, um aufs neue in Schuld und Schuldgefühl zu schwelgen. Dostojewskys „Schuld an allem und an allen“, wie er sich ausdrückt, ruft zum Leben, zur Liebe und zur That auf — das ist die grosse Trennungslinie zwischen seinem, dem russischen, Christentum und jenem aller anderen Völker, die auf diesen Namen hören. Er musste es also schwer empfinden, wenn die „Unglücklichen“, wie er seine Brüder nennt, seine Kameradschaft nicht anerkennen wollten. Auch fand er anfangs Hindernisse in sich selbst. „Ich schloss die Augen,“ sagt er, „und wollte nicht schauen; unter den bösen und gehässigen Gefährten des Strafhauses bemerkte ich die guten nicht, die, welche fähig waren zu denken und zu fühlen, ungeachtet der höchst widerwärtigen Rinde, die sie von aussen bedeckte. Unter den bissigen Worten bemerkte ich manchmal gar nicht das freundliche, entgegenkommende Wort, das um so kostbarer war, als es ja ohne jegliche Absichten ausgesprochen, manchmal direkt aus einer Seele kam, welche vielleicht mehr gelitten und ertragen hatte, als ich.“
Später erst, je tiefer er sich in sich selbst versenkt hatte, gewahrte er immer mehr die anderen. „Du meinst,“ sagt er an anderer Stelle, „das sei ein Tier und kein Mensch ... plötzlich aber kommt zufällig eine Minute, da sich seine Seele unwillkürlich, durch etwas hingerissen, nach aussen offenbart, und du erblickst einen solchen Reichtum, ein solches Gefühl, ein Herz, ein so klares Begreifen eigener und fremder Leiden, dass dir förmlich die Augen aufgehen und du im ersten Augenblicke sogar deinen Augen und Ohren nicht traust.“ In seinem „Tagebuch eines Schriftstellers“ des Jahrgangs 1873 bespricht er immer noch diese Epoche seiner Wiedergeburt, seiner „Umwandlung“, wie er es nennt, seines Fortschreitens in der in ihm von Anbeginn gezeichneten Richtung, wie wir es nennen müssen. Für ihn wurzelt diese Umwandlung im unmittelbaren Kontakt mit dem Volke, in der brüderlichen Vereinigung mit ihm, im Gleichwerden mit ihm, ja mit seiner niedersten Stufe. „Dies vollzog sich nicht so schnell,“ sagte er, „sondern allmählich und nach einer sehr langen Zeit. Es wäre mir sehr schwer, die Geschichte meiner Wiedergeburt zu erzählen.“ — Doch hat er sie uns ja ausführlich in seinen „Memoiren aus einem Totenhause“ erzählt.
Sehr bezeichnend für sein rein demokratisches Verhalten ist auch ein Ausspruch aus seinen letzten Lebensjahren, den wir in seinem Notizbuche finden. Es heisst da: „Liebet das Volk, aber nicht indem ihr es zu euch erhebt, sondern indem ihr selbst zu ihm hinabsteigt.“
Dass Dostojewsky nicht nur theoretisch diese Lehre verfocht, sondern sie in jedem Detail gelebt hat, beweisen tausend kleine Episoden aus seinem Gefangenenleben — so die seltsame Freude, von einem vorübergehenden Mädchen die milde Gabe von einer Kopeke zugesteckt zu bekommen, die durchgekostete Erniedrigung, wenn die Sträflinge, wie immer, in Ketten geschmiedet und geschoren zur Messe geführt wurden und nur gedrängt vor der Kirchenthüre bleiben durften, wo sie vor der übrigen Gemeinde als Gebrandmarkte dastanden, gefürchtet, gemieden, als die allerniedersten Geschöpfe bemitleidet, wie er es wohl in der Kinderzeit mit den Leibeigenen gehalten hatte, die sich auf dem väterlichen Gütchen vor die Kirchenthüre drängten, während er als „Herrschaft“ im Betstuhle sass. Die Qualen rein physischer Natur, die er selbst ertragen oder andere ertragen sehen musste, namentlich solche, die sich mit Ekel verbanden, waren wohl schwerer hinzunehmen: das Schlafen auf den harten Pritschen, oft zu hundert in die dumpfigen Säle gedrängt, wo die Luft durch die hier angebrachten Nachtstühle verpestet war; das gräuliche Dampfbad, in das sie auf Kommando gepfercht wurden und worin sie in erstickendem Qualm und ohne sich eigentlich bewegen zu können, sich kunstvoll ihrer Wäsche entledigen mussten, natürlich auch ohne die an die Beine geschmiedeten Ketten zu lösen. Diese Prozedur erinnert lebhaft an die sogenannten Geduldspiele, wo man eine Stahlschlinge aus einer Stahlkette herausbringen soll, ohne den dadurch gebildeten Ring zu zerstören. Wollten die Sträflinge nach Monaten solcher Qualen ein wenig aufatmen, so nahmen sie ihre Zuflucht zur Krankenmeldung, weil sie im Hospital doch gewisse Erleichterungen, etwas mehr physische Ruhe und einen gewissen Scenenwechsel hatten. Hier aber erwartete sie der furchtbare Schlafrock. Sie mussten nämlich das durch Krankheit, Alter und alle Unreinlichkeiten früherer Häftlinge besudelte und übelriechende, nie gereinigte Krankengewand anlegen. Sie wussten das sehr wohl und meldeten sich dennoch dazu. Aber noch Schwereres mussten sie im Spital ertragen: den Anblick der halbtot Hineingeschleppten, welche eben die schweren Körperstrafen hatten erdulden müssen, 50 — 100 — 150 Stockschläge, unter denen sie mit zerbrochenen Gliedern und zerfetztem Fleische zusammengesunken waren. Der grausame Platz-Major, welcher zu jener Zeit im Strafhaus amtierte und bei jeder Gelegenheit wutbebend kreischte: „Ich bin euer Kaiser, ich bin euer Gott,“ er verhängte die schwersten Körperstrafen für den leisesten Widerspruch. So liess er einem der Edelleute 100 Rutenstreiche geben, weil dieser gesagt hatte: „Wir sind keine Vagabunden, sondern politische Gefangene.“ „Hun — dert — Strei — che, gleich diesen Augenblick!“ schrie in wahnsinniger Wut der „Gott“ des Strafhauses. Der „alte Mann“ (er war über fünfzig Jahre alt) legte sich ohne Widerrede unter die Rutenstreiche, biss sich die Zähne in die Hand und ertrug die Strafe, ohne einen Laut von sich zu geben oder sich zu rühren. Das imponierte den gemeinen Sträflingen überaus und sie begannen von da ab, ihn hochzuschätzen, obwohl er ein Edelmann und noch dazu ein Pole war. Auch das gefiel ihnen, dass er sofort nach der Rutenstrafe zum Gebet ging.
Dessenungeachtet hebt Dostojewsky ganz besonders hervor, dass die Wirtschaft dieses Platz-Majors ein vereinzelter Fall gewesen sei; „man kann ja auch an einen schlechten Menschen kommen,“ meint er. „Die anderen, höheren Vorgesetzten benahmen sich meist human; erstens,“ erläutert er, „sind sie selbst Edelleute, zweitens war es schon früher manchmal vorgekommen, dass einige von den Edelleuten unter den Sträflingen sich nicht unter die Rutenhiebe legten, sondern sich auf die Vollstrecker warfen, worauf dann entsetzliche Dinge entstanden.“
Dass ein solches Leben, die selbstgetragenen Beschwerden und das Beiwohnen solch unmenschlicher Züchtigungen Dostojewskys Gesundheit, die schon vorher nicht sehr stark gewesen war, untergraben musste, ist ganz klar, auch ohne die Annahme, dass er selbst körperliche Züchtigungen hätte müssen über sich ergehen lassen. Diese Annahme wurde von vielen ausgesprochen, und die Entwickelung seines schweren Nervenleidens, der Epilepsie, davon hergeleitet. Indessen erklären seine Freunde und Bekannten aus jener Zeit, dass er niemals einer körperlichen Züchtigung unterworfen worden sei, und finden im Zusehen und inneren Erleben einen ganz genügenden Grund für die Steigerung seiner psychisch-physischen Krankheit, welche er selbst übrigens lange nicht als das hatte erkennen wollen, was sie war.
Das letzte Jahr seiner vierjährigen Haft verlebte er in fieberhafter Aufregung. Er hatte schon einige Erleichterungen erlangt, durfte Bücher lesen, an seine Angehörigen schreiben usw. Dennoch konnte er im Sommer den Herbst, im Herbst den Winter kaum erwarten. Da er nämlich zur Winterzeit angekommen war, so konnte seine Freilassung auch nur zur selben Jahreszeit stattfinden. „Mit welcher Ungeduld,“ sagt er, „erwartete ich den Winter, mit welcher Wonne sah ich zu Ende des Sommers, wie das Blatt auf dem Baume verwelkt und das Gras der Steppe verbleicht!“ Die allerletzte Zeit aber war wieder eine sehr ruhige für ihn; je näher der Tag der Befreiung herankam, um so geduldiger wurde er. Die letzten Stunden seines Aufenthaltes in der Strafkaserne brachte er damit zu, noch einmal um das Gebäude herumzugehen und die Pfähle des Pallisadenzauns zu zählen, wie er in den ersten Tagen seiner Gefangenschaft an diesen Pfählen die Tage seiner Haft abgezählt hatte. Der Abschied von den Genossen war ein sehr verschiedenartiger. Die einen drückten ihm herzlich die Hand, einige sogar freundschaftlich und gerührt, aber doch wie einem „Herrn“, manche wendeten sich ab, um einem Abschied auszuweichen, andere wieder blickten ihm gehässig nach; auf dem Antlitz aller aber lag unverhohlen der Gedanke ausgedrückt — „von morgen an bist du nie unter uns gewesen.“
Orest Miller setzt in seinen „Materialien“ die Enthaftung Dostojewskys auf den 2. März 1854. Indessen geht aus den Dokumenten, welche uns in den Archiven der III. Abteilung bereitwilligst vorgelegt wurden, hervor, dass Durow und Dostojewsky laut Verordnung des General-Adjutanten Grafen Orloff an das Kriegsministerium vom 17. November 1853 (No. 1920) „am Tage ihrer Enthaftung, dem 23. Januar 1854, in die Truppen des sibirischen Corps eingeteilt werden sollen.“
Auch in Bezug auf die ersten Briefe des Dichters an seine Angehörigen sind die „Materialien“ noch nicht genügend informiert. Seit der Abfassung derselben, 1883, also zwei Jahre nach des Dichters Tode, haben sich mehrere Briefe teils in den Händen der Familie vorgefunden, welche auch schon teilweise in verschiedenen Blättern durch die Witwe veröffentlicht worden sind; so ein Brief vom 22. Februar und, da dieser unbeantwortet blieb, ein zweiter vom 27. März. (Michael hatte ihm, nach Aussage der Witwe, während der ganzen Strafzeit nicht geschrieben, sowie sich die ganze Familie, wohl aus Furcht „sich zu kompromittieren“, die ersten Jahre seiner Strafzeit wenig um ihn kümmerte.) Ferner haben wir, gleichfalls in den Archiven der III. Abteilung die Belege dafür gefunden, dass vom 16. März 1854 bis zum 11. September 1856 neunzehn Briefe Theodor Michailowitschs an seinen Bruder, seine Angehörigen und andere Personen durch das Corps-Kommando in Sibirien an den nunmehrigen Chef der kaiserlichen Kanzlei, Generallieutenant Dubelt, zur Beförderung an ihre Adresse übermittelt worden sind. Ob die Witwe des Dichters, welcher diese Daten mit uns zur Verfügung gestellt wurden, in ihrer unermüdlichen Arbeit, ihres Gatten Briefe und Manuskripte zu sammeln, in diesem Falle durch Erfolg belohnt werden wird, das wird die Zeit lehren. Der erste Brief nach der Enthaftung und Einreihung Dostojewskys (in das 7. Linien-Infanterie-Bataillon des sibirischen Corps), den wir kennen, ist vom 27. März 1854 an den Bruder datiert. Wir entnehmen ihm folgende Stellen:
„Ich eile Dir mitzuteilen, mein teurer Freund, dass ich Deinen Brief samt der Einlage von 50 Rubeln in Silber erhalten habe, wofür ich Dir herzlich danke. Ich wollte Dir auch gleich antworten, habe aber die Post versäumt. Verzeihe und strafe mich nicht dafür. Ich hoffe, mein Teurer, dass Du mir jetzt öfter schreiben wirst. Wisse, dass Deine Briefe mir ein wahrer Feiertag sind; darum: sei nicht faul! Wir haben einander ja so lange nichts geschrieben! Hast Du mir denn nicht schreiben können? Das ist für mich sehr seltsam und bitter. Vielleicht hast Du nicht selbst um die Erlaubnis gebeten; Briefe sind aber erlaubt, ich weiss das sicher. Übrigens wirst Du jetzt nicht meiner vergessen, nicht wahr?“ Nach einer warmen Nachfrage um die Angehörigen und ihre Kinder, deren er jedes beim Namen nennt, spricht er seine Freude darüber aus, dass der Bruder einen Erwerbszweig gefunden habe, der ihn beschäftigt. Michael Dostojewsky hatte nämlich kurz vorher eine Zigarretten-Fabrik errichtet, wovon Theodor durch die Annoncen Nachricht erhalten hatte. „Du hast Familie, ein Auskommen ist Dir unumgänglich nötig, verdiene es Dir, verstärke Deine Thätigkeit, wenn Du kannst. Mit einem Wort, lass nicht fallen, was Du begonnen hast.“
„Du gratulierst mir zu meinem Austritt aus dem Strafhause und es bekümmert Dich, dass ich im Hinblick auf meine schlechte Gesundheit nicht um die Einreihung in die eigentliche Armee ansuchen kann. Meine Gesundheit würde ich indessen nicht beachten, darin liegt es nicht. Aber habe ich denn ein Recht anzusuchen? Die Versetzung in die Armee ist eine Allerhöchste Gnade und hängt vom Willen des Kaisers selbst ab. Darum kann ich nicht selbst darum bitten. Wenn das nur von mir abhinge! Vorläufig lerne ich den Dienst, gehe zum Unterricht und rufe mir das Alte zurück. Meine Gesundheit ist ziemlich gut und hat sich in diesen zwei Monaten sehr gebessert; da sieht man, was es heisst, aus der Enge, der Stickluft und der schweren Unfreiheit herauskommen; das Klima ist ziemlich gesund. Hier beginnt schon die kirgisische Steppe. Die Stadt ist ziemlich gross und bevölkert, Asiaten giebt es eine Menge. Rings die offene Steppe. Der Sommer ist lang und heiss, der Winter ist kürzer als in Tobolsk und Omsk, aber streng. Von Vegetation keine Spur, kein Bäumchen — die nackte Steppe. Einige Werst von der Stadt entfernt ist ein Fichtenwäldchen, eins auf viele Dutzend, ja hunderte von Werst. Da ist immer nur Tanne, Fichte oder Silberweide, andere Bäume giebt es da nicht. — Wild die Menge. Es giebt einen ordentlichen Markt, aber die europäischen Waren sind so teuer, dass man nicht an sie heran kann. Einmal werde ich Dir detaillierter über Semipalatinsk schreiben; es lohnt die Mühe. Jetzt aber will ich Dich um Bücher bitten, schicke mir welche, Bruder — keine Zeitungen; aber schicke mir europäische Historiker, Ökonomisten, Kirchenväter, womöglich alle alten (Herodot, Thukydides, Tacitus, Plinius, Flavius, Plutarch und Diodor usw.; sie sind alle ins Französische übersetzt). Endlich den Koran und ein deutsches Lexikon. Natürlich nicht alles auf einmal, sondern was Du eben kannst. Schicke mir auch Pissarews Physik und irgend eine Physiologie (sei’s auch eine französische, wenn sie russisch zu teuer ist). Suche die billigsten und gedrängtesten Ausgaben aus. Nicht alles auf einmal, langsam nach einander. Auch für weniges werde ich Dir dankbar sein. Begreife, wie nötig mir diese geistige Nahrung ist! Übrigens brauche ich Dir ja nichts zu sagen. Lebe wohl, mein Teurer! Schreibe öfter. Um Gottes willen vergiss nicht
Deinen Th. Dostojewsky.“
Diese Briefe aus Sibirien, welche in dem Zeitraume von 1854-1859 geschrieben wurden, deren Mehrzahl, wie wir sahen, durch das Corps-Kommando und die Generaladjutantur ihren Weg an die Adressaten nahmen, geben uns dennoch einige Auskunft über des Dichters Stimmung, über sein gegenwärtiges Leben und seine Zukunftspläne. Der nächste Brief an den Bruder ist vom 30. Juli 1854 datiert. Er entschuldigt sich über sein langes Schweigen in folgender Weise: „Ich versichere Dir, mein Teurer, dass ich bis auf diesen Augenblick fast gar keine Zeit zum Schreiben hatte; und schliesslich, wenn es auch einige freiere Minuten gab, so verschob ich das Schreiben absichtlich auf eine günstigere Zeit, immer hoffend, dass diese bald kommen werde, denn ich wollte Dir nicht in Abrissen und in Eile schreiben. Du weisst natürlich oder kannst es ja erraten, womit ich jetzt beschäftigt bin. Exerzieren, Musterungen der Brigade- und Divisions-Kommandanten und Vorbereitungen dazu. Ich bin im März hierher gekommen (nach Semipalatinsk). Vom Liniendienst hatte ich so gut wie gar nichts gewusst, bin aber doch im Juli bei der Musterung in Reih und Glied gestanden und habe meine Sache nicht schlimmer gemacht als die anderen.“
Weiter schreibt er: „Wie fremd Dir auch all dieses sein möge, so denke ich doch, Du wirst begreifen, dass das Soldatenleben kein Spass ist, dass es mit all seinen Verpflichtungen kein leichtes ist, für einen Menschen mit meiner Gesundheit und einen, der alles dessen so entwöhnt ist .... Ich murre nicht, dies ist mein Kreuz und ich habe es verdient“. Im weiteren Verlauf des Briefes spricht er liebevoll von den Schwestern (beide hatten sich inzwischen vermählt), beschwört den Bruder, doch nicht auf Antwort zu warten, damit es nicht immer drei Monate dauere, ehe einer vom anderen Nachricht habe. „Jetzt kennst Du ja meine Beschäftigungen“, führt er fort, „andere Erlebnisse hat es nicht gegeben, als dienstliche äussere Lebensumwälzungen, besondere Vorfälle ebenfalls nicht. Die Seele aber, das Herz, den Geist — was gewachsen, was herangereift ist, was mit allem Unkraut hinausgeworfen worden, das kann man nicht auf einem Stückchen Papier sagen und wiedergeben“ .... Weiter berührt er seine Krankheit, über welche er, wie oben gesagt worden, noch immer nicht im klaren ist, und fährt fort: „Übrigens sei so freundlich und denke nicht, dass ich etwa so melancholisch und voller Bedenken bin, wie ich es in den letzten Jahren in Petersburg gewesen bin. Dies alles ist vollkommen vergangen, wie weggeblasen. Im übrigen ist alles von Gott und in Gottes Hand.“ Zum Schluss meint er, der Bruder, der ihn gefragt hatte, ob er Geld brauche, sei seine einzige Rettung, er solle aber nur dann schicken, wann er etwas habe; er beschwört ihn, bald zu schreiben, obwohl es traurig genug sei, nur brieflich mit einander zu leben, wenn man einander fünf Jahre nicht gesehen habe.
Der zweite der, von der Witwe des Dichters im März 1898 dem Redakteur der Monatsschrift „Niva“, Herrn R. J. Sementkowsky, zur Veröffentlichung übergebenen drei Briefe Dostojewskys, welche im Aprilhefte desselben Jahres erschienen sind, ist vom 21. August 1855 datiert. Auch in diesem spricht sich das furchtbare Heimweh und Gefühl der Vereinsamung aus, das uns in den vorhergehenden Briefen entgegentritt.
„Mein teurer Freund, mein lieber Bruder Mischa!“ — heisst es darin — „da ist nun schon eine sehr lange Zeit vergangen, und es ist auch nicht ein Zeilchen von Dir da, und ich beginne, nach meiner Gewohnheit, mich zu beunruhigen und zu härmen. Es wird offenbar so werden, wie im vorigen Sommer. Mein Lieber, wenn Du nur wüsstest, in welcher bitteren Einsamkeit ich mich hier befinde, so würdest Du mich wahrlich nicht so lange schmachten lassen und würdest nicht so lange verziehen, mir wenigstens einige Zeilen zu schreiben. Weisst Du was? Mir kommt manchmal ein schwerer Gedanke. Mir scheint, die Zeit nimmt sich nach und nach das ihre; eine alte Anhänglichkeit ermattet und frühere Eindrücke verblassen und verwischen sich. Es scheint mir, dass Du anfängst, mich zu vergessen. Wie könnte man anders so lange Pausen zwischen Deinen Briefen erklären? Auf mich sei nicht böse, wenn ich selbst Dir manchmal lange Zeit nicht schreibe. Aber erstens schreibe ich immer öfter, zweitens aber schwöre ich Dir, dass manchmal sehr schwere Arbeiten zu leisten sind; da ermüde ich und — versäume die Post, welche hier nur einmal wöchentlich abgeht. Bei Dir ist’s etwas anderes. Wenn auch zum Beispiel thatsächlich nichts zu schreiben wäre, so schreibe wenigstens was immer, seien’s auch zwei Zeilen. Mir käme dann nicht der Gedanke, dass Du mich verlässest. Lieber Freund, als ich im Oktober des vorigen Jahres[9] ähnliche Klagen an Dich schrieb, da antwortetest Du, es sei Dir sehr peinlich, sehr schwer gewesen, sie zu lesen. Mein teurer Mischa! sei mir um Gottes willen nicht böse, bedenke, dass ich einsam bin, wie ein dahingeworfener Stein, — dass mein Charakter immer schwermütig, krankhaft, empfindlich war. Bedenke das alles und verzeihe mir, wenn meine Klagen ungerecht, meine Voraussetzungen dumm waren; ich bin ja selbst überzeugt, dass ich unrecht habe. Allein Du weisst: auch ein Zweifel von der Grösse eines Mohnkörnchens ist schwer zu ertragen, und ich habe ja niemand, der mich eines besseren belehren könnte, als Dich selbst.“
Nach eindringlichen Fragen nach des Bruders materiellen Zuständen, nach der Familie, spricht er die Sorge aus, ob denn der Erfolg des kaufmännischen Unternehmens Michaels durch genügenden Unterhalt der Familie das Opfer aufwiege, das dieser gebracht habe, indem er sich von der Litteratur, dem Staatsdienste und allen Beschäftigungen lossagte, die seinem Charakter angemessener waren. „Was soll ich Dir über mein Leben sagen?“ heisst es weiter. „Bei mir ist alles im alten, alles im gleichen und es hat sich seit meinem letzten Briefe fast nichts verändert. Ich lebe ganz still. Im Sommer ist der Dienst schwerer, sind Musterungen. Mit meiner Gesundheit kann ich mich nicht brüsten, lieber Freund; sie ist nicht ganz gut. Je älter man wird, um so schlimmer wird es. Wenn Du aber meinst, dass noch so viel reizbare Empfindlichkeit, so viel Einbildung aller Krankheiten in mir steckt, wie in Petersburg, so rede Dir das gefälligst aus; auch nicht eine Mahnung davon ist vorhanden, wie von vielem anderen, Gewesenen.“ Der Brief schliesst mit hundert Fragen nach Verwandten und Grüssen an sie und verstärkt unseren Eindruck davon, dass Theodor Michailowitsch, ganz abgesehen von seinem durch die Einsamkeit gesteigerten Gefühl für die Familie, vor allem seinem Bruder Michael unendlich mehr Wärme entgegenbringt, als ihm erwidert wird. Michaels ganzes Verhalten gegen ihn während der Jahre der Haft und der Abwesenheit, der Umstand, dass er, als die Geschäfte der Fabrik schlecht gingen, sofort wieder zur Litteratur griff, da der Bruder zurückkam und mit ihm und für ihn arbeitete, das alles bestärkt uns mindestens in der Annahme, dass Theodor nicht der Empfangende von beiden sein mochte, eine Annahme, die vom weiteren Lauf der Ereignisse nur bestätigt wird.
In diesem Jahre, 1855, traten neue Personen in des Dichters Leben ein, Personen, welchen es bestimmt war, ihm sehr nahe zu stehen. Dies sind erstens ein Baron Alexander Jegorowitsch Wrangel, mit dem ihn eine enge Freundschaft verbindet, was zu einem langjährigen, wenn auch oft stockenden Briefwechsel führte. Die zweite dieser Personen ist Marja Dmitrjewna Issajew, die in Sibirien lebende Witwe eines dort an Lungentuberkulose verstorbenen Beamten.
Über Wrangel spricht sich der Dichter in einem an Apollon Maikow gerichteten Briefe vom 18. Januar 1856 folgendermassen aus: „Diesen Brief wird Ihnen Alexander Gregorowitsch Wrangel übergeben, ein sehr junger Mensch (Wrangel musste damals 23 Jahre alt sein), mit vortrefflichen Eigenschaften der Seele und des Herzens, der direkt aus dem Lyceum nach Sibirien gekommen ist, mit dem edeln Vorsatze, das Land kennen zu lernen, nützlich zu sein usw. Er hat in Semipalatinsk gedient, wir haben einander getroffen und ich habe ihn sehr lieb gewonnen. Da ich Sie ganz besonders bitten werde, ihm Ihre Aufmerksamkeit zu schenken und womöglich näher mit ihm bekannt zu werden, so will ich Ihnen zwei Worte über seinen Charakter sagen: Ausserordentlich viel Güte, ein sanftes Herz, obwohl sein Äusseres einen gewissen Anschein von Unnahbarkeit trägt. Ich wünschte sehr, um seines Vorteils willen, dass Sie näher mit ihm bekannt würden. Der halb oder dreiviertel aristokratische, freiherrliche Kreis, in welchem er aufgewachsen ist, gefällt mir nicht ganz, ja ihm selbst auch nicht, denn er besitzt vortreffliche Eigenschaften, und doch ist vieles an ihm ersichtlich, was von alten Einflüssen zeugt. Wirken Sie auf ihn, wenn es möglich ist, er ist es wert. Er hat mir sehr viel Gutes gethan, allein ich liebe ihn nicht nur für das erwiesene Gute. Schliesslich noch eins: Er ist etwas argwöhnisch, sehr eindrucksfähig, manchmal versteckt und etwas ungleich in seinen Stimmungen. Wenn Sie mit ihm zusammen kommen, sprechen Sie mit ihm offen, gerade heraus, und holen Sie nicht weit aus.“
Dieser Jüngling scheint, nach dem Briefwechsel zu urteilen, sehr viel Gelegenheit gehabt zu haben, dem Dichter sowohl in Sibirien als in Russland nützlich zu werden. Er hat durch seine Verbindungen manchem Gesuch Dostojewskys bei den betreffenden Persönlichkeiten Eingang verschafft und so an vielen Erleichterungen mitgewirkt, welche dem Dichter mit der Zeit geworden sind. Auch scheint er diesem in eigenen intimen Angelegenheiten volles Vertrauen geschenkt und ihn in seinen, wie man leicht herausfühlen kann, schwierigen Familien- und Herzens-Angelegenheiten zu Rate gezogen zu haben. Eine der ersten gemeinsamen Angelegenheiten beider scheint die gewesen zu sein, eben jenem sterbenden Issajew und seinen Angehörigen mit kleinen Geldmitteln auszuhelfen, da sich diese Familie in bitterer Not befand. In einem Briefe an Wrangel vom 14. August 1855 berichtet ihm der Dichter vom Tode des „unglücklichen Issajew“, spricht über die traurige Lage seiner Witwe Maria Dmitrjewna und bittet ihn, dieser die unter ihnen verabredete Summe zu senden. An der Wärme im Ton dieses Briefes ist leicht ersichtlich, wie nahe diese Menschen seinem Herzen stehen. So schreibt er: „Er starb unter entsetzlichen Leiden, aber wunderschön, wie Gott geben möge, dass wir andern dahingehen. Er starb kraftvoll, seine Gattin und sein Kind segnend und nur um ihr Los besorgt. Die unglückliche Marja Dmitrjewna erzählt mir seinen Heimgang bis in die kleinsten Details. Sie schreibt, diese Details wieder hervorzurufen, sei ihr einziger Trost. In den furchtbarsten Qualen (er kämpfte zwei Tage mit dem Tode) rief er sie zu sich, umarmte sie und wiederholte unaufhörlich: „Was wird mit Dir geschehen, was wird mit Dir geschehen?“ Erinnern Sie sich an ihren kleinen Jungen, den Pascha? er ist vom Weinen und von der Verzweiflung ganz von Sinnen gekommen. Mitten in der Nacht springt er aus dem Bette, läuft zum Bilde, mit welchem ihn der Vater zwei Stunden vor seinem Tode gesegnet hat, fällt auf die Kniee und betet nach ihren Worten um die ewige Ruhe der dahingeschiedenen Seele. ... Man hat ihn ärmlich begraben, auf fremde Kosten (es fanden sich gute Leute), sie aber war ganz besinnungslos .... Jetzt schreibt sie, dass sie krank ist, den Schlaf verloren hat und keinen Bissen zu essen vermag ... sie hat gar nichts, ausser Schulden im Kaufladen, irgend jemand hat ihr drei Silberrubel geschickt. „Die Not hat mir die Hand hingestossen, es anzunehmen,“ schreibt sie, „und ich habe ... das Almosen angenommen!“ — Nun folgt eine eingehende Belehrung an Wrangel, in welcher Weise dieser der Witwe Issajew die verabredete Summe schicken solle, mit den feinsten Details einer ausgesuchten Delikatesse eingeleitet und motiviert.
In seinem nächsten Brief an Wrangel vom 23. August 1855 erwähnt er noch einmal diese Geldangelegenheit, erzählt Marja Dmitrjewna habe ihm schwere Vorwürfe gemacht, dass eigentlich doch er, der selbst nichts habe, der Geber sei; er hoffe sie aber mit seiner Antwort beruhigt zu haben. „Wenn Sie hierher kommen,“ fährt er fort, „werde ich Ihnen ihren Brief zeigen. Mein Gott! was ist das für eine Frau! wie schade, dass Sie sie so wenig kennen!“ Mit einem P. S. noch einmal auf die Sache zurückkommend schliesst er: „Werden Sie ihr ein paar Worte schreiben?“
Wir ahnen schon hier, dass sich in dem, durch sechs Jahre von jedem ebenbürtigen Verkehr, von jeder Annäherung an edle Frauen abgetrennten Staatsgefangenen (zu Annäherungen banaler Natur scheint, nach den „Memoiren aus dem Totenhause“, auch das strenge Sträflingsleben für untergeordnete Kostgänger des Staates nicht ohne Möglichkeit gewesen zu sein), eine tiefe Sympathie, eine überschwängliche Bewunderung für das erste weibliche Wesen entwickeln wird, das schon durch seine Leiden ein Anrecht an ihn erworben hat und wohl auch durch eine seltene Begabung und Seelenart diesen tiefen Anteil rechtfertigen musste. Einen Anhaltspunkt für die Vorstellung vom Wesen Marja Dmitrjewnas finden wir in dem Umstande, dass der Herausgeber der „Biographischen Materiale“, Orest Miller, den Roman des Dichters „Erniedrigte und Beleidigte“ als jenen bezeichnet, in welchem wir, den äussern Thatsachen nach, neben den „Memoiren aus dem Totenhause“ die deutlichsten Spuren einer Autobiographie verfolgen können. Es ist thatsächlich geschehen, dass, als eine tiefere Beziehung des Dichters zu Marja Dmitrjewna eingetreten war, diese, gerade so wie Natascha im Roman, eine plötzliche Leidenschaft zu einem anderen fasste und Dostojewsky, aus innigstem Mitgefühl für ihre Leiden, sich eifrig bemühte, diesem anderen zu einer Stelle und einem Erwerb zu verhelfen. In welcher Weise sich dann der Umschlag in Marja Dmitrjewnas Gefühlen und Entschlüssen vollzog, das erfahren wir aus den diskreten Notizen O. Millers nicht.
Um unser Urteil über Marja Dmitrjewna zu vervollständigen, werden wir gewiss nicht fehl gehen, wenn wir die Zeichnung Nataschas als nach ihrem Vorbilde entworfen annehmen. Der Roman ist innerhalb eines Zeitraumes von ungefähr zwei Jahren nach des Dichters Vermählung geschrieben, also genug nahe, um jene Eindrücke noch ganz frisch in sich zu tragen, und genug ferne, um sie nach aussen hin gestalten zu können. Er hatte früher eine längere Erzählung, die er anfangs Roman nennt, geschrieben, welche er über zwei Jahre mit sich herumgetragen hatte; dies war die uns unter dem Namen „Tollhaus und Herrenhaus“ bekannte Erzählung „Das Dorf Stepantschikowo und seine Bewohner“. Dazwischen schrieb er aus Not eine kleine Erzählung nieder, die ihn auch schon lange beschäftigt hatte: „Onkelchens Traum“.
In der Gestalt der Natascha[10] nun sind, ganz abgesehen von den äusseren Umständen, Züge, welche uns an Marja Dmitrjewna erinnern. Ja, der Dichter, welcher sich in seiner grandiosen Unbekümmertheit um Wiederholungen wirklich oft wiederholt, gebraucht in einem Briefe an Wrangel bei der Mitteilung ihrer Zustimmung genau dieselben einfachen Worte, die er dann an der betreffenden Stelle im Roman ausspricht: „Sie sagte mir selbst: ‚ja‘. Das, was ich Ihnen über sie im vergangenen Sommer schrieb“ — fährt er in seinem Briefe vom 1. Dezember 1856 fort —, „hat gar wenig Einfluss auf ihre Neigung zu mir gehabt ... sie hat sich bald vom Irrtum ihrer neuen Neigung überzeugt .... o wenn Sie wüssten, was diese Frau ist!“ ... Am 6. März 1857 giebt er dem Freunde in einem uns nur bruchstückweise mitgeteilten Briefe von seiner in Kuznezk vollzogenen Vermählung mit wenigen Worten Nachricht. Dieser Brief beschäftigt sich hauptsächlich mit den Zuständen Wrangels, dessen komplizierten Beziehungen zum Vater usw. und enthält Ermahnungen, sich vor zu grosser argwöhnischer Empfindlichkeit zu bewahren. Zum Schlusse sagt er: „..... grosse Umwandlungen in unserem Leben helfen da immer. Ich war im höchsten Grade hypochondrisch, wurde aber durch die scharfe Umwälzung, welche in meinem Schicksal eintrat, gründlich davon geheilt.“
Ehe wir zu den weiteren Erlebnissen des Dichters übergehen, die von Wichtigkeit für seine Thätigkeit waren, möchten wir jenen Brief Dostojewskys hier einschalten, der über die letzten Augenblicke Marja Dmitrjewnas berichtet, um so einen Abschluss des Bildes dieser Ehe zu gewinnen, welche ihm grosses Glück und grosse Leiden gebracht zu haben scheint.
Die Briefe enthalten nur stellenweise Andeutungen intimer Beziehungen. So finden wir nur sehr spärliche Äusserungen in einigen derselben zerstreut. Viel reichlicher sind die Mitteilungen seiner Sorgen um den Stiefsohn Pascha, der ihm sowohl wegen seines Studienganges und der dazu kaum ausreichenden materiellen Mittel, als auch später seines unzuverlässigen Charakters wegen manche Prüfung auferlegt. Das Zusammenleben des Dichters nun mit seiner Gattin scheint zu Schwierigkeiten geführt zu haben, welche wohl in gewissen Charakterähnlichkeiten zu suchen sein dürften. Schon das Faktum allein, dass Dostojewsky es im Verlauf dieser Ehe trotz angestrengtester Arbeit und später auch erzielter grosser Honorare nie dazu gebracht hat, einen sorgenfreien Augenblick, ein Ausruhen von der Furcht drohender Not zu geniessen, deutet darauf hin, dass beide Gatten gleich unfähig waren, sich das äussere Leben erträglich einzurichten.
Anderseits finden wir in des Dichters Briefen immer dieselbe Bewunderung und Liebe für Marja Dmitrjewna ausgedrückt, obgleich er auf eine örtliche Trennung eingehen musste, welche auf Anraten der Ärzte um der Gattin Gesundheit willen eingeleitet wurde. So verblieb denn Theodor Michailowitsch in Petersburg, während Marja Dmitrjewna nach dem milderen Moskau übersiedelte.
Nachdem sich aber ein ernstes Lungenleiden rasch entwickelt zu haben scheint, eilt der Dichter an das Krankenbett der Gattin und bringt dort, selbst sehr leidend, unter „allseitigen“ Qualen, wie er sagt, und unter dem Druck bestellter, eiliger Arbeit zwei schwere Monate zu.
Er bleibt von Ende Februar bis Mitte April 1864 an ihrer Seite, schreibt während des dringende Geschäftsbriefe an den Bruder, denen wir eben nur die wenigen Andeutungen über seinen Seelenzustand entnehmen, während das unaufhörliche Sprudeln und Gähren seiner Schöpferkraft ihn auch hier nicht verlässt.
Voll von Plänen für seine damals erscheinende Zeitschrift „Wremja“, Entwürfen, kritisch-ästhetischen Artikeln über „Theoretismus und Phantasterei“, die, wie er sagt, „nicht eine Polemik sein wird, sondern eine That,“ wird er doch endlich von der Macht der Verhältnisse, nämlich eigener Krankheit und dem Tode seiner Gattin, für eine Zeit überwältigt, so dass er gar nicht schreiben kann, obwohl er noch kurz vorher schrieb: „Meine Frau ist sterbend, buchstäblich. Jeden Tag kommt ein Augenblick, da wir ihren Tod erwarten. Ihre Leiden sind furchtbar und finden ihren Widerhall in mir, weil ja ... das Schreiben aber ist keine mechanische Arbeit, dennoch aber schreibe ich und schreibe meist am Morgen — doch fängt die Handlung erst an. Die Erzählung zieht sich in die Länge. Manchmal denke ich, es wird ein Quark, dennoch schreibe ich mit Feuer, ich weiss nicht, was daraus wird. Im allgemeinen habe ich wenig Zeit zum Schreiben, obgleich es scheint, dass ich alle Zeit für mich habe — dennoch ist es wenig, denn es ist diese Zeit keine Arbeitszeit für mich und ich habe manchmal ganz anderes im Kopfe; dann noch eins: ich fürchte, der Tod meiner Frau wird bald eintreten, dann wird aber eine Unterbrechung der Arbeit unvermeidlich sein — wenn diese Unterbrechung nicht wäre, würde ich wahrscheinlich fertig.“
Diese Stelle des Briefes müsste uns geradezu durch ihre kühle Geschäftsmässigkeit verblüffen, wenn wir es nicht schon an vielen anderen Beispielen aus dem Leben grosser Dichter und Künstler erfahren hätten, dass sie, während des Schaffens gleich der pythischen Priesterin vom Geiste erfasst, im Taumel aller Irdischkeit entrückt sind. Dieses absorbierende, despotische Etwas, das sie hat, lässt zu Zeiten nichts übrig für die Erdengenossen, die sich ihnen angelobt.
Dienstag, den 14. April 1864, schreibt er an den Bruder als Nachschrift: „Gestern um 2 Uhr nachts habe ich diesen Brief geschlossen. Später wurde Marja Dmitrjewna sehr schlecht. Sie verlangte nach dem Geistlichen. Ich ging Alexander Pawlowitsch zu holen und schickte nach dem Priester. Die ganze Nacht sassen sie bei ihr; die Sakramente empfing sie um 4 Uhr morgens. Um 8 Uhr legte ich mich nieder, ein wenig auszuruhen, um 10 Uhr wurde ich geweckt, es sei Marja Dmitrjewna in diesem Augenblicke besser.“
Unter dem 15. schreibt er: „Gestern hatte Marja Dmitrjewna einen entscheidenden Anfall. Eine Halsblutung trat ein, die einen Druck auf die Brust und Würganfälle hervorrief. Wir alle erwarteten das Ende, wir waren alle an ihrer Seite. Sie nahm von allen Abschied, versöhnte sich mit allen, machte Ordnung mit allem. Deiner ganzen Familie sendete sie Grüsse und Wünsche langen Lebens, ganz besonders an Emilie Fjodorowna. Auch sprach sie das Verlangen aus, sich mit Dir zu versöhnen. (Du weisst, mein Freund, dass sie ihr Leben lang davon überzeugt war, Du seist ihr heimlicher Feind.) Die Nacht brachte sie schlecht zu. Heute aber, soeben sagt Alexander Pawlowitsch endgiltig, dass sie heute — sterben wird. Und das ist unzweifelhaft.
Ich werde zur Tante um Geld fahren: Sie kann es aber verweigern, weil sie vielleicht keines bei der Hand hat. Ich weiss nicht, was ich machen werde. Dich aber bitte ich: verlass mich nicht. Es werden sehr grosse Auslagen sein. Schicke so viel Du kannst, um alles! Um Gotteswillen — ich werde es abdienen.“ —
Wir glauben, dass es keines Kommentars bedarf, um das Tragische dieses Lakonismus der Not hervorzuheben. Ein Dichtergenius, der ganz wie das arme Volk erlebt: dem die Sorge um den nächsten Augenblick eines tiefen und zarten Erlebnisses kein anderes Wort in den Mund legt, als: Geld!
Als Nachschrift heisst es: „Marja Dmitrjewna stirbt sanft bei vollem Bewusstsein, Pascha (den Sohn) hat sie im Geiste gesegnet.“
Der letzte Brief, wenigstens der letzte, in den wir Einblick haben, in welchem Dostojewsky über Marja Dmitrjewna und sein Verhältnis zu ihr spricht, ist vom 31. März 1865 an Wrangel gerichtet. Die betreffende Stelle lautet: „Ja, Alexander Jegorowitsch, ja, mein unschätzbarer Freund, Sie schreiben mir und klagen mit mir über meinen verhängnisvollen Verlust, den Tod meines Schutzengels, Bruder Mischas (der Bruder war bald nach Marja Dmitrjewna plötzlich gestorben), aber Sie wissen nicht, wie tief mich das Schicksal niedergedrückt hat. Ein zweites Wesen, das mich liebte, und das ich grenzenlos liebte, meine Frau ist in Moskau, wohin sie ein Jahr vorher übersiedelt war, an Tuberkulose gestorben. Ich bin ihr dorthin nachgekommen, bin den ganzen Winter 1864 nicht von ihrem Lager gewichen und am 16. April des vorigen Jahres ist sie verschieden, bei vollem Bewusstsein; und da sie von allen Abschied nahm, und aller gedachte, denen sie noch letzte Grüsse senden wollte, gedachte sie auch Ihrer. Ich übergebe Ihnen hier diesen Gruss, lieber, guter, alter Freund. Weihen Sie ihr ein gutes und freundliches Erinnern. O, mein Freund, sie hat mich grenzenlos geliebt, und auch ich liebte sie über die Massen, doch lebten wir nicht glücklich miteinander. Ich werde Ihnen alles bei unserem Wiedersehen erzählen — jetzt sage ich nur das, dass wir ungeachtet dessen, dass wir mit einander unbedingt unglücklich waren (ihres seltsamen, argwöhnischen und krankhaft-phantastischen Charakters wegen) — nicht aufhören konnten, einander zu lieben. Ja sogar, je unglücklicher wir waren, desto mehr liebten wir einander. Wie seltsam dies auch klingen möge, dennoch war es so. Sie war die ehrlichste, die edelste und grossherzigste aller Frauen, welche ich in meinem ganzen Leben gekannt habe. Als sie starb — habe ich, obwohl mich ein Jahr lang tiefer Kummer beim Anblick ihres Hinsterbens gequält hatte, obwohl ich wusste und mit tiefem Schmerze empfand, was ich mit ihr begraben würde — da habe ich in keiner Weise die Vorstellung davon gehabt, wie leer und öde mein Leben von dem Augenblicke an sein würde, da man die Erde über sie schüttete. Und nun ist schon ein Jahr vergangen, und dieses Gefühl schwächt sich nicht ab .... Da eilte ich, nachdem ich sie begraben, nach Petersburg zum Bruder — nun blieb mir nur er allein; nach drei Monaten starb auch er, nachdem er im ganzen einen Monat, und das ganz leicht, krank gewesen war, so dass die Krisis, welche dem Tode voranging, ganz unerwartet unter drei Tagen eintrat.
Und nun bin ich plötzlich allein geblieben und es war mir geradezu furchtbar zu Mute. Mein ganzes Leben war in zwei Teile zerbrochen. In der einen Hälfte, die ich hinter mir hatte, war alles wofür ich gelebt hatte, und in der zweiten, mir noch unbekannten Hälfte, alles fremd, alles neu, und nicht ein Herz, das mir diese beiden ersetzen könnte. Es war mir buchstäblich nichts geblieben, wofür ich leben sollte. Neue Bande knüpfen, ein neues Leben ersinnen? Der blosse Gedanke daran war mir widerwärtig. Hier empfand ich zum ersten Male, dass ich sie durch niemand ersetzen, dass ich nur sie auf der Welt geliebt, und dass eine neue Liebe zu fassen ganz unmöglich, ja nicht nötig sei. Alles um mich herum wurde kalt und öde. Da, als ich vor drei Monaten Ihre guten, so warmen Zeilen, voll alter Erinnerungen erhielt, da wurde mir so traurig zu Mute, dass ich es gar nicht ausdrücken kann. Aber nun hören Sie weiter.“
Hier wird der Brief unterbrochen und erst nach neun Tagen wieder fortgesetzt, und wir finden darin des Dichters unzerstörbare Lebenskraft wieder an der Arbeit, diesmal an der Ordnung der trostlosen Verhältnisse, in welchen der Bruder seine Familie zurückgelassen.
Wir kehren jedoch zu den Erlebnissen des Dichters zurück, die noch vor seiner gänzlichen Befreiung aus Sibirien (1859) von Bedeutung waren. Das, was den Dichter in der Zeit zwischen 1854 und 59 am meisten beschäftigt, ist seine und seiner Freunde Bemühung, die Erlaubnis zu drucken, die Befreiung vom Militärdienst und endlich die Rückkehr nach Russland zu betreiben. Durch Baron Wrangel, welcher inzwischen nach Petersburg gereist war, hofft er auf den General Totleben, den dermaligen General-Auditor, in diesem Sinne einzuwirken. Er schreibt Wrangel eingehend und dringlich darüber und fügt hinzu: „Sollte man nicht etwa das Gedicht beischliessen?“ Unter dem „Gedicht“ ist eine Art Hymnus gemeint, welchen der Dichter in seiner Begeisterung für die Sache der Christen im Orient zu Beginn des Orientkrieges 1854 verfasst hatte und welcher in den Archiven der „Dritten Abteilung“ aufbewahrt worden war. Das Gedicht (zehn zehnzeilige Strophen in fünffüssigen Jamben) erschien zum ersten Male im ersten Heft des Grashdanin 1883 im Druck. Es ist künstlerisch ganz unbedeutend und nur durch die Wärme und den Schwung bemerkenswert, mit welchem Dostojewsky den Sieg des christlichen Heeres über die Ungläubigen preist, andererseits heute durch den Spott interessant, den er über jene christlichen Nationen, namentlich die Franzosen ausgiesst, welche auf der Seite der Ungläubigen stehen. Die Hoffnung auf die Erfolge der russischen Waffen lässt den Dichter in einer Art gläubiger Verzückung, das siegreiche Heer bis vor die Thore Konstantinopels führen. Im selben Briefe vom April 1856 erwähnt der Dichter eines Gedichtes zur Feier der Krönung Alexanders des Zweiten, des von ihm „vergötterten Kaisers“. Orest Miller berichtet, dass dieses Gedicht spurlos verschwunden ist, was um so beklagenswerter sei, als es die Gefühle nicht nur aller patriotischen Russen, sondern auch eines Teils der Gefährten Dostojewskys in der Affaire Petraschewskys ausdrücke. So viel Platz man nun den überschwänglichen Hoffnungen einräumen muss, welche jeder neue Regierungsantritt, jeder junge Herrscher, der einer verbrauchten und verhärteten Kraft auf dem Throne nachfolgt, in den Herzen eines Volkes hervorruft, so viel neue Schwungkraft namentlich in Russland bei diesen Gelegenheiten in der Gesellschaft ausgelöst wird, so dürften doch diese Worte des allzu eifrigen Freundes mit Vorsicht aufzunehmen sein. Es ist nicht anzunehmen, dass die Teilnehmer an der Petraschewsky-Affaire, auch nur ein Teil von ihnen so hoch über dem Niveau von Verbitterung und Misstrauen gestanden und so gross und so frei, so liebe- und hoffnungsvoll auf die Weltereignisse zu blicken vermocht hätten, wie Dostojewsky. Diese Stelle des Berichtes sowie manche, die uns noch begegnet, sind zum mindesten eine Ungeschicktheit, weil sie gerade jenem in unseren Augen schaden, den sie mit einem Kreise Gleichgesinnter und mit einem Nimbus umgeben wollen, den er gar nicht braucht.
Einen längeren politischen Aufsatz, den der Dichter um diese Zeit schrieb, nennt er ein Pamphlet und fügt hinzu: „ich möchte nicht ein Wort aus diesem Artikel hinauswerfen, aber bei allem darin enthaltenen Patriotismus würde man mir kaum gestatten, das Drucken mit einem Pamphlet zu beginnen“. Er vernichtet also diesen Artikel, nimmt aber vieles davon in eine Schrift über die Kunst hinüber, die er, wie er sagt, zehn Jahre mit sich herumgetragen hat, nun niederschreibt und der Grossfürstin Marja Nikolajewna als Präsidentin der Kunst-Akademie widmet, da er meint, dadurch schneller die Druckerlaubnis zu erlangen. „In manchen Kapiteln,“ sagt er, „werden ganze Seiten aus meinem Pamphlet enthalten sein, namentlich jene über die Bedeutung des Christentums in der Kunst.“ Über die weiteren Schicksale dieses Artikels wissen die Herausgeber der Materialien nichts näheres, vermuten jedoch, dass vieles daraus in die Artikel aufgenommen worden ist, welche Dostojewsky seinerzeit in seiner Zeitschrift „Wremja“ als Polemik gegen den Kritiker Dobroljubow veröffentlicht hat. Wir werden weiter unten bei der Besprechung seiner publizistischen Thätigkeit näher auf diese Kunstanschauungen eingehen.
Jetzt, es ist um die Jahre 1856-59 herum, beschäftigt ihn vor allem sein ganz persönliches Schicksal. Die Liebe zu Marja Dmitrjewna, welche durch gegenseitige Eifersucht seine Qualen und durch diese seine Krankheit steigert; die übermenschliche Anstrengung, die es ihn kostet, dem Rivalen zu einem Lebensunterhalt, ihr zu einer einmaligen Gnadengabe, sowie ihrem Sohne zu einem Stiftungsplatz in einem Gymnasium zu verhelfen, „ehe sie heiratet, weil sie nach der Vermählung (mit dem anderen natürlich) nichts bekommt;“ der heftige Wunsch, den Abschied zu erlangen und drucken zu dürfen, wenn er auch in Sibirien bleiben müsste — dies alles steigerte seine seelischen und physischen Leiden auf das höchste. Am Schlusse seines Briefes vom 21. Juli sagt er: ... „ich aber — bei Gott — ins Wasser mit mir, oder zu trinken anfangen“ .... Dabei ist er immer voll Hoffnung auf den jungen Kaiser, erwartet von da ausgehend (wie er denn immer ganz im Sinne der historischen Entwickelung seiner Heimat Reformen von oben für segensreicher und dauerhafter hält, als Revolutionen von unten) eine völlige Wiedergeburt Russlands. Der Brief Wrangels, der ihm von Totlebens Verwendung für ihn berichtet, bringt ihn in Entzücken über diesen letzteren, er vergisst der eigenen Leiden und schwingt sich mit der ihm eigentümlichen sanguinischen, rasch wechselnden Begeisterung, wie beflügelt in die Hoffnung einer nahen, schöneren Zukunft. „Mehr Glauben“ — ruft er aus — „mehr Einigkeit ... und wenn noch Liebe dazu kommt, so ist alles gethan. Wie könnte irgend einer zurückbleiben, sich der allgemeinen Bewegung nicht anschliessen, sein Schärflein nicht hinzutragen? O, wäre mein Schicksal doch schon entschieden!“ Ein Handbillet ernennt den Dichter endlich am 1. Oktober 1856 zum Offizier, was ihm die Aussicht auf Abschied näher rückt. Inzwischen bittet er aber, man möge für ihn bei in Moskau lebenden Verwandten, die der Familie schon oft beigestanden hatten, leihweise 600 Rubel aufnehmen, da er schon um 1000 Rubel ein fertiges Manuskript habe, das er aber bis zur Erteilung der Druckerlaubnis nicht verwerten könne. „Noch ein Jahr nicht drucken dürfen,“ ruft er aus, „und ich bin verloren, dann ist es besser, nicht zu leben!“ An anderer Stelle sagt er: „Ich bin bereit ohne Namen oder unter einem Pseudonym zu schreiben, wenn auch für immer.“
Das Manuskript, das 1000 Rubel repräsentiert, ist die im Gefängnis vor Sibirien geschriebene Erzählung „Ein kleiner Held“, welche der Dichter damals „eine Kindergeschichte“ genannt hatte.
Diese „Kindergeschichte“ hat der Dichter, wie wir wissen, in den Kasematten der Peter Pauls-Festung niedergeschrieben, „wo man nur das Unschuldigste schreiben konnte“. Dass er aber in der Zeit zwischen dem Abschluss der Untersuchung und dem Urteilsspruch — erst nach Schluss der Untersuchung wurden ihm nämlich Bücher und Schreibmaterialien zugesprochen — imstande war, nicht nur etwas so „Unschuldiges“ zu schreiben, sondern ein Kunstwerk von so entzückender Anmut zu schaffen, dies ist, scheint uns, das allergrösste Zeugnis seiner Kraft und Seelengrösse. Aber auch noch etwas anderes finden wir in diesem Werke bekräftigt: Dostojewskys hohes künstlerisches Können, da wo ihn weder eine innere Ungeduld, noch eine äussere Not daran hinderte, an der feinen Ausführung des Kunstwerks so recht nach seinem Sinne zu meistern. Ganz und gar einheitlich ist die Schilderung des Erlebnisses durchgeführt.
Der elfjährige, lebhafte, aber höchst feinfühlende Junge, der Held der Erzählung, gerät in eine grosse Gesellschaft auf dem Schlosse eines Gutsbesitzers. Er wird von einer übermütigen Dame bis zu Thränen geneckt, wendet aber seine geheimnisvoll ahnende Bewunderung ihrer schönen, traurigen Freundin zu, die er halb unbewusst auf allen Wegen begleitet, bis er endlich einmal von der ganzen Gesellschaft lachend und neckend als deren Cavaliere servente erklärt wird, zu dem sie eine tiefe Neigung gefasst hätte. Dies ist in feiner Weise von der übermütigen Blondine eingeleitet worden, welche die einsamen Spaziergänge der Freundin vor der Eifersucht ihres grossmäuligen Gatten decken will. In innerster Seele verletzt, da er dunkel fühlt, dass etwas Lächerliches und höchst Beschämendes über ihn gekommen, flieht der Knabe in seine Stube, wo er sich schluchzend einschliesst. Die ganze Damen-Gesellschaft pocht und ruft an seiner Thüre. Er schliesst jedoch nicht auf und wartet, bis alle sich entfernen. Dann giebt er sich ungehemmt seinem Schmerz und seinen Betrachtungen über das Vorgefallene hin. Endlich erweckt ihn ein ungewöhnliches Getümmel im Schlosshof aus seiner verzweifelten Betäubung. „Ich erhob mich und trat ans Fenster. Der ganze Hofraum war mit Equipagen, Reitpferden und eilfertigen Dienern angefüllt. Es schien, dass alle fortfuhren; einige Reiter sassen schon im Sattel, andere Gäste nahmen in den Equipagen Platz .... Da erinnerte ich mich, dass eine Ausfahrt geplant worden war und nun, nach und nach, drang eine Unruhe in mein Herz — ich spähte intensiv, ob mein Klepper auch im Hofe sei. Aber der Klepper war nicht da, also hatte man mich vergessen. Ich hielt es nicht aus und im Nu war ich unten, alle unangenehmen Begegnungen sowie meine jüngste Schmach vergessend ....“
Kann man die Vorgänge in einer Kinderseele einfacher und vollendeter schildern? Erst der wahnsinnige Schmerz der Beschämung, Zorn, Trotz, dies alles von der Neugierde besiegt: was wohl da unten vorgehe; endlich die aufsteigende leidenschaftliche Unruhe, vergessen zu sein und zurückbleiben zu müssen! Wer erinnert sich nicht aus seinen Kindertagen, dass diese Schmerzen intensiver, leidenschaftlicher sind, als vielleicht alle Schmerzen der reiferen Jahre?
Nun kommt der Knabe hinunter, sieht, dass „alles seinen Herrn hat“ und nur noch ein wildes junges Pferd da ist, das niemand zu besteigen wagt. Der junge Mann, ein guter Reiter, dem es vorgeführt worden war, verzichtet auf den Ruhm, es zu besteigen, und nun soll es fortgeführt werden. Da will die übermütige Blondine das Pferd für sich satteln lassen, um den ängstlichen Ritter zu beschämen, dem sie ihr zahmeres Tier anbietet. Allein der Hausherr gestattet dies nicht und man soll dieses eben in seinen Stall zurückführen, als die Dame den Knaben erblickt und den „weinerlichen“ Helden mit der Aufforderung neckt, doch sein Glück zu versuchen. Im Zorn und Trotz, wohl auch um vor den Augen seiner Huldin ein rühmliches Heldenstück zu vollbringen, schwingt er sich, bleich und bebend, auf das Pferd, das nun mit ihm aus dem Hofthor jagt, ehe er noch im zweiten Steigbügel Fuss fassen konnte. Zum Glück für den kleinen Reiter stolpert das Tier an einem grossen Stein, macht Kehrt und wird endlich, von den Pferden der zu Hilfe eilenden übrigen Reiter bedrängt, die seine Zügel fassen, vor der Freitreppe zum Stehen gebracht. Man umringt den kleinen Helden, der mehr tot als lebendig vom Sattel gehoben wird, und bringt ihn zu Bett, da er fiebert. Die tolle Blondine erweist sich in ihrer Zerknirschung als treue, zärtliche Pflegerin, und die traurige Dame seines Herzens schenkt ihm einen Blick herzlicher Teilnahme, worüber der Knabe wonnevoll errötet.
Am andern Morgen ist er wieder frisch und munter und streicht im Park umher. Und nun kommt die herrlichste Stelle der Dichtung. Der kleine Held wird durch Zufall der ungesehene Zeuge eines schweren Abschiedes zwischen „seiner“ Dame und einem Gaste, welcher die Gesellschaft offiziell schon gestern verlassen hatte und nun mit ihr in einem stillen Boskett des Parkes zusammentrifft. Der Knabe sieht, wie der junge Mann sich vom Pferd herunter neigt, die Hand der schönen Frau küsst, endlich seinen Arm um ihre Schulter legt und einen langen Kuss auf ihre Lippen drückt. Dann übergiebt er ihr ein versiegeltes Päckchen ohne Aufschrift und fliegt wie ein Pfeil an dem kleinen Nebenbuhler vorüber. Die Dame geht in Träume versunken und verliert das Briefpäckchen, das der Junge, der ihr nachgeht, findet und nach einem schweren inneren Kampfe rasch an eine sichtbare Stelle des Gartenpfades hinlegt. Sie ist aber so verloren, dass sie es nicht sieht, und eilt, da sie schon erwartet wird, dem Hause zu. Hier bereitet man sich zu einer zweiten Ausfahrt und bestürmt die Herzukommende mit Fragen über ihr Befinden, da man sie sehr bleich findet. Der kleine Held hat sich indessen in einiger Entfernung von ihr aufgestellt, hält das Päckchen, das er in die Rocktasche gesteckt, darin krampfhaft in der Hand und ist in der peinlichsten Verlegenheit, da er es ihr übermitteln und doch nicht seine Mitwissenschaft an ihrem Geheimnisse zeigen will. Sie merkt nichts von alledem, erklärt nur, dass sie an der Spazierfahrt nicht teilnehmen, sondern einen kleinen Gang durch den Park machen werde — in Begleitung ihres kleinen Ritters. Alle fahren fort, es wird ruhig im Schlosshof, und die Schöne tritt nun gesenkten, suchenden Blickes ihre Wanderung an, des kleinen Ritters vergessend, der erfreut und gequält zugleich an ihrer Seite wandelt.
Nun folgt die Schilderung seines Kummers, seines vergeblichen Nachdenkens, wie er ihr den Fund in die Hände spielen könne. Sie nimmt, nachdem sie überall umhergespäht, auf einer Gartenbank Platz und vertieft sich scheinbar in das Lesen eines Buches, während zwei schwere Thränen an ihren Wimpern hängen. Endlich hat der Knabe einen Ausweg gefunden. Freudig ruft er ihr zu, er werde einen Strauss für sie pflücken, ehe noch die Mäher den letzten Wiesenschmuck niedermähen. Er springt davon, um den Strauss zu pflücken. Die Schilderung dieses Vorgangs erscheint uns psychologisch wie künstlerisch der Höhepunkt der Erzählung zu sein, der nur durch den feinen und sinnreichen Schluss gekrönt wird. Der Knabe läuft vom Strauch zur Wiese, von der Wiese aufs Feld, vom Feld in den schattigen Hain, von der Freude am Augenblick, an den einzelnen Blumenfunden echt kindhaft hingerissen. Was er zuletzt in seiner Hand vereinigt, ist an Farbe und Zusammenstellung ein Strauss, um den ihn jeder Gärtner beneiden könnte. Immer voller und dichter lässt er ihn werden, bis er ihn endlich mit Ahornblättern einfasst und mit feinen Gräsern bindet und jetzt — lässt er klopfenden Herzens das Briefpäckchen in seine Mitte gleiten. Anfangs bleibt der Brief ganz sichtbar, mit jedem Stückchen Weges aber, um das sich der Knabe der Trauernden nähert, wird ihm ängstlicher zu Mute und stösst er das Päckchen tiefer in die bunte Hülle hinein, bis er — am Ziele angelangt — es ganz und gar darin vergraben hat. Nun überreicht er mit flammenden Wangen seine Gabe. Sie blickt nur zerstreut auf, dankt und legt den Strauss neben sich auf die Bank. Betrübt und besorgt legt sich nun der Knabe in der Nähe auf das Gras, stellt sich müde und schliesst endlich blinzelnd die Augen. Da kommt eine Biene zu seinem Entsatz. Sie umschwirrt summend die Leserin, lässt sich nicht abweisen. Diese fasst endlich den Strauss und schwingt ihn zur Abwehr nach der Biene. Der Brief fällt heraus; die Dame hebt ihn, starr vor Erstaunen, auf und sieht in stummer Überraschung bald auf die Blumen, bald auf das Päckchen. Plötzlich errötet sie heftig und sieht nach dem Jungen hin, der noch rechtzeitig die Augen fest schliesst. Da fühlt er, dass sie sich ganz nahe über ihn neigt, fühlt bebenden Herzens ihren Atem an seinen flammenden Wangen, fühlt ihre Thränen auf seiner Hand, wie sie diese einmal, zweimal küsst, und zuletzt fühlt er einen warmen Kuss auf seinen Lippen. Er „erwacht“ mit einem leisen Schrei, allein da fällt ein Gazetüchlein über sein Gesicht, wie um ihn vor der heissen Sonne zu decken und — er ist allein.
Nach dem zuletzt angeführten Schreiben des Dichters folgt eine Pause in seinem Briefwechsel mit Wrangel, während welcher ein häufigerer Gedankenaustausch mit dem Bruder ersichtlich wird, der wohl nicht unterbrochen war, sondern aus welchem, wie die Freunde sagen[11], Briefe entweder gänzlich fehlen oder bis heute noch nicht aufgefunden worden sind. In einem Briefe vom 31. Mai 1858 finden wir die Beziehung auf einen schweren Geldverlust des Bruders, wodurch es Theodor Michailowitsch doppelt peinlich wird, sich immer wieder um Nachhilfe an den Bruder wenden zu müssen. Er teilt diesem mit, dass er Beziehungen zu Katkow, dem Redakteur des „Russkij Wjestnik“, angeknüpft habe, welcher ihm einen Vorschuss von 500 Rubeln gesandt, ihn aber in einem „sehr gescheiten und liebenswürdigen Briefe“ gebeten habe, „sich mit der Arbeit ja nicht zu drängen und nicht auf eine Frist hin zu arbeiten.“
Die Ausführung des Romans, welchen er mit sich trägt, verschiebt er für seine Rückkehr nach Russland. In diesem Roman, sagt er, „liegt eine ziemlich glückliche Idee, ein neuer, bis jetzt nirgends dargestellter Charakter. Allein, da dieser Charakter jetzt in Russland wahrscheinlich in der Wirklichkeit sehr verbreitet ist, ganz besonders jetzt, nach der Bewegung und den Ideen zu urteilen, von welchen alle erfüllt sind, so bin ich überzeugt, dass ich meinen Roman mit neuen Beobachtungen bereichern werde, wenn ich nach Russland zurückkomme.“
O. Miller ist der Ansicht, unter diesem Charakter könne nur Raskolnikow gemeint sein, das Produkt jener Betrachtungen, welche der eben durch russische Nachrichten und Zeitschriften dem Dichter wiedergewonnene Einblick in die Verhältnisse und bewegenden Ideen in ihm erweckt hätten. Ja, noch lange ehe Raskolnikow erschienen — so findet Miller und wir müssen ihm vollkommen beistimmen — ist der Grundtypus dieses neuen russischen Charakters in den „Memoiren eines Totenhauses“ an jener Stelle bezeichnet worden, wo Dostojewsky sagt: „Die Eigenschaften eines Scharfrichters finden sich im Keime fast bei jedem jungen Menschen unsrer Tage vor.[12] Indessen“, sagt der Dichter, „schreibe ich zwei Erzählungen, welche eben nur erträglich sein werden.“ Weiter spricht sich Dostojewsky über seine Arbeitsmethode aus, und wir müssten erstaunt sein, dass sie dem vollkommen widerspricht, was sich uns beim Lesen aller seiner Werke aufdrängt, nämlich der Raschheit, Achtlosigkeit auf Detail, der Spontaneität, die sich überall darin fühlbar macht. Es ist eben immer wieder die Not, welche ihn antrieb, seinem innersten Gefühl zuwider etwa in zwei Tagen und zwei Nächten zwischen 3 und 4 Druckbogen anzufüllen. In diesem Briefe widerspricht er dem Bruder, bekämpft dessen Ansicht, dass eine Situation auf einen Sitz geschrieben werden müsse. „Ich schreibe nur eine Scene sofort nieder, so wie sie sich mir anfänglich gezeigt hat, und freue mich daran; dann aber bearbeite ich sie ganze Monate, ein Jahr lang, begeistere mich zu mehreren Malen daran, nicht nur einmal (weil ich diese Scene liebe), und füge ihr mehrere Male etwas zu oder nehme etwas fort ... und glaube mir, es kommt alles viel besser heraus. Wenn nur Begeisterung da ist. Ohne sie, freilich, wird nichts daraus.“
Inzwischen hat der Dichter die Erzählung „Onkelchens Traum“ für das Journal „Russkoje Slowo“ geschrieben, „per Eilpost“, wie er sagt, rein nur, um Geld zu bekommen, da er gelegentlich seiner Vermählung durch den Bruder 500 Rubel als Vorschuss aus der Redaktion hatte nehmen lassen. Katkow verspricht er den Roman, das schon mehrmals erwähnte „Dorf Stepantschikowo“, für den Herbst. Diese beiden Erzählungen scheinen uns eine Art Interimsepoche in des Dichters Thätigkeit darzustellen. Zwischen das Ausklingen des alten und den Beginn des neuen Lebens gesetzt, äusserlich vom Drang nach Arbeit und Erwerb beschleunigt, innerlich nicht im allerengsten Zusammenhang mit der in Sibirien gewonnenen Vertiefung des Dichters, welche zu ihrer äusseren Gestaltung eben seine Gegenwart in Russland forderte, stehen sie eigentlich vereinzelt da; und wenn sie auch die ausserordentliche psychologische Realität und Nuancierung nicht verleugnet, welche Dostojewskys künstlerische Grösse ausmacht, so gehören sie doch weder zu jenen Werken des Dichters, welche in die Zeit des litterarischen Tastens und Spielens mit Humor und Satire einzureihen wären, noch zu jenen, welche sein Apostolat der Alliebe und Allschuld mit allen Machtmitteln seiner Glutnatur verkünden und besiegeln.
In einem Briefe vom 9. Mai 1859 legt er dem Bruder einen Plan vor, wie seine bis dahin geschriebenen Werke in eine Ausgabe vereinigt werden könnten, um wieder einiges Geld hereinzubringen. Es war schon in einem anderen Briefe davon die Rede gewesen, dass Dostojewsky 100 Rubel für den Druckbogen erhielt, während Turgenjew damals schon 400 Rubel per Bogen gezahlt wurden. Uns interessiert hier nur seine Einreihung der Werke in zwei Bände und die Berechnung, die er daran knüpft, welche uns zugleich ein Bild seiner mühseligen, dabei klugen, aber doch immer etwas sanguinischen Transaktionen mit Redakteuren und Verlegern zu geben vermag. Bezeichnend ist dabei die häufige Wiederkehr der absoluten Mutlosigkeit, die immer wieder in Ausrufe ausbricht: dann, dann bin ich der Verzweiflung anheimgegeben, oder: dann, — höchstens ins Wasser — oder — ich bin verloren usw. In diesem Briefe also heisst es: „Höre, Mischa! Dieser Roman hat unbedingt grosse Mängel und hauptsächlich wohl den, dass er sich in die Länge zieht; wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass er zugleich auch grosse Vorzüge hat und dass er mein bestes Werk ist.“ Dies meint der Dichter bei jedem eben vollendeten Werke und kommt erst spät von dieser Meinung zurück. „Ich habe ihn zwei Jahre hindurch geschrieben (mit der Unterbrechung „Onkelchens Traum“), Anfang und Mitte sind durchgebildet, das Ende in Eile hingeschrieben. Aber ich habe meine Seele, mein Fleisch und Blut da hineingelegt. Ich will nicht sagen, dass ich mich darin ganz ausgesprochen hätte, das wäre Unsinn. Es wird noch vieles zu sagen geben. Dazu kommt, dass in diesem Roman wenig Herzenselement vorhanden ist (d. h. leidenschaftliches Element, wie z. B. im „Adeligen Nest“) — aber er enthält zwei ungemein typische Charaktere, die ich fünf Jahre lang geschaffen und notiert und tadellos (nach meiner Meinung) durchgearbeitet habe — Charaktere, welche durchaus russisch und bis heute durch unsre Litteratur noch schlecht dargestellt worden sind. Ich weiss nicht, ob Katkow das würdigen wird, aber wenn das Publikum meinen Roman kühl aufnimmt, so werde ich, ich bekenne es, in Verzweiflung sein. Auf ihn sind meine besten Hoffnungen und vor allem die Befestigung meines litterarischen Rufes gegründet. — Jetzt bedenke: der Roman erscheint heuer, vielleicht im September. Ich denke, dass, wenn man von ihm sprechen, ihn loben wird, ich von Kuschelew schon 300 Rubel für den Druckbogen werde fordern können. Es wird dann nicht mehr jener Schriftsteller mit ihm zu thun haben, der nur „Onkelchens Traum“ geschrieben hat. Freilich kann ich mich sehr über meinen Roman und seinen Wert täuschen, aber darauf beruhen alle meine Hoffnungen. Nun: wenn der Roman im „Russkij Wjestnik“ (Katkow) Erfolg hat, und allenfalls einen bedeutenden, so habe ich, anstatt die „armen Leute“ gesondert herauszugeben, eine neue Idee: Wenn ich werde nach Twer gekommen sein (dem Dichter war damals schon Twer als nächster Wohnort angewiesen worden), will ich, mit deiner Hilfe versteht sich, mein Täubchen, du mein ewiger Helfer — zum Januar oder Februar des kommenden Jahres zwei Bändchen meiner Werke in folgender Ordnung herausgeben: 1) erster Band: „Arme Leute“, „Njetoschka Njezwanowa“ (die ersten 6 Kapitel sind überarbeitet und haben allen gefallen), „Helle Nächte“, „Kindergeschichte“ (die Erzählung, welche Dostojewsky im Gefängnis schrieb und später „Ein kleiner Held“ nannte) und „Christbaum und Hochzeit“; alles in allem 18 Druckbogen. Im zweiten Band: „Das Dorf Stepantschikowo“ und „Onkelchens Traum“. Der zweite Band hat 24 Druckbogen. (NB. Später kann man den überarbeiteten oder, besser gesagt, neugeschriebenen „Doppelgänger“ und andre gesondert herausgeben. Das wäre der dritte Band (dies aber später und jetzt nur zwei Bände).)“
„Die Auflage in 2000 Exemplaren wird 1500 Rubel kosten, nicht mehr. Man kann das Exemplar zu 3 Rubeln verkaufen. Daher werde ich, wenn ich durch 1½ Jahre einen grossen Roman schreibe, durch den allmählichen Verkauf der Exemplare geschützt und bei Gelde sein. Man kann es auch so machen: die Ausgabe an Kuschelew um 3000 oder sogar 2500 verkaufen; aber natürlich sich jetzt in keinerlei Verhandlungen einlassen: man muss den Erfolg des Romans bei Katkow abwarten. Hier ist alle Hoffnung enthalten und dieser Erfolg wird alle Abmachungen erleichtern.“
„NB. An Katkow sende ich im ganzen 15 Bogen zu 100 Rubeln, macht 1500 Rubel. Genommen habe ich von ihm 500, und nachdem ich das dritte Viertel des Romans eingesandt, habe ich um weitere 200 für die Reise gebeten, also sind 700 Rubel herausgenommen.“
„Ich werde ohne Kopeke nach Twer kommen, dafür aber erhalte ich dann in der allernächsten Zeit von Katkow 700 oder 800 Rubel. Das geht noch an, man kann sich wenigstens umdrehen.“
Solche und ähnliche Kombinationen bilden den Haupttext von Dostojewskys Briefen durch eine lange Reihe von Jahren und sind, so monoton diese Briefe dadurch auch sind, ein ungemein charakteristisches Merkmal für des Dichters seltsame Verbindung von Geschäftskenntnis, Klugheit und Optimismus, sowie die Umschläge seiner Stimmung von überschwänglichem Selbstgefühl zu vollständiger, kindlicher Verzweiflung und Mutlosigkeit.
Vom 22. September ist endlich ein Brief an Wrangel aus Twer datiert. Nach einer langen Pause, welche nicht verfehlt hat, im Dichter allerlei argwöhnische Vermutungen über die Treue des Freundes zu nähren, greift er mit alter Wärme die Korrespondenz wieder auf und berichtet über sein neues Leben in Twer, das indessen seine Hoffnungen durchaus nicht erfüllt, so dass er mit einer gewissen Sehnsucht an Semipalatinsk zurück denkt: „Wenn Sie nach mir fragen“ — sagt er — „was soll ich da antworten? Ich habe Familiensorgen auf mich genommen und schleppe sie nun. Aber ich glaube, dass mein Leben noch nicht zu Ende ist, und ich will nicht sterben. Meine Krankheit ist beim alten — nicht schlechter. Ich würde mich gerne mit Ärzten beraten — aber solange ich nicht nach Petersburg kann — werde ich mich nicht kurieren! Wozu mit Dummköpfen herumpatzen! Jetzt bin ich in Twer eingeschlossen, und das ist schlimmer als Semipalatinsk — — düster, kalt, steinerne Häuser, keinerlei Bewegung, keinerlei Interessen — nicht einmal eine ordentliche Bibliothek ist da! das reine Gefängnis! Ich denke sobald als möglich von hier fort zu kommen; aber meine Lage ist höchst sonderbar: ich betrachte mich schon seit langem als vollkommen begnadigt; man hat mir auf persönlichen Befehl schon vor zwei Jahren den erblichen Adel zurückerstattet; bei alledem aber weiss ich, dass ich ohne formelles Gesuch (in Petersburg zu leben) weder nach Petersburg noch nach Moskau hinein kann. Ich habe die Zeit verpasst, ich hätte vor zwei Monaten einreichen müssen, jetzt aber ist Fürst Dolgorukow abwesend.“ — — So plagt sich der Dichter zwischen Hoffnungen, Befürchtungen herum, fürchtet, wenn er sich an einen der einflussreichen Freunde wendet, den anderen zu verletzen und so für endlose Zeiten in Twer bleiben zu müssen, wo er in allem gelähmt ist. Endlich führt er die Idee aus, die er schon eine Zeit bei sich herumträgt, einen offenen Brief an den jungen Kaiser zu schreiben und ihm die Schwierigkeit seiner Lage darzulegen.
Eine Kopie dieses Schreibens wurde auf Veranlassung des Grafen N. P. Ignatjew aus dem Archiv der ehemaligen III. Abteilung, samt dem oben erwähnten Gedicht den Herausgebern der „Materialien“ mitgeteilt, sowie auch uns das Original auf Veranlassung des Fürsten Obolensky, Gehilfen des Ministers des Innern, durch den gegenwärtigen Chef der ehemaligen III. Abteilung, Herrn von Swaljansky, vorgelegt wurde. Wir entnehmen aus diesem Schreiben die hervorragendsten Stellen.
Nach einigen einleitenden Worten, mit welchen sich Dostojewsky als „ehemaliger Staatsverbrecher“ einführt, erzählt er in Kürze:
„Ich bin als politischer Verbrecher im Jahre 1849 in Petersburg verurteilt, degradiert, aller bürgerlichen Rechte entkleidet und nach Sibirien zu den Zwangsarbeiten zweiten Grades in die Festung auf vier Jahre mit der Bestimmung verschickt worden, nach Ablauf dieser Frist als Gemeiner in die Linientruppe eingereiht zu werden. Im Jahre 1854 trat ich nach meiner Entlassung aus dem Festungs-Gefängnis von Omsk als Gemeiner in das 7. Sibirische Linien-Infanterie-Bataillon; im Jahre 1855 wurde ich zum Unteroffizier befördert und im darauf folgenden Jahre 1856 wurde ich durch die Gnade Eurer Kaiserlichen Majestät beglückt und zum Offizier ernannt. Im Jahre 1858 haben mir Euer Majestät den erblichen Adel zu erstatten geruht. Im selben Jahre habe ich infolge der Epilepsie, welche sich schon im ersten Jahre meiner Zwangsarbeit eingestellt hatte, um meine Entlassung eingereicht und jetzt, nach Erhalt meines Abschiedes, bin ich zum Aufenthalt nach Twer übersiedelt. Meine Krankheit nimmt fortwährend zu. Nach jedem Anfalle verliere ich sichtlich an Gedächtnis, Vorstellungsgabe, seelischen und körperlichen Kräften, der Ausgang dieser Krankheit ist — Lähmung, Tod oder Wahnsinn.
Ich habe eine Gattin und ein Stiefsöhnchen, für das ich zu sorgen habe. Ich habe keinerlei Besitz und erwerbe mir den Lebensunterhalt einzig und allein durch litterarische Thätigkeit, welche bei meinem kränklichen Zustande eine mühevolle und erschöpfende ist. Dabei aber geben mir die Ärzte Hoffnung auf Genesung, die sie auf den Umstand gründen, dass meine Krankheit keine ererbte, sondern eine erworbene ist. Nun aber kann ich ernste und gründliche ärztliche Hilfe nur in St. Petersburg erlangen, wo sich Ärzte befinden, welche sich speziell mit der Erforschung der Nervenkrankeiten beschäftigen. Euer Majestät! In Ihrer Hand liegt mein ganzes Schicksal, meine Gesundheit, mein Leben. Gestatten Sie mir, nach Petersburg zu fahren, um den Rat der Ärzte einzuholen. Erlösen Sie mich und schenken Sie mir die Möglichkeit, mit der Herstellung meiner Gesundheit meiner Familie, vielleicht auch auf irgend eine Weise meinem Vaterlande nützlich zu sein! In Petersburg haben zwei meiner Brüder ihren beständigen Aufenthalt, von denen ich nun über zehn Jahre getrennt bin; ihre brüderlichen Bemühungen um mich könnten dazu beitragen, meine schwere Lage zu erleichtern. Aber, ungeachtet aller meiner Hoffnungen, kann ein schlimmer Ausgang meiner Krankheit und mein Tod meine Gattin und mein Stiefsöhnchen ohne jegliche Hilfe zurücklassen. So lange noch ein Tropfen Gesundheit und Kraft in mir übrig ist, werde ich arbeiten, um sie zu sichern — allein über die Zukunft waltet Gott, und menschliche Hoffnungen sind unzuverlässig.
Allergnädigster Herr! Verzeihen Euere Kaiserliche Majestät mir auch die zweite Bitte und geruhen Sie, mir eine ausserordentliche Gnade zu gewähren, indem Sie anordnen, dass man meinen zwölfjährigen Stiefsohn Paul Issajew auf Staatskosten in ein Petersburger Gymnasium aufnehme. Er ist von erblichem Adel, Sohn des Gubernial-Sekretärs Alexander Issajew, welcher in Sibirien in der Stadt Kuznjezk, Gouvernement Tomsk, im Dienste Ihrer Kaiserlichen Majestät gestorben ist — einzig und allein darum gestorben, weil ärztliche Hilfsmittel in jenem öden Lande unzulänglich sind, wo er gedient und Gattin und Sohn ohne jegliche Mittel zurückgelassen hat. Sollte aber die Aufnahme Paul Issajews in ein Gymnasium unmöglich sein, so geruhen Sie, Herr, anzuordnen, dass er in eines der Petersburger Kadetten-Korps aufgenommen werde. Sie werden seine Mutter beglücken, welche ihren Sohn täglich lehrt, um das Glück Euer Kaiserlichen Majestät und Ihres erhabenen Hauses zu beten. Sie, Herr, sind wie die Sonne, welche über Gerechte und Ungerechte scheint. Sie haben schon Millionen Ihres Volkes beglückt, beglücken Sie auch eine arme Waise, seine Mutter und einen unglücklichen Kranken, von dem der Bann bis heute noch nicht genommen ist, und welcher bereit ist, sofort sein Leben für den Kaiser, den Wohlthäter seines Volkes, hinzugeben.“
Ganz abgesehen von dem Aufschwung, den die Hoffnung aller nach dem Regierungsantritte des Zaren Alexander II. genommen hatte, von der Zuversicht auf die Reformen des jungen Kaisers und der Liebe, die ihm das Land entgegen brachte, ist dieses Schreiben überschwänglicher Unterwürfigkeit, die im Munde eines Europäers nur servil wäre, im Munde eines echten Russen aber etwas von den Naturlauten eines Kindes hat, das vertrauensvoll und ohne Umschweife alle seine Wünsche und Leiden dem „Väterchen“ zu Füssen legt. Der einfach sachliche Ton, der in der Erzählung der Geschichte dieser schweren Jahre liegt, das naive Fordern und Begründen der Forderung eins und zwei lässt diesen Brief als eine intime Mitteilung erscheinen, an die sich die Unterwürfigkeit des Schlusses und mancher Wendung ganz anders anschliesst, als dies etwa in einem europäischen Majestätsgesuch der Fall sein könnte.
Wie kompliziert jedoch die Erledigung dieser Angelegenheit durch des Dichters Ungeduld geworden ist, davon giebt ein Brief, der letzte, den er aus Twer an Wrangel richtet, ein deutliches Bild.
„Sie schreiben,“ — heisst es darin — „warum ich, da ich die Einwilligung Dolgorukows und Timaschews (des General-Adjutanten) zur Niederlassung in Petersburg habe, nicht zu Euch komme? Das ist ja das Elend, lieber Freund, dass es unmöglich ist, denn die Sache steht jetzt beim Kaiser. Ich habe nämlich an Ihn geschrieben und jetzt wird schon Er entscheiden. Ich habe vorgehabt, nur auf einige Zeit hinzufahren, da, wenn Dolgorukow damit einverstanden ist, dass ich endgiltig nach Petersburg übersiedle, er auch nicht ungehalten sein wird, wenn ich in Erwartung der letzten Entscheidung auf einige Tage dahin komme. Ich hatte mich schon fast entschlossen, zu reisen, und sprach davon mit dem Grafen Baranow (dem damaligen Gouverneur). Allein der hat mir davon abgeraten, da er fürchtete, ich könne mir dadurch schaden, dass ich mir eigenmächtig ein Recht herausnehme, um das ich erst vorlängst gebeten, und ohne noch eine Antwort darauf erhalten zu haben. Sie müssen selbst zugeben, lieber Freund, dass ich ja nicht reisen kann, wenn Baranow es nicht gerne sieht. Ohne es ihm mitzuteilen aber konnte ich nicht abreisen. Er hat mein Schreiben an den Kaiser gesandt (durch Adlerberg) und hat dabei gebeten, es in seinem Namen zu übergeben, folglich hat er als Gouverneur für mich Bürgschaft geleistet, darum wäre es meinerseits unzart, in aller Stille fortzufahren. — Und darum habe ich folgendes ausgedacht, wozu auch der Graf mir geraten“ usw.
Es folgt nun eine Reihe von Kombinationen, wie die Sache, ohne hier und dort anzustossen, schnell durchgeführt werden könne.
Die Belege zu den oben erwähnten Stellen, sowie zwei Briefe Dostojewskys an Baranow und Dolgorukow sind uns gleichfalls zur Abschrift übermittelt worden; wir glauben aber, dass es hier nicht darauf ankommt, diese Bitt-Korrespondenz voll wiederzugeben. Wir beschränken uns hier auf eine Aufzählung der Dokumente, welche im Zeitraum jener fünf Jahre 1854-1859 mit den wichtigeren Ereignissen im Leben des Dichters zusammenhängen. Dazu gehören: ein Rapport des Gouverneurs von Tobolsk an den Kaiser (15. April 1853), dass sich Durow und Dostojewsky in der Festung gut gehalten haben, ferner die Bitte, ein patriotisches Gedicht gelegentlich des Orientkrieges in den „Petersburger Nachrichten“ veröffentlichen zu dürfen (26. Januar 1854), die auf die besondere Verwendung des Prinzen Peter von Oldenburg und des General-Adjutanten Graf Totleben erfolgte Beförderung Dostojewskys zum Unteroffizier (28. Februar 1856 Nr. 335), die Verfügung des Kriegsministers (Nr. 2634), dass ihm der Adel wiedergegeben werde (1857), Mitteilung des General-Auditoriats (Suchosanet) des Kriegsministeriums an den Herrn Chef der Gendarmerie Fürst Dolgorukow, dass Th. M. Dostojewsky infolge aufrichtiger Reue und guter Aufführung und auf spontane Verwendung des Grossfürsten Michael Pawlowitsch unter fortlaufender geheimer Überwachung zum Fähnrich befördert wurde (20. Oktober 1856 Nr. 6118).
Die geheime polizeiliche Aufsicht scheint übrigens noch sehr lange über Dostojewsky gewaltet zu haben, da sich seine Witwe erinnert, wie in seinen späten Lebensjahren irgend ein Funktionär sich gelegentlich einer kleinen Ortsveränderung ihres Gatten darüber wunderte, nichts davon gewusst zu haben. Es kann indessen immerhin sein, dass ein dienstbeflissener Unter-Staatsmann, wie es deren in Russland nur allzuviele giebt, diesen geheimen Schutz auf eigene Faust zum Besten Dostojewskys und des gefährdeten Staates unternommen hatte. Der letzte der in der „Niva“ veröffentlichten Briefe schliesst unmittelbar an jene an, welche sein Gesuch um die Erlaubnis zur Heimkehr besprechen. Er ist vom 12. November 1859 datiert und wiederholt die Reihe seiner Bemühungen, die bis dahin ohne Resultat geblieben waren. Bemerkenswert ist in diesem Briefe der praktische Geist, welcher sich darin kundgiebt. Nicht etwa, als wäre Dostojewsky eine bis in das Detail des Lebens praktische Natur gewesen, allein er besass, wie die meisten genialen Menschen, eine Art Praxis in theoretischer Form, einen Zug ins Grosse, der ihm den Gedanken mancher Unternehmung eingab, die er allerdings in der Wirklichkeit nicht festzuhalten und auszuführen vermochte. Darüber spricht sich N. Strachow, der ihn in seiner Geschäftsgebahrung sehr nahe kannte, in seinem Beitrage zu den „Materialien“ eingehend aus. „Ich muss hauptsächlich darum in Petersburg sein, um den Verkauf meiner Werke zu betreiben. Übrigens habe ich einen Plan im Kopfe — nämlich: die Sachen nicht um Geld herzugeben, sondern sie in 2000 Exemplaren, wenn das nötig sein sollte, bei Schtschepkin und Soldatenkow in Moskau zu drucken. Sie geben kein Geld, sondern drucken die Werke und machen sich zuerst beim Verkauf bezahlt, mit Zuschlag vernünftiger Prozente natürlich. Dies scheint mir aus vielen Ursachen günstiger zu sein. (Es wäre zu weitläufig, wollte ich mich jetzt des längeren darüber ausbreiten.) Ich würde es unbedingt so machen, wenn ich sofort nach meiner Ankunft in Petersburg Geld zum Leben hätte (ausser dem, welches ich von Krajewsky bekomme).[13] Du begreifst, dass mich dies alles sehr interessiert. Da ist Leben und Zukunft. Nimm übrigens meine Worte nicht à la lettre und verkaufe die Sachen für Geld, wenn sich nur immer eine Gelegenheit dazu bietet. Diese Gelegenheit aber suche, ohne meine Ankunft in Petersburg zu erwarten. Begreife, dass die Zeit vergeht; es wäre schon Zeit, zu drucken — sie vergeht und dabei gehen auch die Chancen des Gewinns verloren ....
Aber — der Teufel hole das Geld! Dich möcht’ ich umarmen — das ist’s! Könnt’ ich mich nur schon bald neben Euch niederlassen, in Eurem Kreise sein. Es ist mir schwer, hier zu leben. Ich kann nichts anfangen, so sehr bin ich durch vieles innerlich bewegt; die Zeit vergeht ... Du ahnst nicht, Mischa, was das heisst: etwas erwarten! Ein Monat! Ja, wird es nach einem Monat damit aus sein? Vielleicht vergehen auch drei, ja vier Monate. Du schreibst über eine Idee, zu deren Ausführung man für den Anfang 15-20000 Rubel brauchte. Mich regt das alles sehr auf, Bruder. Es ist, als wären gerade wir irgendwie fluchbeladen. Man sieht andre: weder Talent, noch Fähigkeiten — es werden aber Leute aus ihnen, sie hinterlassen ein Kapital. — Wir aber kämpfen, kämpfen, schlagen uns herum .... Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass wir beide bedeutend mehr Geschick und Fähigkeiten und Sachkenntnis haben (sic), als .... Das ist ja litterarisches Bauernvolk, dabei aber werden sie reich und wir sitzen auf dem Sande. Du, zum Beispiel, hast Dein Geschäft angefangen. Wie viele Mühe und was für Resultate?[14] Was hast Du verdient? Du musst noch Gott danken, dass Du etwas hattest, wovon Du leben und Deine Kinder erziehen konntest. Dein Geschäft ging bis zu einem gewissen Punkte in die Höhe, dann stockte es. Das ist traurig für einen Menschen von Deinen Fähigkeiten. Nein, Bruder, wir müssen nachdenken und das recht ernstlich. Wir müssen etwas wagen und irgend ein litterarisches Unternehmen ins Werk setzen — eine Zeitschrift zum Beispiel. Übrigens werden wir darüber nachdenken und miteinander darüber reden. — — —
Bei meinem Roman ist thatsächlich wenig herausgekommen: 13-14 Druckbogen ist sehr wenig, und ich erhalte dafür weniger, als ich erwartete. Aber wie brauch’ ich’s! Schicke mir um Gottes Willen ein Separat-Exemplar noch vor dem Erscheinen des Buches; bedenke, wie sehr mich dies alles interessiert. Auf 8¾ Bogen kommen 1050 Rubel, folglich gebühren mir nach Abtragung meiner Schuld an Dich (von 375 Rubel) — 175 Rubel, nicht 125 Rubel. Ich bitte Dich sehr, trachte sie so schnell als möglich zu erhalten und schicke sie mir jedenfalls sofort. Wer weiss, vielleicht entscheidet sich mein Schicksal; dann werde ich Geld brauchen, um von hier fortzukommen. Darum schicke es so schnell als möglich.
Lebe wohl, ich umarme Dich, schreibe was immer und so bald als möglich.
Dein
Dostojewsky.
Wenn der Roman erscheint — teile mir sofort und bis ins Kleinste alles mit, was Du über ihn hören wirst, was für Meinungen geäussert werden, wenn überhaupt Meinungen da sein werden.“
Endlich, am 29. November 1859, wird das Gesuch erledigt. Das Original trägt in der Handschrift des Chefs der Gendarmerie, Fürsten Dolgorukow, den Bescheid:
„Hohenorts ist der Befehl ergangen, dass man betreffs Issajews die nötigen Massregeln nehme. Was Dostojewsky anbelangt, so ist seine Bitte schon nach dem Briefe erledigt worden, den er an mich schrieb.“
Der Dichter übersiedelt nun nach Petersburg, und hier erleidet die Korrespondenz naturgemäss kürzere und längere Unterbrechungen.
Über den Empfang des Dichters in Petersburg und den Eindruck, den er auf die Freunde hervorgerufen, citiert O. Miller den Bericht A. P. Miljukows, den wir hier nachcitieren. „Einmal“, sagt Miljukow, „kam Michael Michailowitsch früh am Morgen mit der freudigen Botschaft zu mir, dass man entschieden habe, der Bruder dürfe in Petersburg leben, und dass er am nämlichen Tage ankommen werde. Wir eilten auf den Bahnhof der Nikolaewsker Eisenbahn, und dort endlich umarmte ich unseren Verbannten nach einer Trennung von nahezu zehn Jahren. Den Abend brachten wir alle miteinander zu. Theodor Michailowitsch, so schien es mir, war physisch gar nicht verändert; sein Blick war sogar kühner als früher, und sein Gesicht hatte nicht das geringste von seiner gewöhnlichen Energie verloren. Ich erinnere mich nicht daran, wer von den gemeinsamen Bekannten an diesem Abend zugegen gewesen ist, allein es ist mir im Gedächtnis geblieben, dass wir bei diesem ersten Beisammensein nur Neuigkeiten und Eindrücke austauschten und früherer Jahre und alter Freunde gedachten. Nachher sehen wir einander nahezu jede Woche.“
In Bezug darauf, wie sich Theodor Michailowitsch zu den Erlebnissen in Sibirien verhielt, bemerkt Miljukow, dass er „sich niemals über sein eigenes Schicksal beklagte ... freilich“ — sagt er — „auch von anderen zurückgekehrten Petraschewzen habe ich nie Gelegenheit gehabt, heftige Klagen zu hören, allein bei diesen kam das von der, dem Russen angebornen, Eigenschaft, das Böse zu vergessen; bei Dostojewsky jedoch vereinigte sich diese Eigenschaft noch gleichsam mit einem Gefühl von Dankbarkeit gegen das Schicksal, welches ihm die Möglichkeit gegeben hatte, in seiner Strafzeit nicht nur die russischen Menschen, sondern auch zugleich sich selbst besser verstehen zu lernen“.
Nicht ohne Grund hat Theodor Michailowitsch später durch den Mund des „Idioten“, den er mit vielem Eigenen ausgestattet hat, ausgesprochen: „es schien mir, dass man auch im Gefängnis ein ungeheures Leben finden kann“. „Unsere Unterhaltungen im neuen Freundeskreise“ — fährt Miljukow fort — „glichen jenen, die im Durowschen Kreise stattgefunden hatten, in vielem nicht mehr. Und konnte das anders sein? Es war, als hätten das westliche Europa und Russland in diesen letzten zehn Jahren geradezu die Rollen vertauscht: dort waren die uns ehemals mit sich fortreissenden humanitären Utopien in Rauch aufgegangen, und die Reaktion hatte überall den Sieg errungen; hier aber begann vieles zur Thatsache zu werden, wovon wir geträumt hatten, und es bereiteten oder vollzogen sich Reformen, welche das russische Leben erneuerten und neue Hoffnungen keimen machten. Es ist natürlich, dass der ehemalige Pessimismus in unseren Unterhaltungen keinen Raum mehr fand.“
Diese Äusserungen, so wertvoll sie uns für das Zeitbild der jungen, auf Alexander und seine Reformen gesetzten Hoffnungen sein mögen, scheinen als eine Reminiscenz an Dostojewsky in seinem Sterbejahr 1881 in der „Russkaja Starina“ (Maiheft p. 35-36-40) publiziert worden zu sein und werden wohl von uns Westeuropäern trotz allen Beklagens der bei uns in Rauch aufgegangenen Utopien doch mit einem gewissen Lächeln der Rührung über die russische Genügsamkeit aufgenommen werden, die in irgend einer Epoche der russischen Zeitgeschichte für den „Pessimismus keinen Raum mehr fand.“
Nach diesen freudigen Anläufen finden wir den Dichter bald genug von den Beschwerden des Petersburger Lebens angewidert und schon anfangs 1860 ersehen wir aus kleinen Mitteilungen an Freunde und Bekannte, dass Petersburg im Dichter nach so langer Abwesenheit keine glückliche Stimmung hervorzurufen vermag. So heisst es in dem Fragment eines Briefes vom 14. März 1860 an eine Frau Sch., das nach des Dichters Tode ebenfalls in der „Russkaja Starina“ (wohl auch durch Miljukow) mitgeteilt wurde: „Wenn man nur auf acht Tage dieses hässliche Petersburg hinter sich lassen könnte! ... vielleicht kommt unser Ausflug nach Moskau doch zustande.“ Nach seiner Rückkunft aus Moskau schreibt er: „Da bin ich nun wieder ins feuchte, ins Patschwetter, ins Ladoga-Eis, in die Langweile zurückgekommen.“ .... Weiter heisst es: „Ich bin zurückgekehrt und befinde mich in einem förmlichen Fieberzustand. An alledem ist mein Roman schuld. Ich will was gutes schreiben, ich fühle, dass Poesie darin ist, ich weiss, dass von seinem Gelingen meine ganze schriftstellerische Karriere abhängt ... Drei Monate lang wird es nun heissen Tag und Nacht dabei sitzen — (es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach, sagt O. Miller, um den grossen, noch in Sibirien ersonnenen Roman). Im selben Briefe treten die warmen Beziehungen zu Tage, welche Dostojewsky zu den litterarischen Versuchen der jungen Generation unterhält. „Ich habe Krestowsky gesehen,“ schreibt er einmal, „ich habe ihn sehr lieb. Er hat ein Gedicht geschrieben und es uns mit Stolz vorgelesen. Wir haben ihm alle gesagt, dass dieses Gedicht etwas entsetzlich Abscheuliches ist (da wir unter uns übereingekommen sind, die Wahrheit zu reden). Und nun? nicht im geringsten war er beleidigt! ein lieber, edler Junge. Er gefällt mir so sehr (immer mehr und mehr), dass ich ihm nächstens einmal beim Trinken das Du anbieten werde.“ — —
Wir gelangen nun zu jenem Abschnitt im Leben und Wirken Dostojewskys, welcher mit der wichtigsten Wandlung in der Geschichte Russlands zusammenfällt, nämlich zum Heraustreten des Dichters in die Arena des politischen Lebens, an welchem als Publizist teilzunehmen er sich seiner Mission nach gedrungen fühlt. Es ist dies gegen Ende des Jahres 1861, da er die Monatsschrift „Wremja“ gründet, um darin seine Gedanken über die grosse Umwälzung auszusprechen, welche die am 19. Februar erfolgte Aufhebung der Leibeigenschaft einleitete. Diese Epoche ist uns Westländern nicht genug bekannt, um uns einen klaren Überblick der damaligen politisch-litterarischen Situation des Landes zu gewähren, ist aber so interessant, was die Stellung der Parteien, den Anteil der Jugend daran, die Folgen derselben betrifft, dass wir hier weiter ausholen müssen, indem wir den beiden Herausgebern der „Materialien“ das Wort lassen.
N. Strachow, Dostojewskys Mitarbeiter, beginnt die Besprechung der damaligen politischen Lage mit einer Präzisierung des Wortes „Liberalismus“, „des russischen Liberalismus“, der von den Westländern nicht richtig verstanden werde. Am Schlusse dieser Erörterung heisst es: „Leider besteht bei uns, ungeachtet aller historischen Erfahrungen, ungeachtet aller gedruckten und gesprochenen Erläuterungen ein sehr grosser Wirrwarr in den Begriffen, welcher natürlich durch unsere Lehrmeisterin Europa unterhalten wird, und der wahre Sinn des Liberalismus ist fast gänzlich darüber verloren gegangen. Dass der Liberale im wesentlichen in den meisten Fälle konservativ sein muss, aber nicht Progressist und in keinem Falle revolutionär, das wissen und begreifen wohl sehr wenige.“ — „Einen solchen wirklichen Liberalismus,“ fährt Strachow fort „bewahrte Theodor Michailowitsch bis an sein Lebensende, sowie ihn jeder aufgeklärte und nicht verblendete Mensch bewahren soll.“
Dieser Satz bedarf ebenso sehr der Erläuterung, als nach Strachows Meinung der russische Liberalismus. Strachow versteht unter „Progressist“ nicht einen für den Fortschritt im allgemeinen Eintretenden, sondern vielmehr jene Gattung von Politikern, welche den Fortschritt der russischen Kultur nicht sowohl in einer organischen Fortentwickelung auf nationaler Grundlage, als in einer beschleunigten Anwendung der Lehren des Westens sahen und anstrebten. Auch Dostojewsky hat sich, ohne ein „Progressist“ zu sein, immer und überall für den Fortschritt eingesetzt und meint es sehr ernst damit, wenn er den müssigen Byrons der jungen Generation zuruft: „Ich wüsste wohl eine Arbeit für Euch, aber Ihr werdet sie nicht leisten wollen, sie zu gering achten, ob sie auch die einzige ist, die uns jetzt zukommt: Lehrt auch nur einen kleinen Bauernjungen lesen.“ „Ich will hier“ — setzt der Berichterstatter fort — „eines der wichtigsten Vorkommnisse jener Zeit erzählen, die sogenannte Studentengeschichte, welche sich zu Ende des Jahres 1861 abspielte und den damaligen Zustand der Gesellschaft am vortrefflichsten beleuchtet. In dieser Geschichte wirkten sicherlich verschiedene innere Triebfedern mit; allein ich werde sie nicht berühren, sondern ihre äussere öffentliche Erscheinung schildern, welche sowohl für die Mehrzahl der Agierenden als auch der Zusehenden von der grössten Bedeutung war.
Infolge des Zuströmens des Liberalismus schäumte die Universität immer mehr und mehr von Leben und von Bewegung über, leider aber von einem solchen Leben, das die Beschäftigung mit der Wissenschaft erstickte. Die Studenten hielten häufige Zusammenkünfte, gründeten eine Kasse, eine Bibliothek, gaben ein Sammelwerk heraus, übten ein Richteramt über ihre Kameraden aus usw., aber alles dieses zerstreute sie und regte sie so sehr auf, dass die Mehrheit, ja sogar viele der Begabtesten und Gescheitesten unter ihnen aufhörten zu studieren. Es gab auch nicht wenige Unzulässigkeiten, d. h. Überschreitung der Grenzen aller möglichen Dispense, und so entschloss sich die Studien-Obrigkeit endlich Massregeln zu ergreifen, um diesem Lauf der Dinge ein Ende zu machen. Um sich eine widerspruchslose Autorität zu sichern, verschaffte sie sich einen Allerhöchsten Befehl, vermittelst dessen Zusammenkünfte, Kassen, Deputationen und Ähnliches verboten wurde. Der Befehl wurde im Sommer ausgegeben, und als im Herbste die Studenten sich auf der Universität zeigten, musste er in Anwendung gebracht werden. Die Studenten dachten, sich zu widersetzen, beschlossen jedoch, es einzig und allein durch einen Widerstand zu thun, welchen die liberalen Grundsätze sanktionieren, d. h. durch passiven Widerstand. So geschah es auch. Sie hingen sich an jeden Vorwand, welcher geeignet war, den Behörden soviel Arbeit und der Sache soviel Publicität als möglich zu schaffen. Sie brachten höchst künstlich den ausgiebigsten Skandal zustande, den man nur in Scene setzen kann.
Die Behörden waren so gezwungen, sie zwei- oder dreimal bei Tage, auf offener Strasse in grossen Haufen fortzuführen. Zur grösseren Freude der Studenten setzte man sie sogar in die Peter Pauls-Festung. Sie unterwarfen sich ohne Widerrede diesem Arrest, später dem Urteilsspruch der Verschickung, welche für viele eine sehr schwere und langwährende wurde. Nachdem sie das gethan hatten, dachten sie, alles gethan zu haben, was nötig war, nämlich: sie hatten laut über die Verletzung ihrer Rechte gesprochen, waren selbst nicht über die Grenzen der Gesetzlichkeit geschritten und hatten eine schwere Strafe über sich ergehen lassen, gleichsam rein nur darum, weil sie von ihren Forderungen nicht abgewichen waren. Obwohl nun diese juridischen Begriffe in Wirklichkeit nicht auf Studierende anwendbar sind, so führten die Studenten dieses liberal-juridische Drama zum Nutz und Frommen der übrigen Staatsbürger tadellos und mit wahrer Begeisterung durch. Es war durchaus kein Aufruhr, auch nicht im allerkleinsten Ausmasse.
Das Interessanteste und Charakteristischste dabei ist, dass sich damals Leute fanden, welche sehr wünschten, diese Geschichte in einen Aufruhr umzuwandeln, dass man Beratungen darüber abhielt, ihnen z. B. vorschlug, irgend eine Unthat zu begehen, welche die Behörden in eine fatale Lage brächte usw. Revolutionäre Elemente waren in der Gesellschaft herangereift, allein diesmal bewahrte der Liberalismus seine Reinheit, und es war nur eine grosse Demonstration vollbracht worden, gleichsam eine Anklage vor dem Forum der öffentlichen Meinung.
Natürlich sprach die ganze Stadt nur von den Studenten. Man hatte gestattet, dass die Eingeschlossenen besucht würden, und so kamen täglich sehr viele Besucher in die Festung. Auch von der Redaktion der „Wremja“ ward ihnen ein Gastgeschenk gesendet. Bei Michael Michailowitsch wurde ein ungeheures Roastbeef gebraten und mit Hinzufügung einer Flasche Cognac und einer Flasche roten Weines in die Festung gesandt. Als man endlich begann, jene Studenten, welche man als die Schuldigsten befunden hatte, fortzuführen, begleiteten Freunde und Bekannte sie weit über das Weichbild der Stadt hinaus. Die Abschiedsgrüsse waren vielseitig und laut und die Verschickten schauten zum grossen Teil wie Helden drein.“
Hier wird der Westeuropäer unwillkürlich im Lesen innehalten und über die Selbstverständlichkeit und Einfachheit staunen, mit welcher ein „russischer Liberaler“ von Festungsstrafen und Verschickung junger Schwärmer spricht. Es tritt uns da förmlich eine „erbliche Belastung“ mit dem Verschickungs-Begriffe entgegen, von dem auch der liberalste Russe heute nicht frei sein kann.
„Diese Geschichte“ — fährt Strachow fort — „wickelte sich im selben Geiste weiter ab. Man schloss die Universität, um sie einer vollständigen Umgestaltung zu unterwerfen. Da baten die Professoren um die Erlaubnis, öffentliche Vorlesungen zu halten, und erhielten diese Erlaubnis ohne Mühe. Die Duma (der Stadtrat) überliess ihnen ihre Säle zu diesem Zwecke, und so wurden die Universitätskurse eröffnet. Alle Schritte für das Arrangement der Vorlesungen sowie die Sorge für die Aufrechthaltung der Ordnung nahmen die Studenten auf sich und waren mit dieser neuen, freien Universität sehr zufrieden und sehr stolz darauf. Allein ihre Gedanken waren nicht mit der Wissenschaft beschäftigt, um welche sie sich augenscheinlich so bemüht hatten, sondern mit etwas anderem, und das verdarb zuletzt alles. Die Ursache der Aufhebung dieser Rathaus-Universität war der bekannte „litterarisch-musikalische“ Abend des 2. März 1862. Dieser Abend war mit der Absicht veranstaltet worden, gleichsam eine Auslese aller vorgeschrittensten, progressivistischen Kräfte vorzuführen. Die Wahl der Schriftsteller in diesem Sinne war auf das Sorgfältigste vorgenommen worden, und das Publikum war im selben Sinne ebenfalls das sorgsam ausgewählteste. Sogar die Musikstücke, mit welchen die litterarischen Produktionen abwechselten, wurden von den Frauen und Töchtern von Schriftstellern „der guten Richtung“ ausgeführt. Theodor Michailowitsch war in der Zahl der Lesenden und seine Nichte in jener der Mitwirkenden.
Es handelte sich nicht um das, was gelesen und vorgestellt wurde, sondern um die Ovationen, welche man den Vertretern fortschrittlicher Ideen brachte. Der Lärm und Enthusiasmus war ein ungeheurer, und es hat mir später immer geschienen, dass dieser Abend der höchste Punkt war, den die liberale Bewegung unserer Gesellschaft erreicht hatte, und zugleich der Kulminationspunkt unserer Seifenblasen-Revolution. Eine Episode dieses Abends bildete den Beginn des Verfalls und der Entzauberung unserer damaligen Fortschritts-Bewegung. Professor P.... las an jenem Abend seinen Artikel, welcher, wie alles andere das vorgetragen wurde, vorher der Zensur unterbreitet worden war. Er las ihn ohne jede Abänderung, aber mit so ausdrucksvollen Intonationen und Gesten, dass ein durchaus zensurwidriger Sinn dabei herauskam. Es entstand ein Freudengeschrei, ein unbeschreiblicher Jubel. —
Und nun: am nächsten Tage verbreitet sich plötzlich die Nachricht, dass der Professor arretiert und aus Petersburg fortgeschickt worden sei. Was war nun zu thun? In welcher Weise sollte man gegen eine solche Massregel protestieren? Die Studenten folgerten, ganz logisch, dass die Entfernung eines Professors eine Bedrohung der übrigen Professoren in sich schliesse, dass diese deshalb ihre Vorlesungen nicht fortsetzen könnten, wenn sie nicht dadurch zu zeigen wünschten, dass sie ihren Kollegen für schuldig erachten und vor der Behörde selbst als Unschuldige dastehen wollten. Es wurde beschlossen die Rathaus-Universität zu schliessen und dadurch gegen jeglichen Zwang zu protestieren — ein bekanntlich sich fortwährend wiederholender Vorgang an den russischen Universitäten, etwas das Ähnlichkeit hat mit dem japanischen Selbstmord. Die Studenten setzten voraus, dass die ganze Gesellschaft von Betrübnis und Zorn erfüllt sein werde, wenn so plötzlich die Hauptquelle ihrer Aufklärung verstopft würde. Die Professoren willfahrten dem Wunsche der Studenten und sagten ihre Vorlesungen ab, mit Ausnahme eines oder zweier von ihnen, welchen dafür die Hörer Skandale machten. Endlich mischte sich die Obrigkeit hinein und machte der ganzen Sache ein Ende, indem sie den Professoren überhaupt verbot, öffentliche Vorlesungen zu halten.“
„Was war nun das Resultat der ganzen Affaire? Es zeigte sich gleich, dass der schlimme Plan die Gesellschaft aufzuregen und sie gegen die Obrigkeit aufzureizen vollkommen misslang. Die Gesellschaft rührte sich nicht, und anstatt zu wachsen, erlosch die Bewegung vollständig. Die Führer in dieser Sache hatten die allzu naive Vorstellung, dass der Lärm, welcher in ihren Zirkeln geschlagen wurde, der Ausdruck der allgemeinen Stimmung sei und dass es so leicht sein werde, das Publikum zu täuschen. In Wirklichkeit vermochte niemand ernstlich zu glauben, dass die Obrigkeit der Feind und Bedrücker der Aufklärung sei. Die Unterlage der Sache war allen gar zu durchsichtig, namentlich als zu gleicher Zeit eine Proklamation nach der andern auftauchte, deren erste hunderttausend Menschen in Russland als der öffentlichen Wohlfahrt hinderlich erklärte, deren letzte schon direkt drohte, „die Strassen mit Blutströmen zu begiessen und keinen Stein auf dem andern stehen zu lassen.“
„Wie immer das nun gewesen sein möge, war die Obrigkeit, welche beständig bemüht gewesen war, den liberalen Charakter der Ereignisse zu wahren, in eine sehr schwierige Lage versetzt; es zeigte sich, dass jede liberale Massregel innerhalb der Gesellschaft eine Bewegung hervorruft, welche sich dieser Massregel zu ihren eigenen Zwecken bedient, welche durchaus nicht liberal, sondern ganz radikal sind. Diese Schwierigkeiten fanden nun ihr Ende durch die Petersburger Brände und den polnischen Aufstand, als es endlich klar wurde, dass man das Böse nicht dulden und seinem natürlichen Lauf nicht überlassen darf, wenn es so erschreckende Dimensionen angenommen hat.“
Wir sehen in diesen Worten den kennzeichnenden Ausdruck des russischen ehrlichen Liberalkonservativen reinsten Wassers, nämlich jener Richtung des Liberalismus, der nie und nirgend durch Zwang wirken will, sondern die Förderung fortschrittlicher Ideen nur mit solchen Mitteln für gerechtfertigt erachtet, welche keine anderen Freiheiten einschränkt — eine Anschauung, über die sich streiten lässt, die aber gerade in den Konstellationen der russischen Parteistandpunkte besondere Beachtung verdient. Dass diese Anschauung in Dostojewsky ihren genialsten und berechtigsten Vertreter gehabt hat, ist uns bereits aus seinem ganzen Leben und Wirken klar geworden. Wie er sich speziell zur Studenten-Affaire verhalten hat, das erfahren wir aus den Mitteilungen O. Millers, welcher uns jene Vorgänge in einer lebendigeren, intimeren und weniger doktrinären Form erzählt und speziell diese Sache anders beleuchtet, als Strachow. Wir werden durch diese zwei Berichte so recht in die Stimmung und das Milieu der grossen Befreiungsepoche hineinversetzt. Natürlich haben wir es auch hier mit einem Vertreter der konservativ-liberalen Richtung zu thun.
Nachdem Miller die Verteilung und Verschiebung der Parteien besprochen, welche aus sehr verschiedenen Gründen gegenüber der Aufhebung der Leibeigenschaft und ihren Folgen Stellung nahmen, und meint: „man begann uns eindringlich das ‚Sterben‘ zu lehren — gerade dann, als man uns hätte lehren sollen zu leben, ehrenhaft, aufopfernd, fest zu leben,“ — fährt er fort: „das ist’s, was ein Mensch bei uns antreffen musste, der aus Sibirien geschrieben hatte: „Mehr Glauben, mehr Einheit, und wenn noch Liebe dazu kommt, so ist alles gethan.“ „Das alles war den Unzufriedenen der Herrenpartei sehr zur Hand. Mit dem revolutionären Radikalismus — sei es auch vom entgegengesetzten Ende — ging der Konservatismus sehr wohl zusammen, der — ganz ebenso revolutionär war, wie ihn J. Th. Samarin treffend benannt hat. Es ist auch bekannt, dass jenem ‚Nihilismus‘, dessen erste Formation sozusagen Turgenjew in der Person des Studenten mit burschikosem Unterfutter Bazarow aufgestellt hatte, derselbe Samarin ebenso treffend den Generals-Nihilismus entgegen gestellt hatte. Das französische Sprichwort „les extrêmes se touchent“ ist bei uns auf die glänzendste Weise zur Wahrheit geworden.
Dies konnte ein jeder wahrnehmen, der zufällig an jenem denkwürdigen litterarischen Lese-Abend gegenwärtig war, da der zur 1862 stattfindenden Feier des tausendjährigen Bestandes Russlands verfasste Artikel vorgelesen wurde. Die grosse Reform (Aufhebung der Leibeigenschaft) hatte sich gerade am Vorabende des Millenniums vollzogen und man hätte nun dieses, sollte man meinen, mit beruhigtem Gewissen und einem furchtlosen Blick in die Zukunft feiern können. Als der Lesende zum „Wermutsbecher“ gekommen war, „den das russische Volk im Laufe seines tausendjährigen Lebens hatte leeren müssen,“ sagte er: „Zur Zeit der Thronbesteigung des heute glücklich regierenden Kaisers und Imperators lief der Becher über ...“ Man liess ihn nicht vollenden: „dass der Zar jenen Überschuss von Bitternis daraus weggegossen, welcher sich durch die Leibeigenschaft darin angehäuft hatten — man fasste seine Worte in einem durchaus anderen Sinne auf, als in welchem sie gesagt worden waren, und es brach ein frenetischer Sturm von Applaus und Bravorufen aus. Ich erinnere mich daran, als wäre es heute, mit welchem wollüstigen Entzücken damals gerade die Repräsentanten des nicht verpönten Nihilismus applaudierten — dies war an den Dekorationen ersichtlich, welche sie ungeachtet dessen trugen, dass sie sich in ihren „heiligsten Gefühlen“ verletzt fühlten. Als nun der Vortragende zum Satze kam: „Unsere Administratoren stehen am Rande eines Abgrundes,“ da floss der Enthusiasmus dieser Nihilisten thatsächlich mit dem Enthusiasmus jener Nihilisten zusammen — obwohl, natürlich, jede der extremen Richtungen das Wort ‚Administratoren‘ in ihrer Weise verstand.“
O. Miller erinnert sich nicht, ob Dostojewsky an jenem Abende teilgenommen habe, findet aber den zehn Jahre später im Roman „Die Besessenen“ beschriebenen Leseabend den getreuen Spiegel der hier vorgefallenen Affäre und fügt hinzu, Dostojewsky habe an irgend einem anderen Leseabend Teile aus den „Memoiren aus einem Totenhause“ vorgelesen und das mit Absicht in einem Sinne und Geiste, welcher jenem der Einberufer entgegengesetzt war. Es scheint hier ein Gedächtnisfehler obzuwalten, der indes nichts zu sagen hat, da ja in keinem Berichte dieser beiden Freunde des Dichters je ein Irrtum betreffs der Grundtendenz Dostojewskys vorkommen könnte. Die Erzählungen jener lärmenden Begebenheit selbst jedoch weichen, wie wir sehen, ziemlich von einander ab, und was wir Westländer daraus gewinnen können, ist vornehmlich der Einblick in die Verschiebungen der Standpunkte, wie sie in dem von politisch-litterarischem Leben so heftig pulsierenden Russland sogar innerhalb einer und derselben Partei möglich sind. Die Herausgeber der Materialien gehören beide der konservativ-liberalen Richtung an, dennoch sehen wir in Strachow die Thatsachen bei aller Objektivität der Erzählung gleichsam nach der streng-konservativen, fast möchte man sagen offiziellen Seite umgebogen, während O. Miller mit der feinen Anführung des „Generals-Nihilismus“ dem eigenen Konservatismus gleichsam die Spitze abbricht.
Dieselbe Studenten-Affäre, welche offenbar eine sehr grosse Rolle in der Geschichte der russischen Reformjahre spielt, ist wohl oft genug auch von der gegnerischen Seite aus besprochen worden. Einen längeren Artikel widmet ihr auch der Ukrainophile Dragomanow in dem vor einigen Jahren von ihm in Genf herausgegebenen Briefwechsel zwischen Turgenjew, Kavelin und Herzen. Wir haben es aber hier hauptsächlich mit Dostojewsky und seinem Standpunkt zu thun und fahren in der interessanten Wiedergabe seiner Ansichten durch O. Miller fort. Nach der, durch die uns bekannten Ereignisse erfolgten, Enthebung des Professors von seinem Lehramte und der vorhergegangenen Einschliessung der Studenten waren im Publikum und namentlich im Volke allerlei missverständliche Meinungen darüber entstanden; „die Gefängnishaft“ — fährt Miller fort — „hatte bekanntlich das Selbstgefühl der Jugend nur erhöht, das sie antrieb, neue Vorschriften abzulehnen, indem sie sich von einem übrigens durchaus ernsten und edlen Gefühle leiten liess, das ihnen verbot, mit jener Vorschrift einverstanden zu sein, wonach Alle verpflichtet waren, ein Kollegiengeld zu entrichten, wodurch alle jene jungen Leute des Zutritts zu höherer Bildung verlustig wurden, welchen die Mittel fehlten, diese Forderung zu erfüllen.“ Wer das nicht wusste, dem musste diese Auflehnung „um irgend welcher Matrikel willen“ in der grossen Stunde der Bauernbefreiung tragikomisch erscheinen. — Das Volk wusste natürlich nicht, um was es sich handle — und urteilte: „Die jungen Herrlein rebellieren, weil man uns die Freiheit gegeben hat.“ Zu Dostojewsky und seinen Ansichten über jene durcheinander gewirrten Verhältnisse übergehend, führt Miller jene Stelle aus dem „Tagebuch eines Schriftstellers“ aus dem Jahre 1873 an, welche sich darauf bezieht und eine Antwort auf die Zumutung ist, als sei Dostojewskys phantastische Satire „das Krokodil“[15] ein Ausfall auf Tschernyschewsky, den Autor des Romans „Was thun?“
„Mit Nikolaus Gawrilowitsch Tschernyschewsky“ — sagt Dostojewsky — „bin ich im Jahre 1859, im ersten Jahre nach meiner Rückkunft aus Sibirien, zusammengetroffen; ich weiss nicht mehr, wo und wieso es geschah.
Später begegneten wir einander manchmal, aber sehr selten, sprachen miteinander, aber sehr wenig. Übrigens reichten wir einander jedesmal die Hand. Herzen hat mir gesagt, Tschernyschewsky habe ihm einen unangenehmen Eindruck gemacht, d. h. durch sein Äusseres, seine Manieren. Mir gefielen das Äussere Tschernyschewskys und seine Manier ganz wohl.
Einmal, am Morgen, fand ich an meiner Wohnungsthüre, auf der Klinke des Schlosses, eine der bemerkenswertesten Proklamationen, welche damals auftauchten; und es tauchten damals nicht wenige auf. Diese hatte die Aufschrift: „An die junge Generation.“ Man kann sich nichts Abgeschmackteres und Dummeres vorstellen. Der Inhalt aufreizend in der lächerlichsten Form, welche nur ein Feind für diese Leute hätte ersinnen können, um sie selbst zu vernichten. Es wurde mir schrecklich zu Mute und ich war den ganzen Tag verdriesslich und verstimmt. Das war damals alles noch so neu und so nahe, dass es sogar noch schwer war, sich diese Leute gründlich anzuschauen. Schwer namentlich, weil es einem nicht recht glaubhaft erschien, dass sich unter all diesem Wirrwarr ein so leerer Unsinn verberge. Ich spreche nicht von der damaligen Bewegung als einem Ganzen, sondern bloss von den Menschen. Was die Bewegung anbelangt, so war sie eine dunkle, krankhafte, aber durch ihre historischen Konsequenzen verhängnisvolle Erscheinung, welche ein ernstes Blatt in der Petersburger Periode unsrer Geschichte ausfüllen wird. Ja, und dieses Blatt ist, scheint es, noch lange nicht zu Ende geschrieben.
Und nun wurde mir, der ich schon lange aus meiner Seele und meinem Herzen heraus weder mit diesen Leuten, noch mit dem Sinne ihrer Bewegung einverstanden war, — mir wurde verdriesslich zu Mute, mir war, als schämte ich mich gleichsam ihres Unverstandes ... Obwohl ich schon drei Jahre in Petersburg gelebt und schon manchen Erscheinungen zugesehen hatte — verblüffte mich doch diese Proklamation geradezu, erschien sie mir wie eine neue, unerwartete Entdeckung: niemals bis zu diesem Tage hatte ich eine solche Nichtigkeit vorausgesetzt. Plötzlich, noch ehe es Abend wurde, fiel es mir ein, Tschernyschewsky aufzusuchen. Noch niemals bis auf diesen Augenblick war es mir in den Sinn gekommen, zu ihm zu gehen, ebenso wenig als dies bei ihm der Fall gewesen“ ....
„Nikolai Gawrilowitsch, was ist das?“ und ich zog die Proklamation aus der Tasche.
Er nahm sie in die Hand, wie eine ihm völlig unbekannte Sache, und las sie durch. Es waren im Ganzen zehn Zeilen.
— „Nun, was denn?“ fragte er mit einem leichten Lächeln.
— „Sollten sie denn so dumm und lächerlich sein? Sollte es denn nicht möglich sein, ihnen Einhalt zu thun und dieser Abscheulichkeit ein Ende zu machen?“
Er antwortete ausserordentlich gewichtig und eindringlich: — „Glauben Sie denn, dass ich mit ihnen solidarisch bin, und meinen Sie, dass ich imstande gewesen wäre, an der Abfassung dieses Zettels teilzunehmen?“
— „Das ist’s eben, dass ich das nicht voraussetzte,“ — antwortete ich — „und ich finde es sogar überflüssig, Ihnen das zu versichern. Allein auf jeden Fall ist es nötig, sie aufzuhalten, koste es was es wolle. Ihr Wort ist bei ihnen von Gewicht, und das ist einmal sicher, dass sie Ihre Meinung fürchten.“
— „Ich kenne keinen von ihnen.“
— „Ich bin auch davon überzeugt. Allein es ist durchaus nicht nötig, sie zu kennen und persönlich mit ihnen zu sprechen. Sie brauchen nur laut, wo immer, Ihren Tadel auszusprechen, und es wird zu ihnen gelangen.“
— „Vielleicht wird das auch keine Wirkung haben. Ja, und diese Erscheinungen sind als Nebenfakten unvermeidlich.“
— „Dennoch aber schaden sie allen und allem“ ....
.... „Ich erachte es als meine Pflicht, hier zu bemerken, dass ich vollkommen aufrichtig mit Tschernyschewsky sprach und durchaus daran glaubte, wie ich auch jetzt noch glaube, dass er mit diesen Zerstörern nicht ‚solidarisch‘ gewesen ist.“
Der Schluss von Millers Betrachtungen und die darin enthaltene treffende Beurteilung der Kluft zwischen den russischen und polnischen Anschauungen, welche an die Vorgänge von 1863 anknüpft, ist zu bedeutungsvoll für die Beleuchtung der damaligen Situation und mit einigen Modifikationen auch der heutigen, als dass wir es uns versagen dürften, dieses Resumé vollinhaltlich hierher zu setzen.
„Wenn aber nun eine solche Erscheinung“ — fährt Miller fort — „zur Zeit der Bauern-Befreiung durch ihre „Nichtigkeit“ in ihrer Art komisch war, so kann man das natürlich nicht mehr vom polnischen Aufstande von 1863 sagen. Ich erinnere mich mit Schamgefühl daran, dass ich, als ich damals im Auslande lebte, anfangs den deutschen Zeitungen Glauben schenkte, in dem, was sie über die Grausamkeit unserer Soldaten in Polen verbreiteten. Inzwischen erhob sich ebenfalls dort in Deutschland eine vorurteilslose, — mehr als das, eine feierliche Stimme, wie man thatsächlich keine bei uns daheim gehört hatte, über unsere Bauern-Reform. Es war die Stimme eines Greises mit junger Seele — Jacob Grimms. Er erkannte vollkommen und begrüsste freudig mit seinem allumfassenden, menschlichen Herzen unsere, wie er sich ausdrückte, „riesenhafte Bewegung nach vorwärts“. Und da musste diese Bewegung aufgehalten werden! — Und zur Befriedigung jener europäischen Majorität, welche nicht über den edlen Geist eines Grimm verfügte, entspann sich gerade jetzt der polnische Aufstand mit seinem so blutigen Terrorismus.
Hier konnte sich Dostojewsky keineswegs mehr geringschätzig über die „Nichtigkeit“ der Erscheinung aussprechen, hier konnte er nicht anders, als von einem entrüsteten Entsetzen erfüllt werden. Viele halten Dostojewsky bekanntlich für einen offenen Feind Polens, und die Edelsten unter den Polen können ihm diesen Ausfall nicht verzeihen. Wenn wir indes uns jenes Kapitels aus den „Memoiren aus einem Totenhause“ erinnern, wo von den politisch Verschickten die Rede ist, so finden wir, dass der Polen nicht nur ohne feindseliges Vorurteil, sondern mit voller Wertschätzung darin gedacht wird. Theodor Michailowitsch verletzte nur ihr hochmütiges „je hais ces brigands“ im Verkehr mit den Sträflingen, in denen er selbst immer wieder das gleiche russische Volk erblickte. — Geradezu als ein Hohn musste diese Erhebung Dostojewsky erscheinen, ein Hohn auf die ganze russische Nation, die eben endlich ihren Zar-Befreier erharrt hatte, die polnische Rebellion, und das gerade in diesem gesegneten Augenblick, — eine Rebellion, der als armseliges, aber doch immer trauriges Präludium die Studenten-Unruhen mit den darauffolgenden „dummen“, aber immerhin „unheilverkündenden“ Proklamationen dienten. Während unsre „Herrlein“ gleichsam nur zufällig in den Augen des Volkes zu einer ihm so widrigen Rolle kamen, konnte man im polnischen Aufstand schon ganz ernsthaft den alten, hochedelgeborenen Geist vernehmen, der von Verachtung gegen das Bauernvolk erfüllt ist. Nicht Polen war es, und nicht das polnische Volk, das endlich vom selben russischen Kaiser mit Grund und Boden beteilt worden war, was Dostojewsky nicht liebte; er hasste jenen traditionellen Geist Polens, durch welchen sein eigenes Volk bedrückt worden war und welcher Polen verloren hatte. Diesen alten Geist Polens musste er hassen, wie ihn Proud’hon hasste und viele von den Polen selbst hassten, viele der echten, uneigennützig-ehrenhaften polnischen Patrioten. Dieser alte Geist Polens war Dostojewsky verhasst als einem Socialisten — und ein Socialist im weiten, menschlichen Sinne dieses Wortes zu sein hat er niemals aufgehört.
Aber die Sache steht so, dass unsre — nicht nur „Liberalen“, sondern auch „Socialisten“ bereit gewesen wären, den polnischen „Pany“ die brüderliche Hand zu reichen — weil sie bei ihnen einen reichlichen Vorrat von Unzufriedenheit wahrnahmen —, und bei uns hatte sich damals schon jener Opportunismus entwickelt, welcher keinerlei unzufriedene Elemente verschmäht, worauf die Briefe Samarins an Herzen so deutlich hinweisen.
Dostojewsky war niemals ein „getreuer Unterthan“ der Revolution (wie sich Samarin in diesen Briefen an Herzen ausdrückt), darum aber war er auch niemals „Opportunist“.
Von Sibirien mit einem überreichen Schatz von Glauben und Liebe zurückgekehrt, sowie mit dem heissen Verlangen nach Einigkeit bei der schöpferischen Thätigkeit zum Nutzen des Vaterlandes, musste er mit wachsender Entrüstung rund um sich die immer mehr und mehr hervortretenden Anzeichen einer negativen Thätigkeit im Dienste der Zerstörung wahrnehmen. Es ist begreiflich, dass er sich bei seiner Geradheit mehr und mehr Feinde machte. — In dieser Situation und unter diesen Umständen war es, dass Dostojewskys litterarische Thätigkeit wieder neu auflebte. Im selben Jahre, als die Leibeigenschaft aufgehoben wurde, begann er gemeinsam mit dem Bruder Michael Michailowitsch die Herausgabe der Zeitschrift ‚Wremja‘.“
Mit der Gründung der Zeitschrift „Wremja“ wird Dostojewskys tiefster Herzenswunsch erfüllt. Ihm, dem das Verkünden des „wahren Christus“ vor allem andern als Lebensaufgabe galt, die er bisher nur indirekt auf dem Umwege der Kunst (was für einer Kunst allerdings!) hatte erfüllen können, ihm musste es wie eine Erlösung erscheinen, endlich direkt und unzweideutig und, wie er schon nicht anders konnte, eindringlich bis zur Gewaltsamkeit „seine Wahrheit“ verkünden zu können. Diese Epoche ist zu wichtig im Leben des Dichters, ihr Ausdruck in seinem ersten Exposé des Unternehmens zu bezeichnend, als dass wir es uns versagen dürften, jenen Aushängebogen vollinhaltlich wiederzugeben; ja, wir werden später jede der drei Ankündigungen neuer Journalgründung, welche dieser ersten folgten, ins Auge fassen müssen, um uns daraus den Beweis zu holen, wie geschlossen und unerschütterlich einheitlich sein Streben, sich in einer Zeitschrift auszusprechen, allezeit geblieben ist, wie er denn auch oft genug wiederholt: „ein Journal ist eine grosse Sache“. — Zugleich holen wir uns, als Fremde, ein Bild jener Epoche der russischen Geschichte.
N. N. Strachow, der thätigste Mitarbeiter an jener Zeitschrift, teilt uns mit, dass schon im Jahre 1860 von den Brüdern Dostojewsky die Herausgabe einer voluminösen Monatsschrift geplant gewesen war, zu welcher sie eifrig nach geeigneten Mitarbeitern suchten. Th. Michailowitsch war von einigen Arbeiten naturphilosophischen Inhalts, welche Strachow früher publiziert hatte, sehr entzückt gewesen (weit über deren Verdienst, wie dieser hinzufügt) und forderte ihn infolgedessen zur Mitarbeit an der Monatsschrift auf. Auch Strachow findet die Ankündigung so bezeichnend für Dostojewskys damaligen Ideengang, dass er sie wörtlich wiedergiebt.
Sie lautet:
„Vom Januar des Jahres 1861 an wird erscheinen
„Wremja“ (Die Zeit),
eine litterarische und politische Monatsschrift in Bänden
von 25-30 Bogen grossen Formats.
„Ehe wir daran gehen, zu erklären, warum wir es eigentlich für nötig erachten, ein neues, öffentliches Organ unserer Litteratur zu gründen, wollen wir einige Worte darüber sagen, wie wir unsere Zeit und namentlich den gegenwärtigen Moment unseres gesellschaftlichen Lebens verstehen. Dies wird auch zur Aufklärung über den Geist und die Richtung unserer Zeitschrift dienen.
Wir leben in einer im höchsten Grade bemerkenswerten und kritischen Zeitepoche. Wir werden jedoch zur Darlegung unserer Anschauung ausschliesslich auf jene neuen Ideen und Forderungen der russischen Gesellschaft hinweisen, welche den ganzen denkenden Teil derselben während der letzten Jahre so übereinstimmend erfüllt hat. Wir werden nicht erst auf die grosse Bauernfrage hinweisen, welche in unserer Zeit ihren Anfang genommen hat ... Alles dies sind nur Äusserungen und Anzeichen jener ungeheuren Umwälzung, der es bestimmt ist, sich friedlich und einhellig in unserem ganzen Vaterlande zu vollziehen, obwohl sie, ihrer Bedeutung nach, an Mächtigkeit allen wichtigsten Ereignissen, ja sogar der Reform Peters gleich ist. Diese Umwälzung ist das Ineinanderfliessen der Bildung und ihrer Vertreter mit den Elementen des Volkes und die Vereinigung der ganzen grossen russischen Nation mit allen Elementen unseres gegenwärtigen Lebens — einer Nation, welche sich schon vor 170 Jahren von der Peterschen Reform abgewendet und seit jener Zeit mit dem Stande der Gebildeten entzweit hat, welcher abgesondert sein eigenes, selbständiges, individuelles Leben lebte.
Wir sprachen von Äusserungen und Symptomen. Unbestreitbar ist deren Wichtigstes die Verbesserung der Lage unserer Bauern. Jetzt sind es nicht mehr tausende, jetzt werden es viele Millionen Russen sein, welche in das russische Leben eintreten, ihre frischen, unverbrauchten Kräfte hineintragen und ihr neues Wort sagen werden. Kein Klassenhass zwischen Siegern und Besiegten, wie in Europa, darf der Entwickelung der künftigen Urelemente unseres Lebens zu Grunde liegen. Wir sind nicht Europa, und bei uns wird und darf es keine Sieger und Besiegte geben. Die Reform Peters des Grossen hat uns auch ohne das allzuviel gekostet: sie hat uns mit dem Volke entzweit. Schon von Anbeginn hat das Volk sie abgelehnt. Die Lebensformen, welche ihm durch die Umgestaltung mitgeteilt wurden, waren weder mit seinem Geiste, noch mit seinen Bestrebungen im Einklange, waren nicht nach seinem Mass berechnet und ihm nicht zeitgemäss. Es nannte sie „deutsch“, nannte die Nachfolger des grossen Zaren Fremdlinge. Schon allein das geistige Abfallen des Volkes von seinen höheren Ständen mit ihren Befehlshabern und Anführern zeigt, wie teuer uns das damalige neue Leben zu stehen kam. Allein — obwohl mit der Reform entzweit, sank dem Volke der Mut nicht. Mehr als einmal hat es seine Unabhängigkeit geäussert, hat sie mit ausserordentlichen, krampfhaften Bemühungen geäussert, weil es allein war und ihm das schwer wurde. Es wandelte im Dunkeln, aber es hielt sich energisch bei seinem gesonderten Wege. Es dachte sich in sich selbst und seine Lage hinein, versuchte es, sich selbst seine Anschauung zu verdeutlichen, zerfiel in geheime, schädliche Sekten, suchte neue Ausgangspunkte für sein Leben, neue Formen. Man kann sich nicht weiter vom alten Ufer entfernen, nicht kühner seine Schiffe verbrennen, als dies unser Volk beim Betreten jener neuen Bahnen gethan, welche es sich mit so vielen Beschwernissen aufgefunden hatte. Bei alledem aber nannte man es den Bewahrer der alten vorpeterschen Formen, des stumpfen Altgläubertums.
Allerdings waren die Ideen des Volkes, welches ohne Führer und auf seine eigenen Kräfte allein angewiesen blieb, manchmal absonderlich, seine Versuche einer neuen Lebensform oft nicht gestaltungsfähig. Aber in ihnen war eine gemeinsame Grundlage, ein Geist, ein unerschütterlicher Glaube an sich selbst, eine unverbrauchte Kraft. Nach der Reform hat es zwischen ihm und uns, den gebildeten Ständen, nur einen Augenblick der Einigung gegeben — das Jahr 1812 — und wir haben gesehen, wie sich das Volk da geäussert hat. Wir erkannten damals, was das Volk eigentlich sei. Das Elend liegt darin, dass es uns nicht kennt und nicht versteht.
Allein jetzt hört der Zwiespalt auf. Die Petersche Reform, welche sich ununterbrochen bis auf unsere Zeit fortgesetzt hat, ist endlich an ihre letzte Grenze angelangt. Weiter kann man nicht gehen, ja, wohin auch? Es giebt da keinen Weg mehr, er ist durchlaufen. Alle, welche Peter den Grossen nachgeahmt haben, haben Europa kennen gelernt, sich europäischem Leben angeschlossen und sind nicht Europäer geworden. Ehemals machten wir uns selbst Vorwürfe über unsere Unfähigkeit zum Europäismus; heute denken wir anders. Wir wissen heute, dass wir nicht Europäer sein können, dass wir nicht im stande sind, uns in eine der westländischen Formen hineinzuzwängen, welche Europa aus seinen eigenen nationalen, uns fremden und entgegengesetzten Grundelementen ausgearbeitet und ausgelebt hat — geradeso wie wir etwa ein fremdes Kleid nicht tragen könnten, das nicht nach unserem Masse verfertigt ist. Wir haben uns endlich überzeugt, dass auch wir eine Nationalität für uns sind, eine im höchsten Grade selbständige Nationalität, und dass unsere Aufgabe ist — uns eine neue, uns eigene, heimische Form aufzubauen, eine Form, die wir unserer eigenen Grundlage, unserem Volksgeist und unseren Volkselementen entnehmen müssen. Wir sind unbesiegt zum heimischen Boden zurückgekehrt. Wir leugnen unsere Vergangenheit nicht ab, wir anerkennen auch das Vernünftige darin. Wir anerkennen, dass die Reform unseren Horizont erweitert, dass wir durch sie unsere künftige Bedeutung in der grossen Familie aller Völker kennen gelernt haben.
Wir wissen, dass wir uns jetzt nicht mehr mit einer chinesischen Mauer von der Menschheit absondern werden. Wir ahnen, und ahnen mit ehrfürchtigem Sinn, dass der Charakter unserer künftigen Thätigkeit im höchsten Grade allgemeinmenschlich sein muss, dass die russische Idee vielleicht die Synthese aller jener Ideen sein wird, welche Europa mit solcher Hartnäckigkeit, mit solcher Männlichkeit in seinen verschiedenartigen Nationalitäten entwickelt; dass vielleicht alles Feindselige in diesen Ideen seine Versöhnung und fernere Entwickelung im russischen Volkstum finden wird. Wir haben also nicht vergebens alle Sprachen gesprochen, alle Zivilisationen begriffen, an den Interessen eines jeden europäischen Volkes teilgenommen, den Sinn und die Vernunft von Erscheinungen verstanden, welche uns vollständig fremd waren; nicht vergebens haben wir eine solche Kraft der Selbstkritik bekundet, die alle Fremdländer in Erstaunen versetzt hat. Sie haben uns darob gescholten, haben uns Leute ohne Persönlichkeit, ohne Vaterland geheissen, ohne zu bemerken, dass die Fähigkeit, sich auf eine Zeit lang von seinem Boden loszureissen, um nüchterner und unparteiischer auf sich selbst zu schauen, schon an und für sich eine sehr starke Eigentümlichkeit ist; die Fähigkeit endlich, das Fremde mit dem Auge des Versöhners anzusehen, ist die höchste und edelste Gabe der Natur, welche nur sehr wenigen Nationalitäten verliehen ist. Die Angehörigen anderer Nationen haben unsere unermesslichen Kräfte noch nicht einmal versucht ... Jetzt aber, scheint es, treten auch wir in ein neues Leben ein.
Hier nun, vor eben diesem Eintreten in das neue Leben ist die Versöhnung der Anhänger der Peterschen Reform mit jenen der Volksgrundlage unvermeidlich geworden. Wir sprechen hier nicht von Slavophilen und nicht von Westlern. Ihrem feindlichen Zwiste gegenüber verhält sich unsere Zeit vollkommen gleichgiltig. Wir sprechen von der Aussöhnung der Zivilisation mit dem Volkstum. Wir fühlen, dass beide Parteien einander endlich verstehen müssen, alle Missverständnisse, die sich zwischen ihnen in so unglaublicher Anzahl aufgehäuft haben, aufklären und dann in Harmonie und Eintracht mit vereinten Kräften einen neuen breiten und ruhmvollen Weg betreten müssen. Die Vereinigung, was immer sie kosten möge, ohne Rücksicht auf was immer für Opfer, und das so schnell als möglich — das ist unser leitender Gedanke, das ist unsere Devise.
Allein, wo ist denn der Berührungspunkt mit dem Volke? Wie macht man den ersten Schritt, um sich ihm zu nähern? Das ist die Frage, das die Sorge, die alle teilen sollten, denen der russische Name teuer ist, alle, die das Volk lieben und denen sein Glück teuer ist. Sein Glück aber — ist unser Glück. Es versteht sich, dass der erste Schritt zur Erreichung jeglicher Übereinstimmung das Alphabet und die Bildung ist. Das Volk wird uns niemals verstehen, wenn es nicht vorher vorbereitet worden. Es giebt keinen anderen Weg und wir wissen, dass, indem wir dies aussprechen, wir nichts Neues sagen. Allein so lange es an den gebildeten Ständen ist, den ersten Schritt zu thun, haben sie ihre Situation auszunützen, mit allen Kräften auszunützen. Kräftige, schleunige Verbreitung von Bildung, koste es was es wolle, das ist die Hauptaufgabe unserer Zeit, der erste Schritt zu jeglicher Thätigkeit.
Wir haben nur die leitenden Hauptgedanken unserer Zeitschrift ausgesprochen, haben den Charakter, den Geist ihrer künftigen Thätigkeit angedeutet. — Allein wir haben noch einen zweiten Grund, der uns veranlasst, ein neues, unabhängiges litterarisches Organ zu gründen. Wir haben schon lange bemerkt, dass sich in den letzten Jahren unter unserer Journalistik eine gewisse besondere und freiwillige Abhängigkeit und Unterordnung gegenüber den litterarischen Autoritäten entwickelt hat. Es versteht sich, dass wir unsere Journalistik nicht der Gewinnsucht, der Käuflichkeit anklagen. Bei uns giebt es nicht, wie nahezu überall in dem europäischen Schriftwesen, Zeitschriften und Tagesblätter, welche ihre Überzeugungen um Geld veräussern und ihre niederen Dienste, sowie ihre Herren mit anderen vertauschen, einzig und allein darum, weil die anderen mehr Geld geben. Allein wir bemerken gleichwohl, dass man seine Überzeugung verkaufen kann, wenn auch nicht um Geldeswert. Man kann sich zum Beispiel aus einem Übermass von angeborener Wohldienerei verkaufen, oder aus Furcht, um seines Mangels an Übereinstimmung mit den litterarischen Autoritäten willen, als Dummkopf ausgerufen zu werden. Die goldene Mittelmässigkeit zittert manchmal sogar ganz uneigennützig vor den Meinungen, welche von den Stützpfeilern der Litteratur festgestellt sind, besonders wenn diese Meinungen kühn, keck und frech ausgesprochen wurden. Manchmal verschafft nur diese Keckheit und Frechheit einem nicht dummen Schriftsteller, welcher die Umstände zu benutzen versteht, den Namen eines Pfeilers der Litteratur, einer Autorität, und verschafft gleichzeitig diesem Pfeiler einen ausserordentlichen, wenn auch nur zeitweiligen Einfluss auf die Massen. Die Mittelmässigkeit ihrerseits ist fast immer äusserst furchtsam, ungeachtet ihres augenscheinlichen Dünkels, und unterordnet sich willig: die Furchtsamkeit aber erzeugt eine litterarische Sklaverei; allein in der Litteratur darf es keine Sklaverei geben.
In dem heissen Verlangen nach litterarischer Macht, nach litterarischer Überlegenheit, nach einem litterarischen Range ist mancher sogar alte und angesehene Schriftsteller oftmals imstande, sich zu einer so unerwarteten und seltsamen Thätigkeit zu entschliessen, dass sie unwillkürlich Verwunderung und Ärgernis unter den Zeitgenossen hervorruft, unbedingt aber in der Zahl der skandalösen Anekdoten über die russische Litteratur der Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die Nachkommenden übergehen wird. Und solche Vorkommnisse ereignen sich immer öfter und öfter, und solche Leute üben einen fortgesetzten Einfluss aus. Die Journalistik aber schweigt und wagt es nicht, daran zu rühren. Es giebt in unserer Litteratur noch heute einige festgesetzte Ideen und Meinungen, welche nicht die geringste Selbständigkeit besitzen und doch als unzweifelhafte Wahrheiten bestehen, einzig nur darum, weil es irgend einmal litterarische Anführer so festgestellt haben. Die Kritik wird immer flacher und unbedeutender; in manchen Publikationen werden gewisse Schriftsteller ganz umgangen, weil man fürchtet, sich, über sie sprechend, zu verplaudern. Man streitet um des Rechtbehaltens und nicht um der Wahrheit willen. Ein Groschen-Skeptizismus, welcher durch seinen Einfluss auf die Majorität schädlich ist, deckt mit Erfolg die Talentlosigkeit und wird in Pflicht genommen, um Subskribenten heranzulocken. Ein strenges Wort aufrichtiger, tiefer Überzeugung wird immer seltener gehört. Endlich wandelt der Spekulationsgeist, der sich in der Litteratur ausbreitet, gewisse periodische Zeitschriften in vornehmlich kommerzielle Unternehmungen um, die Litteratur aber und ihr Nutzen treten in den Hintergrund und manchmal wird ihrer nicht einmal gedacht.
Wir haben uns entschlossen, eine Zeitschrift zu gründen, welche, ungeachtet unserer Achtung vor litterarischen Autoritäten, doch vollkommen unabhängig von ihnen sein, in freiester und aufrichtiger Weise auf alle litterarischen Absonderlichkeiten unserer Zeit hinweisen wird. Diesen Hinweis unternehmen wir aus hoher Achtung für die russische Litteratur.
Unsere Zeitschrift wird keinerlei unlitterarische Antipathien oder Voreingenommenheiten hegen. Wir werden sogar bereit sein, unsere eigenen Irrtümer und Fehlschüsse einzugestehen, gedruckt einzugestehen, finden uns aber gar nicht lächerlich, uns dessen (wenn auch voraus) zu rühmen. Wir werden auch der Polemik nicht aus dem Wege gehen und wir werden auch davor nicht zurückschrecken, die litterarischen Gänse manchmal zu reizen. Gänsegeschnatter ist manchmal ganz nützlich; es zeigt das Wetter an, wenn es auch nicht immer das Kapitol rettet. Eine besondere Aufmerksamkeit werden wir dem kritischen Teile unseres Blattes widmen. Nicht nur jedes bemerkenswerte Buch, sondern auch jeder bemerkenswerte litterarische Artikel, welcher in anderen Zeitschriften erscheint, wird unbedingt in der unseren analysiert werden. Die Kritik darf also nicht verschwinden, rein nur, weil man beginnt die Bücher nicht separat, wie ehedem, sondern in Zeitschriften zu drucken. Indem das Journal „Wremja“ alles Persönliche beiseite lassen, alles Mittelmässige durch Schweigen umgehen wird, wenn es nicht geradezu schädlich ist, wird es alle halbwegs wichtigen litterarischen Kundgebungen verfolgen, die Aufmerksamkeit auf alle scharf ausgeprägten Fakten, seien sie nun positiver oder negativer Natur, hinlenken, und unerbittlich Talentlosigkeit, Übelwollen, falsche Bestrebungen, übelangebrachten Stolz und litterarischen Aristokratismus blossstellen, wo immer sie sich zeigen mögen. Erscheinungen des Lebens, umlaufende Meinungen, festgestellte Principien, welche aus allgemeinen und allzu persönlich passenden oder unpassenden Anwendungen verflachter, absonderlicher und ärgerlicher Aphorismen entstehen, sie alle unterstehen der Kritik genau wie ein eben erschienenes Buch oder ein Zeitungsartikel. Unsere Zeitschrift spricht sich das unabänderliche Reckt zu, offen über jede litterarische und ehrenhafte, ehrliche Arbeit ihre Meinung auszusprechen. Der weitbekannte Name, mit welchem das Blatt gefertigt ist, verpflichtet das öffentliche Urteil, sich nur um so strenger dagegen zu verhalten, und unser Journal wird sich niemals zu dem jetzt allgemein gebrauchten Kniff herablassen — einem bekannten Schriftsteller zehn schwülstige Komplimente vorzureden, um das Recht zu haben, eine nicht ganz schmeichelhafte Bemerkung über ihn einzustreuen. Das Lob ist immer keusch; nur die Schmeichelei riecht nach der Bedientenstube. Da es uns in einer einfachen Ankündigung an Raum gebricht, auf alle Details unserer Publikation einzugehen, wollen wir nur sagen, dass unser, von der Obrigkeit bestätigtes, Programm ausserordentlich reichhaltig ist.“
Hier folgt ein Programm der verschiedenen Inhaltsgruppen, sowie die Ankündigung, dass die Mitarbeiter, entgegen dem alten Brauch, nicht genannt werden, und endlich die Unterschrift Michail Michailowitsch Dostojewskys, da Theodor Michailowitsch noch (de iure bis 1873) unter polizeilicher Aufsicht stand und daher als Redakteur nicht officiell bestätigt werden konnte.
Aus diesem, seine Ansichten und Absichten eigentlich nur in ihrer äusseren Umgrenzung zeichnenden Exposé finden wir schon die ganze, klare Richtung nach dem Volkstum und der von da erwarteten Erlösung nicht nur Russlands, sondern aller übrigen im Streit befindlichen Partikularismen, und die ganze Hartnäckigkeit, diese Richtung einzuhalten und andere hineinzubringen.
Im neunten Bande der Gesamtausgabe der Werke Dostojewskys finden wir nun „eine Reihe von Artikeln über die russische Litteratur“, welche aus den Heften der „Wremja“ und zwar vom Januar, Februar, Juli, August und November 1861 abgedruckt sind und unzweifelhaft von Theodor Michailowitsch stammen, obgleich sie damals ohne Unterschrift erschienen waren. Die ersten derselben haben, nach Millers Meinung, einen grossen Teil jenes Aufsatzes über die Kunst in sich aufgenommen, der, wie wir wissen, anfangs der Grossfürstin Marja Nikolajewna gewidmet gewesen und später verschwunden ist.
Diese Artikel „über die russische Litteratur“ sind durch zwei Momente für uns besonders interessant. Erstens und vor allem durch das Persönliche, das Verlebendigende, wenn man so sagen darf, das Dostojewsky hier wie überall, wo er es mit einer Sache ernst meint (und wo thut er das nicht?), hineinlegt; zweitens durch den Einblick, welchen wir da in die Anschauungen der Russen über die Litteratur und ihre Anwendung gewinnen. Diese Anschauungen sind uns durch die Jugendlichkeit ihres Ernstes zuerst nur befremdlich und etwas wie ein Lächeln zieht unsere müden Dekadenten-Lippen herab, ob der Erhitzung, in die sich die Russen über litterarische Streitfragen stürzen. Allein es will uns bedünken, dass gerade in diesem jugendlichen Ernst, der heute, im neunzehnten Jahrhundert und hier, mitten unter uns, um des Lebens beste Güter (womit nicht nur Brot gemeint ist) streitet, eine Mahnung liegt, von der litterarischen Spielerei zum Leben und zu seinen ernsten Forderungen zurückzukehren.
Die Einleitung dieser Artikel beginnt mit einer launig-beissenden Betrachtung über die Art, wie die nach Russland kommenden Fremden Russland verstehen; der Deutsche, der Franzose, der Engländer, jeder in seiner Weise und jeder — falsch. „Für Europa,“ heisst es da, „ist Russland das Rätsel der Sphinx. Schneller wird das Perpetuum mobile oder das Lebenselixir gefunden werden, als die russische Wahrheit, der russische Geist, sein Charakter und seine Richtung vom Westen erfasst werden wird. In dieser Beziehung ist sogar der Mond jetzt weit ausführlicher erforscht als Russland. Wenigstens weiss man entschieden, dass dort niemand lebt; von Russland aber weiss man, dass dort Menschen leben und sogar russische Menschen —, aber was für Menschen, das ist bis heute noch ein Rätsel, obwohl die Europäer überzeugt sind, dass sie uns schon lange begriffen haben.“
Nun nimmt Dostojewsky die Deutschen her, welche nach Russland kommen. Er geht der Reihe nach die Gutsverwalter, die Semmelbäcker, Wursterzeuger und Raritätenschausteller durch und langt bei dem gebildeten und ehrlichen Deutschen an, der wirklich Russisch lernt, sich ernstlich mit der russischen Litteratur beschäftigt, um schliesslich Cheraskows Russiade in das — Sanskrit zu übersetzen. Ganz anders der Franzose. Der Franzose hat über Russland alles schon zu Hause gewusst; er weiss alles, er versteht alles — auch ohne etwas zu lernen. Er hat sein Buch über Russland schon in Paris um gutes Geld verkauft und gönnt sich dafür die Reise von 28 Tagen, um in Russland zu erscheinen, es zu blenden, zu beglücken und, wenigstens teilweise, umzugestalten. Er schreibt auch sofort eine echt russische Erzählung unter dem Titel „Petroucha“, „welche zwei Vorzüge hat: 1. dass sie das russische Leben getreu charakterisiert und 2. dass sie gleichzeitig auch das Leben auf den Sandwichinseln schildert Kommt aber der Russe nach Paris, so weiss man schon, dass er das eigentlich dem Genfer Lefort zu verdanken hat, welcher eine grosse Wendung in den Geschicken Russlands herbeigeführt hat, und jede Portiersfrau, der du in später Nachtstunde zurufst: „Le cordon s’il vous plaît“, brummt schlaftrunken in sich hinein: „Sieh mal, wäre in Genf nicht der Genfer Lefort auf die Welt gekommen, so wärest du heute noch ein Barbar, kämest nicht nach Paris, au centre de la civilisation, würdest mich nicht jetzt mitten in der Nacht aufwecken und aus vollem Halse „le cordon s’il vous plaît“ schreien.“
Im weiteren Verlaufe seiner Ausführungen kommt Dostojewsky auf den Standpunkt zu sprechen, den die Russen selbst ihrem Volke, ihrer Sprache gegenüber einnehmen. Da ist es namentlich der vornehme, der an ausländische Kultur gewöhnte Russe, welcher sich dem „dunklen Volke“ gegenüber verächtlich verhält, welcher seinen Tischnachbar bittet, ihm Wasser geben zu lassen, nur um nicht selbst ein russisches Wort an den Lakaien zu richten, welcher die Geistesbildung so hoch schätzt, dass er hundertmal lieber ein Schuft genannt würde als ein Dummkopf und daraus allein ein Privileg seiner Menschheitsrechte und Würden macht, das ihn ein- für allemal vom Volke trennt.
Da aber die Menschen dieser Klassen im Vaterlande nichts zu thun finden, nach grossen Thaten ächzen, sich gegenseitig ihren Weltschmerz klagen und sich ihrer Nichtswürdigkeit anklagen: „ach, Bruder, sieh, ein so gemeiner Schuft bin ich!“, so wird jene Art Byrons daraus, welche sich wundern, dass der wirkliche Byron über eine solche Welt hat klagen und weinen können, was eines Lords ganz unwürdig ist, während sie zum höheren Byronismus übergehen, den Byron selbst noch nicht ausgestaltet hatte: ein gutes Mittagessen zu schätzen, gelegentlich falsch zu spielen und den Leuten die Taschentücher aus den Säcken zu ziehen. Diesen Byrons ruft er zu: „Ich habe eine Arbeit für euch, allein ihr werdet sie nicht leisten wollen, sie zu gering achten, ob sie auch die einzige ist, die uns jetzt zukommt: Lehrt auch nur einen kleinen Bauernjungen lesen.“
Aus diesen scheinbar weglosen Exkursen heraus tritt Dostojewsky allmählich auf das Gebiet der Forderungen, die aus den Bedürfnissen oder vielmehr der Bedürftigkeit des Volks entstehen und für das Volk eintreten. Er tritt leidenschaftlich für die Volksbildung ein und widerlegt den Einwurf, dass gerade der Lakai, der Schaffer usw., kurz alle Bauern, die lesen können, es sind, welche die Gefängnisse füllen. Jawohl, antwortet er — weil diese Bildung oder eigentlich Halbbildung noch ein Privileg ist und Privilegien immer Übergriffe und Unredlichkeit im Gefolge haben.
So sind es, wie wir sehen, die primären Probleme, ganz einfache Konflikte, die aufrichtige Bemühung jedes Russen, für sich und „unsern Bruder“, wie das hübsche Wort lautet, das Leben einzurichten, das auch den Dichter so recht an die Scholle bindet. Diese ewige Frage nach dem, was er soll, hat dem Russen auch ein anderes Wort in den Mund gelegt, das nun eine stereotype Redensart ist, und das er bei den kleinsten Zwischenfällen unwillkürlich anwendet. Er sagt da nicht: „was soll ich thun“, sondern: „wie habe ich zu sein?“
Aus der „verfluchten Frage“ heraus: „Wie soll mein Leben sein?“ ist eben das russische Leben, seine Kunst und Kritik einzig zu verstehen. Nun begreifen wir auch, warum die Russen Turgenjew trotz seiner hohen Künstlerschaft nicht zu den Ihren zählen. Wer die russische Litteratur und ihre mühevolle Pflügearbeit kennt, muss diesem Verdikt beipflichten. Das, was Schilderung, getreues Nachbilden russischen Lebens ist, was mit allen Künsten der Farbengebung, der Licht- und Schattenverteilung, der „Lasur“, wenn man so sagen darf, ausgestattet ist, was der Europäer entzückend findet, so fremdartig und doch nicht verletzend, so fein zubereitet, gerade genug, um „anzuregen“, ohne allzusehr wehe zu thun, das wird den Russen beleidigen, der von seinem Dichter vor allem Mitarbeit an seinem schweren Werden fordert. Dies spricht sich noch viel deutlicher in Tolstojs, des grössten russischen Künstlers, Wandlung zum Volkserzähler aus. Heute erst, nachdem er der hohen Kunst abgeschworen, die im Roman „Krieg und Frieden“ ihren vollendetsten Ausdruck gefunden, heute, da seine kleinen Volkserzählungen, zu 1 Kopeke verkauft, in Tausenden von Exemplaren wirklich dem Volke gehören, heute erst rechnet er sich selbst zu den führenden Geistern seines Volks und wird von ihm dazu gezählt. Andere Beispiele für diese Auffassung der Dinge finden wir in direkten Aussprüchen Dostojewskys und endlich im weiteren Verlauf der „litterarischen Artikel“, da, wo der Dichter den Parteihader schlichten will, welcher zwischen Utilitaristen und Vertretern der „Kunst als Selbstzweck“ entbrannt ist.
Zu den deutlichsten Äusserungen Dostojewskys über belletristische Werke gehört wohl seine an Strachow gerichtete Kritik Tolstojs. Strachow hatte gesagt, dass Tolstojs „Krieg und Frieden“ zu den vortrefflichsten Werken der gesamten russischen Litteratur gerechnet werden müsse, darauf Dostojewsky:
„... Das kann man nicht unbedingt sagen: Puschkin, Lomonossow — das sind Genies. Mit dem „Mohr Peters des Grossen“ und mit „Bjelkin“ hervortreten, das heisst unbedingt mit einem genialen, neuen Wort auftauchen, das bis dahin durchaus nie und nirgends gesagt worden war. Allein mit „Krieg und Frieden“ auftreten, das heisst nach diesem Worte kommen, das schon von Puschkin gesagt worden war; und das in jedem Falle, wie hoch und weit auch Tolstoj in der Ausgestaltung dieses, vor ihm schon durch einen Genius ausgesprochenen neuen Wortes kommen möge. Ich denke, das ist sehr wichtig usw.“
An anderer Stelle nennt er Turgenjews und Tolstojs „neues Wort“ das „Gutsbesitzer-Wort“[16], das allerdings bei Tolstoj unendlich bedeutender zum Ausdruck komme.
Wie dies neue Wort Puschkins lautet, das hat Dostojewsky an vielen Orten gesagt, am feurigsten aber in seiner im Jahre 1880 in Moskau gehaltenen grossen Puschkinrede. Kurz gefasst liesse es sich etwa so ausdrücken: „Nur der Russe ist, vermöge seiner unendlichen Assimilationsfähigkeit, „Allmensch“ und nur dieser Allmensch vermag die Idee des lebendigen Christentums in sich zu tragen und sie zu verbreiten.“
Es darf uns danach nicht wundern, wenn Dostojewsky die unvollendete Erzählung Puschkins „Der Mohr Peters des Grossen“ und die „Novellen Bjelkins“, zwei Werke, die wir kaum dem Namen nach kennen, doch höher stellt, als Tolstojs Meisterwerke oder Turgenjews Kabinettstücke.
In Puschkin allein findet Dostojewsky den bewussten Ausdruck der russischen Eigenart, wie sie in Peter dem Grossen, „dessen Persönlichkeit uns noch nicht ganz aufgeklärt ist,“ ihren elementaren Ausbruch findet. Jene Assimilationsfähigkeit des Russen, sich alle Sprachen eigen zu machen, alle Kulturen anzunehmen, mit einer scharfen Wendung vom eingeschlagenen Wege abzugehen, wenn es seine bessere Überzeugung gebietet, dabei die Eigenschaft, sich schuldig zu bekennen, alles dies, was ihn dem Europäer unverständlich macht, was dieser als Unpersönlichkeit an ihm rügt, das befähige eben den Russen zu jener Allversöhnlichkeit und Allmenschlichkeit, welche die Einigung der Menschen herbeiführt — im Gegensatz zu den immer komplizierteren Trennungen der europäischen Nationen, die wohl nicht „in der Jeanne d’Arc und den Kreuzzügen ihren Ursprung“ haben dürften und auch nicht durch das Wissen aufgehoben werden. Dostojewsky streift hiermit wieder die grosse Streitfrage des 19. Jahrhunderts: Glauben oder Wissen, Gott oder Ich, die er ja in allen seinen Werken in tiefsinnige Probleme aufblättert. In einem seiner Briefe spricht er es offen aus, dass er mit seinem letzten Romane nichts anderes will, als „das Dasein Gottes beweisen“.
Puschkin nun sieht Dostojewsky als den Genius an, der dies synthetische Wesen des Russen erkannt und in sich gerade aus seiner westlichen und künstlerischen Kultur heraus verkörpert habe. „Die kolossale Bedeutung Puschkins,“ sagt er, „ersteht vor uns immer mehr und mehr ... Für alle Russen ist er der vollendetste künstlerische Ausdruck dessen, was eigentlich der russische Geist ist, wohin alle seine Kräfte streben und wie namentlich das Ideal eines Russen beschaffen ist. Die Gestalt Puschkins ist der Beweis dafür, dass der Baum der Zivilisation schon früh reif geworden ist, und dass seine Früchte nicht faule, sondern herrliche, goldene Früchte sind. Alles, was wir aus der Bekanntschaft mit den Europäern über uns selbst lernen konnten, haben wir gelernt — alles, worüber uns die Zivilisation nur aufklären konnte, haben wir uns erklärt, und dieses Erkennen hat sich in der vollsten und harmonischsten Weise in Puschkin geoffenbart. Wir haben aus ihm herausverstanden, dass das russische Ideal All-Einheit. All-Versöhnlichkeit, All-Menschlichkeit ist usw.“
Und nun geht Dostojewsky zur brennenden Frage über, welche seit Jahren die russischen Schriftsteller in streitende Parteien geschieden hatte, nämlich dem Kampf der Utilitaristen und Tendenzschriftsteller gegen die Vertreter der reinen Kunst.
Hier zeigt sich sofort des Dichters synthetische Natur. In zwei prächtigen, durch Beispiele beleuchteten Ausführungen beweist er beiden Teilen ihre Berechtigung, sowie ihr Unrecht, geisselt er bei beiden die Blindheit, in der sie das Kind mit dem Bade ausschütten. Er, der selbst ein Feind der Utilitätslitteratur ist, wie sie von der Hand in den Mund lebt, geisselt jene, die ein Werk dieser Gattung verwerfen, selbst wenn es, wie bei Schtschedrin, durchaus künstlerisch hingestellt ist, und hält den Utilitaristen vor, dass sie Wirkung und Nutzen sofort verlangen, wie ein Kind den Mond vom Himmel herunter verlangt. Es sind also die Menschen, welche Litteratur und Kunst treiben, nicht aber diese für ihre Wirkungen verantwortlich zu machen.
„Die Kunst ist immer real und immer zeitgemäss, ist es immer gewesen und, was die Hauptsache ist, wird es immer bleiben,“ sagt Dostojewsky da. „Die Gesellschaft leidet oft an schweren Übeln und greift nach den Mitteln, die ihr die rechten scheinen, um sich zu helfen. Dient ihr eine Kunst als Arznei, so hat sie das ihre gethan, und hat sie es geleistet, so war es gewiss künstlerisch.“ Braucht aber die Zeit noch Anthologien, so möge sie nur noch danach greifen. Die Hauptsache aber ist, dass die Freiheit der Eingebung nie und nirgends gehemmt werde usw.
Hier ist nicht nur Äusseres als Hemmnis der „freien Eingebung“ aufzufassen, sondern ebenso sehr Einseitigkeit der Tendenz, Einseitigkeit eines ästhetischen Steckenpferdes, antikisierende oder mittelalterliche Schrullen, wie auch Abwendung von der Gegenwart im allgemeinen, Mangel an Gefühl der Bürgerpflicht und an Gemeinsinn.
Zur Beleuchtung dieses letzteren Mangels führt Dostojewsky folgendes drastische Beispiel an:
„Versetzen wir uns,“ sagt er da, „in das 18. Jahrhundert, gerade an den Tag des Erdbebens von Lissabon. Die Hälfte der Einwohner geht zu Grunde, Häuser stürzen ein, aller Besitz ist zerstört, jeder der Zurückbleibenden hat einen schweren Verlust erlitten — entweder Hab und Gut, oder seine Familie ist ihm entrissen. Die Leute taumeln verzweifelnd in den Strassen umher, durch das Entsetzen ihrer Sinne beraubt. Zu dieser Zeit lebt in Lissabon irgend ein berühmter portugiesischer Dichter. Am nächsten Tage erscheint irgend eine Nummer des Lissabonschen Merkur (damals erschienen überall Merkure). Das Blatt, das in einem solchen Augenblicke erscheint, erregt sogar einiges Interesse in den Gemütern der unglücklichen Stadtbewohner, ungeachtet dessen, dass sie nicht gerade dazu angethan sind, Zeitungen zu lesen; sie hoffen, dass die heutige Nummer ein Extrablatt sein werde, welches ausgegeben worden sei, um über die Verlorenen, die spurlos zu Grunde Gegangenen Nachricht zu geben usw. Da — an irgend einer in die Augen springenden Stelle — erblicken sie etwas in folgender Art:[17]
„Leises Flüstern, lindes Fächeln,
Nachtigallen-Trillersang,
Silberleuchten, träumend Wiegen
All den klaren Bach entlang,
Nächt’ge Helle, nächt’ge Schatten,
Unbegrenztes Dämmerlicht,
Zaub’risch wechselnde Bewegung
In der Liebsten Angesicht;
Rosenglut im Wolkenschleier,
Wiederschein wie Bernsteinlicht,
Küsse, Thränen, sanftes Feuer
Und — Morgenröte, Morgenlicht!“
„Ich weiss wirklich nicht, wie die Bewohner Lissabons ihren Merkur aufnehmen würden, aber mir scheint, ihren Poeten würden sie öffentlich auf dem Marktplatze justifizieren. Durchaus nicht darum, weil er ein Gedicht ohne Zeitwort geschrieben hat, sondern weil man gestern statt der Nachtigallentriller unter der Erde solche Triller gehört hatte, und das „Wiegen“ des Baches in einem Augenblicke solchen Wiegens der ganzen Stadt auftrat, dass die armen Leute nicht nur durchaus keine Lust verspürten, die „Rosenglut im Wolkenschleier“ oder das „Bernsteinlicht“ zu betrachten, sondern dass ihnen die Handlungsweise des Dichters allzu beleidigend und unbrüderlich erscheinen musste, der in einem solchen Augenblicke ihres Lebens so amüsante Dinge zu singen wusste. — Bemerken wir übrigens folgendes: Nehmen wir an, die Bewohner Lissabons hätten ihren Dichter hingerichtet, aber das Gedicht, das sie alle so erzürnte (sei’s auch von Rosenglut und Bernsteinlicht), konnte doch seiner künstlerischen Vollendung nach herrlich sein. Ja noch mehr, den Dichter haben sie hingerichtet, aber nach 30, nach 50 Jahren errichten sie ihm auf dem Marktplatze ein Standbild zu Ehren seiner bewunderungswürdigen Verse im allgemeinen und der „Rosenglut“ im besonderen. Es zeigt sich, dass nicht die Kunst schuldig geworden ist an dem Tage des Erdbebens. Das Gedicht, für das sie den Dichter justifizierten, hatte möglicherweise als ein Denkmal der Poesie und Sprache den Lissabonensern sogar einen nicht geringen Nutzen gebracht, indem es ihnen später Entzücken, sowie tiefes Schönheitsgefühl hervorrief und sich als ein erquickender Tau auf die Seele der jungen Generation niedersenkte. Folglich war nicht die Kunst schuldig, sondern der Dichter, welcher die Kunst in einem Augenblicke missbräuchlich anwendete, da es nicht an der Zeit war. Er sang und jubilierte an einer Totenbahre — — das war natürlich arg und ausserordentlich dumm seinerseits, aber immer war eben er schuldig und nicht die Kunst ist es gewesen.“
Dass ihm aber die ästhetische Gestaltung des Kunstwerks sehr am Herzen liegt, ja eigentlich sein Herzblatt ist, zeigt er uns auch auf andere Weise als durch das auserlesene Befürworten der gegnerischen Anschauung. Er spricht sich sehr entschieden darüber aus, in welcher Weise der Mangel an Kunst der besten Idee schaden könne, und dass die hohe künstlerische Vollendung, etwa der Iliade, auch nach Jahrtausenden niemals die Wirkung versage.
Für die Beweisführung gegen die grobe Tendenzaufbauschung holt er sich ein sehr angesehenes Opfer, den bekannten und in jenen Tagen vielbewunderten Kritiker N. A. Dobroljubow, herbei und füllt mehrere Bogen seiner Tagebücher mit der eingehenden Kritik seiner Kritik.
Diese Gegenkritiken hier wiederzugeben, hiesse etwa den Leser in einen Raum führen, wo gegenüberstehende Spiegel eine endlose Reihe von Reflexen erzeugen. Wir halten uns aber an das, worauf es hier ankommt — das Volkswohl und die Art, es auf dem Wege des Schrifttums zu fördern.
Es handelt sich um die Erzählung „Mascha“ der kleinrussischen Schriftstellerin Markowitsch, welche unter dem Pseudonym Marko Wowtschók zwei Bände Volkserzählungen im kleinrussischen und im grossrussischen Dialekt geschrieben hat; Turgenjew hat die ersteren in das Grossrussische übersetzt. Die Dichterin behandelt in den Erzählungen hauptsächlich das so oft erörterte Verhältnis der Leibeigenen zu ihrer Herrschaft. „Mascha“ ist ein junges Bauernmädchen, das sich auf alle Weise der ihr von der Gutsherrin auferlegten Arbeit widersetzt und nur „frei“ arbeiten will. Schon in ihrer frühesten Kindheit hat sie immer nach den Gründen jedes Befehls gefragt, hat die Gutsfrau nicht grüssen wollen und sich bei ihrem Erscheinen versteckt. Später hat sie allen Vorstellungen ihrer Muhme, die sie und ihren Bruder als Waisen aufgezogen hatte, immer die Frage entgegengesetzt: und wer steht für uns ein, wo ist unser Recht? Später will sie weder spinnen, noch im Garten jäten, und als ihr die Herrin einmal selbst die Sichel in die Hand drückt und sagt: „Da, schneide das Gras hier“ — schneidet sie sich sofort in die Hand; die Gutsherrin, „die noch obendrein nicht von der schlimmen Gattung, sondern liberal ist“, verbindet dem Mädchen die blutende Hand mit dem eigenen Taschentuche, das dieses aber zu Hause sofort zornig von der Wunde reisst und in den fernsten Winkel der Stube wirft. Endlich geht das Mädchen nicht mehr am Tage aus der Hütte, damit man ihrer „Krankheit“ Glauben schenke — wandert nur Nächte lang im Hausgärtchen umher, isst nicht, spricht nicht und „schmilzt vor den Augen der Muhme zusammen“. Da kommt eines Tages der Bruder heim und verkündet die Nachricht, dass die Gutsfrau ihnen gestattet habe, sich freizukaufen. Das Mädchen stürzt sich mit einem Schrei dem Bruder zu Füssen: „Kaufe uns los,“ schreit sie, „verkaufe alles und kaufe uns los, ich will alles durch freie Arbeit heimzahlen!“ Er verkauft alles, und die Heroine ist gerettet.
Hier stellt Dostojewsky das Falsche einer Kritik ans Licht, welche ein Kunstwerk darum preist, weil man darin ganz gescheit über Selbstverständliches spreche, während es doch nichts unwahreres, puppenhafteres und weniger russisches geben könne, als dieses Bauernmädchen, das da über Freiheit und Menschenrechte deklamiere und „unbewusst heroisch“ werde. Der Dichter greift nun diese unkünstlerische Art der polemischen Litteratur — „womit Ihr Euch nur selbst schadet, meine Herren“ — auf das heftigste an und stellt dem vermeintlichen Nutzen eines solchen Eintagsmachwerks bei allem Talent, das er dem Autor (man wusste damals offenbar noch nicht, dass dies eine Frau sei) und dem Kritiker zuspricht, die unsterbliche Wirkung der Antike entgegen.
Hier kehrt Dostojewsky zu seinem früheren Ausspruch zurück, den er als Argument der Künstler gegen die Utilitaristen ins Feld geführt hatte. „In der That,“ heisst es da, „wenn man auch die Kunst nur von einem Standpunkte, dem des Nutzens, betrachten wollte, so ist uns ja der normale, historische Gang des Nutzens, den die Kunst der Menschheit gebracht hat, noch gar nicht bekannt. Es wäre schwer, die ganze Masse von Nutzen zu berechnen, welche z. B. die Ilias oder der Apollo von Belvedere der Menschheit gebracht hat und heute noch bringt, Dinge, die unserer Zeit offenbar durchaus nicht nötig sind. Seht, es hätte z. B. irgend einer, als er noch ein Jüngling war, in jenen Tagen, da noch „des Daseins Bilder frisch und neu“, einmal den Apollo von Belvedere angesehen, und das erhabene und unendlich schöne Bild des Gottes hätte sich unwiderstehlich seiner Seele eingeprägt. Dies scheint ein leeres Faktum zu sein: er hat sich zwei Minuten an der Statue erfreut und ist darauf fortgegangen. Allein dieses Sicherfreuen hat ja keine Ähnlichkeit mit der Bewunderung z. B. einer schönen Damentoilette! „Dieser Marmor ist ja ein Gott“ — Ihr möget so viel Ihr wollt die Nase rümpfen, seine Gottheit nehmt Ihr ihm nicht. Man hat versucht, sie ihm zu nehmen, doch ist nichts dabei herausgekommen. Und darum war wohl der Eindruck, den der Jüngling empfing, ein heisser, einer, der die Nerven erschütterte, der die Haut kalt überrieselte; ja — wer weiss es denn! vielleicht geht im Menschen bei solchem Empfinden einer hohen Schönheit, bei solcher Nervenerschütterung irgend eine innere Veränderung, irgend ein Umsatz der Moleküle, irgend eine galvanische Strömung vor sich, welche in einer Sekunde das Vorhandene zu einem anderen, ein Stück Eisen zum Magnete macht. Es giebt freilich eine grosse Menge von Eindrücken auf der Welt, allein dieser besondere Eindruck eines Gottes, der geht wohl nicht spurlos vorüber. Nicht vergebens bleiben denn auch solche Eindrücke fürs Leben. Und, wer weiss: als dieser Jüngling etwa zwanzig, dreissig Jahre nachher, bei irgend einem grossen Ereignisse des öffentlichen Lebens, sich als einer von dessen Hauptfaktoren nach der einen und nicht nach der anderen Richtung hervorthat, kann es leicht sein, dass in der Masse der Ursachen, welche ihn veranlassten, so und nicht anders zu handeln, ihm ganz unbewusst auch der Eindruck enthalten war, den er zwanzig Jahre vorher vom Bildnis des Apoll von Belvedere empfangen hatte usw.“
Die weiteren Aufsätze in der „Wremja“ enthalten, wie gesagt, schon deutlicher die ersten Anklänge jenes Glaubensbekenntnisses, das Dostojewsky sein Leben lang erfüllte und das, wie wir wissen, in der Puschkin-Rede seinen scharf umschriebenen und klarsten Ausdruck fand.
Den belletristischen Teil des Blattes suchten die Brüder so leicht und so amüsant als möglich zu gestalten. Es lag ihnen, wie Strachow erläutert, damals ganz besonders daran, ihren national-politischen Überzeugungen, welche sich damals noch vom reinen Slavophilentum abtrennten, so rasch als möglich einen grossen Leserkreis zu verschaffen, um allen etwaigen Missverständnissen in dieser Richtung von vornherein entgegenzutreten oder da, wo sich noch keine Meinung gebildet hatte, die ihrige einzusetzen. Einen breiten Boden aber konnten sie nur gewinnen, indem sie in ihrem Unterhaltungsblatt die weitesten Konzessionen dem leichten Geschmack des Romane lesenden Publikums machten und Erzählungen brachten, wie: „Johann Casanovas Flucht aus den Bleidächern Venedigs“, „Der Prozess Lassenare“ usw. Einer ihrer bedeutendsten Mitarbeiter, Apollon Grigorjew, der sich namentlich durch die Schärfe und Tiefe seiner kritischen Studien einen Namen gemacht hatte, der aber nur von wenigen ernsten Lesern gelesen wurde, war mit dieser Führung nicht zufrieden und warf, als in der Folge auch Theodor Michailowitsch Feuilleton-Romane für die „Wremja“ schrieb, dem Hauptredakteur Michail Dostojewsky vor, er lasse den Bruder wie ein Postpferd für das Blatt arbeiten, was diesen sicherlich an seiner Gesundheit und an seinem Talent schädigen müsse.
Einige Jahre später, im Jahre 1864, nimmt Theodor M. Dostojewsky diesen Streit auf und veröffentlicht in der später gegründeten „Epoche“ eine Entkräftung dieser Anschuldigung, die wir hier vorbringen:
„Erstens können die (angeführten) Worte Grigorjews auf keine Weise als Vorwurf gegen meinen Bruder gekehrt werden, welcher mich liebte, mich als Schriftsteller nur allzu parteiisch hochschätzte und sich über mir gewordene Erfolge noch bedeutend mehr freute, als ich selbst. Dieser edelste Mensch war nicht imstande, mich wie ein Postpferd in seinem Journal zu verwenden. Offenbar handelt es sich in diesem Briefe Grigorjews um meinen Roman „Erniedrigte und Beleidigte“, welcher damals im „Wremja“ gedruckt wurde. Wenn ich einen Feuilleton-Roman geschrieben habe (was ich vollkommen zugestehe), so bin ich allein, ich ganz allein daran schuld. So habe ich mein ganzes Leben lang geschrieben, so — habe ich alles geschrieben, was von mir publiziert worden ist, mit Ausnahme der Erzählung „Arme Leute“ und einiger Kapitel der „Memoiren aus einem Totenhause“.“ (Wir müssen hier den „Kleinen Held“ anfügen, von dem wir ja wissen, dass er in der Petersburger Festungshaft vor dem Todesurteil geschrieben wurde und aus diesem Umstand so „unschuldig“ ausfiel.) „Es hat sich in meinem litterarischen Leben sehr oft ereignet, dass der Anfang eines Kapitels von einem Roman oder einer Erzählung schon in der Druckerei und schon gesetzt war, während das Ende desselben noch in meinem Kopfe sass, aber unbedingt bis morgen geschrieben sein musste. Gewohnt so zu arbeiten, that ich das Gleiche mit den „Erniedrigten und Beleidigten“, allein durchaus ohne von irgend jemand dazu gedrängt worden zu sein, aus eigenem Willen. Die erst gegründete Zeitschrift, deren Erfolg mir über alles teuer war, brauchte einen Roman, und ich bot ihr einen Roman in vier Teilen an. Ich selbst versicherte dem Bruder, dass der ganze Plan dazu schon lange in mir fertig sei (was nicht der Fall war), dass es mir leicht sein werde, zu schreiben, der erste Teil schon geschrieben sei usw. Hier habe ich nicht um des Geldes willen gehandelt. Ich gestehe vollkommen ein, dass in meinem Roman viele Gliederpuppen statt Menschen vorkommen[18], dass wandelnde Bücher[18] finden sind und nicht Personen, welchen künstlerische Gestaltung geworden ist (wozu allerdings Zeit und Ausprägung der Idee im Geist und in der Seele erforderlich sind). Zur Zeit, als ich schrieb, erkannte ich das im Arbeitsfeuereifer nicht, ahnte es höchstens. Allein, was ich wirklich wusste, als ich zu schreiben anfing, war dies: 1. dass, wenn der Roman auch nicht gelingt, er Poesie haben würde, 2. dass zwei bis drei heisse, kraftvolle Stellen darin sein werden, 3. dass die zwei ernsthaftesten Charaktere darin vollkommen wahr und sogar künstlerisch dargestellt sein werden. Mit dieser Überzeugung begnügte ich mich. Es kam ein rohes Produkt zu Tage, allein es sind etwa ein halbes Hundert Seiten darin, auf welche ich stolz bin. Gewiss, ich trage selbst die Schuld daran, dass ich mein ganzes Leben lang so gearbeitet habe, und ich gebe zu, dass dies sehr schlecht ist aber ... Der Leser möge mir diese schöne Rede über mich selbst und meine „hohe Begabung“ verzeihen, sei es nur mit Rücksicht darauf, dass ich jetzt zum erstenmale im Leben selbst über meine Werke etwas gesagt habe[19].“
In der weiteren Ausführung der Differenzen der „Wremja“ mit ihrem Haupt-Mitarbeiter Grigorjew sagt Dostojewsky: „Drittens ist es vollkommen wahr, dass sich in der Zeitschrift in den ersten Jahren ihres Bestandes Schwankungen bemerkbar machten, Schwankungen — nicht in der Richtung, sondern in der Art ihrer Wirksamkeit. Auch in manchen Überzeugungen hat es Irrtümer gegeben. Allein die Richtung konnte sich nur mit den Jahren formulieren. Eine Richtung haben und sie klar und für alle verständlich formulieren können — ist zweierlei. Das letztere erreicht man durch Erfahrung, durch die Zeit, das Leben, und es steht in direkter Beziehung zur Entwickelung der Gesellschaft selbst. Eine abstrakte Formel ist nicht immer entsprechend. Wer etwas zu sagen hat, der weiss, wie schwer es oft ist, sich auszusprechen. Fertige Formeln, die man der Routine entlehnt, namentlich solche älteren Datums, d. h. wenn schon alle einen gewissen Begriff von ihnen haben, gelingen weit besser, gefallen der Gesellschaft weit mehr, als Überzeugungen, die ihr noch nicht bekannt sind. Nur solche Ideen sind leicht verständlich, die schon viel herumgetragen wurden. Wir sind aufrichtig bereit, unsere früheren Irrtümer einzugestehen, allein wir haben sie ja damals selbst nicht zu sehen vermocht, gerade deshalb nicht, weil wir auch damals nach unserer festen Überzeugung handelten.“
An anderer Stelle dieser Rechtfertigungsschrift sagt der Dichter: „Ich will noch eine letzte allgemeine Bemerkung machen. Von jenen prächtigen, historischen Briefen (11 Briefe aus Orenburg an Strachow), in welchen auch nicht eine falsche (unaufrichtige) Note erklingt und in welchen sich so typisch, wenn auch immer noch nicht vollständig einer der russischen Hamlets unserer Zeit (ein wirklicher Hamlet) zeichnet — von diesen herrlichen Briefen sage ich, kann auch heute nicht alles ohne Vorbehalt von der Redaktion der „Epoche“ (die nach dem Auseinanderfallen der „Wremja“ von Dostojewsky gegründete Monatsschrift, welche von Anfang 1864 bis incl. Februar 1865 bestand) angenommen werden. Ohne Zweifel, jeder litterarische Kritiker muss zugleich auch Dichter sein, dies ist, scheint mir, eine der unentbehrlichsten Bedingungen für einen wirklichen Kritiker. Grigorjew war ein unbestrittener und ein leidenschaftlicher Dichter, aber er war auch launenhaft und heftig wie ein leidenschaftlicher Dichter — — — Grigorjew war, wenn auch ein wirklicher Hamlet, doch, wenn man bei Shakespeares Hamlet beginnt, und bei unseren modernen russischen Hamlets und Hamletchen aufhört, einer jener Hamlets, welche weniger doppellebig sind, als die übrigen, und auch weniger reflektieren als die anderen. Er war unmittelbar Mensch, in vielem sogar ihm selbst unbewusst ein urwüchsiger und knorriger Mensch. Er war vielleicht, als Natur (nicht als Ideal genommen, das versteht sich von selbst), der russischeste Mensch unter allen seinen Zeitgenossen. Daher kam es auch, dass er auch seinen kleinsten Ausbruch in einer allgemeinen Sache in so hohem Grade für organisch und unvermeidlich für die ganze Sache, von ihr für so untrennbar hielt, dass die geringste Nichtbeachtung dieses Ausbruches ihm manchmal schon als ein Zusammenbrechen der ganzen Sache erschien. Und so wie er sich im Leben weniger als andere in zwei teilte, und es nicht verstand, ebenso bequem, wie jeder „Held unserer Tage“, mit der einen Hälfte seines Wesens sich zu grämen und zu quälen, mit der anderen Hälfte aber den Gram und die Qual der ersten Hälfte zu beobachten, zu erkennen und zu beschreiben, manchmal sogar in wunderschönen Versen mit Selbstvergötterung und einer gewissen Feinschmeckerei, so wurde er ganz und gar, durch und durch — in seinem ganzen Menschen, wenn ich so sagen darf — von seinem Gram ergriffen. In dieser Stimmung sind auch seine Briefe geschrieben.
„Ich bin Kritiker und nicht Publizist“, hat er mir mehrere Male, sogar kurze Zeit vor seinem Tode, als Antwort auf meine Bemerkungen, selbst gesagt. Allein jeder Kritiker soll auch Publizist sein, in dem Sinne, als es die Pflicht eines jeden Kritikers ist — nicht nur feste Überzeugungen zu haben, sondern sie auch ausführen zu können. Dieses Vermögen aber, seine Überzeugungen auszuführen, ist die wesentlichste Eigenheit jedes Publizisten.
Ich glaube, dass Grigorjew in keiner Redaktion der Welt ruhig hätte verbleiben können; wenn er aber sein eigenes Journal gehabt hätte, so würde er es selbst fünf Monate nach dessen Gründung zu Grunde gerichtet haben usw.“
Alle diese Ausführungen zeigen den Dichter, wie uns scheint, von einer Seite, welche der Leser seiner belletristischen Werke, sowie der Kenner seiner eigenen Lebensführung nicht bei ihm voraussetzt, wir meinen die, wenn auch nur theoretisch, geschäftsmännische Seite. Es ist wohl nicht die feine Psychologie, welche er in der Beurteilung Grigorjews bekundet, die wir ja an ihm, dem „Realisten des Innern“ kennen, was uns hier frappiert, sondern einerseits ganz praktische Forderungen an die Führung einer Zeitschrift, andererseits der Ernst, mit welchem die Thätigkeit der Publizistik von Dostojewsky selbst, sowie von seiner Zeit und Umgebung betrachtet wurde. Um die geringsten Schwankungen in der Wahl seiner Mittel zu erläutern und zu entschuldigen, welche Fülle von Argumenten, welche Vertiefung in die Entwickelungsphasen von eines Menschen innerster Wahrhaftigkeit. Wir begreifen danach sein Axiom: „ein Journal ist eine grosse Sache“. — Allein diese Anschauung und ihre Befolgung brachte den Dichter in hellen Gegensatz nicht nur zu Einzelnen, wie Grigorjew, sondern zu den Slavophilen, welche sich um Aksakow gruppierten, sowie zu allen jenen, welche es mit der Kunst ernst nahmen und, durch die landläufige, journalistische Behandlung ernster Dinge abgestossen, in diesem litterarischen, „von der Hand in den Mund-Leben“ Dostojewskys weder für ihn noch für die gute Sache ein Heil finden konnten. Sie vergassen dabei oder konnten es nicht sehen, dass es sich hier um ganz anderes handelte, als um ein tägliches Menu für den Hunger des Publikums. Es handelte sich darum, ein solches Publikum nicht aus den Augen und aus der Hand zu lassen und ihm immer wieder seine Ration Wahrheit aufzunötigen. Später allerdings, als sich Dostojewsky immer mehr den Slavophilen anschloss, konnte es nicht anders sein, als dass auch er sich etwas von der journalistisch gangbaren Litteratur abwandte, nachdem er sie gegen einen Angriff Aksakows im Jahre 1861 energisch mit folgenden Sätzen vertreten: „Man liest einen oder den anderen Eurer Aussprüche und kommt endlich unwillkürlich zum Schluss, dass Ihr Euch endgiltig abseits gestellt habt und auf uns schaut, wie auf ein fremdes Geschlecht, als wäret Ihr aus dem Monde zu uns herunter gekommen, als lebtet Ihr nicht im selben Reiche mit uns, nicht in der gleichen Zeit, nicht das nämliche Leben! — Es ist, als machtet Ihr mit jemand Experimente, als sähet Ihr irgendwen unter dem Mikroskop an! Aber das ist ja Eure eigene, Eure russische Litteratur! Was seht Ihr sie denn so von oben herab an und zerlegt sie wie ein Käferchen? Ihr seid ja selbst Litteraten, Ihr Herren Slavophilen!“
Auch seinen Mitarbeiter Strachow, der sich anfangs gleichfalls vornehm vom Journalismus fernehielt, hatte Dostojewsky zu bekämpfen. N. Strachow erzählt uns darüber folgendes: „Ich trat erst später in die belletristische Richtung ein, denn ich hatte mich anfangs zu einem wissenschaftlichen Berufe vorbereitet, darum blickte auch ich mit scheelem Auge auf die Journalistik und brachte ihr einigen Hochmut entgegen. Auf jede Weise trachtete ich der Vielschreiberei zu entgehen und bemühte mich, meine Artikel vollkommen auszuarbeiten. Diese Bestrebungen riefen gewöhnlich Theodor Michailowitschs Spott hervor: „Sie sorgen immer für eine ‚Vollständige Ausgabe‘ Ihrer Werke“ — sagte er. — „Aber es wird ja niemals eine solche Ausgabe erscheinen“, antwortete ich. Allein ich wurde bald in die Litteratur hineingezogen und begann ihre Interessen mit grösserer Wärme ans Herz zu schliessen.“ — „Wie immer dies nun sein möge“, fährt N. Strachow weiter fort, „das Resultat von Dostojewskys litterarischen Beziehungen ist bekannt. Am Ende seiner Laufbahn, als er sich schon als vollständiger Slavophile bekannte, war er imstande, sich über unsere Intelligenz und ihre Bestrebungen fast mit einer ebensolchen Bitterkeit auszusprechen, als die gewesen, die ihn in den Blättern des „Denj“ (Tag) so sehr beleidigt hatte. Was aber seine Vorliebe für die feuilletonistische Form der Zeitschriften betrifft, so ist sie bei ihm niemals ganz verschwunden. Er zwang sich sogar manchmal, um des allgemeinen Nutzens willen dazu, ein Feuilletonist und ein Schnellschreiber zu sein. Mit den Jahren jedoch wurde seine Art zu schreiben immer strenger; ja, auch früher schon konnte man in seinen Feuilletons nicht wenige Seiten finden, welche eine künstlerische Kraft und strenge Ausführung zeigten, die weit über die Aufgaben des Feuilletons hinausgingen.“
Wir begegnen also hier abermals einer von jenen Wandlungen tieferer Natur, welche so oft im Leben Dostojewskys vorkommen, von den Gegnern verurteilt, von den Freunden mit mehr oder minder Geschick beschönigt werden. Nach unserer Meinung ist die Verurteilung nicht zutreffend, die Beschönigung überflüssig. Die Verurteilung ist nicht zutreffend, weil es zu oberflächlich ist, das Resultat, welches sich am Zielpunkt einer ernsten Entwickelung ergiebt, einfach als Gegensatz des Ausgangspunktes hinzustellen. Die Beschönigung aber ist überflüssig, weil Dostojewskys Wandlungen und Wendungen nicht in den engen Kräfte-Komplex gezwängt werden dürfen, die man gemeinhin „Festigkeit“, „Charakter“ nennt. Was ihn trieb, seine weiten, unberechenbaren Bahnen um ein unsichtbares Zentrum zu durchlaufen, war jene Kraft, die jedes Urphänomen in sich trägt und die meist erst, wenn die Bahn durchlaufen ist, von Logikern und Moralisten rückblickend begriffen wird. — Dostojewskys Lebensweise entsprach ganz und gar seiner Arbeitsmethode, und es wäre schwer zu sagen, welche von der anderen bedingt war. „Dostojewsky schrieb fast ausschliesslich bei Nacht“, erzählt Strachow und es bestätigt dies seine Witwe. „Um 12 Uhr, wenn alles sich zur Ruhe begeben hatte, blieb er allein mit seinem Samovar, und während er einen kühlen, nicht allzustarken Thee schlürfte, schrieb er bis 5 oder 6 Uhr morgens. Er stand um 2, auch 3 Uhr nach Mittag auf und der Tag verging mit dem Empfang von Gästen, Spaziergängen und Besuchen bei Freunden.“
Der Akt des Schreibens war Dostojewsky eigentlich ein sehr unangenehmer. Er schildert in dem Roman „Erniedrigte und Beleidigte“ seinen eigenen Zustand, wenn er Iwan Petrowitsch die Worte in den Mund legt: „Es ist mir immer angenehmer gewesen, meine Werke in mir herumzutragen, darüber nachzusinnen, wie ich sie schreiben werde, als sie in der That niederzuschreiben, und doch war es nicht Faulheit. Was war es also?“
Strachow antwortet darauf sehr richtig: „Es war die Überfülle geistigen Schaffens, die in ihm brodelte, für die das Niederschreiben eine Unterbrechung war“. „Dennoch phantasierte Theodor Michailowitsch oft davon“ — schliesst Strachow — „was für wunderschöne Dinge er ausarbeiten könnte, wenn er die nötige Musse dazu hätte. Übrigens waren, wie er selbst erzählt, die besten Seiten seiner Werke in einem Zug ohne Umarbeitung entstanden — allerdings als Folge innerlich schon ausgetragener Ideen.“
Mitten in dieser fieberhaften, alle seine Kräfte intellektuell und materiell anspannenden Doppelthätigkeit des Schriftstellers und Wahrheits-Apostels einerseits, des praktischen Redakteurs andererseits, muss man sich den Dichter einer Krankheit unterworfen denken, die sich durch die Aufregungen seines Berufes und seines häuslichen Lebens nur steigerte, ihn oft heimsuchte und immer eine mehrtägige Gedächtnisschwäche und Arbeitsunfähigkeit zurückliess. Über die Art, wie seine Krankheit auftrat, hat er uns im „Idiot“ eine genaue Schilderung gegeben. Sie ist sehr merkwürdig und widerspricht eigentlich dem, was wir sonst von den Erscheinungen vor und nach einem epileptischen Anfalle gehört oder gesehen haben. Strachow erzählt uns als Augenzeuge eines solchen Anfalles darüber Folgendes:
„Die Anfälle seiner Krankheit ereigneten sich ungefähr einmal im Monat — das war der gewöhnliche Verlauf. Allein manchmal, obwohl sehr selten, waren sie häufiger; es kamen sogar zwei Anfälle in einer Woche vor. Im Ausland, das heisst bei grösserer Ruhe, aber auch infolge des günstigeren Klimas, kam es vor, dass vier Monate ohne einen Anfall vergingen. Er hatte immer ein Vorgefühl des Anfalles, es konnte dies indessen auch täuschen. Im Roman „Der Idiot“ ist eine ausführliche Beschreibung der Empfindungen, welche der Kranke in solchem Falle durchmacht. Ich selbst war zufällig einmal Zeuge, wie ein Anfall gewöhnlicher Stärke Theodor Michailowitsch überraschte. Es war wahrscheinlich im Jahre 1863, gerade am Char-Samstag. Er kam spät, um 11 Uhr abends, zu mir, und wir gerieten in ein sehr lebhaftes Gespräch. Ich kann mich des Gesprächsthemas nicht erinnern, aber ich weiss, dass es ein sehr wichtiges und abstraktes Thema war. Theodor Michailowitsch ging in gehobener Stimmung in der Stube auf und ab, ich aber sass am Tische. Er sprach über irgend etwas Hohes und Freudiges. Als ich seinem Gedanken mit einer Bemerkung zustimmte, wendete er mir sein begeistertes Gesicht zu, worin sich zeigte, dass seine Entzückung den höchsten Grad erreicht hatte. Er blieb einen Augenblick stehen, gleichsam Worte für seine Gedanken suchend, und öffnete schon den Mund. Ich sah ihn mit gespannter Aufmerksamkeit an, im Gefühle, dass er etwas Aussergewöhnliches sagen, dass ich eine Offenbarung hören würde. Plötzlich entrang sich seinem Munde ein seltsamer, langgezogener, unartikulierter Laut, und er sank bewusstlos mitten im Zimmer auf den Boden. Der Anfall war diesmal nicht stark. Der ganze Körper streckte sich nur krampfhaft aus und in den Mundwinkeln zeigte sich Schaum. Nach einer halben Stunde kam er zu sich, und ich begleitete ihn zu Fuss nach Hause, da es nicht weit dahin war. Oft hatte mir Theodor Michailowitsch erzählt, dass er vor den Anfällen Minuten eines entzückten Zustandes habe. „Für einige Augenblicke“ — sagt er — „empfinde ich ein solches Glück, wie es in einem gewöhnlichen Zustande nicht möglich ist und wovon andere keine Vorstellung haben können. Ich fühle in mir und in der Welt eine vollständige Harmonie, und dieses Gefühl ist so süss und so stark, dass man für einige Sekunden solcher Seligkeit zehn Jahre seines Lebens, ja meinetwegen das ganze Leben hingeben könnte.[20]“
Eine Folge seiner epileptischen Anfälle war die, dass er manchmal zufällig beim Fallen heftig an etwas stiess. Selten zeigte sich Röte im Gesicht, manchmal Flecken. Die Hauptsache aber war, dass der Kranke das Gedächtnis verlor und sich zwei oder drei Tage danach vollkommen zerschlagen fühlte. Seine Seelenstimmung war dann auch eine sehr gedrückte; er konnte seiner Schwermut und Reizbarkeit kaum Herr werden. Der Charakter dieser Schwermut bestand nach seinen Worten darin, dass er sich als ein Verbrecher fühlte; es schien ihm, als drücke ihn eine unbekannte Schuld, eine grosse Missethat nieder.“
Welche Kraft mochte dazu gehören, solche Zustände zu überwinden, und trotz des geschwächten Gedächtnisses in wenigen Nächten zwei bis drei Druckbogen fertig zu stellen! Wenn es noch eines Beweises seiner Kraft bedürfte, so wäre es die rastlose Thätigkeit, welche der Dichter nun, seit Beginn der publizistischen Arbeit, bei der Erfassung und Beleuchtung der brennenden Tagesfragen entfaltete.
Wir lassen hier die Namen der vier, von ihm von 1861 bis 1881, seinem Todesjahre, redigierten Zeitschriften folgen: die „Wremja“ wurde, wie oben gesagt, im Jahre 1861 gegründet und erschien vom Januar dieses Jahres bis inkl. April 1863. Auf die Ursachen der Auflösung dieses Redaktions-Verbandes werden wir sofort zu sprechen kommen. In dieser Monatsschrift erschienen, wie schon erwähnt, als Feuilleton-Roman „Die Erniedrigten und Beleidigten“, ferner eine Reihe von Artikeln über Kunst, wovon wir oben sprachen. Zu Anfang des Jahres 1864 wurde die Arbeit wieder aufgenommen mit einer Ankündigung, die wir weiter unten zu bringen uns ebenfalls nicht versagen können. Diese Monatsschrift erschien auch nur kurze Zeit, d. h. bis inkl. Februar 1865. Zwischen 1865 und 1872 fällt ein langer Aufenthalt in Deutschland und Italien, der Tod des Bruders, Schuldenlast, böse Zeiten überhaupt, über die uns manche seiner Briefe betrübenden Aufschluss geben. Im Jahre 1873 endlich übernimmt Dostojewsky die Redaktion des vom Fürsten Meschtschersky gegründeten „Grashdanin“, dessen Feuilleton er zumeist selbst unter dem Titel „Tagebuch eines Schriftstellers“ besorgt. Später, im Jahre 1876, gründet er neben dem Grashdanin eine selbständige Monatsschrift unter dem gleichen Titel „Tagebuch eines Schriftstellers“, die zwei volle Jahrgänge 1876 und 1877 durchlaufen hat, wovon aber, offenbar aus Mangel an Subskribenten und Geld, später nur im August 1880 und im Januar 1881 unmittelbar nach des Dichters Tode je eine Nummer erschien. In der Gesamtausgabe seiner Werke sind die Aufsätze aus dem Grashdanin vom Jahre 1873, sowie die Jahrgänge von 1876 und 1877 in drei Bänden erschienen, wobei im letzten auch die zwei Nummern aus den Jahren 1880 und 1881 Aufnahme gefunden haben. Der Erfolg der neuen Monatsschrift scheint gleich anfangs ein sehr grosser gewesen zu sein. Sie hatte im ersten Jahre 2300, im zweiten Jahre 4302 Abonnenten. Dieser Erfolg dürfte dem Umstand zuzuschreiben sein, dass so vortreffliche Kräfte wie Njekrassow, Ostrowsky, Schtschedrin ausser Grigorjew, Strachow und den Brüdern Dostojewsky an der Arbeit teilnahmen.
Indessen scheint doch das Hauptgewicht auf der Belletristik geruht zu haben und Theodor Michailowitschs Bestrebungen im eigentlichen Bereich seiner volklich-religiösen Mission entweder nicht genug betont, oder vom Publikum nicht genug herausgefühlt und von den Slavophilen reinsten Wassers nicht anerkannt worden zu sein; sonst hätte unmöglich jenes Missverständnis entstehen können, das schliesslich zum Verbot der Monatsschrift und zu jenen Streitschriften führte, als deren eine ein Brief J. S. Aksakows zu bezeichnend ist, um nicht im weiteren Verlauf unserer Aufzeichnungen Platz zu finden. Die ganze Sache, welche so wichtige Folgen für das Blatt und die Verhältnisse der Brüder Dostojewsky haben sollte, entstand durch einen Artikel N. Strachows über den polnischen Aufstand zu Beginn des Jahres 1863. Wir müssen hier einiges über die ehrliche und freundschaftliche Beziehung vorausschicken, welche Dostojewsky mit Strachow verband und später das volle Eintreten des Dichters für Strachows Arbeit zur Folge hatte, trotzdem er gleich anfangs eine gewisse litterarische Unzufriedenheit über dessen Abstraktheit und Unverständlichkeit dem Autor gegenüber angedeutet hatte. Was Strachow über ihre Beziehungen sagt ist bezeichnend: „Unsere damalige Freundschaft“ — sagt er (Materialien p. 224) — „war, obwohl sie vornehmlich einen intellektuellen Charakter hatte, damals doch eine sehr enge. Das Einander-Nahestehen der Menschen hängt von ihrer beiderseitigen Natur ab und überschreitet auch bei den günstigsten Bedingungen nicht ein gewisses Mass. Jeder von uns zieht gleichsam eine Kreislinie um sich herum, über die hinweg er niemanden zulässt, oder besser gesagt, niemanden zulassen kann. So fand unsere Annäherung ein Hindernis in unseren beiderseitigen seelischen Eigenschaften, wobei ich mir durchaus nicht den geringsten Teil dieses Hindernisses zusprechen will. Über Theodor Michailowitsch kamen manchmal Augenblicke des Misstrauens, dann sagte er argwöhnisch: „Strachow hat niemand, mit dem er reden könnte, darum hält er sich an mich.“ Diese vorübergehenden Zweifel bezeugen nur, wie fest wir im allgemeinen auf unser gegenseitiges Verhältnis vertrauten. Wenn Theodor Michailowitsch einen Anfall von Epilepsie hatte, befand er sich, wieder zur Besinnung gekommen, in einem unerträglichen seelischen Zustande. Alles reizte und schreckte ihn, und er litt unter der Gegenwart der allernächsten Freunde. Dann pflegten sein Bruder oder seine Gattin nach mir zu schicken — in meiner Gesellschaft wurde ihm leichter, und so er erholte sich nach und nach.“ „Indem ich mich daran erinnere“ — fährt Strachow fort — „so erneuere ich in meinem Gedächtnisse einige meiner besten Empfindungen und denke, dass ich damals ein besserer Mensch war, als heute.“
Im Juni 1862 jedoch, ehe noch die Dinge Gestalt annahmen, welche dem Blatte ein jähes Ende bereiten sollten, konnte Theodor Michailowitsch, dem die Ärzte eine Reise ins Ausland wiederholt anrieten, das Redaktions-Bureau für einige Zeit verlassen. So finden wir ihn auf einem Ausfluge nach Paris, London, abermals Paris, Köln, Düsseldorf, Mainz, Basel und Genf, wo er mit Strachow zusammentrifft. Von dort gingen sie gemeinsam nach Luzern, dann über den Mont-Cenis nach Turin und Genua, wo sie sich nach Livorno einschifften, um dann mittels Eisenbahn nach Florenz zu gelangen. Spuren dieser ersten Reise finden wir nur in einem Briefe an Strachow, wo der Dichter in heller Begeisterung für das Bevorstehende dem Freunde zuredet, sich ihm anzuschliessen, ferner in den Aufzeichnungen Strachows und in einem Aufsatze des Dichters, worin er seiner Galle über Paris und die Franzosen Luft macht und der unter dem Titel: „Winterliche Betrachtungen über sommerliche Eindrücke“ im dritten Bande seiner Gesamtwerke enthalten ist. In jenem Briefe drückt sich der Dichter, er, dessen Kenntnis europäischer Litteratur fast ausschliesslich aus französischen Quellen geschöpft war, der begeisterte Verehrer Balzacs und Jünger der George Sand, über die Franzosen in natura folgendermassen aus: „Der Franzose ist still, ehrenhaft, höflich, aber falsch; und das Geld ist bei ihm alles.“ (In gallig-humoristischer Weise finden wir diese Beobachtung im oben erwähnten Aufsatz illustriert und müssen dabei der Romane Balzacs, dieses umfassenden Genies und tiefen Menschenkenners denken, wo die Tugend zuletzt doch zu ihren 40-50000 Frs. Rente kommt.) „Ideale keine. Nicht nur Überzeugungen, sondern Überlegung darf man gar nicht verlangen. Das Niveau der allgemeinen Bildung ist äusserst niedrig. (Ich spreche hier nicht von den beeideten Gelehrten. Aber auch diese sind nicht zahlreich, und übrigens ist dann Gelehrtheit auch Bildung in dem Sinne, wie wir gewohnt sind, dieses Wort zu verstehen?)“ — Weiter fährt er fort: „Noch eins, mein Täubchen Nikolaj; Sie glauben nicht, wie hier die Seele von Einsamkeit erfasst wird! Ein schweres, beängstigendes Gefühl.“ — „Freilich — fährt er fort — war mir im Auslande bis heute alles ungünstig; schlechtes Wetter und das, dass ich noch immer im Norden Europas herumkugelte und von den Wundern der Natur erst den Rhein gesehen habe. (Nikolaj Nikolajewitsch, das ist wirklich ein Wunder!) Was dann weiter sein wird, wenn ich von den Alpen in die Ebene Italiens niedersteige? — Ach! wären wir doch beisammen! Wir sehen Neapel, spazieren in Rom herum — liebkosen gar eine junge Venetianerin in der Gondel (He? Nikolaj Nikolajewitsch?). Aber .... „nichts, nichts und Schweigen“, wie im gleichen Fall Poprischtschin sagt.“
Was Strachow über jene Reise Dostojewskys sagt, welcher er sich von Genf aus angeschlossen, ist nicht sehr viel. Er erwähnt Dostojewskys Zusammenkunft mit Herzen in London, worüber der Dichter selbst im Feuilleton des Grashdanin vom Jahre 1873 erzählt, und er meint, dieser habe sich Herzen gegenüber sehr „weich“ verhalten, so dass die „winterlichen Betrachtungen“ ein wenig unter dem Zeichen dieses Einflusses ständen. Später aber, in den folgenden Jahren, habe Dostojewsky oft seinen Unwillen darüber geäussert, dass Herzen nicht imstande sei, den Geist des russischen Volkes zu begreifen und die Merkmale seines eigensten Wesens zu würdigen. „Der Aufklärungshochmut, die verachtende Geringschätzung Herzens empörten Dostojewsky, der sie sogar in Gribojedow, dem Verfasser des Stückes: „Wehe dem Gescheidten“, gerade so verurteilte, wie in unseren Revolutionären und kleinlichen Denunzianten.“ Was Strachow über ihr Zusammensein in Italien erzählt, bestätigt nur, was wir aus des Dichters späteren Dresdener Briefen erfahren, nämlich, dass er nicht nur die gewöhnliche, „offizielle Art, verschiedene merkwürdige Punkte mit einem Führer zu besichtigen, verachtete,“ sondern sich überhaupt weder um die Natur noch um die Kunstschätze eines Ortes kümmerte, sondern immer nur dahin ging, wo es am lebhaftesten war und möglichst viele Menschen aller Kategorien und Klassen zu finden waren. Sie waren einmal zusammen in die Uffizien gegangen; da sie aber nicht nach einem ausgearbeiteten Plan vorgingen, der sie schnell zu den Meisterwerken geführt hätte, so war Theodor Michailowitsch schon sehr bald so gelangweilt, dass sie wieder fort gingen, ohne bis zur medicäischen Venus gelangt zu sein. Dafür waren ihre Spaziergänge in volkreichen Teilen der Stadt und ihrer Umgebung, obwohl sie auch hier nicht bis zu den Cascinen kamen, sehr erfreulich, sowie ihre Nachtgespräche bei einem Glase roten Nostranos.
Der so folgenschwere Artikel nun, welchen Strachow anfangs des Jahres 1863 im „Wremja“ veröffentlichte, erschien unter dem Titel „Eine verhängnisvolle Frage“ und behandelte den polnischen Aufstand, ein Ereignis, über welches die Meinungen noch nicht geklärt, die Parteinahme jedoch schon aufgeregt und die Stimmung sehr gespannt war, ohne dass irgend ein Blatt noch das Wort darüber ergriffen hätte. Es waren allerdings schon vor dem Aufstande Stimmen darüber laut geworden, dass Russland Polen eingenommen habe, wie eine schädliche Medizin, und es wohl am ratsamsten wäre, diese wieder von sich zu geben. Allein seit Beginn des Aufstandes schwieg Alles. In diese Spannung hinein kam Strachows Artikel, der unglücklicherweise so abstrakt gehalten war, dass er von allen Parteien missverstanden wurde. Die Slavophilen verstanden ihn als einen Abfall von der russischen Sache des Volkes; die Regierung in ihrem Fühlorgan der Zensur sah eine Parteinahme für die Polen gegen die Obrigkeit darin, und das Schlimmste war, wie Strachow sagt, dass die Polen und ihre Parteigänger ihn von nun an zu den Ihren zählten, den Artikel abdruckten, sowie ihn auch die Revue des deux mondes brachte: das Missverständnis lag darin, dass Strachow die ältere Kultur der Polen hervorhob, die sie über das urwüchsige russische Volkstum hinwegsehen und hinwegstreben mache. Dass aber diese Kultur eine ewig edelmännische, volksfeindliche gewesen sei und es bleiben werde und müsse, hatte der Autor so theoretisch und objektiv hingestellt, dass nur die wenigsten es verstanden, den schweren Anwurf gegen die Polen zu finden, der darin lag, und die tiefe Kluft zu sehen, die für immer unüberbrückbar zwischen diesem Volke ritterlicher Vergangenheit und jenem gähnt, dessen ganze Entwickelung auf den Elementen des Volkslebens sich langsam aufbaut.
In seiner Erläuterung jenes Artikels sagt Strachow unter anderem: „Der polnische Aristokratismus ist an und für sich sowohl, als auch im Verhältnis zu den russischen Provinzen für jeden Russen etwas Widerwärtiges. Ja, er ist es, der mehr als alles andere Polen zu Grunde gerichtet hat. Indessen hatte sich dieser Aristokratismus entwickelt und erhält sich noch heute durch eine alte Aneignung europäischer Kultur. Daraus geht hervor, dass das Böse auch in einer so guten Sache enthalten sein kann, wie die Aufklärung eine ist, dass es manchmal besser ist, in der Kultur zurückzubleiben, aber seine seelische Gesundheit zu bewahren und nicht in jenen hoffnungslosen Zerfall von Bestrebungen und Gefühlen zu geraten, in welchem sich die Polen befinden. In diesem Sinne hatte ich meinen Artikel „Eine verhängnisvolle Frage“ betitelt. Ich war bereit gradaus zu sagen, dass für die Polen keine Rettung mehr möglich sei, dass die Geschichte sie zum Untergang verurteilt habe.
Das war, ich wiederhole es, allzu abstrakt, unklar ausgedrückt, es stimmte nicht zu den geläufigen Anschauungen und wurde verkehrt aufgefasst.“
Dostojewsky war gleich mit diesem Artikel nicht sehr zufrieden gewesen, was Strachow anfangs verletzte. Als aber in der Folge das Blatt von allen Seiten angefeindet und endlich auch durch die Zensur verboten wurde, da war es Dostojewsky, welcher in einer heftigen, sehr persönlichen Replik gegen die „Moskauer Wjedomosti“ dafür eintrat. Er sagte unter anderem: „Ja, was haben wir denn die ganzen drei Jahre her in unserer Zeitschrift gepredigt? Eben dies, dass unsere (heutige russische) von Europa entlehnte Zivilisation auf jenen Punkten, wo sie mit dem breiten russischen Geiste nicht zusammentrifft, dem russischen Volke nicht passt; dass dies heisst, einen Erwachsenen in ein Kindergewand zwängen, endlich, dass wir unsere Elemente, unsere Grundlagen, unsere nationalen Grundlagen haben, welche Selbständigkeit und Selbstentwickelung verlangen; dass die russische Erde ihr neues Wort sagen wird und dieses neue Wort vielleicht einmal das neue Wort der allgemein menschlichen Zivilisation sein und die Zivilisation der ganzen slavischen Welt in sich zum Ausdruck bringen wird. In den Elementen unserer nationalen Zivilisation haben wir immer die Merkmale der Scholle sehen können, während in jener Europas die Merkmale des Aristokratismus und Exklusivismus zu sehen sind. Ja, noch mehr, wir gestehen, dass wir, d. h. alle auf europäische Art zivilisierte Menschen, uns von unserem Boden losgerissen, alles russische Empfinden verloren haben, so sehr, dass wir an unsere eigene russische Kraft, an unsere Eigenart nicht glauben und uns wie Sklaven vor der Peterschen Holländerei in den Staub niederwerfen, über das Wort „nationale Grundlagen“ lachen und es als einen Rückschritt, einen Mystizismus betrachten.“ „So haben wir denn in unserem Artikel auf das hingewiesen — was Sie (der Gegner) auch im Traum nicht wagen würden — auf das, was auch der Kaiser Alexander der Erste ernst und aufrichtig achtete, welcher eben aus Achtung für die polnische Zivilisation den Polen höhere Einrichtungen gab, als den Russen, die er kulturell bedeutend tiefer stehend erachtete, als jene ...“
Dieser Ausfall Dostojewskys war seinen Anschauungen und Bestrebungen vollkommen entsprechend, jedoch, wie es scheint, war er blind für das, was das Blatt thatsächlich an politisch-nationaler Mission in diesen drei Jahren mochte ins Werk gesetzt haben. Strachow selbst sagt, der belletristische Teil sei bedeutend reicher und vorzüglicher gewesen, als der politische, der eigentlich noch nicht in dem Fahrwasser gewesen sein muss, wie wir es bei den später von Dostojewsky redigierten Zeitschriften sehen. Auch ist dies in dem heftigen Ausfall bestätigt, den der Vollblut-Russophile J. S. Aksakow auf Strachow machte und welchen dieser in kurzem Auszuge bringt: Aksakow schreibt 6. Juli 1863: „... Sie berufen sich vergebens auf die „Richtung“ der „Wremja“. Obgleich sie fortwährend darüber schrie, dass sie eine Richtung habe, hat das doch niemand beachtet. Ihre Zeitschrift hat die Bedeutung eines guten belletristischen Journals gehabt, das reiner und ehrenhafter war als andere, aber ihre Prätensionen waren allen lächerlich. Dort konnten gute Artikel untergebracht werden und sie waren es auch ..., allein dies alles hat der „Wremja“ keinerlei Farbe, keinerlei Kraft gegeben. Es gebrach ihr an höheren sittlichen Grundlagen, an einer Ehrenhaftigkeit höherer Ordnung. Sie hat die Unverschämtheit gehabt, in ihrem Programm auszusprechen, dass sie das erste Journal gewesen sei, das in der russischen Litteratur die Existenz eines russischen Volkstums entdeckt und proklamiert habe! Es giebt keinen so grossen Feind des Slavophilentums, den dies nicht empören würde. Und dann die naive Verkündigung, dass das Slavophilentum eine überlebte Sache sei und der Weg zum Leben, das neue Wort, jetzt bei der „Wremja“ zu finden sei! Die Slavophilen können alle, bis auf den letzten, sterben, dennoch wird die von ihnen eingeschlagene Richtung nicht zu Grunde gehen — und damit verstehe ich diese Richtung in all ihrer Strenge und Unerbittlichkeit, nicht für den Geschmack des cancanierenden Petersburger Publikums zugerichtet. — Dieses Buhlen um die Gunst des Publikums, dieser Wunsch, den Unseren und den Eueren zu dienen, dieses Von-oben-herab- und verächtliche Traktieren der Slavophilen im ersten Programm der „Wremja“, das ist’s, was dieses Journal in der öffentlichen Meinung zu Falle gebracht hat, während wir Slavophilen, wie Sie wissen, nirgends, nicht mit einem einzigen Worte an die „Wremja“ gerührt haben, weil unsere Überzeugungen eben keine Frage persönlicher Eigenliebe sind .... Übrigens kann in Petersburg gar keine Zeitschrift volkstümlicher Richtung herausgegeben werden, denn die erste Bedingung, um das gebundene Volksgefühl in uns freizumachen, die ist — Petersburg zu hassen mit unserer ganzen Seele und allen unseren Kräften. Ja, man kann sich überhaupt nicht zum christlichen Glauben bekennen (und das Slavophilentum ist nichts anderes als eine höhere Verkündigung des Christentums), ohne sich vom Satan loszumachen, loszusagen und loszuspucken[21].“
Strachow bringt diesen zornsprühenden Brief hauptsächlich darum, weil einige darin befindliche Worte der Anerkennung über die Zeitschrift sich doppelt vorteilhaft von dem Zorn-Hintergrunde des Schreibens abheben. Eine weitere Erläuterung knüpft er an den Vorwurf der Petersburgerei und verwahrt sich dagegen, da weder er noch die Brüder Dostojewsky, noch einer der anderen Mitarbeiter Petersburger seien, sondern echte Moskowiten, in denen ein langer Aufenthalt in Petersburg gerade ein starkes Heimweh nach dem Moskauer Boden, sowie Abneigung gegen das kosmopolitische Leben der Hauptstadt geweckt hatte.
Für uns ist an diesem Kampfe das Orientierende und Bezeichnende die Kluft, welche damals noch zwischen den Heisssporn-Slavophilen und Dostojewsky bestand und welche im Verlauf der Zeit durch des letzteren immer rückhaltslosere Hingabe an den nationalen Gedanken, allerdings bei Aufrechthaltung seiner Eigenart, immer kleiner wurde. Die Zeitschrift wurde also verboten, was den Herausgeber Michail Michailowitsch in grosse Geldverlegenheiten stürzte, da die Subskriptionsgelder schon eingelaufen und verbraucht waren, nun aber zurückgegeben werden mussten, und er ausserdem durch die Auflassung seiner bis jetzt innegehabten Cigarettenfabrik ganz allein auf den Erwerb durch die Feder angewiesen war und eine grössere Familie zu erhalten hatte.
Indessen war es für Theodor Michailowitsch, auf dessen Gesundheit der erste Aufenthalt im Auslande sehr günstig gewirkt hatte und der nun durch die Auflösung des Journals freier wurde, notwendig geworden, abermals Erholung zu suchen, und er machte sich ein zweites Mal auf den Weg nach Europa. Hier erzählt Strachow, Dostojewsky habe schon bei seinem ersten Ausfluge nach Paris Bekanntschaft mit dem Roulettespiel gemacht und sei so glücklich darin gewesen, dass er 11000 Frs. gewonnen habe, was ihm für die Reise sehr zu statten gekommen sei, in ihm aber die Erwartung zurückgelassen habe, er werde ein anderes Mal vom Glück ebenso begünstigt werden. Es war die Lockung des Spiels gerade für ihn eine doppelte. Fand der leidenschaftliche Geist des Dichters in den wechselnden Chancen des Spiels selbst ganz subjektiv die Nahrung, deren er bedurfte, die Erregung des Spieltriebes, ohne die er nicht leben konnte, so fand der feine und scharfe Beobachter in der ganzen Situation eine Fülle von Details, die er in seinem Gedächtnis aufspeicherte, im Verhalten der Mitspielenden alle jene Nüancen menschlicher Leidenschaften und Triebe ausgedrückt, die er aus seinem eigenen Wesen heraus so wohl verstand und zu deuten wusste.
Diesem Blick in die eigene Brust verdanken wir ja viele der tiefsinnigsten und genialsten Herausarbeitungen des Menschwesens in Dostojewskys Werken, und wenn irgend einer dazu berufen ist, uns die neue Ethik des Vollmenschen in seiner grössten Kompliziertheit und Verstricktheit von gut und böse zu verkünden und zu sagen: „Sieh’, dies ist der Mensch und so ist es gemeint, dass du ihn lieben sollst“, so ist es Dostojewsky, der bei aller Hassenskraft, die er gegen das Laster ausströmt, bei allem Zorn, mit dem er Irrtümer des Geistes und namentlich des Herzens verfolgt und vertilgen möchte, doch der Einzige ist, der eine Ahnung in uns davon erweckt, was man mit dem Leben und Lieben eigentlich alles anfangen kann.
Die unmittelbare Frucht von des Dichters zweiter Reise ist sein Roman: „Der Spieler“. Hören wir in einem Briefe an Strachow, vom 30. September 1863, was er selbst darüber sagt. Natürlich spielt sich hier, wie immer, die alte Geschichte ab — die Idee zum Roman ist da, Geld keines — also voraus verkaufen, die Beschwörungen, die zwingenden Wiederholungen, das Ausrechnen, bis zu welchem Tage das Geld eintreffen müsse, sonst sei er verloren, kurz das ganze heftige, aufreibende Überreden und Überzeugenwollen, wie wir es schon kennen! Er fährt also fort: „Jetzt habe ich nichts fertig. Allein es hat sich ein ziemlich (wie ich selbst urteile) günstiger Plan zu einer Erzählung in mir aufgebaut. Er ist zum grössten Teil auf Zettelchen geschrieben. Ich habe sogar schon anfangen wollen, ihn aufzuschreiben, allein — es geht hier nicht. Es ist sehr heiss und zudem bin ich an einen solchen Ort, wie Rom ist, auf eine Woche gekommen. Kann man aber in dieser einen Woche in Rom schreiben? Auch ermüde ich sehr beim Gehen. Das Sujet meiner Erzählung ist folgendes: — ein Typus des Russen im Auslande. Bemerken Sie: über die Russen im Auslande wurde diesen Sommer in den Journalen viel geschrieben. Das alles wird in meiner Erzählung einen Widerhall finden. Ja, im allgemeinen wird sich darin der heutige Zustand unseres internen Lebens wiederspiegeln (so weit als möglich natürlich). Ich nehme eine Natur, die Unmittelbarkeit besitzt, dabei hochentwickelt, in allem unfertig, dem Glauben entfremdet und doch nicht wagend, nicht zu glauben, sich gegen die Autoritäten auflehnend und sie doch fürchtend. Er beruhigt sich damit, dass er nichts in Russland zu thun habe — daher: strenge Kritik der Leute, welche aus Russland die im Ausland Weilenden herbeirufen. Aber das kann man ja nicht so erzählen. Es ist eine lebendige Person — (er steht förmlich leibhaft vor mir) — man wird es lesen müssen, wenn es geschrieben sein wird. Der Hauptwitz dabei ist der, dass alle seine Lebenssäfte, seine Kraft, Energie, Kühnheit — alles von der Roulette verbraucht wird. Er ist ein Spieler, und kein gewöhnlicher Spieler, so wenig wie der geizige Ritter Puschkins ein gewöhnlicher Geizhals ist (dies ist durchaus keine Vergleichung meiner selbst mit Puschkin, ich sage es nur der Klarheit wegen). Er ist in seiner Art ein Dichter, allein die Sache ist so, dass er sich selbst dieser Poesie schämt, da er in tiefster Seele ihre Niedrigkeit empfindet, wenn auch die Notwendigkeit des Risiko ihn in den eigenen Augen hebt. Die ganze Erzählung ist eine Erzählung davon, wie er schon das dritte Jahr in den Spielhäusern Roulette spielt.
Wenn das „Tote Haus“ die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich gelenkt hat, als eine Darstellung von Sträflingen, welche niemand vorher aus eigener Anschauung geschildert hatte, so wird diese Erzählung unbedingt durch die eigene Anschauung und detaillierte Schilderung des Roulettespiels die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ausserdem, dass solche Artikel bei uns mit ausserordentlichem Interesse gelesen werden, hat das Hazardspiel in den Badeörtern, besonders in Bezug auf die im Auslande befindlichen Russen, eine gewisse Bedeutung.
Endlich glaube ich annehmen zu können, dass ich alle diese höchst interessanten Vorwürfe mit feinem Gefühl, mit Vernunft und in einem Fluss darstellen werde.“
Den Schluss des Briefes bildet ein ganzer Feldzugsplan, wie man auf dieses noch nicht geschriebene Buch bei Boborykin, dem damaligen Redakteur der „Lesebibliothek“, voraus Geld nehmen könne. Michael Michailowitsch protestierte vergebens dagegen, dass sein Bruder eine Arbeit bei Fremden erscheinen lassen sollte. Er hätte es vorgezogen, dass Theodor Michailowitsch so lange warte, bis der Bruder sie in einem neu zu gründenden Blatte herausgeben könnte. Allein die Not drängte, so wurde man Handels einig, und Michael trat schweren Herzens zurück. Indessen ist dieser Roman niemals bei Boborykin erschienen, sondern erst viel später, im Jahre 1867 unter Umständen, welche eine grosse Wandlung in des Dichters Leben herbeizuführen bestimmt waren. Das vorher genommene Geld musste endlich nach Gründung der „Epocha“ auf Drängen Boborykins wieder herausgegeben werden.
Strachow bringt jenen Brief des Dichters in extenso, breitet sich auch sehr über die Nebenumstände und Details jener Geldkalamität aus, unterlässt es aber merkwürdigerweise, hier über die abermals unrichtige Wertschätzung des Dichters, zwei seiner Werke anlangend, ein Wort zu verlieren. Wer aber konnte darüber im Zweifel sein, dass hier wieder ein solcher Mangel objektiven Urteils von Seiten des Dichters mit unterlief, wie damals, als er den Roman „in neun Briefen“ den „Armen Leuten“ an die Seite stellte. Allerdings ist „Der Spieler“ künstlerisch als Ganzes genommen eine vollwertige Einheit, und Stellen wie jene, wo der Spieler das geliebte Mädchen am späten Abend in seinem Hotelzimmer zurücklässt und zum Roulettetisch eilt, um mit dem letzten 5 Frcs.-Stück das Geld zu gewinnen, das sie von dem zweideutigen Franzosen retten soll, der ihren Ruf in seiner Hand hat, solcher Stellen giebt es nicht allzuviele in der Weltlitteratur. Der Spieler hat nämlich mit dem letzten Goldstück unerhörtes Glück gehabt, er hat Tausende gewonnen, 20000, 30000, 50000; von einem Tisch zum andern ist er im Glückstaumel gewankt, ihm nach die Rotte, die sich an die Fersen der Glücksritter hängt. Ein Spielsaal nach dem anderen wird geschlossen, er bleibt bis zuletzt — endlich, es ist längst Mitternacht, kehrt er in das Hotel zurück. Er tritt in sein Zimmer, da sitzt Pauline auf dem Divan, vor ihr steht eine angezündete Kerze auf dem Tische. Sie sieht ihn verblüfft an — er hatte sie vergessen, ihre Situation, die Ursache seines Spiels und ihres Hierseins. Man kann wohl kaum einen Hintergrund ersinnen, von dem sich das Laster und die Seichtigkeit krasser abhebt, als diese von Liebe und Gefahr durchdämmerte, in Qualen hingebrachte Warte-Nacht des Mädchens, das ihm in sprachlosem Erstaunen zusieht, wie er den Inhalt seiner vollen Taschen triumphierend vor sie hin auf den Tisch schüttet. Bei aller Grossartigkeit dieser Episode jedoch, bei aller Feinheit mancher anderer in dem Buche, namentlich der herrlichen Zeichnung der alten Grossmutter, kann man nicht begreifen, wie Dostojewsky so nach — Publicisten-Art die Wirkung dieses Buches jener des Totenhauses an die Seite stellen kann. Es möchte uns fast scheinen, als wirkten da zwei Faktoren mit, um seine Objektivität, die ohnedies sehr gering war, zu paralysieren. Erstens die allen Dichtern anhaftende Seltsamkeit, über ihre eigenen Werke kaum je ein richtiges Urteil zu haben, und zweitens jenes innerliche Vergessen erlittener Unbill, das sich bis auf die Grösse und Wichtigkeit jenes tragischen Stoffes erstreckte. „Das Volk hätte uns gerichtet“, und „wir haben es verdient“, sagt er wiederholt; wie hätte er dies Buch anders taxieren sollen, als eine, auf „eigene Anschauung gestützte Darstellung persönlicher Erlebnisse“?
Dostojewsky musste natürlich der Spieler sehr am Herzen liegen, da er ja nicht nur den „Augenschein“ schilderte, sondern den Seelenzustand, den er selbst mehrmals in verhängnisvoller Weise durchgemacht hat. Unwillkürlich sehen wir da wieder den feurigen, leidenschaftlichen kleinen Theodor vor uns, wie er mit den Geschwistern Karten spielt und in seiner Ungeduld das „Glück korrigiert“; und doppelt verständlich wird uns die Mission des Dichters, der selbst so viel „vom Stoff der Schuld“ in sich getragen.
Von den persönlichen Erlebnissen des Dichters in der Zeit von 1862-64 haben wir ausser den oben von Strachow mitgeteilten Nachrichten wenig Kenntnis. Seine Korrespondenz mit Marja Dmitrjewna ist zur Stunde wohl im Besitze Anna Grigorjewnas, seiner zweiten Gattin; auch die Korrespondenz mit den Freunden, Wrangel, Maikow und anderen scheint entweder zu stocken, oder es ist nach allem, was wir vermuten dürfen, den noch Lebenden eine Pietätverletzung, etwas von ihren Schätzen einem weiten Kreise mitzuteilen. Wir können jedoch insofern getrost auf gewisse intimere Details verzichten, als wir uns gerade bei Dostojewsky nichts aus den Legenden holen könnten, die das Leben grosser Dichter umspinnt, und es uns gleichgiltig sein kann, mehr oder weniger von den kleinen Episoden seines Lebens in unsere Schilderung einzureihen; Episoden, die ihn nicht erhellen, sondern vielmehr von seinem ein für allemal feststehenden Wesen erst ihre Farbe und ihr Licht erhalten. Zudem gehörte sein Denken und Fühlen ganz der Allgemeinheit; da ist es also, bei den grossen Ereignissen der Heimat und den grossen Interessen der Menschheit, wo wir ihn aufsuchen müssen.
Des Dichters Rückkehr nach Russland scheint durch die Verschlimmerung im Gesundheitszustande Marja Dmitrjewnas ihren Grund gehabt zu haben. Wann sie stattfand, weiss auch N. Strachow nicht uns zu sagen. Marja Dmitrjewna war von den Ärzten nach Moskau geschickt worden und das wohl bald nach den grossen Petersburger Bränden, den polnischen Unruhen und ihres Gatten Abreise, also im Sommer oder Herbst 1863. Die schwere Erkrankung der Gattin veranlasst offenbar seine Zurückkunft. Wir finden ihn im November dieses Jahres in Moskau, wo er jedoch nicht bleibt, da ihn geschäftliche Unternehmungen nach Petersburg treiben. Vor allem handelt es sich um die Erlaubnis zur Gründung eines neuen Journals, dem die Brüder den Namen „Die Wahrheit“ geben wollen.
Um den Lesern darüber Klarheit zu geben, dass sich unter dem neuen Namen das Blatt und seine Richtung kundgebe, wollte Dostojewsky schon in der ersten Zeile darauf hinweisen, da es etwa heissen sollte: die Zeit (Wremja) verlangt nach Wahrheit usw., die Zensur jedoch, welche nach dem Irrtum ihres Verbots ins Schwanken geraten war, wusste nicht mehr recht, was zu gestatten, was zu verbieten sei, fand den Namen zu anzüglich, und so musste man sich für „Epocha“ entscheiden. In welcher Weise Theodor Michailowitsch über die Pflicht der Wahrheit auf breitester Basis dachte, bezeugt die Stelle in einem Briefe an den Bruder, wo es heisst: „Der zweite Aufsatz des Journals wird keinerlei Einfluss auf den Leitartikel haben. Die Besprechung des Tschernyschewskyschen Romans und jenes von Pissemsky würden grossen Effekt machen und, was die Hauptsache ist, unserem Programm gemäss sein. Zwei einander entgegengesetzte Ideen und beiden gerecht werden — also: Wahrheit“.
Man machte sich dann an die Arbeit. Der grosse Erfolg der durch ein Missverständnis eingegangenen „Wremja“ machte die Brüder über den zu erwartenden Erfolg der „Epocha“ allzu sanguinisch sicher. Unter den Mitarbeitern befanden sich noch immer Schtschedrin, Njekrassow und der glänzende Kritiker Apollon Grigorjew. Indessen hatte das Blatt sehr bald gegen intellektuelle und materielle Hindernisse anzukämpfen. Zu den tieferen Schäden gehörte die Abwendung der oben genannten berühmten Dichter, welchen die immer stärker zu Tage tretende slavophile Richtung der Brüder nicht zusagte, die schnell aufeinander folgenden Todesfälle, deren Opfer Marja Dmitrjewna, der Bruder Michael Michailowitsch und zuletzt Grigorjew (1864) waren; die Folge davon war in erster Linie der Irrtum im Publikum, dass der Dostojewsky gestorben sei, dessen Werke es bewunderte, woraus eine geringere Teilnahme und Subskription entstand, welcher Umstand wieder Unordnung in den Geldangelegenheiten der Redaktion nach sich zog. Die ersten Hefte waren, da der Dichter in Moskau am Krankenbette seiner Gattin weilte, in der Petersburger Typographie sehr schleuderhaft hergestellt worden, mit unzähligen Druckfehlern und falschen Interpunktionen behaftet, sodass das Entgegengesetzte von dem zu Tage kam, was der Autor hatte sagen wollen. Nichtsdestoweniger mühte sich Theodor Michailowitsch übermenschlich, schrieb in wenigen Nächten 2-3 Druckbogen und brachte das Januarheft auf nahezu 40 Druckbogen. Ein weiteres äusseres Hindernis zum Aufschwung des Blattes war die Gemächlichkeit, mit welcher sich die Zensur ihrer Arbeit entledigte. Strachow bringt dafür Daten, die unglaublich klingen, doch authentische Abschriften der auf den einzelnen Heften gedruckten Entscheidungen der Zensurbehörde sind. So wurde das Märzheft am 23. April, das Maiheft am 7. Juli, das Juniheft am 20. August, das Juliheft am 19. September, das Augustheft am 22. Oktober, das Septemberheft am 22. November, das Oktoberheft am 24. Oktober (!), das Novemberheft am 24. Dezember und das Dezemberheft 1864 am 25. Januar 1865 freigegeben.
Zu den grössten Missständen rechnet Strachow jedoch die sanguinische Selbsttäuschung der Brüder und ganz besonders ihre Unfähigkeit, eine Sache stetig und praktisch durchzuführen. Strachow breitet sich über die Wesenheit und Grundlage dieser unpraktischen Art aus, die er in einer allzu beweglichen Phantasie, in einem ewigen Steigen und Sinken von Stimmungen findet, und schliesst mit folgender konkreten Darstellung: „Was die Dostojewskys betrifft, so konnte man Michael Michailowitsch durchaus nicht als einen ganz unpraktischen Menschen ansehen; er war ziemlich umsichtig und scharfsichtig. Theodor Michailowitsch jedoch war, ungeachtet seines raschen Geistes, ungeachtet der erhabenen Ziele — ja, besser gesagt: gerade infolge dieser höheren Ziele — ausserordentlich unpraktisch. Wenn er eine Sache machte, so machte er sie sehr gut; allein er that dies mit Anläufen, mit sehr kurz anhaltenden Anläufen, war leicht befriedigt und hielt leicht inne, und das Chaos wuchs in jeder Minute um ihn herum. Die „Epocha“ wurde ohne einen Heller gegründet. Als sie einging (mit dem Februarheft 1865), hatte sie nicht nur die ganze Subskriptionssumme verschlungen, sondern auch jenen Teil der Erbschaft von einer reichen Moskauer Tante (etwa 10000 Rubel für jeden der Brüder), die sie sich voraus ausgebeten hatten, dabei 15000 Rubel Schulden, welche nach Eingehen der „Wremja“ Michael Michailowitsch zu Lasten geblieben waren. Bei alledem hatte die „Epocha“ für das Jahr 1865 noch immer 1300 Abonnenten aufgebracht. Als ein neues Blatt, ohne alte Lasten, hätte sie sich erhalten können. So aber zerflatterte alles und Theodor Michailowitsch blieb mit der Schuldenlast des Bruders, 15000 Rubel und dessen unversorgter Familie zurück.“
Ein langer Brief Dostojewskys an Baron Wrangel, welcher in dieser Zeit als Sekretär der russischen Gesandtschaft in Kopenhagen lebte, erzählt im Detail die Widerwärtigkeiten der letzten Jahre. Wir entnehmen diesem Briefe jene Stellen, die sich auf seinen persönlichen Anteil daran und seine privaten Verhältnisse beziehen. Es ist dies derselbe Brief vom 31. März 1865, dem wir weiter oben die Stelle über Marja Dmitrjewnas Tod entnommen haben. Nach der Erzählung des Todes seiner Gattin nimmt Dostojewsky jene seiner Kalamitäten folgendermassen auf:
„Mein Bruder hinterliess im ganzen 300 Rubel, damit wurde auch sein Leichenbegängnis bestritten. Ausserdem blieben gegen 25000 Rubel Schulden, wovon 10000 nicht beängstigend für die Familie waren, 15000 jedoch auf Wechseln standen, die gefordert wurden. Sie fragen hier, mit welchen Mitteln er hätte noch sechs Nummern des Journals herausgeben können (er starb im Juli 1865). Allein er hatte einen ungeheuren Kredit und konnte ausserdem Geld aufnehmen und dies war auch schon begonnen. Nun starb er und der ganze Kredit der Zeitschrift fiel zusammen. Keine Kopeke zur Herausgabe, dabei aber noch sechs Nummern auszugeben, was im Minimum 18000 Rubel kostete, und überdies die Gläubiger zu befriedigen, wozu 15000 Rubel nötig waren — also 33000 R. um den Jahrgang zu vollenden und eine neue Subskription zu erreichen. Seine Familie blieb buchstäblich aller Mittel bar — am Bettelstab. Ich blieb ihre einzige Hoffnung, und sie alle, die Witwe und die Kinder umstellten mich im Kreise und erwarteten von mir die Rettung. Es blieben zwei Wege übrig: 1. das Blatt nicht weiterführen, es, da ein Journal immerhin einen Besitz repräsentiert, den Gläubigern samt den Möbeln und dem ganzen Hausrat übergeben und die Kinder zu mir nehmen. Dann arbeiten, litteraturen, Romane schreiben und die Witwe und Waisen des Bruders erhalten. 2. Geld aufnehmen und die Herausgabe fortsetzen, koste es, was es wolle. Wie schade, dass ich mich für das Erstere nicht entschieden habe. Die Gläubiger würden natürlich kaum 20% erhalten haben, aber die Familie hätte die Erbschaft abgelehnt, wäre dadurch gesetzlich von jeder Zahlung befreit gewesen. Ich, meinerseits habe diese ganzen fünf Jahre an der Arbeit beim Bruder und für die Journale 8-10000 Rubel jährlich verdient. Folglich könnte ich sie und mich ernähren — natürlich wenn ich mein ganzes Leben vom Morgen bis auf die Nacht arbeite. Allein ich habe den zweiten Weg vorgezogen, d. h. das Blatt weiter herauszugeben. Übrigens war ich es nicht allein, der so wählte. Alle meine Freunde und früheren Mitarbeiter waren derselben Meinung.
Dazu kam, dass des Bruders Schulden bezahlt werden mussten, ich wollte nicht, dass eine schlechte Meinung das Andenken seines Namens beflecke. Dafür gab es ein Mittel: das neue Jahres-Abonnement erreichen, einen Teil der Schuld abtragen, trachten, dass das Blatt von Jahr zu Jahr besser werde und nach drei, vier Jahren, wenn die Schulden bezahlt wären, das Blatt irgend jemand abgeben und die Familie des Bruders sichern. Dann würde ich aufatmen, dann würde ich wieder anfangen, das zu schreiben, was ich schon lange auf dem Herzen habe.
Ich entschloss mich kurz. Ich fuhr nach Moskau, bat mir bei einer reichen alten Tante 10000 R. aus, die sie in ihrem Testament als meinen Anteil bestimmt hatte, und setzte, nach Petersburg zurückgekehrt, die Herausgabe des Blattes für diesen Jahrgang fort. Allein die Sache war schon sehr verdorben. Es musste die Erlaubnis der Zensur zur Herausgabe des Journals eingeholt werden. Man zog die Sache so hinaus, dass das Juniheft erst Ende August erscheinen konnte. Die Abonnenten, die gar nichts damit zu thun hatten, begannen aufzubegehren, die Zensur gestattete mir nicht, meinen Namen auf das Blatt zu setzen, weder als Herausgeber noch als Redakteur. Ich musste mich zu energischen Massregeln entschliessen: Ich begann in drei Druckereien auf einmal drucken zu lassen, sparte weder Geld noch Gesundheit und Kraft. — Ich allein war Redakteur, las die Korrekturen, schlug mich mit Autoren und mit der Zensur herum, besserte Artikel aus, bemühte mich um Geld, sass bis sechs Uhr morgens auf und schlief 5 Stunden von 24; und obwohl ich Ordnung in die Sache brachte — es war zu spät. — — Was mich das alles gekostet hat! Die Hauptsache aber ist, dass ich bei all dieser Zwangs- und Schmutzarbeit nicht imstande war, im Blatte auch nur eine Zeile Eigenes zu drucken. Meinem Namen begegnete das Publikum gar nicht und sogar in Petersburg, nicht nur in der Provinz, wusste es nicht, dass ich das Blatt redigiere. Und plötzlich brach bei uns eine allgemeine Journal-Krisis herein.
Oh, mein Freund, gern würde ich abermals ins Gefängnis auf ebenso viele Jahre wandern, könnte ich dadurch alle Schulden bezahlen und mich wieder frei fühlen. Jetzt werde ich abermals anfangen, einen Roman unter der Rute zu schreiben, das heisst, in aller Eile, aus Not. Er wird effektvoll werden, aber brauch’ ich nur das! Die Arbeit aus Not um des Geldes willen hat mich erstickt und zerstört. — — Ich habe Ihnen nun alles beschrieben und sehe, dass ich die Hauptsache, das Leben meines Geistes und Herzens, nicht ausgesprochen, ja keine Vorstellung davon gegeben habe. So wird es immer bleiben, so lange wir schriftlich verkehren. Ich kann nicht Briefe schreiben und kann über mich nicht in bestimmten Grenzen schreiben. Übrigens ist das auch schwer: viele Jahre liegen zwischen uns, und was für Jahre! — —
Im Auslande bin ich zweimal gewesen — im Sommer 1862 und 1863. Jedesmal bin ich auf drei Monate fortgegangen. Ich war in Deutschland (fast überall), in der Schweiz, in Frankreich, in Italien (auch überall). Meine Gesundheit hat sich beide Male im Auslande mit unglaublicher Geschwindigkeit gebessert. Ich habe beschlossen, alljährlich auf drei Monate zu verreisen, umsomehr, als das in materieller Beziehung bei der Teuerung unseres hiesigen Lebens nichts zu bedeuten hat. Ich wollte reisen, um mich zu erholen, um auszuruhen, zu mir zu kommen und um so tüchtiger die weiteren neun Monate des Jahres in Russland zu arbeiten. Allein im vorigen Jahre hat des Bruders Tod mich gezwungen, endgiltig hier zu bleiben. Und wie hätte ich das Bedürfnis, wenigstens auf einen Monat fortzufahren, mich ein bischen umzuthun, zu erfrischen, zu erneuern“ .... usw.
„Mit diesem Briefe“ — sagt Strachow — „kann man einen besonderen Abschnitt in Dostojewskys persönlichem Leben abschliessen, die Periode von seiner Zurückkunft aus der Verbannung bis zu dem Augenblick der Vereinsamung, da er ohne Gattin, ohne Bruder, ohne sein Blatt zurückblieb. Das Lebensgefühl, von dem er spricht, hat ihn nicht betrogen. Von hier an beginnt die bessere Hälfte seines Lebens: ihn erwarteten sehr grosse Mühen und Beschwerden, allein zugleich auch neue, höhere Schöpfungen seines Talents, ein neues, schönes Familienleben, unausgesetzte litterarische Erfolge, wachsende Berühmtheit und endlich, in den letzten Jahren, die Tilgung aller Schulden, genügendes Auskommen und Ordnung in seinen Geldangelegenheiten. In dieser schweren und angestrengten Zeit entstand im Jahre 1866 „Schuld und Sühne“ (Raskolnikow), 1868 „Der Idiot“, 1870 „Die Besessenen“. Strachow schreibt diese Fruchtbarkeit dem Umstande zu, dass die „Epocha“ eingegangen war und seine Kräfte nicht aufbrauchte. „Theodor Michailowitschs übriges Leben“, fährt Strachow fort, „kann man von hier an in zwei Perioden abteilen. Die erste, von 1865-1871, während welcher alle diese Romane geschaffen wurden, war sehr beschwerlich, fruchtbar und zum grössten Teil im Ausland zugebracht. Die zweite Periode, welche mit der Rückkehr nach Russland begann (1872-1881), repräsentiert die neuen publizistischen Versuche, in der Form einer Redaktion des „Grashdanin“ und des „Tagebuchs“ — allein das ist eine weniger beschwerliche, verhältnismässig ruhige, und nach aussen durch die Ordnung der Verhältnisse — und den öffentlichen Erfolg sich immer glücklicher gestaltende Periode.“
Der Sommer und Herbst 1865 fand Dostojewsky teilweise im Auslande. Seine wieder aufgenommene Korrespondenz mit Baron Wrangel ist aus Wiesbaden datiert, wo er bis Ende Oktober verweilte. Im November war er schon wieder in Petersburg und blieb darauf das ganze Jahr 1866, das, wie Strachow sagt, das folgenreichste Jahr seines Lebens war. Im Januar dieses Jahres begann im Russkij Wjestnik die Publikation seines bis dahin bedeutendsten Werkes: „Schuld und Sühne“ — und am 4. Oktober desselben Jahres lernt er Anna Grigorjewna Snitkina, seine künftige zweite Gattin, kennen.
„Schuld und Sühne“ — oder, wie es in manchen Übersetzungen heisst, „Raskolnikow“ — ist jenes von Dostojewskys Werken, welches in allen europäischen Ländern die grösste Verbreitung gefunden hat und hier die erste Grundlage seines Ruhmes geworden ist. Dass dieser Erfolg nur teilweise auf einer richtigen Schätzung seines Talentes beruht, wird jeder verstehen, welcher die Wege des schriftstellerischen Erfolges kennt. Vorerst war es das Packende, Sensationelle des Romans, das zündete, sodass sich das Interesse daran wie ein Lauffeuer über einen ungeheuren Kreis verbreitete. Als das Buch endlich in die Hände der ästhetischen Kritiker gelangte, da fanden erst seine künstlerischen Eigenschaften ihre Würdigung. Hatte also früher das gröbere litterarische Bedürfnis durch den Stoff Nahrung erhalten, so war es jetzt die Form, welche Bewunderung erregte, wodurch sie das Werk auf ein höheres Niveau erhob. Bald trat die Philosophie hinzu und legte ihren Massstab an das psychologische Detail, um aus den inneren Zusammenhängen der geschilderten verbrecherischen Handlung mit ihren Folgen das ethische Prinzip des Dichters herauszulösen. Auch diese kam auf ihre Rechnung, wenn auch nur bedingt; denn Dostojewskys ethische Gestaltungen verdanken nicht Prinzipien ihre Entstehung, sondern sind Probleme, wie das Leben selbst sie bietet. So ist der endgiltige Eindruck dieses Romans in Europa der eines sensationellen Verbrechens, das mit dem Aufwand einer grossen schöpferischen Kraft durch die Beobachtung der feinsten psychologischen Details zu einem Kunstwerk ersten Ranges ausgestaltet wurde. Nicht so in Russland. Hier war man einerseits mit Dostojewskys Schöpfungen sowohl als mit seinem Stil schon vertraut; das Sensationelle und Unmittelbare seiner Art zu erzählen, die wohl vorbereiteten Überraschungen, sowie der feste Griff ins Gewissen der Menschen hatten ihm hier schon sein Publikum erzogen; auch stand dieses Publikum mit ihm auf gleichem Boden; das gleiche Milieu, die gleichen Geistesformen, die gleichen äusseren Lebensgewohnheiten bereiteten sozusagen eine neutrale Atmosphäre für das neue Wort, das es mit jedem neuen Dichterwerke erwartet, von ihm ganz besonders erwartete. Andererseits legt das russische Publikum keinen so hohen Wert auf das Künstlerische in einem Buch, wie wir es thun: die Russen haben noch zu viel mit der Ausgestaltung ihres staatlichen und nationalen Lebens zu thun, um heute schon mit Vorliebe die fein verschlungenen Wege der Kunst zu wandeln; sie wollen Wahrheit, nichts als Wahrheit, etwas das ihnen ihr Leben erklärt und sie weiterführt. Sie wollen dies aber nicht nur als Menschen, sondern ganz besonders als russische Menschen. So ist denn der Eindruck dieses Werkes für die Russen aus diesen Forderungen heraus zu formulieren, und in der That: liest man die Fülle von russischen Kritiken, welche gerade dieses Werk hervorgerufen hat, sieht man die Fülle von Anregungen, welche es gerade dem russischen Menschen gebracht hat, so muss man gestehen, dass es bei seinen allgemein-menschlichen Vorzügen, bei seiner hohen künstlerischen Vollendung ein spezifisch russisches Buch ist, was wir da vor uns haben, so reich und tief in seinen Problemen, so verworren in seinen Axiomen, so ungelöst in seinen Fragen und so hoffnungsvoll-gläubig in die Zukunft, wie Russland selbst.
Dass Dostojewsky mit vollem Bewusstsein nur über Russen und für Russen schrieb, erhellt aus vielen Stellen seiner Briefe aus Sibirien und dem Auslande. Namentlich wiederholen sich jene Stellen immer wieder, wo es heisst: „Ich muss erst in Russland sein, ich brauche russischen Boden, russische Menschen.“ So bezieht sich jene Stelle in seinem Brief aus Semipalatinsk an den Bruder vom 31. Mai 1858, wo er sagt, dass er den Roman, den er schon fertig im Kopf habe, erst nach seiner Zurückkunft nach Russland schreiben werde, offenbar auf „Schuld und Sühne“, „— da dieser Charakter wahrscheinlich heute in Russland im wirklichen Leben sehr stark im Schwange ist, besonders jetzt, wenn man nach der Bewegung und den Ideen urteilt, von welchen alle erfüllt sind, so bin ich überzeugt, dass ich meinen Roman mit neuen Beobachtungen bereichern werde, wenn ich nach Russland zurückkomme.“ Da Dostojewsky ein Werk sehr lange in seinem Kopfe ausreifen liess, ehe er es niederschrieb, so ist wohl anzunehmen, dass der erste grössere Roman, den er in Russland schrieb, jener lange schon ersonnene gewesen ist, zu dem er „Russland brauchte“: „Schuld und Sühne“.
Die Fabel des Buches ist höchst einfach. Bin junger, aussergewöhnlich begabter Student lebt in grosser Armut in einer elenden Kammer als Aftermieter, arbeitet nicht, liest nicht, versteckt sich in seinem Winkel und träumt dahin. Seine hohe Begabung und seine Kenntnisse befähigen ihn zu dem höchsten Ideenfluge, seine bittere Armut stellt ihn unter die Niedrigsten, die ihr Leben mit ihrer Hände Arbeit verdienen und es ohne Demütigung geniessen. Zudem ist der Mensch nicht ohne edlere Empfindung, und es bedrückt ihn sehr, dass seine Mutter und Schwester, zwei arme, in der Provinz lebende Frauen, sich das Nötigste absparen, um dem Petersburger Studenten, der ihre stolze Hoffnung ist, hie und da ein paar Rubel zu schicken. Unthätigkeit und ein schwächliches Träumen steigern die Schlaffheit seines Charakters, Stolz, Hochmut und tausend Weltbeglückungs-Ideen peitschen seine blutarmen, gereizten Nerven zu einer Philosophie der Weltverbesserung und Weltstrafe an. Er will etwas Grosses thun, aus den Reihen der Alltagsmenschen hervortreten, wenigstens ein Stück Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen — ein altes Weib, das Geld gegen hohe Wucherzinsen verleiht, umbringen, damit sie niemandem mehr schade. Warum nicht? sagt er sich. Napoleon I., Mahomet, haben Tausende hingeschlachtet und sind bewundert worden, sind Grosse dieser Erde gewesen. Auch ich bin ein Napoleon, ein Mahomet, ich bin mehr als sie, ich folge einer Idee, ich bestrafe das Laster. Diese Idee gewinnt immer mehr Macht über den unbeschäftigten, widerstandslosen Jüngling mit der Lucifer-Seele; er vollbringt die That, welche gegen alle Erwartung gelingt, so dass kein Verdacht auf ihn fällt, empfindet aber zu seinem Erstaunen keinerlei Befriedigung darauf, vergräbt die aufgefundenen Wertgegenstände unter einen Stein im Hofraum eines entlegenen Hauses, verfällt aber bald danach in ein hitziges Fieber, aus dem er mit der Furcht erwacht, sich verplaudert zu haben. Hier setzen Vorsicht, Misstrauen gegen seine Umgebung und Furcht vor Entdeckung ein, die ihm endlich die Schlinge um den Hals legen und unentrinnbar seinem Schicksal, der Selbstanklage und Verurteilung nach Sibirien, zuführen. Im Epilog ist der Hinweis auf eine wahrhafte innere Sühne ausgesprochen. Sie wird, eine neue Illustration zu Goethes Schluss-Worten im Faust, durch die Liebe zu Sonja, der Gefallenen und doch unendlich Reinen, eingeleitet.
Wir haben also das Problem einer Selbstvergöttlichung vor uns, die sich das Recht zuspricht, über Menschenleben zu richten und Scharfrichter zu sein, die sofort nach der That zum eigenen Erstaunen keine Erhöhung des Gottheitsgefühls erfährt und eine Weile zwischen Leben und Selbstmord schwankt. Als er das Mädchen kennen lernt, das seine Jungfräulichkeit für den Trunkenbold von einem Vater, die schwindsüchtige Stiefmutter und die hungrigen kleinen Geschwister zum Opfer gebracht bat, das eine gewisse Gleichheit vor den Gerechten der Erde und ein Gefühl tiefen Mitleids für seinen geheimen Kummer ihm entgegenbringt, da ist er von einem rätselhaften Bedürfnis getrieben, sich ihr anzuvertrauen. Es ist nicht Reue, was ihn treibt, auch nicht Liebe zu dem Mädchen — er will nur reden, einen Teil seiner Qualen vor ihr abladen. Diese Scene gehört künstlerisch und menschlich zu dem Grossartigsten, was je in dieser Art geschrieben worden. Sie ist bekannt und wir können nicht bei den psychologischen Feinheiten verweilen, welche hier ein vollendetes Kunstwerk aufbauen. Dass es z. B. Raskolnikow selbst erst im Laufe der Erzählung immer klarer wird, was für Motive ihn getrieben haben, wie er, der noch mit niemand davon gesprochen, erst äusserliche Beweggründe zur That angiebt dann durch die Einfalt in Sonjas Fragen immer tiefer in sich hineingeführt wird, aus dem Unbewussten seines Wesens endlich den Kern desselben, den Luciferhochmut heraufholt, der sich das Recht zuspricht zu töten, da er stärker ist als die andern — wie das alles eingeleitet, gesteigert und durchgebildet ist, darüber hat die ästhetische Kritik Europas längst ihr Wort gesprochen. Für den russischen Menschen ist hier massgebend, was bei dieser allmählichen Selbstbeleuchtung herauskommt: der Mord aus Prinzip, die aufleuchtende Erkenntnis, dass der Mörder einen Augenblick über sein Recht im Zweifel, also kein Napoleon war, kein Recht besass; die Scham, auch „eine Laus zu sein wie alle andern“, und endlich die, Bezwingung dieses Hochmuts durch die fromme Liebe Sonjas, welche dem Sünder das Christentum aufschliesst. Wir müssen hier, obgleich wir das Werk als bekannt annehmen, dennoch die bezeichnenden Stellen bringen, um unsere Gedanken über die echt russische Auffassung des Dichters über menschliche Schuld und Sühne durch seine eigenen Worte zu bekräftigen.
„Nein! es ist wieder nicht so! .. ich erzähle abermals nicht recht! Siehst Du, ich habe mich damals immer gefragt: warum bin ich so dumm, wenn die andern dumm sind und ich sicher weiss, dass sie dumm sind — dass ich selbst nicht gescheiter sein will? Dann habe ich erkannt, Sonja, dass, wenn man warten wollte, bis alle gescheit werden, dies allzu lang dauern würde. — Dann habe ich weiter erkannt, dass das auch niemals geschehen wird, dass die Menschen sich nicht ändern werden und niemand da ist sie umzuarbeiten, und dass es nicht der Mühe wert wäre! Ja, so ist es! ... das ist ihr Gesetz ... ihr Gesetz, Sonja! So ist es! ... Und ich weiss jetzt, Sonja, dass der gescheit ist und stark im Geiste, der über sie mächtig ist! Wer viel wagt, der hat bei ihnen auch Rechte. Wer auf Grosses spucken kann, der ist ihr Gesetzgeber, und wer sich am meisten erdreistet, der hat am meisten Recht! So ist es bis heute gegangen und so wird es immer sein. Nur ein Blinder wird das nicht sehen!“
„Ich bin damals darauf gekommen“ — fuhr er in feierlichem Tone fort — „dass die Macht nur dem gegeben wird, der es wagt, sich zu bücken und sie an sich zu nehmen. Hier ist nur Eines, nur Eines: es heisst nur wagen!“
„Es ist damals ein Gedanke in mir aufgetaucht, zum ersten Mal in meinem Leben — ein Gedanke, den noch niemand jemals vor mir ersonnen hat! Niemand! Es wurde mir plötzlich so klar wie die Sonne und stellte sich vor mich die Frage: wieso denn bis heute niemand gewagt habe, nicht wage, wenn er an all dieser Abgeschmacktheit vorübergeht, alles kurzweg beim Schwanz zu fassen und es zum Teufel zu schleudern! Ich ... ich habe mich dreist machen wollen und habe gemordet ... nur erdreisten wollte ich mich, Sonja — da hast Du die ganze Ursache!“
„O, schweigen Sie, schweigen Sie!“ rief Sonja, die Hände zusammenschlagend. — „Von Gott haben Sie sich entfernt, und Gott hat Sie getroffen, hat Sie dem Teufel übergeben!“
„Sage, Sonja, als ich im Finstern lag und alles vor mir so dastand, war es der Teufel, der mich zwang? Wie?“
„Schweigen Sie! wagen Sie es nicht, Gotteslästerer — nichts, nichts begreifen Sie! O, Herr! nichts, nichts wird er begreifen!“
„Schweige Du, Sonja, ich scherze durchaus nicht, ich weiss ja selbst, dass mich der Teufel gefasst hat. Schweige, Sonja, schweige!“ wiederholte er finster und nachdrücklich — „ich weiss alles. Alles das habe ich schon durchgedacht und mir vorgeflüstert, als ich dort im Dunklen lag .... Alles das habe ich schon mit mir selbst durchgestritten, bis zum letzten, kleinsten Zug, und weiss nun alles, alles! Und so überdrüssig ist mir damals dieses ganze Geschwätz geworden, so überdrüssig! Ich wollte alles vergessen und frisch anfangen, Sonja, und aufhören zu schwatzen! Und glaubst Du denn, dass ich hinging wie ein Dummkopf, aufs Geradewohl? Nein, ich ging hin, wie ein Kluger, und das ist’s, was mich zu Grunde gerichtet hat. Und meinst Du denn, ich hätte nicht z. B. wenigstens das gewusst, dass, wenn ich schon anfing mich selbst zu fragen: habe ich das Recht zur Macht? — ich schon kein Recht zur Macht mehr habe? Oder wenn ich die Frage stelle: ist der Mensch eine Laus? er für mich keine Laus mehr ist, sondern für den, dem das auch gar nicht in den Kopf kommt und der geradeaus hingeht .... Wenn ich mich schon so viele Tage mit der Frage herumquälte, ob Napoleon hingehen würde oder nicht, so fühlte ich ja schon deutlich, dass ich kein Napoleon war .... Die ganze, ganze Qual dieses Argumentierens habe ich ausgehalten, Sonja, habe alles das loswerden wollen, ich habe gewünscht, ohne Kasuistik umzubringen, für mich zu töten, für mich allein! Ich habe darin auch mich selbst nicht belügen wollen! Nicht um der Mutter zu helfen habe ich getötet — Unsinn! Nicht darum habe ich getötet, um, nachdem ich Geld und Macht erlangt hätte, ein Wohlthäter der Menschheit zu werden, Unsinn! Ich habe einfach getötet, für mich getötet, für mich allein, ob ich aber irgend jemandes Wohlthäter geworden wäre, oder mein Leben lang wie eine Spinne Alle in mein Netz gelockt und ihnen alle Lebenssäfte ausgesogen hätte, das hätte mir in jenem Augenblick ganz gleich sein müssen! Und nicht Geld war es, das ich hauptsächlich brauchte, Sonja, als ich mordete, nicht Geld hatte ich so sehr nötig als etwas anderes .... Jetzt weiss ich das alles .... Verstehe mich recht: Es kann sein, dass ich, diesen Weg verfolgend, niemals mehr einen Mord wiederholt hätte. Mich verlangte es, ein anderes zu erfahren, ein anderes stiess meine Hand dahin; ich musste wissen, so schnell als möglich wissen, ob ich auch eine Laus bin, wie alle anderen, oder ein Mensch? Werde ich es vermögen ein Verbrechen zu begehen, oder werde ich’s nicht vermögen? Werde ich es wagen mich um die Macht zu bücken oder nicht? Bin ich eine zitternde Kreatur, oder habe ich das Recht ...“
„Zu töten, das Recht zu töten habt Ihr?“ rief Sonja händeringend.
„Eh, Sonja!“ rief er gereizt aus, wollte schon etwas erwidern, hielt sich aber verächtlich zurück. — „Unterbrich mich nicht, Sonja! Ich wollte Dir nur Eines beweisen: dass mich damals der Teufel erfasst hatte, mir aber danach schon gezeigt hat, dass ich kein Recht hatte dahinzugehen, da ich eine ebensolche Laus bin, wie alle. Er hat mich ordentlich ausgelacht, und nun siehst Du, bin ich zu Dir gekommen! Nimm den Gast auf! Wenn ich keine Laus wäre, käme ich da zu Dir? Höre: als ich damals zur Alten ging, da ging ich nur hin, um zu probieren ... das wisse!“
„Und gemordet haben Sie, gemordet!“
„Ja, wie habe ich denn gemordet? Mordet man denn so, geht man denn so hin, um jemanden zu ermorden, wie ich hinging? Habe ich denn die Alte umgebracht? Mich habe ich umgebracht und nicht die Alte! Mich hab ich zugleich mit ihr umgebracht, in alle Ewigkeit! Diese Alte hat der Teufel umgebracht, nicht ich ... Genug, genug, Sonja, genug. Lass mich“ — schrie er plötzlich mit krampfhafter Angst — „lass mich!“
Als er sie fragt: „Wirst Du zu mir ins Gefängnis kommen, wenn ich dort sitzen werde?“ — und sie ihm antwortet: — „O ich komme, ich komme!“ da geht ihm ihre Liebe auf; er sieht sie an und, sonderbar, ihm war’s plötzlich schwer und leid, dass man ihn so liebe. Ja, das war eine seltsame und schreckliche Empfindung! Als er zu Sonja gegangen war, hatte er gefühlt, dass in ihr all seine Hoffnung und seine endgiltige Ruhe enthalten sei; er gedachte wenigstens einen Teil seiner Qualen hier niederzulegen, und nun, plötzlich, da ihr ganzes Herz sich ihm zugewendet hatte, da fühlte und erkannte er es plötzlich, dass er unendlich viel unglücklicher geworden war, als er früher gewesen.“
Der Epilog findet den auf neun Jahre zur Zwangsarbeit Verurteilten am Irtisch unter Missethätern. Wir sehen abermals dasselbe Bild wie im „Totenhause“. Auch auf Raskolnikow macht die Umgebung der Verbrecher denselben Eindruck, auch er fühlt, dass er nicht zu ihnen gehöre, fühlt es mit der künstlerisch hingesetzten Nuance, dass er „keinen Glauben“ hat. Anfangs fühlt er sich aber nur dadurch bedrückt, dass sie ihn ob seines freien Schuldgeständnisses nicht zu den Ihren zählen, weil sie ihre Verbrechen ausgehalten hatten, er aber das seine nicht ertrug. Auch fragte er sich, warum er sich damals nicht umgebracht habe.
„Er stellte sich unter Qualen diese Frage und konnte nicht begreifen, dass er vielleicht schon damals, als er am Flussufer stand, in sich und seinen Überzeugungen eine tiefe Lüge ahnte. Er begriff nicht, dass diese Ahnung der Vorbote eines künftigen Umschlags in seinem Leben, der Vorbote einer einstigen Wiedergeburt, eines neuen Blicks auf das Leben sein konnte. Später erst erkannte er den Grund der Abneigung der Verbrecher gegen ihn, „Du bist ein Gottloser,“ sagen sie — „Du glaubst nicht an Gott, Dich soll man erschlagen.“ Sonja jedoch, welche ihm in die Verbannung gefolgt war und im Städtchen, wo die Festung lag, sich ihr kärgliches Leben eingerichtet hatte, nur um ihn, wenn er mit den anderen Sträflingen zur Arbeit ging, fünf Minuten sehen und sprechen zu können, Sonja wurde von allen geliebt. „Mütterchen, Sofia Semjonowna,“ sagten sie, „Du unsere Mutter, Du blasse, kranke usw.“ „Warum?“ fragt er sich, „warum lieben sie sie?“ Endlich erkrankt er und wird in das Sträflings-Spital gebracht. Dort besucht ihn Sonja nur zweimal, und als er einmal, Reconvalescent, am Fenster steht, sieht er ihre schmächtige Gestalt von weitem sich durch den Hofraum entfernen. Sie hatte, wie so oft, nur zu seinen Fenstern hinaufgeblickt. Nun erkrankt Sonja, er sieht sie längere Zeit nicht, und jetzt erst geht ihm an seinem Sehnen und Bedürfen nach ihrer weichen und starken Seele die Liebe und mit ihr die Erlösung auf. An einem schönen frühen Morgen, da er beim Alabaster-Ofen an der Arbeit ist, entfernt er sich für einen Augenblick aus dem Heizraum und setzt sich am Flussufer auf einem Balken nieder, da erscheint plötzlich Sonja und setzt sich still neben ihn. Anfangs bleiben sie schweigend neben einander, er senkt den Kopf und blickt starr auf die Erde, da:
„Wie dies geschah, wusste er selbst nicht, aber plötzlich packte ihn etwas und warf ihn zu ihren Füssen. Er weinte und umklammerte ihre Kniee. Im ersten Augenblick erschrak sie furchtbar, und ihr Gesicht wurde totenbleich. Sie sprang auf und sah ihn zitternd an. Allein sofort, im selben Augenblick hatte sie alles begriffen. In ihren Augen leuchtete ein unendliches Glück auf; sie verstand, und es gab für sie keinen Zweifel mehr, dass er sie liebe, sie grenzenlos liebe und dass sie endlich gekommen war, diese Minute.“ ...
„Sie versuchten zu sprechen, allein sie konnten es nicht. Thränen standen in ihren Augen. Sie waren beide blass und armselig, allein in diesen kranken und blassen Gesichtern leuchtete schon die Morgenröte einer neuen Zukunft, der Wiedergeburt zu einem neuen Leben. — —
Zu Anfang seiner Strafzeit hatte er gefürchtet, dass sie ihn mit Religion quälen, ihm vom Evangelium reden und ihm Bücher aufnötigen werde. Aber zu seiner grossen Verwunderung sprach sie nicht ein einziges Mal davon, legte ihm nicht einmal das Evangelium vor. Er selbst hatte es sich kurz vor seiner Erkrankung erbeten, und sie hatte schweigend das Buch gebracht. Bis heute hatte er es nicht aufgeschlagen.
Er schlug es auch jetzt nicht auf, aber ein Gedanke durchzuckte ihn: „Kann es denn sein, dass ihre Überzeugungen von jetzt an nicht auch die meinigen sind? Ihre Gefühle, ihre Bestrebungen wenigstens.“
„Auch sie verbrachte diesen ganzen Tag in heftiger Erregung, in der Nacht aber erkrankte sie abermals. Allein sie war so überaus glücklich und so unerwartet glücklich, dass sie fast vor ihrem Glücke erschrak. Sieben Jahre, nur mehr sieben Jahre! Zu Anfang ihres Glückes in manchen Augenblicken waren beide imstande, auf diese sieben Jahre wie auf sieben Tage zu schauen. Er wusste es ja noch nicht, dass das neue Leben ihm nicht umsonst zufallen werde, dass er es noch werde teuer erkaufen, es mit einer grossen künftigen That bezahlen müssen.“
Hier schliesst der Roman. Wir haben es versucht, seine spezifisch russische Seite, die russischen Absichten des Dichters und das hervorzukehren, was die grösste Wirkung auf seine russischen Leser machen musste. Schon im „Totenhause“ hatte er es ausgesprochen, dass „in jedem russischen Menschen unserer Tage der Keim zu einem Scharfrichter enthalten sei.“ Das war wohl die Idee, zu deren künstlerischer Gestaltung er russischen Boden, russische Menschen brauchte. Wenn man hier einwenden wollte, dass für eine Nation schreiben, seine Probleme den Formen eines Volkes anpassen eine Beschränkung dichterischer Kraft sei, so muss darauf hingewiesen werden, dass Dostojewsky gerade der Russe immer als Allmensch vorschwebte und er ihn nicht ausser die anderen Nationen stellte, sondern als sie alle in sich zusammenfassend und im Christentum einigend dachte.
Dass wir es uns versagen mussten, auf vollendet ausgeführte Gestalten wie Porfiry Petrowitsch und Swidrigailow einzugehen, ist nach dem Gesagten selbstverständlich. Einheitlicher mit unserem Zweck, das Werk von der russischen „breiten“ Ethik aus zu beleuchten, ist es, einige Worte über eine weichere, weniger scharf gezeichnete Figur zu sagen. Dies ist Rasumichin, der harmlose „ehemalige Student“ und Freund Raskolnikows. Ihm legt der Dichter ohne viele künstlerische Umschweife zwei bedeutsame Aussprüche in den Mund. Einmal sagt Rasumichin in etwas angeheitertem Zustande: „Ich liebe es, wenn man lügt; das Lügen ist das einzige Privilegium, das der Mensch vor allen Organismen voraus hat. Lügst du — so wirst du schon zur Wahrheit kommen! Darum bin ich eben ein Mensch, weil ich lüge. Nicht zu einer Wahrheit ist man gekommen, wenn man nicht früher 14mal, ja vielleicht 114mal gelogen hat. Und das ist in seiner Weise ehrenhaft. Wir aber können nicht einmal ordentlich nach unserem Verstande lügen! Du lüge mich an, aber lüge nach deinem eigenen Wesen, und ich werde dich küssen. In seiner Weise lügen, das ist ja besser, als eine fremde Wahrheit nachreden; im ersten Falle bist du ein Mensch, im zweiten aber bist du nur ein Vogel! Die Wahrheit wird nicht verschwinden, das Leben aber kann man zerstören — es hat Beispiele gegeben.
Und was sind wir jetzt? Alle sitzen wir, alle (ohne Ausnahme), in unserem Wissen, unserer Entwickelung, unserem Denken, unseren Entdeckungen, Idealen, Wünschen, unserem Liberalismus, unserer Vernunft, Erfahrung, in allem, allem, allem noch in der ersten Vorbereitungsklasse des Gymnasiums. Es hat uns gefallen, uns mit fremden Gedanken die Zeit zu vertreiben — hineingefressen haben wir uns!“ —
„... Wir werden uns schon zur Wahrheit durchlügen.“ — Die zweite Stelle, an welcher der Leser nicht achtlos vorübergehen kann, ist die, wo Rasumichin mit grosser Wärme für die Unschuld des Zimmermalers eintritt, den man des Mordes beschuldigt, weil er ein Etui mit Ohrgehängen aus dem Raube der Alten für einen Rubel versetzt hatte. Dieser Bursche war auf derselben Stiege in einer leeren Wohnung mit dem Streichen der Wände beschäftigt gewesen, als der Mord im oberen Stockwerk geschah. Er war mit einem anderen jungen Burschen nach gethaner Arbeit schäkernd und Ulk treibend die Treppe hinabgelaufen, sie hatten sich im Hausflur, wie 8 Personen sehen konnten, gebalgt und er war noch einmal in den Arbeitsraum hinaufgelaufen und hatte sich hinter die Thüre gestellt. Dort hatte er das Etui gefunden. Nun wird er gesucht, um in Untersuchung gezogen zu werden, die Anzeichen sind gegen ihn, da er den Fund verheimlicht hat, und als er hört, dass er zur Verantwortung gezogen werde, sich zu erhängen versucht. Als man ihn fragt, warum er sich habe töten wollen, antwortet er: „weil man mich verurteilen wird“. Es ist etwas Ergreifendes in dieser russischen Schuldfurcht eines Unschuldigen, den später eine Art mystischer Täuschung dazu treibt, sich für den Thäter zu erklären, zum Glück in einem Augenblick, da Raskolnikows Thäterschaft schon so gut wie erwiesen ist. Rasumichin aber greift mit aller Hitze seines gütigen Wesens die Frage auf, um „unsere Jurisprudenz“ anzuklagen, welche „niemals, niemals die subjektive Thatsache der Stimmung, der psychologischen Unmöglichkeit, einen Mord zu begehen und im nächsten Augenblick sich mit einem Kameraden zu balgen,“ in Betracht ziehen wird, „weil man die Ohrgehänge bei ihm gefunden und er sich hatte erhängen wollen“, „was nicht möglich wäre, wenn er sich nicht schuldig gefühlt hätte.“ Dies ist, scheint uns, eine Stelle, wo das echt russische Verhältnis zur Schuld vom Dichter mit einer Selbstverständlichkeit benützt wird, wie sie an das Unbewusste grenzt, uns aber höchst bedeutsam und symptomatisch erscheinen muss. Es wäre wohl keinem europäischen Dichter in den Sinn gekommen, eine solche unbegründete Selbstanklage als glaubwürdiges retardierendes Motiv in einem Romane anzubringen.
Die Korrespondenz mit Wrangel scheint eine kurze Begegnung der Freunde in Kopenhagen eingeleitet zu haben und wieder durch diese aufgefrischt worden zu sein, und so finden wir den häufigsten Austausch von persönlichen und geschäftlichen Berichten aus jener Zeit zwischen dem Dichter und diesem Freunde im Gang. In einem dieser Briefe aus Wiesbaden heisst es unter anderem: „— diesmal will ich Ihnen über mich schreiben, eigentlich aber nur über eine Sache. Teilen Sie, was ich Ihnen sagen werde, niemand mit, denn ich fühle, dass es mich teilweise anschwärzt. Da aber in einem solchen Falle Phrasen vollkommen unfruchtbar und auch schwer sind, so will ich Ihnen offen bekennen, dass ich — in meiner Dummheit vor vierzehn Tagen alles im Spiel verloren habe, was ich hatte. Ich habe auch früher gespielt, gleich vom Anfang meines Wiesbadener Aufenthalts an, aber ich hatte Glück, sogar bedeutendes Glück (verhältnismässig gesprochen), habe mich aber dann in meiner Dummheit vergaloppiert, alles in drei Tagen verspielt und sitze nun in der abscheulichsten Situation, die man sich vorstellen kann, und kann aus Wiesbaden nicht heraus.“
Nun verlangt er für eine kurze Zeit 100 Thaler, um nur vom Hôtel loszukommen, nach Paris zu gehen, wo er jemand sicher zu finden hofft, der ihm helfen wird. In einem zweiten, ca. 14 Tage später datierten Briefe beklagt er sich darüber, keine Antwort erhalten zu haben. Er bittet, Wrangel möge ihm das Geld unverzüglich schicken, „obwohl es ihm nun nicht mehr radikal helfen könne“, und fügt hinzu, dass die Erzählung, die er eben schreibe, mindestens 1000 Rubel wert sei, dass er das Geld in einem Monat werde aus dieser Summe sicher abzahlen können, die er von Katkow, dem Redakteur des Russky Wjestnik, als Abschlagszahlung für seine Erzählung (Raskolnikow) erhalten werde. Ein dritter Brief vom 8. Nov. 1865, aus Petersburg datiert, bezieht sich auf eine inzwischen stattgehabte Begegnung in Kopenhagen. Er erzählt darin von seiner Rückkehr, von den drei Anfällen, die er sofort und im Verlauf einer Woche erlitten hatte, von den 300 R., welche Katkow nach Wiesbaden gesandt, die er nun daheim erst erhalten habe, von der vollkommenen Deroute in der Familie des Bruders, die ihn erwartet habe, und der er alles gleich gab, was er besass, und ausserdem 100 R., die er dazu aufnahm. Er bittet den Freund um Geduld, da er alle Schulden erst nach der Bezahlung des Romans abtragen könne, der wohl 2500 R. einbringen werde. Noch einmal aber von Katkow vorausnehmen will er nicht. Er findet es nicht politisch, unmöglich, hässlich; es seien durchaus die Beziehungen nicht solche, um das zu thun. Zum Schluss erwähnt er seines Stiefsohnes Pascha, Marja Dmitrjewnas Sohnes, für welchen er ebenfalls sorgt, der ihm aber niemals Freude gemacht hat, sowie eines kranken Bruders, der nicht mehr lange zu leben habe.
Nach einem sorgenvollen Winter schreibt er aus Petersburg am 18. Febr. 1866: „Bester alter Freund Alexander Jegorowitsch, ich bin durch mein langes Schweigen vor Ihnen schuldig geworden, aber schuldig ohne Schuld. Es würde mir jetzt schwer, Ihnen mein ganzes jetziges Leben, die Ursache meines langen Schweigens klar zu machen. Die Ursachen sind vielfach und kompliziert, und ich kann sie darum nicht beschreiben, will nur einiges andeuten. Erstens sitze ich über der Arbeit, wie ein Sträfling. Es ist das der Roman für den Russky Wjestnik; ein grosser Roman in sechs Teilen. Ende November war vieles aufgeschrieben und fertig; ich habe alles verbrannt, dass kann ich jetzt bekennen. Es hat mir selbst nicht gefallen. Eine neue Form, ein neuer Plan hat mich fortgerissen, und ich habe frisch angefangen. Ich arbeite Tag und Nacht und dennoch arbeite ich wenig. Nach meiner Berechnung kommt heraus, dass ich jeden Monat 6 Druckbogen an den Russkij Wjestnik abgeben muss. Das ist furchtbar, allein ich würde es leisten, wenn ich genug Seelenruhe hätte. Ein Roman ist ein poetisches Werk und bedarf zu seiner Vollendung der Ruhe für Seele und Phantasie. Mich aber quälen die Gläubiger, d. h. sie drohen, mich einsperren zu lassen. Ich habe bis heute noch nicht mit ihnen fertig werden können und weiss wirklich noch nicht, ob ich’s überhaupt werde, obgleich viele von ihnen ganz vernünftig sind und meinen Vorschlag annehmen, die Abzahlung auf 5 Jahre zu verteilen. Mit anderen aber konnte ich bis jetzt nicht in Ordnung kommen.
Sie können denken, wie beunruhigt ich bin; das zerreisst mir Kopf und Herz, verstimmt auf mehrere Tage. Da setze dich dann hin und schreibe! Manchmal ist das ganz unmöglich. Darum ist’s auch schwer, eine ruhige Minute zu finden, um mit einem alten Freunde ein wenig zu plaudern, weiss Gott! Dazu die Krankheiten! Anfangs, nach meiner Rückkunft, hat mich die Hinfallende schrecklich geplagt; es war, als hätte sie die drei Monate nachholen wollen, die sie mich nicht heimgesucht hatte. Jetzt aber plagen mich schon seit einem Monat Hämorrhoiden. Sie haben von dieser Krankheit und davon, wie ihre Anfälle sein können, wahrscheinlich keine Vorstellung. Nun sind es schon drei Jahre nacheinander, dass sie sichs eingerichtet hat, mich durch zwei Monate im Jahre, im Februar und März, zu quälen. Und, denken Sie, vierzehn Tage(!) war ich gezwungen auf meinem Divan zu liegen, vierzehn Tage habe ich keine Feder in die Hand nehmen können. Jetzt, während der letzten vierzehn Tage, muss ich fünf Druckbogen schreiben! Und liegen müssen, wenn man organisch ganz gesund ist, nur darum, weil man weder stehen noch sitzen kann, ohne dass sofort Krämpfe kommen, sobald man sich vom Divan erhebt! —
Nun beantworte ich Ihre Worte: Sie schreiben, es wäre besser, wenn ich in Staatsdienst träte; kaum. Mir ist dort besser, wo ich mehr Geld bekommen kann. In der Litteratur habe ich schon einen solchen Namen, dass ich (wären nicht die Schulden) immer ein sicheres Stück Brot, ja sogar ein süsses, reichliches haben könnte, wie es ja auch in continuo bis zum letzten Jahr der Fall war. Bei dieser Gelegenheit will ich Ihnen von meinen gegenwärtigen litterarischen Geschäften erzählen, und Sie werden daraus ersehen, wie sich alles verhält. Vom Auslande aus, da ich durch die Umstände bedrängt war, stellte ich Katkow den für mich niedrigsten Preis, d. h. 125 Rubel für den Druckbogen ihres Blattes, 150 vom Format des „Sowremjennik“. Sie waren einverstanden. Später erfuhr ich, dass sie mit Freuden einstimmten, weil sie für dieses Jahr nichts Belletristisches hatten. Turgenjew schreibt nichts, und mit Leo Tolstoi haben sie sich zerstritten. Ich bin als Lückenbüsser erschienen (das alles weiss ich aus sicherer Quelle), sie haben mit mir aber schrecklich laviert und politisiert. Die Sache ist die, dass sie schreckliche Knicker sind. Der Roman kam ihnen gross vor, und es schreckte sie für 25, ja möglicherweise 30 Druckbogen zu 125 Rubel zu zahlen. Mit einem Wort: ihre ganze Politik lag darin (sie hatten schon zu mir geschickt), den Preis per Bogen herabzusetzen; die meine lag darin, ihn zu steigern. Und jetzt ist ein stummer Kampf zwischen uns, sie wollen offenbar, dass ich nach Moskau komme. Ich aber halte aus. Folgendes ist dabei mein Zweck: Hilft Gott, so wird dieser Roman ein grossartiges Ding. Ich möchte, dass nicht weniger als drei Teile davon (d. h. die Hälfte des Ganzen) gedruckt werden. Der Effekt wird damit erreicht sein, dann erst fahre ich nach Moskau und sehe zu, wie sie mir was abreissen wollen? Im Gegenteil, es kann sein, dass sie hinzufügen. — Das wird zu Ostern sein. Ausserdem trachte ich, dort gar kein Geld vorauszunehmen, drücke mich zusammen und lebe wie ein Bettler, werde nur das Nötigste verbrauchen; wenn ich aber vorausnehme, so bin ich moralisch nicht mehr frei, wenn ich später endgiltig über das Honorar mit ihnen verhandle. Vor zwei Wochen ist der erste Teil meines Romans im ersten Januarheft des Russkij Wjestnik erschienen. Er heisst: „Schuld und Sühne“. Ich habe schon viele entzückte Äusserungen darüber gehört. Es sind kühne und neue Sachen darin.“
Im weiteren Verlauf des Briefes thut Dostojewsky einiger Privatangelegenheiten Wrangels Erwähnung und schliesst: „Übrigens bin ich sehr froh darüber, dass Sie unser intimes russisches, geistiges und bürgerliches Leben so sehr interessiert. Mir ist das als Ihrem Freunde sehr angenehm, obwohl ich Ihnen nicht in allem beipflichte. Sie sehen vieles ein wenig exklusiv an. Schöpfen Sie Ihre Kenntnisse nicht aus ausländischen Zeitungen? Dort wird systematisch alles verunglimpft, was sich auf Russland bezieht. — Nun, das ist eine umfangreiche Frage. Man kommt meiner Ansicht nach, wenn man im Auslande lebt, thatsächlich unter den Einfluss der auswärtigen Presse. Sonst aber fühle ich, dass ich in vielem und sogar sehr mit Ihnen übereinstimme usw.“
Ein Brief vom 9. Mai 1866 lautet: „Bester Alexander Jegorowitsch! Ich habe mich mit der Antwort verspätet und eile nun, das Versäumte nachzuholen. Glauben Sie mir, Sie unveränderlicher Freund Alexander Jegorowitsch, das Gewissen plagt mich selber, und wäre Ihr Brief nur um 8 Tage früher gekommen — ich hätte Ihnen sofort alles geschickt. Lachen Sie nicht, wenn ich so spreche. Hier meine Situation. Den ganzen Winter habe ich wie ein Anachoret gelebt, habe gearbeitet, meine Gesundheit zerstört, von Kopeken gelebt und doch 1500 Rubel ausgegeben. — Wohin sind sie gekommen? Ja, man reisst alles nur so von mir! In der Charwoche bin ich zu Katkow nach Moskau gefahren, um 1000 Rubel voraus zu nehmen.[22] Mein Zweck war der, so schnell als möglich nach Dresden zu fahren, und dort drei Monate sitzen zu bleiben und meinen Roman ganz ungestört zu vollenden. Anderswo, hier in Petersburg, kann ich ihn unmöglich vollenden. Die Anfälle nehmen zu (was im Auslande nicht der Fall ist). Die Gläubiger aber, je mehr man ihnen zahlt, desto zudringlicher werden sie. Indessen sollten sie mir dafür dankbar sein, dass ich nach meines Bruders Tode die Wechsel auf meinen Namen schreiben liess und einen Teil schon bezahlt habe. Hätte ich aber die Wechsel nicht auf mich schreiben lassen, so hätten sie gar nichts bekommen. — Allein die Sache hat sich so gewendet, dass diesmal zur Erteilung des Passes ins Ausland besondere Formalitäten nötig wurden, sich dadurch alles hinauszog, der Kurs zu fallen begann und, was in der Osterwoche noch möglich war, jetzt undenkbar ist. Inzwischen haben die Gläubiger die Klage eingereicht und so ist mein Tausender in Rauch aufgegangen.
Ich kann unbedingt nicht in Petersburg leben. Dennoch sitze ich da und setze meinen Roman mit dem Aufgebot aller Kräfte fort. In diesem Augenblick ist er — meine einzige Hoffnung. Ich werde dafür noch 1500 Rubel zu bekommen haben, vielleicht auch mehr; später aber gebe ich ihn für die zweite Auflage auch durchaus nicht um weniger als 1500 (man handelt schon darum). Von Katkow aber werde ich nicht früher als im Juli Geld herausbekommen. So werde ich Ihnen das Ihre unbedingt im Juli schicken. Entsteht aber die geringste Möglichkeit es früher zu senden (das aber kann leicht geschehen, da die Buchhändler schon um die zweite Auflage handeln, ehe der Roman vollendet ist), so schicke ich gleich. Sie aber bitte ich, mir, wenn auch nur in zwei Worten, meine vorjährige Schuld in Reichsthalern zu notieren, da ich mein Notizbuch verloren habe und mich der Summe nur annähernd, aber nicht genau entsinne. Ich füge hinzu, dass es mir peinlicher ist, als Ihnen, dass ich es Ihnen jetzt nicht schicken kann. Sie werden mir gewiss den Vorwurf machen, warum ich andere befriedigt habe und nicht Sie? Alles was ich zu meiner Entschuldigung sagen kann ist, dass es ohne Vorbedacht geschehen ist; sie sind neben mir und haben mich so bedrängt, dass ich nicht zu Atem kam — so habe ich alles willenlos hingegeben usw.“ —
Anknüpfend an diesen Brief erzählt Strachow aus seiner Erinnerung, dass der Eindruck des Romans ein ungeheurer war, dass gesunde Leute fast krank davon wurden, nervenschwache aber die Lektüre des Buches aufgeben mussten. Was aber die grösste Sensation machte, war der Umstand, dass zur nämlichen Zeit, als der Teil des Romans erschien, in welchem sich die Beschreibung des Mordanschlages Raskolnikows befindet, ein junger Student in Moskau unter nahezu genau denselben Umständen einen Mord vollbrachte. Es ist dies wohl ein Hinweis auf die damals in der Luft schwebenden falschen Prinzipien, nach welchen alle Mittel erlaubt sind, um das Böse aus der Welt zu schaffen; ein Miasma, das Dostojewsky schon in Sibirien erkannt hatte, als er jene oben angeführten Worte schrieb.
Im Herbste des Jahres 1866 sollte eine Gesamtausgabe von des Dichters bis dahin erschienenen Werken veranstaltet werden. Der Herausgeber, Stellowsky, ein Mensch, welcher das Talent anderer auf die schändlichste Weise ausbeutete, hatte dem Dichter unter anderen folgende Bedingung gemacht: Dostojewsky reiht in diese Sammlung eine Erzählung ein, welche noch nirgends gedruckt worden ist, und sendet sie bis Ende Oktober ein. Für diese Gesamtausgabe samt der neuen Erzählung zahlt Stellowsky dem Dichter 3000 Rubel. Kommt aber das neue Werk um einen Tag später, so erhält Dostojewsky für die Gesamtausgabe kein Honorar, und das Recht, eine Gesamtausgabe zu veranstalten, bleibt für alle Zeiten Stellowsky. Der Dichter hatte nun die Erzählung „Der Spieler“ niederzuschreiben begonnen, war aber durch die Schuldenlast, welche seines Bruders Tod auf ihn gewälzt hatte, so beunruhigt, dass er fürchten musste, nicht die nötige Sammlung zur Arbeit zu finden. Ein Brief aus Dresden an N. Strachow, sowie die Erzählung, welche uns Anna Grigorjewna davon machte, mögen die Schilderung dieser Situation ergänzen. Er schreibt:
„Stellowsky hat im Sommer 1865 meine Werke auf die folgende Weise erworben: Ich war in entsetzlichen Verhältnissen. Nach dem Tode meines Bruders im Jahre 1864 hatte ich viele seiner Schulden auf mich genommen und hatte 10000 Rubel vom Eigenen (welche ich von einer Tante als Erbteil bekam) auf die Fortsetzung der Herausgabe der „Epocha“ — meines Bruders Journal — zu Gunsten seiner Familie verwendet, ohne den geringsten Anteil und ohne das Recht zu haben, meinen Namen als Redakteur auf dem Umschlag des Blattes anzubringen. Das Blatt aber fiel, es musste aufgegeben werden; dennoch setzte ich die Bezahlung der Schulden meines Bruders sowie des Blattes fort. Wie viele Wechsel habe ich da ausgestellt! Unter anderen (sofort nach meines Bruders Tode) einem gewissen D.... Dieser D.... war zu mir gekommen und hatte mich angefleht, des Bruders Wechsel (er war sein Papierlieferant) auf meinen Namen zu schreiben, und gab mir sein Ehrenwort, dass er so lange warten würde, als es mir beliebe. Aus Dummheit that ich es.
Im Sommer 1865 fängt man an, mich mit den Wechseln D.s und eines anderen (ich erinnere mich seines Namens nicht) zu verfolgen. Von der andern Seite präsentierte Gawrilow, der damals in der Druckerei des Pratz arbeitete, ebenfalls einen Wechsel auf 1000 R., den ich ihm ausgestellt hatte, da ich Geld für die Herausgabe jenes, nun fremden, Journals brauchte .... und da, plötzlich, zur selben Zeit, sendet Stellowsky zu mir und lässt mir vorschlagen, ob ich ihm nicht meine sämtlichen Werke, samt einem ganz neuen Roman, um 3000 Rubel verkaufen wolle usw. usw., d. h. also unter den demütigendsten Bedingungen. Wartete ich nur ein wenig, so bekam ich von den Buchhändlern für das Recht der Publikation wenigstens das Doppelte, liess ich mir aber ein Jahr damit Zeit, dann bekam ich sicher das Dreifache, denn ein Jahr später wurde die zweite Auflage von „Schuld und Sühne“ allein gegen 7000 Rubel Schulden eingetauscht (immer Journalschulden — an Bazunow, Pratz und einen Papier-Agenten). Auf diese Weise habe ich für des Bruders Zeitschrift und seine Schulden 22 oder 23000 Rubel verbraucht, d. h. mit meiner Arbeit ausgezahlt, und habe jetzt noch gegen 5000 auf mir lasten. Stellowsky gab mir damals 10-12 Tage Bedenkzeit. Das war auch die Klagefrist für den Schulden-Arrest. Dazu müssen Sie wissen, dass meine Wechsel an D.... von einem gewissen Staatsrat B. (er hatte ehemals auch geschriftstellert, Goethe übersetzt, ist jetzt, wie es scheint, Friedensrichter auf der Wassilewsky-Insel) präsentiert wurden. In diesen 10 Tagen schlug ich mich überall herum, um Geld für die Auslösung der Wechsel zu bekommen und mich dadurch von dem so schimpflichen Handel mit Stellowsky zu befreien. Auch bei B. war ich achtmal, fand ihn aber nie zu Hause. Endlich erfuhr ich durch den Viertelsvorsteher (Quartalnij), den ich kennen lernte, dessen Namen ich vergass, dass B. ein alter Freund Stellowskys sei, seine Geschäfte führe usw. Da willigte ich ein, und wir verfassten jenen Kontrakt, dessen Kopie in Ihren Händen ist. Ich bezahlte D...., Gawrilow und die anderen und reiste mit dem Rest von 35 Halbimperialen ins Ausland.
Im Oktober kam ich mit dem im Auslande begonnenen Roman „Schuld und Sühne“ zurück, nachdem ich mit dem Russkij Wjestnik (Katkow) in Verbindung getreten war und von diesem schon einiges Geld voraus erhalten hatte. Da ich im Sommer den Kontrakt mit Stellowsky unterfertigt hatte, sagte ich diesem geradeaus, dass ich nicht imstande sein würde, den ihm versprochenen Roman bis zum 1. November 1865 zu vollenden. Er erwiderte mir, dass er dies auch nicht verlange und nicht vor einem Jahre die Publikation zu veranstalten gedenke, bat mich aber, zum 1. November 1866 zuverlässiger zu sein. Dies alles wurde mündlich und unter vier Augen verabredet, aber das schreckliche Pönale, wenn ich zum 1. November 1866 nicht fertig werde, blieb im Kontrakt.“
Die Ergänzung zu dieser Kontraktsgeschichte erzählte uns Anna Grigorjewna selbst. Der Dichter hatte nämlich den schon im Jahre 1863 geplanten und in vielen kleinen Notizen, namentlich im Gedächtnisse festgehaltenen Roman „Der Spieler“ Anfang Oktober 1866 zu schreiben begonnen und verlor, da die fatale Frist immer näher heranrückte, so sehr den Mut, dass seine Freunde befürchteten, er werde die Arbeit gar nicht machen können. Da machte ihm Miljukow den Vorschlag, sich einer Hilfskraft zum Schreiben zu bedienen. Dostojewsky weigerte sich anfangs eigensinnig. Doch setzten sich die Freunde mit dem Professor der Stenographie P. M. Olchin in Verbindung, erfuhren von ihm den Namen seiner besten Schülerin A. G. Snitkina und besuchten deren Familie, um dem jungen Mädchen ihre Vorschläge zu bringen. Sie hatte kurz vorher ihre Lehrjahre im Mariengymnasium vollendet und bald darauf ihren Vater verloren. Aus dem Wunsche heraus, ihren Kummer durch Arbeit zu lindern und auch um etwas zu verdienen, entschloss sie sich dazu, des Professors Vorschlag, der ihr durch Dostojewskys Freunde zukam, anzunehmen. Als sie gar hörte, wem sie in der Arbeit helfen sollte, da war das Mädchen voll Freude und Begeisterung, allein auch voll Angst, ob sie wohl dem grossen Dichter, den sie schon sehr bewunderte, genügen würde. Sie trat zitternd bei ihm ein, wurde jedoch bald durch einige freundliche Worte, namentlich aber dadurch ermutigt, dass man sofort an die Arbeit ging und der Dichter sie als Person gar nicht bemerkte. Es waren vom 4. Oktober bis 1. November noch sieben Druckbogen zu schreiben und alle ins Reine zu bringen. Anna Grigorjewna pflegte gegen die Mittagsstunde zu Theodor Michailowitsch zu kommen, wo sie zwei bis drei Stunden miteinander arbeiteten. Zuerst las Dostojewsky das in der von ihr mitgebrachten Reinschrift durch, was er gestern diktiert hatte, dann diktierte er weiter. So ging es bis zum 30. Oktober fort.
Nun war die Erzählung vollendet und wurde an Stellowsky durch Eilboten gesandt. Er war verreist, unauffindbar. Sandte man das Päckchen durch die Post, so kam es einige Tage später in Stellowskys Hände, und Dostojewsky war verloren. Da verfiel die junge, sehr gewandte Stenographin auf die Idee, das Manuskript in das Polizeirayon-Amt zu tragen und sich dort eine Empfangsbestätigung für den Empfänger mit dem Tagesdatum ausstellen zu lassen. Das geschah und der Dichter war gerettet. Die dreitausend Rubel, welche kontraktlich festgesetzt worden waren, hatte Stellowsky mit einer Hand als Herausgeber bezahlt, mit der anderen als Gläubiger der aufgekauften Wechsel, die ihm dazu gedient hatten, den Dichter in die Enge zu treiben, wieder eingestrichen.
So war durch Anna Grigorjewnas flinke Arbeitskraft, mehr noch durch ihre kluge und findige Art, des Dichters Interessen zu fördern, ihm eine unentbehrliche Helferin erstanden, die er nicht mehr missen konnte. Gegen das Ende ihrer Arbeit sprach er einmal den Wunsch aus, sie in ihrem Hause zu besuchen, ihre Mutter und den Grossvater, der mit ihnen lebte, kennen zu lernen. Schon nach wenigen Besuchen erklärte der Dichter Anna Grigorjewna und ihren Angehörigen, dass er seine Gehilfin auch gern zur Lebensgefährtin machen möchte. Das junge Mädchen, das mit grosser Verehrung zum Dichter aufblickte, hatte sich niemals eine solche Annäherung träumen lassen. Auch war Dostojewsky physisch nichts weniger als anziehend. So rief der Antrag des 46 jährigen Mannes in der 20 jährigen, sicher auch lebenslustigen Stenographin anfangs ein erschrecktes Staunen hervor. Doch war es keine kleine Versuchung für sie, an der Seite eines Schriftstellers als Gattin zu wandeln, dessen Ruhm in stetem Steigen begriffen war, an dessen Arbeiten sie thatsächlich und praktisch so viel Anteil nehmen durfte, um ihnen auch Erfolg zuzuführen und ihn, den Dichter, mit der Hoffnung eines sorgenlosen Alters zu beglücken. Sie willigte also ein. „Als ich seine Gattin wurde“ — sagte sie uns —, „da empfand ich nur Verehrung für ihn, aber nach einem Jahre, als ich so viel Liebe und Güte von ihm erfahren hatte, da liebte ich ihn bereits.“ Die Vermählung fand am 15. Februar 1867 statt, nicht ohne vieles Abraten von Seiten der Familie Michael Michailowitsch, welche eine Heirat des Dichters als ihren Interessen schädlich betrachten musste. Auch hier wusste die Klugheit der Neuvermählten, welche eine böse Ehezeit fürchten musste, wenn man in Petersburg blieb, den Dingen eine energische Wendung zu geben, indem sie zur Abreise antrieb, welche ja ohnedies durch die Klagen der Gläubiger und den drohenden Schuldenarrest ratsam geworden war.
Dieser Ehe entsprossen vier Kinder: Sophie, welche am 22. Februar 1868 in Genf geboren wurde und ebenda am 12. Mai desselben Jahres starb. Die zweite Tochter, Ljubow, wurde am 14. September 1869 in Dresden geboren und lebt bei ihrer Mutter teilweise in Petersburg, teilweise auf einer Besitzung in Stara Russa. Ein Sohn Theodor, welcher am 16. Juli 1871 in Petersburg geboren wurde, ist heute der Besitzer eines Gutes in der Krim und eines Rennstalles, dessen Racestuten schon viele Ehren und Preise gewonnen haben. Ein viertes Kind, Alexei, wurde am 12. August 1875 in Stara Russa geboren und starb in Petersburg im Mai 1878.
Zwei Monate nach seiner Vermählung, d. h. am 14. April 1867, ging das Ehepaar Dostojewsky nach dem Auslande, wo es, wie Strachow erzählt, weit länger zu bleiben verurteilt war, als es zu verweilen gedacht hatte. In einer Reihe von Briefen aus jener Zeit finden wir die Erklärung dazu. Mit der Rückkehr Dostojewskys nach Russland wären so viele Zahlungen und Verpflichtungen an ihn herangetreten, dass er dem Schuldgefängnisse nicht hätte entgehen können, wo er seiner physischen und psychischen Natur nach unmöglich hätte arbeiten und so weder für die Familie des Bruders noch für seine eigene hätte aufkommen können. Er musste also im Auslande bleiben, um bei unermüdlicher Arbeit endlich die grosse Schuldenlast, welche des Bruders Tod auf ihn gewälzt hatte, allmählich abzutragen.
Dieser Aufenthalt im Auslande wurde, ganz abgesehen von vielen schweren Sorgen, von der fast ausschliesslichen Einsamkeit und den Beschwernissen, welche Familienzuwachs in der Fremde bei beschränktesten Mitteln mit sich bringt, doch ein reicher Erntesegen, sowohl in materieller wie in geistiger Beziehung. Strachow sagt, es sei kein Zweifel, dass gerade im Auslande, bei diesen Umständen und den langen und ungestörten Meditationen, sich in dem Dichter die ganz besondere Ausgestaltung jenes christlichen Geistes vollzog, der immer in ihm gelebt hatte. In seinen Briefen ertönte plötzlich diese Saite seines Wesens, sie begann so mächtig in ihm zu erklingen, dass er es nicht mehr für sich allein zu behalten vermochte, wie er dies früher gethan. Von dieser durchgreifenden Umgestaltung geben seine Briefe jedoch keinen vollkommenen Begriff. Allein für alle seine Bekannten hat sie sich sehr klar gezeigt, als Theodor Michailowitsch von seiner Auslandsreise zurückkam. Unaufhörlich lenkte er das Gespräch auf religiöse Themata. „Nicht genug an dem“ — sagt Strachow — „er war auch in seinem Benehmen mit Menschen, das eine grössere Weichheit erlangt hatte, ja manchmal geradezu zur Sanftmut wurde, verändert. Sogar seine Gesichtszüge trugen die Spuren dieser Stimmung an sich, und auf seine Lippen war ein mildes Lächeln getreten. Ich erinnere mich“ — fährt Strachow fort — „an eine kleine Episode im „Slavischen Comité“. Wir traten zugleich ein und wurden von J. Petrow begrüsst. Wer ist das? fragte mich Theodor Michailowitsch, der ihn entweder nicht kannte, oder vergessen hatte, da er fortwährend auch solche Leute vergass, denen er oft begegnete. Ich sagte es ihm und fügte hinzu: was für ein wunderbarer, höchst wunderbarer Mensch! Theodor Michailowitschs Augen leuchteten freundlich auf, er sah alle Anwesenden mit liebevollem Blicke an und sagte: „Ja, alle Menschen sind wunderschöne Geschöpfe.“
Ehe wir jene Reihe Briefe mitteilen, welche der Dichter im Laufe seiner Abwesenheit von der Heimat an die Freunde schrieb, wollen wir Strachows orientierende Erzählung über die Reisestationen und das Lebensdetail dieses vier Jahre dauernden Exils in Kürze wiedergeben. Das Ehepaar ging im April über Berlin nach Dresden, wo es sich zwei Monate aufhielt. Der Dichter schrieb hier an seinem Artikel: „Meine Erinnerungen an Belinsky“, welchen er erst in Genf vollendete, im September an Maikow schickte, der ihn dem jungen Redakteur einer Sammlung übergab, worauf die Arbeit, sowie auch alle anderen, für diese Sammlung vorbereiteten Artikel, spurlos verschwunden sind. In Dresden war es namentlich Anna Grigorjewna, welche die Galerie eifrig besuchte und studierte. Theodor Michailowitsch besuchte sie wohl auch, beschränkte sich dabei jedoch immer auf seine Lieblinge: „Die Sixtina“, Correggios „Nacht“, Tizians „Zinsgroschen“, den Christuskopf von Annibale Caracci und die „Abendlandschaft“ Claude Lorrains. Ausserdem liebte er die Gemälde Rujsdaels, namentlich seine „Jagd“.
Hier schalten wir eine kleine Episode ein, welche wir aus dem Munde Anna Grigorjewnas haben und welche einmal durch den Briefwechsel des Dichters mit seiner Gemahlin, in welchen sie uns Einblick gewährte, ihre eigentliche Beleuchtung erhalten wird.
Kaum drei Monate verheiratet und in Dresden in den bekannten, sehr engen Verhältnissen lebend, beschliesst Dostojewsky von dort aus einen Abstecher nach Homburg zu machen, wo das Roulettespiel noch in voller Blüte stand, um noch einmal (wohl nicht zum letzten Male) sein Glück zu versuchen. Die kluge junge Gattin widersetzt sich diesem Vorhaben durchaus nicht; weiss sie ja doch, dass in solchem Falle ein Begehren sich ins Unerträgliche steigern und den Hausfrieden stören kann. Auch ist sie klar genug, zu erkennen, dass es nicht nur der praktische Beweggrund — so viel zu gewinnen, um eventuell in die Heimat zurückkehren zu können — allein ist, der den Dichter aus Dresden forttreibt, sondern wohl in ebenso hohem Grade sein nervöses und künstlerisches Bedürfnis nach der Aufregung des Spiels. Beide fühlen das ohne es auszusprechen, und so nimmt er hundert Thaler mit, die ihm zum Glück helfen sollen, über deren Verlust hinaus aber er nichts riskieren will. Nun beginnt jenes aufregende hinauf und hinab von Furcht und Hoffnung des Spielzufalls, das wir in seinen täglichen Briefen an die Gattin sich getreu wiederspiegeln sehen. Selbstanklage, Zerknirschung, Verhimmelung des jungen Weibes, das so geduldig alle diese Wendungen mit ihm durchlebt, ihre letzten besseren Sachen versetzt, um ihm noch einmal Geld zu senden, das die versetzte Uhr auslösen, ihn heimbringen soll, dies alles ohne Vorwurf und Bitterkeit lassen sowohl seinen, vom Augenblick und der Leidenschaft so oft beherrschten „schlechten Charakter“, wie er es nennt, unendlich plastisch hervortreten, sowie sein dankbares Verhältnis zur klugen jungen Frau, die ihn durch Nachgiebigkeit und unmerkliche Führung so gut zu lenken weiss.
Um die Mitte des Monats Juni 1867 reiste das Ehepaar von Dresden ab, um in die Schweiz zu gehen. In Baden-Baden wurden sie jedoch sechs Wochen festgehalten, da sich Theodor Michailowitsch abermals zum Spiel hatte hinreissen lassen, anfangs gewonnen, dann aber so viel verloren hatte, dass er sich nur mit dem von Katkow ihm gesandten Gelde loskaufen konnte und mit einem Rest von 30 Frcs. in der Tasche in Genf ankam. Seine Stimmung jedoch, sagt Strachow, wurde sofort eine bessere, als er nur der ihn wie ein Alp drückenden Vorstellung, am Roulettetisch gewinnen zu müssen, entronnen war.
In Genf brachte das Ehepaar den Winter 1867-68 zu, wo er den „Idioten“ schrieb, welcher Roman im „Russkij Wjestnik“ mit dem Januar 1868 zu erscheinen begann. Ihr Leben war einsam und einförmig. Um 11 oder 12 Uhr stand der Dichter auf, trank Kaffee und setzte sich zur Arbeit, an der er bis 3 Uhr verblieb. Dann diktierte er seiner Gattin aus dem Brouillon. Um 4 Uhr ging man in irgend ein Restaurant zu Tische. Dann las er im Lesesaal russische Zeitungen. Gegen Abend machte man einen Spaziergang, dann nahm man den Thee, worauf sich Theodor Michailowitsch ungefähr um 10 Uhr abends an sein Werk begab und bis 4-5 Uhr morgens arbeitete. Von Bekannten war niemand da, ausser Ogarew, welcher sie hier und da besuchte und ihnen in Zeiten grosser Not manchmal 5-10 Frcs. lieh. Am 22. Februar 1868 wurde ihnen das erste Töchterchen, Sophie, geboren; am 7. Mai desselben Jahres erfolgte deren Tod, den der Dichter so schwer empfunden und nie verwunden hat. Das Leben in Genf hatte für das Ehepaar aber auch noch manche andere Beschwerden und Unannehmlichkeiten, so dass sie sich Ende Mai davon losrissen und in Vevey ansiedelten, wo sie den Sommer über verblieben. Anfangs September gingen sie über den Simplon nach Italien, brachten zwei Monate in Mailand zu und liessen sich für den Winter 1868-69 in Florenz nieder. Die ganze Zeit wurde die Arbeit am „Idiot“ fortgesetzt, dessen Schluss als Separat-Anhang des „Russkij Wjestnik“ im Januar- oder Februarheft 1869 erschien.
War „Schuld und Sühne“, ohne dass man dies in Europa beachtete, ein spezifisch russisches Buch, der Roman der russischen Prinzipien und Probleme, so finden wir im „Idiot“, der, wie wir sahen, im Auslande begonnen und vollendet wurde, etwas ganz anderes in Wirksamkeit treten. Die Gestalt des Helden bietet den Russen kein neues Problem, hat kein neues Wort für sie, während zugleich die vielen Figuren des Beiwerks, mit sichtlichem Zorn und unnachsichtiger Härte hingestellt, in seinen Landsleuten Unwillen ob der Parteilichkeit erwecken mussten, mit welcher der Dichter die Gesinnungsgenossen einer „längst vergangenen Zeit“ brandmarkt. Dostojewsky hat dies später, in dem Roman „Die Besessenen“ noch in höherem Masse durchgeführt.
Für die europäische Lesewelt steht die Sache jedoch anders. Auch sie wird vieles in der Komposition dieses Buches fehlerhaft, die Charaktere der jungen Generation übertrieben, die Handlung gedrängt und doch lose, den Ton ungleich finden, und es wird ihr gerade dieses Scharfe, Krause, Wirre des Beiwerks russisch grausam erscheinen müssen. Die Gestalt des Helden aber, welche dem Russen, als allzuverwandt mit seiner Volksseele, kaum auffällt, ja vielleicht lächerlich erscheint, sie wird uns mit allen Mängeln der Dichtung aussöhnen.
Betrachten wir dies Buch aber weder vom Standpunkt des russischen, noch dem des deutschen Lesers, sondern, da wir ja schon die späteren Werke des Dichters kennen, im Hinblick auf seinen Werdegang, so finden wir darin, ganz im Gegensatz zu den russischen, zeitgenössischen Kritikern (welche die immer schärfer hervortretende Verbissenheit tadeln), die neue Form seiner christlichen Anschauungen sich immer klarer und deutlicher aus der Umgebung widerstreitender Erscheinungen herausschälen.
Fanden wir bei Raskolnikow die Hoffnung auf eine innere Sühne der Schuld durch ein künftiges christliches Glauben und Lieben, so steht hier in diesem „Idioten“ eine Verkörperung hoher, christlicher Weisheit, ohne jegliches „Prinzip“, ohne Zwang, in grösster Anmut vor unseren Augen.
Vollendet künstlerisch, wie alle Expositionen Dostojewskys setzt die Erzählung ein. Schon nach den ersten Seiten wissen wir, dass der Held, der junge Fürst Myschkin, kein Idiot ist, sondern der „reine Thor“, jene herrliche Gestalt, welche in der Litteratur so vieler Völker wiederkehrt, in der deutschen Sage im Parsifal unsterblich lebt, beim russischen Volk aber nicht sagenhaft, als Held, sondern als ein Kind des Volkes, „Iwanuschka-Duratschók“ noch heute lebendig unter ihm einherwandelt, belächelt und bemitleidet von seiner Umgebung, die selbst dereinst ein Stück russischer Sage darstellen wird.
Der junge Mann kommt aus der Schweiz in Petersburg an; er ist ärmlich gekleidet, so dass ihn im Waggon dritter Klasse friert; er hat sein ganzes Hab und Gut in einem Bündelchen bei sich und erzählt seinen Reisegefährten mit der Bereitwilligkeit eines Kindes, dass er, der letzte seines Namens, durch die Güte eines väterlichen Freundes bei einem Schweizer Arzt auf dem Lande untergebracht worden war, wo er von nervösen Anfällen geheilt werden und, so weit es seine Krankheit zuliesse, unterrichtet werden sollte. Seine Gesundheit sei viel besser geworden, seine Erziehung aber dennoch sehr lückenhaft geblieben. Vor zwei Jahren sei der Wohlthäter gestorben, der freundliche Arzt habe ihn aber dennoch bei sich behalten, habe väterlich für ihn gesorgt und ihn erst jetzt aus einem bestimmten Anlass nach Petersburg geschickt, ihm die Reise bezahlt, aber weiter nichts mitgeben können, so dass er nun ohne eine Kopeke anlange und noch nicht wisse, was er beginnen werde. Seine Reisegefährten sind: Rogoschin, der Sohn eines ebenso reichen als geizigen und despotischen Kaufmannes, dem er vor kurzem 10000 Rubel entwendet hat, um sie einer berühmten Schönheit zweifelhaften Rufes zu verehren. (Nun ist der Vater plötzlich gestorben und er kehrt zurück, um sein Erbe anzutreten.) Ferner ein mit allen Salben geriebener kleiner Beamte, schlechtester Sorte. Beide lächeln über die Harmlosigkeit des jungen Fürsten, der selbst erzählt, man hätte ihn in der Schweiz einen Idioten genannt, was er auch sicherlich ohne die treue Pflege jenes Arztes geworden wäre, nun aber nicht sei, wenn er sich auch noch nicht ganz genesen nennen könne.
Als die Rede auf jenes schöne Mädchen, Nastassja Philippowna, kommt, das der Kaufmannssohn leidenschaftlich zu begehren scheint, bekennt Myschkin (zu Rogoschins grosser Freude und Erleichterung) freimütig, dass er immer zu krank gewesen sei, um je ein Weib zu kennen. Damit ist auch für den Leser das Bild Myschkins als das eines Zuschauers in Liebesangelegenheiten klar, was seinen warmen, ja leidenschaftlichen Anteil an Nastassja, sowie später an Aglaia Epantschina, der jüngsten Generalstochter, die ihn liebt, in das reinste Licht stellt.
Nachdem die Reisegefährten angekommen sind, bietet Rogoschin dem Fürsten seine Gastfreundschaft und Hilfe an. Dieser will sich vorerst an den General Epantschin wenden, dessen Gattin ebenfalls eine Fürstin Myschkin ist, und hofft sich dort wegen der Angelegenheit, um derentwillen ihn der Pfleger in die Heimat geschickt hatte, Rat holen zu können. Da er keinen Wert auf diese Sache legt, sie nur nebenher erwähnt und hilflos-vergnügt mit seinem Bündelchen weiter zieht, fragt auch niemand nach dieser Angelegenheit, und er tritt nach einem schüchternen Läuten in die Vorstube des Generals ein, wo ihn ein Kammerdiener misstrauisch von oben bis unten ansieht und endlich gnädig hereinlässt. Die hier folgende Scene, da der junge Fürst seinen Namen nennt, aber mit seinem Bündelchen in der Hand lieber in der Dienerstube bleibt, als dass er in das Wartezimmer der Gäste ginge, ist ganz ausserordentlich geschildert.
Der Diener hält den Besucher natürlich bald für einen „Idioten“, gewinnt aber allmählich und unbewusst Sympathie und eine gewisse Achtung für diesen jungen Menschen, den er gleichwohl nirgends einzureihen weiss. Für den Leser ist aber von den ersten Worten, die Myschkin spricht, sichtbar geworden, dass da ein Wesen tiefster Herzenskundigkeit, weltfremd und unerfahren, doch in den letzten Dingen hellsehend und weise sich entfalten wird. Zugleich kindhaft vertraulich und streng bestimmt in ihren sittlichen Forderungen, lässt uns diese genialische Seele keinen Augenblick über sich im Zweifel. Die Krankheit, welche er nun fast ganz überwunden, ist auch hier sehr künstlerisch verwendet. Nicht ein Hemmnis oder eine Beugung des Charakters durch sie wird hier sichtbar, sondern sie hinderte den jungen Geist am Lernen, so dass auch darüber kein Zweifel sei, dass wir es nicht mit einem „gebildeten Geist“ zu thun haben, sondern mit einem natürlich entfalteten Wesen.
Manche russische Kritiker haben es abfällig beurteilt, dass Dostojewsky dem Fürsten Aussprüche tiefster Weisheit in den Mund legt. Wir können diesem Urteil nicht beipflichten. Der Dichter hat es wohl abgewogen, welcher Art die Weisheit sein müsse, die er den jungen Menschen aussprechen lässt. Immer ist es eine auf das Reinmenschliche gerichtete Wahrheit, eine Feinheit, die aus dem Gemüt quillt und zum Gemüt dringt, keinerlei Reflexions- oder Dogma-Weisheit. Und selbst da, wo Myschkin über den Katholicismus spricht, holt er seine Ansichten aus anderen Quellen, als einer erworbenen Tradition oder einem ausgeklügelten Axiom. Hören wir, was er gleich zu Anfang der Erzählung mit dem Kammerdiener des Generals in der Dienerstube über die Todesstrafe sagt. Der Diener fragt nach dem Auslande, den Sitten, der Gerichtsbarkeit, den Strafen. Da erzählt Myschkin, er habe in Lyon einer Hinrichtung durch die Guillotine beigewohnt, und beschreibt die Guillotine, wie sie so schnell arbeite. Auf des Kammerdieners Antwort, das sei noch gut, wenn es so schnell geschehe, sagt Myschkin:
„Wisst Ihr was? — seht, das habt Ihr bemerkt und das bemerken alle so wie Ihr, und darum ist diese Maschine, die Guillotine, so ersonnen. Mir aber ist gerade damals ein Gedanke in den Kopf gekommen: wie wenn gerade das noch schlimmer wäre? Das scheint Euch lächerlich, ja toll; bei einiger Vorstellung kommt einem aber doch so ein Gedanke in den Kopf. Bedenket: wenn man z. B. die Folter nimmt, dabei giebt es Schmerzen und Wunden, körperliche Qualen; das alles aber zieht ja von der seelischen Qual ab, so dass Du Dich nur mit den Wunden abquälst bis zum letzten Augenblick, bis zum Tod. Aber der Hauptschmerz, der heftigste Schmerz, ist ja vielleicht nicht in den Wunden, sondern darin, dass Du weisst, nun wirklich weisst, dass nach einer Stunde, dann nach zehn Minuten, dann nach einer halben Minute, dann sofort — Deine Seele dem Körper entflieht, dass Du dann kein Mensch mehr sein wirst und dass das schon sicher sein wird; die Hauptsache ist, dass es wirklich geschehen wird. Siehst Du, wenn Du den Kopf unter das Messer legst und hörst, wie es über ihm knirscht, diese Viertelsekunde, siehst Du, das ist das schrecklichste von allem. Wisst Ihr, das ist nicht meine Phantasie, das haben viele gesagt. Ich bin so überzeugt davon, dass ich Euch offen meine Meinung sagen will. Einen Totschlag mit einem Totschlag zu sühnen ist eine unermesslich grössere Strafe, als das Verbrechen selbst. Das Töten infolge eines Urteilsspruchs ist unvergleichlich furchtbarer, als der Totschlag eines Räubers. Derjenige, welchen die Räuber erschlagen, bei Nacht, im Walde oder sonst wie zerhauen, hofft unbedingt, bis zum letzten Augenblicke, noch auf Rettung. Es hat Beispiele gegeben, da Einer, dem schon die Gurgel durchschnitten war, noch hoffte, dass er noch lief oder flehte. Hier aber nimmt man ihm diese ganze letzte Hoffnung, mit der zu sterben es zehnmal leichter ist; man nimmt sie ihm thatsächlich, unwiderruflich fort. Hier ist ein Urteilsspruch und darin, dass Du ihm wirklich nicht entrinnen kannst, darin sitzt ja die furchtbare Qual. Und eine furchtbarere Qual als diese giebt es nicht auf der Welt. Stellt einen Soldaten im Krieg vor die Mündung einer Kanone und schiesst auf ihn, er wird immer noch hoffen, aber leset diesem nämlichen Soldaten das wirkliche Todesurteil vor, so wird er wahnsinnig[23], oder er fängt an zu weinen. Wer hat gesagt, dass die menschliche Natur imstande ist, das auszuhalten, ohne verrückt zu werden? Wozu ist eine solche Beschimpfung, eine so unsinnige, unnötige, so unnütze? Vielleicht giebt es auch einen solchen Menschen, dem man sein Urteil vorgelesen, den man sich abquälen liess und dem man dann gesagt hat: „Geh hin, man hat Dir verziehen“; das wäre ein Mensch, seht ihr, der was erzählen könnte! Von dieser Qual und diesen Todesschrecken hat auch Christus gesprochen. Nein! mit einem Menschen darf man nicht so verfahren!“
Wir wissen, dass Dostojewsky hier die bitterste Frucht seines eigenen Lebens dem jungen Myschkin in den Mund legt, doch ist dies so glaubwürdig aus dem Herzen des „Idioten“ herausgesagt, dass dieser Ausspruch, den des Dichters eigene Erfahrung gereift, hier wie eine Ahnung möglicher Qualen, wie ein Protest gegen diese das weiche und doch feste Empfinden des jungen Mannes beleuchten. Mit diesem Gespräch und dem gleich darauf folgenden Besuch bei der Familie des Generals, wo er der Generalin und ihren drei schönen Töchtern einiges aus seinem Leben in der Schweiz erzählt, ist gleichsam das „Leitmotiv“ des ganzen Romans angeschlagen, durch dessen wirre, gedrängte, mit Personen und Zufälligkeiten überfüllte Handlung die Gestalt des Idioten wie ein irrender Sonnenstrahl hindurchgleitet.
Der Kritiker Michailowsky nennt Dostojewsky in einem geistvollen Essay „ein grausames Talent“ und meint, die „Wollust an unnützer Qual der Nebenmenschen“ sei das charakteristische Merkzeichen seiner schriftstellerischen Thätigkeit, die sich immer nur um das Verhältnis von Wolf und Schaf herumbewege. In der ersten Hälfte seiner litterarischen Laufbahn sei Dostojewsky mit Vorliebe bei den Leiden des Schafes verweilt, das vom Wolf gefressen werde, später aber habe er mit wahrer Wollust die Gefühle des Wolfes geschildert, der das Schaf auffrisst. Diese Vorstellung hat Michailowsky sich wohl aus dem Eindrucke geholt, welchen der „Idiot“ und später „Die Besessenen“ in ihm mochten hervorgerufen haben. Es giebt in der That kaum je eine Lektüre, welche stellenweise solche Qualen hervorzurufen vermöchte. Allein die Deutung Michailowskys ist durchaus herbeigezwungen, denn auch hier, in diesen „grausamsten“ Werken des grossen Dichters und ganz besonders im „Idioten“, wiewohl er künstlerisch weit schwächer ist als „Die Besessenen“, steht er nicht nur auf der Seite des Schafes, sondern er löst die heitere, unbefangene, starke und überzeugte Milde seines Helden wie einen glänzenden Kern aus dem stachlichen Gehäuse des um ihn sich schliessenden Lebens heraus. Diese Lebens-Umgebung, diese Menschen und ihre Zustände, namentlich aber ihr Verhalten gegen den kranken und durch das Mitleid so überaus erregbaren jungen Mann, das alles hat etwas Widerwärtiges an sich, das indessen nur zur Hälfte als Vorwurf auf des Dichters Rechnung zu setzen ist. Wo er die junge Generation nihilistischer, atheistischer Färbung schildert, da ist er beissend, ja bissig bis ins Ungerechte, subjektiv bis zur Blindheit. Er, der im gemeinen Verbrecher des Totenhauses den göttlichen Funken, die „russische Wahrheit“ sucht und findet, ist unerbittlich gegen Verirrungen und Trugschlüsse des Geistes, Irrtümer des Herzens, die er selbst einmal geteilt hatte. Hier liegt die Vermutung nahe, dass er eben darum, weil er gelernt hatte, diese Richtung in sich selbst aufrichtig zu verdammen, das Mass für die Beurteilung der selben Ideen in Anderen verlor. Was uns aber sonst als quälend und unbehaglich in der Umgebung Myschkins entgegentritt, ist das zusammengewürfelte Milieu, das in Russland in gewissen mittleren Kreisen sich bildet, dem der Dichter in jüngeren Jahren wohl selbst mochte angehört haben, das ihn aber sicher als Romancier mehr locken musste, als die ausgeglichene Eleganz der hohen Kreise oder die Einheitlichkeit des Dorflebens.
In diesem mittleren Milieu brodelt das vielfältigste Leben. Es verkehren Menschen mit einander, die ursprünglich nicht zusammen gehörten. Die einen wollen hinauf, die andern müssen hinunter, alle wollen leben, geniessen, verdienen, wenigstens nicht verlieren, etwas gelten, ihren Leidenschaften freien Lauf lassen. Das kostspielige Leben der Hauptstadt gestattet vielen dieser Existenzen nicht, ein eigenes Quartier zu mieten. Man wohnt in Aftermiete (meblirovannye komnaty); der verabschiedete General, der kleine Beamte mit seiner Familie, die Gutsbesitzerswitwe mit ihrer Tochter, verwitterte Excellenzen, versoffene Kollegienräte, Hochstapler, Spieler, Cigaretten rauchende „Generalinnen“, das alles lebt in einzelnen Zimmern auf einem Gange „bei Vermietern“. In den Mietwohnungen minderen Ranges entsteht eine Gemeinschaft des Lebens; man lebt mit, man zieht bald zu dem einen, bald zu dem anderen der Stubennachbarn, man führt politische Gespräche, trinkt, spielt bis tief in die Nacht, streitet und versöhnt sich usw. Jener merkwürdige Typus „verlorener Kinder“ wie sie Dostojewsky als Sonja in Schuld und Sühne, als Nastassja Philippowna im Idiot schildert, ist auch aus diesem Milieu hervorgeholt. Was einer solchen Menschengemeinschaft vom Standpunkt geordneter und vornehmer Verhältnisse als Makel anhaften muss, das bildet wohl einen Vorzug im Leben jener von unserer Gesellschaft zur Schmach erzogenen Wesen. Dostojewsky, der konservative Politiker, ist als Mensch im weitesten Sinne frei und zeigt uns in diesen Gestalten eine merkwürdige Mischung von Verderbnis und Naivetät.
Ganz besonders in Nastassja Philippowna ist diese Keckheit und dieser Stolz der „Verlorenen“, die sich verschenkt, aber nicht verlizitieren will, ganz herrlich hingeworfen. Auch sie, wiewohl sie schon „vom Stoff der Schuld“ viel mehr in sich trägt, als die sanfte Sonja, ruft der Dichter durch Myschkins Mund zum „Liebesmahle“ heran. Myschkin hat ihr Bildnis gesehen, er soll es aus des Generals Kanzlei zu den Damen hinüberbringen. In einem der leeren Säle, die er, das Bild in der Hand, durchschreitet, bleibt er stehen, betrachtet dieses schöne, bleiche, magere Gesicht mit den tiefen Augen und — drückt plötzlich einen innigen Kuss darauf. Wir bleiben aber nicht lange über den Sinn dieses Kusses im Unklaren. Als er bei den Damen sitzt und ihnen von der Schweiz erzählen muss, da sagt er, dass er dort so überaus glücklich gewesen sei. Man lächelt, fragt, nötigt ihn zu reden. „Ich war nicht verliebt — ich war dort .. anders glücklich.“ Nun dringt man noch mehr in ihn und er fährt fort: „Dort — waren immer viele Kinder und ich war die ganze Zeit mit Kindern, nur mit Kindern. Es waren die Kinder aus jenem Dorfe, der ganze Tross, der dort in die Schule ging. Nicht, dass ich sie unterrichtet hätte — o nein, dazu war der Schulmeister da, Jules Thibaut; übrigens habe ich sie wohl auch gelehrt, aber ich war die meiste Zeit nur so mit ihnen — und so sind mir vier Jahre vergangen. Ich brauchte nichts anderes. Ich sprach mit ihnen über alles, habe ihnen nichts verheimlicht. Ihre Eltern und Verwandten wurden alle böse auf mich, weil die Kinder zuletzt gar nicht mehr ohne mich sein konnten und sich immer um mich scharten. Auch der Schullehrer wurde am Ende mein grösster Feind. Es erstanden mir dort viele Feinde und alle um der Kinder willen. Sogar Schneider (jener Arzt, der ihn aufgenommen hatte) beschämte mich. Aber was fürchtete er denn? Einem Kinde kann man alles sagen — alles. Mich hat immer der Gedanke frappiert, wie schlecht doch die Grossen die Kinder kennen, ja wie schlecht Väter und Mütter ihre eigenen Kinder verstehen. Vor Kindern braucht man nichts zu verbergen, unter dem Vorwande, dass sie klein sind und es zu früh für sie sei. Was für ein trauriger und unglücklicher Gedanke! Und wie gut bemerken es die Kinder selbst, dass die Eltern sie für zu klein erachten, um etwas zu verstehen, während sie alles verstehen. Die Erwachsenen wissen es nicht, dass ein Kind auch in der schwersten Sache einen richtigen Ratschlag zu geben vermag. Ach Gott, wenn dich dieses gute Vögelchen ansieht, so vertrauensvoll und glücklich, so muss man sich ja schämen es zu betrügen“. — Weiter heisst es dann: „Anfangs lachten mich die Kinder aus, dann warfen sie sogar Steine auf mich, als sie es gesehen hatten, wie ich Marie küsste. Ich habe sie aber ein einziges Mal geküsst .... Nein, lachen Sie nicht, beeilte sich der Fürst zu sagen, um das Lächeln seiner Zuhörerinnen aufzuhalten — da war nichts von Liebe vorhanden. Wenn Sie wüssten, was das für ein unglückliches Geschöpf war, so würde Ihnen selbst sehr leid um sie, gerade wie mir. Sie war aus unserem Dorfe usw.“
Nun erzählt der Fürst die Geschichte dieses armen, demütigen Wesens, das sich mit niedrigster Arbeit einige Kopeken verdiente; dabei war sie schwindsüchtig. Einmal war ein französischer Kommis des Weges daher gekommen, hatte sie bethört und mit sich genommen, nach acht Tagen wieder fortgejagt. Da war sie die vielen Werst zu Fuss zurückgegangen, eine ganze Woche lang, war in Lumpen gehüllt, elend, erkältet heimgekommen. Die Mutter, welche einen ganz kleinen Handel im Fenster ihrer Kammer versah und davon lebte, beschimpfte sie, gab sie dem Hohn und den Schmähungen der Dorfbewohner preis. Man nahm sie nirgends mehr zur Arbeit, und selbst der Kuhhirt wollte ihr keinen Teil der Herde anvertrauen. Schweigend ging sie aber doch dem Vieh nach und hütete es gut, sodass er ihr hie und da etwas Brot und Käse gab. Da war es, dass der junge Fürst sie einmal traf und ihr 8 Francs gab, die er für eine kleine Diamantnadel eingelöst hatte.
„Ich hatte lange getrachtet, Marie allein zu treffen, endlich begegnete sie mir hinter dem Dorfe, beim Zaun, an einem Seitenpfade hinter einem Baum. Hier gab ich ihr die 8 Francs und sagte ihr, sie möge sie gut bewahren, weil ich weiter nichts haben würde. Dann aber küsste ich sie und sagte ihr, sie möge nicht denken, ich hätte böse Absichten, dass ich sie nicht darum küsse, weil ich etwa in sie verliebt sei, sondern weil sie mir so sehr leid thue und ich sie von Anfang an nicht im geringsten für schuldig, nur für sehr unglücklich erachtet hätte. Ich hatte so sehr den Wunsch, sie auch gleich zu trösten und zu überzeugen, dass sie sich nicht vor allen so zu erniedrigen habe, aber sie hat das, scheint es, nicht verstanden.“ „Dann, als ich geendet hatte, küsste sie mir die Hand, und ich ergriff sogleich die ihre und wollte sie auch küssen, allein sie zog sie rasch zurück. Da erblickten uns plötzlich die Kinder, eine ganze Schar. Ich erfuhr nachher, dass sie mich schon lange belauscht hatten. Sie begannen zu pfeifen, mit den Händchen zu klatschen und zu lachen, Marie aber lief davon. Ich wollte sprechen, sie aber begannen Steine auf mich zu werfen.“
Weiter fährt er fort: „Ich erzählte ihnen, wie unglücklich Marie sei; bald hörten sie auf zu schmähen und gingen schweigend davon. Nach und nach begannen wir miteinander zu reden; ich verbarg ihnen nichts, erzählte ihnen alles. Sie lauschten mit vielem Interesse und begannen bald Marie zu bemitleiden. Manche von ihnen begrüssten sie nun schon zärtlich, wenn sie ihnen begegnete“ usw. — Zuletzt riefen ihr die Kinder oft zu: „nous t’aimons Marie“! Als sie stirbt, überschütten sie die Kinder mit Blumen, legen ihr einen Kranz aufs Haupt und wollen den Sarg zum Friedhof tragen. Da sie es nicht vermögen, folgt die ganze Schar ihm weinend nach, und der Grabhügel blüht seither unter ihrer Obhut. Er aber, der junge Fürst, wird der Kinder unzertrennlicher Genosse und Berater, wenn auch vom Pastor und dem Lehrer angefeindet. Auch sein Beschützer, der Arzt Schneider, tadelt ihn darob und nennt ihn ein „ewiges Kind“.
Endlich fertigt ihn dieser nach Russland ab, und wir ersehen am ersten Abend nach der Ankunft Myschkins, um was es sich da handelt. Der junge Fürst ist ungeladen zu jener Schönen, Nastassja Philippowna, gekommen, wohin eine Gesellschaft zusammengerufen worden, um ihren Entschluss zu hören: ob sie, mit einer Mitgift ihres ehemaligen Liebhabers ausgestattet, Ganja Iwolgin, einen jungen Streber, der sie um dieses Geldes willen nehmen will, heiraten wird oder nicht.
Myschkin ahnt, dass er hier etwas zu sagen oder zu thun haben werde, und tritt nun, seine Scheu überwindend, in die verblüffte Gesellschaft. Man hat sich jedoch bald mit dem ungebetenen Gaste zurecht gefunden, denn der Abend soll ja anderes, Wichtigeres bringen. Alles ist gespannt. — Da stürzt Rogoschin, des Fürsten wüster Reisegefährte, mit einem Schwarm betrunkener Genossen herein und legt ein Päckchen von 100000 Rubeln auf den Tisch, womit er Nastassja als Geliebte für sich loskaufen will; diese schleudert nun, krampfhaft lachend, eine wilde Herausforderung den Anwesenden, namentlich dem sie verheiratenden alten Liebhaber Totzky ins Gesicht.
„Auch noch verpflichtet wäre ich ihm, so meint er wohl; er hat mir ja eine Erziehung gegeben, mich wie eine Gräfin gehalten, und Geld, wieviel Geld ist da aufgegangen! Einen anständigen Gatten hat er mir gesucht, schon dort, und hier nun diesen. Und was glaubst du — ich habe diese fünf Jahre nicht mit ihm gelebt, habe aber Geld von ihm genommen und gedacht, ich sei im Recht! Ganz unsinnig bin ich ja geworden! Du sagst: Nimm die Hunderttausend und jag’ ihn fort, wenn’s dich ekelt. Freilich ist es ekelhaft .... Ich hätte auch schon lange heiraten können und andere, als diesen hier — aber das ist ja schon gar ekelhaft! Und wofür habe ich meine fünf Jahre in diesem Zorn vergeudet? Und wirst du’s glauben (sie wendet sich da an eine Freundin) oder nicht, dass ich vor etwa vier Jahren zeitweise daran gedacht habe, ob ich nicht kurzweg meinen Athanasji Iwanowitsch nehmen sollte? Das hab’ ich damals aus Bosheit so gedacht; es ist mir damals nicht wenig im Kopf herumgegangen. Ich hätte ihn sicher dazu vermocht, das glaube mir! Er hat selbst einmal dazu gedrängt, ob du’s glaubst oder nicht! Freilich, er hat gelogen, denn er ist schon gar zu gierig, hält nicht Stand. Und später, Gott Lob, ist mir eingefallen: ist er einer solchen Bosheit wert? Da hab’ ich einen solchen Abscheu vor ihm bekommen, dass, wenn er auch um mich gefreit hätte, ich ihn nicht genommen hätte. Ganze fünf Jahre habe ich so forciert! Nein, da ist’s schon besser auf die Strasse, wohin ich auch gehöre! Entweder mich mit Rogoschin verlottern, oder morgen unter die Wäscherinnen gehen! Denn es ist nichts mein eigen, was ich da trage. Geh’ ich fort, so werf ich ihm alles hin, den letzten Fetzen lass’ ich hier — wer aber nimmt mich ohne alles — frage nur den da, Ganja, ob er mich nimmt? Ja, auch Ferdyschtschenko (der Spassmacher der Gesellschaft) nimmt mich nicht! ....“
„Ferdyschtschenko nimmt Euch vielleicht nicht, Nastassja Philippowna, ich bin ein aufrichtiger Mensch“, unterbrach sie dieser; „dafür hingegen — nimmt Euch der Fürst! Ihr sitzet so da und lamentiert — schaut nur einmal den Fürsten an! Ich beobachte ihn schon lange ...“
Nastassja Philippowna wendet sich neugierig nach dem Fürsten um.
„Ist es wahr?“ fragt sie ihn.
„Es ist wahr,“ sagt er leise.
(Der Eindruck dieser Scene ist unbeschreiblich.)
„Da hab’ ich einen Wohlthäter gefunden!“ sagt Nastassja „Übrigens spricht man vielleicht die Wahrheit über ihn, dass er .... so ist. Wovon wirst du denn leben, wenn du so verliebt bist, die Rogoschinskaia zu nehmen, für dich, als — Fürstin?“
„Ich nehme Euch als eine Ehrenhafte, Nastassja Philippowna, nicht als eine Rogoschinskaia“, sagte der Fürst.
„Ich, ehrenhaft?“
„Ja, Ihr,“ usw.
Nun wird die Frage des Unterhalts erörtert und es stellt sich aus einem Briefe, den Myschkin bei sich trägt, heraus, dass er der Erbe einer steinreichen Verwandten ist und es eben diese Angelegenheit war, um deren willen man ihn nach Russland gesandt hatte.
Er will nun ernstlich Nastassja heiraten, sie vor sich selbst retten. Sie entflieht ihm mit Rogoschin, da sie dieses Opfer des Erbarmens nicht annehmen will. Nach vielen höchst aufregenden und den Leser in quälende Spannung versetzenden Episoden setzt Myschkin, dessen Gesundheit allen diesen Erregungen nicht mehr stand hält, doch endlich die Vermählung durch. Schon im Brautgewande und vor dem Altar — entflieht die Braut. Spät in der Nacht, es ist eine helle Petersburger Nacht, erscheint Myschkin vor Rogoschins finsterem, versperrtem Hause. Man lässt ihn nicht ein. Er stellt sich gegenüber Rogoschins Fenster auf, dieser erblickt ihn und holt ihn in die dunkle, durch einen schweren Vorhang abgeteilte Stube. Der Fürst, den schon wiederholte Anfälle seiner Krankheit des klaren, folgerichtigen Denkens zu berauben anfangen, sammelt sich mit schwerer Mühe, um zu begreifen, was hier vorgegangen. Rogoschin führt ihn hinter den Vorhang. Hier liegt auf dem Bette, mit dem Leintuch bis über den Kopf zugedeckt, ein unbeweglicher Körper. Ein nackter Fuss, wie aus Marmor gemeisselt, ist beim unteren Bettende sichtbar und ringsum weisse Gewänder, Spitzen, Brillanten — — — Sie war mit Rogoschin leise in das unbewohnte Haus hinaufgeschlichen, „damit Myschkin sie nicht finde“. Hier hatte sie die Nacht auf seinem Bette zugebracht, hier hat er ihr sein Messer ins Herz gestossen. Darauf hat er sich zu Füssen des Bettes vor den Vorhang hingesetzt und gewartet. Nun erzählt er das alles, vom Fieber geschüttelt, dem Fürsten. „Du sollst aber keinen Anfall hier bekommen und schreien, sonst musst du fort.“ — — Allmählich verlässt beide das Bewusstsein. — Am andern Morgen findet man Rogoschin im Fieber schreiend und rasend, Myschkin neben ihm auf dem Boden sitzend, nun vollständig blödsinnig — und dem Kranken bei jedem Schrei zärtlich Haar und Antlitz streichelnd .....
Es ist wohl hier der Platz für einen Brief, welchen der Dichter neun Jahre später an einen jener Korrespondenten richtete, die ihn in seinen letzten Lebensjahren so oft um Rat in schweren Gewissensfragen angingen. Dieser Brief ist in mehr als einem Sinne und in mehr als einer Richtung bedeutsam und interessant.
Er lautet:
„Petersburg, 14. Februar 1877.
Geehrter Herr Kowner!
„Ich habe Ihnen lange nicht geantwortet, weil ich ein kranker Mensch bin und sehr schwer an meiner Monatsschrift arbeite. Auch muss ich jeden Monat einige Dutzende von Briefen beantworten. Endlich habe ich eine Familie und noch andere Geschäfte und Verpflichtungen. Ich habe thatsächlich keine Musse zum Leben, und mich in eine längere Korrespondenz einzulassen, ist mir unmöglich. Besonders mit Ihnen.
Ich habe selten etwas gelesen, das geistvoller geschrieben wäre, als Ihr erster Brief an mich (Ihr zweiter Brief ist etwas für sich).
Ich glaube Ihnen vollkommen alles, was Sie mir darin über sich selbst sagen. — Über Ihr einstmals begangenes Verbrechen haben Sie sich so klar und (wenigstens was mich anbelangt) so verständlich ausgedrückt, dass ich, ohne Ihre That in deren Einzelheiten zu kennen, diese jetzt mindestens ebenso ansehe, wie Sie selbst.
Sie beurteilen meine Romane. Darüber kann ich natürlich nicht mit Ihnen reden; doch hat es mir gefallen, dass Sie den „Idiot“ als den besten darunter hervorheben. Stellen Sie sich vor, dass ich dieses Urteil schon fünfzig Mal, wenn nicht öfter, gehört habe. Das Buch wird auch alljährlich verkauft und jedes Jahr in einer grösseren Anzahl von Exemplaren. Ich habe den „Idioten“ darum jetzt genannt, weil alle, die mit mir darüber als von meinem besten Werke sprechen, etwas besonderes in der Zusammensetzung ihrer Geistesfähigkeiten haben, das mich sehr berührt und mir sehr gefällt. Wenn sich diese Geistesrichtung nun auch bei Ihnen findet, so ist das für mich nur um so besser, natürlich wenn Sie aufrichtig sind. Aber wenn es auch nicht so wäre ....
NB. Die zwei Zeilen Ihres Briefes, worin Sie sagen, dass Sie keinerlei Reue über das von Ihnen begangene Verbrechen in der Bank empfinden, sind nicht recht nach meinem Sinne. Es giebt etwas, das höher ist, als die Beweisführung der Vernunft und aller erdenklichen hinzugetretenen Umstände, etwas, dem sich zu unterwerfen ein jeder sich verpflichtet fühlen muss (das heisst, wieder als einem Symbol). Sie sind vielleicht so gescheit, dass Sie sich über diese unerbetene Offenheit meiner Bemerkung nicht beleidigt fühlen; denn, erstens bin ich nicht besser, als Sie oder irgend Einer (und dies ist durchaus keine falsche Demut, wozu auch?); und zweitens, wenn ich Sie auch in meinem Herzen freispreche (so wie ich auch Sie auffordere, mich freizusprechen), so ist es immer besser, wenn ich es thue, als wenn Sie selbst es thun. Scheint Ihnen das unklar? (Hier nebenbei zur Erläuterung eine kleine Parallele. Der Christ, das heisst der volle, der höhere, ideale Christ sagt: „Ich habe meinen Besitz mit den armen und niederen Brüdern zu teilen, ich habe ihnen allen zu dienen.“ Der Kommunard aber sagt: „Du hast mit mir, dem Armen und Niedrigen zu teilen, du hast uns zu dienen.“ Der Christ wird recht, der Kommunard wird unrecht haben.) Übrigens ist Ihnen vielleicht jetzt noch unverständlicher, was ich Ihnen sagen wollte.
Nun zu den Juden. Über ein solches Thema kann man sich in einem Briefe nicht aussprechen, besonders mit Ihnen nicht .... Sie sind so gescheit, dass wir einen solchen strittigen Punkt auch in hundert Briefen nicht erledigen und uns dabei nur abquälen würden. Ich will Ihnen nur sagen, dass ich auch von anderen Israeliten Briefe mit ähnlichen Bemerkungen bekommen habe. So habe ich namentlich vor kurzem einen ideal vornehmen Brief von einer Jüdin erhalten, welcher ebenfalls mit bitteren Vorwürfen schloss. Ich denke, ich werde, veranlasst durch diese mir von Israeliten gemachten Vorwürfe, einige Zeilen im Februarheft meines Tagebuches schreiben (das ich übrigens noch nicht zu schreiben begonnen habe, da ich bis heute noch infolge meines letzten epileptischen Anfalles leidend bin). Jetzt sage ich Ihnen nur, dass ich durchaus kein Feind der Juden bin, niemals ein solcher war. Allein — schon ihr, vierzig Jahrhunderte währender Bestand beweist, wie Sie selbst mir sagen, dass dieses Geschlecht eine ausserordentliche Lebenskraft besitzt, welche im Laufe seiner ganzen Geschichte nicht anders konnte, als sich als verschiedene status in statu formulieren. Ein sehr kräftiger status in statu ist unbestreitbar auch bei unseren russischen Juden vorhanden. Wenn es aber so ist, wie ist es dann anders möglich, als dass sie, wenigstens teilweise, zur Wurzel der Nation, zur russischen Volksfamilie eine Dissonanz bilden? Sie weisen auf die Intelligenz der Juden hin — nun, Sie selbst sind ja auch eine Intelligenz und — sehen Sie nur ...
Aber lassen wir das, dies Thema ist ein zu langes. Ich habe viele Bekannte, die Juden sind, auch Jüdinnen, die mich auch jetzt oft um Rat angehen. Doch lesen sie das „Tagebuch eines Schriftstellers“; und obwohl sie, wie alle Israeliten, was das Judentum anbelangt, empfindlich sind, so sind sie mir doch nicht feind und kommen doch zu mir.
Was die Sache der Kornilowa[24] anlangt, bemerke ich nur, dass Sie nichts wissen, daher auch nicht kompetent sind. Aber was sind Sie doch für ein Lehrling. Mit einem solchen Blick auf das Herz des Menschen und seine Handlungen bleibt ja nichts übrig, als im Kot materieller Genüsse zu versinken ...
... Übrigens kenne ich Sie ja, ungeachtet Ihres Briefes, gar nicht. Ihr Brief (der erste) ist hinreissend schön und gut. Ich will mit voller Seele glauben, dass Sie vollkommen aufrichtig sind. Aber auch wenn Sie nicht aufrichtig wären ... es ist dies einerlei; denn Unaufrichtigkeit in einem gegebenen Falle ist eine in ihrer Art höchst komplizierte und sehr tiefe Sache. —
Glauben Sie an die volle Aufrichtigkeit, mit der ich Ihnen die mir dargereichte Hand drücke; erheben Sie sich aber im Geiste und formulieren Sie Ihr Ideal. Sie haben es ja bis zum heutigen Tage gesucht, oder nicht?
Mit aufrichtiger Hochachtung
Ihr
Th. Dostojewsky.“
Mehr als langatmige Abhandlungen es vermöchten, kündet uns dieser Brief die ganze Eigenart Dostojewskys. Gleichsam im Vorübergehen, wie unbewusst, streift er einige der bedeutendsten Probleme der Gegenwart und löst sie in seinem ihm eigenen Sinn. In seiner Freude über jene, welche den „Idioten“ als sein bestes Werk ansehen, steckt eine ganze Ethik der unbefleckten Wahrheit, so wie in jener Parallele zwischen Christ und Kommunard sein soziales Glaubensbekenntnis enthalten ist. Die Andeutung über die Lüge, die „in gegebenem Falle eine sehr ernste und komplizierte Sache“ ist, deckt sich mit dem Ausspruch, den er Rasumichin in den Mund legt: „Lügen wir uns zur Wahrheit durch“, und reisst gleichsam vor unseren Augen das Dornengestrüpp der Lüge auseinander, das oft unseren Weg zur Wahrheit umwirrt; und wie gewandt endlich kehrt er, in der Berührung der Judenfrage, seines Korrespondenten eigene Waffe gegen diesen, um damit zum hundertsten Male sein Credo an die „nationale Grundlage“ des Volks zu erhärten. —
Das Leben in Florenz war ebenso einförmig wie das in Genf gewesen, doch gab es hier viele Kunstsammlungen, welche nicht nur von Anna Grigorjewna, sondern auch von Theodor Michailowitsch oft besucht wurden. Des Dichters Lieblinge waren hier Rafaels „Madonna della Sedia“ und „Johannes der Täufer“. Ganz besonders entzückte den Dichter der Campanile und Ghibertis Thor des Battisterio. Auch ein Lesesaal war hier, wo man russische Zeitschriften finden konnte. Ausserdem beschäftigte sich Dostojewsky hier mit den Dichtern der 40er und 50er Jahre, namentlich Balzac und George Sand. Bekannte Russen gab es hier gar keine, so dass das Ehepaar zehn Monate in Florenz zubrachte, ohne mit irgend jemand ein russisches Wort zu wechseln. Übrigens empfand Theodor Michailowitsch eine ausserordentliche Sympathie für das italienische Volk und fand es immer dem russischen sehr ähnlich. In Theater-Aufführungen kamen sie sehr selten, weil sie allzuwenig Geld hatten, um sich ein solches Vergnügen zu gestatten.
Im Juli 1869 ging das Ehepaar über Venedig, Triest, Wien und Prag nach Dresden. Venedig machte auf den Dichter einen besonders bezaubernden Eindruck und es blieb immer das Ziel seiner Träume. Er hatte es anfangs vorgehabt, sich in Prag niederzulassen, um mit Rieger und Palacky näher bekannt zu werden, welche ihn sehr interessierten. Der Umstand jedoch, dass in Prag keine möblierten Wohnungen zu finden waren, nötigte ihn, Dresden zu seinem Wohnort zu erwählen. Hier wurde ihm am 14. September (1869) die zweite Tochter geboren und das brachte neue Freuden und neue Sorgen in das Leben der Wandernden. Den Dichter erfüllte die Geburt einer Tochter mit Glück und er widmete diesem Kinde jede freie Minute, wie sie auch sein erster Gedanke beim Erwachen war. Zu Ende des Jahres schrieb Dostojewsky den „Hahnrei“ und das ganze Jahr 1870 hindurch die „Dämonen“ (in einer Übersetzung „Die Besessenen“ genannt), welche anfangs 1871 im „Russkij Wjestnik“ zu erscheinen begannen.
Auch hier fand Theodor Michailowitsch keine näheren Bekannten; übrigens liebte er es nicht besonders, im Auslande Verkehr mit Russen zu pflegen, die er nur oberflächlich kannte. Seine Lektüre schöpfte er hier aus russischen Zeitschriften und einigen Werken, die er mit sich genommen oder sich verschrieben hatte, so die Werke Belinskys, „Krieg und Frieden“ von Tolstoj und einige andere. Das Buch jedoch, zu welchem er immer wieder zurückkehrte und das ihn, seit er es von den Frauen der Dezembristen in Sibirien auf dem Wege dahin erhalten, nie verlassen hatte, war das Evangelium.
In Dresden musste die Familie zwei Jahre verbleiben und, wie Anna Grigorjewna selbst berichtet hat, es gehörten gerade diese zwei Jahre zu den schwersten Zeiten der freiwilligen Verbannung. „Er litt immer mehr darunter,“ sagte sie, „dass er sich von Russland entfernt habe, es nicht mehr kenne.“ In seinen Briefen drückt er oft diese Sehnsucht nach Russland aus. Allein die Rückkehr war schwer zu bewerkstelligen, weil man dazu von vornherein grosse Geldsummen brauchte. Dazu gehörte, dass man nicht nur hier ganz loskam, dass man nach Petersburg übersiedelte, sondern die Wechsel und Schulden einlöste, welche von der Leitung der „Epocha“ her noch unbeglichen waren. Lange warteten sie auf günstige Umstände, aber so viel Geld brachten sie doch nie auf. Ungeachtet ihres höchst bescheidenen Lebens wurde doch alles eingesandte Geld zu diesem verbraucht. Ein bedeutender Teil ging für die Erhaltung der Witwe des dahingeschiedenen Bruders, ein anderer für die des (offenbar nicht wohlgeratenen) Stiefsohnes Theodor Michailowitschs auf, ebenso für die Interessen der bei der Abreise versetzten Effekten (die zuletzt doch verfielen). Da sie keinen Ausgang aus allen diesen Schwierigkeiten vor sich sahen, dabei aber fühlten, dass es ihnen unerträglich wurde, unter diesen Verhältnissen in der Fremde weiter zu leben, entschlossen sie sich, alle Folgen einer solchen Rückkehr auf sich zu nehmen, und kehrten am 8. Juli 1871 nach Petersburg zurück, wo am 16. desselben Monats ihr erster Sohn Theodor geboren wurde.
Blättern wir nun in den Briefen des Dichters aus dieser Zeit der Selbstverbannung, so finden wir darin die Bestätigung alles dessen, was Strachow darüber berichtet und Anna Grigorjewna selbst erzählt, alles was wir durch sie über äussere Ereignisse, Verhältnisse und Stimmungen erfuhren. Diese Briefe in extenso zu bringen, müssen wir aus zwei Gründen verzichten. Einmal weil die Zahl der uns vorliegenden, 42, einen Umfang von etwa zehn Druckbogen grossen Formats einnimmt, die Länge einzelner oft sehr beträchtlich ist, ohne dass uns daraus neues Material für die Erkenntnis des Dichters erwüchse. Dann aber, und dies ist wichtiger, weil seine Richtung durch alles Vorangegangene und namentlich durch das Tagebuch besser gekennzeichnet ist als durch diese Briefe, deren Wiederholungen mit ihrem Nachdruck auf gewisse rein persönliche geschäftliche Beziehungen und Kontroversen von einem deutschen Publikum gleichgiltig, ja wohl missverständlich müsste aufgenommen werden. Auch jenen Briefen, welche hier angefügt werden, müssen wir eine Bemerkung voransetzen, welche der Leser dieser Aufzeichnungen wohl selbst gemacht hat, die aber als Merkmal von Dostojewskys Wesen hervorgehoben zu werden verdient. Des Dichters Briefe sind alles andere eher als „geistreiche Briefe“; sie sind in noch viel höherem Grade als seine künstlerischen und publizistischen Schriften nicht litteraturmässig. In seiner Grossartigkeit und Unmittelbarkeit (bei allem Raffinement des Künstlers) hier wie überall um die Form unbekümmert, sorglos um die tausend Sachen und Sächelchen, die er da oder dorthin in das rechte Licht stellen könnte, ist Dostojewsky in seinen Briefen einfach wie die Alltäglichkeit, ja durchaus Alltagsmensch, und wir glauben ihm aufs Wort, was er noch im Jahre 1856 aus Sibirien an Apollon Maikow schrieb: „— — Verzeihen Sie die Zerfahrenheit meines Briefes. In einem Briefe kann man niemals etwas Ordentliches schreiben. Darum eben kann ich die Mme. de Sévigné nicht leiden. Sie hat allzu gute Briefe geschrieben.“ Dostojewskys Stil ist sowohl in seinen Werken, als in seinen Briefen so, wie ihn Nietzsche fordert (ohne ihn selbst zu haben): „nicht der kunterbunt superlativistische, sondern der einer zu vornehmer Einfachheit geadelten Alltäglichkeit“.
Der erste Brief, in den wir nach seiner Abreise Einblick haben, ist vom 28. August 1867 aus Genf datiert, an Maikow gerichtet. Nach einer einleitenden Entschuldigung, dass er so lange geschwiegen habe, und einem jener Vertrauensanfalle, die uns bei Dostojewsky immer wie die Reversseite des Misstrauens erscheinen, bei dem wir ihn den besten Freunden gegenüber manchmal ertappen, beginnt er die zusammenfassende Erzählung seines Reiselebens wie folgt:
„Sie wissen, wie ich abgereist bin und aus welchen Gründen. Der Hauptgründe waren zwei: 1. Nicht nur die Gesundheit, nein, das Leben zu retten. Die Anfälle wiederholten sich schon in jeder Woche; diese Nerven- und Gehirnzerrüttung aber zu empfinden und klar zu erkennen, das war unerträglich. Der Geist begann thatsächlich sich zu zerrütten. Das ist thatsächlich wahr. Die Nervenstörungen aber brachten mich manchmal zu Wutausbrüchen. Die zweite Ursache, oder Situation, war diese: die Gläubiger konnten nicht mehr länger warten, und zur Zeit meiner Abreise war schon durch Latkin und später durch Petschatkin die Klage gegen mich eingereicht. Noch ein Kleines und sie nahmen mich fest. Nehmen wir an — ich will keine schönen Worte machen und mich aufschmücken — nehmen wir an, das Schuldgefängnis wäre mir in einer Hinsicht auch sehr nützlich: Aktualität, Material, ein zweites „Totenhaus“; mit einem Wort, es gäbe Material mindestens für 4-5000 Rubel, aber ich habe eben erst geheiratet und, ausserdem, würde ich den heissen Sommer im Tarassowschen Hause aushalten? Das war eine unlösbare Frage. Wäre es mir aber unmöglich geworden im Tarassowschen Hause, bei zunehmenden Anfällen, litterarisch thätig zu sein — wie hätte ich dann die Schulden bezahlt? Und die Verpflichtungen waren schrecklich angewachsen.
Ich ging also fort, allein den Tod in der Seele. Ans Ausland habe ich nicht geglaubt, d. h. ich war überzeugt, der geistige Einfluss des Auslandes werde ein sehr schädlicher sein. Allein, ohne Material, mit einem jungen Geschöpf, das sich mit naiver Freude anschickte, mein Wanderleben zu teilen — ich aber sah in dieser naiven Freude viel Unerfahrenheit und erste Glut, und das bedrückte und quälte mich sehr. Ich fürchtete, Anna Grigorjewna werde sich in dieser Zweisamkeit mit mir langweilen; auch sind wir ja bis heute mitsammen ganz allein. In mich aber setzte ich keine Hoffnungen: mein Wesen ist krankhaft, und ich sah voraus, dass sie sich mit mir abquälen werde. (NB. Allerdings hat sich Anna Grigorjewna als stärker und tiefer erwiesen, als ich sie gekannt und vermutet hatte, und in vielen Fällen war sie mir geradezu ein Schutzengel; dabei war aber auch viel Kindliches, Zwanzigjähriges, das wunderschön und natürlich unvermeidlich ist, dem zu entsprechen ich aber kaum die Kraft und Fähigkeit habe. Alles dieses hat mir bei der Abreise vorgeschwebt, und obwohl, ich wiederhole es, Anna Grigorjewna sich kräftiger und trefflicher erwies, als ich gedacht hatte, so bin ich dennoch, auch heute, nicht beruhigt.) Endlich bedrückte mich die Kargheit unserer Mittel. Wir reisten mit einer durchaus nicht grossen Barschaft und mit einer Vorschuss-Schuld von 3000 Rubel an Katkow ab. Ich rechnete allerdings damit, dass ich im Auslande sofort zu arbeiten beginnen würde. Was aber kam heraus? Ich habe bis jetzt nichts oder nahezu nichts geleistet und mache mich erst jetzt ernstlich und endgiltig an die Arbeit. Freilich, darüber, ob ich gar nichts gethan habe, bin ich noch im Zweifel; dafür hat man viel durchempfunden und manches ersonnen; aber Niedergeschriebenes, Schwarz auf Weiss ist noch wenig da, dieses Schwarz auf Weiss aber ist ja das Endgiltige, das allein wird bezahlt. Nachdem wir das langweilige Berlin so schnell als möglich hinter uns gelassen — wo ich mich einen Tag aufhielt, wo die langweiligen Deutschen es zuwege brachten, meine Nerven bis zur Bosheit zu reizen, und wo ich das russische Bad besuchte — gingen wir nach Dresden, mieteten eine Wohnung und setzten uns auf einige Zeit fest.
Die Wirkung davon war für mich eine sehr seltsame: sofort warf sich mir die Frage auf: wozu bin ich in Dresden, gerade in Dresden und nicht anderswo, und was zwang mich gerade dazu, alles an einem Orte zu verlassen und nach einem anderen zu fahren? Die Antwort war ja klar (Gesundheit, Schulden usw.); allein das Erbärmliche war auch das, dass ich es zu deutlich empfand, dass es für mich jetzt, wo immer ich auch leben mochte, ganz gleich sei — ob in Dresden oder anderswo. Überall war ich in der Fremde, überall ein abgerissenes Bruchstück. Ich wollte mich sofort an die Arbeit machen und fühlte, dass es damit durchaus nicht gehe, dass der Eindruck durchaus nicht der richtige sei. Ich las, ich schrieb einiges, war von Sehnsucht, dann von Hitze gequält — die Tage vergingen einförmig. Wir gingen regelmässig nach Tische im Grossen Garten spazieren, hörten billige Musik, dann lasen wir, dann gingen wir schlafen. In Anna Grigorjewna’s Charakter kam ein entschieden antiquarischer Zug zum Vorschein (das freut mich und unterhält mich sehr). Es ist z. B. ihre Hauptbeschäftigung, irgend welche dumme Rathäuser zu besichtigen, sie zu verzeichnen, zu beschreiben, was sie mit ihren stenographischen Zeichen ausführt und womit sie schon sieben Büchlein vollgeschrieben hat. Aber mehr als alles hat sie die Galerie eingenommen und aufgeregt, und ich war sehr erfreut darüber, weil dadurch in ihrer Seele zu viele Eindrücke entstanden sind, um Langweile aufkommen zu lassen. Sie hat die Galerie täglich besucht.
Soviel wir aber auch über alle die Unseren, über die Petersburger und die Moskauer gesprochen und debattiert haben, über Sie und Anna Iwanowna — es war teilweise doch recht trübselig. Meine Gedanken will ich Ihnen nicht beschreiben. Viele Eindrücke haben sich aufgespeichert. Ich habe russische Zeitungen gelesen und mir damit das Herz erleichtert. Da habe ich’s endlich empfunden, dass sich in mir genug Material angesammelt hatte für einen ganzen Artikel über das Verhalten Russlands Europa gegenüber und über die oberste Schichte der russischen Gesellschaft. Aber, was soll man davon reden! Die Deutschen haben mich nervös gemacht, unser russisches Leben der höheren Kreise aber mit ihrem Glauben an Europa und die Zivilisation — ebenfalls. Die Vorgänge in Paris waren ein Schlag für mich. Auch die guten Pariser Advokaten schrieen: Vive la Pologne! Puh! wie abscheulich, namentlich wie dumm und wie wohldienerisch! Ich habe mich in meiner früheren Idee nur noch bestärkt, dass es für uns teilweise sogar vorteilhaft ist, dass uns Europa nicht kennt und so schlecht kennt. Die Details aber des Prozesses Berezowski! Wie viel fauler Schleppträgerei! Aber die Hauptsache, die Hauptsache ist — wie wenig sind sie mit ihren Reden noch weiter gekommen, wie ist alles noch auf demselben Fleck, alles auf demselben Fleck!
Auch Russland erscheint unsereinem von hier aus plastischer, das ungewöhnliche Faktum der Mündigkeit und unerwarteten Reife des russischen Volkes angesichts all unserer Reformen (sei es auch nur die der Gerichtsbarkeit), und gleichzeitig die Kunde von dem durch den Kreisrichter des Orenburger Gouvernements durchgeprügelten Kaufmann erster Gilde! Eines fühlt man: dass das russische Volk dank seinem Wohlthäter und dessen Reformen nach und nach in eine solche Lage gekommen ist, dass es unwillkürlich Thatkraft, selbständiges Sehen erlernt, und darin liegt die ganze Kunst. Bei Gott, die heutige Zeit ist, was den Durchbruch und die Reformen anlangt, fast wichtiger als die Zeiten Peters. Und die Eisenbahnen? So schnell als möglich nach dem Süden, so schnell als möglich[25]; darauf kommt alles an. Bis dahin überall die rechte Gerichtsbarkeit, und dann, was für eine grosse Wiedergeburt! (Über all dieses denkt man hier nach, träumt man, über all dieses schlägt einem das Herz.) Obwohl ich hier fast mit niemand verkehre, kann man doch nicht umhin, manchmal unversehens auf jemand zu stossen.
In Deutschland begegnete mir ein Russe, der ständig im Auslande lebt, alljährlich auf drei Wochen nach Russland reist, seine Einkünfte einstreicht und wieder nach Deutschland zurückkehrt, wo er Frau und Kinder hat, die alle germanisiert sind. Ich fragte ihn unter anderem: warum er sich eigentlich expatriiert habe? Er antwortete wörtlich (mit gereizter Heftigkeit): „hier ist Zivilisation, bei uns aber Barbarei. Ausserdem giebt es hier keine Nationalitäten. Ich sass gestern im Coupé und konnte den Franzosen nicht vom Engländer oder vom Deutschen unterscheiden.“
„Das ist also, nach Ihrer Meinung, Fortschritt?“
„Wie denn nicht, natürlich!“
„Ja wissen Sie, dass das vollkommen unrichtig ist? Der Franzose ist vor allem Franzose, der Engländer — Engländer, nur sie selbst zu sein ist ihr höchstes Ziel, ja noch mehr, es ist das eben ihre Kraft.“
„Durchaus nicht. Die Zivilisation muss alles ausgleichen, und wir werden erst dann glücklich sein, wenn wir vergessen werden, dass wir Russen sind und jeder allen ähnlich sein wird. Man darf nicht auf Katkow hören!“
„Sie also lieben Katkow nicht?“
„Er ist ein Nichtswürdiger!“
„Warum?“
„Weil er die Polen nicht liebt.“
„Lesen Sie sein Journal?“
„Nein, ich lese es niemals.“
Dieses Gespräch gebe ich buchstäblich wieder, dieser Mensch gehört zu den jungen Progressisten, hält sich aber übrigens, wie es scheint, abseits von allen anderen. In was für knurrigen und verachtenden Spitzigkeiten bewegen sie sich doch im Auslande!
Er teilte mir mit, dass er ein endgiltiger Atheist sei. Aber du mein Gott: der Deismus hat uns Christum geschenkt, d. h. eine so erhabene Vorstellung des Menschen, dass man ihn nicht ohne Andacht begreifen kann, und dass man nicht anders kann, als glauben, dies sei das Ideal der Menschheit für alle Ewigkeit. Sie aber — —[26] haben sie uns hingestellt? Anstatt der höchsten göttlichen Schönheit, auf welche sie spucken, sind sie alle so niedrig, selbstsüchtig, so schamlos aufreizend, so leichtfertig, hochmütig, dass es unverständlich ist, was sie erhoffen und was ihnen nachfolgen wird. Russland und die Russen hat er abscheulich, unanständig geschmäht. Was ich aber beobachtet habe ist dies: alle diese Liberälchen und Progressisten, namentlich jene, die noch aus der Schule Belinskys sind, halten es für ihr vornehmstes Vergnügen und ihre grösste Befriedigung, über Russland loszuziehen. Der Unterschied liegt darin, dass die Nachfolger ......s einfach Russland schmähen und ihm offen den Zusammenbruch wünschen (vor allem den Zusammenbruch!) Diese Ableger aber fügen hinzu, dass sie Russland lieben. Dabei aber ist ihnen nicht nur alles, was nur in Russland halbwegs selbständig ist, verhasst, so dass sie es ablehnen und mit Lust in Karikatur verwandeln, vielmehr, wenn man ihnen thatsächlich ein Faktum vorlegte, das man auf keine Weise leugnen oder in eine Karikatur verstümmeln könnte, sondern mit dem man unbedingt einverstanden sein müsste, so würden sie, meine ich, bis zum Schmerz, zur Qual, bis zur Verzweiflung unglücklich sein. Zweitens habe ich bemerkt, dass sie (wie alle, welche lange Zeit nicht in Russland gewesen sind) entschieden die Thatsachen nicht kennen (obwohl sie Zeitungen lesen) und so gröblich jedes Empfinden Russlands verloren haben, dass sie ganz gewöhnliche Fakten nicht begreifen, die unser russischer Nihilist nicht einmal leugnet, sondern nur in seinem Sinne karikiert. Unter anderem hat er gesagt, dass wir vor den Deutschen kriechen sollten, dass es nur einen allen gemeinsamen und unausweichbaren Weg gebe: die Zivilisation, und dass alle Anläufe zum Russismus und zur Selbständigkeit — Schweinerei und Dummheit sind ....
Endlich plagte sowohl mich als Anna Grigorjewna die Unruhe und Beklemmung in Dresden allzusehr. Dazu kamen hauptsächlich zwei Fakten: 1. Nach Briefen, welche mir Pascha einsandte (er hatte mir nur einmal geschrieben), zeigte es sich, dass die Gläubiger die Klage eingereicht hatten; folglich war an eine Rückkehr vor der Tilgung nicht zu denken. 2. Fühlte meine Gattin sich in gesegneten Umständen (dies bitte ich, unter uns, die neun Monate werden im Februar voll, folglich kann man umsoweniger zurückkehren). 3. Was geschieht aber mit meinen Petersburgern, mit Emilie Fjodorowna (der Schwägerin), mit Pascha und einigen anderen? Geld. Geld! und es ist keines da. 4. Sollen wir irgendwo überwintern, so sei es im Süden. Dabei möchte man Anna Grigorjewna doch irgend was zeigen, sie zerstreuen, mit ihr ein wenig reisen. Wir haben beschlossen, irgendwo in der Schweiz oder in Italien den Winter zuzubringen. Dabei kein Geld! Das Vorausgenommene ist schon sehr stark geschmolzen. Ich habe an Katkow geschrieben, ihm die ganze Lage auseinandergesetzt und ihn abermals um 500 Rubel Vorschuss gebeten. Wie denken Sie? er hat’s geschickt! Was ist das für ein vortrefflicher Mensch! Ein Mann von Herz! Wir sind in die Schweiz aufgebrochen. Aber hier muss ich meine Niedrigkeiten und Laster erzählen.
Apollon Nikolaewitsch, mein Täubchen, ich fühle, dass ich Sie als meinen Richter ansehen kann. Sie sind ein Mann von Herz, wovon ich mich schon lange überzeugt habe; und endlich habe ich Ihr Urteil immer hochgeschätzt. Es ist mir nicht schmerzlich, mich vor Ihnen schuldig zu bekennen. Aber ich schreibe dies nur an Sie allein. Geben Sie mich dem Urteil der Menschen nicht preis! An Baden-Baden vorüberkommend fiel es mir ein, mich dahin zu wenden. Es verfolgte mich der lockende Gedanke, 10 Louisd’ors zu wagen, um vielleicht 2000 Frcs. als Zugabe zu gewinnen, das wäre ja dann genug auf vier Monate, um mit allem und allen Petersburgern zu leben; das schlimmste war, dass ich auch früher schon manchmal gewonnen hatte, und das allerschlimmste, dass meine Natur niedrig und allzu leidenschaftlich ist. Überall und in allem gehe ich bis an die äusserste Grenze, mein ganzes Leben habe ich das Mass überschritten. Der Teufel hat dann auch sofort ein Stückchen mit mir aufgeführt: In drei Tagen gewann ich mit ungewöhnlicher Leichtigkeit 4000 Frcs. Jetzt will ich Ihnen erklären, wie sich mir nun alles darstellte. Von der einen Seite dieser leichte Gewinnst — von 100 Frcs, in drei Tagen 4000 —, von der anderen Seite — Schulden, Klageschriften, seelische Unruhe, die Unmöglichkeit nach Russland zurückzukehren. Endlich drittens, die Hauptsache — das Spiel selbst. Wissen Sie, wie Einen das hineinzieht? Nein, ich schwöre es Ihnen, da ist nicht Habgier im Spiele, obwohl mir vor allem Geld um Geldeswillen nötig war. Anna Grigorjewna beschwor mich, ich solle mich mit den 4000 Frcs. zufrieden geben und sofort abreisen. Aber eine so leichte und mögliche Möglichkeit, alles zu reparieren! Und welche Beispiele! Ausser dem eigenen Gewinnst siehst Du täglich, wie andere zu 20 und 30000 Frcs, einziehen. (Die Verlierenden siehst Du ja nicht.) Wodurch haben sie’s verdient? Mir ist das Geld nötiger als ihnen. Ich riskierte also weiter und verlor. Ich fing an mein Letztes zu verlieren, wurde aufgeregt bis zum Fieber — und verlor. Ich fing an die Kleider zu versetzen: Anna Grigorjewna versetzte all ihre Habe, die letzten Sächelchen (welch ein Engel! wie tröstete sie mich, wie quälte sie sich in dem verfluchten Baden in den zwei Stübchen über der Schmiede, wohin wir übersiedelt waren!). Endlich war’s genug — alles war verloren. Endlich musste man sich retten und von Baden fortkommen. Ich schrieb abermals an Katkow, bat abermals um 500 Rubel (ohne der Umstände zu erwähnen; allein der Brief war aus Baden datiert, und so ahnte er wohl etwas). Nun, und er hat’s ja geschickt! Hat’s geschickt! So sind also jetzt 4000 vom „Russkij Wjestnik“ vorausgenommen!“
Im weiteren Verlauf des Briefes rechnet Dostojewsky dem Freunde die Auslagen vor und kommt zur Schlussmitteilung, dass sie in Genf angekommen seien, bei zwei alten Frauen Quartier genommen haben und nun am vierten Tage ihres Aufenthalts 18 Francs in der Tasche und weitere 50 Rubel für die zwei nächsten Monate in Aussicht haben. Nun folgt einer jener bekannten kindlich schlauen Feldzugspläne, die wir in seinen ausführlichen Briefen immer schon kommen sehen, die uns Rührung und Lächeln zugleich abgewinnen über des Dichters Menschliches und Allzumenschliches! In einem Briefe vom 15. September an denselben Freund erwähnt er, dass dessen 125 Rubel sie gerettet haben.
Doch beklagt sich Theodor Michailowitsch sehr über seine Gesundheit, welcher das Klima schade, da er jeden zehnten Tag ungefähr einen Anfall habe, nach welchem er sich fünf Tage nicht erholen könne. Schliesslich folgende Stelle: „Habe ich Ihnen schon über den hiesigen Friedenskongress geschrieben? Ich habe in meinem Leben nicht nur keinen solchen Unsinn gesehen oder gehört, sondern nicht einmal angenommen, dass die Menschen solcher Dummheit fähig wären. Alles war dumm: wie sie sich vereinigten, wie sie die Sache durchführten und wie sie die Entscheidung trafen. Natürlich hatte ich schon früher keinen Zweifel darüber, dass ihr erstes Wort Zank sein werde. So geschah es auch. Sie fingen mit dem Antrag an, man möge votieren, dass grosse Monarchieen überflüssig seien und dass man lauter kleine daraus machen solle; dann: dass es keinen Glauben zu geben brauche usw. Es gab vier Tage Geschrei und Geschimpfe: Wir aber, bei uns zu Hause, wenn wir die Erzählungen davon lesen und hören, sehen wahrlich alles verkehrt. Nein mit eigenen Augen solltet Ihr schauen, mit eigenen Ohren hören.“ Über Genf, seine ungünstigen klimatischen Verhältnisse und deren Rückschlag auf seine Gesundheit drückt sich Theodor Michailowitsch in einem Briefe vom 21. Oktober geradezu verzweifelt aus. Im Zornausbruch sagt er: „Und was sind das für selbstzufriedene Prahlhänse! Das ist ja ein Zeichen besonderer Dummheit, mit allem so zufrieden zu sein! Alles ist hier hässlich, faul, teuer, Alles ist hier betrunken! So viele Renommisten und so viele betrunkene Schreiliesen giebt es sogar in London nicht. Und alles bei ihnen, jeder Pfosten — ist herrlich und grossartig. „Wo ist die Rue N. N.?“ — „Voyez monsieur, vous irez tout droit, et quand vous passerez près de cette majestueuse et élégante fontaine en bronze, vous prendrez etc.“ — Diese majestueuse élégante fontaine — ist der allerhinfälligste, geschmackloseste Rococo-Quark; aber man kann nicht anders, als sich brüsten, wenn Einer nur um die Strasse fragt usw.“
Nun finden wir eine grosse Lücke in der Korrespondenz. Der nächste Brief an Maikow ist nach einem Zeitraum von sechs Monaten geschrieben. In diese Zeit fällt die Geburt Sonjas, des Kindes, welches das Ehepaar so sehr beglückt haben muss, wie wir aus dem tiefen Schmerz über ihren drei Monate später erfolgten Tod ersehen. Eine Reihe intimer Briefe aus jener Zeit ist teilweise in Verlust geraten, zum Teil nicht aus der Hand gegeben worden. In dem rein geschäftlichen Briefe vom 21. April 1868 wird nur an einer Stelle des Kindes erwähnt: „Einzig und allein das Kind zerstreut uns beide, — aber es ist eine quälende Freude — wenn Du in die Zukunft blickst — ach!“
Am 18. Mai aber beherrscht der eben erlittene Verlust des Kindes schon den ganzen Brief. „Meine Sonja ist gestorben, vor drei Tagen haben wir sie begraben. Zwei Stunden vor ihrem Tode habe ich es nicht gewusst, dass sie sterben wird; der Arzt hatte drei Stunden vor der Katastrophe gesagt, dass ihr besser sei und dass sie leben werde. Sie war im ganzen eine Woche krank — eine Lungenentzündung war’s. Ach, Apollon Nikolaewitsch! mag doch meine Liebe zu meinem ersten Kindchen lächerlich gewesen sein, mag ich mich doch lächerlich in meinen vielen Antwortschreiben auf die Glückwünsche darüber ausgedrückt haben! Es war ja nur ich, der für sie lächerlich war, aber Ihnen, Ihnen zu schreiben fürchte ich mich nicht. Dieses winzige, drei Monate alte Wesen, so armselig, so klein — für mich war es schon eine Persönlichkeit und ein Charakter. Sie fing schon an, mich zu erkennen, lieb zu haben, sie lächelte, wenn ich auf sie zukam. Wenn ich ihr mit meiner komischen Stimme Lieder sang, so liebte sie ihnen zu lauschen. Sie hat nie geweint oder das Gesichtchen verzogen, wenn ich sie küsste; sie hat zu weinen aufgehört, wenn ich zu ihr trat. Und nun sagen sie mir zum Troste, ich würde noch andere Kinder haben. Wo aber ist Sonja? Wo ist diese winzige Persönlichkeit, um derentwillen ich, offen spreche ich’s aus, die Kreuzmarter auf mich nähme, wenn sie nur leben würde? Nun — lassen wir das, meine Frau weint. Übermorgen werden wir uns endlich von unserem kleinen Grabhügel trennen und irgend wohin fortfahren. Anna Nikolajewna (Anna Grigorjewnas Mutter) ist mit uns. Sie ist eine Woche vor des Kindes Tode gekommen.“
„Die letzten vierzehn Tage, seit dem Beginn von Sonjas Krankheit, habe ich gar nicht arbeiten können. Abermals habe ich eine Entschuldigung an Katkow geschrieben, und im Maiheft des „Russkij Wjestnik“ werden abermals nur drei Kapitel erscheinen. Allein, ich hoffe jetzt Tag und Nacht ununterbrochen arbeiten zu können, und vom Juniheft angefangen wird der Roman wenigstens anständig erscheinen.“ (Es handelt sich um den „Idiot“.)
Im nächsten Brief, der vom 22. Juni aus Vevey an Maikow gerichtet ist, entschuldigt sich der Dichter über sein langes Schweigen damit, dass er trotz vieler Anfälle und grosser Erschöpfung thatsächlich Tag und Nacht gearbeitet habe. Wieder auf seinen Verlust zurückkommend sagt er noch einmal: „Niemals bin ich unglücklicher gewesen, als in dieser ganzen letzten Zeit. Ich will Ihnen nichts beschreiben, aber je mehr die Zeit vorschreitet, umso brennender ist die Erinnerung, und desto lebendiger stellt sich mir das Bild der verstorbenen Sonja vor die Augen. Es giebt Minuten, die ich nicht ertragen kann. Sie hat mich schon gekannt, sie hat mich an ihrem Todestage — als ich aus dem Hause ging, um die Zeitungen zu lesen, ohne zu ahnen, dass sie in zwei Stunden sterben würde — da hat sie mir so mit ihren Äuglein nachgeschaut, dass ich es bis jetzt, und immer deutlicher und deutlicher sehe. Nie werde ich das vergessen und niemals werde ich aufhören, mich darüber zu quälen! Wenn auch ein anderes Kind da sein wird, so begreife ich nicht, wie ich es lieben werde, wo ich Liebe dafür aufbringe, ich brauche Sonja! Ich kann nicht begreifen, dass sie nicht da ist und ich sie niemals mehr sehen werde.“
In einem Anfalle seines alten Zweifels, ob man auf ihn „nicht böse sei“, schreibt er am 19. August nach einer Klage darüber, dass er keine Antwort erhalten habe: „Dafür giebt es wohl zwei Gründe: 1. Sie sind auf mich über etwas böse geworden, 2. es ist entweder mein Brief oder der Ihre in Verlust geraten.“
„Ich glaube um keinen Preis an die erste Ursache: Ihr Brief (der letzte, vom Mai) war so, dass ich nicht begreifen kann, dass es möglich wäre, nach so herzlichen Gefühlen gegen mich, plötzlich wieder böse auf mich zu werden, und darum glaube ich blind, dass mein Brief in Verlust geraten ist. Die Petersburger Polizei öffnet und liest alle meine Briefe, und da der Genfer .... allen gegebenen Daten nach (bemerken Sie wohl, nicht Annahme, sondern Daten) bei der geheimen Polizei Dienste leistet, so sind auch im hiesigen (Genfer) Postamte, mit welchem er in geheimer Verbindung steht — wie ich sicher weiss — einige meiner Briefe zurückgehalten worden. Schliesslich habe ich ein anonymes Schreiben erhalten, das mir mitteilt, ich werde verdächtigt (weiss der Teufel wessen verdächtigt), und dass befohlen worden sei, meine Briefe zu eröffnen und mich an der Grenze zu erwarten, wenn ich sie passiere, um mich unvermutet und strengstens zu visitieren. Darum glaube ich fest, dass Ihnen entweder mein Brief nicht zukam oder der Ihrige verloren ist. (NB. Aber wie soll ein reiner Mensch, ein Patriot, der sich ihnen bis zur Abwendung von seinen früheren Überzeugungen hingegeben hat, der den Kaiser vergöttert — wie soll er Verdächtigungen etwa einer Beziehung zu irgend welchen Polaken oder dem Kolokol[27] ertragen ...! Unwillkürlich sinken einem da die Hände, die ihnen dienen wollten. Wen haben sie nicht alles von den Schuldigen bei uns übersehen, und den Dostojewsky verdächtigen sie!)“
An einer anderen Stelle dringt es doch hervor, dass Dostojewsky dieses „Nichtglauben an das böse sein“ mehr als Festigung für sich gesagt habe, denn als einen Ausfluss wirklichen Vertrauens. Er sagt: „Apollon Nikolajewitsch, mein Freund (Sie selbst haben mich Ihren Freund genannt), wie schwer war es mir manchmal in jener Zeit, bei dem Gedanken, dass Sie böse auf mich sind!
Schreiben Sie also, schreiben Sie in beiden Fällen: sind Sie böse, so erklären Sie die Ursachen, und sind Sie es nicht, so schreiben Sie, dass Sie mich lieben.“
Diese Stelle bedarf wohl keines Kommentars, sie ist Kommentar für vieles im Leben und in den Werken des Dichters.
„Mit dem Roman“, fährt er fort, „bin ich unzufrieden bis zum Ekel. Ich habe mich furchtbar zur Arbeit angespannt, konnte aber nichts machen: Die Seele ist krank. Jetzt will ich die letzten Anstrengungen für den dritten Teil machen. Verbessere ich den Roman — erhole ich mich selbst; wenn nicht, bin ich verloren. Ich bin diese ganze Zeit unglücklich gewesen. Sonjas Tod hat mich sowohl als meine Frau heruntergebracht. Meine Gesundheit ist nicht gut: Anfälle, das Klima von Vevey verstimmt die Nerven“, hiess es an anderer Stelle. —
Der nächste Brief, ebenfalls an Maikow gerichtet, ist schon vom 7. Oktober aus Mailand datiert. Nach einigen Entschuldigungen über sein längeres Schweigen kommt Theodor Michailowitsch auf seine Furcht eines Missverständnisses zu sprechen, die übrigens auch Maikow seinerseits zu teilen scheint. Dies redet er jenem aus: „Nein, mein Herz ist anders geartet, und sehen Sie, wir haben einander vor 22 Jahren kennen gelernt (zuerst bei Belinsky, erinnern Sie sich?). Seit jener Zeit hat mich das Leben viele Male hierhin und dorthin geschleudert und mich mit seinen Variationen manchmal verblüfft, zuletzt aber, jetzt in diesem Augenblick — sind ja nur Sie da, d. h. der einzige Mensch, an dessen Herz und Seele ich glaube, den ich liebe und mit dessen Ideen und Überzeugungen die meinigen in eins verschmolzen sind. Kann es denn anders sein, als dass Sie mir fast so teuer sind, als mein verstorbener Bruder? Ihre Briefe haben mich erfreut und ermutigt; denn mein Seelenzustand ist ein sehr trauriger. Auch hat mich vor allem die Arbeit gequält und erschöpft. Es ist schon fast ein Jahr, dass ich 3½ Druckbogen im Monat schreibe. Das ist schwer. Dabei nichts von russischem Leben, nichts von russischen Eindrücken ringsherum; für meine Arbeit war das aber von jeher unentbehrlich. Endlich, wenn Sie auch die Idee meines Romans loben, seine Ausführung war bis jetzt nicht eine glänzende. Es quält mich der Gedanke sehr, dass, könnte ich einen Roman voraus, etwa ein Jahr voraus schreiben, und hätte dann zwei bis drei Monate zu Reinschrift und Korrekturen vor mir, ganz etwas anderes herauskäme — dafür stehe ich gut. Jetzt, da mir das alles klar geworden ist, sehe ich es deutlich.“
Weiter heisst es dann: „Mein hiesiges Leben wird mir schon allzu schwer. Gar nichts Russisches, nicht ein Buch, nicht eine Zeitung habe ich nun schon volle sechs Monate zu Gesicht bekommen; dazu völlige Vereinsamung. Im Frühling, als wir Sonja verloren hatten, übersiedelten wir nach Vevey, dorthin kam auch Anna Grigorjewnas Mutter zu uns. Allein Vevey reizt die Nerven. Gegen das Ende unseres dortigen Aufenthalts erkrankte sowohl meine Frau als auch ich selbst. Und nun sind wir vor zwei Monaten über den Simplon nach Mailand gekommen. Hier ist das Klima besser, aber das Leben ist teurer, es regnet viel und ausserdem — tötliche Langweile. Anna Grigorjewna ist geduldig, doch sehnt sie sich nach Russland, und wir beide weinen um Sonja. Wir leben trübselig und klösterlich. Anna Grigorjewnas Charakter ist empfänglich, thätig; hier kann sie sich mit nichts beschäftigen. Ich sehe, dass sie sich grämt, und obwohl wir einander fast noch mehr lieben, als vor 1½ Jahren, so drückt es mich doch, dass sie mit mir in einer so traurigen Abgeschiedenheit lebt. Das ist sehr schwer zu tragen. In der Perspektive steht weiss Gott was. Wenn wenigstens der Roman vollendet wäre, so wäre ich freier. Nach Russland zurückkehren, daran ist schwer zu denken — keinerlei Mittel. Das heisst soviel als: hinkommen und in den Schuldenarrest hineinfallen. Aber dort bin ich ja nicht mehr ein Arbeitsmensch. Gefängnis ertrage ich infolge meiner Epilepsie nicht, folglich werde ich im Gefängnis auch nicht arbeiten. Womit werde ich dann anfangen die Schulden zu tilgen, und wovon werde ich leben? Wenn mir die Gläubiger ein Jahr Ruhe liessen — sie haben mir aber durch drei Jahre keinen ruhigen Moment gelassen —, so würde ich dazu kommen, ihnen nach einem Jahre durch meine Arbeit die Schuld abzutragen. Wie bedeutend auch meine Schulden sind, so sind sie doch nur ein Fünftel dessen, was ich schon mit meiner Arbeit abgezahlt habe. Ich bin ja auch fortgefahren, um zu arbeiten. Und nun hat die Idee des „Idioten“ Sprünge bekommen. Wenn er auch einen gewissen Wert hat oder haben wird, so ist wenig Effekt darin; Effekt aber ist für die zweite Auflage unumgänglich notwendig, auf die ich noch vor wenigen Monaten blind rechnete und die etwas Geld eintragen könnte. Jetzt, da der Roman noch nicht einmal vollendet ist, ist an eine zweite Auflage gar nicht zu denken. Käme ich nach Russland, wüsste ich, woran ich arbeiten und Geld verdienen sollte; hab’ ich doch seinerzeit genug verdient! Hier aber werde ich stumpf, begrenzt, entferne mich im Geiste von Russland; keine russische Luft, keine Menschen! Die russischen Emigranten endlich, die kann ich schon gar nicht begreifen, das sind — Wahnsinnige.
Das ist also die Lage, in der wir uns befinden. In Mailand aber zu bleiben ist auch unmöglich. Wir wollen in einem Monat nach Florenz übersiedeln, dort werde ich auch den Roman beendigen. Geld bekomme ich immer noch von Katkow. Es ist schrecklich, was wir en tout verbrauchen, obwohl wir uns furchtbar einschränken. Bald, mit der Vollendung des Romans, endet auch, das versteht sich, die Geldeinnahme von Katkow. Dann: abermals Plackerei und Sorge. Indessen ist doch meine Schuld an Katkow, wenn man sie mit dem zusammenrechnet, was ich zuerst vorausgenommen, jetzt bedeutend verringert.
Ihrem Leben bin ich ganz entfremdet, obwohl mein ganzes Herz bei Ihnen weilt und Ihre Briefe mir wahre Himmelsmanna sind. Ich habe mich über die Nachricht von einem neuen Journal überaus gefreut. Ich habe niemals etwas von Kaschpirew gehört, bin aber sehr froh, dass Nikolai Nikolajewitsch (Strachow) endlich eine seiner würdige Beschäftigung findet. Gerade er muss Redakteur sein und darf sich nicht auf irgend ein Ressort in der neuen Zeitschrift beschränken, sondern soll die Seele des Ganzen sein. In diesem Falle wird die Sache Zukunft haben. Jetzt also, was kann es jetzt besseres für Nikolai Nikolajewitsch geben? Die Hauptsache ist, dass er an seinem Ort frei schalten kann.
Es wäre sehr wünschenswert, dass die Zeitschrift unbedingt im russischen Geiste gehalten sei — so wie Sie und ich das verstehen —, wenn auch, sagen wir, nicht im rein slavophilen Geiste. Nach meiner Meinung, lieber Freund, brauchen wir den Slaven nicht allzuviel nachzulaufen, eben nicht allzu sehr. Sie müssen zu uns kommen. Nach dem Panslavisten-Kongress in Moskau haben nämlich viele von ihnen, als sie nach Hause kamen, über die Russen von oben herab darüber gewitzelt, dass sie sich daran gemacht haben, andere zu führen und gleichsam den Slaven zu imponieren; dabei sei bei ihnen selbst wenig zu finden und welch ein Mangel an Selbsterkenntnis usw. Und glauben Sie mir, dass viele von den Slaven, in Prag z. B., uns vollständig vom westlichen, vom deutschen, vom französischen Standpunkt aus beurteilen und sich vielleicht sogar darüber verwundern, dass sich bei uns die Slavophilen wenig um die allgemein angenommenen Formen der abendländischen Civilisation bekümmern. Was sollen wir also hinter den Slaven her sein? Sie studieren — das ist eine andere Sache; auch ihnen helfen. Aber sich zur Verbrüderung hinzwängen, ist nicht nötig; ich meine nur: sich hinzwängen; denn: sie als Brüder betrachten und an ihnen brüderlich handeln, das sollen wir unbedingt.
Auch hoffe ich sehr, dass Nikolai Nikolajewitsch der Zeitschrift auch eine politische Schattierung verleihen wird — von Selbsterkenntnis gar nicht zu reden. Selbsterkenntnis — das ist unsere lahme Stelle, die brauchen wir. In jedem Falle wird es Nikolai Nikolajewitsch glänzend machen, und ich bereite mich mit unersättlicher Lust darauf vor, seine Artikel zu lesen, die ich so lange, seit der „Epocha“ nicht gelesen habe. Es wäre gut, wenn sich das Blatt von vorn herein so unabhängig als möglich machte, besonders in der Litteratur, so dass es z. B. 2000 Rubel für Sachen im Genre „Minin“ oder anderer historischer Dramen von Ostrowskij zahlte; wenn er nun gar Kaufmanns-Komödien hergiebt, so kann man sie auch bezahlen. Mit einem Wort: die Litteratur müsste man, nach meiner Meinung endlich in die Hand nehmen und nicht nur den Namen bezahlen, sondern lediglich das Werk — was bis heute noch keine Zeitschrift zu thun gewagt hat, „Wremja“ und „Epocha“ nicht ausgenommen. Ohne vortreffliche Arbeit aber in den ersten zwei Nummern einer Zeitschrift darf man sie gar nicht herausgeben; das heisst gleich anfangs tausend Abonnenten fallen lassen.“
Der nächste Brief ist aus Florenz vom 11. Dezember 1868 datiert und sehr eilig und geschäftsmässig geschrieben. Über den „Idiot“ finden sich folgende Stellen darin: „Ich habe mich entschlossen, für das Dezemberheft alles fertig zu machen, sowohl den vierten Teil als den Schluss; mit dem Vorbehalt jedoch, dass das Heft etwas später erscheine. Aber ich werde von heute an sieben Druckbogen in vier Wochen schreiben müssen. Ich habe plötzlich erkannt, dass ich imstande bin, das zu thun, ohne den Roman sehr zu verderben. Dazu kommt, dass alles, alles übrige schon mehr oder weniger aufgezeichnet ist und ich jedes Wort auswendig weiss. Wenn der „Idiot“ Leser hat, so werden diese vielleicht durch das Unerwartete des Schlusses ein wenig betroffen sein. Allein nach einigem Nachdenken werden sie zugeben, dass ich es so ausgehen lassen musste. Überhaupt ist dieser Schluss einer der gelungenen, d. h. als Schluss betrachtet. Ich spreche nicht über den Wert des Romans im besonderen; aber wenn ich damit fertig sein werde, schreibe ich Ihnen als Freund eines oder das andere darüber, was ich selbst davon denke.“
In demselben Briefe finden wir weiter unten die Darlegung neuer Roman-Entwürfe, zu deren Ausarbeitung in der gedachten Form es nie gekommen ist. Da heisst es: „Die verfluchten Gläubiger werden mich endgiltig umbringen — dumm hab ich’s gemacht, dass ich ins Ausland ging; wahrlich, besser wäre es gewesen, im Schuldenarrest eine Weile zu sitzen. Könnte ich mich nur mit ihnen einigen! Aber auch das kann ich nicht, weil ich persönlich nicht dort bin. Ich sage das hauptsächlich darum, weil ich zwei, sogar drei Werke im Kopfe habe, welche weiter nichts als einer ochsenhaften, mechanischen Arbeit bedürften und dabei unbestreitbar Geld einbringen würden. Es ist mir solches ja schon manchmal gelungen.
Ich habe also jetzt im Kopf: Erstlich einen grossen Roman; sein Name ist „Atheismus“. Ehe ich mich aber an ihn machen kann, muss ich fast die ganze Bibliothek der Atheïsten, der Katholiken und der Orthodoxen durchlesen. Er wird auch bei voller Arbeitsruhe nicht vor zwei Jahren fertig werden. Die Hauptperson habe ich: ein Russe unserer Gesellschaft, schon bei Jahren, nicht sonderlich gebildet, aber auch nicht ungebildet, und nicht ohne Ehren und Würden. Plötzlich, da er schon bei Jahren ist, verliert er den Glauben an Gott. Sein ganzes Leben hat er nur mit seinem Dienst zu thun gehabt, ist niemals aus dem Geleise getreten und hat sich bis zu seinem 45. Lebensjahre durch nichts ausgezeichnet. (Psychologisches Problem: tiefes Gefühl, Mensch und Russe.) Der Verlust des Glaubens wirkt auf ihn kolossal (besonders sind im Roman Wirkung und Umstände — sehr bedeutend). Er huscht herum bei den Jungen, bei den Atheisten, bei Slavophilen und Europäern, bei Fanatikern, Einsiedlern und Priestern. Unter anderem fällt er sehr stark einem agitatorischen Jesuiten ins Garn, einem Polen; er sinkt von da in die Tiefe der Flagellanten und — am Ende findet er Christum und die russische Erde, den russischen Christus und den russischen Gott (um Himmelswillen, sagen Sie es niemand, aber bei mir ist es so: diesen letzten Roman schreibe ich — ja sterben will ich meinetwegen daran, aber — ich spreche mich ganz aus).
Ach! mein Freund! Ich habe ganz andere Begriffe von der Wirklichkeit und dem Realismus als unsere Realisten und Kritiker. Mein Realismus ist realer als der ihrige. Herrgott! Wenn man nur erzählte, was wir, wir Russen in den zehn letzten Jahren unserer geistigen Entwickelung durchlebt haben — würden da die Realisten nicht schreien, dass dies Phantasie ist? Indessen aber ist es wirklicher Ur-Realismus! Das ist ja eigentlich Realismus, nur tiefer, während er bei ihnen seicht einherfliesst. Mit ihrem Realismus wirst du nicht den hundertsten Teil der thatsächlichen Geschehnisse erklären. Wir aber mit unserem Idealismus haben sogar Fakten vorhergesagt. Es ist vorgekommen. Mein Täubchen, lachen Sie nicht über mein Selbstgefühl, aber ich bin wie — —: „lobt man mich nicht, so werde ich selbst mich loben“.
Indessen aber muss man leben. Den „Atheismus“ schleppe ich nicht zum Verkauf (über den Katholicismus und die Jesuiten im Verhältnis zur Orthodoxie habe ich aber manches zu sagen). Dann habe ich die Idee zu einer ziemlich grossen Erzählung, etwa zwölf Druckbogen, die mich sehr anzieht. Noch eine Idee hab’ ich. Zu was soll ich mich entschliessen und wem die Arbeiten anbieten?“
Wer erkennt nicht in diesen Andeutungen jene Urelemente Dostojewskyscher Aussprache, die wir zerstreut und anders verteilt in den Brüdern Karamasow wiederfinden, dem Roman, der thatsächlich das letzte Wort zu sagen anhebt, dabei der Dichter „meinetwegen sterben“ will. Eine sehr bemerkenswerte, hierauf bezügliche Stelle finden wir in des Dichters Tagebuch-Notizen aus dem Jahre 1880. Da heisst es: „Die Nichtswürdigen haben mich höhnend eines ungebildeten und rückschrittlichen Gottesglaubens geziehen. Diesen Tölpeln hat eine solche Kraft der Gottesleugnung gar nicht geträumt, wie sie in dem „Inquisitor“ und dem vorangehenden Kapitel niedergelegt ist und welchen der ganze Roman als Antwort dient. Nicht wie ein Dummkopf (ein Fanatiker) also glaube ich an Gott. Und diese Leute wollen mich belehren und lachen über meine mangelhafte Entwickelung! Ja, ihrer dummen Art hat auch nicht eine solche Kraft der Verneinung geträumt, wie ich sie durchgemacht habe. An ihnen ist’s, mich zu lehren!“
Zum Schluss des Briefes die kurze Stelle über Florenz. „Florenz ist schön, aber schon gar zu nass. Die Rosen im Garten „Boboli“ blühen bis heute im Freien. Und was für Schätze in den Galerien! Mein Gott, ich habe im Jahre 1863 die „Madonna della Sedia“ übersehen! Nun besehe ich mir alles seit einer Woche und habe sie erst jetzt erblickt. Aber ausser ihr, wie viel Göttliches! Allein ich habe alles bis zur Vollendung des Romans stehen gelassen.“
Wenn irgend etwas, so sind diese Briefe aus Italien Belege dafür, dass Dostojewsky, der grosse Dichter und Schöpfer ein Apostel war, aber kein „Kunstliebhaber“ und noch viel weniger ein Dilettant. Den europäischen Leser, den Wanderer durch Italiens Natur und seine Kunstschätze muss es merkwürdig berühren, in diesen Briefen nur kurze Andeutungen all des Herrlichen zu finden, das Dichter, Künstler und Liebhaber aller Länder der Erde begeistert, zu neuen Werken anspornt, ja ihnen neue Lebenswenden und Lebensrichtungen aufnötigt. Nichts von alledem bei Dostojewsky; ja, die ewige Klage: „fern von Russland keine Anregung, keine Arbeit möglich, entsetzliche Vereinsamung, Langweile, Heimweh“, sein Urthema findet hier keinen Resonanzboden, es sind nicht russische Menschen da, an welchen er es im Geiste zu variieren vermöchte. So sehen wir ihn kämpfen, leiden, schimpfen, inmitten einer Welt, die tausenden Geistern europäischer Kultur und Kunsttendenz Anregung zur Bethätigung in Ernst und Spiel verleiht. Ja, wer den Werken des Dichters kritisch nachspürt, wird darin neben dem Nichtlitteraturmässigen, das darin zu Tage tritt und dem Überreichtum an ethischen Inhalt entspringt, geradezu ein Ablehnen des Künstlerischen finden. Die Ursache beruht wohl vornehmlich in der Konzentration seines Wesens, das ihn wohl schöpferisch, aber nicht künstlerisch zu seinen Werken veranlasst; so ist denn auch seine Wirkung auf uns viel mehr eine menschliche Erschütterung, als eine ästhetische Anregung.
Ja, es ist, als schlösse die ganz eigenartige Entwickelung russischen Schriftwesens — heute wenigstens, da diese noch im Kampfe steht — das künstlerische Moment geradezu aus, so dass von den zwei grössten Künstlern der russischen Litteratur, Turgenjew und Tolstoj, der erste von seinen Landsleuten nicht eigentlich zu Russland gerechnet wird, der letztere sich selbst erst seit jener Epoche dazu rechnet, da er der künstlerischen Auffassung des Lebens den Rücken gekehrt hat. Wenn uns aber Dostojewsky oft und oft wiederholt, wie ganz anders er seine Werke ausarbeiten würde, wenn ihm des Lebens schwere Not Zeit und Ruhe dazu liesse, so müssen wir dies so verstehen, dass alle innere Realität noch feiner herausgearbeitet wäre, alle tiefen, geheimnisvollen Beziehungen der Menschenseele zu sich selbst und ihrer Wahrheit noch urgründlicher uns aufgeschlossen würden. Allein die Gegenständlichkeit der äusseren Welt und ihre Anordnung um die inneren Geschehnisse, das Bildliche der Umgebung, die physische Zeit, kurz alles Sinnliche, das zur Kunst gehört, würde sicher nicht anders uns entgegentreten, als es heute in den Gestaltungen des Dichters der Fall ist, wo die Scenerie, in welcher die Handlung vorgeht, nicht sowohl diese beleuchtet und erklärt, als vielmehr im engsten Umkreis vom seelischen Vorgang und dessen Träger aus, wie von einer Blendlaterne in dunkler Nacht, erhellt wird; ein dem modernen französischen Impressionismus diametral entgegengesetzter Vorgang.
Wir glauben diese Beobachtung an keiner anderen Stelle so deutlich, so schlagend mit Thatsachen belegen zu können, als dies während des Aufenthalts in Italien durch des Dichters Briefe an seine Freunde sich uns darbietet. Der nächste Brief, dem wir einige Stellen entlehnen, ist ein an Strachow gerichtetes Schreiben aus Florenz vom 12. Dezember 1868. Nach einigen Erinnerungen an ihren gemeinsamen Aufenthalt in Florenz und nach Vergleichen mit dem gegenwärtigen Leben der Stadt fährt der Dichter mit Bezug auf eine Stelle aus Strachows letztem Briefe fort: „Dass die Litteratur bald schon ganz aufgehört hätte, das ist vollkommen richtig. Ja, eigentlich hat sie schon aufgehört, wenn man’s so nehmen will. Und das schon lange. Sehen Sie, mein Lieber, von diesem Gesichtspunkt aus muss man es ja ansehen: meiner Meinung nach, wenn das eigene, echt russische und originale Wort versiegt ist, so hat sie auch aufgehört; ist kein Genius in Sicht — so hat sie aufgehört. Seit Gogols Tode hat sie aufgehört. Ich wünschte so schnell als möglich etwas vom Unserigen. Sie schätzen Leo Tolstoj sehr hoch, wie ich sehe. Ich gebe zu, dass hier auch vom Unserigen vorhanden ist, aber wenig. Übrigens aber ist es ihm nach meiner Meinung gelungen, mehr als wir alle Eigenes auszusprechen, und darum ist er wert, dass man von ihm spreche. Aber lassen wir das. — Was sagen Sie aber da über sich? „Nein, hoffen Sie nicht auf mich!“ Diese Worte können doch keine ernste Grundlage haben, Nikolai Nikolajewitsch? Wenn es Ihnen endlich widerwärtig geworden ist, immerfort für bestimmte Fristen bestellte Artikel zu schreiben, so geht es uns allen ja genau ebenso. Diese Fristen und Bestellungen erdrücken zuletzt jede Stimmung, jedes Feuer, besonders mit den Jahren. Allein beruhigen Sie sich: das innerste Mark Ihrer Begeisterung werden Sie niemals verlieren. Was weiter? Schreiben Sie nicht zwölf Artikel im Jahre, schreiben Sie drei. Diese werden Sie mit Befriedigung schreiben, namentlich wenn Sie in die Wärme kommen. Aber es ist ja genug nicht nur an dreien, sondern an zweien, ja an einem vortrefflichen Artikel, um einer Zeitschrift einen Ton zu verleihen und die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Aber die Hauptsache ist — die Redaktion. Die Redaktion ist die allerwichtigste Sache: unser Auge, unsere Hand und unsere immerwährende Richtung. Jetzt aber, besonders jetzt ist das die Hauptsache.“
Im nächsten, vom 10. März 1869 aus Florenz datierten Briefe an Strachow feuert der Dichter den Freund wieder an, bei der Gründung des neuen Blattes auszuharren, gegen die Opposition der Mehrheit, die jedes neue Blatt angreift, Stand zu halten. „Sie wissen ja die Antwort: Sie sollen nur schmähen, d. h. nicht schweigen, sondern reden. Sie aber sind ohne Zweifel (so wie auch ich) davon überzeugt, dass der Erfolg eines Blattes von der Minderheit abhängt. Diese Minorität wird unausbleiblich für Euch sein (sogar ungeachtet aller „Plutzer“ und Irrtümer des Blattes, welche es, wie es scheint, machen wird). Diese Minderheit wird gegen Ende des Jahres sicherlich erstarken und sich festigen. Warum ich so überzeugend spreche? Weil in diesem Blatte ein Gedanke steckt, derselbe, der jetzt unvermeidlich, unentrinnbar ist und dem allein es beschieden ist, zu wachsen, während alle anderen „klein werden“ müssen.
Allein dieser Gedanke ist eine schwierige und heikle Sache, Sie wissen das selbst. Um dieses Gedankens willen, besonders, wenn man anfangen wird, ihn zu begreifen, d. h. wenn Ihr ihn noch breiter auseinander setzen werdet, wird man Euch Reaktionäre, Kamtschadalen, wohl gar Korrumpierte nennen, während er für uns der einzige, fortschrittliche und liberale Gedanke in unserer Zeit ist. Wenn Ihr das aber endgiltig werdet auseinandergesetzt haben, dann werden alle mit Euch gehen. Indessen aber sieht die Routine den Liberalismus und den neuen Gedanken immer im Veralteten und Abgestandenen. Die „Vaterländischen Annalen“, das „Djelo“ rechnen sich sicherlich zu den Vorgeschrittensten.
Alles dieses wissen Sie selbst vollkommen gut, vor allem das, dass Euch die Zukunft gehört. Nun aber wissen Sie, was ich fürchte? Dass Sie (und viele der Eurigen) vor der ungeheuren Mühe erschrecken und die grosse Arbeit aufgeben werden. Diese Mühen sind so gross und erfordern so viel Vertrauen und Zähigkeit, dass Sie das erst nach langer Zeit voll erkennen werden. So scheint es mir. Ich selbst kenne sie nur von einem Zipfelchen aus, seit der Zeit, als ich dem Bruder bei der Redaktion half. Aber die „Wremja“ und die „Epocha“ haben sich, wie Sie selbst wissen, zu einer solchen Offenheit und Nacktheit im Aussprechen ihres Gedankens niemals verstiegen und haben sich meist an die Mittelstrasse gehalten, namentlich anfangs. Ihr aber habt direkt mit der Hauptsache begonnen; für Euch ist es schwerer; folglich heisst es: feststehen.“
Uns Europäern ist es wohl nicht leicht, dieser Verschränkung der Begriffe „liberal“ und „abgestanden“ zu folgen oder ihr gerecht zu werden. Es ist das eine der Grundursachen der Missverständnisse, die zwischen den Anhängern abendländischer Kultur und jenen einer langsamen und organischen Entwickelung des Ostens auf eigener Grundlage obwalten. Nur ein langer Aufenthalt in Russland und ein vorurteilsloses Eindringen in die Bedingungen dieser Entwickelung, sowie in den Nutzen oder Schaden hinzutretender „europäischer“ Elemente vermöchte uns darüber zu belehren, in welchem der beiden Axiome mehr Menschenvernunft liegt.
In demselben Briefe heisst es an anderer Stelle: „Sie haben eine unendliche, unmittelbare Sympathie für Leo Tolstoj, schon seit der ganzen Zeit, da ich Sie kenne. Allerdings, als ich Ihren Aufsatz in der „Zarja“ [dem neuen Journal] durchgelesen hatte, empfand ich als ersten Eindruck sofort, dass er unvermeidlich sei und dass Sie, wollten Sie sich nach Möglichkeit aussprechen, nicht anders anfangen konnten, als mit L. Tolstoj, d. h. seinem letzten Werke [„Krieg und Frieden“]. Im „Golos“ hat ein Feuilletonist gesagt, dass Sie L. Tolstojs historischen Fatalismus teilen. Natürlich kann man auf das alberne Wort speien, aber daran liegt es nicht; es handelt sich darum: Woher nehmen die Leute, sagen Sie mir, so wunderliche Einfälle und Ausdrücke? Was heisst „historischer Fatalismus“? Warum verdunkeln und vertiefen gerade jene Routinierten und albernen Leute, die nichts bemerken, was weiter reicht, als ihre Nase, ihre eigenen Gedanken, dass man daraus nicht klug werden kann? Er will ja offenbar etwas sagen; dass er Ihren Aufsatz gelesen, daran ist kein Zweifel. Gerade das, was Sie an jener Stelle sagen, wo Sie von der Schlacht bei Borodino sprechen, drückt das Wesentliche von Tolstojs Gedanken sowohl als auch Ihrer Gedanken über Tolstoj aus. Man könnte sich nicht klarer ausdrücken, der nationale russische Gedanke ist da nahezu ganz nackt dargelegt. Und das gerade haben sie nicht verstanden und haben es in Fatalismus umgedeutet. Was die übrigen Einzelheiten Ihres Artikels anlangt, erwarte ich die Fortsetzung. Der Gedanke ist klar, logisch, fest entworfen, im höchsten Grade vollendet niedergeschrieben. Aber mit einem und dem anderen Detail bin ich nicht einverstanden. Natürlich würden wir persönlich anders miteinander sprechen können, als es schriftlich geschieht.
Schliesslich und endlich halte ich Sie für den einzigen Repräsentanten unserer heutigen Kritik, dem die Zukunft gehört. Aber wissen Sie was? Ihren Brief habe ich mit Unruhe durchgelesen. Ich sehe an seinem Tone, dass Sie aufgeregt und beunruhigt sind, dass Sie sich in grosser Gemütsbewegung befinden. Ich fürchte für Sie auch Ihre Ungewohnheit, zu bestimmter Frist und ausdauernd zu arbeiten. Sie müssen unbedingt drei grosse Artikel im Jahre schreiben. Sie haben noch vieles zu sagen, glauben Sie mir. Indessen aber sinkt Ihr Mut, ganz ohne Mass; eine geringe Sache bringt Sie ins Schwanken wie eine grosse. Dabei sind Sie offenbar die unentbehrlichste Person der Redaktion in Bezug auf die klare Darlegung des Grundgedankens der Zeitschrift. Ohne Sie wird sie nicht in Gang kommen. Also heisst es, sich fest zur That entschliessen, Nikolai Nikolajewitsch, zu einer schweren und andauernden Wirksamkeit, und auf keinerlei Unannehmlichkeiten achten. Jede Unannehmlichkeit steht unvergleichlich tiefer als Ihr Ziel, und darum heisst es ertragen lernen und überhaupt sich festigen. Aber die Sache fallen zu lassen, dazu haben Sie nicht einmal das Recht; ich würde dann der Erste sein, Sie zu verfluchen.“
In demselben Briefe heisst es an anderer Stelle: „Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Anteil an mir nehmen. Ich befinde mich immer gleich, das heisst meine Anfälle sind sogar schwächer, als in Petersburg. In der letzten Zeit, vor 1½ Monaten, war ich mit der Beendigung des „Idioten“ sehr beschäftigt. Schreiben Sie mir, wie Sie es versprachen, Ihre Meinung darüber; ich erwarte sie mit Begierde. Ich habe meine eigene Anschauung über das Schöpferische in der Kunst; und das, was die Mehrheit fast phantastisch und excentrisch nennt, das bildet für mich manchmal das eigentlichste Wesen der Wirklichkeit. Die Alltäglichkeit der Erscheinungen und eine offizielle Art sie zu betrachten, das ist meiner Meinung nach noch kein Realismus, im Gegenteil! In jedem Zeitungsblatte begegnen Sie Berichten über die wirklichsten und die absonderlichsten Geschehnisse. Für unsere Schriftsteller sind sie phantastisch: ja sie befassen sich gar nicht mit ihnen; indessen sind sie doch Wirklichkeit, weil sie Fakten sind. Wer wird sie denn bemerken, beleuchten und beschreiben? sie sind alltäglich, allstündlich, aber gar nicht Ausnahmen — — ‚ein pseudo-russischer Zug, dass der Mensch alles anfange, sich mit Grossem zu schaffen mache und das Kleine nicht einmal fertig bringe.‘ Was für abgestandenes Zeug! Was für ein armseliger, leerer Gedanke, noch dazu ein ganz unrichtiger! Ein Klatsch über den russischen Charakter, noch aus Belinskys Zeiten. Und was für eine Enge und Kleinlichkeit im Betrachten und Durchdringen der Wirklichkeit! Und immer dasselbe und dasselbe! Auf diese Weise lassen wir die ganze Wirklichkeit uns vor der Nase vorüber gehen. Wer wird denn die Begebenheiten beachten und sich in sie vertiefen? Von Turgenjews Erzählung will ich gar nicht reden — der Teufel weiss, was die sein soll! Ist dann nicht mein phantastischer „Idiot“ Wirklichkeit, ja die alltäglichste Wirklichkeit? Ja, eben jetzt muss es solche Charaktere in unseren, vom heimatlichen Boden losgerissenen Gesellschaftsschichten geben, den Schichten, die in der That phantastisch erscheinen. Allein da ist nichts zu sagen! Vieles im Roman ist eilig hingeschrieben, vieles zu breit und misslungen. Manches aber ist auch gelungen: Ich stehe nicht für den Roman, sondern für meine Idee ein.“
Zum Schluss abermals ein Anfall von Misstrauen, das, wie immer, auf ein Gefühl von Schuld zurückzuführen ist: „Jetzt will ich Ihnen, als einem alten Freund und Mitarbeiter, im Vertrauen noch eines verraten, was mich ausserordentlich beunruhigt. Jene 200 Rubel, welche ich seit mehr als Jahresfrist Apollon Nikolajewitsch schulde, scheinen Ursache seines jetzigen Schweigens zu sein; er hat plötzlich den Briefwechsel mit mir abgebrochen. Ich habe im Dezember Katkow gebeten, 100 Rubel an Emilie Fjodorowna [des Bruders Witwe] und Pascha auf den Namen Apollon Nikolajewitsch zu schicken (wie das immer in diesen Fällen geschah), und ihn habe ich in meinem letzten Briefe gebeten, diese 100 Rubel Emilie zu übergeben. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass ich eine bedeutende Summe bekommen hätte, dass ich in Gold bade, ihm aber sein Geld nicht abgebe. „Anderen zu helfen, dazu hat er Geld, aber eine Schuld abzutragen, dazu hat er keines“ — das hat er sicherlich gedacht. Wenn er nur wüsste, in welche Lage ich mich selbst gebracht habe! Nachdem ich Erhebliches aus dem „Russkij Wjestnik“ entnommen hatte, sind wir das letzte Halbjahr so schlecht daran gewesen, dass jetzt unsere letzte Wäsche im Leihhaus ist. (Sagen Sie das niemand.) In der Redaktion des „Russkij Wjestnik“ aber wollte ich vor Beendigung des Romans nichts mehr verlangen. Nun aber stellen sie dort die Rechnungen zusammen und haben mir bis heute nicht geantwortet. Gewiss, ich habe gefehlt, dass ich ein ganzes Jahr nicht zahlte, und ich habe schon allzu viel bei dem Gedanken gelitten; allein ich habe während der zwei in der Fremde zugebrachten Jahre im ganzen 3500 Rubel verbraucht, wobei die Umsiedelungen, einige Sendungen nach Petersburg und meine Sonja mitgerechnet sind; da war nichts da, wovon ich hätte noch schicken sollen. Er aber hat mich indessen niemals gemahnt; so habe ich auch gedacht, er könne noch warten, und jeden Monat gehofft, ihm etwas schicken zu können. Diese 100 R. an Emilie F. müssen ihn beleidigt haben. Aber Emilie F. stirbt ja fast vor Hunger, wie sollte man da nicht helfen! Bei meiner traurigen Lage ist mir der Gedanke, dass da wieder ein mir treu ergebener Mensch mich verlässt, höchst peinvoll. Hat er Ihnen nicht irgend was gesagt, oder wissen Sie etwas darüber? Wenn Sie etwas wissen, teilen Sie mir’s mit, mein Täubchen! Andererseits ist es mir seltsam, dass sich eine sonst freundschaftliche Verbindung, welche seit dem Jahre 1846 zwischen uns besteht, um 200 R. willen auflösen sollte, zudem bin ich ohnedies von allen vergessen.“
Schon am 30. März (desselben Jahres) ist der Dichter über das „Missverständnis“ ganz beruhigt; er schreibt an Strachow: „Ich danke Ihnen ... drittens für die gute Nachricht über Apollon Nikolajewitsch. Ich werde seinen Brief in den nächsten Tagen selbst beantworten .... Ich habe in dieser letzten Zeit des „Missverständnisses“, welches durch meine Zweifelsucht entstanden war, auch nicht einen Tropfen meiner herzlichen Beziehung zu ihm eingebüsst. Darüber aber, dass er ein guter und reiner Mensch ist, hege ich schon allzulange nicht den geringsten Zweifel und bin selbst sehr froh, dass Sie sich mit einander so gut verständigt haben.“
Über die neue Zeitschrift, welcher Dostojewsky so viele Hoffnungen entgegen bringt, finden wir folgende, für des Dichters Ernst und seine fast kindliche Herzensgüte bezeichnende Stelle: „Die zweite Nummer hat mir einen ausserordentlich günstigen Eindruck gemacht. Über Ihren Artikel rede ich nicht einmal, ausser dass dies wirkliche Kritik ist, gerade das Wort, welches jetzt unentbehrlicher ist, als alles andere, und am besten die Sache beleuchtet. Der Artikel Danilewskys aber stellt sich in meinen Augen immer wichtiger und durchschlagender dar. Das ist ja — das künftige Nachschlagebuch aller Russen auf lange Zeit hinaus. Und wie viel trägt seine Sprache und Klarheit, seine populäre Form, ungeachtet seines streng wissenschaftlichen Stils, dazu bei. Diese Arbeit stimmt so sehr mit meinen eigenen Schlüssen und Überzeugungen überein, dass ich an mancher Stelle geradezu verblüfft bin über die Ähnlichkeit der Schlussfolgerungen mit den meinigen. Viele meiner Gedanken notiere ich mir schon seit langem, schon seit zwei Jahren, eben darum, weil ich einen Aufsatz, ja fast unter dem gleichen Titel, vorbereite, in ganz demselben Gedankengange und mit denselben Folgerungen. Wie freudig ist also meine Überraschung, da ich jetzt den Gedanken, die ich künftig einmal zu gestalten so sehr gedürstet habe, schon in lebender Form begegne, und zwar mit Wohllaut, harmonisch, mit einer ungewöhnlichen Kraft der Logik und auf einer solchen Stufe wissenschaftlicher Behandlung, welche ich natürlich, ungeachtet aller meiner Anstrengungen, niemals erreichen könnte.
Ich lechze so sehr nach der Fortsetzung dieses Artikels, dass ich täglich auf die Post laufe und mir alle Möglichkeiten eines schnelleren Eintreffens ausrechne. Auch darum lechze ich, diesen Artikel auszulesen, weil ich ein wenig, und das mit Schrecken, über die endgiltige Beweisführung im Zweifel bin. Ich glaube noch immer nicht, dass Danilewsky mit voller Kraft das letzte Wesen der russischen Sendung darlegen wird, welches darin besteht, den russischen Christus vor der Welt zu entschleiern, den der Welt unbekannten Christus, dessen Grund-Elemente in unserem volkstümlichen Rechtglauben enthalten sind. [Dostojewsky gebraucht das Wort „Christus“ nicht als Personennamen, sondern stets als Personifikation, wie das für einen aufmerksamen Leser in seinen Werken mehr oder weniger deutlich hervortritt.] Nach meiner Meinung liegt hier die ganze wesentliche Kraft unseres mächtigen, künftigen Zivilisations- und Erweckungswerkes, sogar in ganz Europa, und die ganze Wesenheit unseres kraftvollen, zukünftigen Seins. Aber mit einem Worte spricht man das nicht aus, und ich habe auch vergeblich zu reden angefangen.“
Weiter heisst es: „Aber was Sie da, und das mit solcher Trauer und solchem offenbaren Kummer sagen: dass Ihr Aufsatz keinen Erfolg hat, dass man ihn nicht verstehe, nicht interessant finde! Ja, waren Sie denn wirklich überzeugt, dass ihn alle sofort verstehen würden? Das wäre nach meiner Meinung eine schlechte Empfehlung der Arbeit. Was man allzu schnell und leicht versteht, das hat nicht viel Zukunft. Belinsky hat erst am Ende seiner Laufbahn die gewünschte Berühmtheit erlangt, und Grigorjew ist gestorben, fast ohne im Leben irgend etwas zu erreichen. Ich bin gewohnt, Sie so zu schätzen, dass ich Sie auch einem solchen Vorkommnis gegenüber für weise hielt. Die Wesenheit einer Sache ist so fein, dass sie immer der Mehrheit entgeht. Sie verstehen erst, wenn man ihnen den Brei schon ganz auseinander rührt; und noch dazu erscheint ihnen jeder neue Gedanke nicht besonders interessant. Und je einfacher, je klarer, d. h. je talentvoller er dargelegt ist, umsomehr erscheint er ihnen allzu einfach und ordinär. Das ist ja die Regel! Verzeihen Sie, aber ich habe sogar lächeln müssen bei Ihrem sehr naiven Ausspruch, dass ‚sogar sehr spitzfindige Leute Sie nicht verstehen‘. Ja, diese noch mehr als andere, verstehen niemals, hindern sogar die anderen zu verstehen, und das hat seine nur allzuklaren Ursachen und ist natürlich auch ein Gesetz. Aber Sie sagen ja selbst, dass sowohl Gradowsky als Danilewsky begeistert zu Ihnen stehen, dass Aksakow zu Ihnen gekommen ist usw. Ist Ihnen das zu wenig? Aber ich bin trotzdem fest überzeugt, dass so viel Selbsterkenntnis in Ihnen ist, so viel innere Nötigung nach vorwärts zu streben, dass Sie die Schätzung Ihrer Thätigkeit nicht verlieren und die Sache nicht im Stiche lassen werden! Also schrecken Sie uns nicht, bitte. Gehen Sie — so ist’s mit der Zarjá aus. Und nun von Geschäften.“
Dostojewsky schlägt nun der Redaktion der neuen Zeitschrift, als Antwort auf ihr Anerbieten der Mitarbeiterschaft, eine kleine Erzählung von etwa 3 Druckbogen vor. „Diese Erzählung“, sagt er, „habe ich schon vor vier Jahren, im Todesjahre meines Bruders, als Antwort auf die Worte Apollon Grigorjews schreiben wollen, der mein „Zapiski iz Podpolja“ sehr gelobt und gesagt hatte: ‚In diesem Genre sollst du weiter schreiben‘.“
Die „Memoiren aus einem Keller“, wie wir jene Erzählung nennen möchten, welche unter dem Titel „Aus dem dunkelsten Winkel einer Grossstadt“ in deutscher Übersetzung erschienen ist, drücken das als Axiom aus, was wir im Lebenswerk Dostojewskys als stärkste Triebkraft an der Arbeit finden: die Einsicht von der durch kein Wissen und keine Kultur auszugleichenden Irrationalität der Menschenseele und als Folge davon die Einsetzung dieses Mensch-Komplexes als eine absolute Werteinheit in das Weltganze. Daher als letzte Konsequenz die Liebe zum Bruder, die wir irrtümlicher Weise Erbarmen nennen. Was Dostojewsky in allen seinen Werken mehr oder weniger künstlerisch, immer aber subjektiv darstellt, das ist der Mensch mit allen seinen Brüchen, mit allen seinen Möglichkeiten, welche das Sitten-, ja das Naturgesetz durchbrechen. Hier, in diesem galligen Monolog eines Misslungenen, formuliert er diese Einsichten philosophisch, analytisch.
W. Rósanow, einer der tiefsten Kenner Dostojewskys, hat in einem bemerkenswerten „kritischen Kommentar“ zur „Legende vom Grossinquisitor“ auch über diese Memoiren als über das philosophische Credo des Dichters das Vortrefflichste gesagt. Nur wollen uns Ursache und Wirkung hier in umgekehrtem Verhältnis erscheinen, als Rósanow sie darstellt. Uns kann nicht scheinen, dass Dostojewsky durch die Analyse zur Mystik gelangt; wir meinen, dass man weder auf analytischen noch auf anderen Erfahrungswegen zur Mystik kommt, sondern dass man sie in sich trägt und die Analyse als Werkzeug zur Hand nimmt, um andere zu diesem, seinem innersten Lebenskern zu führen. Dostojewsky, so hat sich sein Menschheitsbild uns gewiesen, hat immer aus der Synthese heraus zur Analyse gegriffen, um sich verständlich zu machen.
Die Erzählung zerfällt in zwei, der Form nach vollständig getrennte Teile, was die Absichtlichkeit, die in dieselbe gelegt ist, in’s rechte Licht setzt. Der erste Teil, jener philosophierende Monolog des unterirdischen Weltbürgers, führt den Gedanken durch, dass nur Menschen ohne Erkenntnis zum Handeln kommen und handeln, die Erkenntnis aber unbedingt zur Unthätigkeit (inertia) führe. Es werde dahin kommen, dass der immer „logischer“ entwickelte Erkenntnismensch sich endlich als den Stift einer grossen Musikwalze fühlen werde. Nun sei es aber merkwürdig, dass man bei der Aufzählung der Naturgesetze, welche dieses vollkommene Funktionieren des Menschen herbeizuführen berufen sind, auf seinen Willen wirken und sein Handeln vorausbestimmend anordnen, dass man da immer ein Gesetz aus dem Spiel lasse, nämlich jenes, wonach der Mensch gerade immer das Gesetzmässige umwerfe und bewusst gegen seinen Vorteil, seine Vervollkommnung und sein Glück handle. Die Auslegung, dass dies eben sein persönliches Glück ausmache, verweist er mit Recht unter die Sophismen, welche aufgewendet werden, um zu beweisen, dass 2×2=4 sind. „Die Gesetze der Logik,“ sagt er, „sind eines, die des Menschseins ein anderes.“ Das grösste und einzige Gesetz, das jeder Mensch geltend mache, sei nicht sein Recht auf Vorteil, Tugend, Vernunft, Harmonie, sondern das Recht auf persönliche Unabhängigkeit und Freiheit — womit er immer wieder alle jene schönen Dinge umwirft. Der Mensch — so lautet das Resumé — wird also nicht besser, nicht glücklicher, nicht wertvoller werden durch den „Ameisenhaufen“ des Wissens und der Erkenntnisse, sondern — ein Musikstift; doch er wird dies eben nie werden, sondern ein Irrationales und als solches etwas Absolutes innerhalb der Schöpfung bleiben, ein Absolutes, das man so wie es ist annehmen muss, das so wie es ist den Gattungsnamen ‚Mensch‘ trägt.
Der zweite Teil der Erzählung führt uns die Geschichte des Menschen vor, dessen unterirdische Philosophie uns der erste Teil in vortrefflicher Einhaltung des galligen Sonderlingshumors gebracht hat. Dies ist ein Mensch, der gerade immer, wenn er sich am klarsten die Herrlichkeit alles „Hohen und Schönen“ vorgestellt hat, am tiefsten in den Schlamm von „allerlei grossen und kleinen Lastern“ versinkt, der durch seine Gewohnheit alles bis auf die „letzte und allerletzte Ursache“ durchzudenken, nie mehr eine unbefangene Handlung zu begehen imstande ist, dessen Reflexion immer sein Thun zerstört oder im entscheidenden Augenblick von diesem umgeworfen wird. So ärgert er sich geraume Zeit über einen Offizier, der ihm oft auf dem Bürgersteig des Newsky Prospekt begegnet und dem er, da er sehr ärmlich gekleidet ist, ganz selbstverständlich ausweicht. Nun will er das nicht; er will einmal zeigen, dass er so unbefangen wie jener vor sich hingehen, meinetwegen an ihn anstossen könne. So oft es aber zur That kommt, drückt er sich doch auf die Seite; ja er weiss es endlich, dass es wieder so kommen werde.
In einem anderen Handel mit alten Schulgenossen, die er trifft und die zur Abschiedsfeier eines unter ihnen ein Mittagessen veranstalten, geht es ihm nicht besser. Er drängt sich ihnen, die ihn nicht mögen und verachten, auf, trinkt sich Mut an, insultiert sie, bittet sie um Verzeihung, fühlt dabei, dass alles dies unglaublich niedrig ist, empfindet ein Rasen von Zorn und Scham und treibt dies, durch allerlei überkluge Erwägungen gestossen, gegen seine Einsicht, ja gegen seine Natur immer weiter. Diesem Treiben setzt er die Krone auf, da er, noch betrunken, nach jenem Gelage den anderen in ein verrufenes Haus nachfährt, dort als der Letzte ankommt und nimmt was übrig bleibt: ein noch sehr junges Mädchen, das noch ein Neuling im Gewerbe ist. Wie nun der Morgen graut und er von seiner Trunkenheit erwacht, ergreift ihn die Lust Moral zu predigen. Er steigert sich in immer grössere Hitze, schildert das Glück eines tugendhaften Lebenswandels, bespricht ihren eigenen Wandel und seine letzten Folgen, kurz er jagt dieses Wesen in einen Anfall von Schmerz und Verzweiflung hinein — „nicht ohne selbst bewegt zu sein“, wie er sagt, aber doch „buchmässig, litteraturmässig“; er endet damit, dass er ihr seine Adresse giebt, damit sie ihn aufsuchen könne, wenn sie sich retten wolle.
Nun erwartet er mit Angst und Unbehagen ihr Kommen, denn er weiss, er fühlt es, dass er sie wieder fortschicken werde. Täglich atmet er auf, da sie nicht kommt. Ja, es wird ihm nach 9 Uhr abends so wohl zumute, dass er „ziemlich süss“ zu träumen beginnt: ... „ich bilde sie, trage zu ihrer Entwickelung bei. Endlich bemerke ich, dass sie mich leidenschaftlich liebt. Ich stelle mich an, als verstünde ich es nicht (ich weiss nicht warum; wahrscheinlich der Ausschmückung wegen). Endlich wirft sie sich schluchzend, errötend, bebend mir zu Füssen und sagt, dass ich ihr Retter sei, dass sie mich mehr, als alles in der Welt liebe. Ich erstaune, aber ... „— Lisa, sage ich, glaubst du denn, ich hätte deine Liebe nicht bemerkt? Ich habe alles gesehen, alles erraten; allein ich wagte es nicht, der Erste zu sein, wagte nicht, Anspruch auf dein Herz zu erheben, weil ich ja Einfluss auf dich hatte und fürchtete, du würdest aus Dankbarkeit dich zwingen, meine Liebe zu erwidern, du würdest selbst ein Gefühl in dir erzwingen, das vielleicht gar nicht vorhanden ist; ich aber wollte das nicht, weil das Despotismus, weil das undelikat ist ... (kurz, ich vergaloppierte mich da in so eine europäische, George-Sand’sche, unerklärbar edle Feinheit hinein). Jetzt aber bist du mein, mein Geschöpf, bist rein, herrlich, bist — mein herrliches Weib!“
Eines Abends aber erscheint Lisa wirklich, da er gerade mit seinem Diener, den er hasst und fürchtet, eine sehr unangenehme Scene gehabt hat. Er schämt sich auch seines schlechten Schlafrocks, seines zerrissenen Wachstuchdivans und lässt sie hart an. Er fragt sie, warum sie zu ihm gekommen sei, schreit und poltert. Das eingeschüchterte Mädchen sieht in diesem ganzen Gebahren nur das eine: dass er leidet, und — bleibt. Ihre Güte erweicht ihn, und aus seinem Wutanfall wird Selbstanklage und endlich hysterisches Schluchzen. Auch dieses versetzt er mit Selbstbespiegelung, bis zur Übertreibung, schämt sich darauf dessen sehr und rächt diese Beschämung wieder an ihr, die Zeugin derselben gewesen ist. Er fühlt seine Gewalt über sie und nutzt sie aus. — — —
Am frühen Morgen mahnt er sie ans Fortgehen. Als sie eilig ihre Siebensachen zusammennimmt und sich zur Thüre wendend ihm einfach ‚Lebt wohl‘ sagt, läuft er auf sie zu und drückt ihr einen Fünfrubelschein in die Hand — „aus Zorn“, wie er sagt, „hineingehetzt“, „buchmässig“ that er das. Nun eilt er zur Treppe, lauscht, ruft, sie ist fort. Als er in seine Stube zurückkehrt, erblickt er den zerknitterten Schein auf dem Tische vor sich liegen. Wie toll läuft er nun Lisa auf die Strasse nach. Er sieht sie nicht mehr; sie muss in eine Seitengasse verschwunden sein — — Er bleibt stehen und fragt sich: „Wohin ist sie denn gegangen? und — warum laufe ich ihr denn nach?“ „Wird es nicht besser für sie sein“, phantasiert er weiter, „wenn sie diese Demütigung für ewige Zeiten mit sich nimmt? Demütigung — das ist ja Reinigung!“ Weiter sagt er: „Was ist besser, ein billiges Glück oder ein erhabener Schmerz?“
„So flog es mir durch den Kopf, als ich an jenem Abend zu Hause sass, halbtot von seelischen Schmerzen. Noch niemals hatte ich soviel Leid und Reue empfunden. Und dennoch — konnte denn irgend ein Zweifel darüber bestehen, dass ich vom halben Wege zurückkehren würde? Ich habe Lisa nie wieder getroffen, nie wieder etwas von ihr gehört. Ich füge noch hinzu, dass ich mich lange Zeit mit der Phrase vom Nutzen der Demütigung und des Hasses beruhigte, ungeachtet dessen, dass ich damals aus Kummer fast krank wurde.“
Das Schlusswort des unterirdischen Philosophen spricht im Sinne des Ganzen die Erkenntnis von der ewigen Fehlbarkeit der Menschennatur, von ihrer Freiheit, zu fehlen, aus. Er fragt sich, ob er diese Memoiren fortsetzen solle. Aber — „zum Beispiel lange Geschichten davon zu erzählen, wie ich mein Leben in einem finstern Winkel durch sittliche Zersetzung, durch den Mangel eines Milieu, Entwöhnung vom Lebendigen, durch die im Kellerloch immer genährte Bosheit verfehlt habe — das ist bei Gott nicht interessant. In einem Roman braucht man einen Helden, hier aber sind absichtlich alle Züge für einen Anti-Helden zusammengetragen. Die Hauptsache aber ist, dass dies alles einen sehr unangenehmen Eindruck hervorrufen wird, weil wir alle vom Leben entwöhnt sind, alle hinken, der eine mehr, der andere weniger. So sehr sind wir vom Leben abgewöhnt, dass wir das wirkliche ‚lebendige Leben‘ fast als eine Arbeit ansehen, fast wie einen Dienst; und wir stimmen alle darin überein, dass es nach dem Buch zu leben besser ist. Und warum treiben wir’s manchmal so, warum beunruhigen wir uns, was verlangen wir? Wir wissen es selbst nicht. Es wird uns aber schlechter gehen, wenn man unsere heftigen Wünsche erfüllt. Versucht es einmal, nun, gebt uns zum Beispiel etwas mehr Selbständigkeit, macht irgend einem von uns die Hände frei, erweitert unseren Wirkungskreis, verringert die Obhut und wir — ich versichere Euch — wir werden uns sofort wieder die Obhut ausbitten. Ich weiss, dass Ihr wahrscheinlich auf mich böse sein, mich anschreien, mit den Füssen treten werdet: Redet von Euch allein und von Euren Miseren in der Kellerwohnung, wagt es aber nicht, von ‚uns allen‘ zu sprechen. Erlaubt meine Herren, ich reinige mich ja nicht durch dieses ‚wir alle‘. Was aber mich im besonderen betrifft, so habe ich in meinem Leben das bis aufs Äusserste getrieben, was Ihr nicht wagtet bis zur Hälfte zu bringen. Ja, Ihr habt noch Eure Feigheit für Einsicht gehalten und habt Euch damit, Euch selbst betrügend, etwas zu gut gehalten, sodass ich jetzt förmlich lebendiger herauskomme, als Ihr. Ja, seht nur genauer zu. Wir wissen ja gar nicht, wo das Lebendige jetzt lebt, was es denn ist und wie es heisst. Lasst uns allein, ohne Buch — sofort verwirren und verlieren wir uns; wir wissen nicht, an was uns halten, wo uns anlehnen, was wir lieben, was wir hassen, was wir achten, was wir verachten sollen. Sogar das ‚Mensch sein‘ wird uns beschwerlich fallen, Mensch mit wirklichem, eigenem Fleisch und Blut. Wir schämen uns das zu sein und bestreben uns, irgend eine Art von nie dagewesenen Allgemein-Menschen zu sein. Wir sind Totgeborene, ja wir werden schon lange nicht von lebendigen Vätern geboren, und das gefällt uns immer mehr und mehr. Wir kommen auf den Geschmack. Wir werden bald darauf kommen, aus irgend einer Idee geboren zu werden. Aber genug“ usw.
Des Dichters Meinung liegt hier klar zu Tage. Das Buch, die Idee, die Logik, das Gesetz — das alles macht keine Menschen. Blut, Leidenschaften, der inkommensurable und irreguläre Reichtum des Lebens in seinen erstaunlichsten harmonischen, aber noch mehr unharmonischen Mischungen und Möglichkeiten — das ist für Dostojewsky der Mensch. Aber nicht jenseits, vielmehr diesseits von Gut und Böse, mit aller Freiheit, eines oder das andere zu thun oder zu lassen; erlöst aber durch die Liebe derer, die auch nicht besser sein wollen, dessen, der sich auch da hinein begab. Aus dem ‚Labyrinth der Brust‘, aus den eigenen tausendfältigen Möglichkeiten der ‚Sünde‘ wie der höchsten Entzückung heraus ist sie ihm ja geworden, diese Fähigkeit: verstehend in jede Seele einzudringen und die Kraft, mit welcher er unablässig nach Reinigung rang, mächtig, gewaltsam auch auf andere wirken zu lassen.
„Nun sind das keine Memoiren aus einem Keller,“ fährt Dostojewsky in dem Briefe fort; „es ist etwas der Form nach ganz anderes, obwohl dessen Wesen mein immer gleiches Wesen ist, wenn nur Sie, Nikolai Nikolajewitsch, auch mir als einem Schriftsteller einige mir gehörige, besondere Eigenart zugestehen. Diese Erzählung kann ich sehr schnell niederschreiben, da auch nicht ein Zeichen, nicht ein Wort darin mir unklar ist. Dabei ist schon vieles notiert, wenn auch nicht aufgeschrieben. Ich kann diese Erzählung vollenden und in die Redaktion schicken, lange vor dem ersten September. Kurz, ich kann sie sogar in zwei Monaten abschicken. Das ist aber alles, womit ich mich gegenwärtig an der „Zarjá“ beteiligen kann, trotz allen Wunsches, für ein Blatt zu schreiben, an dem Sie, Danilewsky, Gradowsky und Maikow arbeiten.“ Nun folgen die bekannten, immer wieder variierten Honorar- und Elends-Berichte, denen wir in jedem Briefe begegnen müssen.
Im nächsten Briefe an Strachow vom 18. April 1869 sind einige Stellen litterarischer Kritik bemerkenswert. Da heisst es: „Ein für allemal — schweigen Sie doch und reden Sie nicht von Ihrem „Unvermögen“ und den „zusammengefegten Entwurf-Abschnitzeln“. Es wird einem übel, das zu hören. Man kommt auf den Gedanken, dass Sie sich verstellen. Noch niemals haben Sie so viel Klarheit, Logik, so viel Scharfblick und überzeugte Beweisführung gehabt. Allerdings, Ihre „Armut der russischen Litteratur“ hat mir besser gefallen als der Artikel über „Tolstoj“. Jene wird breiter sein; dafür aber ist die erste Hälfte des Artikels über Tolstoj mit gar nichts zu vergleichen: das ist das Ideal einer kritischen Ausführung. Nach meiner Ansicht befindet sich auch ein Fehler in dem Aufsatze, doch ist das nur meine Ansicht, und dann sind solche Fehler auch gut. Dieser Fehler heisst: allzu grosser Idealismus; dieses aber schadet einer Arbeit nicht, sondern fördert sie. Alles in allem habe ich in der russischen Kritik noch nie etwas ähnliches gelesen.
Ich weiss nicht, was aus Awerkiew noch werden wird, aber nach der „Kapitänstochter“ (Puschkins) habe ich nichts ähnliches gelesen. [Dies bezieht sich auf eine im neuen Blatt „Zarjá“ publizierte Komödie Awerkiews: „Frol Skobjejew“, die Dramatisierung des altrussischen Romans gleichen Namens.] Ostrowsky ist ein Stutzer und blickt auf seine Krämer sehr von oben herab. Wenn er schon einen Kaufmann in Menschengestalt darstellt, so ist es gerade, als sagte er dabei zum Leser oder Zuschauer: Nun, siehst du, auch der ist ein Mensch. Wissen Sie, ich glaube, Dobroljubows Urteil über Ostrowsky ist richtiger, als das Grigorjews. Es kann sein, dass Ostrowsky thatsächlich die ganze Idee seines „Dunkeln Königreichs“ nicht in den Sinn gekommen ist, aber Dobroljubow hat sie gut ausgedeutet und ist damit auf den rechten Weg verfallen. Ich weiss nicht, ob sich so viel Glanz der Phantasie und des Talents in Awerkiew zeigen wird, wie bei Ostrowsky; allein seine Darstellung und der Geist dieser Darstellung ist ohne Widerrede höher. Keinerlei vorgefasste Absicht. Annuschka ist unbedingt prächtig, der Vater ebenfalls. Frol aber würde ich ein wenig begabter hingestellt haben. Wissen Sie, der Grossbojar, Naschtschokin, Lycikow — das sind ja unsere ehemaligen Gentlemen (von anderen gar nicht zu sprechen), das ist ja bojarische Grandezza ohne jede Karikatur. Über diese kann man nicht nur keine Karikatur-Lächerlichkeit werfen à la Ostrowsky, sondern im Gegenteil, man muss sich über ihre Vornehmheit, ihr russisches Bojarentum verwundern. Das ist grand-monde jener Zeit, auf der höchsten Stufe der Wahrheit; sodass, wenn irgend wer lächeln wollte, er es höchstens darüber kann, dass der Kaftan einen anderen Schnitt hat. Vor allem und hauptsächlich fühlt man, dass das eine Darstellung der Wirklichkeit ist, dessen, was auch thatsächlich vorhanden war. Das ist ein grosses neues Talent, vielleicht höher als vieles Gegenwärtige. Es wäre ein Elend, wenn es nur für eine Komödie ausreichte.“
Am 11. Mai schreibt Dostojewsky in grosser Aufregung einige Zeilen. Er will Florenz verlassen, da die Hitze sehr gross ist, und möchte einem neuen Familienereignis lieber in Deutschland entgegensehen, wo man sich mit Arzt und Wärterin besser verständigen kann. Nur erwartet er Geld und kann nicht fort, fragt, ob Strachow krank oder etwas in der Redaktion vorgefallen sei. Bezeichnend für Strachow ist die Notiz, die er diesem Briefe anfügt: „Die Sache ist die, dass ich am 27. März jene 125 Rubel (Dostojewskys Verlangen gemäss) an Marja Grigorjewna [D.s Schwägerin] abgeliefert hatte. Obwohl ich nun am selben Tage an Theodor Michailowitsch geschrieben hatte, dass man ihm Mitte April 175 Rubel schicken werde, ihm auch später am 12. April dieses Versprechen erneuerte, wurde das Geld zu meinem grossen Verdruss doch nicht abgeschickt. So verschob sich der Empfang von einem Tag auf den andern, ich wusste nicht was thun und schämte mich so sehr vor Theodor, dass ich dann auch meinen Briefwechsel mit ihm abbrach.“
Ein Brief, den Strachow erst am 17. August desselben Jahres aus Dresden erhielt, beginnt: „Klagen Sie sich um Ihres Schweigens willen vor mir nicht an, Nikolai Nikolajewitsch. Es geht nun einmal so im Leben und dann: Wie kommt ein Redakteur zu einem Briefwechsel mit Freunden, geschweige denn mit Mitarbeitern! Aber, aus Ihrem Zusatz an den Brief unseres teuern Apollon Nikolajewitsch sehe und schliesse ich, dass Sie mir wie früher gut sind. Das ist sehr erfreulich für mich, weil der Leute, die mir zugethan sind, mit der Zeit immer weniger werden. Ich bin selbst schuld daran, habe mich im Auslande allzu festgerannt und bringe mich nicht genug in Erinnerung; folglich habe ich kein Recht, Ansprüche zu machen. In Dresden befinde ich mich thatsächlich erst seit zehn Tagen — ja ich bin im ganzen erst drei Wochen von Florenz fort! Ich habe den ganzen Juli dort zugebracht und bin auch noch in den August hineingekommen. Sie können mit Sicherheit sagen, dass niemals jemand eine solche Hitze erlitten hat. Ein russisches Schwitzbad — nur damit kann man das vergleichen, noch dazu Tag und Nacht. Die Luft ist rein, das ist wahr, der Himmel klar, furchtbar viel Sonne; aber dennoch ist’s unerträglich. Ich habe gesehen, dass es im Schatten (in grossem, gedeckten Schatten) 35° Reaumur waren. Und stellen Sie sich vor, obwohl alle Ausländer entweder in deutsche Bäder oder ans Meer gefahren sind, so sind doch eine Masse Menschen in Florenz geblieben, sogar wirkliche, sozusagen Mylords. Sie haben ihre Kostüme zur Schau getragen, sind herumstolziert usw. Mit einem Wort, wenn Sie wüssten, bis zu welchem Grade ich mich hier als ein ganz überflüssiger und fremder Mensch fühle! — Und so sind wir in Dresden. In drei Wochen werde ich ein Kind haben, ich erwarte es mit Aufregung und Furcht, hoffnungsvoll und zaghaft. Überhaupt habe ich eine sehr sorgenvolle Zeit“ usw.
Am 29. September schreibt Dostojewsky an Maikow wieder einmal einen von der Not diktierten Brief, der jeden Leser durch seine rührende und stolze Kindesschlauheit ergreifen muss. Wir bringen die Hauptstellen hier:
„Sogleich werde ich Ihnen meine Lage schildern und sagen, welcher Art die Hilfe ist, die ich als ein Ertrinkender von Ihnen erwarte: Erstens ist mir vor drei Tagen, am 14. Septbr. (a. St.) eine Tochter, Ljubow, geboren worden. Alles ist vortrefflich von statten gegangen, das Kind ist gross, gesund und eine Schönheit. Wir sind glücklich. (Denken Sie daran, dass wir Sie zum Taufpathen berufen werden. Anja bittet Sie mit gefalteten Händen, unbedingt Sie, also antworten Sie.) Aber Geld haben wir keine ganzen 10 Thaler. Beschuldigen Sie mich nicht der Sorglosigkeit und Unbedachtheit; hier ist niemand schuldig. Wir haben in Florenz berechnet, dass das vom „Russkij Wjestnik“ gesandte Geld für alles reichen werde. Allein, wie es bei allen Berechnungen geht — wir haben uns verrechnet. Es hat keinen Sinn, sich hier in Einzelheiten einzulassen; aber die Sache ist die, dass, wenn ich auch an den höchst zartfühlenden, gütigen und edlen Michail Nikiforowitsch [es ist der Redakteur des „Russkij Wjestnik“, M. Katkow, gemeint] schreiben will, dass er aushelfe — gleich zu schreiben, nachdem ich vor so kurzer Zeit Geld von ihm bekommen habe, schäme ich mich allzu sehr, ist mir geradezu unmöglich. Die Hände wollen sich dazu nicht erheben. Indessen ist weder die Hebamme noch der Arzt bezahlt, und obwohl wir jeden Heller um und umdrehen — ohne Geld geht es in dieser Lage nicht. Es geht nicht!
Da habe ich nun folgende Massregel ergriffen: Heute zugleich mit diesem Briefe an Sie sende ich ein Schreiben an Kaschpirew persönlich, da ich weiss, dass Strachow nicht in Petersburg ist. In diesem Schreiben schildere ich anfangs meine Lage, erwähne meine Übersiedelung, die Geburt eines Kindes (alles wie sich’s gehört), habe aber dabei gelogen, dass mir fünfzehn Thaler geblieben seien, während nicht einmal zehn da sind, und schliesse mit der Bitte, mir auf folgender Grundlage 200 Rubel zu senden. Da ich im gegenwärtigen Augenblick an einer Erzählung für die „Zarjá“ arbeite und diese Arbeit schon bis zur Hälfte gediehen ist (dies alles ist richtig), so sehe ich erstens: dass die Erzählung einen Umfang von 3½ Bogen des „Russkij Wjestnik“ (d. h. fast 5 Bogen der „Zarjá“) haben wird. Dies ist das Minimum. Da ich nun schon im Frühling 300 Rubel von der „Zarjá“ erhalten habe, habe ich demnach nach Vollendung der Erzählung ungefähr für 1½ Bogen nachgezahlt zu bekommen. Obwohl sie noch nicht vollendet ist, wird sie doch Ende Oktober gewiss in die Redaktion der „Zarja“ gesandt. Dies ist ganz sicher. Zweitens: obwohl ich nicht das Recht habe, auf dieser Grundlage jetzt Geld voraus zu verlangen, so bitte ich ihn doch, um meiner kritischen Lage willen als Christ mir auszuhelfen und die 200 Rubel zu senden. Da dies aber gleich zu bewerkstelligen schwer sein wird, so bitte ich ihn, nur 75 Rubel sofort abzusenden (dies um mich aus dem Wasser zu ziehen und mich nicht umfallen zu lassen). Dann, zwei Wochen nach dieser ersten Sendung, bitte ich ihn weitere 75 Rubel zu schicken und zuletzt zugleich mit dieser letzten Sendung Ihnen [Apollon N. Maikow] 50 Rubel auszufolgen. Auf diese Weise wird die erbetene Summe von 200 Rubel sich zusammensetzen. Da ich Kaschpirews Persönlichkeit ganz und gar nicht kenne, schreibe ich in einem gesteigert achtungsvollen, wenn auch etwas nachdrücklichen Tone.
Überdies erklärt sich in diesem Brief an Kaschpirew auch meine zweite und hauptsächlichste Bitte. Nämlich, wenn er sich damit einverstanden erklärt, meine Bitte um Geld zu erfüllen, so möge er die ersten 75 Rubel sofort, unverweilt absenden. Ich habe ihm geschrieben, dass ich mich an die ganze Delikatesse seines Geistes und Herzens wende; dass er über das Drängen, sofort und unverweilt das Geld zu senden, nicht beleidigt sein, sondern in die Sache eingehen und begreifen möge: dass für mich die Frist der Hilfe fast wichtiger ist, als das Geld selbst. Ich fügte hinzu, dass es deshalb genüge, im Falle meine Bitte abgelehnt werde, von der Hand seines Redaktions-Sekretärs nur eine Zeile zu erhalten, aber sofort, damit ich so schnell als möglich meine letzten Massnahmen ergreifen könne und nicht vergeblich auf die Möglichkeit einer Geldsendung warte.
Hier habe ich zum zweiten Male in meinem Briefe an Kaschpirew gelogen in Bezug auf die „letzten Massnahmen“, indem ich ihm erklärte, dass ich genötigt sein würde, sofort meine letzten und unentbehrlichsten Sachen zu verkaufen, und für eine Sache, welche 100 Thaler wert ist, deren 20 bekommen würde; was ich natürlich werde zu thun gezwungen sein, um drei Wesen das Leben zu retten, wenn er mit der Antwort zögern würde, wäre es auch eine befriedigende Antwort. — Dass ich in einer Woche anfangen werde, unsere letzten Sachen zu verkaufen, wenn ich kein Geld bekomme, das ist vollkommen wahr — denn anders geht es auf keine Weise; allein ich habe darin gelogen, dass ich sagte, ich würde Hundert-Thaler-Sachen verkaufen. Die zwei, drei Sachen, die wir hatten, welche 100 Thaler wert waren, sind schon längst, gleich nach unserer Ankunft in Dresden, versetzt und thatsächlich anstatt um 100 nach der Schätzung — um 20 Thaler. Jetzt aber wird es heissen die Wäsche verkaufen, den Paletot und meinetwegen den Überzieher; denn wenn ich auch an Katkow schreibe, so wird dennoch von dorther vor einem Monat kein Geld einlangen, obwohl es sicher einlangt.“
In der Fortsetzung dieses Briefes tritt wieder des Dichters ganze persönliche Empfindlichkeit zu Tage, wenn er sagt: ... „(dies unter uns) ich bitte ja nur sozusagen um das Meine. Die Erzählung wird ja in einem Monat alles bezahlen, und wenn ich auch nicht das Recht beanspruche, vorauszunehmen, so wird doch dem allerletzten Schriftsteller eine solche Nachsicht gewährt, so dass, wenn man mir in der „Zarjá“ das verweigert, ich nur allzusehr begreifen werde, auf welche Stufe man mich in litterarischer Beziehung dort stellt.“ — Dostojewsky konnte nach allem Vorangegangenen wissen, dass von einer Weigerung keine Rede sein würde — dennoch immer wieder der empfindliche Zweifel. — „Auch fürchte ich, fährt er fort, dass er meinen allzu ehrfurchtsvollen Ton für ironisch nimmt. Denn, weiss Gott, was es für ein Mensch ist, ich habe ja persönlich keinen Begriff von ihm. Kurz gesagt, ich verstehe es nicht, über heikle Gegenstände an Fremde zu schreiben, und habe später erst beim Überlesen des Briefes bemerkt, dass er gar zu ehrfürchtig zu sein schien. Endlich das Letzte: Ich bat, Katkow möge Ihnen 50 Rubel in die Hand geben, dies (verzeihen Sie mir, mein Teurer, diese Belästigung und erfüllen Sie es um Christi willen) dieses ist, damit Sie 25 Rubel Emilie Fjodorowna geben und 25 an Pascha. Sie haben beide volles Recht, über eine so bettelhafte Aushilfe entrüstet zu sein; aber mögen sie sogar beleidigt sein, sie sind im Rechte. Da aber 25 Rubel doch etwas sind und ihnen ein wenig Nutzen bringen werden, so geben Sie sie ihnen. Da sie durchaus nicht glauben werden, in welcher Lage ich bin und warum ich ihnen so armselig aushelfe, so sagen Sie ihnen auch kein Wort zu meiner Rechtfertigung.“ „P.S. Fast hätte ich das wichtigste vergessen. Als man mir damals von der „Zarjá“ 300 Rubel herausschickte, kugelte das Geld einen Monat herum. Ich kenne diese Stückchen. Die Hauptsache ist, dass mir N. Strachow später schrieb, dass Geld nicht anders geschickt wird. Folglich haben sie auch keine Vorstellung, wie man Geld fortschickt, sodass es ebenso schnell ankommt wie ein Brief, d. h. in drei Tagen.“
Nun setzt Dostojewsky auseinander, wie man es anfangen soll, Geld so abzusenden, dass der Empfänger es rechtzeitig erhalte. Diese Auseinandersetzung gewinnt durch den nächstfolgenden Brief vom 28. Oktober [also einen Monat nach Absendung des vorigen] eine traurige Berechtigung. In diesem Briefe schildert der Dichter mit Wut und Verzweiflung die Einzelheiten dieser Transaktion, die uns, würden wir nicht zugleich von Teilnahme für den Dulder bewegt, ungemein belustigen könnten. Es kommt thatsächlich ein Brief von Kaschpirew an, der ihm mitteilt, er habe durch den Bankier Chessin an Hirsch in Dresden das Geld senden lassen und schliesse hier den Wechsel ein. Dostojewsky eilt zu Hirsch, dieser liest den Wechsel und sagt: „Hier steht: laut Bericht, das heisst, dass ich erst dann das Geld auszahlen darf, wenn ich auf privatem Wege von Chessin Nachricht erhalte; folglich kann ich nicht zahlen.“ Nun läuft Dostojewsky jeden Tag in das Bankkontor, wo man über ihn zu lächeln beginnt — aber kein Avis erscheint. „Da ich die Geduld verliere und ohne Brot bin, schreibe ich an Kaschpirew, stelle ihm meine Lage vor, bitte ihn Chessin zu veranlassen, dass er den Avis an Hirsch sende. Mein Brief ist vom 9. Oktober datiert — keine Antwort! Bei Gott, ich dachte, es werde überhaupt keine mehr kommen. Dabei laufe ich täglich zu Hirsch. Dort lachen sie und meinen, Chessin habe wahrscheinlich den Avis „vergessen“. Nun ging ich in zwei, drei andere Bankgeschäfte mich zu erkundigen — überall sagte man, dass auf meinen Wechsel mit den Worten „laut Bericht“ niemand Geld giebt, ohne einen solchen zu haben. In einem Kontor sagte man, dass manchmal solche Wechsel zum Spass ausgegeben werden.
Endlich erscheint ein Brief von Kaschpirew — am zwölften Tage nach Absendung des meinen! und bemerken Sie, er schreibt am 3. Oktober unseres Stils, und der Petersburger Poststempel weist den 6. Oktober auf. Das heisst, der Brief hat auf seinem Tische nur so ohne Ursache drei Tage herumgelegen. Hätte er wenigstens aus Delikatesse einen 5. aus dem 3. gemacht! Begreift er denn nicht, dass mich das verletzt? Ich habe ihm ja über die Not meines Weibes und meines Kindes geschrieben — und darauf eine solche Fahrlässigkeit! Ist das keine Kränkung? Und nun schreibt er, er habe bei Chessin angefragt, dieser sage, der Avis sei abgegangen und er begreife nicht, warum ich nichts erhalten hätte; ferner habe er Chessin veranlasst, einen zweiten Avis zu schicken, dass er folglich jetzt überzeugt sei, dass ich das Geld von Hirsch erhalten (woher überzeugt, wieso überzeugt?). Sollte ich aber das Geld noch nicht haben, so möge ich den Wechsel zurückschicken; er werde mir am Tage nach dem Erhalt dieses Wechsels einen anderen, auf einen anderen Bankier lautenden absenden. Nachher fügt er in einer Nachschrift hinzu, ich möge ihm, wenn ich das Geld noch nicht habe, unverzüglich telegraphieren, „natürlich auf meine Kosten“, worauf er sofort, ohne die Ankunft des anderen Wechsels abzuwarten, mir den neuen schicken würde. Endlich fügt er hinzu, dass er in den nächsten Tagen auch die übrigen 75 Rubel senden werde (bemerken Sie, dass das alles am 3. Oktober geschrieben wurde).
Telegraphieren konnte ich am selben Tage, d. h. den 21. Oktober nicht, denn wo sollte ich zwei Thaler für ein Telegramm hernehmen? Konnte er sich nach meinen zwei Briefen nicht vorstellen, dass ich nicht eine Kopeke, buchstäblich nicht eine Kopeke hatte! Wenn er nur wüsste, wie ich am nächsten Tage zu diesen zwei Thalern kam, um ihm zu telegraphieren! Nun, ich habe sie bekommen und ihm telegraphiert: „Kein Avis, Hirsch giebt nicht Geld“; das war am Freitag. Sonnabend schicke ich den Wechsel zurück.“
Und nun erzählt Dostojewsky verzweifelt, wie am fünften Tage nach Rücksendung des Wechsels endlich der Avis einlangt, der nun zu nichts nützt. Endlich gesteht Chessin, er habe ihn darum nicht fortgeschickt, weil er gemeint habe, der Wechsel sei seiner Anweisung gemäss auf „ohne Bericht“ ausgestellt, während der Kommis aber irrtümlicher Weise anstatt „ohne“ — „laut“ geschrieben habe. — Man kann wohl begreifen, wie es dem Dichter inmitten dieser ständigen Kämpfe um die Existenz oft „gar nicht litteraturmässig zu Mute war“, wie er das in einem der nächsten Briefe gesteht. —
Nun folgt eine Reihe von Briefen, welche dasselbe Thema variieren, wozu die unlösbaren Verstrickungen seines Lebens den Anlass nie abreissen lassen. Wir übergehen sie und entnehmen ihrem oft äusserst grossen Umfange und den langen Erörterungen nur die rein persönlichen Äusserungen. Am Ende eines Schreibens vom 19. Dezember heisst es: „Wissen Sie, was ich jetzt mache? Nachdem ich in 2½ Monaten neun enggeschriebene Druckbogen fertig gemacht habe, schreibe ich jetzt mit aller Kraft Briefe an alle jene, denen ich so lange nicht schrieb, als ich mit der Erzählung beschäftigt war.“ [Es ist die Erzählung „Der Hahnrei“.] Dann aber, in drei Tagen, setzte ich mich zu dem für den „Russkij Wjestnik“ bestimmten Roman. Denken Sie aber nicht, dass ich Pfannkuchen backe: wie hässlich und abscheulich auch das herauskommen möge, was ich schreiben werde; die Idee des Romans und ihre Bearbeitung sind mir Armen, d. h. dem Autor doch teurer, als alles auf der Welt! Das ist kein Pfannkuchen, sondern die teuerste Idee, die älteste auch. Natürlich werde ich’s verpatzen; aber was ist zu thun!“
„Der Hahnrei“ nimmt unter den Erzählungen Dostojewskys eine eigentümliche Doppelstellung ein, je nach den Erwartungen, welche der europäische und der russische Leser in Dostojewskys Werke legen und darin erfüllt zu finden gewohnt sind. Künstlerisch gehört diese Erzählung zu dem Vortrefflichsten, was der Dichter geschaffen. Luft und Raum zwischen den Personen und Geschehnissen, Einheitlichkeit, Harmonie in allen Teilen. Dies söhnt aber den europäischen Leser nicht mit der Unerquicklichkeit des Gegenstandes, mit der komplizierten Hässlichkeit des Titelhelden aus, in dessen feines Seelenmysterium einzudringen er nicht genug Interesse empfindet, in dessen Erlebnissen er für sich keine Offenbarung holen kann, die ihn etwa für den Mangel an Schönheit entschädigte. Der russische Leser hinwiederum sieht und sucht tiefer. Er sieht die tiefe Lehre, die darin steckt, das unerschöpfliche Erbarmen für den widerlichsten der Sünder, sowie das kühle Laufenlassen des Weltmanns in den letzten sechs Worten des Buches — allein das ist ihm ja nichts Neues, das kennt er alles, das begegnet ihm täglich, das trägt er selbst in sich. Er sucht im russischen Roman Worte, Andeutungen, die sich auf Russland und seine fernere Entwickelung, auf die Jugend, sein künftiges Russland beziehen. Wo er das nicht findet, lässt ihn das vollendetste Kunstwerk nur kalt.
Wir haben viele russische Kritiker Dostojewskys kennen gelernt, Bände ihrer Abhandlungen über einzelne seiner Werke durchgesehen: es ist uns nicht einmal eine Besprechung oder Erwähnung des „Hahnrei“ (ausser jener Strachows in seinem Briefe nach Dresden 1870-1871) in die Hände gekommen. Auch der Dichter selbst dürfte nicht viel von dieser Sache gehalten haben, die er in 2½ Monaten niederschrieb. Das darf uns nicht stören. Wissen wir ja doch, wie oft er sich über seine Werke täuschte. „Prochartschin“, mit dem er sich „einen Sommer lang herumquälte“; „Der Doppelgänger“, den er immer wieder umarbeitete; dann „Die Besessenen“, die er zu seiner Qual, wie wir später sehen werden, nicht vorwärts gehen sah — auf alle diese Werke hielt er die grössten Stücke, meinte, da seien seine besten, tiefsten Ideen in Fleisch und Blut getreten, während dies nur bei dem letzten derselben, und das nur teilweise und bedingt der Fall gewesen ist. Für uns, die wir versuchen in die russischen Anschauungen einzudringen, aus denen das russische Kunstwerk entsteht, ist gerade im „Hahnrei“ eine der tiefsten Ideen Dostojewskys um so klarer hervorgetreten, als hier das Kunstwerk von keiner Überfülle erstickt und vortrefflich disponiert ist.
Eine eigentümliche, echt künstlerische Laune des Dichters hat ihn getrieben, sich da, offenbar mit grosser Wollust, an die Karikatur des Christentums zu machen. Es ist dabei mit vollendeter Deutlichkeit jenes Zerrbild entstanden, das dem modernen Europäer bei der Vorstellung der Demut und Versöhnlichkeit einer Slavennatur gemeiniglich vorschwebt: eine Mischung von hasserfüllter Sentimentalität, rachedürstender Thränenseligkeit, die sich in falschen Bruderküssen auslebt. Alle Möglichkeiten, die in der „breiten slavischen Natur“ bei einander wohnen, hat er hier in eine widerwärtige Wirklichkeit zusammengefasst und dadurch sein Wort bestätigt, dass dies Werk anders in der Form, doch im selben Geiste geschaffen sei, wie die „Memoiren aus dem Kellerloch“.
Sehr klar und wohl durchdacht, wie alle Expositionen des Dichters, ist auch die des „Hahnrei“ (der russische Titel ist: „Der ewige Gatte“ und entspricht der später gegebenen Definition dieser Spezies besser als das unzulängliche deutsche Wort).
Weltschaninow, ein etwas heruntergekommener Lebemann von 39 Jahren, bringt den Sommer in Petersburg zu, um einem Prozess nachzusehen, der ihm den Rest seines ehemals grossen Vermögens, eine Erbschaft von 60000 Rubeln, sichern soll. Er hat alles andere vergeudet und zittert nun um seinen künftigen Egoismus; das heisst, er will alles thun, sogar sparen und geregelt leben, um dessen sicher zu sein, dass er sein gewohntes schmackhaftes „Diner“, seine feine Toilette niemals werde entbehren müssen. Vorläufig aber nimmt er in einem kleinen Restaurant ein Mittagessen zu einem Rubel, hält eine anständige, aber vernachlässigte Wohnung, in welcher ihm die Frau des Hauswächters recht zweifelhafte Ordnung hält, und verfällt durch diesen äusseren Zustand des Sichgehenlassens in eine seltsame Art von Hypochondrie.
Hier setzt das russische Thema ein. Die Hypochondrie plagt den Mann nicht mit Krankheitsbildern, wie sie uns etwa damit belagert, sondern es fallen ihm gewisse kleine Dinge aus seiner Vergangenheit ein, die er „lieber nicht gethan hätte“. Da ist das junge Mädchen aus dem Volke, das er verführt und samt ihrem Kinde verlassen hat; der junge Fürst, dem er für nichts und wieder nichts im Duell das Bein zerschossen hat, und manches andere mehr. Weltschaninow verfügt bei aller Hypochondrie über einen klaren, gesunden Menschenverstand; er sagt sich, dass er, käme die Sache wieder so, unzweifelhaft der alten Fürstin dennoch das Leid zufügen würde, ihrem Söhnchen das Bein abzuschiessen — heute aber, in seiner jetzigen Verfassung verdriesst ihn das, lässt es ihm keine Ruhe. Hier haben wir in wenigen Strichen den russischen Weltmann mit dem Einschlag: Reue und Einkehr aus äusseren Gründen, eine Reue auf Zeit, die, wie wir sofort empfinden, der gesicherten Erbschaft und dem guten kleinen Diner bald das Feld für neue Thaten räumen wird.
An ein Erlebnis jedoch scheint er sich nicht zu erinnern, und gerade dies soll ihm verhängnisvoll werden. Ihm begegnet fast täglich ein Mann mit einem Hut, um den ein Trauerflor geschlungen ist. Das Gesicht reizt, verdriesst ihn; es verfolgt ihn, sodass Appetit und Schlaf vergehen. Endlich scheint ihm, er müsse den Mann „einmal gekannt haben“. Da, in einer schlaflosen Nacht tritt er ans Fenster, schiebt die schwere Gardine, welche ihm die Helle der Petersburger Nächte zu decken bestimmt ist, auseinander und sieht auf dem jenseitigen Bürgersteig — den Mann mit dem Trauerhute stehen und spähend auf sein Fenster blicken. Kaum ist er mit Staunen seiner ansichtig geworden, als jener auch schon über die Strasse und — gerade ins Haus geht. Weltschaninow tritt in sein Vorzimmer und lauscht mit atemloser Spannung. Richtig, da kommt es auf der Treppe heraufgeschlichen, da drückt und zerrt es an der Thürklinke. Weltschaninow öffnet plötzlich die Thüre, und vor ihm steht der Mann „mit dem Krepp“, in welchem er mit einemmale Paul Pawlowitsch Trussotzky, den Mann erkennt, mit dessen Gattin, einer russischen Madame Bovary, er vor neun Jahren in der Provinzstadt T. ein intimes Verhältnis unterhalten hatte. Er nötigt Trussotzky in die Stube und fordert Aufklärung über den nächtlichen Besuch. Dieser entschuldigt sich nur halb, er sei auf dem Heimwege vorübergegangen und, „ohne es eigentlich zu wollen, zufällig“ heraufgekommen. Er erzählt ferner, dass er, um in ein anderes Gouvernement versetzt zu werden, nach Petersburg gekommen sei und nun in seiner Stimmung nicht loskomme. Dabei deutet er auf den Krepp auf seinem Hute. „Ja, sie; Natalja Wassiljewna! im heurigen März!“ beantwortet er Weltschaninows Frage. Nun weiss er den überraschten und mehr, als er’s vermutet hatte, erschütterten Weltschaninow mit süsslich stichelnden Anspielungen so in die Enge zu treiben, dass dieser in die höchste Aufregung kommt und ihm, zu Trussotzkys steigender Freude, mehr als ein unvorsichtiges Wort entschlüpft. Diese Szene ist voll vortrefflicher kleiner Züge, die das innerste Wesen dieser beiden Menschen aufdecken.
Endlich schickt Weltschaninow den verhängnisvollen Gast fort, schliesst diesmal seine Thüre fest zu und wirft sich angekleidet auf sein Lager. Als er spät am Morgen erwacht, fällt ihm sofort der Tod jenes Weibes ein. Er denkt über sie nach, kommt zu dem Schluss, dass sie verderbt war — mit seiner Beihilfe, wie der Dichter „im Vorübergehen“ bemerkt — ohne sich im geringsten dafür zu halten, und dass eine solche Frau als notwendigen Gegenpart einen Hahnrei zum Manne haben müsse. „Seiner Ansicht nach besteht die Wesenheit solcher Gatten darin, dass sie „ewige Gatten“ oder, besser gesagt, im Leben nur Gatten sind und weiter nichts.“ „Ein solcher Mensch wird geboren und entwickelt sich einzig und allein, um sich zu verheiraten und, nachdem er sich verheiratet hat, sich sofort in eine Zugabe seiner Frau zu verwandeln, auch in dem Falle, dass er selbst einen eigenen unbestreitbaren Charakter besässe. Das Hauptmerkmal eines solchen Gatten bildet — ein gewisser Stirnschmuck. Ein so Gehörnter nicht zu sein, ist ihm gerade so unmöglich, als es der Sonne ist, nicht zu scheinen. Allein er weiss nicht nur gar nichts davon, sondern er kann den Naturgesetzen nach nie etwas davon wissen.“
Weltschaninow hat sich im letzten Augenblick Trussotzkys Adresse geben lassen und findet ihn endlich in einer elenden Mietwohnung, halbangekleidet — ein kläglich bittendes Kind züchtigend. Es ist Lisa, der Verstorbenen Töchterchen, „das uns geboren wurde, als Sie schon — wie lange fort waren?“ Er zählt die Monate: ja acht Monate, nachdem Sie fort waren. — Das Kind ist furchtbar eingeschüchtert. Wir erfahren aus Abrissen des Gespräches, dass Trussotzky das Kind sehr geliebt, nach dem Tode der Frau aber gequält, geschreckt und Tage lang sich selbst überlassen habe. Weltschaninow erkennt unter Qualen, dass es sein Kind ist, und führt es zu guten Freunden aufs Land. Es ist eine kinderreiche Familie, die das kranke, scheue Mädchen liebevoll aufnimmt. Das Kind erkrankt dort am zweiten Tage und stirbt, ohne dass Trussotzky auch nur einmal hinausgekommen wäre, sich nach ihm umzusehen. Weltschaninow entschliesst sich mit Widerwillen, den Mann wegen des Begräbnisses aufzusuchen, und findet ihn endlich in trunkenem Zustande bei einigen „Damen“. Als er ihm mitteilt, dass sein Töchterchen gestorben sei und die Bestattungspflichten an ihn herantreten, ruft er ihm lallend giftig die Worte zu: „Erinnern Sie sich des Lieutenants, der nach Ihnen ankam; zu dem gehen Sie wegen der Bestattung.“ Der Rausch allein versetzt ihn in die mutige Stimmung, giftige Pfeile unmittelbar nach seinem Feinde zu schleudern. Indessen zahlt er nach einigen Tagen in nüchternem Zustande jener Familie die Begräbniskosten bei Heller und Pfennig.
Dies ist das erste Stück seiner Rache. Er will nichts anderes, als in Weltschaninow jene Empfindungen erwecken, die er selbst gehabt, als er erfuhr, dass nicht er Lisas Vater sei. Zwischen diesen durch Trunkenheit aufgestachelten Rache-Versuchen des feigen „Gatten“ spielen sich Szenen widriger „Vergebung“, Küsse, Thränen, Umarmungen ab, denen sich Weltschaninow — da er sich im Banne der Schuld fühlt, ihn auch wohl nach einem klaren Abschluss dieser peinvollen Sache verlangt und vor allem, weil er eben jetzt physisch entsprechend konstituiert ist — auf keine Weise entwinden kann. Nach einer solchen Szene, die ihn wieder in den Bann seiner eigenen Reuegefühle versetzt hatte, lässt er sich auch von Trussotzky erbitten, ihn zu einer töchterreichen Familie aufs Land zu begleiten, in deren Schosse er, Trussotzky, sich — eine Braut erwählt habe. Es ist dies die sechste der Haustöchter, Nadja, eine frische, kecke Gymnasiastin. In Weltschaninow, der auf der Fahrt mit seinem Gefährten auch nicht ein Wort gewechselt hatte, erwacht draussen unter der blühenden Mädchenschar der alte Frauenbestricker; er musiziert, singt, entzückt die junge Nadja und reizt dadurch Trussotzky zu verbissener Wut.
Als ein Gewitter heraufzieht, fahren sie endlich auf Trussotzkys stilles Drängen nach Petersburg zurück, wo dieser Weltschaninow in seine Wohnung folgt. Der Hausherr ist erschöpft, fühlt sich leidend; Trussotzky aber weicht nicht von der Stelle, bis er nicht das Versprechen empfangen hat, Weltschaninow werde niemals in jenes Haus zurückkehren. Da, schon spät am Abend, unter Blitz und Donner, stürmt ein sehr junger Mensch herein, der sich als Nadjas heimlich Verlobter vorstellt und mit der ganzen Sicherheit und Anmassung der Jugend — eine meisterhafte Szene — Trussotzky verbietet, um seine Braut zu werben. Diese Episode zieht sich so lange hin, dass endlich Weltschaninow nach des Studenten Abgang Paul Pawlowitsch veranlasst, bei ihm zu übernachten. Kaum hat sich Weltschaninow niedergelegt, als der Brustkrampf, welcher ihn schon seit geraumer Zeit angefallen hatte, sich zu einem unerträglichen Grade steigert. Trussotzky eilt in die leere Küche, macht Feuer an, weckt die Frau des Hauswächters und wärmt abwechselnd mit ihr Tücher und Teller, die er mit unermüdeter Sorgfalt dem Kranken auflegt, giebt ihm Thee zu schlucken, den er schnell bereitet hat, bis endlich das Übel sich legt und nur eine grosse Schwäche zurückbleibt, die zur Nachtruhe mahnt.
Überwältigt von dieses Menschen aufrichtiger Bemühung um ihn, ruft ihn Weltschaninow noch einmal an sein Lager und sagt halbmurmelnd: „Sie — Sie — Sie sind besser als ich! Ich begreife alles, alles ... ich danke Ihnen.“ — Trussotzky löscht das Licht aus und legt sich leise auf den zweiten Divan nieder. Es ist nach dem Gewitter tiefdunkel in der Stube, wo schwere Vorhänge das Licht ausschliessen. Nur vom Nebenraum her dringt ein schwacher Schein herein. Weltschaninow hat einen beängstigenden Traum. Er hat ihn schon einmal gehabt, als Trussotzky das erste Mal bei ihm übernachtet hatte und er ihn plötzlich mitten im Zimmer stehend mehr fühlte als sah. Ihm war auch diesmal, als kämen immer mehr Leute die Treppe herauf und zu ihm herein, sodass die Stube zu voll wird, um darin atmen zu können. Endlich hört er genau, ebenso wie damals, drei Glockenschläge an der Wohnungsthür und erwacht mit einem Schrei.
Eine Eingebung heisst ihn mit vorgestreckten Händen dorthin eilen, wo Paul Pawlowitsch schläft. Da berühren seine Hände zwei andere Hände, etwas Scharfes schneidet in seine Linke und fällt darauf zu Boden. Es ist sein Rasiermesser, das gerade heute zufällig auf dem Tischchen neben dem Divan liegen geblieben war. Nun folgt ein minutenlanger, lautloser Kampf, der damit endet, dass Weltschaninow trotz seiner Schwäche Trussotzky niederwirft und ihm die Hände mit der Vorhangschnur, die er mit Zorneskraft abgerissen, auf dem Rücken zusammenbindet.
Es ist nun fünf Uhr geworden. Weltschaninow lässt den vollen Tag herein, eilt zu einem Schrank um ein Handtuch, verbindet sich damit die blutende Hand, hebt das Rasiermesser vom Boden auf, verwahrt es an seinem Ort und wendet sich zuletzt Trussotzky zu, welchem es indessen gelungen war sich aufzurichten und in einen Stuhl zu setzen. Plötzlich blickt er halb stumpf empor und deutet nach der Wasserflasche: „Wasser möcht’ ich“, flüstert er. Weltschaninow giesst ein Glas voll ein und führt es zu seinen Lippen, bis der Durst schluckweise gestillt ist. Darauf nimmt Weltschaninow sein Kopfkissen und begiebt sich in das Nebenzimmer zur Ruhe, nachdem er vorher Trussotzky nach aussen eingeschlossen hat.
Wir lassen hier den Dichter erzählen: „Seine Schmerzen waren ganz vergangen, allein er empfand aufs neue eine ungeheure Mattigkeit, jetzt nach der aussergewöhnlichen Anspannung seiner ihm, weiss Gott woher, zugeströmten Kräfte. Er wollte versuchen sich den ganzen Vorgang vorzustellen, allein seine Gedanken vermochten sich noch nicht aneinander zu reihen; der Schlag war allzu stark gewesen. Bald fielen ihm die Augen zu und blieben etwa zehn Minuten geschlossen, bald zuckte er plötzlich zusammen, erwachte, erinnerte sich an alles, erinnerte sich seiner schmerzenden, in das blutnasse Handtuch gewickelten Hand und begann fieberhaft, wühlend, nachzudenken. Klar wurde ihm nur eines: dass Paul Pawlowitsch ihm thatsächlich hatte die Gurgel abschneiden wollen, dass er aber möglicherweise eine Viertelstunde vorher nicht wusste, dass er es thun werde. Das Rasierzeug (das übrigens sonst immer im Schreibtisch eingeschlossen lag) war von ihm vielleicht erst am Abend mit dem Blick gestreift worden, ohne jedoch dabei irgend einen Gedanken in ihm zu erwecken. „Wenn er sich schon seit langem vorgenommen hätte, mich umzubringen — fiel ihm unter anderem ein —, so hätte er sicherlich schon ein Messer oder eine Pistole vorbereitet und nicht auf mein Rasiermesser gerechnet, das er bis zum gestrigen Tage noch nie gesehen hat.“
Der Dichter kommt auf das Unbewusste im Handelnden zurück, und damit beim Leser auch kein Irrtum sei, wie er Trussotzky zu betrachten habe, lässt er diesen eben das noch nie gesehene Rasiermesser benutzen. Er geht noch weiter. Im Kapitel, das ‚Analyse‘ überschrieben ist, nimmt Weltschaninow den Faden seiner Folgerungen — nachdem er Trussotzky entlassen hat — folgendermassen wieder auf. „Diese Leute,“ dachte er, „eben diese Leute, welche vor einer Minute noch nicht wussten, werden sie den Hals abschneiden oder nicht, — wenn die schon einmal das Messer in ihre zitternde Hand nehmen und sie den ersten Spritzer heissen Bluts auf ihren Fingern fühlen, dann bleibt es nicht beim Schneiden allein — den ganzen Kopf schneiden sie dann herunter: ‚zum Wohlsein‘, wie die Arrestanten sagen. So ist es.“
Dieses tiefe Eindringen in den Blutrausch der unbewusst Mordenden zeigt er noch ausführlicher in der Besprechung des Prozesses der Kairowa, welche „noch am Vorabend sicher nicht wusste, ob und wie weit sie ihrer Rivalin in die Gurgel schneiden werde“. Auch in jener ergreifenden Gerichtsszene, wo Dmitri Karamasow erzählt, er habe daran gedacht, den Vater zu töten, aber den mörderischen Stössel von sich in den Garten geschleudert, er wisse nicht warum — „es muss wohl in diesem Augenblick meine Mutter für mich gebetet haben“, meint er — auch hier ist das Mysterium betont, die tiefen Zusammenhänge der Möglichkeiten in der Menschenseele, über die kein Gesetz je gerecht zu entscheiden vermag.
Im weiteren Verlauf der Analyse kommt Weltschaninow-Dostojewsky zu seltsamen Schlüssen: „Wenn es also entschieden ist, dass er mich ohne Vorbedacht umzubringen auf dem Wege war, grübelte Weltschaninow, ist ihm dieser Gedanke etwa schon einmal früher in den Sinn gekommen, wenn auch nur wie eine Vorstellung in einem zornigen Augenblick?“ „Er löste die Frage seltsam, — damit, dass Paul Pawlowitsch ihn wohl umbringen gewollt, dass aber der Gedanke des Mordes dem künftigen Mörder auch nicht einmal eingefallen war.“ Kürzer gesagt: „Paul Pawlowitsch wollte umbringen, allein er wusste es nicht, dass er umbringen wollte. Das ist unsinnig, aber es ist so,“ dachte Weltschaninow: „er ist wegen meiner hergefahren und mit Lisa hergekommen!“ „Und war denn das wahr, das alles wahr,“ rief er, plötzlich den Kopf vom Kissen erhebend und die Augen öffnend, „alles, was dieser ... Verrückte mir gestern über seine Liebe zu mir vorgeredet hat, als sein Kinn zu zittern begann und er sich mit der Faust an die Brust schlug?“ „Vollkommene Wahrheit,“ entschied er, sich immer mehr in die Analyse vertiefend, „dieser Quasimodo aus T. war genug dumm und edelmütig dazu, um sich in den Liebhaber seiner Frau zu verlieben. [Man merke hier die Anschauung des Weltmannes Weltschaninow, wie sie der Dichter markiert.] Einer Frau, der er zwanzig Jahre lang nichts anmerkte. Er achtete mich neun Jahre lang, ehrte mein Andenken und erinnerte sich an meine ‚Aussprüche‘ — Herrgott, und ich wusste von gar nichts! Er konnte gestern nicht lügen! Aber, liebte er mich gestern, als er mir seine Liebe erklärte und sagte: ‚werden wir quitt?‘ Ja, aus Bosheit liebte er mich; diese Liebe ist die allerstärkste.“
Nun lässt der Dichter Weltschaninow sich erinnern, welchen Eindruck er auf diesen „Schiller in der Form eines Quasimodo“ gemacht habe. [Bei den Russen ist der Name Schiller als ein Gattungsname für verschrobene, hohle Idealisten eingebürgert.] Den günstigsten, vor allem durch seine Handschuhe und die Art, sie zu tragen; „denn die Quasimodos lieben die Ästhetik, hu, wie sie sie lieben! Handschuhe sind ganz genügend für manche edle Seele, gar aus dem Geschlechte der ‚ewigen Gatten‘.“ Weltschaninow geht alle Phasen von Trussotzkys Zustand durch, natürlich in der Beleuchtung des leichtfertigen Weltmannes. „Wenn auch dieser, wem kann man danach noch trauen!“ — „Nach einem solchen Aufschrei wird man ein Tier!“ denkt er bei sich.
„Hm! er ist hergekommen, um mich zu umarmen und mit mir zu weinen“, wie er selbst es in der niedrigsten Weise ausgedrückt hat — das heisst, er kam, um mich umzubringen, und dachte dabei, es sei „um mich zu umarmen und mit mir zu weinen“ ... Auch Lisa hat er hergebracht ... Wie aber, wenn ich mit ihm geweint hätte, da hätte er mir vielleicht thatsächlich verziehen, weil er schrecklich das Bedürfnis hatte, zu verzeihen! .. Alles das hat sich aber bei der ersten Begegnung in betrunkene Gewaltstücke, in Karikatur verwandelt, in weibisches Geheul über die Beleidigung. (Hörner hat er sich vor mir auf die Stirne gemacht, Hörner!) Darum ist er auch in trunkenem Zustand gekommen, um sich wenigstens fratzenhaft auszusprechen usw. Und wie er in der Nacht herumgesprungen ist, die Teller zu wärmen, dachte eine Abwechselung zu machen — vom Messer zum innigen Mitgefühl! Sich und mich wollte er retten — mit gewärmten Tellern! ...“
Endlich kommt Weltschaninow zur Ruhe, schläft sich aus, erwacht mit einem unendlichen Gefühl der Erleichterung, dass „alles vorüber sei“, geht an diesem Tage viel aus und hat Mühe sich zurückzuhalten, um nicht dem ersten besten sein Erlebnis zu erzählen. Nach einer gut zugebrachten Nacht erwacht er mit einem ungeheueren Schrecken. Er fühlt, dass er: Trussotzky aufsuchen muss. „Warum? Wozu? Darüber wusste er nichts und empfand einen tiefen Widerwillen es zu wissen, wusste aber nur das, dass er gewiss aus irgend einem Grunde dahin kriechen werde.“
Also auch hier versäumt es der Dichter nicht, das echt russische Schuld- und Ausgleichsbedürfnis in die Gegenfigur des in zwei gespaltenen Menschen ohne Gott zu legen. Den Weltmenschen wie den Sünder treibt das unbewusste Verlangen geheimnisvoll nach dem „Quittwerden“ mit äusseren und inneren Geschicken. Ohne dass ein einziges Mal im ganzen Buche der christliche Gedanke mittelbar oder unmittelbar ausgesprochen würde, sehen wir, wie er sich allmählich aus den Zuständen und den endgiltigen Schicksalen dieser Beiden herausschält.
Weltschaninow macht sich also auf den Weg zu seinem Mörder, begegnet aber dem jungen Studenten, Nadjas „Bräutigam“, in angeheitertem Zustand, der ihn mit dem Namen Trussotzkys anspricht. Weltschaninow ergänzt halb unbewusst, seiner inneren Vermutung folgend: „— — hat sich erhenkt“. „Ei was erhenkt, wir haben ihn zur Bahn begleitet, im Waggon noch mit ihm getrunken, auch auf Ihr Wohl.“ — —
Im letzten Kapitel, einer Art Epilog, mit der Aufschrift „Der ewige Gatte“, finden wir Weltschaninow zwei Jahre später, verjüngt, voll frischer Lebenspläne, seine ehemaligen „hypochondrischen Schrullen“ belachend, auf der Reise. Er hat seine Erbschaft angetreten, verwaltet sein Vermögen vernünftig, hat sein tägliches gutes, kleines „Diner“, verkehrt wieder mit der „Gesellschaft“, wo ihn „alle“ wieder aufs freundlichste in ihrer Mitte aufnehmen, als sei er nur „verreist gewesen“. Er fährt nach Odessa, um einen Freund zu besuchen und eine interessante Dame zu treffen, deren Bekanntschaft er schon lange zu machen gewünscht hat. Da, auf einem Kreuzungspunkte der Bahnlinien, fällt ihm ein, dass eine andere interessante Dame, eine ehemalige Bekannte, nicht weit von der Station, jedoch auf der anderen Linie ihre Besitzung habe und dass er sehr wohl die Fahrt unterbrechen könne, um auch sie zu besuchen. Doch war er noch nicht ganz entschlossen und erwartete, da ein Aufenthalt von 40 Minuten vollauf Zeit liess, irgend einen „Anstoss von aussen“.
Da entsteht im Gedränge der Fahrgäste beider Züge auf dem Bahnsteig eine laute Szene. Eine hübsche und sehr auffallend gekleidete junge Dame aus der Provinz zerrt einen betrunkenen, sehr jungen Offizier hinter sich her, welcher Skandal macht und ihr nicht in den Saal folgen will. Man drängt sich um sie, macht schlechte Witze, verlacht, beschimpft sie endlich. Sie sieht sich ängstlich nach jemand um, der ihr helfen möchte. Weltschaninow eilt herzu, nimmt sie in Schutz, packt einen sie belästigenden Krämer am Kragen und schafft im Nu Ruhe, da alles vor dem eleganten Herrn zurücktritt. Die Dame fliesst vor Dankbarkeit über, der junge Ulan brüllt ein besoffenes „Dddanke!“ und streckt sich auf zwei Stühle aus, wo er einschläft.
Weltschaninow hat der Vorfall interessiert: die Frau ist hübsch, scheint reich zu sein, wenn auch von etwas komisch kleinstädtischen Manieren. Sie dankt ihm wiederholt, schmäht auf ihren Mann, der, weiss Gott wohin verschwunden sei. Da taucht plötzlich ein bekannter Kahlkopf aus der Menschenmenge hervor; er kommt gerade auf die Gruppe zu. Es ist der Gatte; Paul Pawlowitsch steht vor Weltschaninow. Die Frau überhäuft ihn mit Vorwürfen und stellt ihm den Retter vor. Weltschaninow durchbricht die Entsetzensstarre, die jenen erfasst hatte, legt seinen rechten Arm kameradschaftlich um des anderen Schulter und sagt lachend: „Wir sind ja Freunde, von Kindheit an, hat er Ihnen nicht von Weltschaninow gesprochen?“ Olympia Semjonowna ladet nun diesen dringend ein, sie auf ihrem Gute zu besuchen, was er auch bestimmt zusagt.
Paul Pawlowitsch beeilt sich, die Gattin samt dem „jungen Verwandten“ in den Waggon zu bringen, und kehrt vor Aufregung zitternd zu Weltschaninow zurück, um ihm das Versprechen abzunehmen, dass dieser sie nicht besuchen werde. Es wird zur Abfahrt geläutet. Olympia und der Ulan rufen: „Paul Pawlowitsch! Paul Pawlowitsch!“ Paul Pawlowitsch wurde abermals unruhig und fing an, sich hin und her zu drehen; da packt ihn der — nun durch Gesundheit von aller Sentimentalität befreite — Weltschaninow am Ellbogen, hält ihn fest und sagt: „Wollen Sie, ich gehe sofort zu Ihrer Gattin und erzähle ihr, wie Sie mich einmal umbringen wollten — ha?“ „Was wollt Ihr, Herr, was wollt Ihr — Gott bewahre Euch.“ „Paul Pawlowitsch, Paul Pawlowitsch!“ hört man wieder rufen. Endlich lässt Weltschaninow ihn los. „Nun, gehen Sie endlich“ sagt er, ihn gutmütig anlachend. [Wie charakteristisch hier die Leichtfertigkeit des Weltmenschen, der einen Scherz aus der Sache macht und den Mörder „gutmütig anlacht“; wie echt russisch auch!]
„Also Sie kommen nicht?“ flüsterte fast verzweifelt Paul Pawlowitsch zum letzten Male und legte sogar, wie ehemals, die Hände bittend vor ihm zusammen. „Ich schwöre es Ihnen ja, ich komme nicht! Laufen Sie, sonst giebts Verdruss.“ Und er streckte ihm behäbig breit die Hand entgegen — er streckte sie hin — und zuckte zusammen: Paul Pawlowitsch nahm die Hand nicht, zog sogar die seine zurück.
Da ertönte das dritte Glockenzeichen. In einem Augenblick ging nun etwas Seltsames mit den Beiden vor sich; es war, als wären Beide in ihr Gegenteil umgewandelt. Etwas zuckte und riss an Weltschaninow, der eben erst so gelacht hatte. Er packte Paul Pawlowitsch fest und wütend an der Schulter. „Wenn schon ich, ich Ihnen diese Hand reiche“ — und er wies ihm die linke Handfläche, in welcher die Schramme der Schnittwunde deutlich zu sehen war — „so können Sie sie wohl nehmen!“ stiess er leise mit zitternden, erbleichenden Lippen hervor. Auch Paul Pawlowitsch war bleich geworden und auch seine Lippen bebten. Wie Krämpfe lief es über sein Gesicht. „Und Lisa. Herr?“ lallte er im schnellen Flüstortone — und plötzlich begannen ihm Lippen, Kinn und Wangen heftig zu zittern und zu zucken, und Thränen stürzten aus seinen Augen. Weltschaninow stand vor ihm, zur Säule erstarrt. „Paul Pawlowitsch, Paul Pawlowitsch!“ brüllte man aus dem Waggon, als würde dort jemand umgebracht — und plötzlich ertönte ein Pfiff. Paul Pawlowitsch kam zu sich, schlug die Hände zusammen und begann über Hals und Kopf zu rennen. Der Zug hatte sich schon in Bewegung gesetzt, allein es gelang ihm irgendwie, sich anzuhängen, und er sprang im vollen Lauf noch zurecht gerade in seinen Waggon.
Weltschaninow blieb auf der Station und fuhr, nachdem er einen anderen Zug abgewartet, erst abends, doch in der früher eingeschlagenen Richtung weiter. Nach rechts, zur Bekannten auf dem Landgute fuhr er nicht — es war ihm so gar nicht danach zu Mute. Und wie hat er das später bereut!“
Wen erschütterte nicht dieser mächtige und doch so einfache Schluss? Die tiefe Unruhe des Weltmannes wie die des „ewigen Gatten“, jener Beiden, die mit sich und mit einander nicht „quitt“ werden können, weil sie das nicht in sich tragen, was allein den „irrationalen Rest“ zwischen Begierde und Erfüllung aufhebt: einen Gott — der Künstler hat sie in jedem von ihnen gestillt. Aber wenn er den Weltmann mit jenen letzten Worten „wie hat er das später bereut!“ entlässt, ihn also seine Ruhe endgiltig in den wiedergewonnenen Lebensgenüssen finden lässt, so schüttet sein Genius über das Haupt des von Schmerzen zuckenden, widerwärtigen Sünders etwas von jenem Liebesstrom aus, dem einst die Worte entstiegen: „Ihr wird viel vergeben, denn sie hat viel geliebt.“
In einem Briefe vom 24. Februar 1870 schreibt Dostojewsky, ebenfalls an Maikow, unter anderem: „Ich bin wieder in einer solchen Not — es ist um sich nur aufzuhängen!“ Weiter heisst es: „Nach einer langen Pause zwischen den Anfällen haben diese angefangen mich wieder zu quälen und ärgern mich hauptsächlich darum, weil sie mich an der Arbeit hindern. Ich habe eine reiche Idee in Angriff genommen. Ich rede nicht von der Ausführung, nur von der Idee. Es ist eine jener Ideen, welche eine unzweifelhafte Wirkung auf das Publikum ausüben. Etwas in der Art wie „Schuld und Sühne“, allein noch näher, der Wirklichkeit mehr an den Leib gerückt und sich auf die wichtigste Frage der Gegenwart beziehend“.
In einem Briefe an Strachow vom 10. März 1870 finden wir eine Wiederholung des abfälligen Urteils über frühere besprochene Nummern der „Zarjá“, worin auch eine Kritik Strachows gewesen war. Diese überzeugten Wiederholungen derselben Gedanken mit den nämlichen Ausdrücken sind sowohl in den Briefen, als auch in den Werken Dostojewskys sehr häufig und für ihn charakteristisch. Hier, in diesem Briefe ist die Wiederholung allerdings auch noch ein Beweis von Dostojewskys grosser Offenheit, ein Beweis, der uns nach so vielen Äusserungen persönlichen Misstrauens und Furcht vor verschobenen Beziehungen höchst wohlthuend berührt, ja Bedürfnis war. In noch viel grösserem Ausmasse finden wir diese Offenheit in den Briefen an jene tausend Unbekannte, die sich an den berühmten Seelenerforscher und Seelenkenner um Rat und Zuspruch wandten. Wir werden die bemerkenswertesten dieser Antworten weiter unten anschliessen. In einem Briefe an Strachow heisst es: „Ihr Artikel aber, obwohl vortrefflich, behandelt immer das alte Thema (ich spreche hier nicht von meinem Gesichtspunkt, sondern von dem der Abonnenten). Übrigens, wer hat Ihnen gesagt, dass Ihr Aufsatz über Turgenjew besser sei, als der über Tolstoj? Der Artikel über Turgenjew ist eine sehr schöne und klare Arbeit, aber in jenem über Tolstoj haben Sie gleichsam Ihre Grundanschauung niedergelegt, aus der heraus Sie Ihre Thätigkeit fortzusetzen gedenken — so sehe ich die Sache an. Und ich bin mit allem einverstanden (was ich früher nicht war), und lehne von allen den paar tausend Zeilen dieses Artikels nur zwei ab — nicht mehr, nicht weniger —, mit welchen ich mich unbedingt nicht einverstanden erklären kann. Doch davon später.“
Die Aufforderung, an der „Zarjá“ beständig mitzuarbeiten, beantwortet Dostojewsky mit der Bedingung, dass ihm Honorarraten vorgeschossen würden. „Ein Thema habe ich wohl auch jetzt. Ich will mich darüber nicht ausbreiten, nur dies will ich sagen: es ist selten etwas Neueres, Volleres und Originelleres in mir aufgetaucht. Ich kann so sprechen, ohne der Ruhmsucht geziehen zu werden, da ich nur vom Thema spreche, von der Idee, die in meinem Kopfe zu Fleisch geworden, aber nicht von der Ausführung. Die Ausführung hängt von Gott ab. Ich kann auch alles verderben, was sich schon oft bei mir ereignet hat; allein eine innere Stimme sagt mir, dass mich die Inspiration nicht verlassen wird. Aber für die Neuheit des Gedankens und die Originalität der Inscenierung verbürge ich mich und blicke vorläufig mit Entzücken auf diese Idee. Es wird ein Roman in zwei Teilen sein, nicht weniger als zwölf, keinesfalls mehr als fünfzehn Bogen stark. Er kann sicher noch dieses Jahr (1870) am 1. Dezember der Redaktion zugestellt werden; ich kann mich der Zeit versichern, um ordentlich zu schreiben. (NB. Der Roman könnte auch schon zum 1. November zugestellt werden, aber ich muss gestehen, mir wäre es sehr unlieb, in einem und demselben Jahre zum zweiten Male eine grössere Erzählung in ein und dasselbe Blatt zu schreiben. Wäre es nicht besser, so wie jetzt, erst zum Januar oder Februar des künftigen Jahres? Übrigens könnte es, scheint mir, auch gar nicht anders sein.) Zum Schluss die Stelle: „Anna Grigorjewna grüsst Sie und gedenkt Ihrer mit Herzlichkeit. Wir tollen jetzt mit unserer Ljubotschka herum. Ach, warum sind Sie nicht verheiratet und haben kein kleines Kind, lieber Nikolai Nikolajewitsch! Ich schwöre Ihnen, dass darin dreiviertel unseres Lebensglücks enthalten ist und in allem übrigen wohl nur ein Viertel. — Werde ich denn auch heute nicht die „Zarjá“ erhalten?“ — heisst es am Schlusse — „ich spitze schon die Lippen nach Ihrem Artikel ‚Die Frauenfrage‘ — was für ein Thema! Ich verspreche mir einen ausserordentlichen Genuss. Gerade Sie können darüber schreiben, wie es nötig ist usw.“
Dem Plan des Romans schien es beschieden zu sein, vielfache Änderungen der Ausführung und lange Verzögerungen zu erleiden. Schon am 5. April 1870 schreibt der Dichter gleich zu Anfang seines Briefes: „Ich will Ihnen offen und endgiltig sagen, dass ich, alles berechnet, den Roman auf keine Weise für die Herbsthefte versprechen kann oder zu versprechen wage.
Auf die Sache, welche ich jetzt für den Russkij Wjestnik schreibe, baue ich grosse Hoffnungen, aber nicht vom künstlerischen Standpunkt aus, sondern von dem der Tendenz. Ich habe Lust einige Gedanken herauszusagen, sollte dabei auch mein Künstlertum zu Grunde gehen. Aber es drängt mich, was sich alles in Geist und Herz bei mir aufgehäuft hat; mag ein Pamphlet daraus werden, ich spreche mich doch dabei aus. Ich hoffe auf Erfolg — übrigens, wer setzt sich denn zum Schreiben, ohne auf Erfolg zu hoffen?“ Weiter heisst es: „Ich beendige bald, was ich für den „Russkij Wjestnik“ schreibe, und werde mich mit Wollust zum Roman setzen. Die Idee zu diesem Roman lebt in mir schon drei Jahre, allein früher fürchtete ich mich im Auslande daran zu gehen; ich wollte dazu in Russland sein. Nun ist in drei Jahren vieles reif geworden, der ganze Plan des Romans; und ich denke, dass ich den ersten Teil desselben, d. h. jenen, welchen ich für die „Zarjá“ bestimmt, auch hier beginnen kann, da die Handlung viele Jahre früher beginnt. Beunruhigen Sie sich nicht darüber, dass ich von einem „ersten Teil“ spreche. Die ganze Idee verlangt einen grossen Umfang, mindestens einen so grossen, wie Tolstojs Roman „Krieg und Frieden“. Aber, das wird fünf abgesonderte Romane bilden, und zwar so abgesonderte, dass einige davon (mit Ausnahme der zwei mittleren) sogar in verschiedenen Zeitschriften, als ganz selbständige Erzählungen oder, einzeln herausgegeben, als ganz vollständige Dinge werden erscheinen können. Der Gesamtname übrigens wird sein: „Das Leben eines grossen Sünders“, während die einzelnen Teile ihre besonderen Titel haben werden. Jeder Teil (d. h. Roman) wird nicht mehr als fünfzehn Bogen haben. Zum zweiten Teil muss ich schon in Russland sein. Die Handlung dieses Teils wird in einem Kloster vor sich gehen, und obwohl ich das russische Kloster vortrefflich kenne, so muss ich dennoch dazu in Russland sein. Ich würde überaus gern des näheren mit Ihnen darüber sprechen, aber was sagt man denn schriftlich? Ich sage noch einmal, für dieses laufende Jahr kann ich nichts versprechen; drängt Ihr mich nicht, so bekommt Ihr eine gewissenhafte Arbeit, vielleicht sogar eine gute. Wenigstens habe ich aus dieser Idee das Ziel meiner ganzen künftigen litterarischen Laufbahn gemacht, denn ich darf nicht länger als auf 6-7 Jahre Leben und Arbeit rechnen.
Möge die „Zarjá“ nicht unwillig darüber werden, dass sie neun Monate voraus Geld hergiebt; ich habe manchmal auch zwei Jahre voraus Geld bekommen .... um Eines bitte ich Sie ernstlich, Nikolai Nikolajewitsch, — wenn die Sache sich machen lässt, so benachrichtigen Sie mich, als alten Freund und Mitarbeiter, so schnell als möglich. Mein Elend wächst in solcher Weise, dass ich keine Zeit verlieren kann, um endlich sicher zu sein. Ich habe für Frau und Kinder zu sorgen und brauche ausserdem Ruhe und Sicherheit ....
Das Märzheft der „Zarjá“ habe ich mit grossem Vergnügen durchgelesen. Ich erwarte daher mit Ungeduld die Fortsetzung Ihres Artikels, um alles darin zu erfassen. Ich ahne, dass Sie H. hauptsächlich als Westler darstellen und vom Westen im Gegensatz von Russland sprechen wollen; ist es so?“ N. Strachow erläutert hier in einer Fussnote, dass es sich um seinen Artikel „Herzens litterarische Thätigkeit“ handle, dessen erster Teil in der dritten Nummer der „Zarjá“ im März 1870 erschienen war .... „Sie haben“, fährt Dostojewsky fort, „sehr treffend Herzens Hauptgesichtspunkt hingestellt — den Pessimismus; aber erklären Sie seine Zweifel (wer ist schuldig usw.) für unlösbar? Sie umgehen das, wie es scheint, und, wie es mir scheint, darum, weil Sie ganz speziell Ihren Hauptgedanken aussprechen wollen. In jedem Falle erwarte ich mit fieberhafter Ungeduld die Fortsetzung des Artikels; es ist ein allzu brennendes und zeitgemässes Thema. Wie wird das aber sein, wenn Sie beweisen werden, dass Herzen früher als viele andere gesagt hat, dass der Westen in Fäulnis begriffen ist? Was werden die Westler aus Granowskys Zeit dazu sagen? Ich weiss nicht, ob das bei Ihnen herauskommen wird, ich rate nur, nebenbei gesagt, obwohl ich in das Thema Ihres Artikels gar nicht eingehen will. Finden Sie nicht, dass es noch einen Gesichtspunkt für die Bestimmung und Feststellung des Wesentlichsten in Herzens grosser Thätigkeit giebt: nämlich den, dass er immer und überall vor allem Poet war. Der Poet hat in ihm überall, in allem, in seiner ganzen Thätigkeit die Oberhand. Er ist als Agitator: Poet, Politiker: Poet, Sozialist: Poet, als Philosoph im höchsten Grade: Poet. Das ist die Eigenart seiner Natur. Mir scheint, es könnte vieles in seiner Thätigkeit, sogar durch seinen Leichtsinn und seinen Hang zum Calembourg, auch in den höchsten sittlichen und philosophischen Fragen erklärt werden — was nebenbei gesagt, in ihm sehr widerwärtig ist.
Die Frauenfrage (Februarheft) haben Sie, meiner Ansicht nach, vortrefflich disponiert. Ihre Frage: warum ich in der „Zarjá“ ungenügendes Selbstvertrauen gefunden habe, will ich beantworten. Ich habe mich vielleicht nicht genau ausgedrückt, aber hören Sie: Sie sind allzu, allzu weich. Für diese Leute muss man schreiben die Peitsche in der Hand. In vielen Fällen sind Sie zu gescheit für sie. Würden Sie etwas zorniger, gröber über sie herfallen, so wäre es besser. Nihilisten und Westler brauchen definitiv die Peitsche. In den Aufsätzen über Tolstoj flehen Sie sie gleichsam an, Ihnen beizustimmen; in dem letzten Tolstoj-Artikel aber verfallen Sie in eine Art Niedergeschlagenheit und Entzauberung, gerade da, wo nach meiner Ansicht der Ton triumphierend und freudig bis zur Frechheit sein sollte. Nun, was glauben Sie — werden sie wirklich Ihren feinen brillanten Humor in den Briefen des Kosiza verstehen? — — Mit einem Wort: in einem solchen Tone nicht zu schreiben — ist Ihnen unmöglich; denn dieser Ernst, diese Liebe und Achtung für die Sache ist jetzt der Ton des Blattes, dieser Ton ist ein hoher, was sowohl schön ist, als auch den Kern der „Zarjá“ ausmacht. Allein manchmal muss man, denke ich, den Ton herabstimmen, die Peitsche in die Hand nehmen, nicht nur um sich zu verteidigen, sondern um viel gröber darein zu fahren. Das ist’s, was ich unter Selbstvertrauen verstand. Übrigens — vielleicht urteile ich falsch, vom Zorn geleitet. Die zwei Zeilen über Tolstoj, mit denen ich nicht ganz einverstanden bin, sind die, wo Sie sagen, dass Tolstoj allem gleichkommt, was nur Grosses in unserer Litteratur vorhanden ist.“ Hier folgt jene Stelle über Tolstoj, welche wir gelegentlich der Besprechung von Dostojewskys Kunst-Anschauungen anführten.
Einen Tag später, am 25. März 1870, nimmt Dostojewsky das Thema seines Romans in einem Briefe an Apollon N. Maikow, seinen ältesten und durch Bande persönlicher Freundschaft mit ihm verknüpften Jugendbekannten, wieder auf, dem er mehr über seine Pläne anzuvertrauen sich gedrungen fühlt. Nach einer Entschuldigung über sein langes Schweigen beginnt der Dichter mit der Aufzählung der ihn hindernden Leiden in der Fremde: „Erstens die Arbeit, zweitens aber die Gesundheit und die Ängstlichkeit, welche durch die Vereinsamung entstanden ist. Angst um die Gesundheit; ich hatte grosse Unruhe. Das Herz schlug sehr unregelmässig, und ich habe keinen Schlaf. Ich ging also doch zu einem Arzt, einem der berühmten Professoren; er hat mich ganz untersucht: durchaus nichts, nur Nerven, aber diese sind arg zerrüttet. Im Sommer sollte man von Dresden weg irgend wo hinausfahren, an das Meer etwa, ein wenig baden. Auch für die Frau wäre es gut — besser als alles wäre, ohne Widerrede, die Luft der Heimat; und alles, was Sie mir darüber in Ihrem Briefe sagten, ist goldene Wahrheit, Wahrheit über alle Wahrheiten. Aber, Apollon Nikolajewitsch, wissen Sie denn nicht, warum ich nicht zurückkehre und dieses verfluchte Ausland nicht fahren lasse? Wie kann ich denn ankommen und sofort in den Schuldarrest eintreten? Bis zu einem gewissen Zeitpunkt kann ich auf keine Weise zurückkehren; und denken Sie denn, dass ich nicht selbst Heimweh habe und mich nicht selbst mit ganzer Seele nach Russland sehne? Und wie meiner Frau bangt! Ist es mir denn heiter zu Mute, ihr Heimweh anzusehen?
Nicht genug an dem; ich weiss es apodiktisch, aus Fakten, dass meine Angelegenheiten in ökonomischer Beziehung dort dreimal besser stünden, als sie hier stehen. Diesbezüglich will ich mich endgiltig mit Ihnen aussprechen. Ich schwöre Ihnen, teurer Freund, dass ich mich nicht daran stossen wollte, dass man mich unbedingt in den Schuldarrest setzt — ich habe wohl schon anderes in meinem Leben gesehen! Ich sässe ein Jahr ab und kaufte mich los. Allein ich weiss, dass, wenn das früher (noch vor fünf Jahren) möglich war, es jetzt — das weiss ich ganz sicher — unbedingt unmöglich wäre. Mit meiner Gesundheit halte ich auch ein halbes Jahr Arrest nicht aus, und was die Hauptsache ist: arbeiten könnte ich nichts. Themata habe ich zum Schreiben — einen Haufen. Über das Schreiben hier in der Fremde aber reden Sie goldene Worte; ich werde thatsächlich abgetrennt, — nicht vom Zeitalter, nicht von der Kenntnis dessen, was bei Euch vorgeht — ich weiss das wahrhaftig besser als Sie, denn ich lese täglich drei russische Zeitungen, bis auf die letzte Zeile, und erhalte zwei Monatsschriften — aber von dem lebendigen Quell des Lebens werde ich abgetrennt; nicht von der Idee, sondern von ihrem Fleisch und Blut. Dieses aber, ach! wie sehr beeinflusst es die künstlerische Arbeit! Alles dies ist wahr, aber wie soll ich’s machen?“ ...
Und weiter: „Übrigens werde ich im Sommer ernstlich darüber nachdenken, wenn sich irgend eine Möglichkeit bietet. Jetzt arbeite ich für den „Russkij Wjestnik“. Ich bin dort in der Schuld, und indem ich den „Hahnrei“ in die „Zarjá“ gegeben, habe ich mich bei jenen in eine zweideutige Lage versetzt. Koste es, was es wolle, so muss ich für jene das vollenden, was ich jetzt schreibe. Ja, es ist ihnen auch fest von mir zugesagt worden; in der Litteratur aber bin ich ein ehrlicher Mensch. Das, was ich schreibe, ist eine tendenziöse Sache — ich habe das Bedürfnis, mich ein wenig hitziger auszusprechen. Da werden die Nihilisten und Westler über mich zu schreien anfangen, dass ich ein Reaktionär bin! Der Teufel sei mit ihnen — ich aber will mich bis aufs letzte Wort aussprechen. Und wissen Sie, in welchen Zweifeln ich stecke? Ich kann absolut nicht entscheiden, wird es Erfolg haben oder nicht? Bald scheint es mir, dass es ausserordentlich gut ausfällt und ich aus einer zweiten Auflage Geld ergattere, bald scheint es mir wieder, dass es ganz misslingt.“ [Es ist immer von den „Besessenen“ die Rede.] „Aber lieber ist es mir, ich falle ganz durch, als ich habe einen mittelmässigen Erfolg. Sie haben mir eins mit einem Knüttel aufs Haupt versetzt mit Ihrer Bemerkung über die „Anstrengungen der Vorstellungskraft“, die Sie im „Hahnrei“ gefunden haben. Was hat mir das für Sorge gemacht; indessen, wie Gott will. Ohne Hoffnung auf Erfolg ist es unmöglich mit Feuer zu arbeiten. Ich aber arbeite mit Feuer — folglich hoffe ich.“
Nach einer Stelle rein privater Natur folgt die Auseinandersetzung der geschäftlichen Lage des Dichters, welche mit den Worten beginnt: „Indessen aber bin ich jetzt in einer fürchterlichen Lage (Mister Micowber). Kein Heller Geld“ usw. Dann fährt er fort: „Das, was ich jetzt für den „Russkij Wjestnik“ schreibe, vollende ich sicherlich in drei Monaten. Dann, nach einem Monat Pause, würde ich mich zur Arbeit für die „Zarjá“ setzen. Ich habe jetzt 1½ Jahre in continuo nichts gearbeitet (den „Hahnrei“ zähle ich nicht), und das Schreiben ermüdet mich jetzt. Über dem, was ich für den „Russkij Wjestnik“ schreibe, werde ich nicht abgespannt werden; dafür verspreche ich der „Zarjá“ eine gute Sache.
Es sind schon zwei Jahre, dass sie für die „Zarjá“ in meinem Kopfe reift. Es ist dieselbe Idee, über welche ich Ihnen schon geschrieben habe: dies wird mein letzter Roman sein. Der Umfang von „Krieg und Frieden“; die Idee würden Sie gut heissen — soweit ich wenigstens nach meinen ehemaligen Gesprächen mit Ihnen schliesse. Dieser Roman wird aus fünf grossen Erzählungen bestehen, jede 15 Bogen stark. Die Erzählungen werden von einander vollkommen unabhängig sein, sodass jede einzelne verkauft werden kann. Die erste Erzählung bestimme ich eben für Kaschpirew [die „Zarjá“]; hier ist die Handlung aus den vierziger Jahren. Der gemeinsame Titel ist: „Das Leben eines grossen Sünders“, aber jede Erzählung wird ihren besonderen Namen haben. Die Hauptfrage, welche durch alle Teile gehen wird, ist dieselbe, mit der ich mich, bewusst und unbewusst, mein Leben lang herumgequält habe — das Dasein Gottes. Der Held ist im Lauf seines Lebens bald Atheist, bald ein Glaubender, dann Fanatiker und Sektierer, dann wieder Atheist.
Die zweite Erzählung wird in einem Kloster spielen. Auf diesen zweiten Teil habe ich alle meine Hoffnungen gesetzt. Vielleicht sagt man dann endlich, dass ich nicht nur leeres Zeug geschrieben habe. Ihnen allein will ich beichten, Apollon Nikolajewitsch; ich will in dieser Erzählung Tichon Zadonsky[28] als Hauptfigur hinstellen, natürlich unter einem anderen Namen, aber auch als Oberpriester, der seinen Ruhestand im Kloster verlebt. Ein 13jähriger Knabe, welcher an der Vollführung eines Kriminalverbrechens teilgenommen hat, begabt und verderbt (ich kenne diesen Typus), der künftige Held dieses Romans, wird von den Eltern im Kloster untergebracht (unsere gebildeten Kreise), auch des Unterrichts wegen. Das Wölflein und Nihilisten-Kindchen kommt mit Tichon zusammen (Sie kennen ja Tichons Charakter und ganzes Wesen). Hierher auch, setze ich Tschaadajew[29] (natürlich auch unter anderem Namen). Warum soll Tschaadajew nicht ein Jahr im Kloster sitzen? Nehmen Sie an, er habe es nach dem ersten Artikel, um dessenwillen ihn die Ärzte jede Woche begutachteten, nicht ausgehalten und z. B. im Ausland in französischer Sprache eine Broschüre gedruckt — es wäre ja sehr möglich, dass man ihn dafür auf ein Jahr ins Kloster gesetzt hätte. Zu Tschaadajew können auch andere auf Besuch kommen: Belinsky z. B., Granowsky, sogar Puschkin. (Ich habe ja, wie Sie wissen, keinen Tschaadajew, nehme nur diesen Typus in den Roman.) Im Kloster befinden sich auch Paul Prussky, Golubow und der Mönch Parfeny. In dieser Welt bin ich ein Kenner, ich kenne das russische Kloster von Kindheit an. Aber die Hauptsache bleiben: Tichon und der Kleine. Teilen Sie ja niemand den Inhalt dieses zweiten Teiles mit. Ich erzähle niemals irgend jemand meine Themen voraus, mir ist, als müsste ich mich schämen; Ihnen aber beichte ich. Für andere mag das keinen Groschen wert sein, für mich ist’s ein Schatz. Über Tichon sprechen Sie nicht. Über das Kloster habe ich an Strachow geschrieben, aber über Tichon nicht. Vielleicht führe ich da eine grossartige, unbedingt heilige Figur aus. Das ist schon kein Kostanschoglo[30], kein Deutscher (habe den Namen vergessen) aus dem Oblomow, keine Lopuchows und Rachmetows[31]. Allerdings, ich werde nichts erschaffen, sondern nur den wirklichen Tichon hinstellen, den ich vor langer Zeit mit Entzücken in mein Herz genommen. Aber ich werde mir auch das, wenn es gelingt, als eine wichtige That anrechnen. Sagen Sie’s also niemand.
Für den zweiten Teil jedoch, für das Kloster, muss ich in Russland sein. Ach, wenn es gelänge! Die erste Erzählung aber — bringt die Kindheit des Helden. Natürlich nicht Kinder sind im Vordergrund; der Roman hat begonnen. Dieses nun kann ich ganz gut in der Fremde schreiben; ich schlage dies der „Zarjá“ vor. Sollten sie ablehnen? Ja, und 1000 Rubel, Gott weiss, wie wenig das ist! Wie sie wollen? wenn sie so handeln, werden sie alles und alle aus der Hand lassen. Übrigens ist’s ihre Sache. Ich habe gestern an Strachow geschrieben und so schnell als möglich um Entscheidung gebeten. Sonst muss ich ohne Verzug etwas anderes unternehmen“ usw.
Aus allem, was hier der Dichter über den Plan seines „letzten Romans“ [der ja wirklich sein letzter geworden ist] seinem Freund Maikow „beichtet“, in Verbindung mit seinen früheren Andeutungen über den Atheismus und dem endlich vor uns erstehenden grössten Roman Dostojewskys „Die Brüder Karamasow“, empfangen wir ein ziemlich deutliches Werdebild dieser Arbeit. Wir sehen, wie viele Wandlungen die Ausführung, ja sogar die Fabel im Laufe der Jahre erfahren, wie zäh jedoch die Grundidee festgehalten ist, die in jenem zweiten Teil wirklich offen daliegt, von dem sich der Dichter mit Recht so viel versprochen hat. Die ursprüngliche Idee, seinen Helden erst Atheist, dann frommgläubig, fanatisch und wieder Atheist werden zu lassen, hat er indessen niemals ganz ausgeführt. Wie uns sowohl die Gattin des Dichters als auch sein um vieles jüngerer warmer Freund W. S. Solowiew mitteilte, hatte der Dichter wirklich eine Fortsetzung des Romans als Abschluss von des Helden Lebensweg geplant und sich auch gegen diese ihm nahestehenden Menschen darüber ausgebreitet; wir kommen hierauf gelegentlich der Besprechung dieses Werkes zurück. Aber auch schon in den ersten Teilen des Romans scheint der Dichter bei mancher Gestalt, ja sogar beim Helden Aljoscha die ursprünglichen Absichten modifiziert zu haben. Die „Verderbtheit“ des jungen Helden hat er da in eine Zeit vor dem Roman verlegt, in das zarte Alter, da junge Wesen ohne Sünde sündigen, sodass uns allerdings in seiner heutigen Gestalt Aljoscha eher als die Verkörperung des naiven Gottesglaubens erscheint. Dessen Antithese bildet Iwan mit seinem Grossinquisitor, der Betrachtung über die Kinder und der Teufelshallucination, während Sosima die beglückende Synthese in sich darstellt. In den „Memoiren aus einem Totenhause“ hat Dostojewsky den Eindruck der Jünglingsgestalt verewigt, die ihm wohl auch bei der Bildung Aljoschas in seiner Reinheits-Phase halb unbewusst mag vorgeschwebt haben. Allerdings hat die Bedachtsamkeit des Schaffenden es nicht unterlassen, das lebensvolle Menschenbild hier mit einem Tropfen Karamasowschen Atridenblutes zu versetzen. Allein wer, der jene Schilderung des dagestanschen Jünglings Alej liest, würde nicht sofort an Aljoscha erinnert?
Der Schluss des Briefes vom 6. April 1870 lautet: „Über den Nihilismus ist nichts zu sagen. Wartet nur ab, bis diese oberste Schichte jener, die sich vom Boden Russlands abgetrennt haben, gänzlich verwest. Wissen Sie was? Mir kommt’s oft in den Sinn, dass viele von diesen nämlichen, niederträchtigen Jungen damit enden, dass aus ihnen wirkliche, feste, russische Ur-Nationale werden. [Das hier gebrauchte unübersetzbare Wort: „Potschwenniki“ bedeutet genauer: „am nationalen Boden Haftende“; die Anhänger dieser Richtung wurden mit diesem Namen bezeichnet.] Nun, die übrigen — mögen sie verwesen. Es wird damit enden, dass auch sie verstummen, in der Paralyse verstummen. Nichtswürdige sind sie immer!“ — —
Am 9. Juni schreibt Dostojewsky an Strachow: „Ich danke Ihnen für Ihren Brief, mein Bester. Sie schreiben immer so kurze Briefe, welche aber die Eigentümlichkeit haben mich aufzuregen. Ihre Meinung über Ihre kritische Thätigkeit finde ich unzureichend und unrichtig. Erstens denke ich so: wären jetzt Ihre Kritiken nicht da, so bliebe bei uns in der ganzen Litteratur ja gar niemand, welcher die Kritik als eine ernste und streng unentbehrliche Sache ansähe. Es bliebe sogar keiner der Kritiken Schreibenden, welcher die Notwendigkeit einer regelrechten philosophischen Betrachtung gegenwärtiger und vergangener Dinge (und die Achtung davor) halbwegs würdigte, folglich also auch die Kritik, d. h. seine eigene Arbeit würdigte. Und so haben Sie vor allem diesen strengen und philosophischen Blick auf die Kritik, den die anderen nicht haben, was die „Zarjá“ zur einzigen Zeitschrift stempelt, die eine Kritik und die richtige Anschauung dafür hat. Wenn also auch nur dies für Euch spräche, so wäre das schon ungeheuer viel.
Ferner aber, erlauben Sie, dass ich Ihnen das sage: dass die Einflüsse nicht schnell zu Tage treten, dass der Unsinn unserer heutigen Gesellschaft doch einen Sinn hat, d. h. sein eigenes Bewegungsgesetz, und dass Sie endlich nicht einmal irgend eine Möglichkeit haben, die unmittelbare Nützlichkeit Ihrer Artikel und die Frage zu beurteilen, ob sie thatsächlich nur für jene geschrieben sind, „die ohne Sie auch schon so gedacht haben“. Das ist nicht richtig.
Hier haben Sie nun, meiner Vorstellung nach, ein gewisses Mass für die Beurteilung Ihres Einflusses: die Zeitschrift „Zarjá“ ist vor allem ein Blatt für Tendenz und Kritik. Die Zahl der Abonnenten wird nach 2 bis 3 Jahren auch den Einfluss des Blattes im Publikum ausdrücken, damit aber unzweifelhaft auch den Einfluss der Kritik, weil diese der Hauptzug des Blattes ist, ihre besondere Spezialität für das Publikum. Auf diese Weise spricht sich dieses immer, wenn auch unbewusst, aus.
Aber denken Sie nur: ich hatte gemeint, Sie würden Struwe loben! Wenigstens um der guten Absicht willen. In der Philosophie bin ich etwas schwach (aber nicht in der Liebe zu ihr; da bin ich stark). Übrigens hat mir selbst, als ich Struwes Dissertation aufmerksam las, die Materialität der Seele herausgeschienen. Die Dissertation aber war mir hauptsächlich darum interessant, weil ich ahnte, dass dies gerade die gegenwärtige, neueste Denkweise der deutschen Philosophie sei. Allein wissen Sie, Nikolai Nikolajewitsch, man wird Sie ja für einen zurückgebliebenen Alten nehmen, der sich noch mit Pfeil und Bogen bewaffnet, während bei ihnen schon lange das Schiessgewehr im Gang ist. Was mich betrifft, so habe ich Ihren Artikel zweimal und mit Hochgenuss gelesen. Ausserdem verstehen Sie es wunderbar, zu schreiben. Ihre Litteratursprache ist schöner, als die aller anderen. Das aber, Sie mögen sagen, was Sie wollen, kann endlich nicht anders als bemerkt werden. Ich habe mich sehr darüber gefreut, wie Sie sich verächtlich gegen die gegenwärtige Manier des Philosophierens verhalten, und würde es sehr wünschen, dass man Ihnen antwortete. Aber, was für ein ausgelassener Ton ist doch in der gesamten heutigen Litteratur! Die Unordnung und Verwirrung in den Ideen — nun, Gott mit ihnen — die musste ja kommen; aber dieser allgemeine Ton! Welche Ausgelassenheit, welche Trivialität! Und nicht ein einziger, zu eigen gemachter fester Gedanke, was immer für einer, wenn auch ein falscher! Was sind das für Philosophen, was für Feuilletonisten. Der reine Quark. Dafür giebt es aber Einzelne, welche sowohl denken als auch Einfluss besitzen — und so geht es immer, bei jedem Durcheinander. Es sollen nur einmal diese Einheiten die Albernheit des Publikums überwältigen, und Sie werden sehen, dass es endlich ihren Ton annimmt. Apropos: wer ist der junge Professor, der mit seinen Leitartikeln im „Golos“ Katkow vollkommen geschlagen hat, sodass man diesen gar nicht mehr liest? Den Namen dieses Glücklichen! Schreiben Sie mir ihn, um alles, so schnell als möglich teilen Sie ihn mit!“[32]
„Ja, noch eins“ — heisst es im nächsten Briefe — „ich wollte Sie schon lange fragen: kennen Sie vielleicht Leo Tolstoj persönlich? Wenn Sie ihn kennen, bitte, schreiben Sie mir, was es für ein Mensch ist. Es ist mir ungemein interessant, irgend etwas über ihn zu erfahren. Ich habe sehr wenig über ihn als Privatperson erfahren.
Ich schreibe für den „Russkij Wjestnik“ mit grossem Eifer und kann durchaus nicht erraten, was herauskommt. Noch niemals habe ich ein solches Thema, niemals etwas in dieser Art aufgenommen. — Dabei quäle ich mich mit dem Gedanken ab, um meine Übersiedlung nach Russland einzurichten; ich werde alle Kräfte daran setzen. Ach, es ist mir so unerträglich, in der Fremde zu leben, dass ich es gar nicht wiedergeben kann!
Von den mir gesandten 500 Rubeln — heisst es weiter — liess ich mir nur das Nötige bis zum 15. Mai übrig. Da sind nun aber zwei Wochen darüber hinaus vergangen; die Miete, der Krämer, der tägliche Unterhalt, alles ist ins Stocken geraten; zum Überfluss ist noch das Kind erkrankt, und der Arzt kommt ins Haus. Sie können sich nicht vorstellen, wie das auf meine Beschäftigung Einfluss nimmt, von allem anderen gar nicht zu sprechen. Ich bin manchmal mehrere Tage hindurch zur Arbeit ganz unfähig. Wenn schon bei der ersten Sendung (der versprochenen 100 Rubel monatlich) eine solche Ungenauigkeit herausgekommen ist, was wird dann in der Folge mit den anderen Anweisungen geschehen? Jetzt aber ist es Sommerszeit, alles ist auf dem Lande, es ist völliger Stillstand; mich wird man ganz vergessen. Ich aber kann nur im Winter auf irgend eine Sendung ausser der „Zarjá“ rechnen. Was soll ich also thun? Dann soll man mir aber keine Vorwürfe machen, wenn auch ich nicht pünktlich bin. Ich schwöre Ihnen, wie lächerlich es auch sei, dass die Pünktlichkeit der Sendung für mich fast wichtiger ist als das Geld selbst. Am Ende kommt doch irgend welches Geld von irgend wo an; aber die Ruhe, die Möglichkeit sich von Sorgen zu befreien, wenn auch nur für die Zeit der Arbeit — kehrt nicht wieder, das ist bereits ruiniert“ usw. ...
„Ich habe hier zufällig den heurigen Jahrgang des „Wjestnik Ewropy“ in die Hand bekommen und alle Nummern durchgesehen. Ich war verblüfft. Ist es denn möglich, dass eine bei uns noch nie dagewesene Mittelmässigkeit — wenn man etwa die „bulgarische nordische Biene“ ausnimmt — einen solchen Erfolg haben konnte (6000 Exemplare und eine zweite Auflage). Da sehen Sie, was es heisst, allen zu Gehör reden. Was für eine Anpassung an die Meinung der Gasse, die allerletzte Schablone des Liberalismus! Das also, heisst das, hat bei uns Erfolg! Die Ausgabe ist übrigens geschickt: am ersten jeden Monats und — Schriftsteller in Fülle. Ich habe unter anderem „Die Hinrichtung Tropmans“ von Turgenjew durchgelesen. Sie können anderer Meinung sein — mich aber hat dieser aufgeblasene und kleinliche Aufsatz aufgebracht. Warum wird er immer verwirrt und behauptet, kein Recht zu haben, da zu sein? Freilich, wenn er nur als Zuschauer zu einem Schauspiel gekommen. — Aber kein Mensch, der auf der Erdoberfläche lebt, hat das Recht, sich abzuwenden und das zu ignorieren, was auf der Erde vorgeht, und dafür giebt es die höchsten sittlichen Gründe. „Homo sum et nihil humanum“ usw. ... das Komischste von allem ist, dass er sich endlich abwendet und im letzten Moment es nicht zu sehen bekommt, wie man hinrichtet: „Seht, meine Herren, wie zart ich erzogen bin! Ich habe es nicht aushalten können!“ Übrigens giebt er sich ganz aus. Der Haupteindruck des Artikels als Endergebnis ist — eine schreckliche, bis zur äussersten Kleinlichkeit getriebene Sorge, um sich selbst, um die eigene Ganzheit und die eigene Ruhe, und das alles angesichts eines abgeschlagenen Hauptes. Speien soll man übrigens auf sie alle. Sie langweilen mich furchtbar. Ich halte Turgenjew für den ausgeschriebensten aller ausgeschriebenen russischen Schriftsteller — was immer Sie auch „in Sachen Turgenjews“ schreiben mögen. — Sie müssen schon verzeihen. — —
Anna Grigorjewna grüsst Sie. Sie ist ganz herabgekommen, sowohl durch das Stillen des Kindes als durch die Sorgen. Und auch noch diese Verdriesslichkeiten!“
Nach einer Unterbrechung von mehreren Monaten spricht Dostojewsky (21. Oktober 1870) seine Freude über den wieder aufgenommenen Briefwechsel aus: „Niemals habe ich Menschenverkehr so sehr gewürdigt, als jetzt in meiner abscheulichen Vereinsamung. Die Hoffnung, im Herbste nach Petersburg zurückzukehren, hat sich nicht erfüllt; die Mittel waren ungenügend. Wir mussten uns entschliessen, sie abermals bis zum Frühling zu verschieben und uns noch einen Winter in Dresden durchzuquälen.
Ich habe Ihnen bis jetzt nicht geantwortet, weil ich buchstäblich, ohne den Kopf zu erheben, hinter meinem Roman für den „Russkij Wjestnik“ sitze. Es ging so schlecht von statten, es musste vieles so oft umgearbeitet werden, dass ich mir endlich das Wort gab, nicht nur nicht zu lesen und nicht zu schreiben, sondern auch nicht um mich zu schauen, ehe ich beendige, was ich mir aufgegeben habe. Und das ist ja erst der allererste Anfang! Allerdings ist schon viel aus der Mitte des Romans aufgeschrieben, vieles ausgemerzt (nicht mit Stumpf und Stiel, versteht sich). Nichtsdestoweniger sitze ich noch über dem Anfang. Ein schlechtes Zeichen; und dennoch möchte man etwas besseres machen. Man sagt, Ton und Manier müssten sich bei einem Künstler ganz von selbst erzeugen; das ist wahr, aber manchmal verirrst du dich in ihnen und suchst sie. Mit einem Wort, niemals hat mir irgend etwas grössere Mühe gemacht. Anfangs, d. h. zu Ende des vorigen Jahres, sah ich auf diese Sache als auf eine herausgequälte, gemachte Sache von oben herab. Später kam wirklich Begeisterung über mich. Abermalige Veränderung: es tauchte noch eine neue Persönlichkeit mit der Prätension auf, der wirkliche Held des Romans zu werden, sodass der erste Held — eine interessante, doch den Namen Held nicht rechtfertigende Figur — auf den zweiten Plan zu stehen kam. Der neue Held fesselte mich so sehr, dass ich abermals an die Umarbeitung ging. Und nun, da ich schon den Anfang an die Redaktion des „Russkij Wjestnik“ gesandt habe — bin ich plötzlich erschrocken: ich fürchte ein Thema gewählt zu haben, das über meine Kraft geht; ernstlich fürchte ich es, mit Qualen! Dabei aber habe ich ja den Helden nicht aufs geradewohl eingeführt. Ich habe seine ganze Rolle voraus im Plan des Romans aufgeschrieben (mein Plan umfasst mehrere Druckbogen), der ganz und gar aus Scenen, d. h. Geschehnissen und nicht aus Erwägungen besteht. Darum, denke ich, wird eine Persönlichkeit herauskommen, ja vielleicht eine neue. Ich hoffe, aber ich fürchte! Es ist endlich Zeit, auch irgend etwas Ernstes zu schreiben. Vielleicht aber falle ich ganz hinein. Wie immer es ausfallen möge, es heisst schreiben: denn mit diesen Umarbeitungen habe ich überaus viel Zeit verloren und schrecklich wenig geschrieben.
Über den „Wjestnik Ewropy“ und seine Erfolge ist nichts zu sagen, als dass es das Blatt der Petersburger Beamten und allen mundgerecht ist (im trivialen, nicht im populären Sinne des Wortes); das Blatt konnte nicht anders als Erfolg haben ... Ihr Artikel über Polonsky hat mir ungemein gefallen. Unbestreitbar ist es ein wichtiges Thema: worin die eigentliche Poesie besteht. Aber es wäre, scheint mir, noch besser, wenn Sie sich darüber ausgebreitet hätten, was eigentlich die falsche, gezierte Poesie ausmacht. Ich versichere Ihnen, Nikolai Nikolajewitsch, dass das jetzige Publikum lange nicht mehr das ist, was es zur Zeit unserer Jugend gewesen. Der jetzigen Jugend muss man vieles aufs neue auseinandersetzen. Seien Sie etwas härter, damit werden Sie anderen und sich viel Nutzen bringen. Übrigens — was lehre ich Sie denn! Sie sind mir eben teuer. Nicht umsonst schneide ich zu allererst Ihren Artikel im Buche auf; der Tag, an dem ich ein Heft mit Ihrem Artikel erhalte, ist ein Feiertag für mich.
Wie ist Ihre Gesundheit? Ich kann mich grosser Gesundheit nicht rühmen — das ist das Zuwidere! Jetzt kommt für mich ein Winter angestrengter Arbeit bei Tag und Nacht. Ich will bis zum Frühling alles bewältigt haben. Das ist die einzig mögliche Art zu arbeiten: nämlich ohne aufzuatmen — sonst kommt man nicht zu Ende. Ich führe ein langweiliges und äusserst regelmässiges Leben. Ich mache täglich einen Spaziergang, lese einige Zeitungen, worunter russische. Nach meiner Meinung werden alle diese gegenwärtigen, erschütternden Ereignisse eine unmittelbare Einwirkung auch auf unser russisches Leben haben, also auch auf die Litteratur. In jedem Falle sind es ungewöhnliche Zeiten. Ich denke nicht, dass die Litteratur in ihrem Einfluss und ihrer Bedeutung verloren hat. Im Gegenteil, sie wird in jedem Falle gewinnen; aber wenn man liest, z. B. russische Zeitungen, so fühlt man, bis zu welchem Grade das alles frühreif und ohne eigene Gedanken ist, ausser den „Moskowskija Wjedomosti“ natürlich. Werden Sie mir nicht irgendwie antworten, teurer Nikolai Nikolajewitsch? Beglücken werden Sie mich. Ich aber verspreche, dass ich pünktlich sein werde.“
Im nächsten Briefe vom 14. Dezember wiederholt der Dichter seine Klage über die Schwierigkeiten, die er bei der Arbeit des Romans zu bekämpfen habe. Es ist dies der Roman „Die Besessenen“, dessen wir schon wiederholt erwähnten.
Der Wunsch, die nihilistische Richtung auf künstlerischem Wege zu brandmarken, hat hier dem Dichter ein schweres Stück Arbeit aufgenötigt, dem sich von vornherein das Positive, das in jeder grossen Kunst und jedem grossen Künstler steckt, entgegensetzen musste. Er musste, um seine Geissel so hart und schwer als möglich zu flechten, um sie so unerbittlich auf die Nacken der „Gottlosen“ niedersausen zu lassen, diesen „Besessenen“ auch jeden menschlichen Zug rauben, jede Anwartschaft auf Sympathie entziehen, musste ihnen sowohl in ihren Zielen, als in ihren Mitteln nur das Ruchloseste zuschreiben und dem Leser solche Scheusale glaubwürdig machen, er, der sein Leben lang den göttlichen Funken im Herzen des vertierten Verbrechers suchte und zu finden verstand. Das Unwahre, Dostojewskysch Unwahre, das dieser Arbeit zu Grunde liegt, diese Spaltung seines Urwesens konnte ihm nicht gelingen und musste ihn mit grossem Unbehagen erfüllen. Dennoch weist der Roman, namentlich in seinem ersten Teil und am Ende, künstlerisch grosse Schönheiten auf, von den tiefen philosophischen Problemen zu schweigen, welche zu dem Ergebnis führen, dass der aufrichtige Atheismus, je nach der sittlichen Person, die er ergreift, im Mord oder Selbstmord seinen Abschluss findet.
In den Mund Stepan Trofimowitsch’, den geistreich-sentimentalen Litteraten der vierziger Jahre, eine der köstlichsten Figuren des Dostojewskyschen Humors, legt der Dichter, wie er das so gerne thut, das Resumé des Buches, seine Wahrheit nieder. Da dieses grosse, eitle, ‚genialische‘ Kind in einer fremden Herberge erkrankt und von einem armen, Evangelien verkaufenden Frauenzimmer gepflegt wird, das er ‚ma chère innocente‘ oder ‚chère et incomparable amie‘ nennt, da fällt ihm plötzlich ein, sie solle ihm „von den Säuen“ vorlesen; „de ces cochons“ — „ich erinnere mich: die Teufel fuhren in die Säue und alle sind ersoffen. Lesen Sie es mir unbedingt, ich will Ihnen dann sagen, warum. Ich will mich wörtlich daran erinnern, wörtlich will ich es haben.“ — — Nun liest Sofja Matwejewna die Stelle aus dem Evangelium Lucae, VIII, 32, 33, welche der Dichter als Motto vor sein Werk gesetzt hat:
„Es war aber daselbst eine grosse Herde Säue an der Weide auf dem Berge. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaubte, in dieselbigen zu fahren. Und er erlaubte es ihnen.
Da fuhren die Teufel aus dem Menschen und fuhren in die Säue; und die Herde stürzte sich mit einem Sturm in den See und ersoff.“
„Meine Freundin,“ sagte am Schluss Stepan Trofimowitsch in grosser Aufregung, „savez-vous, diese wunderbare .... ungewöhnliche Stelle war mir mein ganzes Leben lang ein Stein des Anstosses .... dans ce livre .... so, dass ich mich an diese Stelle seit meiner Kinderzeit erinnere. Jetzt aber ist mir ein Gedanke gekommen — une comparaison. Mir kommen jetzt schrecklich viele Gedanken: sehen Sie, das ist Punkt für Punkt unser Russland. Diese Teufel, die aus dem Kranken heraus in die Säue fahren, das sind alles die Gifte, die Miasmen, alle Unreinigkeit, alle Teufel und alle Teufelchen, welche sich in unserem grossen, teueren Kranken, in unserem Russland angesammelt haben, seit Jahrhunderten, seit Jahrhunderten! Oui, cette Russie, que j’aimais toujours! Aber ein hoher Gedanke und ein hoher Wille beschützen es von oben, wie diesen sinnlosen Besessenen, und es werden alle diese Teufel aus ihm fahren, alle diese Unreinigkeit, all’ diese Abscheulichkeit, die sich auf der Oberfläche angefault hat ... und sie werden selbst darum bitten, in die Säue zu fahren. Ja, und sie sind vielleicht schon hineingefahren! Das sind wir, wir und die andern, Pjetruscha ... et les autres avec lui ... und ich vielleicht der Erste darunter; und wir Sinnlosen und Besessenen werden uns vom Felsen ins Meer stürzen und werden alle ersaufen; denn dahin geht unser Weg, weil unsere Kraft ja nur dazu ausreicht. Allein der Kranke wird genesen, „sitzen zu den Füssen Jesu“ ... und alle werden es mit Verwunderung schauen ... Liebe, vous comprendrez après, jetzt aber erregt mich das alles sehr ... Vous comprendrez après ... Nous comprendrons ensemble.
Wir kehren zur Korrespondenz der letzten Zeit im Auslande zurück und nehmen nur die markantesten Stellen einzelner Briefe hier heraus. Da ist noch am Schlusse des Briefes vom 2. (14.) Dezember 1870 an Strachow die Stelle: „Turgenjews ‚König Lear‘ hat mir gar nicht gefallen. Ein aufgeblähtes, hohles Ding. Der Ton niedrig. Ich sage das nicht aus Neid, weiss Gott!“
In einem Briefe an A. Maikow vom 30. Dezember 1870 finden wir ausser den uns bekannten geschäftlichen Erörterungen am Schlusse eine Stelle, welche als Illustration von Dostojewskys unkritischem Pessimismus in Dingen der europäischen Nationalitäten bezeichnend ist. Finden wir den Dichter in Frankreich mit den Franzosen, in Genf mit den Schweizern höchst unzufrieden, so ist seine Missgunst gegen Deutsche und Deutschland, so lange er dort lebt, ganz genügend, um sich wieder einmal der Franzosen anzunehmen. Man fühlt an solchen Äusserungen das ganz subjektive, vom Augenblick bestimmte Urteil auf dem, allerdings einheitlichen, Untergrunde des „Nichteuropäers“. Er spricht zuerst von seiner Heimkehr, die sowohl er als auch Anna Grigorjewna nicht mehr erwarten können, und fährt fort:
„Strachow schreibt mir, dass in unserer Gesellschaft noch alles furchtbar jugendlich-grün ist. Wenn Ihr wüsstet, wie sehr das von hier aus ersichtlich ist! Aber wenn Sie wüssten, was für einen blutigen Hass, bis zum Abscheu, Europa in diesen vier Jahren in mir hervorgerufen hat! Du lieber Gott, was hat man bei uns für Vorurteile über Europa! Nun, ist jener Russe nicht ein Säugling (das sind aber fast alle), welcher daran glaubt, dass der Preusse durch die Schule gesiegt hat? Das ist sogar schamlos: eine schöne Schule, welche quält und plündert wie eine Hunnenhorde (wenn nicht noch ärger?).
Sie schreiben, dass sich jetzt in Frankreich der Geist der Nation gegen die brutale Macht erhebt? Daran habe ich von allem Anfang an nie gezweifelt; und wenn sie dort keine Böcke schiessen, indem sie Frieden schliessen, sondern noch drei Monate ausharren, so werden die Deutschen hinausgejagt und dann — welche Schande! Da hätte man viel zu schreiben — und ich könnte Ihnen viel Interessantes aus eigener Anschauung mitteilen: z. B. wie die Soldaten von hier aus nach Frankreich aufbrachen, wie man sie zusammenruft, ausrüstet, verpflegt und fortführt. Das ist ungeheuer interessant. Ein armseliges Weiblein zum Beispiel, das davon lebt, dass sie zwei Stübchen aufnimmt, sie einrichtet und dann vermietet (sie besitzt also um ein paar Groschen Einrichtungsstücke), wird, da sie eigene Möbel hat, verpflichtet, auf ihre Rechnung zehn Soldaten aufzunehmen und zu beköstigen. Die bleiben drei Tage, zwei Tage, einen Tag, selten eine Woche. Aber das kommt sie ja auf 20-30 Thaler. — Ich selbst habe einige Briefe von jungen deutschen Soldaten, die vor Paris standen, an ihre hiesigen Angehörigen (Krämer, Marktweiber) gelesen. Herrgott, was schreiben die! Wie sind sie krank, wie hungrig!
Es wäre viel zu erzählen. Unter anderem folgende Beobachtung: Anfangs wurde die Wacht am Rhein sehr oft auf der Strasse in der Menge gesungen — jetzt gar nicht mehr. Am allermeisten erhitzen und brüsten sich die Professoren, Doktoren, Studenten, das Volk aber — nicht besonders; sogar durchaus nicht. Ich begegne jenen an jedem Abend in der Lesehalle. Einer mit einem schneeweissen Kopfe, ein einflussreicher Gelehrter, schrie vorgestern sehr laut: „Paris muss bombardiert werden!“ Das sind die Ergebnisse ihrer Gelehrsamkeit; wenn nicht der Gelehrsamkeit, so — der Dummheit. Mögen sie Gelehrte sein, doch sind sie schreckliche Dummköpfe! Noch eine Beobachtung: Das ganze hiesige Volk kann lesen und schreiben, ist aber unglaublich ungebildet, dumm, stumpf, von den untergeordnetsten Interessen erfüllt“ usw.
Im nächsten Briefe setzt der Dichter seine kritiklosen Kritiken fort und es fällt dabei ein Streiflicht auf Russlands Verhältnis zu Frankreich, das wegen seiner heute völlig veränderten Gestalt einen Kommentar zu den Ironieen der Geschichte zu bieten vermöchte. Es heisst da (30. Januar 1871): „— — Was Sie über unsere Gesellschaft sagen, habe ich mit Kummer in Ihrem Briefe gelesen; und was man von den deutschen Angelegenheiten denken soll, das wissen Sie selbst. Mehr Lug und Trug kann man sich ja gar nicht vorstellen. Mit dem Schwerte wollen sie Napoleons Thron wieder aufrichten, indem sie sich ihn und seine Nachkommenschaft für alle Ewigkeit zu Sklaven machen wollen, ihm aber dafür die Erbfolge sichern, d. h. also: alles, was er nur braucht — das ist klar. Sie werden sehen: wenn auch eine National-Versammlung tagen wird, so werden sie dieselbe durch die Unmässigkeit ihrer (ausgeklügelten) Forderungen zwingen, damit nicht einverstanden zu sein und dann — werden sie den Napoleon proklamieren.
Erinnern Sie sich an den Text des Evangeliums: ‚Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen?‘ Nein, was durch das Schwert aufgebaut ist, wird nicht bestehen! Und nach dem schreien sie „Jung Deutschland“. Umgekehrt — es ist eine Nation, die ihre Kraft verbraucht hat — denn nach einem solchen Geist, nach einer solchen Wissenschaft sich der Idee des Schwertes, des Blutes, der Gewalt anvertrauen und nicht einmal ahnen, was Geist und Geistessieg ist, und darüber mit korporalsmässiger Grobheit lachen, was ist das anders. Nein, das ist eine tote Nation, eine Nation ohne Zukunft. Wenn sie aber lebendig ist, so wird sie, glauben Sie mir, nach dem ersten Taumel in sich selbst einen Protest erstehen sehen, ein Streben zum Besseren, und das Schwert wird von selbst fallen.
Und noch das: Die materielle Erschöpfung Deutschlands ist so gross, dass es kaum mehr vier Monate Widerstand aushalten wird. Wenn sie von Frankreich zurückkommen, werden sie uns anfangs ein, zwei Jahre schön thun! Übrigens kann es geschehen, dass sie sich irgendwie schon früher gröblich verschnappen.
Gott schütze den Zar und Russland — aber für Europa ist die Zukunft wirklich kritisch.“
Wenden wir uns wieder der positiven und fruchtbaren Seite von Dostojewskys vaterländischer Thätigkeit zu. In einem Briefe vom 14. März 1871 an Apollon Maikow sagt der Dichter: „Ihr schmeichelhafter Ausspruch über den Anfang meines Romans hat mich in Entzücken versetzt. Gott, wie habe ich gefürchtet und wie fürchte ich noch! Wenn Sie dies lesen, werden Sie wahrscheinlich auch schon die zweite Hälfte des ersten Teils im Februarheft des „Russkij Wjestnik“ gelesen haben. Was werden Sie sagen? Ich fürchte, ich fürchte. Was das weitere anbelangt, so bin ich einfach in Verzweiflung, ob ich’s zurecht bringe. — Nebenbei gesagt: das Werk wird ja im ganzen vier Teile haben — 40 Bogen. Stepan Trofimowitsch wird eine Nebenfigur sein. Der Roman wird gar nicht von ihm handeln, allein seine Geschichte ist eng mit den übrigen (Haupt-) Vorgängen des Romans verknüpft, und darum habe ich ihn gleichsam zum Eckstein des ganzen genommen. Immerhin aber wird Stepan Trofimowitsch im vierten Teile sein Benefiz haben. Hier wird das sehr originelle Ende seines Schicksals Platz finden. Für alles andere stehe ich nicht, aber für diese Stelle verbürge ich mich von vornherein. [Wir haben gesehen, wie richtig diesmal des Dichters Empfindung und Urteil war.]
Aber ich wiederhole noch einmal, ich fürchte mich, wie eine geschreckte Maus. Die Idee hat mich berückt, und ich habe sie furchtbar leidenschaftlich erfasst. Komme ich aber durch, oder ist der ganze Roman ein .....? Das ist das Elend.
Stellen Sie sich vor, dass ich schon aus aller Welt verschiedene Glückwunsch-Schreiben über den Anfang erhalten habe. Das hat mir sehr, sehr viel Mut gemacht. Allein, ohne Ihnen zu schmeicheln, sage ich gerade heraus, dass Ihre Äusserung mir wertvoller ist als alles andere.“ Hier muss man sich erinnern, dass Strachow nur die erste Hälfte des ersten Teiles gelesen hatte, worin eben Stepan Trofimowitsch die Hauptrolle spielt. „Erstens“ — fährt Dostojewsky fort — „werden Sie mir ja nicht schmeicheln, und zweitens ist in Ihrer Auseinandersetzung ein genialer Gedanke hervorgesprungen: „Das sind Turgenjews Helden im Alter“. Das ist genial! Während ich schrieb, dämmerte mir selbst etwas Ähnliches. Sie aber haben es mit drei Worten, als wie mit einer Formel bezeichnet. Ich danke Ihnen für diese Worte. Sie haben mir das ganze Werk beleuchtet.
Ich habe mich entschlossen, unbedingt im Frühling heimzukehren, da werden wir was plaudern!“
In einem Briefe vom 18. (30.) März schreibt der Dichter an Strachow: „Wenn ich lange keine Anfälle gehabt habe und sie sich plötzlich wieder entladen, so folgt darauf eine ungewöhnliche seelische Herabstimmung. Da bin ich am Rande der Verzweiflung. Früher hat diese Schwermut etwa drei Tage nach einem Anfalle gedauert, jetzt aber hält sie sieben, acht Tage an, obwohl die Anfälle selbst in Dresden seltener auftreten, als irgendwo sonst. Zweitens plagt mich der Kummer über meine Arbeit. Es ist nicht zu sagen, wie schwer ich schreibe. Ich muss nach Russland, wenn ich auch das Petersburger Klima ganz entwöhnt bin. Immerhin, koste es was es wolle, ich muss heimkehren .....
Sie können sich nicht vorstellen, was für traurige und schwere Gedanken mich beim Lesen Ihres Briefes bedrängt haben. Was heisst denn das? „Alles das, wodurch die „Zarjá“ originell war, alles, was ihr vor allen anderen einen individuellen Charakter verliehen hat, alles das hat man als ein Hindernis für ihren Erfolg erkannt. Und das ist die einzige russische Zeitschrift, in der sich noch die reine litterarische Kritik erhalten hat! Gerade darum, weil alle sie aufgegeben haben, ist sie eben jetzt nötig. Sie hat der „Zarjá“ ihre Physiognomie verliehen. Vor dem Gerede und Gespötte haben sie Angst bekommen! Im Gegenteil; in jeder Nummer hätten sie auf ihrer Idee bestehen sollen, und ihrer wäre die Zukunft gewesen. Ich weiss nicht, wie es bei anderen ist, aber ich habe jedesmal nach Erhalt des Heftes Ihre Artikel zuerst aufgeschnitten und mich daran berauscht. Es versteht sich, dass ich manchmal nicht ganz einverstanden war (so z. B. mit der Methode, dem Tone, d. h. mit Ihrer allzugrossen Weichheit und ausserdem mit Ihrem Vergrössern gewisser Erscheinungen der Litteratur und des Lebens) — aber mein Interesse daran war immer ein ausserordentliches. Ihr Artikel über Karamsin ist so tief und so männlich offen, dass ich hier eine helle Freude darüber hatte, dass bei uns noch solche Stimmen zu hören sind. Sie haben mir, so nebenbei, gesagt, und ich habe auch irgendwo etwas darüber gelesen und, so weit auch ich selbst urteilen kann, scheint es so, dass man den Artikel reaktionär findet. Dies denkt doch nicht auch Ihre Redaktion?“
In der weiteren Fortsetzung des Briefes spricht der Dichter eingehend über Strachows Verhältnis zur „Zarjá“, erteilt ihm litterarische Ratschläge und schliesst: „Abermals wiederhole ich, dass ich mit grosser Sehnsucht, ja mit Aufregung den Augenblick des Wiedersehens mit den früheren nahen Menschen in Petersburg erwarte. Hier muss ich aber noch eine Bitte stellen: sprechen Sie, wenn sich die Gelegenheit dazu böte, mit niemand von meiner baldigen Zurückkunft als einer Gewissheit. Ich möchte gern wenigstens die erste Woche nach meiner Heimkehr von den Gläubigern in Ruhe gelassen werden. Ich erwarte es, dass sie gleich auf mich losstürzen; ich fürchte das aber, weil ich kein Geld habe, sondern nur Erwartungen. — Das Schreiben geht nicht, Nikolai Nikolajewitsch, oder mit furchtbarer Anstrengung. Ich denke, das ist nur — weil ich Russland brauche. Um jeden Preis muss ich zurück. Mir scheint, ich werde in der Mitte des Sommers bei Euch auftauchen. Welche Umstände aber mit der Übersiedelung! Zu zweien sind wir fortgezogen, ich mit meinem jungen Weibe, und nun, obwohl ich mit der ebenso jungen Gattin zurückkehre, so ist’s doch auch mit Kindern! Ein Geheimnis: das eine ist 1½ Jahre alt, das zweite aber noch XYZ. Was werden das für Beschwerden auf der Reise sein!“
In einem Briefe an Apollon N. Maikow vom 21. April (a. St.) 1871, welcher zumeist geschäftlichen Inhalts ist, spricht er ebenfalls über die Nötigung der Heimkunft, welche aber durch die im August zu erwartende Niederkunft Anna Grigorjewnas abermals verzögert werden könnte. Er hat sich an die Redaktion des „Russkij Wjestnik“ gewendet, um 1000 Rubel Vorschuss für die Übersiedelung zu erlangen. Nun schickt man ihm allerdings einiges Geld für die Osterfeiertage, die 1000 Rubel aber bittet man ihn erst Ende Juni zu erwarten. Er meint dazu: „Indessen ist es ja geradezu unmöglich zu warten. Anfangs August soll meine Frau in die Wochen kommen; darum ist es unvergleichlich besser, zwei Monate vor der Niederkunft zu reisen, als einen Monat vorher, denn im letzteren Falle ist es sogar unmöglich. Bedenken Sie, dass wir ohne Dienerin und mit einem kleinen Kinde reisen müssen. Nach der Geburt hier bleiben, ist aber auch unmöglich; man kann mit einem neugeborenen Kinde nicht im Oktober reisen. Endlich, noch ein Jahr in Dresden bleiben, ist schon das allerunmöglichste. Das hiesse Anna Grigorjewna schon ganz umbringen, durch die Verzweiflung, deren sie nicht Herr werden könnte; denn sie ist thatsächlich vor Heimweh krank. Auch ich kann nicht mehr ein Jahr ausbleiben; erstens werde ich, wenn ich hier bleibe, aus mir bekannten Ursachen nicht imstande sein, den Roman zu beenden, und kann in geschäftlicher Beziehung noch furchtbar viel verlieren. Das alles werde ich Ihnen beim Wiedersehen erklären.
— — Dabei habe ich folgende Schlüsse gezogen, Schlüsse, die Sie sicherlich ebenfalls kennen, von deren Wahrheit Sie aber noch nicht vollständig durchdrungen sind, wie auch ich es bis in die allerletzte Zeit nicht gewesen bin. Es handelt sich um dieses: Infolge der grossen Umwälzungen, von den staatlichen angefangen bis zu dem Kreise des rein Litterarischen, ist bei uns die allgemeine Bildung und Erkenntnis auf einige Zeit zersplittert, zerstreut, gesunken. Die Leute haben sich eingebildet, dass sie keine Zeit mehr haben, sich mit Litteratur (gleichsam einem Spielzeug; was für eine Bildung!) zu befassen, und es ist das Niveau des kritischen Empfindens und aller litterarischen Bedürfnisse schrecklich tief gesunken, sodass jeder Kritiker, der etwa bei uns auftauchen sollte, jetzt gar nicht die richtige Wirkung hervorrufen würde. Dobroljubow und Pissarew haben gerade darum Erfolg gehabt, weil sie im Wesentlichen die Litteratur verwarfen — das ganze Gebiet des menschlichen Geistes! Gutheissen kann man das unmöglich, sondern man muss gleichwohl in seiner kritischen Thätigkeit fortfahren. Verzeihen Sie mir also den Rat, wie ich an Ihrer Stelle verfahren würde.
Sie sprachen in einer Ihrer Broschüren eine herrliche Idee aus und, was die Hauptsache ist, es geschah dies zum erstenmale in unserer Litteratur. Es ist diese: dass jedes halbwegs bedeutende und wirkliche Talent bei uns — immer damit endigte, dass es sich dem Nationalgefühl zuwandte, volkstümlich, slavophil wurde. So hat der Geck Puschkin plötzlich, früher als alle Kirejewskys und Chomjakows, den Chronikenschreiber im Wunderkloster geschaffen, d. h. früher, als alle Slavophilen, ihre ganze Wesenheit ausgedrückt und — nicht genug an dem — er hat dies unvergleichlich tiefer ausgedrückt, als sie alle es bis auf den heutigen Tag gethan haben.
Sehen Sie hingegen Herzen an — fährt der Dichter fort — wie viel Sehnsucht und Bedürfnis, auf diesen Pfad zurückzukehren, und welches Unvermögen dazu, infolge seiner widerwärtigen persönlichen Eigenschaften! Noch mehr; dieses Gesetz der Rückkehr zum Nationalen kann man nicht nur bei den Dichtern und den litterarischen Faktoren verfolgen, sondern in allen anderen Thätigkeiten; derart, dass man zuletzt auch ein zweites Gesetz daraus entwickeln könnte. Nämlich: Wenn ein Mensch wirklich Talent hat, so wird er trachten, sich aus einer schon verwitterten Gesellschaftsschichte heraus dem Volke zuzuwenden; wenn er aber thatsächlich kein Talent hat, so wird er nicht nur in der verwitterten Schichte verbleiben, sondern sich verpflanzen, katholisch werden usw. — — Belinsky (den Sie heute noch schätzen) war gerade durch sein Talentchen kraftlos und schwach, hat aber auch darum Russland verflucht und ihm sichtlich viel Schaden zugefügt (von Belinsky wird man noch einmal vieles zu sagen haben, Sie werden es schon sehen). Allein die Sache ist die, dass in dieser von Ihnen ausgesprochenen Idee so viel Kraft liegt, dass sie unbedingt für sich allein und speziell ausgeführt werden sollte. Schreiben Sie einen Artikel über dieses Thema, entwickeln Sie es im Einzelnen. Man wird sich gewiss darüber freuen. Es wird dieselbe Kritik sein, nur in anderer Form. Zwei, drei solcher Aufsätze im Jahre, und ich prophezeie Ihnen Erfolg. Ausserdem aber wird das Publikum Sie nicht vergessen, sondern sagen, dass Sie in einen Kreis getreten sind, wo man Sie besser versteht. Die Hauptsache ist: wozu die Litteratur aufgeben?
— — Ich kehre erst im Juni heim, so haben sich meine Geldmittel gestaltet. — Hören Sie, was ich Ihnen noch über Ihre letzte Beurteilung meines Romans sagen will. Erstlich haben Sie mich für das, was Sie Gutes darin finden, gar zu hoch gestellt, und zweitens haben Sie ungemein fein auf meine Hauptmängel hingewiesen. Ja, ich habe darunter gelitten und leide darunter; ich verstehe bis heute nicht (ich hab’ es nicht gelernt), meine Mittel richtig zu gebrauchen. Eine Menge einzelner Romane drängen sich bei mir in einen hinein, sodass weder Mass noch Harmonie vorhanden ist. Das alles haben Sie erstaunlich richtig ausgesprochen. Und wie habe ich selbst schon viele Jahre darunter gelitten, da ich es selbst erkannte!“
Zu dieser Stelle bringt Strachow in einer Fussnote einen Abriss seines kritischen Briefes an Dostojewsky, der im wesentlichen unseren Eindruck vom Roman „Die Besessenen“ bestätigt. Er lautet:
„Im zweiten Teile der „Besessenen“ sind wunderbare Dinge enthalten, welche mit dem Besten, das Sie geschrieben haben, in einer Reihe stehen. Der Nihilist Kirillow ist erstaunlich tief und scharf gezeichnet. Die Erzählung der Verrückten, die Szene in der Kirche, ja sogar die ganz kleine Szene mit Karmasinow — das sind lauter Perlen künstlerischer Vollendung. Allein der Eindruck auf das Publikum ist bis jetzt noch ein sehr unbestimmter. Es sieht dies Ziel der Erzählung nicht und verliert sich in der Menge der Personen und Episoden, deren Verknüpfung ihm nicht klar ist. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen diese unangenehmen Urteile schreibe. Es ist mir sogar in den Kopf gekommen, Ihnen Ratschläge zu erteilen, und ich kann mich dieser Dummheit nicht enthalten, welche ich als den Ausdruck meines sehr grossen Interesses an Ihrer Thätigkeit hinzunehmen bitte.“
„Offenbar sind Sie, was den Reichtum und die Mannigfaltigkeit der Ideen anlangt, bei uns der Erste, und sogar Tolstoj ist im Vergleich mit Ihnen einförmig. Das hindert nicht, dass über allem, was Sie schaffen, ein besonderes und starkes Kolorit ausgebreitet ist. Allein Sie schreiben sichtlich zum grossen Teil für ein ausgewähltes Publikum und Sie füllen Ihre Schöpfungen zu sehr an, komplizieren sie allzu sehr. Wäre das Gewebe Ihrer Romane ein einfacheres, so würden sie stärker wirken. „Der Spieler“ zum Beispiel und „Der Hahnrei“ haben die klarsten Eindrücke hervorgerufen, während alles, was Sie in den „Idioten“ gelegt haben, verloren ging.“
Diesem Urteil Strachows können wir nur hinsichtlich der zwei zuerst genannten Werke beipflichten. Über den „Idiot“ haben wir weiter oben einen sehr verschiedenen Eindruck ausgesprochen.
„Dieser Mangel“ — fährt Strachow in jenem Briefe fort — „steht natürlich mit Ihren Vorzügen in enger Verbindung. Ein geschickter Franzose oder Deutscher würde sich, hätte er den zehnten Teil Ihres Gehaltes, auf beiden Hemisphären berühmt machen und als Leuchte ersten Grades in die Geschichte der Weltlitteratur einführen. Das ganze Geheimnis liegt, scheint mir, darin, dass die Schöpferkraft geschwächt, die Schärfe der Analyse reduziert werde, dass man anstatt zwanzig Bilder und hundert Szenen sich mit Einem Bilde und einem Dutzend Szenen bescheiden sollte. Verzeihen Sie, Theodor Michailowitsch, allein es scheint mir, dass Sie bis zur Stunde mit Ihrem Talente nicht zu schalten, es nicht für die grösste Wirkung auf das Publikum zuzubereiten wissen. Ich fühle, dass ich hier an ein grosses Mysterium rühre, dass ich Ihnen einen höchst unsinnigen Ratschlag vorlege — den, dass Sie aufhören Sie selbst, aufhören Dostojewsky zu sein. Allein ich denke, dass Sie in dieser Form meine Gedanken dennoch verstehen werden.“
Man kann Dostojewskys Fehler und Mängel nicht klarer und prägnanter kennzeichnen, als dies hier Strachow thut. Allerdings geschieht dies nur nach der positiven Seite hin, im Hinblick auf die Fehler, welche aus des Dichters übergrossem Reichtum an seelischer Nüancirung hervorquellen. Was uns als Mangel erscheinen muss, das Fehlen jeder Teilnahme für die Reize und Gewalten der Natur, oder die, der leblosen Umgebung des Menschen entströmende, oder von ihm auf diese ausgestreute Stimmung, das hat der Kritiker nicht berührt und er hat Recht damit gethan. Er mochte wohl fühlen, dass diese Mängel zu jenen gehören, welche am innigsten mit unserer Lebenswurzel verflochten sind und nicht genannt werden dürfen, weil dem, der sie zu tragen hat, keine Macht innewohnt, sie von sich zu lösen, sie selbst zu sehen. Für uns Fernerstehende müssen diese Mängel als das erscheinen, was sie sind: ein Übergewicht des inneren Realismus über den äusseren der Gegenstandswelt, der Grundmangel, aus dem der Fehler des Stoff-Aufhäufens als sichtbare Folge hervortritt. Uns fehlen in Dostojewskys Schöpfungen wohl niemals die tiefen und geheimnisvollen Anlässe in den Handlungen seiner Charaktere, wohl aber fast immer die äusseren und äusserlichen Bindeglieder und sinnlichen Übergänge, wie sie unsere Dutzenddichter zu Hauptmotiven so reichlich verarbeiten. Diese Mängel nun scheinen den Dichter keineswegs gestört zu haben. Ein anderes ist es, das, wie schon gesagt, ihn sehr quälte.
„Es giebt aber noch ein Schlimmeres,“ fährt er in jenem Briefe an Strachow fort, „ich mache mich, ohne meine Mittel zu berechnen, und nur vom poetischen Zuge hingerissen, daran, einen künstlerischen Gedanken auszudrücken, dem ich nicht gewachsen bin. (NB. So ist die Kraft der poetischen Begeisterung immer, z. B. bei Victor Hugo, stärker als die Mittel zur Ausführung. Sogar bei Puschkin lassen sich Spuren dieser Zweiheit erkennen.) Und damit ruiniere ich mich. — Ich füge hinzu, dass die Übersiedelung und eine Menge von Beschwernissen diesen Sommer über, dem Roman sehr schaden werden.“
Der nächste und letzte Brief aus der Fremde fällt in die Zeit der Pariser Kommune und giebt uns Gelegenheit, einen jener Aussprüche des Dichters über Sozialismus und Kommunismus zu hören, wie er sie breiter und ausführlicher in seinem Tagebuch eines Schriftstellers, in seinen letzten Tagebuchnotizen und seinen „Winterlichen Bemerkungen über Sommer-Eindrücke“ ausgesprochen hat, wovon wir weiter unten einige bedeutsame Stellen folgen lassen. Der Brief lautet:
„Dresden, 18. (30.) Mai 1871.
Sehr geehrter Nikolai Nikolajewitsch!
Da haben Sie nun wirklich Ihren Brief geradeaus mit Belinsky angefangen! Das habe ich vorausgeahnt. Aber sehen Sie doch nach Paris, auf die Kommune. Sind Sie wohl gar einer von jenen, welche sagen, dass es wieder nicht gelungen sei wegen Unzulänglichkeit der Menschen, der Umstände? Das ganze neunzehnte Jahrhundert hindurch träumt diese Bewegung entweder von einem Paradies auf Erden (vom Phalanstère angefangen), oder sie zeigt, knapp am Ziele (48-49 und jetzt), ein erniedrigendes Unvermögen, auch nur irgend etwas Entschiedenes zu sagen. Im wesentlichen ist’s immer wieder derselbe Rousseau und der Traum, die Welt mittels des Verstandes, der Erfahrung aufs neue zu erschaffen (Positivismus). Es sind doch, scheint es, schon genug Fakten vorhanden, die zeigen, dass ihr Unvermögen, ein neues Wort zu sagen, keine zufällige Erscheinung ist.
Sie schlagen Köpfe ab — warum? Einzig und allein darum, weil das das leichteste von allem ist. Irgend etwas sagen ist unvergleichlich schwerer. Der Wunsch nach einer Sache ist noch kein Erlangen. Sie wünschen das Glück des Menschen und bleiben bei der Bestimmung des Rousseauschen Wortes „Glück“ stehen, d. h. bei einer Phantasie, welche nicht einmal von der Erfahrung bestätigt worden. Der Brand von Paris ist eine Ungeheuerlichkeit. „Es ist nicht gelungen, so soll denn die Welt untergehen.“ Denn die Kommune steht höher, als das Glück der Welt und Frankreichs. Aber es erscheint ihnen (ja, und vielen anderen) diese Raserei nicht als eine Ungeheuerlichkeit, sondern als Schönheit. Und so hat sich im neuen Menschengeschlecht auch die ästhetische Idee getrübt. Die sittliche Grundlage der Gesellschaft (die dem Positivismus entnommene) erzielt nicht nur kein Resultat, sondern vermag sich selbst nicht zu bestimmen und verstrickt sich in ihren Wünschen und Idealen. Sind denn endlich, jetzt, nicht genug Fakten vorhanden, um zu zeigen, dass man nicht auf diese Weise eine Gesellschaft aufbaut, dass nicht diese Wege zum Glück führen und dass es nicht von daher komme, wie sie bis heute meinten? Woher denn? Sie werden viele Bücher schreiben, die Hauptsache aber auslassen: Im Westen hat man Christum verloren und darum sinkt der Westen, einzig und allein darum.
Das Ideal ist ein anderes geworden — wie klar ist das! Und das Sinken der päpstlichen Macht zugleich mit dem Sinken der römisch-germanischen Welt (Frankreichs und der anderen) — welch’ ein Zusammentreffen!
Dies alles fordert grosse und lange Auseinandersetzungen, allein, was ich im besonderen sagen will, ist dieses: Wenn Belinsky, Granowsky und diese ganze .... jetzt zusähen, so würden sie sagen: nein, davon haben wir nicht geträumt, nein, das ist eine Verirrung; wir werden noch warten, das Licht wird kommen, der Fortschritt wird die Herrschaft antreten und die Gesellschaft wird sich auf gesunden Grundlagen neu aufrichten und glücklich sein. Sie würden es nie zugeben, dass man, betritt man einmal diesen Weg, niemals wo anders anlangt, als bei der Kommune und Felix Piat. Sie waren so stumpf, dass sie auch jetzt nach den Ereignissen nichts zugeben, sondern weiter träumen würden. Hier habe ich Belinsky viel mehr als eine Erscheinung des russischen Lebens getadelt, denn als Menschen; dies war die hässlichste, stumpfste, schimpflichste Äusserung russischen Lebens. Ihre einzige Entschuldigung liegt — in der Unvermeidlichkeit dieser Erscheinung. Und ich versichere Sie, Belinsky würde sich jetzt bei folgendem Gedanken beruhigen: Seht darum ist es der Kommune nicht gelungen, weil sie doch immer vor allem französisch war, d. h. den Ansteckungsstoff der Nationalität in sich bewahrte. Darum muss man ein Volk auffinden, in dem kein Tropfen Nationalität enthalten und das fähig wäre, seiner Mutter Backenstreiche zu versetzen, wie ich [Russland]. Und mit Schaum auf den Lippen würde er sich wieder hinstürzen und seine heidnischen Artikel schreiben, Russland beschimpfen, ihre grossen Erscheinungen (Puschkin) verleugnen — um Russland endgiltig zu einer vacanten Nation zu machen, die fähig wäre, an der Spitze der allgemein menschlichen Aktion zu stehen. Den Jesuitismus und die Lüge unserer Hauptakteure würde er hocherfreut annehmen.
Aber noch eines: Sie haben ihn nie gekannt, ich aber habe ihn gekannt und gesehen und habe ihn jetzt völlig ergründet. Dieser Mensch hat mich einen ...... geschmäht, indessen aber war er niemals fähig, sich selbst und alle Führer der ganzen Welt Christus vergleichend an die Seite zu stellen. Er vermochte es nicht gewahr zu werden, wieviel kleinlicher Selbstsucht, Bosheit, Unduldsamkeit, Reizbarkeit, Niedrigkeit, aber hauptsächlich Selbstsucht in ihm selbst und in ihnen enthalten sei. [Diese Stelle des Briefes wurde schon weiter oben Seite 60 angeführt, wo sie uns zur Beleuchtung von des Dichters Stellungnahme sehr wichtig schien.] Er hat sich niemals gefragt: „Was werden wir denn an seine Stelle setzen? Etwa uns, die wir so hässlich sind? Nein, er hat sich niemals dabei aufgehalten, dass er selbst hässlich ist; er war im höchsten Grade mit sich zufrieden, und das war schon eine abscheuliche, schändliche, persönliche Stumpfheit. Sie sagen, er sei talentvoll gewesen. Durchaus nicht; wie hat Grigorjew in seinem Artikel über ihn gelogen! Ich erinnere mich noch an mein jugendliches Erstaunen, als ich einigen seiner rein künstlerischen Urteile lauschte (z. B. über die toten Seelen): er hat sich gegenüber den Typen Gogols bis zur Unmöglichkeit oberflächlich verhalten und war nur bis zum Entzücken erfreut darüber, dass Gogol betrog.
Hier habe ich, in diesen vier Jahren, seine Kritiken durchgelesen. Er hat Puschkin getadelt, als dieser seinen falschen Ton fahren liess und mit den Erzählungen Bjelkins und seinem „Arap“ hervortrat. Er hat mit Verwunderung die Nichtigkeit von „Bjelkins Erzählungen“ verkündet. Er hat in der Erzählung Gogols „Die Kutsche“ keine künstlerisch zielbewusste Schöpfung und keine Erzählung, sondern nur eine spasshafte Geschichte gefunden. Er hat den Schluss des „Eugen Onjegin“ abgelehnt. Er hat gesagt, Turgenjew werde kein Künstler werden, dabei ist das aber nach dem Lesen von Turgenjews Erzählung „Drei Porträts“ ausgesprochen. Ich könnte Ihnen solcher Beispiele so viele Sie wollen zusammenlesen, um Ihnen die Falschheit seines kritischen Gefühls und seines „empfänglichen Vibrirens“ zu beweisen, von welchem Grigorjew gefaselt hat (weil er selbst ein Dichter war). Über Belinsky und über viele Erscheinungen unseres Lebens urteilen wir heute noch durch eine Menge ausserordentlicher Vorurteile hindurch.
Habe ich Ihnen denn nicht über Ihren Turgenjew-Artikel geschrieben? Ich habe ihn gelesen, wie alle Ihre Arbeiten — mit Begeisterung, allein auch mit ein klein wenig Verdruss. Wenn Sie finden, dass Turgenjew die Richtung verloren hat, hin und her laviert und nicht weiss, was er über manche Erscheinungen des russischen Lebens sagen soll (sie jedenfalls nicht ernst nimmt), so hätten Sie auch gestehen sollen, dass seine grosse künstlerische Befähigung in seinen letzten Werken zurückgegangen ist und zurückgehen musste. So ist es auch in der That: er ist als Künstler sehr zurückgegangen. Der „Golos“ meint, dies sei darum der Fall, weil er im Auslande lebe; allein der Grund liegt tiefer. Sie aber sprechen ihm auch nach seinen letzten Werken seine frühere Künstlergrösse zu. Ist es so? Übrigens täusche ich mich vielleicht (nicht in meiner Beurteilung Turgenjews, sondern bezüglich Ihres Artikels). Vielleicht haben Sie sich nur nicht so ausgedrückt — — Aber wissen Sie, das ist ja alles Gutsbesitzer-Litteratur! Sie hat alles gesagt, was sie zu sagen hatte (grossartig bei Leo Tolstoj). Allein dieses, im höchsten Grade landadelmässige Wort war ihr letztes Wort. Ein neues, das Gutsbesitzerwort ablösendes Wort hat es noch nicht gegeben, war auch noch nicht möglich. Die Rjeschotnikows[33] haben nichts verkündet; aber immerhin drücken sie die Unvermeidlichkeit von irgend etwas Neuem in der Sprache des Künstlers aus, von etwas, das nicht mehr landadelmässig sei, obwohl sie das auf eine unförmliche Weise thun.
Wie sehr wünschte ich, Sie noch in Petersburg anzutreffen. Ich habe keine Vorstellung darüber, wann ich zurückkomme (unter uns: ich trachte in einem Monate). Wenn aber kein Geld kommt und ich den Termin verpasse, dann heisst es abermals bleiben. Aber das ist entsetzlich und unsinnig.
Den Roman werde ich entweder verpfuschen, dass es eine Schande sein wird (habe schon angefangen zu pfuschen), oder ich raffe mich auf und es wird doch was Ordentliches daraus. Ich schreibe auf gut Glück, das ist meine jetzige Devise.“
Am Schlusse des Briefes die Bemerkung: „— — Ich meine nur im allgemeinen, dass es für die Zeitschriften nicht übel wäre — wenn auch nur eine den Anfang machte — sich zu spezialisieren. Zum Beispiel die „Zarjá“ nach der einen ästhetisch-kritischen Seite hin, ohne sich weiter mit irgend etwas anderem zu befassen, ohne andere Ressorts. Sicherlich könnte das gelingen. Schade, dass ich Ihnen nicht sofort meine Ideen darüber entwickeln kann!“
Mit der Heimkehr Dostojewskys und seiner endgiltigen Ansiedelung in Petersburg tritt des Dichters Leben in seine letzte, seine bedeutendste Phase. Gleich einer Dichtung, die ein Meister vollendet, wo sich das Wesenhafte immer deutlicher und klarer aus dem Beiwerk heraus bis zur letzten Steigerung entwickelt, sehen wir des Dichters Leben sich nach dem Plan vollziehen, danach es angetreten. Dies ist aber nicht in einem behaglichen Sinne Goethe-artig ruhevollen Abschliessens zu verstehen, sondern in echt Dostojewskyscher Art: durch alle Lebensunruhe und allen Temperamentskampf, durch schwere körperliche Störungen hindurch der Abschluss eines Lebens, das bis zum Ende Einheit in leidenschaftlich bewegter Vielheit war.
Das Debut in der Heimat war freilich trübe genug. Anna Grigorjewna erzählt uns, dass sie nach Begleichung der Dresdener Schulden und der Reisekosten mit einer Barschaft von wenigen Rubeln in Petersburg ankamen, und das wenige Wochen vor ihrer Entbindung. Sie hatte gehofft, mehrere kostbare Gegenstände, Pelze usw. wiederzufinden, die man für sie aufbewahrt oder versetzt hatte — sie waren verfallen. Auch eines Hausanteiles, auf welchen sie von mütterlicher Seite her Anspruch hatte, war sie durch allerlei Machenschaften verlustig gegangen, sodass es nun hiess, mit Hilfe von Freunden das Leben einrichten, vor allem den letzten Roman verwerten. Theodor Michailowitsch legte von nun an den administrativen Teil seiner Geschäfte in die Hand seiner Gattin, was den endlichen glücklichen Umschwung ihrer Verhältnisse zur Folge hatte.
Strachow giebt uns darüber ziffernmässige Nachweise, die wir hier folgen lassen. Vor allem hat Anna Grigorjewna Dostojewskaja eine neue Ausgabe von des Dichters Werken veranstaltet, welche folgendes Erträgnis hatte: Im Januar 1873 erschienen „Die Besessenen“ in 3500 Exemplaren, im Januar 1874 der „Idiot“ in 2000 und im Dezember 1875 erschienen die „Memoiren aus einem Totenhause“ in 2000 Exemplaren. Im Dezember 1876 „Schuld und Sühne“ in 2000 und im November 1879 „Erniedrigte und Beleidigte“ in 2400 Exemplaren.
Diese Erfolge beruhigten den Dichter, welcher endlich alle Schulden zu tilgen vermochte, ungemein über das Los seiner Familie, die in Armut zu hinterlassen er stets hatte fürchten müssen. Man hat ferner nach seinem Tode ein Blatt in seinen Rechenbüchern gefunden, darauf die aus seinen Werken allein bezogenen Einkünfte mehrerer Jahre genau verzeichnet waren. So bezog er:
Dazu kamen jene Summen, welche der Dichter für die in den Zeitschriften erscheinenden neuen Romane erhielt. So zahlten ihm die „Vaterländischen Annalen“ i. J. 1875 für den Druckbogen des Romans „Junger Nachwuchs“ (Podrostok, der Adolescent) 250 Rubel, und der „Russkij Wjestnik“ für die „Brüder Karamasow“ (1879-80) 300 Rubel.
Die Einnahmen für Dostojewskys Werke haben sich bis auf den heutigen Tag gesteigert. Anna Grigorjewna macht kein Hehl daraus, ja es ist ihr, die des Dichters schwerste Jahre äusserster Not tapfer geteilt hat, heute eine Genugthuung, es dahin gebracht zu haben, dass der Reingewinn jeder neuen Auflage, die sie selbst verlegt, rund 75000 Rubel betrage. Ein noch sehr reichliches ungedrucktes Material an Briefen, Fragmenten und Dokumenten gestattet es, jeder neuen Auflage, je nach den Zeitumständen, etwas ungedrucktes beizufügen. —
Bald nach seiner Rückkunft hatte der Fürst Wladimir P. Meschtschersky den Dichter näher kennen gelernt und ihn eingeladen, die Redaktion seines Blattes „Grashdanin“ zu übernehmen. Für diese Thätigkeit, welche mit dem Jahre 1873 begann und bis Ende desselben Jahres währte, erhielt der Dichter ein Monats-Honorar von 250 Rubeln, ausser dem Honorar für seine Beiträge. Diese Artikel waren meist Feuilletons über die brennenden Tagesfragen, welche den fortlaufenden Titel „Tagebuch eines Schriftstellers“ führten. Sie bilden heute den ersten Band der unter demselben Titel herausgegebenen Schriften.
In dem von Dostojewsky im Jahre 1876 gegründeten und von ihm ganz allein besorgten Blatte, dem er den gleichen Namen „Tagebuch eines Schriftstellers“ gab, fand er endlich das Feld seiner Thätigkeit, das ihm am meisten zusagte. Allerdings nennt er in einem Briefe an eine bekannte Dame einen anderen Grund, der ihn bewogen habe, diese Monatsschrift zu schaffen. Wir meinen jedoch, dass ihm nicht sowohl das Kennenlernen der Tagesfragen um seines Romanes willen, als der nimmer rastende Wunsch dazu trieb, sich auszusprechen, seine Wahrheit an allem zu messen, was der Tag eben brachte. Der oben erwähnte Brief vom 9. April 1876 beginnt mit einer Erörterung persönlicher Beziehungen und fährt dann fort:
„Sie teilen mir Ihre Gedanken darüber mit, dass ich mich im „Tagebuche“ in Kleingeld umwechsle. Ich habe das auch hier aussprechen gehört. Hier ist, was ich Ihnen unter anderem darauf sagen will: Ich bin zu dem unumstösslichen Schluss gekommen, dass ein Schriftsteller der künstlerischen Richtung ausser dem Poem die von ihm dargestellte Wirklichkeit bis in das allerkleinste Detail mit der grössten Genauigkeit, historisch und aktuell, kennen muss. Bei uns glänzt damit nach meiner Meinung einzig und allein — Graf Leo Tolstoj. Victor Hugo, welchen ich als Romanschriftsteller hochschätze, wofür sich der selige Th. Tjutschew über mich, denken Sie nur, heftig ereiferte, indem er sagte, „Schuld und Sühne“ stehe höher als die „Misérables“, hat uns, ob er auch manchmal sehr breit im Studium des Details ist, wunderbare Studien gegeben, welche ohne ihn der Welt völlig unbekannt geblieben wären. Aus diesem Grunde habe ich, da ich mich dazu vorbereite, einen grossen Roman zu schreiben, beschlossen, mich speziell in das Studium — nicht der Wirklichkeit an und für sich, denn ich kenne sie ohne das — sondern der aktuellen Einzelheiten der laufenden Dinge zu vertiefen. Eine der wichtigsten Aufgaben in dieser Gegenwart ist für mich zum Beispiel die junge Generation und zugleich damit die gegenwärtige russische Familie, welche, ich fühle das, heute ganz anders ist, als vor zwanzig Jahren. Allein es giebt ausserdem noch vieles andere.
Wenn man 53 Jahre zählt, so kann man leicht bei der ersten Unachtsamkeit hinter der gegenwärtigen Generation zurückbleiben. Ich habe unlängst Gontscharow getroffen, und auf meine offene Frage, ob er im gegenwärtigen Lauf der Dinge alles verstehe oder schon aufgehört habe, manches zu begreifen, hat er mir geradeaus geantwortet, dass er vieles nicht mehr begreife (dies unter uns). Natürlich bin ich mir ganz klar, dass dieser grosse Geist nicht nur alles versteht, sondern die Lehrer lehren könnte; allein in dem bestimmten Sinne, in welchem ich ihn fragte (und den er in einem halben Worte verstand), versteht er nicht etwa vieles nicht, sondern er will es nicht verstehen. ‚Mir sind meine Ideale teuer und alles, was ich im Leben liebgewonnen‘, fügte er hinzu, ‚damit will ich nun auch die wenigen Jahre zubringen, die mir übrig bleiben; diese aber zu studieren (er wies auf die den Newsky Prospekt entlang wandelnde Menge) ist mir beschwerlich, denn es ginge meine kostbare Zeit darauf‘ ....
Ich weiss nicht, ob ich Ihnen das klar ausgedrückt habe, Christina Danilowna, aber es reizt mich, noch etwas mit voller Sachkenntnis zu schreiben. Das ist’s, warum ich eine Zeit lang zugleich studieren und das „Tagebuch“ führen werde, damit eine Menge von Eindrücken nicht verloren gehe. Alles das ist natürlich ideal! Würden Sie z. B. glauben, dass ich noch nicht damit zu Stande gekommen bin, mir die Form des „Tagebuchs“ klar zu machen, sogar noch nicht weiss, ob ich sie je in die Richte bringe, sodass möglicherweise dies Tagebuch schon zwei Jahre erscheinen und noch immer keine gelungene Sache sein wird? Beispielsweise: Ich habe zehn bis fünfzehn Themen, wenn ich mich zum Schreiben hinsetze (nicht weniger). Nun muss ich jene Themen, welche mich mehr einnehmen, unwillkürlich zurücklegen: sie werden viel Raum einnehmen, viel Glut verbrauchen (der Prozess Kroneberg z. B.), werden dem Heft schaden, denn es wird dadurch einförmig, arm an Artikeln werden. Andererseits habe ich, allzu naiv, gemeint, dies werde ein wirkliches Tagebuch werden. Ein wirkliches Tagebuch ist fast unmöglich, nur ein präsentables für das Publikum ist möglich. Ich treffe auf Begebnisse und empfange viele Eindrücke, die mich sehr einnehmen — aber wie soll man über das und jenes schreiben? Manchmal ist dies geradezu unmöglich.
So erhalte ich seit drei Monaten schon von allen Seiten sehr viele Briefe, mit und ohne Unterschrift — alle voll Teilnahme. Manche darunter sind ausserordentlich interessant und originell, dazu gehören sie allen möglichen jetzt herrschenden Richtungen an. Aus Anlass dieser verschiedenartigsten Richtungen, welche da in der Begrüssung meiner Thätigkeit zusammenfliessen, wollte ich einen Artikel schreiben, namentlich aber den Eindruck niederschreiben (ohne Namensnennung), den ich von diesen verschiedenen Briefen empfangen habe. Dabei ist der Gedanke, der mich mehr als alles in Anspruch nimmt, der: worin liegt unsere Zusammengehörigkeit, wo sind die Punkte, in welchen wir uns alle, die wir den verschiedenen Richtungen angehören, einigen könnten. Aber als ich den Artikel schon überlegt hatte, sah ich plötzlich, dass es um keinen Preis möglich wäre, ihn mit voller Offenheit zu schreiben. Nun aber, ohne Aufrichtigkeit? Ist es wert ihn zu schreiben?
Ja, auch keine Wärme wird bleiben. Vorgestern am Morgen kommen da plötzlich zwei junge Mädchen zu mir, beide etwa zwanzig Jahre alt. Sie kommen herein und sagen: „Wir haben mit Ihnen bekannt werden wollen, schon seit der Fastenzeit her. Alle haben uns ausgelacht und gesagt, Sie würden uns nicht empfangen und, wenn Sie uns auch empfangen sollten, uns nichts sagen. Aber wir haben beschlossen, es zu versuchen, und da sind wir, N. N. und N. N.“ Zuerst hat sie meine Frau empfangen, dann bin auch ich zu ihnen herausgekommen. Sie erzählten, sie seien Studentinnen der medicinischen Akademie, es seien ihrer dort schon 500 Frauenzimmer, und dass sie in die Akademie eingetreten seien, um höhere Grade zu erlangen und später der Gesellschaft Nutzen zu bringen — diesen Typus neuer junger Mädchen hatte ich noch nicht angetroffen (alte Nihilisten kenne ich wohl sehr viele, bin persönlich mit solchen bekannt und habe sie gründlich studiert). Werden Sie mir glauben, dass ich selten eine bessere Zeit verlebt habe, als diese zwei Stunden mit diesen Jungfrauen? Welche Geradheit, welche Natürlichkeit, was für eine Gefühlsfrische, Reinheit des Geistes und Herzens, welcher alleraufrichtigste Ernst und welche alleraufrichtigste Fröhlichkeit. Durch sie habe ich natürlich viele andere kennen gelernt, die ebenso waren, und ich gestehe Ihnen — der Eindruck war stark und sonnig. Aber wie soll man das beschreiben? Bei aller Herzlichkeit und Freude mit der Jugend — unmöglich. Ja, es ist auch fast persönlich. Aber was soll ich in diesem Falle für Eindrücke eintragen?
Gestern nun höre ich da wieder, dass ein junger Mensch, ein Studierender, den man mir gezeigt hatte, da er in einem mir bekannten Hause war, in die Stube des Hauslehrers getreten ist und, auf dessen Tische ein verbotenes Buch erblickend, dieses dem Hausherrn meldet, welcher dann seinen Hofmeister sofort hinausjagt. Als man, in einer anderen Familie, dem jungen Menschen vorhält, dass er eine Schurkerei begangen habe, da hat er das garnicht begriffen. Nun, wie soll ich das erzählen? Das ist etwas Persönliches und dabei ist auch etwas Nicht-Persönliches; es war hier ganz besonders, wie man mir erzählte, jener Denkprozess in den Ansichten und Überzeugungen charakteristisch, demzufolge er nicht begriff und über welchen man ein interessantes Wörtchen sagen könnte.“ —
So beginnen dann endlich für den Dichter bessere Zeiten. Er tilgt nach und nach alle persönlichen sowie die vom Bruder übernommenen Schulden und wenn er, seine Gattin und zwei Kinder auch an seiner Lebenswende noch immer zwei kleine Stuben des Schmiedegässchens unweit der Wladimirkirche innehatten, so haben seine äusseren Zustände an Ruhe und Sorglosigkeit in materieller Beziehung gewonnen und sind, was Anerkennung und Ehrung betrifft, zu einer Höhe gelangt, die trotz aller persönlichen Feindschaften, die ihm sein nervöses und oft wechselndes Wesen eintrug, von Jahr zu Jahr stieg. „Ich habe einen schlechten Charakter“, schrieb er um diese Zeit einmal an eine Freundin, „aber nicht immer, und das ist mein Trost.“
Im Jahre 1875 veröffentlicht Dostojewsky, wie wir schon erwähnten, in den vaterländischen Annalen den Roman: „Der Adolescent“.
Wir haben über die Erzählung „Podrostok“ (der Adolescent), welche nicht mit Unrecht im Deutschen den Titel „Junger Nachwuchs“ führt, weder in des Dichters Briefen, noch bei den russischen Kritikern eine andere als flüchtige Erwähnung gefunden. W. Rósanow meint, es seien darin manche selbstbiographischen Züge enthalten. Wenn man unter selbstbiographisch die Erwähnung auch inneren Fühlens und Erlebens und seiner Eigenform versteht, so kann man sagen, dass es kein Werk Dostojewskys giebt, das nicht selbstbiographische Züge aufwiese. Auch die Schilderung manches äusseren Geschehens tritt uns mit der Lebendigkeit des Erlebten entgegen.
So finden wir in der Schilderung eines Traumes, den Wersilow, des jungen Helden Vater, erzählt, das erlebte Urbild des im Jahre 1877 im Aprilheft des „Tagebuchs“ erschienenen „Traumes eines lächerlichen Menschen“. Ja, der aufmerksame Leser findet in allen Werken Dostojewskys eigentlich immer dieselben Ideen, immer dieselben Typen in unendlichen Variationen wiederkehrend; schon das allein ist nicht nur höchst künstlerisch, sondern auch innenbiographisch.
Der „Podrostok“ nun, dessen Inhaltswiedergabe wir hier für überflüssig erachten, weil der künstlerische Aufbau des Werkes sich nicht ganz mit seiner Grundidee deckt, erscheint uns vom russischen Standpunkt aus als ein Übergang von den Ideen Raskolnikows zum Hinweis auf das künftige, reinchristliche junge Russland, mit dem Dostojewsky seine „Brüder Karamasow“ und somit sein Lebenswerk zu beschliessen gedachte. Von „Schuld und Sühne“, strenger genommen, von seiner Rückkehr nach Russland, angefangen, sehen wir den Dichter unausgesetzt mit der Jugend, der russischen Jugend, beschäftigt, die er, in unendlichen Variationen, von der völligen Abwendung, wie in Stawrogin („Die Besessenen“), bis zu völliger Durchdringung, wie in Myschkin („Idiot“) und Aljoscha Karamasow mit dem Christentum in Contact bringt. Hier und da setzt er Ausgereifte, Alte, welche das Christentum fertig in sich tragen, als feste Stützpunkte, gleichsam Ankerbojen, in dieses überschäumende Jugendmeer hinein. So den ewig pilgernden Bauer Makar, Arkadjis Adoptiv-Vater, so den Starez Sosima, so, wenn auch humoristisch als blindes Werkzeug verwendet, Stepan Trofimowitsch in den „Besessenen“ und die junge Sonja, die ihren naiven Christus durch allen Erdenschmutz hindurchträgt.
Von Raskolnikow, dem „Napoleon“, bis zum Bürschlein Kolja Krassotkin, der — im Epilog der „Karamasow“ — „für die Wahrheit sterben möchte, mögen auch unsere Namen vergehen“, zieht eine endlose Reihe junger Wesen an uns vorüber, durch deren Seele der Geist der Zeit weht. Es ist sehr bedeutsam, was der Dichter in jenem oben citierten Briefe an Christine Danilowna N. sagt, dass er sich bestrebe, mit 53 Jahren noch die Jugend zu verstehen. Gerade er müsste es empfinden, dass mit seiner Liebe, seinem Interesse für die Jugend, seine Thätigkeit begraben würde, dass er, an diese Grenze gelangt, überhaupt nichts mehr zu sagen hätte.
Arkadji Makarowitsch, unser Adolescent, ist eine Art Raskolnikow. Auch er hat seine „Idee“. Nicht ein Napoleon will er sein, sondern ein Rothschild. Er will „ununterbrochen“ und „hartnäckig“ Geld aufhäufen, um die Macht auszuüben, die das Geld verleiht. Aber nicht durch Glanz und Prunk will er das, sondern viel hochmütiger, indem er den Glanz ablehnt und sich erlauben darf, als Bettler einherzugehen, Millionen zu verachten.
Wieso kommt dieser Zwanzigjährige zu seiner „Idee“? Er ist ein unehelicher Sohn, das Opfer der „zufälligen Familie“ unserer Tage, und strebt auf diese Weise alles, was das Schicksal ihm schuldig geblieben, nobel zu quittieren. Er schreibt selbst die Geschichte dieser Ideen, ihrer Entwickelung zur That nieder, sowie das Fiasko, das sie endlich erleidet, und sendet diese Aufzeichnungen an einen klugen, alten Freund zur Beurteilung, ob sie für einen Roman tauglich seien.
Was dieser Aussenstehende darüber sagt, das spricht des Dichters eigene Absicht aus, die Dostojewsky immer oder zumeist im Epilog seiner Hauptgedanken zusammenfassend ausspricht, was manche Neueren ihm mit wenig Glück nachgemacht haben. Denn ein solches Zusammenfassen und Aussprechen wirkt nur bei dem Starken, der seine Ideen künstlerisch auf die Beine zu stellen versteht, als Verstärkung, während sie für den Schwachen zum Rettungsanker für die Verständlichkeit verwendet wird.
Jener Freund nun weist vor allem auf den Verfall der alten, grundständigen russischen Familie hin, die andere Kinder, andere Jünglinge herangezogen habe, als die hereinbrechende Horde der „zufälligen Familie“, die eine solche Jugend erzeuge wie die heutige. Mit solchen Typen, meint er, werde der russische Roman unmöglich werden. Die Reinheit der Familie müsse es sein, welche nicht allein dem Roman, nein, dem Leben verheissungsvolle Typen schenken würde. Nun zählt der Schreiber dem jungen Menschen, die ehelichen und unehelichen Kinder seines „zufälligen“ Vaters, des geistreichen und haltlosen Neurussen Wersilow, vor, und schliesst:
„Sagen Sie mir jetzt, Arkadji Makarowitsch, dass diese Familie — eine zufällige Erscheinung sei, so wird sich meine Seele darüber freuen. Allein, wird nicht im Gegenteil jene Schlussfolgerung richtiger sein, welche sagt, dass unbedingt schon eine grosse Anzahl russischer Stammfamilien unaufhaltbar und in Massen in zufällige Familien eintreten und in gemeinsamen Chaos, gemeinsame Unordnung mit ihnen zusammenfliessen? Auf einen Typus dieser zufälligen Familien weisen ja auch Sie in Ihrer Handschrift hin. Ja, Arkadji Makarowitsch, Sie — sind Mitglied einer zufälligen Familie, im Gegensatze zu unseren noch vorlängst bestehenden alten Familientypen, die eine von der Ihrigen so sehr verschiedene Kindheit und Jugend hatten.
Ich gestehe, ich möchte nicht der Romancier eines Helden der zufälligen Familie sein! Eine undankbare Arbeit, eine Arbeit ohne schöne Formen. Ja, und diese Typen sind auf jeden Fall — noch eine Gegenwarts-Sache, können daher nicht künstlerisch vollendet werden. Da sind schwere Irrtümer, Übertreibungen, da ist ein Übersehen möglich. Auf jeden Fall müsste man allzu viel erraten. Was aber soll ein Schriftsteller thun, der wünschen würde, nicht nur historisch zu schreiben, der von der Sorge um die Gegenwart bedrängt ist? Raten und — sich irren.
Allein solche „Aufzeichnungen“, wie die Ihren, könnten, so scheint es mir, als Material für ein künftiges Kunstwerk, für ein künftiges Bild einer unordentlichen, aber schon vergangenen Epoche dienen. Wenn des Tages Zorn vorüber sein wird und das Kommende hereinbricht, dann wird der künftige Künstler sogar für die Gestaltung des vergangenen Chaos herrliche Formen finden, dann werden solche Aufzeichnungen, wie die Ihrigen sind, gebraucht werden und ein gutes Material abgeben — wenn sie nur aufrichtig sind, ungeachtet alles Chaotischen und Zufälligen darin ... Es werden da wenigstens einige wahrhafte Züge unversehrt erhalten bleiben, aus denen man wird erraten können, was sich in der Seele manch eines Jünglings jener trüben Zeiten bergen konnte — eine nicht ganz geringfügige Erkenntnis, denn aus den Jünglingen erstehen die Geschlechter.“
Ausser der Korrespondenz mit Fremden, die von Jahr zu Jahr für den Dichter immer drückender wurde, nahm Dostojewskys intensive innere und äussere Vorbereitung zu seinem „letzten Roman“ einen immer grösseren Raum in seinem Leben ein. Er sucht die grossen Mönchklöster mit ihren ‚Skity‘ (Einsiedeleien) wieder auf und widmet vor allem jeden freien Augenblick dem Besuch der Gerichtsverhandlungen, dem praktischen Studium der Rechtspflege; denn so wenig er etwas über die Theorie der Psychiatrie gewusst hatte, da er so treffsicher unzählige Krankheitstypen hinzeichnete — an denen die Wissenschaft lernen könne, wie Dr. Tschiž sagt —, ebensowenig hatte er sich ja um den Buchstaben des Gesetzes, um die Rechtswissenschaft bekümmern können, wenn man auch den Umstand nicht übersehen darf, dass jeder Russe, sei er nun in Sibirien gewesen oder nicht, im ersten Teile seines Lebens reichlich Gelegenheit und Nötigung findet, sich mit dem Wortlaut der Gesetze und dessen praktischen Konsequenzen vertraut zu machen.
Bei Dostojewsky jedoch floss diese praktische, rein verstandesmässige Gesetzeskenntnis mit den tieferen Quellen seines Wesens zusammen. Sein Empfinden der menschlichen Allschuld erweckte von vornherein Neugierde und Teilnahme an aller menschlichen Schuld. Finden wir doch in den grossen Aufsätzen, die er um diese Zeit den Schwurgerichten, den Strafprozessen und ihrem Ausgang widmet, das eifrige Bemühen, den lebendigen Strom subjektiver Wahrheit in das dürre Gebiet der „objektiven“ Pragmatik einzuleiten. Er kämpft da gegen die Verurteilung der Mörderin Kairowa nahezu mit denselben Worten, die er im Epilog des „Hahnreis“ ausspricht: „Niemand, niemand, sie selbst am allerwenigsten konnte wissen, ob sie weiter schneiden werde“ usw.
Seine Anteilnahme an den Dingen der irdischen Gerechtigkeit geht soweit, dass er nach Verurteilung der Arbeiterfrau Kornilowa, welche ihr sechsjähriges Stieftöchterchen vom Fenster ihrer Wohnung im vierten Stockwerke in den Hofraum hinunterstiess, auf Wiederaufnahme des Prozesses drängt und das Gutachten der Ärzte herbeiführt, die nach eingehender Prüfung des Sachverhaltes eine Geistesstörung während der ersten Monate der Schwangerschaft feststellen. Die Frau hatte sich im Untersuchungsgefängnis nach dieser Zeit und der Geburt ihres Kindes weich, reuig, tadellos benommen; sie wurde freigesprochen und Dostojewsky übernahm es, die Versöhnung der Gatten einzuleiten und durch persönliche Teilnahme an ihrem weiteren Zusammenleben zu festigen. — Diese Beschäftigung mit den „laufenden Dingen der Gegenwart“ reift eben die Doppelfrucht seiner Thätigkeit im „Tagebuch eines Schriftstellers“. Sie ist zugleich Vorbereitung für den Roman und Verkündung „seiner Wahrheit“ in diesem eigenartig redigierten Organ.
Auch „die Gesellschaft“ hatte sich in dieser Zeit dem Dichter genähert. Er wird vielfach geladen, gefeiert, nimmt Teil an wohlthätigen Veranstaltungen, Kinder- und Adolescentenbällen; ja, drei Tage vor seinem Tode sollte er bei der ersten Probe einer Kindervorstellung die Rolle des Mönchs, die er übernommen hatte, durchführen, wurde aber durch das Unwohlsein verhindert, das einen so raschen Verlauf zum tötlichen Ausgang nahm. —
Hier seien noch einige Stellen aus Briefen an Freunde und einige diktierte Notizen wiedergegeben, die sein Verhalten während der Zeitströmung von 1870-1880 kennzeichnen, sowie seine Anschauungen über Dinge, welche seinem direkten Lebenswerk ferner liegen. Dazu gehörten z. B. des Dichters Ansichten über das Frauenstudium in Russland. So sehr ihm die Studentinnen gefallen [wie wir oben sahen], so wenig will er etwas davon wissen, dass sie „um Nutzen zu bringen“ — wie das Losungswort der russischen Jugend lautet —, Feldscherinnen und Hebammen werden. Er weist dabei auf die grosse Unbildung aller Spezialisten in Russland („ganz anders in Europa“) hin und verlangt von den jungen Mädchen und Frauen Vertiefung der allgemeinen Bildung: „die Mehrheit der Studenten aber und der Studentinnen, das ist alles ohne jegliche Erziehung. Was ist das für ein Nutzen für die Menschheit?“
In einem Briefe vom Juli 1879 an eine Freundin betont Dostojewsky ihr grosses Glück, Kinder zu besitzen. „Wie gut ist es, dass Sie Kinder haben, wie sehr vermenschlichen diese unsere Existenz in einem höheren Sinne. Kinder sind eine Beschwerde, aber eine unentbehrliche, und ohne sie giebt es kein Lebensziel. Und die europäischen Sozialisten verkünden gemeinsame Erziehungshäuser! Ich kenne vortreffliche verheiratete Menschen, die aber kinderlos sind — nun denn: bei so viel Geist, bei solcher Seele fehlt ihnen doch etwas, und wahrlich, in den höheren Aufgaben des Lebens hinken sie irgendwie.“ Wer Dostojewskys Werke aufmerksam gelesen hat, wird mit dieser Anschauungsart längst vertraut sein. Vom „kleinen Held“ angefangen bis zum Schluss der „Brüder Karamasow“, dem niedergeschriebenen wie dem ersonnenen, den er den Freunden mitteilte, schlingt sich, wie eine Blumenkette, eine unzählbare Reihe von Kindergesichtern; Russlands Kinder, die der Dichter so innig ans Herz drückt, von denen er für Russlands Zukunft so viel hofft.
Eine grosse Anzahl von Schriftstellern und Schriftstellerinnen hat nach des Dichters Tode unzählige Vorträge gehalten und Artikel über ihn und seine Thätigkeit geschrieben. Der Katalog der im Zusammentragen von Urkunden und Materialien unermüdlichen Witwe weist bis zum Jahre 1897 allein 190 grössere und kleinere Schriften und Werke auf, die sie im dazu gegründeten „Museum Dostojewsky“ in Moskau samt ungedruckten (von der Zensur noch nicht zum Druck freigegebenen) Fragmenten, z. B. gewisse Kapitel aus den „Besessenen“, bewahrt. Unter diesen Schriften finden wir nicht wenige über das Thema: „Dostojewskys Kindertypen“. Wir haben nur in einigen davon geblättert, sind indes überzeugt, dass sie alle das nicht auszudrücken vermögen, was z. B. in seinen Briefen über das „winzige Wesen“ Sonja wie ein lebendiger Liebesquell hervorbricht. In der aufregendsten Arbeit begriffen, konnte er, wie seine Gattin erzählt, immer wieder auf Verlangen seines dreijährigen, jüngsten Söhnchens Aljoscha die Repetiruhr schlagen lassen, die er bei sich trug. Man denke nur, was alles in seinen Werken über sein Verhältnis zu Kindern ausgestreut liegt: an die Kinderfreundschaft in „Njetotschka Njeswanowa“, das Kinderkapitel im „Idiot“, an alle kleinen Erzählungen und Skizzen bis zum erschütternden Kapitel über die Kinder in den „Karamasow“, und man wird erkennen, dass sie nicht zufällig da sind, dass sie einen integrirenden Teil seiner Dichtung und seines Lebens ausmachen. — Die Anfrage eines seiner Korrespondenten, was dieser sein noch sehr junges Töchterchen lesen lassen solle, beantwortet Dostojewsky ungefähr mit: das Beste. Walter Scott, Schiller, Goethe, den Don Quixote, Gil Blas, Prescott und die russischen Historiker, sowie Puschkin und Tolstoj unbedingt, Turgenjew und Gontscharow, „wenn er wolle“, ihn aber, Dostojewsky, nur mit Auswahl.
In einem Briefe an eine Dame dankt er ihr, dass sie ihn in seinen Werken verstehe, was bei der gesamten litterarischen Kritik nicht der Fall sei, und hegt nur den einen Wunsch, sich einmal ganz aussprechen zu können, wobei er W. S. Solowiow, einen jungen Philosophen [den jetzt hochangesehenen Gelehrten und Dichter] zitiert, der bei seiner Doktor-Disputation das hübsche Wort gesagt habe: „Nach meiner tiefsten Überzeugung weiss die Menschheit unendlich viel mehr, als sie bis heute in ihrer Kunst und Wissenschaft auszusprechen vermocht hat.“
Die kritischen Ausfälle, welche um diese Zeit in Broschüren und Zeitschriften auftauchen, locken Dostojewskys Zorn heraus, dem er aber meist nur in seinem Notizbuch aphoristisch Ausdruck giebt. So ist jene für die russische Ethik bezeichnende Stelle an den Rechtshistoriker K. D. Kawélin gerichtet, wo es heisst: „Sie sagen, das heisse sittlich sein, wenn man nur nach seinen Überzeugungen handelt. Woher haben Sie das genommen? Ich sage Ihnen geradeaus, dass ich Ihnen nicht glaube, und sage im Gegenteil, dass es unsittlich ist, nach seiner Überzeugung zu handeln ..... Blutvergiessen halten Sie nicht für sittlich, aber aus Überzeugung Blut vergiessen, das halten Sie für sittlich. Das Sittliche deckt sich nicht mit dem Begriff der Überzeugung, der man Folge gegeben, weil es manchmal sittlicher ist, seinen Überzeugungen nicht Folge zu leisten, und der Überzeugte, trotzdem er vollkommen bei seiner Überzeugung verharrt, durch ein gewisses Gefühl davon abgehalten wird, die Handlung auszuführen. Er tadelt und verachtet sich mit dem Verstande, allein mit dem Gefühl, das heisst mit dem Gewissen kann er sie nicht ausführen (und weiss es endlich, dass ihn nicht Feigheit zurückhielt). Vera Sassúlitsch hat einen Augenblick lang geschwankt; es ist schwer, die Hand zum Blutvergiessen zu erheben, sagte sie sich. Dieses Schwanken war sittlicher, als das Blutvergiessen selbst.“
An einer anderen Stelle wettert er gegen die Progressisten und Anhänger des Westens, welche jedoch die bureaukratischen Formen und Formeln ablehnen: „Zerstört nur die administrativen Formeln!“ heisst es da, „das ist aber eine Treulosigkeit gegen den Europäismus, es ist ein Verleugnen dessen, dass wir Europäer sind, es ist eine Untreue an Peter dem Grossen. O, auf eine Umgestaltung wird unsere Administration schon eingehen, aber nur in einer untergeordneten Form, praktische Fragen betreffend usw. Allein, dass sie ihren Geist vollkommen umwandeln sollte — nein, nicht um alles in der Welt! Unsere Liberalen, welche im Gegensatz zum Beamtentum auf dem Semstwo bestehen, wahrlich sie widersprechen sich selbst! Das Semstwo, das gesetzmässige Semstwo, das ist ja die Rückkehr zum Volk, zu den Volksgrundlagen (ein von ihnen so sehr verlachtes Wörtchen). Wird also der Europäismus in seiner jetzigen Gestalt bestehen bleiben, wenn sich das gesetzmässige Semstwo einwurzelt? Das ist die Frage. Doch ist das Wahrscheinlichste, dass er sich nicht erhält.
Der Beamte, der jetzige Beamte indessen — das ist der Europäismus, das ist Europa selbst und sein Emblem, das ist gerade das Ideal der Gradowskys, der Kawelins u. a. Folglich müssten unsere Liberalen und Europajunge, wenn sie folgerichtig sein wollten, für den Beamten und seine jetzige Art eintreten, mit kleinen Abänderungen, welche dem Fortschritt der Zeit und ihrer praktischen Forderungen entsprächen. Übrigens, was sage ich? Im wesentlichen treten sie ja auch dafür ein. Gebt ihnen eine Konstitution, so werden sie auch die Konstitution dem administrativen Schutze Russlands anvertrauen“ ....
Und weiter heisst es als Glosse zum Wort Konstitution: „Ja, Ihr werdet die Interessen Eurer Gesellschaft vertreten, aber ganz und gar nicht die des Volkes; Ihr werdet es auf’s neue leibeigen machen, Kanonen werdet Ihr Euch ausbitten, um auf es zu feuern. Die Presse aber! Die Presse werdet Ihr nach Sibirien schicken, so wie sie Euch nur nicht ganz zusagt! Nicht nur Euch widersprechen wird“ usw.
Aus dieser Polemik ist durch alle Verschränkung der Begriffe und Wirrnis der Werde-Elemente in Russland hindurch eines klar: dass das Beamtentum eine furchtbare Krankheit ist, wo immer es sich einfilzt, eines jener historischen Missverständnisse und Missverhältnisse, wonach Diener des Staates allmählich zu Herren des Volkes werden und aus jedem Gemeinwesen eine seelenlose Maschine zu machen vermögen, die alles zermalmt, was in ihre Nähe gelangt und gegen welche auch der beste Wille eines Alleinherrschers machtlos wird. Dostojewsky berührt dieses Thema später noch einmal in einem Briefe an Iwan Sergejewitsch Aksakow, mit welchem er erst nach der denkwürdigen Puschkin-Feier im Sommer 1880 in nähere Beziehungen trat.
Mit dem Jahre 1880 gelangt das Leben und Wirken des Dichters zu seinem äusseren und inneren Gipfelpunkt. In diesem Jahre stellt er durch seine grosse Puschkin-Rede gleichsam für alle Zeiten das Credo des russischen Geistes und Schrifttums fest und im selben Jahre vollendet er sein „letztes Werk“, die Krone von seines Lebens Sinnen und Schaffen, Wünschen und Wirken, die „Brüder Karamasow“.
Nikolaus Strachow erzählt in den „Materialien zu einer Biographie Dostojewskys“ [Petersburg, Suworin 1883] mit grosser Ausführlichkeit den ganzen Verlauf der für die russischen Bestrebungen so bedeutungsvoll gewordenen Puschkin-Feier. Wir folgen ihm in die Einzelheiten dieses „nationalen Ereignisses“ nicht nach. Für uns sind drei springende Punkte wichtig, die mit wenigen Worten hier bezeichnet seien. Erstens die Vorbedingungen, welche dieses Fest zu solcher Bedeutung erhoben, sodann das Konkrete des Verlaufs und endlich das Ergebnis der Feier als Wirkung auf die litterarisch-nationalen Parteien.
Was vorangegangen war, gipfelt in der Spaltung der russischen Schriftsteller und mit ihnen der russischen Gesellschaft in Westler und Slavophile. Dabei ist im Auge zu behalten, dass es sich da nicht um Geschmacks- und Bildungsrichtungen handelte, sondern, wie wir wissen, um die Art des Einflusses auf das Volk. Puschkin allein vereinigte in seiner Dichtergestalt die Anerkennung beider Parteien. Gleichwohl hielten sich zur Zeit die Ultra-Slavophilen der „Moskowskija Wjedomosti“ mit Katkow an der Spitze fern und brachten auch nicht eine Notiz über die Feier. Ihnen war Puschkin und die Gesellschaft der Litteraturfreunde, die ihn feierte, zu „westlich“. Aus alledem lässt sich begreifen, dass man von den angemeldeten Rednern etwas Ausschlaggebendes, Endgiltiges erwartete.
Turgenjew, welcher die erste Rede halten sollte, war am Vortage durch Acclamation zum Ehrenmitglied der Moskauer Universität ernannt worden. Man sah in ihm „den unmittelbaren und würdigen Nachfolger Puschkins“, da auch er, wenn man es nicht zu genau nahm, ähnliche Züge aufwies: als russischer Dichter mit westlicher Kultur. Turgenjew hatte seine Rede in der Einsamkeit seines Landgutes ausgearbeitet und las sie nun, von lebhaften Beifallssalven unterbrochen, in der ersten Festversammlung im Adelskasino am 7. Juni vor. Die Schlussstimmung war jedoch eine geteilte, da Turgenjew die Frage offen liess, ob Puschkin ein nationaler Dichter sei oder nicht, ja auch nicht darauf einging, diese Frage zu beleuchten.
Nach einer Pause sollten Dostojewsky und Aksakow, dieser als Vertreter des reinen Slavophilentums, sprechen. Aber schon als Dostojewsky begann, und mit dem inneren Feuer, das in ihm brannte, den „russischen Menschen“ im Saale mit den Worten anrief, die wir schon einmal anführten: „Demütige Dich, stolzer Mensch, und vor allem, brich Deinen Hochmut, demütige Dich, müssiger Mensch, und vor allem, mühe Dich auf heimatlichem Boden“ — da fühlte dieser „russische Mensch“, der lautlos den Saal füllte, dass das Wort des Tages gesprochen war, und lauschte bewegt bis ans Ende, da die Begeisterung in unerhörten Jubel ausbrach, in einen Versöhnungsjubel, wie ihn Russland noch nie erlebt hatte.
Des Dichters synthetischer Geist hatte hier den Punkt getroffen und ans Licht gebracht, der beide Strömungen versöhnte, nach dem es unbewusst alle verlangte und der eine neue Aera des litterarischen Wirkens anbahnte. Er hatte das Wort gesprochen, dass Puschkins westliche Kultur durchaus national von ihm verwertet worden sei, dass er in sich eben durch seine echt russischen Anschauungen die Verbindung mit dem Geist des Westens in einer Weise herstelle, die mustergiltig für alle Nachkommenden sei, wie man das ja an seinen dichterischen Gestalten sehen könne. Hier führte Dostojewsky seine Gedanken mit Zuhilfenahme einiger Beispiele aus, die — uns ein Zeuge dieser Feste erzählte — durchaus nicht einwandfrei, ja geradezu gewaltsam ausgelegt waren. Derselbe Zeuge, Professor St.... in Moskau, schildert indes selbst die lebendige Wirkung dieser Rede als eine ungeheure, der man sich erst später bei kühler Überlegung aus sehr stichhaltigen Gründen entwand. Für uns ist das gleichgiltig. Das, was Dostojewsky zeigen und erweisen wollte, was er in sich trug, als er jene Argumente heranzog, das war das Wahre und Befruchtende an seiner Rede und das ist es wohl auch heute noch, was, ihm selbst unbewusst, dennoch in der Seele manches modernen Russen nachklingt. Diese Rede war es denn auch, welche die Versöhnung der streitenden Elemente anbahnte.
Wir gelangen nun zum Abschluss von des Dichters Wirken und Leben.
Selten wird einem schaffenden Genius das hohe Glück zu teil, dass sein letztes Wort auch der vollendetste Ausdruck seiner Kunst war; wie oft verwischt ein Allerletztes die Wirkungen eines ganzen Lebens. Dostojewsky ist dieses Glück geworden. Denn wenn es auch durch die Äusserungen seiner Gattin und seiner Freunde beglaubigt ist, dass er eine Fortsetzung der „Brüder Karamasow“ schon fertig in sich trug, wenn wir auch wissen, wie er sich die Lösung dieses Problems im russischen Sinne vorgesetzt hatte, so können wir der Meinung eines seiner nahesten Freunde nur beipflichten, wenn wir annehmen, dass die Ausführung dieses Schlusses so weit hinter dem Plane zurückgeblieben wäre, als überhaupt Erfüllungen hinter Hoffnungen, Ausführungen hinter genialen Entwürfen zurückstehen. In den „Brüdern Karamasow“ aber ist ja schon in der Exposition, d. h. im Kapitel vom Starez Sosima, das Höchste als Ahnung und Ziel für den Helden Aljoscha ausgesprochen; der Leser empfängt ja von diesem „vorläufigen“ Bilde des „russischen Christus“, das der Dichter in Aljoscha erst ausführen wollte — wie er andeutet und alle Freunde bezeugen — vollauf alles, was auf ihn wirken soll: die Ahnung, gleichsam die Verheissung eines reinsten Zustandes. Hier musste jede Ausführung zurückstehen, im besten Falle als Wiederholung wirken. Wohl aber dürfen wir dem Dichter dafür dankbar sein, dass er uns sagte, wo er hinaus wollte; ganz besonders darum, dass es auch für jene, die es nicht schon in dem Vorhandenen herausgelesen haben, keinen Zweifel über die Absichten des Dichters gebe.
Wir setzen bei deutschen Lesern die Bekanntschaft mit dem Buche voraus. Sowohl die Fabel, als auch die Richtung — welche im Kapitel vom Starez angezeigt ist — liegen klar zu Tage. Allein im Grossartigen, im Ungeheuren, das in dem Kapitel vom Grossinquisitor heraustritt und scheinbar allgemein menschlich ist, das in jeder Sprache hätte geschrieben werden können, da vibriert schon die tiefe russische Note mit, die russische Seele, die ihren Gottesdurst in Erdenlust und verneinende Grübelei zerspaltet. Das brennende Begehren nach dem Glauben, das diese „Legende“ geschaffen hat, ein Begehren auch in der Seele eines mit allen Vorzügen westlicher Bildung ausgestatteten Geistes wie Iwan Karamasow, das ist echt russisch. Diese Figur Iwans und diese Episode beleuchten uns auch urplötzlich, was Dostojewsky unter seiner „russischen Allmenschlichkeit“ versteht. Die ewige Frage nach dem Gotte, die dieses Volk durch alle Zeiten hindurch, auf allen Gebieten in sich behält, ist ihm Bürgschaft, dass diese zwei Züge, so untrennbar wie sie es sind, zugleich allgemein menschlich und echt russisch sind.
Echt russisch ist auch das Schuldthema aufgenommen und durchgeführt. Ganz unbewusst und selbstverständlich fliesst dieses „an allem und für alle und alles schuldig sein“ wie ein Element durch die Menschen und Ereignisse des Romans, bis es in den Bekenntnissen Sosimas bewussten Ausdruck erhält. Ja, Rósanow, der geistvolle Kommentator, findet darin einen Fehler, dass nicht auch die Kinder in diese Allschuld einbezogen sind, die Iwan als „unschuldig unter der Disharmonie der Welt Leidende“ hinstellt; dass der Dichter nicht auch ihnen die Erbsünde zugeteilt hat; eine orthodoxe Einseitigkeit, vor welcher ein feineres Gefühl den Künstler glücklich bewahrt hat.
Ganz besonders russisch aber ist der endgiltige Hinweis auf Russlands reinere Zukunft, die Jugend. Dieses Motiv der russischen Jugend, das wir in allen seinen grösseren Werken, gleichsam hinter ihnen her, wie ein Dämmern künftiger Tage fühlten, das er im Epilog des Podrostok geradezu verkündet, hier bricht es plötzlich hervor und wir sehen mit einemmal das ganze Gebiet ringsum beleuchtet, vor uns die Zukunft des Helden jenes Atridenromans der Karamasow, der das Sühnungswerk der Iphigenie in modernem und christlichem Sinne zu vollenden hat. Aljoscha sollte, so war des Dichters Plan, nach des alten Sosima Gebot in die Welt zurückgehen, ihr Leid und ihre Schuld auf sich nehmen. Er heiratet Lisa, verlässt sie dann, um der schönen Sünderin Gruschenka willen, die sein Teil Karamasowschtschina[34] zu Falle bringt, und tritt nach einer bewegten Periode irrenden und verneinenden Lebens, da er kinderlos geblieben ist, geläutert wieder ins Kloster ein; er umgiebt sich da mit einer Schar von Kindern, die er bis an seinen Tod liebt und lehrt und leitet. Wem fiele hier nicht der Zusammenhang mit der Erzählung des Idioten von den Kindern ein, wem nicht der kleine Held, alle die entzückenden Kinderzüge, die nur die Liebe entdeckt. Nun fällt aber auch ein Abglanz dieser Stimmung wie Feuerschein in die unerbittliche Geisselung der Gott-losen Jugend in den „Besessenen“, im „Idiot“, im „Jungen Nachwuchs“, und wir sehen den Dichter förmlich mit seinen zwei Simson-Armen die Säulen jenes Götzentempels umklammern, um sie in Trümmer zusammenzuwerfen. Wir sehen seinen Hass, seine Ungerechtigkeit und Übertreibung als die Zerstörungsarbeit an, auf dem Platze, wo allein ein neuer Aufbau möglich ist. — — Diese Jugend sehen wir, von ihm verdammt, zu Grunde gehen, um jener anderen willen, die er in der Seele trägt und welcher dereinst Russlands Zukunft gehören soll.
Die Fabel des Romans ist bei aller Füllung desselben mit einer Unzahl von Episoden, Ereignissen, Zufälligkeiten u. dergl. klar und einfach genug. Wer Dostojewsky kennt, der weiss, dass er nur wenige Themen hat, ja eigentlich ein einziges Urthema, aus dem er immer wieder das Gerippe eines Problems aufbaut, das er in lebendige Menschen einfleischt, denen er ihre individuelle Seele einhaucht. So fände ein Spurensucher in Dostojewskys Werken reichliches Nachweismaterial für Varianten und Wiederholungen des Grundthemas. Was gäbe es da für Ernten für einen Nachwuchs von Kommentatoren im Sinne der Goethe-Forschung, wenn so etwas in Russland möglich wäre! Was im jungen Russland nachgeforscht und nachgewiesen wird, ist heute noch der Sinn, nicht das i-Tüpfelchen des Mysteriums einer Dichtung. Dieser Nachweis aber ist leicht, denn der Sinn der Wiederholungen ist immer augenfällig.
So wiederholen sich des Dichters Gedanken über die „neuen Ideen“ in den „Tagebüchern“, in „Schuld und Sühne“, in „winterlichen Betrachtungen über Sommereindrücke“ [diese allerdings durch die Londoner Einflüsse modificiert], in den „Besessenen“ usw, nahezu wörtlich, da es sich für ihn in erster Linie um die Wirkung, nicht um die Stilschönheit seiner Worte handelt. Den „Traum eines lächerlichen Menschen“ träumen wir ihm zweimal nach, finden dessen Grundidee in dem kleinen Aufsatz wieder, den er unter dem Titel „Das goldene Zeitalter in der Tasche“ im Januarheft des Tagebuchs von 1876 publiciert, und zuletzt als positiven Hintergrund seiner Hoffnungen für die Zukunft. Auch die Figuren Dostojewskys kehren, unendlich variirt, niemals zum Typus herabsinkend, häufig wieder. Namentlich treten für das Auge des Russen gewisse Merkmale immer wieder auf, deren Gemeinsamkeit dem europäischen Leser oft darum entgeht, weil ihm das Merkmal selbst nichts sagt. So sind Iwan Karamasow und Raskolnikow, der Fürst Walkowsky und Swidrigailow, der „Idiot“ und Aljoscha Karamasow, der Starez Sosima und der Wanderbettler Makar im „Jungen Nachwuchs“, der Fürst Sokolsky ebenda und der alte Fürst in „Onkelchens Traum“ eigentlich Variationen einer Wesenheit, mit künstlerischer Vollendung bis ins Kleinste individualisiert. Nur Dmitri Karamasow steht ohne Gegenspielart da. Er ist auch der Träger des echt Dostojewskyschen Elements des Unbewussten, das eigentlich die Komplikation und den Abschluss des uns bekannten Teiles der Fabel herbeiführt.
Der alte Karamasow ist ein Wollüstling niederster, bis ins Mysteriöse gehender Art. Er erzeugt mit zwei Frauen und einer blödsinnigen Bettlerin, die er vergewaltigt, vier Söhne, welche, jeder in seiner Art durch den Anteil der Mutter modificiert, ihr Teil vom Karamasowschen Erbe in sich tragen. Die erste Gattin war nach einem kurzen Romantismus, der sie veranlasst hatte, ohne alle Not mit ihm durchzugehen, energisch geworden, hatte ihn bald geprügelt und zuletzt mit dem dreijährigen Dmitri und ihrer Mitgift allein gelassen. Die Spuren dieser Ehe prägen sich in Dmitris Zügellosigkeit und der mit einem deklamatorischen Pathos vermengten unordentlichen Ehrlichkeit aus. Iwan, der ältere Sohn der hysterischen „Schreiliesel“, die hinwieder der Gatte prügelte, erbte ausser der Karamasowschtschina (etwa Karamasowerei) die äusserste Reizbarkeit der Nerven seiner Mutter, die ihn zu Hallucinationen führte, während bei Aljoscha, dem Jüngsten, die bösen Mächte sich erschöpft zu haben schienen, wenn sie ihm auch einen Rest jenes Erbübels zuteilten. Der Sohn der Gosse jedoch, Smerdjakow, der nachmalige Vatermörder, ist die Personifikation der Seelenlosigkeit als Produkt bestialischer Triebe, und ihn lässt der Dichter, charakteristisch genug, vom Vater zum Koch ausbilden, gleichsam ein Symbol der verwandten Triebe von Völlerei, Wollust und Grausamkeit.
Dmitri treibt sich unter fremden Menschen herum und verprasst sein mütterliches Erbteil, während Iwan und Aljoscha einer gewissen Bildung in Seminarien und Lyceen teilhaftig werden.
Alle diese Karamasowschen Abkömmlinge lässt der Dichter, jeden in seiner Weise, mit den ererbten Gaben fertig werden. Bei Dmitri treten sie gewaltsam, brutal, doch mit guten Ansätzen und Reue-Anfällen vermengt, zu Tage. In dieser Mischseele ist dem Unbewussten, Rhapsodischen, Thür und Thor geöffnet, was ja auch die Anklage gegen ihn, seine ungeschickte Verteidigung und die Verurteilung des unschuldig Schuldigen wegen Vatermords zur Folge hat.
In Iwan hat sich die grobe Wollust in spintisierende Lebensgier gewandelt, dies führt ihn zu einer leidenschaftlichen Untersuchung des Lebens und seiner Freuden, sowie dazu, es ungerecht eingerichtet und als etwas Misslungenes zu verurteilen, das er „ablehnt“. Wenn ein Gott ist, sagt er zu Aljoscha, mit dem er sich in einem kleinen Wirtshaus am Vorabend seiner Abreise getroffen hat, um „echt russisch, im Traktir vom Dasein Gottes zu sprechen“; wenn ich auch einen Gott annehme — „seine Werke lehne ich ab“. Schon früher hatte er gesagt: „Weisst du, was ich dahier eben erst zu mir gesagt habe? Sollt’ ich auch nicht mehr an das Leben glauben, müsst’ ich den Glauben an ein teures Weib, an die Ordnung der Dinge aufgeben, ja, sollte ich mich im Gegenteil davon überzeugen, dass alles ein unordentliches, verfluchtes und vielleicht teuflisches Chaos ist, sollten mich auch alle Schrecken der menschlichen Enttäuschung treffen — dennoch werde ich leben wollen, und wenn ich diesen Becher angesetzt habe, so will ich nicht eher davon lassen, als bis ich ihn nicht ganz bewältigt habe. — — Ich habe mich oft gefragt: giebt es im Leben eine Verzweiflung, welche in mir diesen wütenden und vielleicht unanständigen Lebensdurst besiegen könnte, und geantwortet: dass es derlei nicht giebt; das heisst bis zu meinem dreissigsten Lebensjahr — dann aber werde ich selbst nicht mehr wollen, so scheint es mir. Diese Lebensgier nennen manche schwindsüchtige Gelbschnäbel-Moralisten, namentlich Poeten, niedrig. Wahr ist’s, es ist zum Teil ein Karamasowscher Zug, diese Lebensgier, die über alles hinweggeht; auch in dir sitzt sie unbedingt, aber warum ist sie denn niedrig?“ usw. „Die klebrigen Frühlingsknospen lieb’ ich, den blauen Himmel lieb’ ich — das ist’s. Hier ist nicht Verstand, nicht Logik, hier liebst du mit den Eingeweiden, als Wurm liebst du hier, deine ersten jungen Kräfte liebst du ... verstehst du etwas davon?“
Darauf Aljoscha: „Nur allzu gut usw.“ ... Hier ist auch des Jüngsten Karamasowschtschina eingeführt; da er sagt, er „verstehe“ — gehört er auch zur Familie. Dennoch lehnt Iwan das Leben als Werk einer Ordnung und Vernunft, als „Euklidische Geometrie“ ab. „Nicht Gott ist’s, den ich ablehne, verstehe das, sondern die von ihm erschaffene Welt, die Gotteswelt lehne ich ab, ich kann mich nicht entschliessen, sie anzunehmen.“ — Nun folgt ein leidenschaftlicher Protest gegen das Leben, den Iwan mit dem Bekenntnis einleitet, dass er nie begriffen habe, wieso man seine Nächsten lieben könne. In der Ferne, meint er, gehe es noch, aber in der Nähe sei jeder Mensch dem anderen widrig und keiner sei imstande, die Leiden des andern zu begreifen. An diese sehr charakteristische Begleiterscheinung seines Karamasowtums schliesst er sofort die Begründung seines Protestes gegen die Weltordnung an und wendet sich dabei an jenen tiefen Zug in Aljoscha, in den dieses Jünglings Karamasowtum schon gemildert einlenkt, um endlich nach des Dichters Absichten ganz geläutert auszuklingen: die Liebe zu den Kindern.
Iwan sagt ungefähr: wenn ich auch glauben will, dass „die Euklidischen Parallelen“ sich in der Ewigkeit berühren, dass alles Leid und alle Missethat der Menschen zuletzt einmal in Harmonie aufgelöst sein wird — wie kann ich eine Welt zugeben, in der auch nur ein kleines Kind seine unschuldigen Thränlein vergiessen muss? Nun erzählt er Episoden aus Kriegszeiten, aus der Zeit der harten Leibeigenschaft, wo Kinder in der grauenvollsten Weise einer Laune, einer Bestialität zum Opfer fielen [der Dichter benutzt für seine Beispiele hier wie überall Dokumente]. „Die Kinder müssen erlöst werden, sonst giebt es keine Harmonie. Womit, womit aber kaufst du sie los? Ist das denn möglich? Etwa damit, das sie gerächt werden? Aber wozu brauch’ ich die Vergeltung, wozu die Hölle für ihre Peiniger; was kann hier die Hölle gutmachen, wenn jene schon zu Tode gequält wurden? Was ist das aber für eine Harmonie, wenn eine Hölle dazu da ist? Ich will vergeben, ich will umarmen, ich will nicht, dass man weiter leide. Und wenn die Leiden der Kinder darauf gegangen sind, um jene Summe von Leiden voll zu machen, die für das Erkaufen der Wahrheit unumgänglich nötig war, so behaupte ich von vornherein, dass die ganze Wahrheit eines solchen Preises nicht wert ist. Ich will endlich nicht, dass die Mutter den Peiniger umarme, der ihr Kind durch Hunde zerfleischen liess! Sie wage es nicht, ihm zu verzeihen! Wenn sie will, so mag sie ihm für sich verzeihen, mag sie dem Peiniger ihr unermessliches mütterliches Leiden vergeben, allein die Leiden ihres zerfleischten Söhnchens ihm zu verzeihen, dazu hat sie kein Recht, sie darf sie ihm nicht vergeben, wenn auch das Kind selbst sie ihm verziehe. Wenn es aber so ist, wenn sie nicht verzeihen dürfen, wo ist dann die Harmonie? Ist auf der ganzen Welt ein Wesen, welches das Recht hätte, zu vergeben? Ich will keine Harmonie, aus Liebe zur Menschheit will ich keine. Ich will lieber bei den unvergoltenen Leiden verharren. Lieber will ich schon bei meinem ungesühnten Leiden, bei meiner ungemilderten Entrüstung bleiben, auch wenn ich nicht recht hätte. Allzu hoch hat man diese Harmonie geschätzt, es geht durchaus über unsere Mittel, da so viel für den Eintritt zu bezahlen. Darum beeile ich mich, meine Eintrittskarte zurückzustellen. Und wenn ich ein ehrlicher Mensch bin, so bin ich verpflichtet, die Karte so schnell als möglich zurückzugeben. Das thue ich auch“ usw. — —
Nun ruft Aljoscha plötzlich mit leuchtenden Augen: „‚Ist in der ganzen Welt ein Geschöpf, das verzeihen könnte‘, sagst du. Aber dieses Wesen ist und es kann ‚alles und allen vergeben‘ — du hast ihn vergessen.“ — — Wir haben hier wieder das Problem des Kellerbewohners in erhöhter, nicht mehr cynisch negativer Form; hier drängt die Frage des Ausgleichs ihrer Lösung zu und es tritt, zum erstenmale in Dostojewskys Werken, der Name Christi und im folgenden Kapitel vom Grossinquisitor die wunderwirkende Gestalt des wiedergekehrten, schweigenden Christus als Person auf.
Dieses Kapitel in dem engen Rahmen einer auf den russischen Volksgeist gerichteten Studie würdig zu besprechen, wäre ein Vermessen. Wir müssen uns auf Andeutungen und Hinweise beschränken. Den Grundgedanken hüllt Iwan, der dem sanften Bruder seinen Atheismus verkünden will, in die Form der Legende. Zur Zeit der Inquisition werden in Sevilla Scheiterhaufen zur alltäglichen Ketzerverbrennung aufgerichtet. Christus erscheint, ein müder Wandersmann, in der Menge und wird von allen sofort erkannt. Man drängt sich um ihn, wirft sich vor ihm nieder, da er Wunder wirkt. Da erscheint der neunzigjährige Grossinquisitor mit seinem Gefolge und lässt den Allverehrten festnehmen und in ein unterirdisches Gefängnis werfen. In der Stille der Nacht öffnet sich die schwere Thür des Gelasses, und der Inquisitor tritt herein. Christus sitzt an einem Tische, eine Leuchte steht vor ihm. Nun beginnt der Greis mit harter, blutleerer Lippe seine Rede.
Er setzt ihm das Unrecht auseinander, noch einmal gekommen zu sein. „Deine Zeit ist vorüber, sagt er, was hast du aus den Menschen gemacht, denen du die Freiheit schenktest, dir, auf dein Beispiel hin, zu folgen? Sie sind zu schwach für diese Freiheit. Damit hast du nur für die Auserwählten gesorgt, für die Starken, die alle Opfer, alle Demütigung auf sich zu nehmen vermögen, wenn sie dir folgen. Aber die anderen? Bist du denn nur ein Gott der Starken? Siehe, wir, die Kirche, wir lieben die Menschen mehr als du, wir lieben alle, wir nehmen ihre Leiden auf uns, wir vollenden in deinem Namen das Werk, das du nur halb gethan. Und du warst gewarnt. Jener furchtbare und tiefsinnige Geist, der dich angeblich versucht hat, er hat dir drei Mittel an die Hand gegeben, wie du die Menschen für alle Zeiten dir unterthan und wie Kinder glücklich machen konntest. — Du hast sie verschmäht. Nun haben wir sie aufgenommen, diese Mittel, und die Menschen sind beruhigt, beruhigt in deinem Namen. Wozu also bist du gekommen unser Werk zu stören?“
Nun entwickelt der Inquisitor die römische Deutung der drei Darbietungen des „furchtbaren Geistes“, welche die Menschen für alle Zeit im Banne halten: Das Wunder, das Geheimnis und die Autorität. Die gezogene Folgerung ist nun die, dass die unerbittliche und unbedingte Machtforderung der römischen Kirche auf den Atheismus gestützt ist, dass das Wunder kein Wunder, hinter dem Geheimnis — nichts ist, dass aber ihre Autorität durch diese erfundenen und aufrechterhaltenen Mysterien die Gewissen beruhige und den Menschen die Sünde gestatte, die sie ihnen, als schwachen Kindern, nicht entziehen könne, sodass sie ihrer Freiheit, ihnen unbewusst, glücklich wieder ledig würden. „Und morgen lasse ich dich verbrennen. Dixi“, schloss der Greis seine Rede. Christus schweigt noch immer, während der Inquisitor eine Antwort erwartet. Da erhebt sich der Gefangene, tritt auf den Inquisitor zu und drückt einen Kuss auf seine kalten Greiseslippen. Dieser erschauert, öffnet die Thüre und entlässt den Gefangenen in die finstere Nacht.
„Und der Alte?“ fragt Aljoscha. „Der Kuss brennt auf seiner Seele, doch er bleibt bei seiner Idee“, erwidert Iwan. „Und du mit ihm, du mit ihm!“ ruft Aljoscha kummervoll aus. Die Brüder trennen sich. Aljoscha macht sich bittere Vorwürfe, dass er den Bruder Dmitri hatte vergessen können, den er indessen nirgends findet, während Iwan zu Smerdjakow eilt, der für seine pathologische Unmenschlichkeit gern gebildete Beweggründe von Iwan entlehnt. Es bereitet sich in diesen Köpfen und Herzen der Mordgedanke vor, und die Rede und Gegenrede dieser Zwei lässt uns, ohne dass die Sache ausgesprochen würde, das Entsetzliche ahnen, dass irgendwie Dmitri, der mit dem Vater um Geldes willen und aus Eifersucht auf eine leichte Schöne, Gruschenka, im Hader lebt, werde missbraucht oder vorgeschoben werden. Die schreckliche That geschieht zu später Nachtstunde und so, dass aller Verdacht auf Dmitri fällt, der in wilder Ungeduld irgendwo eine Mörserkeule mitgenommen hatte und nach des Vaters Garten geeilt war. Hier hatte er am Fenster gestanden und in rasendem Zorn das Kommen der bestellten Schönen erlauern wollen. Da sieht er den alten Lüstling zum Fenster treten und verbirgt sich. Später will er fliehen, hört Stimmen, sieht sich verfolgt und eilt zum Gartenzaun, über den er sich schwingt. Da wird er vom alten Diener Grigorji am Fuss gepackt, der mit rauschheiserer Stimme schreit: ‚Das ist er, der Vatermörder!‘ Da fällt der Alte aber auch schon wie vom Blitz getroffen zu Boden. Dmitri springt in den Garten zurück, wirft die Keule ins Gras, betastet den Kopf des Alten, der von Blut überströmt ist, und entflieht.
Der Dichter lässt überall, wo Dmitri handelt oder handeln könnte, Dunkelheit walten; es fehlen konkrete Bindeglieder der Erzählung. Dies ist nicht nur einem Kunstgriff im gröberen Sinne zuzuschreiben, der die Spannung und Vermutung des Lesers bis zur Lösung offen halten will, sondern in gleichem Masse dem künstlerisch feineren Hilfsmittel, Dmitris Handeln so darzustellen, wie es, ihm unbewusst, aus der Dunkelheit seiner Seele hervorbricht. Kurz vorher noch hatte er zu Aljoscha gesagt: „Weisst du was? Ich weiss nicht, ich weiss nicht, vielleicht bringe ich ihn nicht um, vielleicht aber bringe ich ihn um. Ich fürchte, dass ich’s thue in derselben Minute, da er mir mit seinem Gesicht verhasst wird. Ich hasse seinen Adamsapfel, seine Nase, seine Augen, sein schamloses Lächeln ... einen physischen Ekel fühle ich. Das ist’s, was ich fürchte, da werde ich mich nicht zurückhalten können.“ — — „Gott hat mich davor bewahrt“, sagt er später. Aljoscha aber weiss von allen diesen Dingen nichts. Er hat den Bruder gesucht, ihn nicht finden können und kehrt nun in das Kloster, wo er als dienender Laienbruder um den Starez Sosima beschäftigt ist, voll Sorge zurück. Er findet dort den Ehrwürdigen, den er schon sterbend wähnte, aufrecht sitzend in seiner Zelle, im Kreise der Mönche und Jünger, die seinen ermahnenden Worten lauschen. Sosima begrüsst den Jüngling liebevoll und fragt ihn nach „dem Bruder“. Er denkt dabei nur an Dmitri, der am Vortage zugleich mit Iwan, dem Vater und anderen das Kloster besucht hatte. Sie waren da vor dem Greise in einen hässlichen Streit geraten, und dieser war aufgestanden, um die Zelle zu verlassen, hatte sich plötzlich vor Dmitri niedergeworfen und den Boden mit der Stirn berührt, „um des Furchtbaren willen, das er in Dmitris Antlitz herankommen gesehen“. Um ihn vor diesem Furchtbaren zu bewahren, hatte er Aljoschas sanftes Antlitz nach ihm ausgesendet.
Nun wendet sich der Greis ganz besonders an Aljoscha und uns wird das „Geheimnis“ offenbar, das der Dichter in das Motto [Ev. Johannis XII, 24] des ganzen Werkes gelegt hat und das in jenem anderen, durch viele seiner Werke gehenden und selten verstandenen Citate seine Gegenseite findet: „Wir alle sind für alle und an allem schuldig.“
Der Starez Sosima sagt: „Ich habe Dich zu ihm gesandt, Alexei, weil ich dachte, dass Dein Bruderantlitz ihm helfen werde. Aber es kommt alles von Gott, alle unsere Geschicke. ‚Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch: Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte.‘
Erinnere Dich daran. Dich aber, Alexei, habe ich viele Male im Geiste gesegnet um Deines Antlitzes willen, wisse es,“ sagte still lächelnd der Greis. „So denke ich von Dir: Du wirst aus diesen Mauern scheiden und wirst in der Welt verweilen — als Mönch. Du wirst viele Gegner haben, aber Deine Feinde selbst werden Dich lieben. Viele Widerwärtigkeiten wird Dir das Leben bringen, allein durch sie wirst Du auch beglückt sein und das Leben segnen und auch andere es zu segnen zwingen — was das Wichtigste von allem ist.“
Dies ist für uns der springende Punkt der Hauptidee vom „Dasein Gottes“, welche ohne Dialektik endlich Iwans geniale Beweisführungen besiegen wird. Aljoschas liebevoll brüderliches Wesen, dessen Abglanz auf seinem Antlitz schon seine Sendung verkündet, es wird die Feinde ihn zu lieben zwingen. Unsere immerwährende Schuld ist also die, dass wir nicht wie das Weizenkorn für uns ersterben, um in anderen Früchte zu bringen, sondern, dass wir zu wenig lieben und dadurch auch die anderen zur Unliebe veranlassen. Das wird bis zur Unumstösslichkeit deutlich da, wo Sosima den Umstehenden seine Jugendgeschichte erzählt, allerdings, seinem Wesen entsprechend, mit einer Beimischung orthodoxer Kirchlichkeit.
Als er ein Kind von neun Jahren gewesen, erzählt er, da sei sein einziger um zehn Jahre älterer Bruder an galoppierender Lungenschwindsucht gestorben. Dieser sei früher ganz ungläubig gewesen, sei aber kurz vor seinem Tode, da er die Vöglein so fröhlich im Baumschatten singen gehört, plötzlich sehr heiter und liebevoll geworden und habe aus Freude darüber geweint, dass er es nun verstehe, wie alles gemeint sei. Auch war es ihm schwer, sich bedienen zu lassen, und er habe den Dienern immer besonders gesagt: „Warum kann ich nicht auch Euch bedienen.“ „Mütterchen, meine Freude,“ sagte er, „es kann nicht wohl sein, dass es keine Herren und Diener gäbe, aber lass mich doch auch der Diener meiner Diener sein. Ja, und noch das sag’ ich Dir, Mütterchen, dass ein Jeder von uns für alle in allem schuldig ist, ich aber mehr als alle.“ Man lächelte und hielt diese Reden für Fieberphantasieen.
Jahre waren nach dem Tode des Jünglings und der Mutter vergangen; der nun herangewachsene Junge war in einer Kadettenanstalt erzogen worden und ist nun als Offizier in einer Provinzstadt stationiert. In einem angesehenen Hause bewundert er die Tochter und bildet sich ein, von ihr geliebt zu sein, entscheidet sich aber nicht zu einem Heiratsantrag, weil er seine schönen Junggesellenjahre noch austoben will. Als er von einer mehrmonatlichen Abwesenheit zurückkehrt, findet er sie als die Frau eines Mannes, den er auch früher oft im Hause getroffen. Er hält sich für angeführt und verlacht, da er sich nicht zugestehen will, dass er das Opfer der eigenen Eitelkeit ist. Eines Tages führt er absichtlich eine Herausforderung des jungen Gatten herbei. Das Duell soll am folgenden Tage stattfinden.
Als der Junker in überaus reizbarer Stimmung spät abends nach Hause kommt, bringt irgend ein kleines Vergehen seines Privatdieners ihn in heftigsten Zorn; er versetzt jenem zwei so heftige Backenstreiche, dass das Gesicht blutet. Der Bursche steht mit aufgerissenen Augen, die Daumen an der Hosennaht, lautlos, wie beim Rapport, vor ihm. Auch nicht einen Versuch der Gegenwehr hat er gemacht, dass er etwa einen Arm erhöbe und vor das Gesicht hielte. — Der Junker legt sich zu Bette, schläft einige Stunden sehr unruhig und erwacht noch sehr früh am Morgen mit einem dumpfen Unglücksgefühl in der Brust. Was ist es doch? Das Duell? Nein, er hat sich schon früher geschlagen, das ist es nicht. Eifersucht? Auch die nicht, da er jetzt ganz klar darüber ist, dass er das Mädchen eigentlich nie geliebt hat. Nun hat er’s: der Diener, der sich nicht wehrte unter den blutigen Schlägen. Der Offizier bedeckt sein in Scham erglühendes Gesicht mit beiden Händen und wirft sich schluchzend auf sein Lager ....
Zur festgesetzten Stunde erscheint der Sekundant. „Komm, es ist Zeit.“ Sie gehen vor die Thür, zum Wagen hinaus. „Warte, ich vergass meine Börse“, sagt der junge Duellant und eilt zurück, geradaus in das Kämmerchen des Dieners. „Athanas, ich habe Dir gestern zwei Backenstreiche gegeben, verzeihe Du mir.“ Der Diener schauert wie geschreckt zusammen. Da wirft sich der Herr nieder, mit der Stirn schlägt er den Boden. „Verzeihe mir!“ wiederholt er. „Euer Edelgeboren“, sagt der Bursche, „Väterchen, Herr — — ja wie ist das — — ja bin ich das wert?“ und bricht in Thränen aus. — Man fährt zum Zweikampf. Des Leutnants Stimmung ist ganz umgewandelt; freudestrahlend, glücklich legt er den Weg zurück, sodass der Sekundant sich des wackeren Haudegens freut. Man kommt an und misst die Distanz, der Beleidigte giebt den ersten Schuss ab und streift das Ohr des jungen Mannes ein wenig. „Gott sei gepriesen“, schreit dieser, „es ist kein Mensch getötet worden!“ Dann drückt auch er seine Pistole ab — in die Baumkronen des Wäldchens. Er wendet sich zu seinem Gegner. „Geehrter Herr“, sagt er, „verzeihen Sie mir dummem jungen Menschen, dass ich Sie beleidigt und jetzt auch noch dazu genötigt habe, auf mich zu schiessen.“ Jener wird zornig und fragt: „Ja, haben Sie denn nicht vorgehabt, sich mit mir zu schlagen? Wozu mich dann beunruhigen?“ „Gestern“, erwiderte der Fröhliche, „war ich noch dumm, heute bin ich klüger geworden.“ Man schreit, man will ihn nötigen. „Nein“, sagt er, „ich schiesse nicht. Sie aber — thun Sie es, wenn Sie wollen, ob es auch besser wäre, Sie thäten es nicht.“ Die Sekundanten rufen ihm zu, dass er das Regiment entehre, worauf er erwidert: „Meine Herren, ist es denn wirklich so wunderbar, in unserer Zeit jemand zu begegnen, welcher selbst seine Dummheit bereut und sich öffentlich schuldig bekennt?“ Die Folgen dieses Bekenntnisses sind weittragende. Der junge Bekenner erhält den Abschied, er verlässt den Dienst und die Stadt, und so wird dieses Erlebnis — von innen heraus — der erste Anlass seines späteren Eintritts in ein Mönchskloster.
An einer Stelle seiner biographischen Aufzeichnungen über Dostojewsky sagt N. Strachow, man könne auf den Dichter die Worte anwenden, welche er Puschkin nachgerufen habe: „Er hat ein grosses Geheimnis mit ins Grab genommen und uns überlassen, es auszudeuten.“ Wir finden das nicht. Wir finden vielmehr, dass er uns dieses Geheimnis in seinem grössten, monumentalen Werk gekündet hat. Den „Gott, den er beweisen“ wollte, hat er zuerst mit den blendendsten Künsten der Dialektik vernichtet, um ihn durch das einfache Gebot der Liebe in allen und in jedem wieder aufzurichten. Er spricht durch den Mund Sosimas aus, dass es möglich ist, den Bruder nicht zum Bösen zu zwingen, dass jeder diese Möglichkeit unbewusst in sich trage und diese Blindheit es ist, die alle für sich und alle andern an allem schuldig werden lasse. Dies ist der Kernpunkt dessen, was Dostojewsky mit diesem Atridenbuch, das in die Zukunft, in die russische Zukunft weist, hat sagen wollen. Wenn ich liebe, sagt er, so bin ich glücklich; ich zwinge die anderen zum Glück, da ich nicht für mich leben, sondern gleich dem Weizenkorn ersterben will, um Früchte zu tragen. Das Vollgefühl aber dieser Liebe [vom Glauben ist gar nicht mehr die Rede, da er Accessorium ist] ist — Gott. Wer dieses in sich trägt — und nach des Dichters Meinung trägt es jeder als Keim in sich, weiss es nur nicht und erwartet es nur immer wieder vom Nächsten, was ja das „Geheimnis“ ist — der erlöst schon, wie Aljoscha, durch das Strahlen seines Antlitzes den darbenden Bruder. Wer aber davon nichts weiss, und das sind wir alle, der wird täglich „für alle und an allem schuldig“.
Den Schluss des Romans bildet der eingehend lange Prozess gegen Dmitri und seine Verurteilung, da er zu unbewusst ist, um sich aus der Schlinge zu ziehen, und jene, die ihn retten könnten, im letzten Augenblicke es nicht mehr vermögen. Smerdjakow, der wirkliche Mörder, erhängt sich, und Iwan wird im Gerichtssaal wahnsinnig.
Der Epilog zeigt uns Aljoscha beim Leichenbegängnis eines Schulknaben, den er sehr geliebt, umgeben von einer Schar frischer Buben, die aber noch nicht die rechten sind. Er spricht die Grabrede und fordert von den kleinen Jungen, die ihn umgeben, das Versprechen, in der Erinnerung an den ehrenhaften Knaben, dem sie eben Lebewohl sagen, die Ehre hoch zu halten in allen Versuchungen des Lebens.
September 1880 vollendet Dostojewsky die „Karamasow“. Nun wendet er sich mit voller Kraft der Publicistik zu, da er vieles zu sagen hat und seine gewonnene Autorität ihm gestattet, es fest und sicher auszusprechen. Sehr entschieden drückt er sich auch in einem Briefe an Iwan Aksakow aus, der ihm nach der Puschkin-Feier und einigen gewechselten Briefen näher getreten war. Er kritisiert da einen Artikel Aksakows in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Rusj“. „Bei Ihnen (No. 1 der „Rusj“) heisst es: ‚Peter der Grosse habe uns nach Europa hineingezogen und uns europäische Civilisation gegeben‘. Ja, Sie loben ihn fast gerade um dieser europäischen Civilisation willen: diese aber, ihr Scheinbild ist es ja eben, das zwischen der Macht und dem Volke sitzt in Gestalt eines verhängnisvollen Gürtels ‚bester Leute‘ in vierzehn Rangklassen.“
Für den Monat Januar 1881 bereitet nun der Dichter fieberhaft eine grosse Nummer des Tagebuchs für das Jahr 1881 vor, welche eine Reihe von Artikeln über das Verhältnis der „Intelligenz“ zum Volke einleiten sollte. Die Nummer war schon im Druck, Dostojewsky fürchtete jedoch sehr viel von der Zensur, welcher er sich aus Mangel einer Kaution als einer predwaritelnaia Zensura (vorprüfende Zensur) auf Gnade und Ungnade ergeben musste. N. Strachow meint, die Beunruhigung des Dichters habe sich auf die Stelle bezogen, wo es heisst: „Es giebt dafür ein magisches Wort: ‚Vertrauen zeigen‘. Ja, unserem Volke kann man Vertrauen entgegenbringen, denn es ist dessen würdig. Ruft nur die grauen Kittel herbei und fragt sie selbst um ihre Bedürfnisse, um das, was ihnen not thut, und sie werden Euch die Wahrheit sagen, wir aber werden vielleicht zum erstenmale die wirkliche Wahrheit hören.“
Obwohl von kompetenter Seite über das Schicksal der Publikation beruhigt, wich Dostojewskys Aufregung nicht. Am 25. Januar besuchte ihn Orest Miller, um ihn an sein Versprechen eines kleinen Puschkin-Vortrags zu mahnen. Sie konnten sich um das Programm nicht einigen, und Miller verliess den Dichter, zwar ganz begütigt, dennoch in reizbarem Zustande. Seit mehreren Jahren war infolge eines chronischen Bronchialkatarrhs ein Lungenemphysem zu seinen anderen schweren Leiden getreten, und dieses eigentlich secundäre Übel wurde nun die Ursache seines Todes. Eine Lungen-Arterie borst an jenem verhängnisvollen Tage, was sich jedoch anfangs nur durch Nasenbluten ankündigte. Am 26. fühlte er sich ganz wohl; doch trat plötzlich eine Halsblutung ein. Der Hausarzt wurde gerufen und ward Zeuge einer zweiten, stärkeren Blutung, die zur Bewusstlosigkeit führte. Als der Dichter erwachte, verlangte er sofort nach der Beichte und dem Abendmahl. Am 27. fühlte er sich wohler und beschäftigte sich mit der Korrektur der Druckbogen, da er sehr in Sorge war, dass das Blatt am 31. erscheinen sollte. Am 28. ging es bis Mittag ziemlich gut. Doch von da an kam wieder Blut, das nun nicht mehr abliess, langsam aus dem Munde zu fliessen, wie uns eine Freundin des Dichters, Frau Sophie v. H., die ihn besuchte, erzählte. Die Gattin stillte, an seinem Bette sitzend, mit Tüchern das unaufhörlich langsam dem Munde entrieselnde Blut.
Am Nachmittag bat der Dichter Anna Grigorjewna, sein altes Evangelium aufzuschlagen, das seit Sibirien immer bei seinem Kissen lag, und ihm die Stelle vorzulesen, die sie von ungefähr zu Anfang der Seite finden würde. Es war aber das Evangelium Matthäi III, 15: „Aber Johannes wehrete ihm und sprach: Ich bedarf wohl, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt also sein; also gebühret es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.“ [Der russische Text weist den 11. Vers auf, sowie die Worte: aber Johannes hielt ihn zurück usw., und Jesus antwortete ihm: halte mich nicht zurück usw.] Als die Gattin diesen Vers gelesen hatte, sagte Dostojewsky: „Du hörst es — halte mich nicht zurück — das heisst, dass ich sterben werde“, und damit schloss er das Buch ... Am Abend um 8 Uhr 38 Minuten desselben Tages (28. Januar 1881) schloss der Dichter für immer seine Augen.
Das Leichenbegräbnis wurde, niemand konnte es erklären wieso, zu einem Ereignis für Russland. Schon bei der Aufbahrung in der engen Stube, die auch sein Arbeitszimmer gewesen war, drängte sich die Menge derart und erfüllte den Raum so vollständig, dass die Kerzen, die den Katafalk umgaben, aus Mangel an Sauerstoff erloschen. 63 Abordnungen mit Kränzen und 15 Gesangvereine gaben offiziell dem Zuge das Geleite, und ganz Petersburg wälzte sich ihm zur Kirche vom „heiligen Geiste“ lautlos nach, ein in Russland noch nie gesehenes Schauspiel. Am selben Tage, dem 31. Januar, erblickte nach des Dichters heissem Wunsche die erste und letzte Nummer des „Tagebuchs eines Schriftstellers für das Jahr 1881“ zensurfrei das Licht.


Von dem grösseren Anhang, welcher das vorliegende Buch durch politische, prozessualische und kritische Aufsätze aus dem „Tagebuch“ ergänzen sollten, haben wir in letzter Stunde aus triftigen Gründen Abstand genommen. Es folgt hier nur ein Index von den Werken des Dichters nach ihrer Entstehung und Veröffentlichung. Hierbei wird der Leser selbstverständlich auch alle jene Werke der ersten Periode von Dostojewskys Schaffen eingereiht finden, die eingehend zu besprechen wir von unserem Standpunkt aus nicht für dringend notwendig fanden.
Ferner können wir es uns nicht versagen, einige der bedeutendsten Kritiker anzuführen, in deren Arbeiten wir Einblick genommen haben.
Arme Leute 1844. 1846 in der „Petersburger Sammlung“ von Nekrássow.
Der Doppelgänger 1846. 1846 in den „Vaterländischen Annalen“. Bd. 44 umgearbeitet 1865 in der Gesamtausgabe von Stellowsky.
Herr Prohartschin 1846. 1846 in den „Vaterländischen Annalen“.
Roman in 9 Briefen 1847. 1847 im „Zeitgenossen“ (Sowremennik).
Die Wirtin 1847. 1847 in den „Vaterländischen Annalen“.
Polsunkow 1848. 1848 im „Illustrierten Almanach“ von Panajew und Nekrássow.
Ein schwaches Herz. 1848 in den „Vaterländischen Annalen“.
Der Ehemann unterm Bett. 1848. In den „Vaterländischen Annalen“ Bd. 56 erschien die Erzählung „Die Gattin des anderen“; ebendaselbst im selben Jahre Bd. 61 „Der eifersüchtige Gatte“. Beide Erzählungen wurden für die Gesamtausgabe von Stellowsky 1865 unter dem Titel „Die Gattin des anderen und der Gatte unterm Bett“ verschmolzen.
Der ehrliche Dieb. 1848 in den „Vaterländischen Annalen“ Bd. 57.
Christbaum und Hochzeit. 1848 in den „Vaterländischen Annalen“ Bd. 60.
Helle Nächte 1848. 1848 in den „Vaterländischen Annalen“ Bd. 61.
Netotschka Neswanowa (unvollendet) 1848. 1849 in den „Vaterländischen Annalen“ Bd. 62, 64.
Der kleine Held 1849 (in der Peter-Pauls-Festung). 1857 in den „Vaterländischen Annalen“.
(Sibirien).
Hymnus auf den Orientkrieg, Mai 1854. 1883 im „Graschdanin“ No. 1.
Onkelchens Traum. 1859 im „Russ. Wort“ (Russkoe Slowo) Bd. 2.
Dorf Stepantschikow und seine Bewohner 1858 (deutsch übersetzt als Tollhaus und Herrenhaus). 1859 in den „Vaterländischen Annalen“ Bd. 127.
Memoiren aus einem Totenhaus 1859-60. 1861 und 62 in der „Zeit“ (Wremja).
Erniedrigte und Beleidigte 1861. 1861 in der „Zeit“ (Wremja).
Eine garstige Geschichte. 1862 in der „Zeit“ (Wremja) IX.
Winterliche Betrachtungen über Sommereindrücke. 1863 in der „Zeit“ (Wremja) II., III.
Memoiren aus einem Keller 1864. 1864 in der „Epocha“ I., II., IV.
Der Spieler 1863 entworfen, 66 niedergeschrieben. 1867 in der Gesamtausgabe von Stellowsky.
Das Krokodil. 1865 in der „Epocha“.
Schuld und Sühne 1866. 1866 im „Russ. Boten“ (Russkij Wjestnik).
Der Idiot 1868. 1868 im „Russ. Boten“ (Russkij Wjestnik).
Der Hahnrei 1869. 1870 in der „Morgenröte“ (Zarjá) I., II.
Die Besessenen 1870. 1871-72 im „Russ. Boten“ (Russkij Wjestnik).
Tagebuch eines Schriftstellers. 1873 als Sammlung in einen Band vereinigter — 1861 in der „Wremja“ und 1873 im „Graschdanin“ erschienener — Aufsätze.
Junger Nachwuchs 1875. 1875 in den „Vaterländischen Annalen“.
Tagebuch eines Schriftstellers 1876. 1876 als Monatsschrift.
Krótkaia 1876. 1876 im „Tagebuch eines Schriftstellers“.
Weihnacht. 1876 im „Tagebuch eines Schriftstellers“.
Tagebuch eines Schriftstellers 1877. 1877 als Monatsschrift.
Die Brüder Karamasow 1870 begonnen. 1879-80 im „Russ. Boten“ (Russkij Wjestnik).
Anhang zum Tagebuch eines Schriftstellers von 1877. In der Auflage von 1891.
1. Heft: August 1880 (Puschkin-Rede).
2. Heft: Januar 1881 (Politika).
Eine grosse Anzahl von russischen Kritikern hat, sowohl noch zu Lebzeiten des Dichters als auch nach seinem Tode, einzelne seiner Werke in längeren oder kürzeren Abhandlungen besprochen. Die bedeutendsten darunter sind unbestreitbar: der Vertreter der naturwissenschaftlichen Anschauungen, Psychiater Dr. Tschisch in seiner Studie „Dostojewsky als Psychopathologe“, Moskau 1885, und W. Rósanow, der Vertreter orthodox-mystischer Anschauungen in seiner „Legende vom Gross-Inquisitor, Versuch eines kritischen Kommentars“, Petersburg 1894. Die bedeutendsten der übrigen in Zeitschriften und Revueen erschienenen Artikel sind von Zelinsky im Jahre 1885 in einen Band zusammengestellt worden, dem er ein Supplement nachfolgen liess; dazu gehören Aufsätze von: Nekrássow, Belinsky, Dobroljubow, Grigorjew, Miljukow, Strachow, Achscharumow, Annenkow, M. und W. Solowiow, Kawélin, Obolensky, Michailowsky, O. Miller, G. Uspensky, K. Slutschewsky (mit biographischem Abriss), Bulitsch, Arseniew, Tarassow, D. W. Grigorowitsch und anderen. Von gesonderten Werken über einzelne Schöpfungen Dostojewskys ist namentlich Andrejewskys Studie über die Karamasow hervorzuheben.

Adolescent, 413.
Aksakow, 12. 25. 221. 229. 236. 334. 422. 424. 439.
Alexander I., 236.
Alexander II., 122.
Anklage, 72.
Anschauungen, Russische und polnische, 188.
Arbeitsmethode, 158. 223. 324.
„Arme Leute“, 30. 36. 37. 42. 43. 44. 52. 53. 55. 216.
„Aus dem dunkelsten Winkel einer Grossstadt“, 335.
Awerkiew, 342.
Beketow, Brüder, 51.
Belinsky, 12. 37. 38. 39. 40. 42. 45. 49. 50. 54. 55. 57. 60. 278. 334. 396. 400. 401. 402. 403.
Berlin, 303.
„Besessene“, 183. 251. 281. 286. 298. 352. 373. 385. 386. 397. 406. 413. 419. 427. 428.
Boborykin, 241.
Brand von Paris, 400.
Brief an Kowner, 293.
Brief an Studenten, 110.
Briefe aus der Fremde, 300.
Briefe aus Sibirien, 132.
Butaschewitsch-Petraschewsky, 61.
Charakterzüge, Nationale, 15.
Chomjakow, 12.
Christina Danilowna, 410. 413.
Christlicher Gedanke, 361.
Christlicher Geist, 277.
Christlicher Sozialist, 61.
Christus, Russischer, 425.
Christus, Wahrer, 191.
Comité, Slavisches, 277.
„Denj“, 222.
Deutschland, 390.
Dichter, französische, 27.
„Djelo“, 327.
Dobroljubow, 151. 211. 342. 395.
Dokumente, 105.
„Doppelgänger“, 44. 47. 48. 352.
Dostojewskaia, Anna Grigorjewna, 15. 28. 61. 66. 244. 271. 273. 274. 275. 278. 297. 299. 302. 303. 304. 308. 367. 382. 388. 394. 405. 406. 407. 441.
Dostojewsky und Kaiser Nikolaus, 14.
Dostojewsky, Andreas, 69.
Dostojewsky, Michael, 138. 147. 215. 238. 241. 246. 247.
Dostojewskys synthetische Natur, 208.
Dudischkin, 57.
Epilepsie, 53. 225. 266. 310. 365. 392.
„Epocha“, 215. 219. 242. 245. 247. 271. 299. 327.
Ernennung zum Offizier, 30.
„Erniedrigte und Beleidigte“, 141. 215. 216. 224. 228. 406.
Etappenweg, 119.
Europa, 388.
Fatalismus, Historischer, 328.
Fet, 209.
Feuilletonist, 223.
Fourierismus, 58.
Franzosen, 231.
Frauenfrage, 370.
Frauen, Russische, 7.
Frauenstudium, 418.
Friedenskongress, 310.
Gawrilow, 272.
Geburt und Tod eines Kindes, 280. 311.
Geburt eines Sohnes, 300.
Geburt einer Tochter, 298. 345.
Gedicht zur Krönung Alexanders des Zweiten, 150.
Gefängnis, 101.
Generals-Nihilismus, 182. 184.
„Genie und Wahnsinn“, 227.
Gerichtskommission, 103.
„Goldenes Zeitalter in der Tasche“, 428.
Gradowsky, 334.
„Grashdanin“, 149. 229. 232. 252. 408.
Gribojedow, 233.
Grigorjew, 215. 218. 219. 220. 221. 229. 245. 246. 334. 403.
Grigorowitsch, 36. 37. 38. 44.
Grimm, Jacob, 188.
Grossfürstin Marja Nikolajewna, 151.
Grossinquisitor, 73.
Gutsbesitzer-Litteratur, 404.
„Gutsbesitzerwort“, 206.
Haftbefehl, 64.
„Hahnrei“, 298. 351. 352. 353. 373. 374. 398. 417.
Hallucinationen, 20.
„Helle Nächte“, 47.
Herzen, 12. 50. 186. 232. 233. 369. 370. 396.
Homburg, 279.
Idiot, 43. 105. 172. 224. 225. 251. 280. 281. 286. 293. 313. 320. 329. 330. 398. 406. 413. 420. 427.
Ignatiew, 163.
Ingenieurkorps, 31.
Issajew, Marja Dmitrjewna, 138. 141. 142. 147. 244. 246.
Italien, 280.
Janowsky, 51.
Jastrzembski, 118.
Juden, 296.
„Karamasow“, 43. 227. 322. 377. 407. 413. 419. 420. 423. 425. 438.
Karamsin, 393.
Katastrophe, 59.
Katkow, 157. 159. 264. 265. 267. 270. 273. 280. 308. 309. 313. 318. 330. 345. 380. 423.
Kawélin, 420.
Kinder des Dichters, 276.
Kindertypen Dostojewskys, 419.
Kirche, Orthodoxe, 11.
„Kleiner Held“, 102. 152. 216. 419. 427.
Kommune, 400.
Konservativ-demokratisch, 2.
Krajewsky, 169.
Kriegsgerichtliches Urteil, 103.
Krestowsky, 174.
Latkin, 302.
„Leben eines grossen Sünders“, 374.
Lebensmut, 102.
Leroy-Beaulieu, 108.
„Lesebibliothek“, 241.
Letztes Jahr der Haft, 130.
Liberalismus, 327.
Liberalkonservative, 181.
„Litterarische Artikel“, 205.
Litterarische Kritik, 341.
Litteratur, Russische, 201.
Lomonossow, 205.
Maikow, 57. 244. 278. 301. 311. 313. 315. 330. 332. 344. 365. 371. 376. 387. 391. 394.
Mailand, 315.
„Mascha“ von Wowtschok, 211.
„Materialien“, 121. 131. 175. 230.
„Memoiren aus einem Kellerloch“, 56. 353.
„Memoiren aus einem Totenhause“, 118. 119. 121. 122. 127. 141. 158. 184. 189. 377. 406.
Meschtschersky, 408.
Michailowsky, 286.
Milieu, Russisches, 3. 4. 287.
Miller, Orest, 15. 31. 52. 60. 71. 102. 103. 121. 122. 123. 131. 141. 150. 157. 171. 174. 182. 183. 184. 188. 201. 440.
„Misérables“, 409.
Mission, 229.
„Moskowskija Wjedomosti“, 235. 385. 423.
Museum Dostojewsky, 419.
Nabokow, 71.
Nietzsche, 2.
Nihilisten, 373.
Njekrássow, 35. 36. 37. 38. 39. 40. 44. 45. 51. 229. 245.
„Njetoschka Njezwánowa“, 47. 53. 420.
Odojewsky, 45.
Offener Brief an den Kaiser, 163.
Offiziersernennung, 152.
Ogarew, 280.
Olkin, 274.
Palacky, 298.
Panajew, 45.
Perowsky, 103.
Petersburg, 10. 20. 171. 172. 173. 300. 405.
Petraschewsky, 59.
Petrow, 277.
Petschatkin, 302.
Pissarew, 395.
Pissemsky, 245.
Pleschtschejew, 66.
Politische Thätigkeit, 174.
Polonsky, 384.
„Porfiry Petrowitsch“, 262.
Positivismus, 400.
„Prochartschin“, 51. 54. 58. 352.
Proklamation an die junge Generation, 186.
Propaganda-Gesellschaft, 61.
Psychisch-physische Krankheit, 130.
Puschkin, 25. 205. 206. 207. 395. 399. 402. 403. 423. 424. 438.
Puschkinrede, 12. 206. 214. 423.
„Raskolnikow“, 158. 227. 251. 413.
„Rasumichin“, 262.
Rechtfertigungsschrift, 73.
Rede auf einem Ball, 15.
Reuter, Fritz, 120.
Reval, 33.
Revolutionäre Proklamation, 181.
Rieger, 298.
Riesenkampf, Dr., 20. 32. 33. 34.
Rjeschotnikow, 404.
„Roman in neun Briefen“, 45. 47. 49.
Rostowzew, 71.
Rousseau, 400.
Rückerstattung des erblichen Adels, 163.
„Rus“, 439.
Russe als Allmensch, 262.
„Russkaja Starina“, 173.
„Russkij Wjestnik“, 157. 252. 264. 265. 266. 268. 280. 298. 309. 313. 331. 345. 373. 374. 380. 383. 384. 391. 394. 407.
„Russkoje Slowo“, 159.
Russland ein Rätsel für Europa, 202.
Samarin, 182.
Sassúlitsch, Vera, 421.
Schaffot, 104.
Schiller, 30.
Schriftwesen, Russisches, 324.
Schtscherbatow, 12.
Schuld- und Ausgleichsbedürfnis, Russisches, 36.
„Schuld und Sühne“, 43. 252. 254. 268. 270. 272. 273. 281. 406. 409. 413. 428.
Schweiz, 279.
Sementkowsky, 136.
Sendung, Russische, 333.
Slavennatur, 353.
Slavophile, 319.
Snitkina, Anna Grigorjewna, 252.
Sologub, 45.
Sonja, 313.
Sozialismus und Kommunismus, 400.
Sozialist, 189.
Spiel, 239. 264. 279. 280. 309.
„Spieler“, 240. 242. 271. 273. 398.
Spital, 129.
Stellowsky, 271. 272. 273. 274. 275.
Stiefsohn, 144.
Strachow, 15. 42. 43. 52. 60. 168. 175. 178. 184. 191. 205. 214. 222. 223. 224. 225. 229. 230. 232. 233. 234. 236. 238. 239. 240. 242. 244. 246. 251. 252. 270. 271. 276. 277. 280. 318. 325. 332. 341. 343. 365. 369. 376. 378. 387. 388. 392. 397. 398. 399. 406. 423. 438. 440.
Struwe, 379.
Swaljansky, 163.
„Swidrigailow“, 262.
„Tagebuch eines Schriftstellers“, 16. 43. 48. 49. 60. 107. 118. 119. 127. 185. 229. 252. 400. 408. 417. 440.
Tagebuchnotizen, 400.
Tagebücher, 428.
„Theoretismus und Phantasterei“, 145.
„Thor, Der reine“, 282.
Tjutschew, 409.
Tod des Dichters, 441.
„Totenhaus“, 43. 241. 259. 261.
Tolstoj, 118. 205. 206. 267. 324. 325. 327. 328. 370. 371. 380. 397. 404. 409.
Totleben, 152.
Transport nach Sibirien, 118.
„Traum eines lächerlichen Menschen“, 413. 428.
Turgenjew, 45. 204. 206. 212. 267. 324. 330. 382. 403. 423. 424.
Turgenjews: „König Lear“, 387.
Tschernyschewsky, 185. 187. 188. 245.
Twer, 162.
Umkehr, 108.
Unbewusstes im Handelnden, 359.
Universitätsschliessung, 178.
„Vaterländische Annalen“, 50. 327. 407.
„Verhängnisvolle Frage“, 233. 235.
Volk und Gesellschaft, 4.
Volk, Russisches, 109.
Volksbildung, 204.
„Westler“, 373.
„Winterliche Betrachtungen über sommerliche Eindrücke“, 231. 400. 428.
Wrangel, 138. 147. 152. 162. 244. 247. 252. 264. 265. 268.
„Wremja“, 145. 151. 174. 189. 191. 192. 201. 214. 215. 218. 219. 228. 233. 236. 237. 245. 247. 327.
„Zapiski iz Podpolja“, 335.
„Zarja“, 327. 334. 346. 348. 365. 369. 370. 371. 373. 374. 376. 378. 379. 381. 392. 393. 405.
Zivilisation, Russische, 11.
„Zuboskala“, 45.

Druck der Nauck’schen Buchdruckerei, Berlin SO.
[1] Wir verweisen auf Mackenzie Wallaces vortreffliches Werk „Russia“, sowie auf Leroy-Beaulieus „L’Empire des Tsars et les Russes“.
[2] s. Masaryks vortreffliche Studie „Iwan Wassiljewitsch Kirejewsky“ in seinen „slovanske studie“. Prag, Bursik u. Kohout.
[3] Anlässlich einer Besprechung der Übersetzer-Sünden und Kühnheiten hat Dr. Friedrich Löhr in einem Heft der „Deutschen Worte“ auch dieses französischen Kraftstückes Erwähnung gethan und sich bei der Erhärtung dessen, dass „Die Wirtin“ und die „Memoiren aus einem Souterrain“ ganz getrennte Arbeiten Dostojewskys sind, auf eine Mitteilung von mir berufen. Leider hatte ich damals in der russischen Ausgabe die verdruckte Jahreszahl 1846 anstatt 1864 gefunden und gab sie, da in des Dichters Briefen nie bestimmte Angaben über Namen und Zeitpunkt seiner Publikationen zu finden sind, als authentisch an. Indessen wurde ich bei genauerer Verfolgung der chronologischen Lebens- und Arbeitsdaten bald den Irrtum inne, den ich hiermit berichtige; was jedoch auf den Umstand keinerlei Einfluss hat, dass die zwei Erzählungen sowohl durch eine lange Zeit, als durch ihre Veranlassung und ihren Inhalt vollständig getrennt sind und keinerlei Berechtigung vorhanden ist, sie in eins zu verschmelzen.
[4] Hier wird dem Leser der Widerspruch auffallen, welcher zwischen diesem Briefe und jenem oben citierten Andreas Dostojewskys besteht, worin es heisst, dass die Brüder im weissen Saale einander zwar begegnet waren, jedoch kein Wort, ausser der Begrüssung, mit einander gewechselt hatten. Auch Orest Miller ist dieser Widerspruch während der Bearbeitung seiner Aufzeichnungen aufgefallen, so dass er sich veranlasst sah, Andreas Dostojewsky aufzusuchen und ihn über das Detail jenes Vorgangs zu befragen. In einer Fussnote seiner „Materialien zu einer Biographie Dostojewskys“ klärt er uns denselben auf. Die Brüder hatten allerdings im weissen Saale kein Wort mit einander gewechselt, allein Theodor Michailowitsch hatte es versucht, auf einem Zettel alle diese Vorstellungen dem Bruder zukommen zu lassen, welchen Zettel dieser aber niemals erhielt.
[5] Sie wurden jedoch weiter nach Omsk gebracht, wo sie auch ihre ganze Strafzeit abbüssten.
[6] Vergl. Leroy-Beaulieu: L’empire des tsars et les Russes Bd. III.
[7] Anspielung an den Fleischer Minin aus Nischnij-Novgorod, mit dessen Hülfe der Fürst Pozarsky die Angriffe der Polen siegreich zurückschlagen konnte.
[8] Wer auch nur kurze Zeit in Russland gelebt hat, den wird es geradezu frappieren, dass die Wurzel vieler Übel thatsächlich darin liegt, dass ein ungeheuerer bureaukratischer Apparat das Staatsleben bedient und auch das Einzelleben in sein Räderwerk reisst; dass oft gute, meist kluge Absichten für das Gemeinwohl diesen Apparat in Gang setzen und durch den Unverstand, durch den blinden Buchstabengehorsam einerseits, oder durch Habgier und Bestechlichkeit schlecht bezahlter Unterbeamten und Handlanger bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Vollstreckungen zum Schaden der Gesamtheit oder Einzelner aus dieser Maschine herauskommen.
[9] Dieser Brief dürfte jenes vom 23. Oktober in den Archiven angeführte Schreiben sein, das sich noch nicht gefunden hat.
[10] Der Roman „Erniedrigte und Beleidigte“ ist allen Lesern Dostojewskys zu gut bekannt, als dass hier eine eingehende Besprechung desselben nötig wäre. Auch gehört es nicht in den Rahmen dieses Buches, ästhetisch-kritische Besprechungen der Werke des Dichters aufzunehmen. Indessen hat dieser Roman gerade von russischen Kritikern die schärfste Verurteilung erfahren. Einer der bedeutendsten von ihnen sagt, er stehe unter der Linie der ästhetischen Kritik. Inwieweit die vielen Fehler dieses Werkes dies Urteil berechtigen, wollen wir nun, nach dem oben Gesagten, nicht untersuchen. Die meisten Kritiker aber werfen sich auf die Schilderung eines Mannes, der die Selbstverleugnung hat, dem Mädchen seiner Liebe zu einem andern Glück zu verhelfen, als auf ein ästhetisches Unding, weil es gegen die Wahrheit und Möglichkeit grob sündige. Hier sind sie ihren rein subjektiven Anschauungen gefolgt. Es kann ja ein solches Vorgehen wirklich nur „einer Kopfliebe entspringen“, wie sie sagen, und jedem gesunden Menschen unsympathisch sein. — Dass es aber vollkommen wahr ist, weil es möglich war, das beweist Dostojewskys Geschichte unwiderleglich. Der künstlerische Fehler in der Zeichnung dieser Figur liegt wohl, wie Dobroljubow auch sagt, darin, dass dieser selbstlose Held der Erzähler ist und wir aus seinem Vortrag nicht gewahr werden, dass er mehr als ein Zuschauer sein könnte.
[11] Unsere Nachforschungen in der „Dritten Abteilung“ haben zur Spur von 19 Briefen aus Sibirien an den Bruder und an Verwandte geführt.
[12] Memoiren aus dem Totenhause, 2. Teil, 3. Kapitel.
[13] Der Dichter hat später in der Person seiner zweiten Gattin Anna Grigorjewna jene Kraft gefunden, welche diese praktische Idee bis in das kleinste geschäftliche Detail auszuführen verstand. Er hat jedoch, wie wir später sehen werden, erst in seinen letzten Lebensjahren die Früchte dieses Geschäftsfleisses zu geniessen begonnen.
[14] Michael Dostojewsky hatte anfangs mit seiner Fabrik bessere Geschäfte gemacht, da er zur Anlockung der Kunden jeder Schachtel eine kleine Überraschung beilegte. Da er aber damit nicht wechselte, so bekam jeder Käufer so und so viele Messerchen zusammen und hörte auf, dort seinen Bedarf zu decken.
[15] Reporter und Sensations-Journalisten werden heute in Russland „Krokodile“ genannt, ob dies infolge Dostojewskys Satire geschieht oder diese auf jenes Spitzwort aufgebaut ist, haben wir nicht ermitteln können.
[16] Ein Ausspruch, den Dostojewsky heute, was Tolstoj anlangt, sicher zurücknehmen würde.
[17] Das Gedicht ohne Zeitwort ist von Athanas Athanasjewitsch Fet, dem Verfasser vieler formvollendeter, aber kalter lyrischer Gedichte, worunter „Abende und Nächte“ das bedeutendste ist, welchem auch wohl die herangezogene Strophe entnommen ist. Seine Übersetzungen des ganzen Horaz, Juvenal, des Faust, sollen meisterhaft sein. Dostojewsky mochte ihn wegen eben dieser Abwendung von der brennenden Frage der Zeit (Aufhebung der Leibeigenschaft) nicht leiden, und wir sehen hier, in welcher launigen und doch unerbittlichen Weise er ihn „justifiziert“.
[18] Anführung von Grigorjews Ausdrücken.
[19] Der Roman „Erniedrigte und Beleidigte“ ist allerdings eines der schwächsten Werke Dostojewskys; dies, wie uns scheinen will, vor allem darum, weil die Grundidee nicht in fester Hand gehalten und sicher durchgeführt ist. Diese Natascha, welche zuerst den Erzählenden, Iwan Petrowitsch, einen armen Schriftsteller, liebt und dann aus dem Elternhause zu dem Sohn des Fürsten Walkowsky, einem unreifen, ja fast schwachsinnigen Jungen von 21 Jahren flieht, welcher sie liebt und nicht liebt, dieser Iwan Petrowitsch, der ihr selbst zur Flucht hilft, später aber Liebes- und Zornesbotschaften zwischen ihr und den Eltern hin und her trägt, diese Eltern, die mit dem Fürsten prozessieren und doch in die Ehe ihrer Tochter mit Aljoscha einwilligen, — sie alle wollen offenbar erniedrigt und beleidigt sein, sie sind nicht wirkliche Beleidigte — denn: ein kleiner Druck am Räderwerk des Ganzen, eine logische und vernünftige Schlussfolgerung, ein energisches Halt, und sie sind es nicht und alles wäre anders.
Dostojewskys russische Kritiker haben ihm das Unsinnige und Unwürdige der Gestalt des Erzählers Iwan Petrowitsch ganz besonders übel genommen. Ein Mann, der den Liebesroman seiner Braut mit einem Andern schildert, der darin als helfender Akteur mitwirkt und nicht mit einem Worte verrät, wie ihm dabei zu Mute ist, muss allerdings als eine klägliche Figur erscheinen, ebenso unwürdig im Leben, als unbrauchbar für die Kunst. Nun wissen wir aber heute, dass Dostojewsky in den äusseren Geschicken Iwan Petrowitschs seine eigenen Geschicke, in der Entsagung Iwans seine eigene Entsagung gezeichnet hat; dass ferner dieses bei Hinz und Kunz sicher unwürdige, mindestens befremdliche Vorgehen bei dem eben aus dem Totenhause befreiten, durch das Evangelium und die dort gewonnene Volksdemut zu „seiner Wahrheit“ durchgedrungenen Dichter eine viel kompliziertere und tiefere Deutung erheischt. Uns dünkt auch, dass gerade dieser persönlichste Anteil an dem Roman es ist, welcher den Dichter daran hinderte, Iwan Petrowitschs Seelenzustand auch nur anzudeuten, wodurch diese Figur allein hätte künstlerisch gestaltet werden können. Wie dem auch sei, Dostojewsky hat dennoch Recht, wenn er sagt, dass dieser Roman „zwei, drei Stellen enthält, die warm und kraftvoll sind, und ein halbes Hundert Seiten, auf die er stolz sei“.
[20] Hier wird es am Platze sein, der Studie zu erwähnen, welche der bekannte Psychiater Dr. M. Tschiž im Jahre 1885 unter dem Titel „Dostojewsky als Psychopathologe“ in Moskau publizierte. Es ist für uns sehr wichtig, gerade aus dem Munde eines bedeutenden Fachmannes eine Belehrung darüber zu empfangen, wie sehr Dostojewskys Lucidität in pathologischen Dingen einerseits durch seine eigenen Krankheits-Erscheinungen erhöht wurde, anderseits aber durch die Fülle seiner psychologischen Beobachtungen und Erfahrungen eine Klarheit und Bestimmtheit gewann, welche Krankhaftigkeit geradezu ausschliesst. Nachdem Tschiž den Beweis erbracht hat, dass Dostojewsky in den 25 pathologischen Wesen, welche in seinen Romanen vorkommen, die mannichfaltigsten Nuancen mit der feinsten Beobachtung ausgestattet und nirgends einen Strich verzeichnet hat, wobei die Hallucinierenden und Epileptiker vom Dichter als einem „Kompetenten“ behandelt werden, fügt er folgendes hinzu: „Gewiss hat Dostojewskys eigene Krankheit ihm vieles über die krankhaften Zustände der Seele erklärt, und vieles konnte er aus der Selbstbeobachtung schöpfen, doch ist es heute dem Arzt, schon aus Achtung vor seiner Persönlichkeit und seinen Leiden, nicht gestattet, vieles darüber zu sagen. Hier aber trifft ganz besonders zu, was Dostojewsky selbst sagte: „Nicht auf den Gegenstand kommt es an, sondern auf das Auge: ist das Auge da, so findet sich auch der Gegenstand. Habt Ihr kein Auge, seid Ihr blind, so werdet ihr in keiner Sache irgend etwas herausfinden. O, das Auge ist eine wichtige Sache, was für das eine ein Poëm, das ist fürs andere eine Wolke“.“
Diese letzte Anführung Tschiž’ erhält ihre Bekräftigung an jener Stelle, wo er, die Gestalten Iwan Karamasows und Raskolnikows definierend, das Axiom von „Genie und Wahnsinn“ mit folgenden Worten widerlegt: „Der bekannte Satz, dass Genie und Wahnsinn ein und dasselbe sei, ist auch nicht mehr als ein Paradoxon. Es ist begreiflich, dass auch ein genialer Mensch psychisch krank sein kann, allein Wahnsinn wird immer ein Hemmschuh für sein Genie sein. Das Genie ist der strikte Gegensatz des Wahnsinns: das Genie erfasst die Gegenstände tiefer, von viel mehr Seiten als der gewöhnliche Verstand; der psychisch Kranke sieht entweder weniger als der Gesunde oder er kann im besten Falle etwas nur einseitig — und darum eben falsch — begreifen“.
Nun ist ja dem berühmten Psychiater nichts ferner gelegen, als diese Definition von Genie und Wahnsinn auf Dostojewsky selbst anzuwenden, so klar ihm auch das Krankheitsbild des Dichters vor Augen steht. Zur Zeit, da diese Studie geschrieben wurde und die Mitwelt noch unter dem Eindrucke von Dostojewskys Genius stand, würde es weder einem Laien noch einem Fachmann eingefallen sein, des Dichters schöpferische Phantasie mit seiner Krankheit in irgend eine Verbindung zu bringen. Heute aber und in unserem europäischen Milieu, wo die Anschauung allmählich Platz gegriffen hat, dass Dostojewskys Schöpfungen zum grossen Teil aus seiner Krankhaftigkeit zu erklären seien, heute kann man es nicht genug betonen, wie irrig diese Anschauung ist, und wie sie, im Licht der Wissenschaft betrachtet, in nichts zerrinnt.
[21] Wir haben den Ausdruck hier absichtlich ohne Umschreibung gebracht, weil das Zeitwort spucken ein richtiges, viel und ernst gebrauchtes Wort im Vokabularium der geringschätzenden Ausdrücke der Russen ist. „Ich habe mich mit Europa auseinandergespuckt,“ sagt Dostojewsky ganz ernst an einer Stelle im „jungen Nachwuchs“.
[22] Man merke hier den scheinbaren Widerspruch zu der vorangegangenen Äusserung, von Katkow nicht vorausnehmen zu wollen. Dieser Widerspruch findet seine Lösung in dem Umstande, dass der Roman schon seit Januar zu erscheinen begonnen hatte, eine solche Vorauszahlung also durchaus anders zu beurteilen war, als eine im November 1865.
[23] Anmerkung: Einer der im Prozess Petraschewsky zum Tode Verurteilten, der Lieutenant eines Grenadierregiments Nikolaus Grigorjew, war auf dem Schaffot wahnsinnig geworden.
[24] Eine Person, welche in einem Anfall von Irrsinn in der Schwangerschaft ihr Stieftöchterchen aus dem Fenster geworfen hatte und für die Dostojewsky öffentlich eintrat.
[25] Anspielung auf das letzte Ziel der Grossrussen: die Gewinnung eines Welthafens, Konstantinopels.
[26] Im Abdruck ausgelassene Stellen.
[27] Die von Herzen in London herausgegebene revolutionäre Zeitschrift.
[28] Bischof von Woronesch, ein als Heiliger verehrter Mönch.
[29] Der bekannte Oberst Tschaadajew, welcher das Heil für Russland in der katholischen Idee findet und seine Gedanken über Russlands Mangel an Originalität in einem philosophischen Briefe an eine Dame niederlegte.
[30] Aus Gogols „Tote Seelen“.
[31] Die Hauptpersonen in Tschernyschewskys Roman „Was thun?“
[32] Es ist Gradowsky gemeint.
[33] Rjeschotnikow war ein Bauernsohn, der Schriftsteller wurde und Bauernerzählungen schrieb. Er starb in jungen Jahren.
[34] Ein Wort, das heute in Russland als Gattungsname für angeborene Wollust Geltung gewonnen hat.
Verlag von Ernst Hofmann & Co. in Berlin SW. 46, Hedemannstr. 2.
Kaiser
Wilhelm II.
Von
Friedrich Meister.
Mit zahlreichen Illustrationen.
408 Seiten.
Motto: „Zu Großem sind wir noch bestimmt, und herrlichen Tagen führe Ich Euch noch entgegen.“
Brosch. M. 3,—;
in Prachteinband
M. 4,—.
Schopenhauers
Gespräche und Selbstgespräche.
Hrsgeg. von Eduard Grisebach.
Geheftet M. 3,—; fein gebunden M. 4,—.
Deutsche Charaktere.
Geheftet M. 5,50; fein gebunden M. 7,—.
Von Richard M. Meyer.
Inhalt: Der germanische Nationalcharakter. — Über d. Begriff der Individualität. — Tannhäuser. — Der Kampf um den Einzelnen. — M. R. Lenz. — Friedrich Wilhelm IV. — K. Immermann. — A. Graf v. Platen. — Annette v. Droste-Hülshoff. — Ferd. Freiligrath. — Victor Hehn.— Fr. Rohmer. — Paul de Lagarde. — Sechzig Selbstporträts. — Die Gerechtigkeit der Nachwelt.
Erinnerungen eines Künstlers.
Von Rudolf Lehmann (London).
Mit 16 Lichtdrucken:
Chopin, Pet. Cornelius, Eckermann, Friedrich III., Gladstone, Ferd. Gregorovius, A. v. Humboldt, Lamartine, Liszt, Kardinal Manning, Adolf Menzel, Pius IX., L. v. Ranke, Clara Schumann, Tennyson.
328 Seiten Großoktav. — Splendide Ausstattung.
Geheftet M. 7,—; in Damast gebunden M. 8,—.
Dramen von Max Nordau:
| Das Recht, zu lieben. Schauspiel. 2. Aufl. | } | Preis jedes Bandes: Geheftet M. 2,—. Gebunden M. 3,—. |
| Die Kugel. Schauspiel. 2. Aufl. | ||
| Doktor Kohn. Trauerspiel. 2. Aufl. |
Peter der Große.
Von
Dr. K. Waliszewski.
Deutsche Ausgabe Von Prof. W. Bolin.
Zwei Bände. 320 + 289 Seiten. Mit Bildnis.
Preis: Geheftet M. 6,—; Leinenbd. M. 8,—; Halbfranzbd. M. 9,50.
Das moderne Rußland ist die Schöpfung Peters des Großen. Bis zu welchem Grade und in welcher Bedeutung erweist sich aus der Geschichte seines Lebens und Wirkens. Auf urkundliche Zeugnisse gestützt, die von bisherigen Forschern weniger berücksichtigt oder auch erst später zugänglich wurden, entrollt der bedeutende Geschichtsschreiber ein ebenso fesselndes wie durch seine unbestechliche Wahrheitsliebe ergreifendes Bild von dem nordischen Reformator. Ihm ist der Zar keineswegs eine heroische Ausnahmegröße, wie legendarische Ausschmückung sie gestaltet und unkritische Geschichtsauffassung sie willig geglaubt hat. Durch Peter den Großen wird Rußland nur rascher auf der Bahn der Entwickelung gefördert; durch ihn werden anderwärts bereits gewonnene Kulturerrungenschaften einem Gebiet zugewandt, welches durch eigentümliche, geographische wie geschichtliche, Verhältnisse in seiner Entwickelung gehemmt worden war. Der Verf. bringt den Zaren zugleich in seiner individuellen und nationalen Eigentümlichkeit dem Leser mit Anschaulichkeit nahe.
Das Waliszewskische Werk kann unzweifelhaft als die beste Biographie Peters des Gr. bezeichnet werden.
Neue Preuß. (Kreuz-) Zeitung.
Biographische Blätter.
Jahrbuch für lebensgeschichtliche Kunst u. Forschung.
Unter Mitwirkung von
PProf. DDr. M. Bernays, F. v. Bezold, A. Brandl, A. Fournier, L. Geiger, K. Glossy, E. Guglia, S. Günther, O. Lorenz, K. v. Lützow, J. Minor, F. Ratzel, Erich Schmidt, A. E. Schönbach u. A.
herausgegeben von Dr. Anton Bettelheim.
Band I und II. — Jeder Band (500 Seiten Lexikon-Format) ist selbstständig und einzeln käuflich: Geheftet M. 10,—; fein gebunden M. 11,50.
Die „B. Bl.“ zeigen die Lebensgeschichte von allen Seiten und in allen Stadien, im Werden und Sein, in der Theorie wie der Praxis. Abhandlungen und Essays, Quellen und Darstellungen, Kritiken und Übersichten treten in einen Kreis zusammen, in dessen Mittelpunkt der einheitliche Gedanke herrscht, daß Persönlichkeit, Individualität, Menschendasein und -Wirken in einzigem Maße erforschens-, wissens- und genießenswert ist und bleiben wird, so lange Gelehrte, Schriftsteller und Publikum aus lebendigen Menschen bestehen.
Prof. A. Dove in der Münch. „Allgemeinen Zeitung“.
Geisteshelden.
Eine Sammlung von Biographieen.
Bisher erschienen folgende — einzeln käufliche — Bände:
1. Walther v. d. Vogelweide. 2. Aufl. Von Prof. A. E. Schönbach.
2/3. Hölderlin * Reuter. 2. Aufl. Von Dr. Ad. Wilbrandt.
4. Anzengruber. 2. Aufl. Von Dr. Anton Bettelheim.
5. Columbus. Von Prof. Dr. Sophus Ruge.
6. Carlyle. 2. Aufl. Von Prof. Dr. G. v. Schulze-Gaevernitz.
7. Jahn. Von Dr. F. G. Schultheiß. Preisgekrönt.
8. Shakspere. Von Prof. Dr. Alois Brandl.
9. Spinoza. Von Prof. Dr. Wilhelm Bolin.
10/11. Moltke, I. Von Oberstleutnant Dr. Max Jähns.
12. Stein. Von Dr. Fr. Neubauer. Preisgekrönt.
13/15. Goethe. Von Privatdozent Dr. Richard M. Meyer.
 Mit dem 1. Preise gekrönt.
Mit dem 1. Preise gekrönt.
16/17. 27. Luther. I. II, 1. Von Privatdoz. Dr. Arn. E. Berger.
18. Cotta. Von Minister Dr. Albert Schäffle.
19. Darwin. Von Prof. Dr. Wilhelm Preyer†.
20. Montesquieu. Von Prof. Dr. Alb. Sorel.
21. Dante. Von Pfarrer Dr. Joh. Andreas Scartazzini.
22. Kepler. * Galilei. Von Prof. Dr. S. Günther.
23. Görres. Von Prof. Dr. J. N. Sepp.
24. Stanley. Von Paul Reichard.
25/26. Schopenhauer. Von Konsul Dr. Ed. Grisebach.
28/29. Schiller. Von Prof. Dr. Otto Harnack.
30/31.  Peter der Große.
Peter der Große.  Von Dr. K. Waliszewski.
Von Dr. K. Waliszewski.
32. Tennyson. Von Prof. Dr. Emil Koeppel.
Die
Kulturaufgaben der Reformation.
Von
Dr. Arnold E. Berger.
312 Seiten Grossoktav. Geheftet M. 5,—, fein gebunden M. 6,—.
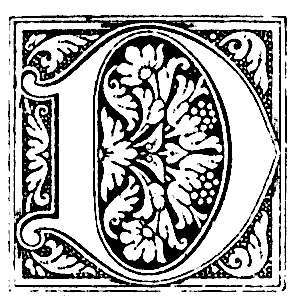 Die in Tausenden von Exemplaren verbreitete, von hervorragenden
Gelehrten geschriebene Biographieen-Sammlung
Die in Tausenden von Exemplaren verbreitete, von hervorragenden
Gelehrten geschriebene Biographieen-Sammlung
„Geisteshelden“
bildet einen unentbehrlichen Bestandtheil aller Privat-, öffentlichen und Schul-Bibliotheken; sie gewährt einen gediegenen, anregenden und bildenden Lesestoff für Männer und Frauen, reife wie reifende Leser. Im Unterschied zu den nachträglich entstandenen Spezial-Sammlungen bieten die „Geisteshelden“ Lebensbilder aus allen Gebieten der Kultur, Litteratur, Kunst und Wissenschaft. Der Umfang der gediegen und geschmackvoll ausgestatteten Bände umfaßt je 200-300 Druckseiten. Der Text ist nicht durch gelehrte Anmerkungen beschwert; doch wird Weiterstrebenden im Anhang durch genaue Quellenangaben Material gewährt.
In Vorbereitung:
Uhland, von Professor Dr. Erich Schmidt.
Grillparzer, von Professor Dr. Alfred Freiherr von Berger.
Hans Sachs, von Privatdozent Dr. Max Herrmann.
Molière, von Professor Dr. Heinrich Morf.
Byron, von Professor Dr. Emil Koeppel.
Buddha, von Dr. Karl Eugen Neumann.
Helmholtz, von Professor Dr. Hugo Kronecker.
Friedrich der Große, von Kgl. Archivrat Dr. Georg Winter.
Napoleon I., von Professor Dr. Alois Schulte.
Tizian, von Dr. Georg Gronau in Berlin.
Michelangelo, von Professor Dr. Alfred Gotthold Meyer.
Bach * Händel, von Dr. Max Seiffert.
Mozart, von Professor Dr. Oskar Fleischer.
Richard Wagner, von Professor Dr. Max Koch.
Preis jedes Bandes: Geheftet M. 2,40; in geschmackvollem Leinenband (dunkelrot oder blau) M. 3,20; in feinem Halbfranzband M. 3,80.
Die Wirtschaftspolitik des Vaterunser.
Von
Prof. Dr. Gustav Ruhland.
Zweites Tausend. — 104 Seiten. — M. 2,—.
DIE LIEDER
DER
MÖNCHE UND NONNEN
GOTAMO BUDDHO’S.
AUS DEM ALTINDISCHEN ZUM ERSTEN MAL ÜBERSETZT
VON
Dr. KARL EUGEN NEUMANN.
400 Seiten Lex.-Oktav. — Geheftet 10 M.; in Halbfranzband 12 M.
Das Werk ist für die weitesten Kreise bestimmt und wird diese mächtig anziehen. Denn hier spricht echter, unverfälschter Buddhismus aus jeder Zeile, die eigenen Worte des Stifters und seiner Jünger. Es kommt hinzu, dass der Inhalt keineswegs einseitig, sondern reichlichst gestaltet ist und sich über alle menschlichen Verhältnisse verbreitet, ja sich stellenweise zu novellenartiger Feinheit und Eleganz erhebt. Das Buch wird nicht nur die Akademiker und Philologen, sondern alle Gebildeten, auch verwöhnte Feinschmecker, lebhaft anregen.
DIE SITTLICHKEIT
und der philosophische Sittlichkeitswahn.
Von
Dr. Abr. Eleutheropulos
Privatdozent an der Universität Zürich.
148 Seiten Lexikon-Oktav. — Preis M. 3,25.
Selbst wer nicht Philosoph vom Fach ist, wird reiche Anregung aus dem geistvollen Buche schöpfen, das auch in kulturhistorischer Hinsicht beachtenswerte Erörterungen enthält.
Deutsche Kern- und Zeitfragen.
Von
Dr. Albert Schäffle,
K. K. Minister a. D.
Erste Sammlung
480 Seiten Lexikon-Oktav.
Neue Folge.
510 Seiten Lexikon-Oktav.
Jeder Band ist selbständig und einzeln käuflich. Preis jedes Bandes: Geheftet M. 10,—; in feinem Halbfranzband M. 12,—.
Anmerkungen zur Transkription
Im Original g e s p e r r t hervorgehobener Text wurde in einem anderen Schriftstil markiert.
Variierende Transliterationen der russischen Namen und Begriffe wurden im Allgemeinen beibehalten, wie z. B. Neswanowa, Njeswanowa und Njezwánowa. Lediglich offensichtliche Fehlschreibungen wurden korrigiert, wie z. B. Njezwánowna zu Njezwánowa.
Andere Fehler wurden, zum Teil unter Zuhilfename der russischen Originale, korrigiert wie hier aufgeführt (vorher/nachher):
End of the Project Gutenberg EBook of Th. M. Dostojewsky, by Nina Hoffmann
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TH. M. DOSTOJEWSKY ***
***** This file should be named 52283-h.htm or 52283-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/2/2/8/52283/
Produced by Peter Becker, Jens Sadowski, and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This
file was produced from images generously made available
by The Internet Archive.
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.