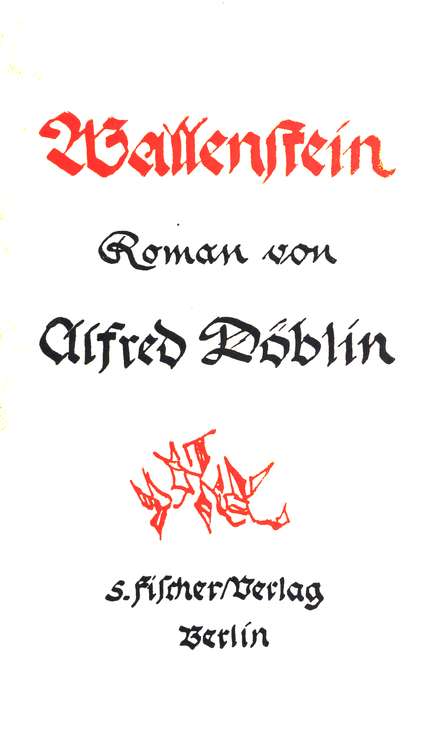
The Project Gutenberg EBook of Wallenstein. II. (of 2), by Alfred Döblin This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Wallenstein. II. (of 2) Author: Alfred Döblin Release Date: October 11, 2013 [EBook #43932] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK WALLENSTEIN. II. (OF 2) *** Produced by Jens Sadowski
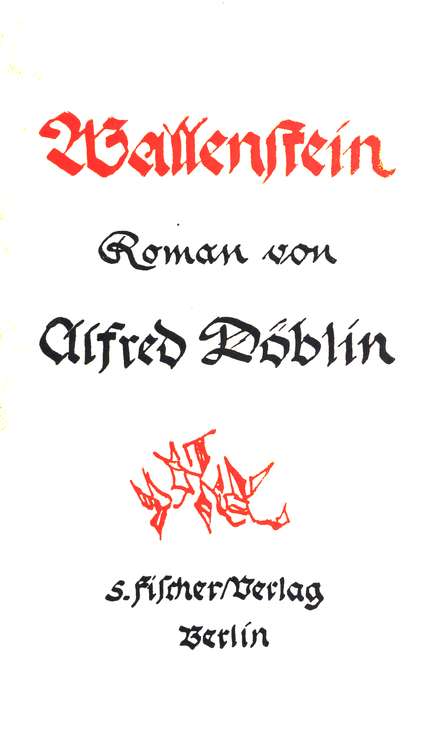

1920
S. Fischer/Verlag/Berlin
Erste bis dritte Auflage
Alle Rechte vorbehalten, besonders das der Übersetzung
Copyright 1920 S. Fischer, Verlag
Durch die beiden Kristallfenster der schönen und reichen Kapelle zu München in der Residenz schien die rote Wintersonne. Das schmale Gewölbe, weißer polierter Gips, nahm purpurne Flecken und Linien an, als würde es angehaucht. Über dem Pflaster von Jaspis und Achat auf Kniestühlen der bayrische Hof, spanische Kostüme, gesenkte Schultern, niedergedrückte Köpfe, grauhaarig, weiße Perücken, dunkle gezügelte Locken. Auf der Kanzel zur Linken des großen Silberaltars mit den Reliquien und dem reitenden Ritter Georg — golden, drei Federbüsche am Helm mit Diamanten, Rubinen, Smaragden — sprach in schwarzem geschlossenen Jesuitenrock ein langer glutäugiger Priester; seine Arme fuhren, ohne daß sie es sahen, über sie weg in der drohenden Erregung:
„Es ist eher erlaubt, Gott zu hassen als zu lieben. Denn Gott steht uns zu fern, zu hoch; es ist eine Sünde, sich ihm zu nahen, selbst in Gedanken. Zu wagen, ihn zu lieben, wie dieses und jenes aus dem Alltag, ihn behängen mit Putz Juwelen und Gold, ihm zarte Gefühle darzubringen: das heißt, ihn erniedrigen. Es ist das Vergehen einer Beleidigung der Göttlichkeit. Kriechen vor ihm, ihm ausweichen, ja ihm grollen: das mag einem Menschen gut anstehen. Ihr habt schon Gott verleugnet in dem Augenblick, wo ihr ihn nicht fürchtet. Er hat euch keine Freundlichkeit gegen sich erlaubt, ist nicht euer Vater, eure Mutter, euer Buhle, euer Herzensbruder. Er ist nicht einmal euer König und Fürst, er lehnt es ab, euer Richter zu sein; sein Gericht ist euch nicht zugänglich; er vollzieht es, wann er will und gegen wen er will. Es läßt sich nicht fassen und erforschen, wer er ist, und darum heißt es nur, Grauen vor ihm empfinden — und so habt ihr getan, was Menschenpflicht ist.
Wehe denen, die glauben, Gott sei unser Vater; es ist fast kein weiterer Schritt nötig, um Ketzerei zu üben. Es heißt: ihr sollt den Sonntag heiligen, um Gottes willen; und Gott selber wollt ihr nicht heiligen? Vergeßt nicht, wer ihr seid, von wo ihr stammt. Wißt ihr, wie die Erbsünde euer Leben eingeleitet hat? Kennt ihr alle Laster, mit denen ihr euch seit jenem Tage schleppt — Glückstag oder Unglückstag? Seht die Niedrigkeit der Menschen, die Erbärmlichkeit ihrer Begierden — und ihr Gotteskinder! Seht euren Tag an, gefüllt mit Arbeit, Sättigen des Leibes, mit hundertfachem Verdruß, hundertfachem Vergnügen, hingeweht das Ganze, von nicht mehr Gewicht als ein Farbenantlitz. Prozesse im Land, Mißgunst, Drang nach Reichtum, Vorrang, Aufsässigkeit der Untertanen, das ist euer Leben, wenn ihr erwachsen und alt seid. Bald mehr, bald weniger Spaß, Spiel, Männer, Weiber, Weine, Biere, Tourniere, Hirsche, Eber, Musik, Bilder, Schlaf, Stumpfheit, Behaglichkeit, Bitterkeit — um nichts und ein bißchen. Trübsinn und Greinen, wenn ihr gichtisch werdet und krumm, mit leeren Kiefern hinter dem Ofen hockt und nur Brei schlucken könnt, Hüftweh, Stuhlbeschwerden, Harndrang, Magenkrämpfe, dann Schlaf und Schlaflosigkeit. Das ist das Leben von Kindern Gottes. Ihr schämt euch, ich fühl’ es mit euch allen; man braucht dies alles nur fassen, sich erinnern, vor Augen halten. Ja, Besinnung, Erinnerung! Ruhe der Seele, Erlöschen der Begierden! Nur ihn wissen, den Gott, das Recht haben, seinen Namen zu kennen, von seinem Dasein zu hören: das ist genug und genug für uns. Das Recht haben, Gott fürchten zu dürfen: seht, ich sprech’ es aus.
Und ihr fühlt, daß ich die Wahrheit sage. Die Wahrheit ist mit mir. Wir wiegen uns nicht in Gefühlen und Träumereien einer Magd. Uns ist das Leben zu ernst; es ist uns gegenwärtig, wir kennen es, haben es erlitten, wissen, was uns erwartet, heute, morgen. Es wird uns kein Engel begegnen, keine Verheißung wird uns ausgesprochen. Lassen wir die Spiele den Kindern, den lieben, und den Toren, den lieben.
Morgen wird die Glocke läuten, dann wird die Frühmesse sein, die Knechte werden in die Höfe stampfen, die Vögte werden hoch auf den Pferden sitzen mit Federhüten und Peitschen. Morgen früh wird die Glocke läuten: wir werden uns im Halbschlaf auf den Rücken legen, dann auffahren, unser Gebet verrichten; und das Geschrei der Kinder nach Milch und Pflege gellt in unsre Ohren. Wir schlucken unsre Frühsuppe, sie kann dünn und kalt sein, wir müssen die Gewölbe durchsehen, wo unsre Schätze und Waren stehen, die Kisten zuschlagen, bald werden die Fuhrwerke über die Brücken knarren; es muß alles verfrachtet und versiegelt sein; wir werden schimpfen mit den Knechten, man wird uns am Fuhrlohn betrügen, wir werden uns wehren; die Bauern schlurren herein.
Wenn morgen die Glocke läutet, hat eine Mutter ihr Kind geboren und freut sich, ihr Mann freut sich und die Geschwister sehen sich das armselige Wurm an. Und an vielen Orten hat sich in dieser Nacht eines verändert, eines ist verhungert und erfroren am Brunnen, vor einer Stalltür, eines erschlagen von Räubern, eines vom Fieber weggerafft, eines alt, siech, todesbedürftig in der Kammer ausgelöscht. Unser Leben, unser Leben! Wie könnte man stolz sein! Wie wagt es einer, stolz zu sein und den Namen Mensch mit Prahlerei im Mund zu führen — es sei denn, er bilde sich etwas ein, auf die Kraft seiner Muskeln, die List seiner Gedanken, die Wildheit seiner Begierden! Und welches Tier wäre ihm nicht da überlegen.
Unser Leben, unser Leben! Gestorben sind wir tausendmal, wenn wir erkannt haben, wer wir sind, aus Stolz; und erhoben hat uns nicht der Kaiserhut, der Kurfürstenhut, der auf unserm Haupt liegt, nicht die Bischofsmütze, die Tonnen Gold, sondern das Grausen, das Entsetzen. Nicht besinnen können: nur das tröstet uns. Die Vergessenheit, der Rausch trägt uns betrügerisch über die Abgründe. Wofern wir sehen, rettet uns von Tod und Vernichtung nur die Furcht.
Brecht, meine Knie! Mein Herz, laß deine Säulen zerfallen! Dach über mir, zerschmettere mich! Kommt angefahren, hundert Rohre, hundert Kartaunen, auf mich gerichtet, hier mein Herz, meine Augen. Ich bin gefroren. Ich kann doch noch immer lachen über euch. In die Luft verpafft ihr euer Eisen und Marmelstein. Ich kann beten, kann zittern!“
Der kranke alte Herzog Wilhelm war über seinen Stuhl nach vorn gefallen, sein weißes Gesicht baumelte, sein Stuhl schwankte seitlich. Der Kurfürst griff mit harter Miene nach links gegen ihn.
Wie der Pater die neue Feste herunterkam und unweit der Kunstkammer an den weiten Stallungen vorüberging, berührte ein unbewaffneter Mann in der Dämmerung seinen Ärmel und sprach ihn, als er sich umwandte und stehenblieb, an, indem er ihn bat, scheublickend, er möchte nicht mit ihm hier stehenbleiben vor den Augen der Passanten und fürstlichen Wächter. Rasch bogen sie in eine Seitengasse. „Ihr seid der Pater, der in der Frauenkirche gepredigt hat; ich habe Euch zugehört. Ich bin Tillyscher Soldat, möchte Euch sprechen.“ „Was wollt Ihr,“ fragte der sehr rührige Jesuit. Heiser, während er ihn aus samtenen Augen verzehrend ansah, bat der untersetzte bärtige Mann, der von der rechten Stirn herunter bis an den Mundwinkel eine blutrünstige Narbe trug, er möchte den Pater in einem geschlossenen Raum, wo er wolle, sprechen über Dinge, die ihm am Herzen liegen; er schwöre, keine Waffen zu haben, nichts Feindliches im Sinn zu haben; er brauche Hilfe. Sie gingen auf Umwegen am Jesuitenkolleg vorbei, stiegen von der Rückwand die Treppe des weiten Konventhauses hinauf. In der dunklen Zelle steckte der Geistliche eine Kerze am Türpfosten an; es war ein schmaler hoher Raum, völlig kahl; über einer Bücherreihe an einer Längswand hing das Bild des heiligen Franziskus in der Wildnis. Der Fremde setzte sich unter die Kerze, gab nach langem Zudringen des Paters Auskunft. Er sei von protestantischen Eltern im Österreichischen geboren, vor Jahren von einer Kommission bekehrt; seine Eltern seien verschollen oder getötet bei den Aufständen; und dann kam er nicht weiter, irrte mit den Blicken immer wieder zu dem großen Gemälde. Was dies Bild bedeute, wollte er dann wissen. Der Pater gab ihm Antwort. Dann stieß der Fremde rasch und hintereinander hervor: er käme — ihm sei prophezeit worden, er werde in diesem Jahr im Krieg umkommen in der Lombardei; er wolle ein Amulett, hätte kein Zutrauen zu einem andern, sei verzweifelt, verzweifelt. Und dabei knirschte der bärtige Mann mit den Zähnen, die Tränen standen ihm in den Augen, er schluckte, schluchzte, blickte den Priester erbärmlich an. Vorsichtig ein Lächeln unterdrückend, fragte der Priester, ob jener ihm wirklich zugehört habe. „Ihr habt ein Amulett,“ bettelte dumpf der andere, immer den Franziskus anblickend, „Ihr wißt alles, ich habe Euch zugehört, gebt mir eins. Denkt an einen andern.“
„Mein Lieber, wenn Euch bestimmt ist, wie Ihr sagt, zu sterben, so wird Euch mein Amulett nichts helfen.“
„Ich will nicht sterben, Ehrwürden. Mein Vater und Mutter sind schon tot um nichts. Ich hab’ nichts verbrochen. Nur Kummer und Plag’ hab’ ich gehabt, und jetzt soll ich sterben.“
„Lieber, Ihr müßt Euch das mit dem Zaubermittel aus dem Kopf schlagen. Das ist verruchtes Soldatenwerk. Seid fromm, betet.“
Erwartungsvoll blickte ihn der gehetzte Mann unter der Kerze an: „Wird mir Gott helfen?“
„Betet.“
„Aber wird er mir helfen?“
„Ihr habt nichts zu fordern.“
„Wozu soll ich beten, wenn es nicht hilft. Gebt mir ein Amulett.“
„Mann, geht Eurer Wege. Ich habe mit Euch nichts zu schaffen.“
Der Pater stand ruhig auf. Der Mann, die Fäuste ballend: „Ich bin doch kein Narr und Lump, daß Ihr mich so wegschickt und mit Worten abspeist.“
„Ihr seid ein Narr. Und das ist noch wenig gesagt.“
Der Soldat zitterte an der Tür, hinter seinem Stuhle stehend: „Weil ich nicht beten will? Es wollen andre auch nicht beten. Und mit ihnen springt man nicht so um wie mit mir; sie brauchen nicht zu sterben.“
„Wer will aus deiner verruchten Gesellschaft nicht beten?“
„Wer? Das fragt Ihr noch? Eure eignen Schüler, die habt Ihr so weit gebracht. Gewiß. Mein Herzensbruder war Novize bei Euch, hat mir geraten, in Eure Andacht zu gehen. Ich hab’s nicht bereut, hab’ wohl gemerkt, daß Ihr alles recht wißt und hab’ Euch in allem recht gegeben. Und so speist Ihr mich ab.“
Der Pater trat an den weinenden Mann, der sich den lumpigen Filzhut vor die Augen hielt: „Wer hat Euch in meine Andacht geschickt?“
„Wer? Wer?“ äffte der andere widerspenstig und grimmig nach; stülpte sich nach kurzem Anstieren des Priesters den Hut auf, sprang mit zwei Sätzen auf das Bild des Franziskus, riß es am Rahmen herunter, raste, den starr stehenden Priester mit dem Bild wider die Brust stoßend, durch die aufgerissene Tür davon; die Kerze schlug er im Vorüberfahren mit dem Holz herunter, so daß er Finsternis hinterließ.
Nach einer Woche wurde dem Pater beim Betreten des Hauses vom Bruder Pförtner gemeldet, daß ein junger Mann ihn vor seiner Zelle erwarte. Der Pater konnte den zum Schutz begleitenden Pförtner gleich zurückschicken; den jungen Menschen, der da stand, erkannte er sofort. Erst als sie in die Zelle traten, bemerkte er, daß der gebräunte feingesichtige Mensch ein Bild am Boden herzog. Der Pater blickte ihn starr an: „Du warst das?“ „Ich habe ihn nicht geschickt, Pater; er lief immer mit mir, er ist ein hilfloses Geschöpf. Das Bild hab’ ich ihm mit List abringen müssen. Hier habt Ihr’s wieder.“
„Ich danke dir. Hast du ein Anliegen? Stell’ es nur an die Wand.“
„Ich muß nicht sterben wie mein ängstlicher Freund, aber Ihr seht: ich bin hier.“
„Ich will Euch nicht um ein Amulett bitten; kann ich Euch sprechen?“
Der Priester setzte sich an das Fenster, wo für Vögel Krumen gestreut waren: „Eure Eltern haben sehr gejammert um Euch.“
Der andere vor dem Bücherpult lächelte streng: „Ich habe mir einen wahrhaft geistlichen Beruf erwählt, sagt das, bitte, ihnen; ich bin Soldat geworden, jetzt unter der dritten Fahne. Ich muß wie die Engel und Teufel um meine Seele kämpfen; wer nicht stark ist, geht dabei unter.“
„Du dienst unter Tilly?“
„Fragt nicht nach mir, Pater. Was tut mir not, Pater?“
„Sprich dich aus, mein Sohn.“
„Ich hab’ ein Dutzend schwere Bataillen mitgefochten, gefangen war ich, bin entwischt. Ich hab’ jahrelang mein Leben geführt, seit ich Euch durchbrannte, wie’s mir gut tat. Als mein Regiment Pikeniere aufgelöst wurde, hab’ ich gebettelt, gearbeitet, kein gut getan; und wie ich unversehens hierher kam und Euch hörte, seht, Pater: da ist keiner gewesen unter allen, die da saßen, der so gelechzt hätte nach Euren Worten wie ich. Ihr müßt mir mehr sagen. Ich — brauch es.“
Bitter sagte der Priester: „Ihr hättet nicht nötig gehabt zu lechzen. Aber du bist ein junges Blut und bist gewiß, daß man dir verzeiht.“
„Sprecht mir von Gott.“
„Schlage du Menschen tot, Dänen, Schweden, und frage nicht nach Gott.“
„Wie steht es mit Gott? Als ich bei Euch lernte, aus Thomas und Aristoteles las, habe ich ganz vergessen zu beachten, was sie sagten; ich nahm es ohne Gedanken an. Jetzt brauch’ ich es; wie steht es mit ihm?“
„Du hast doch Angst, mein Lieber.“
„Wie muß ich von ihm denken, wenn ich lebe, und meinetwegen, wenn ich sterbe.“
Der Priester kauerte sich am Fenster, vor dem die Vögel sprangen, über seinem Schoß zusammen: „Das einzige, was not tut, ist, den Hochmut brechen. Du kannst nicht mehr tun, als Gott aus deinem Herzen reißen. Merk dir dies! Nimm dies auf den Weg. Ja, Gott aus deinem Herzen reißen. Vor dem ungeheuren ewigen Wesen hat jeder dumpfe freche Gedanke in dir zu verstummen; jedes Auge erblindet. Es ist noch zu wenig, wenn geschrieben steht: ihr sollt seinen Namen nicht mißbrauchen. Laß ihn mit deinem Sterben zufrieden. Sein Name, dir sage ich es, soll aus Dir ausgerottet werden. Er soll nichts sein als der Warnungspfeiler vor einem grauenvollen Abgrund: „Bis hierher!“ Der gähnende Abgrund! Die Menschen, weder lebend noch tot, haben teil an ihm. Nichts ist uns von ihm gegeben. Wehe denen, die seiner nur gedenken. Du tust ja recht, mein Lieber, hast nicht nötig, mich zu fragen: tu, was dir beliebt, morde, raube, geh in die Kirche, schenke Almosen, liebe, verheirate dich — es ist ihm, ihm nicht dran gelegen. Wen schert das etwas! Die Menschlein! Ich bin nicht sein Anwalt. Aber sei gewiß: Gott lebt. Nur nicht unser.“
Der andre stemmte gebückt die Ellbogen auf die Knie, stützte das Kinn in die Hände: „Nicht seiner gedenken! Wer aber hat uns dies denn in das Herz gelegt? Wer dies getan hat, war ein Verbrecher am Menschen. Wenn — Ihr recht habt, Pater.“
Still stand der Priester auf: „Ich habe gesprochen, Vincenz.“
„Das hilft mir nicht, Pater, was Ihr mir sagt. Als ich bei Euch lernte, hätte es mir vielleicht genügt. Jetzt brauch’ ich etwas andres.“
„Nimm den heiligen Franziskus, wie dein Herzbruder.“
„Ihr schiebt mich nicht so leicht ab; ich denke doch, Ihr spottet nicht über mich. Wozu braucht Ihr Heilige und den Heiland?“
„Der Heiland sagt aus, wie wir leben sollen.“
„Herr, wie kam der Heiland zu Gottes Wort?“
Der Priester, abgewandt, schwieg lange: „Wir sind Christen. Wir beten zu Christus.“
„Ich weiß nicht, wovon Ihr redet.“
Das starre strenge Gesicht drehte der Priester ihm zu: „Da ist nichts unklar. — Der Hochmut ist zu brechen in den Menschen. Der Gott, den du in dir hast, ist der letzte Rest des Heidentums. ‚Gott‘ sagt der Heide; es ist gleichgültig, ob ein Gott oder mehrere Götter. Man hat euch so lange Ruhe damit gelassen. Es ist Zeit.“
Er beobachtete finster den Soldaten: „Nicht wahr, du willst Heide werden?“
Unruhig, gequält, drohend gab der zurück: „Ich weiß nicht.“
„Was weißt du nicht?“
„Ob Ihr Christ seid.“
Mit kaltem Ausdruck lächelte der Jesuit, indem er den Kopf langsam zurückbog. Der Soldat hob den Arm: „Ihr lacht!“
„Es ist niemand so Christ als ich.“
Dem an der Tür flammten die Augen: „Ihr wollt die Menschen der Verzweiflung ausliefern. Ich habe gebetet, mich gefreut, mich fähig gefühlt zu allen schweren Dingen — durch Gott. Das soll mir alles genommen werden.“
Der Pater setzte sich ans Fenster, schwieg.
„Das soll mir alles genommen werden.“
„Ja.“
Mit schüttelnden Armen: „Und wozu? Wem zu gut?“
„Lieber, nun werde ich wirklich bald lachen. Ich bin Priester der Kirche; was gehen mich Menschen an.“
„So geht doch hin, Pater, und sagt Eure Weisheit dem Papst, den Bischöfen und Mönchen. Sie sind für uns Menschen da.“
„Es ist nicht nötig, sie wissen es schon.“
„Und was sagen Sie?“
„Ja, sie kümmern sich nicht um Gott. Denn sie sind fromm. Sie helfen den Menschen, indem sie sie beschäftigen mit Andachten, Gebetübungen. Für das Christentum sind erst die wenigsten reif.“
Der junge Soldat: „Ich nicht.“
„Nein.“
„Ich wollte Gott wieder in mir errichten. Zu ihm wollte ich beten, mich zu ihm führen lassen. Zu ihm.“
„Nein.“
Wallenstein im Gespräch mit dem Venetianer Pietro Viko, der bei ihm Kreuzzugsideen, gegen den Großtürken, propagierte.
„Will der Herr mir Neuigkeiten erzählen! Ich hab’ in Gradiska für Ferdinand gekämpft. Wittelsbach ist größenwahnsinnig, den Kaiser Ludwig, den Ketzer, hat es nicht vergessen. Man hätte den Wittelsbacher zerschlagen sollen; nun sitzt er an der Isar, der dunkle Mann, prunkt und protzt sich auf, geizt und darbt. Ein Fürst!“
„Er wird dem Kaiser nicht übel zusetzen.“
„Ferdinand ist der beste Mann, ein Edelmann, ein Ritter. Er ist ein Kind. Wenn Ihr daran zweifelt, so seht den Ausgang dieses Kriegsübels an. Den guten Böhmen, meinen Vettern, sollte er den Schädel einschlagen. Er hätte nur nötig gehabt, sein Kaiseramt auszuüben. Aber er war ein Kind. Ich kann mir vorstellen, wie er damals glühte als Kaiser, mit dem Böhmersieg in der Tasche. Und so vor den Bayern zu treten!“
„Ja, er war nicht gut beraten.“
„In der Löwenhöhle ein Kalb verzehren wollen! Warum ging er gerade damals zu Maximilian? Weil München so am Weg lag. Versteht Ihr gut, die Wiener Herren Räte? Er mußte dem Münchener Dank sagen, sich ihm vorstellen. Sie konnten es nicht verhindern; die Herren hatten gerade etwas anderes zu denken.“
„Und da hatte ihn der Max!“
„Die Maus kam ihm spaßhaft vor die Schnauze gelaufen.“
„Haha.“
„Sie fraß ihn. Einmal gepackt, herumgeworfen, dann in die Gurgel geschnappt.“
Wallenstein sagte: „Herr, er hatte schon lange auf den Kaiser gewartet. Der konnte ihm nicht entgehen. Er hatte geholfen, ihm den Kaisermantel umlegen, aber nur um die Lust zu haben, ihn ihm herunterzureißen. ‚Zeig’ mal, was du anhast!‘ sagte der Max. Und als Ferdinand München verließ, hatte er schon fast aufgehört, Kaiser zu sein.“
„Euer Liebden: es sind Zeiten, die erfreulicherweise längst vorbei sind. Ihr werdet bald freie Hand für allerhand haben.“
Wallenstein lachte wieder grell: „Ich hätte in Wien sein mögen, als sie den Ferdinand aus dem Wagen holten von dieser Reise. Begossen, lahm, stumm. Und keiner wußte, was mit ihm war, und er hatte doch in Frankfurt gesiegt, war Römischer Kaiser, und den böhmischen Sieg hatte er damit schon in der Tasche. Was mögen sie sich gedacht haben in der Burg, die weisen Herren! ‚Der Kaiser ist krank, er ist schwermütig,‘ haben sie geschrien, morgens und abends, haben nach den Doktoren im ganzen Reich geschickt.“
„Es ist so.“
Maßlos lachte der Herzog: „Sie werden ihn weidlich zum Purgieren gebracht haben. Gebüßt hat er es, daß er sich hat beglückwünschen lassen von seinem Schwager Max.“
In das Dorf Bubna bei Prag, wo der Herzog eine Meierei besaß, kam eine Truppe Schauspieler Zauberkünstler und Quacksalber gefahren. Erst riefen sie ihre Künste bis nach Prag hin aus; dann schlugen sie einen Bretterzaun auf, bauten eine tiefe Bühne. Vom Herzog auf sein kleines Sommerschloß geladen, veranstalteten einige von ihnen unter großem Geheimnis eines Nachmittags eine besondere Belustigung.
Ein großer Saal stand ihnen zur Verfügung; vornehme Herren und Damen besetzten die Balkons und Galerien; Dienerschaft drängte sich an der offenen Tür. Von den Balkons und Galerien führten Wendeltreppen in den Saal; zu Beginn der Unterhaltung rief von der Tür ein maskierter Schauspieler — er hatte kothurnartige hohe Stiefel, ein griechisches weißes Faltenkleid, trug einen mit Blitzen versehenen Keil in der geschlossenen Rechten; der hoheitsvoll düstere Ausdruck des Zeus —, man hätte davon abgesehen seitens der Truppe, sich am Spiel zu beteiligen. Man möge heruntertreten in den Saal, wer Lust habe. Es werde absonderliche Freude geben.
Im Saal herrschte eine ungeheure Hitze; blickte man von oben herunter, so brodelte und wogte die Luft über dem gefügten Holzboden wie in einem Ofen oder über einem Brand. Die aber unten gingen, merkten von Hitze nichts, auch hatten sie keine Beklemmung der Brust. Aufrecht und übergroß spazierten über die Diele zwei braune Schimpansen, die sich von Zeit zu Zeit auf die Hände fallen ließen und dann rasch liefen; sie kletterten an Säulen hoch, blickten spuckend mit weisen Gesichtern nach der Galerie herüber, ließen sich wieder herab, zeigten vierfüßig jagend ihren hohen Steiß. Woher sie gekommen waren, wußte man nicht. Unten tauchten immer neue Wesen auf; es war nicht zu erkennen, woher sie kamen. Ein junges Fräulein riß sich auf der Galerie von ihrer Begleiterin los, sie wollte sich die kuriosen Affen in der Nähe ansehen. Wie sie die unterste Stufe der Treppe betrat, der heiße Brodem des Saals gegen sie schlug, rannte stürmte sie vorwärts: da lief ein nacktes Geschöpf, das auf der Stelle vor Übermut sprang, sich um sich drehte und jauchzte. Sie ging mit ihren runden rosigen Gliedern, prallem Leib langsam und ungeniert gegen den einen braunfelligen Schimpansen an, der gerade wie auf einer Eisbahn über den Boden rutschte. Ihr wuchs hinten aus dem Rückgrat ein armlanger peitschendicker schwarzer Schweif heraus, mit dem schlug sie ihm vor die Nase; sie trug noch ihre Silberschuh und bunten hängenden Strumpfbänder, ihre übervollen Brüste schaukelten, ihr blondes lockengedrehtes Haar wogte wie eine Kapuze über ihr stumpfnasiges vergnügtes Gesicht. Die beiden Affen balgten sich hinter ihr, dann schlangen sie die Arme umeinander, begannen so, einer den andern festhaltend, ihr zu folgen.
Dicht an der Treppe legte sich ein ernster kleiner Mann, nachdem er sich unglücklich hin und her gewandt hatte, ruhig auf die Diele, zog sich mit den Händen und Knien auf dem Bauch hin. Man trat ihn, schimpfte über ihn. Er bat um Entschuldigung, kroch weiter zwischen den Füßen, unter den Füßen. Bisweilen richtete er sich auf, verschnaufte ernst, sah wehmütig den andern ins Gesicht, ging wieder an seine Arbeit. Niemand unter ihnen wunderte sich über den anderen. Sie waren alle mit sich beschäftigt.
Eine ältere Dame mischte sich ein. Sie trug einen kostbaren Zobelpelz, den sie auch in der Hitze nicht ablegte, aber ihre Hände rührten von Zeit zu Zeit unruhig, während sie gespannt alle beobachtete, die Schnalle vorn an ihrem Hals, die den Pelz zusammenhielt. Plötzlich schrie sie gräßlich, dabei riß sie sich wie erstickend den Umhang auf. Und nun mit offenem Hals stellte sie sich breitbeinig hin an dem Fleck, wo sie war, bog den Kopf zurück, blähte den Hals auf, stieß hochroten Gesichts, während ihre hohe graue Perücke wackelte, einen eselsartigen Trompetenruf aus, mit Blauwerden der Lippen, Zittern der hochgehobenen Arme, die den Fächer fallen ließen. Darauf ging sie rasch, den Fächer aufhebend, die seidenen Röcke wedelnd, weiter, heftig atmend, gewissermaßen erleichtert. Um nach einigen Rundgängen langsamer und zögernd werdend, nach Zausen an ihrem Pelz, wie unter einer Eingebung das helle Geschrei von sich zu geben. Wobei ihr bald von rechts und links, auch von den Zuschauern, heftiges Gelächter antwortete, das sie mit Erblassen, entrüsteter Miene aufnahm.
Einem Offizier geschah, wie er sich in den Saal herunterbegab, ein großes Unglück. Er hatte vor, mit seinem Degen und seiner Muskelkraft der Galerie ein besonderes Schauspiel zu geben. Heimlich warf er sich die Treppe herunter, die letzten Stufen glitt er ab, prallte auf den federnden Boden. Und nun kam er nicht zur Ruhe. Er war wie ein kleiner holzgeschnittener Mann mit zusammengeschlossenen Beinen anzusehen, zusammengeschlossenen Händen, dickem Hals, dickem Kopf; er stürzte bald auf die Hände, da prallte er hoch; stürzte auf den Rücken, da wippte er um; kam auf den Bauch, schoß hoch, stand auf den Füßen, machte einen Schritt. Aber sein tretender Fuß warf ihn hoch; er mußte sich Mühe geben, auf den anderen Fuß zu kommen, und so schnellte er rechts und links meterhoch durch den Saal, immer bemüht, unten ein freundliches Lächeln gegen die anderen, nach der Galerie herauf zu machen, ihnen seinen Degen zu zeigen, seine gewaltigen Armmuskeln. Sofort hatte der Saal sich gegen ihn gewandt, warf ihn auf die Knie, schnellte ihn weiter.
Es kamen viel neue, überall aber war ersichtlich, daß die Situation Keime zu Erregung und Zwistigkeiten barg und daß man einem bösen Wesen gegenüberstand. Es wurde klar, als ein Geistlicher von oben sich entschlossen unter Mitnahme eines Gebetbuches in das Treiben hineinwagte. Auf der Treppe drückte er das Buch gegen seine Brust mit der Linken, mit der Rechten hob er sein silbernes Brustkreuz vor sich. So dachte er bannend in den Saal zu schreiten. In der Tat, sobald er erschien, geriet alles in furchtbares Toben, das Geschrei nahm überhand, die Figuren fuhren toll umeinander. Zugleich aber zog sich der heiße Brodem um ihn in sonderbar spiralig schwebenden Wellen, rauchartig zusammen; wie er mit seinem Kreuz schlug, hingen Flammen an den Spitzen; sein Gebetbuch öffnete er in herausfordernder Ruhe, die Blätter kräuselten sich, wurden gelblich, an den Rändern tief braun. Und jäh brannte das Buch; der erschreckte öffnete die Hand, das Buch loderte am Boden. Wie er das zusammenrinnende bläulich überlaufene Kreuz losließ und gegen die verbrannte Hand blies, seufzte er aus tiefem Herzen auf; er streckte, die Augen schließend, schwarzhaarig, langgewandig wie er war, die Arme sehnsüchtig aus: schon vergingen in den scharfen Luftwellen um ihn seine Talarröcke, die weiten Ärmel. Er konnte tanzartig gehen wie keiner im Saal, einen schmächtigen Jünglingsleib trug er auf langen Beinen, die in Leinenhosen steckten. Aus unverschleierten großen blauen Augen blickte er, er sang hymnisch. Hell trillernd, alle siegreich übertönend, klang seine Stimme; so schön und freudig schmetterte er, daß die auf den Galerien sich mit kleinen Augen scheu ansahen, von gleichgültigen Dingen sprachen und das Beben in sich unterdrücken mußten. Er hatte ein leicht albernes Jungengesicht mit Stuppnase. Einer der beiden Schimpansen zog ihn bald an den Ohren hinter sich her, ängstlich folgte man ihnen, von leisen Angstrufen wurde der Gesang unterbrochen.
Es wirkte verführerisch auf die Massen, die sich an den offenen Türen drängten. Die Türmeister hielten die Stäbe vor, aber die Lockung war zu groß. Man lief, während der Dunst des Saals schwoll, in kleinen Rudeln hinein, hatte sich noch eben die Hände gereicht, war im Saal wie auf dem babylonischen Turm, mit verrenkten Gliedern, hängenden Zungen, sonderbaren Gebärden, fremd gegeneinander, von einer ungekannten Rastlosigkeit und Befriedigung erfüllt. Man lief wie im Traum gegeneinander, prallte voneinander ab, lief wieder gegeneinander, konnte sich darin nicht sättigen. Sie sprangen, schoben sich mit irgendwelchen Begierden in den Saal und dann waren sie jäh entgeistert, absonderlich verloren und verwirrt. Ein paar edle Herren gingen streng durch die Menge, hoben die Arme hoch, schrien den Hut schwenkend: „Hier ist der berühmte edle Soundso, lobt ihn, ehrt ihn“; mit feierlicher Grimasse spazierten sie weiter. Fragte sie einer: „Was kann der Herr?“ antworteten sie: „Alles was man will; nichts ist uns verborgen. Lobt uns, ehrt uns!“ Sie breiteten die Arme aus, nickten würdevoll.
Pferde tummelten sich unter den Menschen, auf denen Männer saßen. Hunde sprangen lüstern umeinander, es war kein Hund in den Saal gekommen. Eine Anzahl Herren blickten nach lauten Ausrufen ihre Umgebung an, dann verunreinigten sie den Boden unter Gestank, wiesen darauf hin, schienen hochentzückt, wieherten vor Lachen. Eine furchtbare Erscheinung zeigte ein Mann, dem die Tränen aus den Augen troffen; ihm war der Kiefer bis auf das Knie gesunken; ungeheuer schnappend mit klaffenden Lippen hing das Maul mit armlangen Zähnen; der Schädel und das obere Gesicht stand trübselig klein dahinter, die blicklosen Glotzaugen und das vertrocknete Bäuchlein mit den Beinchen, die wie Stiele unten tripp-trapp liefen. Er hielt sich bejammernswert an einer Säule auf; von Zeit zu Zeit trippelte er, schlürfte schnaubte schnarchte grausig. Schnüffelnd sich einem Menschen nähernd, faßte er den erstarrenden schreienden eisern bei den Händen, schlug den Oberkiefer wie eine Zange über ihn, rang sich den gebückten strampelnden in den Rachen, saugend, blauwerdend. Unter dem entsetzlichen Gekeif der Zuschauer würgte er das Geschöpf in seinen anschwellenden Leib. Man schlug, spie auf ihn, er heulte, schluchzte; Tränen und Speichel liefen ekelerregend von ihm. Nach kurzen Minuten war das Treiben um den Stummen wieder wie vorher. Nur bläuliche durchsichtige Schatten von Menschen setzten sich neben ihn; das waren, die er verschlungen hatte: sie suchten von Zeit zu Zeit in seinen Mund einzudringen, um ihre Leiber zu holen, aber er sperrte krampfhaft die Kiefern, schnatterte grimmig gegen sie mit den Zähnen.
Atemlos schweißbedeckt drängten manche in einer unsicheren Verzweiflung zurück an die Treppe, an die Saaltür, hatten sogleich ihre alte Gestalt wieder, lächelten lispelten ängstlich. Sie fragten, hatten ein Zittern an sich, brachen in Gelächter aus, als man ihnen erzählte, was unten vorging, drängten stürmisch fort. Manche waren, kaum bei sich, von einer Traurigkeit befallen, saßen fassungslos da, bedeckten das Gesicht.
Unter der Hitze im Saale, dem wachsenden Andrang stieg der Lärm. Die Menschen fielen sich gegenseitig an. Sie bemerkten sich allmählich. Wer nicht fortgeschlichen war, fand sich in seiner neuen Heimat zurecht. Plötzlich schwang sich der Hoppser, der unglückliche Offizier, mit einer, dann einer anderen Dame in die Luft; sie schrie, er juchzte, improvisierte, wenngleich nicht Herr seiner Sprünge, einen ungeheuerlichen klatschenden Tanz über den Köpfen des Gedränges. Er riß dem Riesenmaul einmal einen halberstickten aus den Zähnen; das Brüllen des Enttäuschten, das Keuchen des Befreiten, der schlapp auf dem Arm des Springers durch den Raum segelte. Die Hunde lagen verbissen im Kampf mit den Affen bald hier bald da auf dem Boden. In einem rasenden Entschluß fiel der singende Jüngling, plötzlich verstummend, die vorübertänzelnde Junge mit dem Pferdeschwanz an; sie schlug ihm den Schweif um den Hals, er warf sie um; sie schrie kläglich.
Eine Stimme rief, während grausig Massen von Tieren durch den Saal wogten, Pferde, Kühe, Eber, während blitzartig manche Erscheinungen wechselten, sich überkugelten, rief: „der Herzog, der Herzog.“ Immer durchdringender rief sie. Eine Feuersäule ging durch den Saal, sie sauste wie ein Wasserstrahl, streckte sich langsam gegen die Decke auf; im Wandern äscherte sie Menschen und Tiere ein, die nicht auswichen. Der beizende Qualm wallte durch den Saal.
Da schlug man auf den Galerien und von außen am Saal die Fenster ein. Erschütternd rasselte das Geschrei aus dem Saal und von oben. Die Feuersäule bewegte sich nicht. Wie an den Füßen abgeschnitten brach sie plötzlich zusammen. Der Rauch schwelte über die Diele, legte sich dick über die Geschöpfe, die hilflos im Tumult kreischten und sangen. In Stößen drang frische Tagesluft ein.
Nach diesem alarmierenden Vorfall erlebte die Bevölkerung um Prag und an anderen Teilen Böhmens eine ganze Reihe Teufeleien. Zwei Teufel hatten sich in der Hölle von ihren Ketten losgemacht und schweiften über den böhmischen Boden. Sie suchten besonders die Gegend bei Aussig, an den Felsenwänden des Ziegenberges, am Waltheimer Tal heim, ließen sich in der Abenddämmerung blicken, scheuten bald frech das Tageslicht nicht. In den Monaten April Mai sah man sie über die dreizipfligen Gipfel des Sperlingsteins mit den Spießen im Rücken herumlaufen, langen wippenden mit Widerhaken versehenen Stangen, die oberhalb der Hüften in ihrem Fleisch saßen, mit denen man aus dem Höllenabgrund geworfen haben mußte, als sie entwichen. Sie taten in diesen Monaten, als trügen sie wie müde Knechte der Artillerie ihr Schanzzeug da hinten in einer Lederröhre am Leib und als mochten sie es nicht von sich tun. Man entlarvte sie aber mehrfach, als sie leicht berauscht am Schlosse Tetschen die Mäntel von sich taten und unversehens die Bedienten der Losamente nach dem lustig schaukelnden Gestänge zugriffen, um es davon zu tragen. Ein mordsmäßiges Geschrei, schrilles Keifen und Jaulen erhob sich, die beiden Gevattern warfen die Arme hoch, ihre Augen hingen ihnen wie Äpfel vor der Stirn, ihre Leiber bogen sich nach vorn unter den schönen Westen zusammen, die Stangen zitterten, klirrten metallisch auf den Dielen, jach sausten die Gesellen, Rauch um sich schüttelnd, heulend in den Schornstein, von den Spießen lief grüner Saft herunter, noch vom Dach klapperten und pfiffen sie. Gegen Ende Mai war es aber in der ganzen Gegend, in der sie sich herumtrieben, schon zu bekannt, daß sie entlaufene Teufel wären. Sie hatten einmal selbst davon geplaudert, daß man sie bei einem Aufruhr in der Hölle nicht hätte bändigen können, die Aufruhrsucht in der Hölle wüchse von Tag zu Tag, es werde alles krank und ließe es auf Gewalt ankommen; sie seien nur die Vorläufer von ganzen Scharen. Die beiden konnten sich darauf nirgends mehr sehen lassen, und eines Abends bemerkten Viehtreiber an der Berghalde bei Bodenstedt ein stumm ringendes Paar im Klee, das anscheinend mit Spießen sich zu Leibe ging. Aber es waren Teufel, die geschworen hatten, sich umzubringen oder sich von den Stangen zu befreien. Sie warfen sich in heißem Kampf rechts und links; wie Schwänze, die hochgehoben waren, zappelten an ihnen die Stangen; plötzlich hob der eine den andern, ein Knall, ein rasender Schrei, Wimmern; der eine lag bleich bewegungslos auf dem Rücken, die Lanze dreißig Schritt zersplittert vor ihnen, der Sieger kroch nach ihr, beschnüffelte ihr Ende, von dem das grüne Satansblut troff. Er richtete den Bewußtlosen auf, fuhr ihm mit dem Arm in den Rachen, holte die Zunge zurück, spritzte ihm seinen brennenden Harn ein, wobei der andre würgte, sich wand und wieder zu sich kam. Mit Baumrinde verpflasterten sie das sickernde Loch am Rücken. Dann bellten sie wieder gegeneinander. Der Sieger lief heulend vor Neid um den geraden schlanken andern; der nahm die abgebrochene Eisenlanze, band seinen Gefährten an einen Baumstamm und fing an, lustig auf dessen Stange zu klopfen, darauf ihn zu bespeien und, des Jammerns nicht achtend, zu ziehen, bis er rückwärts stürzte, vom grünen Saft begossen, und jener bald verreckt wäre. Entschlossen stemmte sich der andre an ihn, preßte, Rücken gegen Rücken, die Wunde zu, verstopfte sie mit Pech, das ihm zwischen den Zähnen hervorquoll, und mit dem Körper eines toten Kätzleins, das gerade vor seinen Füßen lag.
So erschienen sie einmal unversehens zu zweit mittags vor der Wegkreuzung bei Bodenstedt, als nackende buschige Teufel, mit trappsigen Pferdefüßen, roten Fellen, stieren Glotzaugen, das schwarze Haar in Strähnen nach rückwärts gestrichen, kaum größer als ein zehnjähriger Junge, rauh miteinander schnatternd. Die Vögel auf den Feldern schwirrten vor ihnen auf. Plötzlich schwirrten die Teufel selber als Raben hinter einer Magd her, über deren Schultern sie fielen, hackend mit ihren spitzen Schnäbeln in das blanke Fleisch. Das gräßliche Gebrüll der Weiber und Knechte; das Geifern der scheugewordenen Ochsen, Flattern der Hühner und Quieken der Schweine war grausig. Die Bauern verbarrikadierten sich in ihren Häusern, läuteten Sturm. Nach einer reichlichen Stunde kamen zwei modisch gekleidete edle Herren des Wegs, hatten Lehm an den seidenen bebänderten Schuhen, schienen ermüdet. Sie sahen erstaunt auf der toten Dorfgasse um sich, riefen sanft nach Menschen, nach einem Trunk Wein, spielten mit ihren Degen. Zaghaft öffnete man die Laden; man fragte aus den Fenstern heraus, ob sie nichts gesehen hätten. Aber die hatten nichts bemerkt; nur einen abscheulichen Gestank hätten sie, wie sie verwundert erzählten, gespürt, aber der könnte von verwesendem Vieh herrühren. Die Bauern hätten sich für geäfft gehalten, wenn nicht die stumpfsinnigen Stalltiere auch jetzt noch heftig um sich geschlagen hätten; das Loch in der Schulter der Magd bearbeitete noch eben der Bader. Sie kamen heraus aus ihren Türen, erwiesen sich beglückt, daß gerade jetzt zwei edle Herren des Weges kamen, denen sie vertrauen könnten. Der eine der Herren betrachtete durch sein Brennglas mit Grimm und Freude, die seine Lippen umwulstete, das Loch in der Haut der Magd; die fuhr jammernd zurück, lief über die Gasse, es sei nicht richtig mit denen, der eine sei der Teufel, der sie gehackt hätte. Allgemein verspotteten die Bauern, die über die Gasse strömten, die Verletzte, dienerten vor dem Besuch. Gerade auf die rabiate Magd hatte es aber der eine Herr abgesehen; er ließ sich noch einmal die besalbte Wunde zeigen, er wolle sie auf italienische Art kurieren. Das Mädchen weigerte sich, der Herr wütete, lachte gell und drohend. Die beschämten und empörten Bauern schoben in einem Häuschen die Widerstrebende ab, er wies stolz das andere Gesindel hinaus. Da drin saß er mit der Magd allein, saß vor ihr, blickte sie an, weidete sich an ihrer Angst. Und während er grinste und die Arme hinter dem Rücken verschränkte, sich seine Nase lang herunterzog, hatte er plötzlich einen dicken starken Schnabel, weitete hob sich sein loser Mantel mit plusternden Federn, saß ein Rabe auf der Bank, stieß mit dem Schnabel in die Wunde, pickte, hackte, riß. Er flatterte um sie, die aufgesprungen war und unter entsetzlichem Geblök um sich schlug, drängte sie ab von der Wand, aus einer Ecke heraus, fuhr ihr gegen die Stirn, vor den kreischenden Mund, kratzte. Er krächzte und freute sich. Mit einem Bein krallte er sich an ihrem Schürzenband über der Schulter fest, dann patschte er in die spritzende Wunde hinein, hier verkniffen tastete er mit dem aufgebogenen Bein ihren Mund ab, riß ihr von der Nase herunter Schramme auf Schramme. Sein dicker fedriger Rumpf drängte sich an ihre erblichene Backe, der Schnabel hackte; auf ihre Nase springend verteilte er nach rechts und links auf die hochstoßenden Hände Hiebe zwischen die Haarwülste, die er auseinanderzerrte, zerzupfte; die starken Flügel schlugen blendend vor ihre Augen. So vertieft war er in den hitzigen Kampf, daß er das Klopfen nicht wahrnahm. Erst als die Tür gesprengt platzte, ließ er wild von ihr. Die draußen sahen noch den mächtigen Raben, seine Federn flogen. Aber schon gleichzeitig saß da und kam ihnen entgegen der degenklingende Herr, zornsprühend, blitzenden Auges, fest gegen sie geworfen: was sie sich erfrechten, er sei eben dabei, den bösen Geist, der in sie gefahren, aus ihr zu vertreiben; da lägen die Federn, nun sei er verschwunden; wüste ungebärdige Tröpfe und Tölpel, die sie seien. Die Hände hatte er auf dem Rücken; als er sie vorholte, waren sie bis an die Knöchel blutrünstig. In ihrem Schrecken sagten sie nichts, ließen ihn durch, die Magd schlug bewußtlos und schäumend um sich am Boden. Beim Wein in der Kammer des Pfarrers beruhigten sich die beiden Herren; sie feierten lärmend den Nachmittag über, bis gegen Abend der verwirrte Geistliche sich ermannte nach der Spätmesse; er wolle sie examinieren, was ihm und dem Dorf die Ehre brächte, von wannen des Weges sie kämen, dann —.
Und während er in der Küsterei nachdachte, war ihm schon, als wenn er wuchs, als wenn etwas Geweihtes aus ihm sprach; fast zornmütig war er und kaum zu halten, sich auf den Weg zu machen. Denn auch die andern Bauern hatte ein Verdacht ergriffen, sie standen vor dem Kirchlein, munkelten miteinander, fürchteten sich. Steckten die Köpfe in das Fenster des Pfarrhauses, die Gäste waren ausgeflogen. Der eine von den beiden, der sich im Hintergrund gehalten hatte, ging pfeifend in der Nachbarschaft herum, hatte Interesse an den Kornhäusern Backöfen Vorratskammern Viehställen, fragte rechts und links seine katzbuckelnden Begleiter, wovon sie meist lebten, was sie am meisten quäle und betrübe. Es war Mißwachs im Jahr gewesen, lange hatte der Regen gedauert, eine kurze Spanne, kaum eine Woche schien die warme Sonne, und man mußte mähen und einbringen, das schwarze Mutterkorn fiel über die Ähren. Der Edelmann, gänzlich unorientiert, sog die Neuigkeiten ein. Seine eindringlichen Fragen waren kurios; wenn aber welche aus dem Haufen über den Herrn lachen wollten und schon daherpolterten, so sah er blitzrasch mit einem gräßlichen ins Herz schneidenden, Blick an ihnen herunter; sie faßten sich an die Brust; es schien, als ob kein Mensch so schnell die Augen bewegen könnte. Zischend, leise, zum Boden schauend, fragte er nach seinem Freund, verschwand im Augenblick um eine Ecke. Schon schoß er wieder gegen sie, scheltend, wo also sein Freund wäre, ob sie ihm ein Leids angetan hätten, er wolle sich beschweren bei der Landeshauptmannschaft, bei der Prager Statthalterei, haderte, schrie, er wolle doch einmal wissen, wo sein lieber Geselle sei. Eine schwarze Henne gluckerte vor ihnen auf einem Dach; er krähte, gackerte sie höhnisch an, schlüpfte, über die Schulter weg den anwandernden Pfarrer erkennend, ihm den Hut entreißend, in die offene Kirche, gackerte noch grinsend an der Tür, er wolle seinen Freund suchen. Und schon schallte der Raum innen wider vom Toben, Lachen, Klatschen. Gegen den Pfarrer höhnte er hinter dem Altar: „Bring’ mir mein Brüderlein“, jauchzte, lockte, der Pfarrer suchte ihm den Hut zu entwenden, ein kalter Schleim sprühte ihn an, er wich voll Ekels zurück, stürzte im Entsetzen die Turmstiege herauf, riß das Glockenseil. Alarm läutete er über das Tal und die Nachbartäler. Die Nachbardörfer antworteten, er gab nicht nach, unablässig unter dem höllischen Krachen und Getobe unter sich riß er die Glocke und ließ sie sausen. Vom Altar zu den Beichtstühlen hüpften sie, kauzten schmutzverbreitend auf den Heiligensäulen Kruzifixen. Mit Wagen Äxten Feuerspritzen Löscheimern knarrten und trabten die Nachbarn an, staubend auf den Alleen. Der Pfarrer, angsterstarrt, sah und hörte im Regen und Anspannen seiner Arme nichts mehr. Auf dem Turm stand er noch, als die Glocke plötzlich hochanschwingend aus dem Stuhl flog, auf die Straße wuchtete und berstend ein Schwein erschlug. Der gleiche Schwung riß ihn zur Seite, er wehte der Glocke nach, zerknickte kopfaufgestellt. Der Raum selbst der Kirche begann zu beben, sich zu dehnen, zu weiten, ein Dunst von Kalk rann an ihren Wänden herunter, im Kirchturm klaffte plötzlich ein Loch, daraus zwischen fallenden Steinen zwei kupferrote geschwänzte Gestalten vorstießen im Zickzack. Aus der Luft meckerte es. In dem Tumult unten fielen sich die Dörfler an; die Nachbarn glaubten sich gefoppt von den Einheimischen, in rätselhafter Weise flammte bei den Leuten eine dunkle Wut auf, sich zu zerfleischen und zerkratzen wie unter einem wilden Juckreiz. Die Glocken der Nachbardörfer dröhnten; von Bergen herunter, die Bäche entlang wälzten sich schreiende Menschen, gräßlich tieffaltige Gesichter, dicke pralle Lippen, stöhnende Brüste, von der Arbeit, vom Essen, vom Schlaf aufbrechend, wo sie standen und lagen. Unten an dem geborstenen Kirchlein schlugen sich, zerrissen sich die verwirrten, sich selbst nicht kennenden Männer und Frauen. In den Kessel mußten sie. Wie sie stockten im Gedränge, schaute einer betrübt und leidend dem andern an den Hals, griff ihm um die Kehle; es war die Not einer gräßlichen zähneknirschenden umdampfenden Lust.
Die Bauern warfen ihre Pflüge hin, schickten die Weiber zum Vieh, saßen, sich die Mäuler schleckend, finster vor ihren Häusern und Ställen. In manchen Landschaften drängten sie zusammen, trollten über die Fluren, fanden ein Behagen darin, sich wechselseitig zu sehen und zu befühlen. Ziellos liefen sie in die Wälder ab, rotteten sich um die Herrschaftshäuser, zerstoben wieder auf die Felder. Sie standen haufenweise in einer stummen Gebanntheit, ratlos, mißtrauisch, mit stockenden Säften vor den kleinen Holzstandbildern an den Wegen, den Kruzifixen. Hier jagte sie keiner fort. Grimmig beschnüffelten sie das Holz. Verächtlich schrie einer: „Wir haben keinen Grund, hier stehenzubleiben. Wir ziehen unserer Wege.“
„Wir bleiben schon hier.“
Sie sahen sich prüfend an, schoben sich zusammen, fühlten wieder die Kraft der Nachbarmuskeln, schoben sich dichter. Enger kreisten sie das Kruzifix ein. Die hinten standen, fühlten sich ferngehalten, drängten heftiger, von ihnen lief der Ruf nach vorn: „Das hat nicht auf unserm Acker zu stehen.“ Und dazu tönte grelles Lachen.
„Christus, Christus!“ dumpften die vordern, schon fast die Säule berührend.
„Die Pfaffen haben ihn hingestellt.“
„Sie wissen, warum sie’s tun.“
„Zieht die Mützen ab! Daß ihr wißt und nicht vergeßt, was man vor dem zu tun hat. Der Herr Pfaff hat ihn hingestellt.“
„Das hat nicht auf unserm Feld zu stehen.“
In ihnen allen krampfte der Drang, etwas zu tun; von Muskel sprang es auf Muskel.
„Werft es um.“
„Die Schandsäule um!“
„Schandsäule.“
Jeder Schrei hatte die Kraft, fünfzig neue nach sich zu ziehen. Wehrlos, schaudernd wurden die vordersten, fast Anbetenden gegen die Säule geworfen; mit ihren Gliedern brach die Menge den Holzstock entzwei, zerknisterte ihn. Dann wußte man, was man wollte; man wogte weiter auf die nächsten Kruzifixe; es war eine Jagd auf die Säulen des Gekreuzigten.
Aus den zurückliegenden Häuschen auf den gepflügten Berghängen sah man ihnen vergrollt, vertattert zu, schloß sich in die Stuben ein: „Auch damit ist es nichts! Sie schaffen’s nicht.“ Der graue Vikar der Gemeinde, plötzlich angesteckt, zerknüllte seinen Talar, hatzte zu seiner Herde herunter, hielt mit stürmischer Brust eine tobende Predigt: es sei geistliches Werk, was sie täten, er nähme sich ihrer an, man hätte ihnen Christus gestohlen, einen falschen untergeschoben. Die Menge verschlang ihn; sie war nur Sturmbock, Stoßbock gegen die Holzsäulen. Aber immer wieder machte er sich frei, von allen Seiten wuchs das Geschrei, man war glücklich nachzustammeln: „Man hat uns Christus gestohlen. Das ist nicht unser Christus. Das ist der Christus der Herren, der Fürsten, der Ritter. Glaubt mir! Der falsche Christus. Zur Fron steht er hier. Sie haben Burgen gebaut mit Kartaunen, Wällen, Gräben, Mauern, um uns zu unterjochen. Die Kirchen sind Burgen. Der Heiland wollte uns befreien davon; sie haben ihn in die Kirchen geführt, gefesselt, eingeschlossen. Auf den Äckern steht er, damit wir wissen, daß wir dienen, daß wir Knechte zu bleiben haben. Kommt, ihr Mühseligen — hoho, kniet, ihr Mühseligen. In Rom steht er in der Petersburg ganz aus Gold. Der Satan hat sich des Heilands bemächtigt. Er hat ihn gestohlen!“
„Wir müssen ihn befreien!“
„Der Papst ist im Bunde!“
„In die Kirchen.“
„Rettet Jesum!“
Von Aussig und Tetschen kamen Männer und Frauen gelaufen, die Scharen vergrößerten sich; die Masse gereizt, tatdurstig; dabei in der Tiefe gepeinigt von dem Gefühl, falsch zu laufen, immer wieder stockend, sich beruhigend. „Wir fordern das Evangelium Jesu, das die Herren uns geraubt haben.“
„Betrüger! Schelme!“
Und doch lief man nicht wider die Herrschaftshäuser, auf die Edelgüter, sondern durch die Dörfer gegen die Kirchen. Und unter dem Gefühl des Irrlaufs wuchs die Wut. Sie schrien, gegen die Haustüren schlagend: „Machet auf! Gebt Christus heraus! Sein Bild her aus den Häusern. Es ist der Falsche.“ Sie rissen Mistwagen aus den Ställen, spannten Ochsen davor, stapelten Kruzifixe, Bilder, Gebetbücher darauf. An den Fenstern weinten die Frauen, die Kinder erschraken vor ihren Vätern, die sie nicht ansahen. Ein junger einäugiger Bauer aus Aussig, ein ehemaliger Mansfelder, weinte brünstig, die Arme windend vor dem Stapel: „Besudelt hat man unsern Herrn Jesum Christ. Du warst nicht unser Schild, denn wir haben dich nicht gekannt. Es war nicht unsere Schuld, wir haben es nicht gewußt. Es war nicht unsere Schuld, daß wir deiner so spät gedenk sind. Verzeih uns Sündern!“
Viele brachen in der Nähe in die Knie nieder. Angstvolles Rufen: „Jesus, Jesus!“ „Verzeih uns!“ „Erbarmen!“ Die Starken, Grollenden ließen sich nicht bewältigen: „Wir wollen ihn retten!“ Einer drängte sich durch, mit Schwimmerstößen gelangte er an den umzingelten Ziehbrunnen; als er am Schwengel zu reißen begann, wich man rechts und links ab. Wie ein Tiger schleppte er den vollen Eimer an den Wagen. Sie verfolgten aufmerksam seine Bewegungen. Er goß im Schwung Wasser über die Kruzifixe, schreiend mit wilder, überschlagender Stimme: „Die zweite Taufe. Es ist geschehen!“ Freudig, mit aufgehobenen Armen betrachtete er das triefende Gehäuf, auch um ihn hob man dumpf sich hingebend die Arme. „In die Erde!“ brüllte der Täufer, fanatisch sich schüttelnd und erbleichend. Sie schoben, automatisch gehorchend, den Wagen aus der Gasse; auf dem ersten Wiesenanger hieben sie mit Piken ein Loch, versenkten die Kruzifixe, auch die schönsten mit den milden Gesichtern und den weinenden Frauen am Fuß. „Sein Leib in die Erde. Er selber auferstanden von den Toten, wohnt im Himmel über uns.“ In das Gewimmel, das sich weiterschob: „Nachdem uns alles so gut gelungen ist, wollen wir zu Prag dem Statthalter sagen, was wir getan haben und was wir denken?“ Mit grimmig fletschenden Zähnen der berserkerhafte Täufer: „Wollen wir nach Wien zum Kaiser und ihm sagen, daß wir die Herren nicht mehr wollen und keine Gewalt wollen und nur Jesum Christum und den Römischen Kaiser über uns anerkennen. Wir verlangen Verantwortung für die Schändung unsers lieben Heilands, man soll uns Jesum wieder ausliefern. Und Buße zahlen.“ „Buße!“ „Buße!“
Leute, die hinzu liefen, fragten: „Wo wollen wir hin?“
Von hinten, aus der Mitte: „Wo ziehen wir hin?“
Kaiser Ferdinand erlebte mit tiefem Glück, wie das deutsche Reich unterjocht wurde. Es war sein Entschluß gewesen, der diese grausige Maschinerie Wallenstein in Bewegung gesetzt hatte, er allein hatte verhindert, daß man die Maschinerie hemmte, sie arbeitete weiter. Rechts und links standen sie an seinem Hoflager auf, um seine Wonne zu schmälern, er sah mit ungestörter Ruhe zu, zwinkerte mitleidig, hoheitsvoll. Fürst Eggenberg war zu nüchtern auf Sicherheit bedacht, konnte nicht spielen, nicht gewinnen; gut, daß er so war, man konnte sich seiner bedienen. Trautmannsdorf hatte Mut, aber er trug an seinem Buckel, liebte es an der Sonne zu liegen und behaglich aus dem Winkel zu kläffen. Freudig grunzte der große Lamormain, roch den großen Braten, der der Kirche im Norden bereitet wurde; damit war es genug, sonst hieß es mäkeln, ihm war niemals recht geschehen. Herrn Meggau flossen die Gelder nicht rasch genug her, Graf Strahlendorf ächzte über die fatale Armee, die nur halb katholisch war, als ob eine Unterwerfung durch protestantische Hand weniger nachdrücklich wäre als durch katholische. Und was machte in München der entthronte Max, jetzt nicht mehr Kaiser im Reiche, sondern Fürst unter vielen, ein zähneknirschender. Das Abenteuer hatte er in schon grauer Zeit heraufbeschworen, ohne ihn wäre der Herzog von Friedland nicht in die Höhe gekommen und angenommen als kaiserlicher General; der Kaiser war ihm Dank schuldig, aber der Bayer war nicht froh über den Lauf der Dinge, es schien so, es schien ganz so, ihm behagte nichts mehr im Reich, Opfer sein machte keinen Spaß. Und Sieger sein dem Friedländer nicht. Den trieb es als sein Verhängnis um, er hatte ein böses giftiges Blut in sich; wenn er Niedersachsen erobert hatte, drängte es ihn nach Dänemark; wenn Dänemark dalag, war Bethlen nicht ruhig; war Bethlen besänftigt, reizte der Türke; der Friedländer war das heiße Schwert, das zu schneiden verlangte, man mußte ihn halten, regieren. Ihm aber, dem Kaiser Ferdinand, war alles durchsichtig; für seine Frömmigkeit hatte ihm die Mutter Gottes diese Menschen und das unterjochte Deutschland verliehen. Der Kaiser, der in diesen Monaten nach der Zerschmetterung der Dänen und Niedersachsen, noch gelb vom Sumpffieber, in der Burg, in Wolkersdorf und Schönbrunn herumwankte, blickte den Dingen scheu und mit einer kichernden Verliebtheit unter die Augen, er empfing sie geheim und stumm wie ein Einsiedler, der Hirsche Rehe in seine Hütte einläßt. Der Zermalmung der Feinde in Schlesien schaute er mit einer schmerzlichen Gespanntheit zu, dann war plötzlich ein Faden in ihm gerissen. Er war plötzlich hellsichtig geworden. Die ungeheuern Märsche kamen, die Siege, er wußte sie vorher; ihm kam vor, er wußte noch vielmehr; manchmal schien ihm, als ob Wallenstein sein Vertrauter war, aber die kalten Meldungen zeigten ihm, daß der Herzog nicht wußte, was vorging. Und so wälzte sich geheimnisvoll leise der Krieg ab vor seinen Füßen; am Hofe tobten ekstatisch die Menschen über die Erfolge, die lauten Glocken dröhnten über Holstein, Pommern. Ferdinand erfüllte sich mit wachsender Ruhe und Scheu. Er wurde behutsam, stille; sein Schicksal sah er draußen sich abspielen. Eine ungeheure Hand wurde sichtbar in diesen von Kriegern Pferden Kanonen getriebenen Ereignissen, die Krieger wußten nicht, was sie taten, warum sie fielen, die Pferde liefen und glaubten den Lederzügeln und dem Kutscher zu gehorchen, die Kanonen waren aus Bronze und keiner glaubte, daß mehr als die Geschicklichkeit der Bedienung die Stein- Blei- und Kettenkugeln lenkte. Eine Hand schrieb für den Sehenden in den niedersächsischen und holsteinischen Boden, Zug um Zug wurde die Schrift deutlicher.
Die Kaiserin sollte daran teilnehmen. Ferdinand dachte wenig an sie, so innig er auch mit ihr zusammen war, mit ihr spazierte, ausfuhr, ihr Geschenke brachte. Er ging mit einer Schöpfung von sich um, einer sanften aufsaugenden Frau, die nur Gewalt in der Inbrunst besaß; eine Gnade des Himmels hat sie ihm zugeschoben, sie war der schwingende widertönende Raum in seiner Seele. Jetzt zeigte er ihr, in der verschlossenen Sänfte mit ihr über Maienhügel fahrend, mit kleinen Sätzen, wie sich draußen alles fügte. Ferdinands Gesicht hatte sich von der Krankheit noch nicht hergestellt; einen fast kahlen kleinen Schädel, von faltiger Haut überzogen, bewegte er auf einem schlottrigen Hals, sein frierender eingefallener Leib verkroch sich, eingeschnürt wie ein Igel, in die braunen und gesprenkelten Pelzmassen, Hände und Füße tremolierten viel. Die weißblauen Augen ließen es sich genügen, geradeaus zu blicken. Er flüsterte demütig: „Wir sind ein Werkzeug des Allmächtigen. Die Gebete und Fürsprachen sind nicht umsonst gewesen.“
Die Mantuanerin, aus allen ihren Zusammenhängen gelöst, ließ sich schon fast willenlos treiben, das Gefühl einer tiefen Sündhaftigkeit wurde sie nicht los. Knirschend beugte bog bäumte sie sich neben ihm zu der Rolle, die er ihr zuschrieb; immer wieder vergewaltigte sie sich mit Graus und Wonne, bog sich für ihn zurecht. Das lombardische Geträllere, süß, frei, mit der Lust einer reinen, hellen Landschaft um sich, die Erinnerung an ländliche Tänze, bunte Kleider, Feste mit sich tragend, vermochte sie nicht mehr zu hören, oder mit einem Hohn, der ihr selbst schmerzlich war. Was die Kirche war, daß es eine Kirche, eine seligmachende heilige Kirche geben mußte, wurde ihr verständlich in ihrer Sündhaftigkeit, rettungslosen Selbstentfremdung; in Gebeten schmiegte sie sich neben den Kaiser, es gab eine reine und selige Gemeinschaft zwischen ihnen, die alles entsühnte, da konnte sie ohne Zittern mit ihm wandern; wenn sie so bleiben konnte mit ihm. Sie wurde Stifterin von neuen Orden; alte zerfallene lockte sie an sich; der Gnadenschatz, den sie sich erwarb, mußte ihr das Leben erleichtern, Dunkel über den Weg gießen, den sie ging. Sie entdeckte mit selbstmörderischer Freude, daß ihr die härtere kühle Luft des Landes zunehmend mehr behagte, daß sie in Straßen fuhr, als wenn sie hier zu Hause wäre. Nur die Fremden, die aus Savoyen und Mantua sie besuchten und sahen, fanden, daß sie mit ihren unnatürlich aufgerissenen Augen nicht mehr zu erkennen war, daß sie wie vom Gram zerschnitten war, bezogen es auf ihre Kinderlosigkeit.
Und wie der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches versunken in die Höhe geschoben wurde von den Siegen, die ihm eine himmlische Macht zuwies, drängten sich im Reiche seine Parteihalter zusammen, sich des Raubs der Siegesbeute zu bemächtigen, wo er sich greifen ließ. Ihre heißen Augen lagen auf den beiden Erzbistümern, zwölf Bistümern in Niedersachsen, mit dem berühmten Magdeburg, Bremen, Halberstadt, Merseburg, Lübeck. Man konnte sie jetzt anpacken, nach denen man solange lüstern war; die Hochstifte waren die Zeugen des Niedergangs der katholischen Macht. Langsam, kaum merklich waren sie in protestantische Hände abgeglitten. Die trüben Zeiten waren vorbei. Unter den ligistischen Mitläufern des Kaisers hörte das Geraune nicht auf, als das Gesicht des Krieges sich unverhüllt zeigte, lächelnd gegen die Wallensteiner, finster gegen den Dänen. Man zog den Kaiser nicht ins Geheimnis, plante mit Ansprüchen an ihn heranzutreten als zu einer Kompensationsforderung bei seinem Machtzuwachs. Die feinhörigen Herren in Wien fingen ihnen das Wasser ab, besänftigten die Wut und das Widerstreben gegen das Vorgehen des Friedländers, indem sie die Rückgabe jener Stifte als mögliches Zugeständnis des Kaisers in Aussicht stellten, nach dem Siege, nach dem Siege. Sie wurden kirr; inzwischen konnte ungehindert der Kriegswagen des eisernen Böhmen über Niederdeutschland fahren. Wenn erst der Böhme und mit ihm der Kaiser in Glorie und Furchtbarkeit flammen werde, werde die Verhandlung über jene Ansprüche ein andres Ansehen bekommen, wie man wünschte: dachten die Räte.
Die geistlichen Herren traten einzeln und in Gruppen in Wien auf; vor dem Reichskammergericht erschienen ihre Abgesandten, vor dem Reichshofrat. Klein war ihr Rechtsgepäck, um so schwerer; es war sicher nach den Friedenssatzungen des vergangenen Jahrhunderts, daß zahllose Güter Erz- und Hochstifte sich in falschen Händen befanden, — wenngleich inzwischen Land und Herrschaft protestantisch geworden war. Aber der Kirche war ihr Besitz entrungen, ihr war nach dem Buchstaben Unrecht geschehen, wie einem Kranken Unrecht geschieht, der nicht essen kann und dessen Speisen unterdessen die Gesunden schlucken. Erregter wurden die Forderungen der Prälaten, je mehr der Hof an sich hielt; Prämonstratenser verlangten ihre Klöster im Erzstift Magdeburg wieder, kaum wäre noch der kleinste Teil der Menschen dort katholisch; Benediktiner regten sich. Unverzüglich, schrien sie in Wien vor den Kammern — und um so hitziger, als die Pracht um sie zeigte, welche Summen aus den eroberten Ländern herflossen —, sogleich sollten jene unbefugten Inhaber die Güter ausräumen und abtreten, samt allen noch vorhandenen Fahrnissen; durch Nachlässigkeit der Geistlichen, durch List und Gewalt der Ketzer sei ihnen ihre Habe entzogen, tausend Seelen um ewiges Heil gekommen. Wie Gläubiger schwirrten sie um die Wiener Burg, schnarrten vor dem ernsten träumenden Kaiser. Er verlangte sie nicht vor sich, als ihm Fürst Eggenberg von dieser Bewegung unter den Altgläubigen erzählte: „Ich bin nicht Kaiser für die Benediktiner und Prämonstratenser.“ Ein zähes Äbtlein, Kaspar geheißen, von dem Prager Kloster Strahow, verstand es, sich einzuschmuggeln, prahlend von seinem verlorenen Kloster Sankta Maria zu Magdeburg zu schwadronieren, auch von den Klöstern Gottesgnad und Jericho im selben Erzstift, bis Ferdinand ihm seufzend ein Zettelchen bot, das eine Anweisung auf den Geldbetrag dieser Klöster darstellte. Damit war Kaspar nicht zufrieden; Prälaten, die davon erfuhren, sahen darin nur ein Zeichen des kaiserlichen Widerstands. Abt Anton von Kremsmünster war Benediktiner, wußte von säkularisierten Gütern seines Ordens; er wandte sich an Eggenberg um Hilfe. Die beiden alten Freunde lächelten sich an: „Ich will Euch nur wiederholen, was die Majestät zum schlauen Kaspar sagte —, daß sie nicht bloß Kaiser der Mönchsorden sei.“ Antonius meinte, es könne doch niemand durch Ausführung von Rechtsbeschlüssen gequält werden, die Leidtragenden seien Ketzer, Rebellen. Eggenberg hob die Hand: „Er will nicht.“ „Er wird wollen, Eggenberg. Man kann es verschieden ansehen, man kann aber auch sagen: es ist nicht schön, am vollen Tisch tafeln und andere hungern lassen.“ „Es ist nicht so, Ihr verkennt ihn.“ „Ich weiß, es ist nicht so. Aber wir wollen tafeln.“
Und die andern schrien nicht mehr Hunger, sondern schon Rache an den Protestanten für die Ablösung jener Stifter und Güter. Der hitzige Abt von Strahow sprach offen aus: Die Kirche habe in der Agonie gelegen vor Jahrzehnten, da sei das Luthertum über sie hergefallen und habe sie ausgeplündert; Leichenraub sei geschehen; das Unrecht muß beseitigt werden, Strafe muß folgen. Mit Strahow sprach ein Profoß der Jesugesellschaft in Wien, sie gingen vor einem wachsenden Klosterneubau hin und her; der Jesuit lobte den Eifer des Abtes, lobte seine Argumente, fand sie nur unvollständig. Und den sehr erstaunten Abt beglückte und stärkte er mit dem Hinweis, zum Leichenraub gehörten zwei, einer der stirbt, und einer der lebt. Ist es ein Verbrechen des Luthertums gewesen, daß es damals lebte; ist es ein Ruhm der heiligen Kirche gewesen, daß sie fast hin war? Wenn Unkraut auf dem Acker überwuchert, kann das Korn nicht gedeihen; wenn das Unkraut ausgerissen ist, findet das Getreide Platz: da ist Recht und Unrecht. Nicht beim Unkraut und Korn, wohl aber beim Gärtner und Bauer. Die Kirche hat Gärtner gehabt, die ihre Äcker nicht gepflegt haben. Jetzt werde man alles nachholen und sich nicht hindern lassen. Heraus mit dem Unkraut; Raum für das blühende Getreide.
Die Kirchenherren erreichten, daß der Abt von Meggau sich an den Herzog von Friedland mit einem Schreiben wandte, was er der Majestät rate und welche vermutlichen militärischen Folgen sich aus einem Zugeständnis ergeben würden. Der Herzog saß in Wismar, organisierte eine deutsche Kriegsarmee gegen Dänemark und arbeitete der drohenden schwedischen Invasion entgegen. Er gab schriftlich von sich, daß man ihn nicht mit Politik befassen möge. Herr von Strahlendorf, Fürsprecher der Rückgabe im Geheimen Rat, drang in das Wismarer Rathaus ein. Was, fragte Friedland verärgert den edlen Herrn, an dieser Angelegenheit denn so wichtig wäre, daß man einen besonderen Befrager an ihn entsende. Als Strahlendorf mit Wärme dargelegt hatte, welches Unrecht der Kirche geschehen sei, schloß der hagere General kurz und den Herrn an die Tür drängend, die Kriegstage erlaubten ihm keine langen Debatten; gehörten die fraglichen Güter der heiligen Kirche, so würde das Reichskammergericht das Urteil fällen; er käme nur für die Exekution in Frage. Erst bei den stockenden Bemerkungen des langen Grafen, daß der Kaiser nicht recht für die Sache zu haben sei, wurde der General aufmerksam, warf seinen schlauen stechenden Blick. Er ließ seinen Freund, den jovialen Arnim von Boitzenburg, in das Zimmer rufen und fragte ihn, den Protestanten, in Gegenwart des kopfsenkenden Grafen, ob er Lust hätte, Magdeburg für die Katholiken zu erobern. Und auf das Erbleichen des Mannes und sein unsicheres finsteres Hin- und Herblicken; gab er ihm die Hand: dies sei ihm nicht zugedacht von ihm, dem Herzog, sondern — irgendwoher, wo man anscheinend Hunger hätte nach dem Rind, aber keine Leine, es zu fangen. Er möge nicht beunruhigt sein, für dies Rind hätte er auch keine Leine. Dies sei, schmähte er nach der Entlassung Arnims gegen Strahlendorf, seine Antwort an ihn: der Krieg habe nichts mit Religion zu tun, man möge nicht Schwierigkeiten machen. — Aber er sei doch Katholik, hob nach langer Pause der Graf den Kopf; ob er es nicht für billig ansehe, Vorteile, die sich aus der Kriegslage für die Religion ergäben, zu benutzen. — „Man denkt vielleicht wieder“, sagte der General, „mir einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Wenn ich katholisch bin, ist es meine Sache; mag den Herrn nicht scheren. Ich lause Rebellen in derselben Weise, ob sie katholisch oder lutherisch sind.“ Darauf wiegelte sehr ruhig Strahlendorf ab, es sei nur eine Anfrage gewesen, die er nicht verübeln wolle; es gäbe in einem Reich vielfache Interessen, regten sich viele Wünsche. Mißtrauisch betrachtete ihn Wallenstein in der Nähe: „Der Kaiser ist wohl dem und jenem zu stark geworden. Möchten ihn etwas zwicken. Möchte wohl auch der und jener im Trüben fischen. Laß er sich nicht zum Werkzeug verkappter Schelmereien machen.“ Strahlendorfs Abschied war nicht gnädiger als sein Empfang.
„Man will ihm an den Kragen,“ streckte Friedland die Arme über sich am Fenster, als Arnim nach Strahlendorfs Abschied wieder eingetreten war. „Sie wollen ihn unter den päpstlichen Hut drücken. Er ist ihnen zu groß, schon jetzt viel viel zu groß.“
„Fühle sich Herzogliche Gnaden nicht durch mich gebunden oder beengt in ihren Entschlüssen. Arnim kann in Boitzenburg seinen Kohl bauen, oder bei den Polen fechten.“
„Es liegt nicht an Euch, Herr Bruder. Hab’ er vielen Dank. Man will ihm an den Kragen, dem Kaiser. Das ist es.“
Er stieg durchs Zimmer: „Sieh da, sieh da, die Liga lebt noch. Man wird den Herren den Kopf vor die Füße legen müssen.“
In Rom residierte im goldenen Vatikan ein Panther, Maffio Barberini, der achte Urban. Man konnte nicht sagen, er verstünde seine Zeit nicht. Zur Macht war er gekommen, indem er beim Konklave beiden Parteien schwor, er sei der Todfeind des andern. Über den Eingang seines Theaters schrieb er, er denke nur an die Sicherheit der Kirche. Vierzigtausend Mann konnte er aus dem Rüstzeug des päpstlichen Arsenals bewaffnen. Das Castell Franco baute er an der Grenze des Bolognesischen, armierte in Rom Sankt Angelo. In Tivoli arbeitete seine Waffenfabrik. Er wollte statt marmorner Denkmäler eiserne. Als jenseits der Alpen der Krieg auf die Höhe stieg, erneuerte er die Nachtmahlsbulle in coena domini, verfluchend Ketzer, Hussiten, Vicklifiten, Lutheraner, Zwinglianer, Calvinisten, Hugenotten, Trinitarier, Wiedertäufer und die Meerpiraten. Zerschmettert sollten die deutschen Ketzer werden, die gestohlene Habe ihnen wieder entrissen werden und der Kirche zufallen.
Schon während der militärischen Aktion erklärten seine Gesandten am Wiener Hofe, die Kirche verlange, wo die Macht des Kaisers, des Kirchenvogtes, dazu ausreiche, daß Anstalten getroffen werden, ihr zu ihrem rechtlichen Besitz wieder zu verhelfen. Witzige Gesellen am Hofe lachten: Wallenstein sollte marschieren, um dem Papst Magdeburg Halberstadt und die anderen deutschen Stifte wiederzuerobern. Es bedurfte nicht des Lamentos der Ligisten, der entrüsteten Hinweise des bigotten Grafen Strahlendorf, um einen Sonderlegaten nach Wien zu rufen, als die Glocken den Sieg in den Straßen läuteten. Schon bereiste eine geheime päpstliche Kommission die besetzten Gebiete und das übrige Deutschland, um für Urban die kommenden Einkünfte abzuschätzen; er hatte vor, mit diesem Gelde die Grenzen des Kirchenstaates vorzurücken, die Liga gegen den gefährlich übermächtigen Kaiser zu unterstützen, Frankreich gegen Spanien zu helfen. Dem abreisenden Nuntius blies Urban bei verschlossener Kammer in die Ohren: „Die Kirche hat nie frömmere Fürsten gesehen als die deutschen und den Kaiser Ferdinand. Das weiß ich. Aber es wäre schrecklich, wenn sie nicht die Frömmigkeit besäßen. Schließlich rechtfertigt nur der Glaube ihre Entsetzlichkeiten und schamlosen Räubereien. Der Kaiser mag uns bitten, die Stifter anzunehmen und auf Ersatz der verlorenen Jahre zu verzichten; wir werden erwägen, ihm einen Anteil am Ertrag, ihm und der Liga, zuzugestehen. Vergeßt nicht, einmal die Bemerkung hinzuwerfen: Ihr hättet von mir das Wort gehört, die Welt verlöre ihr Gleichgewicht ohne Frankreich, und damit verbeugt Euch vor Habsburg; man wird Euch verstehen. Im übrigen liebe ich Frankreich nicht mehr als Deutschland; der Tisch der Kirche ist groß genug für viele Kinder.“
Und zu seinem Unwillen wurde Ferdinand aus Wolkersdorf durch Boten Eggenbergs nach Wien berufen; es sei eine feierliche päpstliche Nuntiatur eingetroffen, die in besonderer Sache empfangen zu werden begehre. Im spanischen Saal, matt in den Armlehnen hängend, wie ein Wundervogel ohne Begierde durch die Käfigstangen den Schnabel steckend, hörte Ferdinand milde und still neugierig den vor großem Gefolge im Kardinalspurpur gestikulierenden Italiener an. Noch einmal ließ ihm der Heilige Vater und nun mündlich Glück zu dem Siege wünschen, dessen Gerüchte den Weltball erschütterten. Es sei durch die Frömmigkeit und Tugend Habsburgs vornehmlich geschehen, daß sich die trauernde Kirche aus ihrem Jammer erhoben habe und nun majestätisch um sich blicke, die Braut Christi, die ein süßes und dankbares Lächeln denen spende, die ihr Schwertträger gewesen waren. Dies aller Welt zu verkünden in feierlich offener Audienz sei dem Papst Urban Herzensbedürfnis. Mögen auch die noch nicht Unterworfenen und unter das Schwert Gefallenen wissen, wessen sie sich zu vergewärtigen haben, wofern sie in Starrsinn verharren. Die Heilige Kirche aber stehe nicht an, ihre Freude zu äußern, wo sie ihre Kinder wieder um sich sammeln wolle, die heimtückisch von ihrer Hand gerissenen Hochstifte und Klöster, die sie mit Jubel an ihr Herz drücke, alles Vergangene vergessend. Sie nehme sie entgegen aus der Hand des kaiserlichen Hauses, dem sie im Glück ihrer Brust keinen Vorwurf über den erlittenen Verlust mache.
Zugegen waren bei dieser Audienz fast alle Herren des Geheimen Rats, die Gesandten Bayerns, Kursachsens, die Vertreter der geistlichen Fürsten. Sie hatten maskenhafte Gesichter, mit keiner Bewegung ihre Anteilnahme verratend. In Ferdinand zog sich, während er zuhörte, ein gräßliches Gefühl zusammen, das ihm den Mund verpappte, sich mit Hitze und Beengung auf ihn legte. Er sollte überfallen werden. Man überfiel ihn: man wollte ihn vor die vollendete Tatsache stellen, daß das Reich geplündert wurde. Ihn, den Kaiser; sie wußten, daß er es nicht zulassen würde. Man wollte ihn zum Erwachen bringen. Er war überflutet, nicht imstande, seitlich zu ihnen hinzublicken. Bestürzt reichte er dem stolzen tönenden Kardinal die Hand.
„Was war das? Was war das?“ flüsterte er, in sich verwirrt, auf den Korridoren. Er saß kaum eine halbe Stunde, als Eggenberg und Trautmannsdorf angemeldet wurden, während er selbst auf die Mantuanerin wartete. Der Habsburger, noch im großen Ornat des Empfangs, in die Ecke eines Armstuhls geschoben, über dessen Lehne Purpurmantel und Schärpen bauschig herabfielen, als gehörten sie nicht zu diesem Manne. Seine Kammer halb dunkel.
Als sie eintraten, machte er, ohne die Arme zu bewegen und sich aufzurichten, ohne sie anzusehen, wagerechte Striche mit den bedeckten Händen, hauchend: „Nicht sprechen. Nicht nötig. Der Besuch ist geschenkt.“ Die beiden, erschüttert, wie er im Audienzornat, wollten unter Verneigungen auf dem Teppich näher treten; er winkte gleichmütig weiter: „Ihr stört mich. Nehmt an, ich hätte euch schon angehört. Ich billige eure Argumente. Es ist gut.“ Eggenberg: „Wir haben keine Argumente. Wir wollten eine Erklärung abgeben.“ „Empfangen. Danke. Die Herren sind entlassen.“ Der schmerzbewegte Fürst: „Was haben wir verschuldet?“ „Ich erwarte die Kaiserin. Ich danke.“ Er strich immer weiter vor sich in die Luft. Trautmannsdorf grub sich die Nägel in die Handteller: „Auf die Gefahr, den Zorn der Majestät herauszufordern: wir sind nicht schuld. Den Satz muß ich gesagt haben.“ Fast mitleidig drehte sich ihm der Kopf Ferdinands zu, die linke Hand fuhr leicht in die Höhe: „Welchen Satz?“ „Daß wir nicht schuld sind. Der Kardinal hat uns bloßgestellt.“ „Wie sonderbar.“ „Eine feierliche Danksagung an Eure Majestät, die Überbringung des päpstlichen Segens war verabredet.“ Wortlos, ohne seine Lage zu verändern, ließ der Kaiser minutenlang von einem zum andern seine weißen Augen gehen: „Was wollt ihr mir erzählen.“ Eggenberg, mit tiefer, wutzitternder Stimme: „Es ist nötig, beim vatikanischen Stuhl zu protestieren in aller Form, wie der Kardinal hier verfahren ist. Gegen den Anstand, gegen Treu und Glauben.“ „Das wollt ihr mir erzählen.“ Eggenberg standen die Tränen in den Augen; voll Bitterkeit sah er auf den Boden. Der Ausdruck des Kaisers veränderte sich, seine Stimme klang entspannter: „Graf Trautmannsdorf, es ist wahr, man hat euch übertölpelt?“ „Es ist ein schwacher Ausdruck für das, was vorgefallen ist.“ „Und ihr beide und andere?“ „Vor uns hat der Kardinal geredet, ohne daß wir uns dessen versehen konnten.“ „Er wollte, er hat erreicht —“ „Gut, Graf Trautmannsdorf.“
Der Kaiser bog den Kopf zur Zimmerdecke, gerade auf das goldene hohe Kruzifix, sein Gesicht wurde wieder gleichmütig; wie er den Kopf gegen die Schulter ablegte, atmete er erleichtert. „Mich freut, daß ich nicht allein überrascht bin und daß ihr meine Freunde seid. Daß ihr nichts gegen mich gewollt habt. Wahrhaftig, Eggenberg, hättet ihr wieder mit mir so getan wie vor einiger Zeit, so hätte ich“ — der Kaiser sprach sehr leise, versunken, monologisch — „kaum noch Lust gehabt zu irgend etwas. Es hätte mich genug gedeucht hier. Ich dachte vorhin: dieser Tag, mich auf meinen Heiland zu besinnen, sei heute gekommen. Gegrollt hätte ich euch nicht —, qualvoll war es nur für einen Augenblick. Geht. Ich danke euch.“
Die Herren traten zögernd nach Verneigungen ein paar Schritt zurück. Dann bat, hingewandt, Eggenberg um Vergebung; was man tun solle, sachlich; wie sich die Majestät zum Heiligen Vater und zur Stifterfrage stellen werde. Es sei genug, äußerte der Kaiser erst, den Kopf in die linke Hand gestützt. Dann mit verhauchender Stimme: den Heiligen Vater respektiere er immer; er habe ja Vollmacht, zu lösen und zu verdammen; worum handle es sich? Um die Stifter —; er werde auch darüber nachdenken.
Dann kam sie hinter den Damen und ihrem Obersthofmeister, die sich ehrfürchtig zurückzogen. Sie half ihm aus den schweren Prunkmänteln und Schärpen heraus. Schwer ließ sie die Stoffe auf den Teppich rauschen. Er saß noch erschöpft, die linke Hand den Kopf stützend, sprach wenig. „Ich denke,“ sagte er, als sie ihn bedrängte, „unser Leben ist nicht lang. Ich wäre heute bald aller Schwierigkeiten Herr geworden.“ — „Ich wäre,“ flüsterte er später, „bald so gegangen, wie mein spanischer Vorfahr, der fünfte Karl. — So durchschauert hat es mich.“ Bleich, langgezogen das tieflinige Gesicht, aufgerissen Mund und Augen, suchte sie mit ihrer linken Hand seine rechte, die zwischen seinen Knien hing, zu fassen: „Du wolltest ins Kloster.“ Sie krümmte sich auf ihrem Stuhl, sie schlug ringend die Arme zusammen: „O, du hattest recht, Ferdinand. O, hattest du recht.“ Sie schlang ihren linken Arm um seine Schulter, er ließ sich zu ihr herüberziehen, still sie anschauend, deren Augen fast delirierten: „Es gibt nichts als den Himmel und Maria, Jesus, die Heiligen, Ferdinand. Wir können nichts weiter tun, als uns zurechtmachen für die Seligkeit. O, wie freue ich mich, daß du sie finden willst. Ich bin glücklich bei dir, mein Leben.“
Er ließ sie sprechen und stammeln. Seine innre, wie wartende Ruhe wurde in diesen Tagen selten unterbrochen. „O, gib nicht nach, Ferdinand,“ flüsterte sie, sich über ihre Knie werfend, „sei da, wenn es dich ruft. Ich will bei dir sein.“
Ferdinand zog das linke Augenlid höher. Er betrachtete sie von der Seite her, rief sie an. Er rief sie nochmal an. Verloren schob sich die Mantuanerin auf. „Eleonore, willst du mich anhören? Dies ist ja vorbei. Es ist an mir vorübergegangen für jetzt. Man ist an mich herangetreten mit Vorschlägen. — Laß mich das überlegen mit dir.“
„Ich kann nicht. Verzeih’ mir.“
„Was hat man von mir gewollt? Schlechtes und Niedriges sollte ich dulden. Es könnte ihnen passen. Ja, ich gefalle ihnen nicht.“
„Willst du mir verzeihen, Ferdinand, daß ich dir nicht folgen kann. Rufe den Beichtvater, oder, es soll ein päpstlicher Legat am Hof eingetroffen sein: er wird dir helfen.“
„Er wird mir helfen! Warum ist er gekommen und hat diese Szene gemacht. Ich will daran nicht denken. Er wollte Länder. Sie sind habsüchtig, wagen sich an mich heran.“
„Der Papst hat von dir Länder verlangt? So gib sie ihm doch. Freue dich, daß er sie verlangt.“
„Ich habe den Krieg gewonnen durch die Gnade des Himmels, durch tausende Gebete und Fürsprachen. Jetzt soll ich zeigen, ob ich’s verdient habe. Ist er nicht wie der Versucher, der Papst? Ich habe meine Macht begründet durch die göttliche Gnade, jetzt will er mich locken, ungerecht und ruchlos zu sein.“
„Ferdinand, von wem sprichst du! So freu’ dich! Gib! Gib mir, daß ich schenken kann! Ferdinand!“
„Ich hab’ ja nichts zu schenken, Eleonore. Ich besitze selbst nichts. Je mehr ich Kaiser wurde, um so mehr wurde von mir genommen, liegt nun da. Ich hab’ es alles zu verwalten, gut zu versehen, recht abzugeben. Ja, ich verfüge über nichts. Ich bin ganz arm, Eleonore.“
„Schenk’ mir. Sprich nicht so. Ich brauch’ es, ich bedarf es. Willst du nicht meiner gedenken, bin ich nicht deine Eleonore, die du aus Mantua geholt hast? Und ich will es ihm schenken, dem Heiligen Vater.“
„Bist du nicht die zweite Versucherin, Eleonore? Und dir würde ich noch eher nachgeben.“
Sie saß plötzlich steif, spannte ihr Gesicht; klar und ernst: „Ich weiß, es gibt einen Versucher, dem du nachgeben wirst, weil er dich zwingt. Das bist du. Wenn es auf mich fiel, könnte ich nicht widerstehen. Wo es dich getroffen hat, kannst du nicht anders. Ich weiß es.“
„Du weißt das?“
Abweisend artikulierte sie: „Ich weiß. Du kannst dich nicht entziehen. Du hast sowenig eine Wahl wie ich.“
„Wir sind fromm. Wir haben nichts verbrochen. Warum sollte ich nicht wählen können?“
„Versuche.“
Er fixierte sie, wie gestochen: „Ich — regiere.“
„Versuche.“
„Wer kommt, um zu stehlen, findet mich und meinen Schwertträger.“
„Versuche.“
„Das heißt: ich sei noch nicht Kaiser?“
Sie drehte sich zu ihm, warf sich über sein Knie: „Es heißt, daß es damit nicht genug ist. Sei Kaiser, sei nicht Kaiser: ich will dich so nicht. Komm mit mir. Sei mein Begleiter — zu Maria.“
Ferdinand hatte seine stille erwartende Miene wieder: „Du darfst mich nicht verwirren, Eleonore. Wir dürfen uns nicht erregen. Man hat versucht, mir Länder mit Gewalt zu entreißen. Daraus spricht ein schlechtes Gewissen. Ich vergesse darum nicht, was ich der Heiligen Kirche schuldig bin und wieviel ich ihr gerade zu danken habe.“
Sie hängte sich an ihn, als er mühsam aufstand und die Arme, als wenn sie steif wären, schaukelte, zweifelnd ängstlich: „Gib mir nach. Bald.“
„Nein,“ schrie sie bald darauf verzückt, „tu, wie du willst. Ich will dir nicht raten. Nichts will ich geraten haben. Tu. Tu wie du willst.“
Während die Geheimen Räte warteten, was Ferdinand beschließen würde, wurden sie überrascht von der Nachricht, daß Befehl zur Abreise von Wien gegeben sei. Der Oberstallmeister bestätigte, von der Kaiserin selbst den Befehl erhalten zu haben. Und so hatte sich Ferdinand in der Tat in einem Zustand unbezwinglichen Grolls, zwangsartig sich steigernden Abscheus, dazu auch einer Furcht entschlossen: wegzugehen von Wien, in Wolkersdorf sich einzuschließen und nicht zuzugeben, wie er von dem Wege der Kaiserlichkeit, auf dem er ging, abgedrängt würde. Er kniff die Augen zu, spie: er wollte sie alle nicht. Er suchte instinktiv die Verdunklung wieder, in der er sich befunden hatte; in dieser Dunkelheit ging sein Weg. Er sträubte sich gleichermaßen gegen den Nuntius, wie gegen seine Räte, wie gegen dieses Wien überhaupt, diese Dichtigkeit der Häuser um ihn, dieses Zudringen und Bedrängen, diese Stimmen an allen Seiten der Burg.
Da wagte es der päpstliche Nuntius, ein Mann, der die Person des Kaisers nur von der Audienz kannte, sich gegen die Warnungen in seine Kammer zu begeben, nur gedenk seines Auftrages, und es gelang ihm, den Kaiser, der im Reisemantel ihm befremdet entgegenblickte, zu bewegen ihn anzuhören. Widerwillig, stumm setzte sich der Kaiser auf den Sessel, von dem er eben widerwillig aufgestanden war, gedrängt, fast mit Pein, ließ er seinen Körper auf das Holz nieder, von dem er sich eben freigemacht hatte, drückte den hutbeschatteten Kopf auf die Brust, schob die Arme auf dem Schoß gegeneinander, schwieg. Mit einer stummen Bereitwilligkeit harrte er, horchte, was da gebraut wurde, blickte gelegentlich scheu den dozierenden roten Menschen an, den Arm, der ihn hier zurückgedrückt hatte.
Er ließ ihn später wissen, er werde bald über den kaiserlichen Entscheid informiert werden. Er war herausgefordert, er wollte sich entschließen. Man sollte es fühlen, sie wollten ihn in ihre kleinlichen Zweifel einmengen. In die Schreibstube seines Sekretärs ließ er sich fahren, Schrecken verbreitend, diktierte augenblicklich, kaum eine Stunde nach der Verabschiedung des Italieners, er begehre Gutachten vom Geheimen Rat und Hofrat noch einmal über die Angelegenheit der Stifter. Sie sollten zeigen, wer sie sind.
Dann in die Gemächer der Mantuanerin. Ihre Damen sahen sie neben dem Habsburger, ihn belauschend, sich an ihn heftend wie eine Spinne an eine graue Mauer. Er blieb in Wien.
Nach zehn Tagen wurden die klaren harten Worte des Herzogs durch den Oberst Neumann vor ihn gebracht. Der Plan wurde darin als albern bezeichnet, man solle ihn abweisen. Der stille Kaiser hielt das Blatt geknüllt stundenlang vor sich, ohne es zu lesen. Der Nuntius des Papstes! Der Papst Urban! Die Mönche! Die Kurfürsten! Was wollten die, was wußten sie! Gegen diesen, gegen den Herzog! Da lag der Friedländer mit seiner Armee über dem Reich, erdrückend ja, aussaugend ja, keine Gewalt sollte ihn daran hindern, so zu tun wie er wollte: das Reich platt hinzulegen. Sie sollten alle verschwinden, die gegen ihn meuterten. Wie ging der finstere Mensch, der Friedländer, gnadenlos durch das Reich. Wie der Kaiser sich über seinen Leib bückte, zerriß ihm die Lust die Eingeweide; es wogte über die Haut seiner Hände, seines Rückens, ein kühler Schauer lief ihm über Wangen und Mund; er zitterte, preßte sich zusammen und genoß es, was ihn schmerzhaft wild überfiel. Er lachte heiß und gequetscht aus sich heraus. Er versteckte das Papier Wallensteins an seiner Brust, ehe er aufstand und sich den irrenden fragenden Augen der eingetretenen Mantuanerin darbot. Sie war selbst so erregt über sein freudiges Gebaren, als er davonging, daß sie auf dem roten Teppich hinkniend, allein in der Kammer, leise kreischte und kicherte.
Es erfolgte damals der erste Versuch des Fürsten Eggenberg, die Macht des Kaisers auf andre Schultern zu stützen als auf die Wallensteins; nach der Überrumpelung durch den Nuntius begriff er rasch: man konnte mit dem Geschenk der Stifter sich eine Zahl ligistischer Herren gewinnen und sie an den Gefahren der Situation beteiligen. Eggenberg saß neben Ferdinand in den anberaumten Besprechungen, den weißen kleinen Spitzbart an den steifen Mühlsteinkragen andrückend, klein, die hohe Stirn steil runzelnd, das weinrote Gesicht gestrafft, nicht gewillt nachzugeben. Er fühlte, daß man dem Kaiser wehe tun mußte, aber es war ihm von Tag zu Tag seit den Siegen mehr, als wenn nicht dieser gelbliche Herr unter dem blauweißen Baldachin, sondern er verantwortlich wäre für die Dinge. Dieser Kaiser konnte sich sträuben, das Haus Habsburg stand in Gefahr; ein liebes Kind war Ferdinand, der Heiland möge geben, daß diesem Herrscher Schlimmes erspart bliebe. Er war Ferdinand innig verbunden, sein Brautwerber und Vater war er gewesen; er begriff die Fascination Ferdinands durch den monströsen Herzog. Das Haus aber durfte durch den Kaiser nicht erschüttert werden. Die Räte, die herumsaßen, stumm, lippenbeißend, hatte er für die Stiftersache gewonnen; sie waren im Machtrausch, die Abgabe von Geschenken an den Papst und wen sonst schien ihnen belanglos. Die Unterhaltung zog sich stockend hin, der Kaiser ließ sich hinausführen.
„Welchen Rat gibst du mir?“ fragte an der Tür ihrer Kammer Ferdinand die Mantuanerin, die er umarmte, an der er sich versteckte. Glücklich bog sie sich, erschauernd, an ihm; sie suchte ihm ins Gesicht zu blicken, aber er drückte die Stirn noch tiefer vor ihr: „Du wirst es ja wissen, ich habe für dich gebetet“, jubelte sie.
Scheuer betrachtete und betastete Ferdinand das zerknüllte Schreiben des Friedländers, das er in seinem Gürtel trug. Er hatte seiner Gläubigkeit und Frömmigkeit, der Fürsprache der Heiligen Kirche seine Macht zu verdanken. Die Länder, die sie verlangten, unterlagen seiner Obhut, sie durfte er nicht als Beutestücke weggeben, er sträubte sich dagegen, wütend, jäh, von seiner Kaiserlichkeit einen Titel abzugeben. Aber sie gewannen ihm Boden ab, indem sie sich mit den Generalen gleichstellten, die er auch beschenkt hatte. Die Heilige Kirche verlangte ihren Sold. Wie ihn die Gesandten der Liga und des Papstes bedrängten, fiel es immer schwarz in ihn: „Man will mich schwächen, man will mich schwächen, ich seh’ es.“
Und einmal fand er sich vor dem Papier, das die Worte „albern“ und „frech“ enthielt, in einem zuckenden Schmerz; ein Flüstern in ihm: „Ich muß dir weh tun, verzeih es mir, es muß geschehen, denke nicht schlimm von mir. Unser Seelenheil verlangt es. Du weißt es nicht. Sei gut, sei gut.“
Dann legte er es vor Eleonore: „Sie sollen die Länder haben.“
Eleonore starrte ihn aus ihren inbrünstigen Augen an: „Wie ich dich beneide, Ferdinand, daß dir diese Wahl gegeben ist.“ Er lachte sie finster an. „Ich danke dir herzlich.“ Die Frau drängte sich unheimlich in seine Seele, in seine Entschlüsse.
Der Kaiser aber, welk und tief gereizt, wie er dieses knisternde, aus allen Balken brennende Leben neben sich fühlte, hatte das wilde Begehren, ihr etwas anzutun, sie auflodern zu sehen, leiden zu machen. Der Wunsch, Böses zu tun, war in ihm erwacht, der Zwang hatte in ihm das Gefühl der Rache hinterlassen. Tosend gab er nach. Zwischen den Zähnen knirschte er; während ihm der Schweiß auf die Stirn trat und die Augen in graue Höhlen zurückfielen und er ihre linke dünne Hand rieb: „Ich will dem Heiland zuliebe nichts versäumen; was ihm zu Ehren ist, wird mich leiten.“ Sie krallte sich an ihm fest und stöhnte. „Ja,“ seufzte er, hingeworfen mit ihr betete er, dann umschlangen sie sich.
In der Nacht ließ er einmal die Kaiserin rufen. Grimmig empfing er sie: „Bin ich wieder so weit, daß ich nicht weiß, wen ich rufen soll? Meine Narren, den blöden Grafen Paar? Blick mich nicht an.“
„Was ist?“ weinte sie über seinem Bett.
„Daß du zu früh triumphierst. Es ist die Spekulation, daß ich es nicht wage, den Friedländer zu rufen. Und ich rufe ihn, ich rufe ihn doch.“
„So tu es doch.“ Sie war hilflos.
„Er soll kommen, sag’ ich Euch. Die Augen werden Euch übergehen. Er soll Euch in Eisen schlagen, weil Ihr Euch vergreift an mir.“
„Was hab’ ich dir getan?“
Widerwillig legte er sich zurück: „Nichts, nichts, beim Heiland, nichts. Ich bin verloren, verkauft. Weiter nichts.“
Das war wieder der Fremde. Sie stand auf. „Wohin willst du?“ fragte er höhnend.
Sie kniete vor seinem Kruzifix.
Tage gingen hin; täglich marterte sich lange Stunden der Kaiser im Gebet neben der Mantuanerin. Lamormain, der große Beichtvater, trat an ihn heran. Ferdinand erhob sich mühsam, verstört aus den Andachten. Lamormain pries den Kaiser, daß er im Glanz des Siegerruhms den demütigen Glauben, den kindlichen Gehorsam bewahrt habe. Die schmächtige Kaiserin lief, nachdem sie rasch vor dem lächelnden hinkenden Jesuiten ein Knie gebogen hatte, aus der Kammer mit stürmischer Atmung. Mit lahmen Füßen schleppte sich Ferdinand an seinen Sessel, seine Hände zitterten. Dumpf, leise sagte er: „Ich danke.“ Hing an den Lippen des Jesuiten, bückte sich in sich, fiel zusammen. Beichtete ihm.
Dem Beichtvater gab er am nächsten Tage den Entscheid über die Stifter: Er sei mit sich zu Rat gegangen, habe Maria und die Heiligen fleißig und innig angerufen. Durch die Gnade dieser Himmlischen sei ihm zuteil geworden, daß ein furchtbar schwerer Feldzug beendet, der einen glücklichen Ausgang bis zur Stunde genommen habe. Sein Thron sei gefestigt worden, der erst so unsicher war wie sonst etwas Irdisches. Nun habe man ihn angegangen um Wiederherstellung kirchlichen Eigentums, das im Laufe der Jahrzehnte verlorengegangen sei. Er hätte sich schon früher dem nicht verschlossen, daß den geistlichen Gewalten ein Recht auf diese Güter zustand. Aber trotzdem hätte er sich gesträubt, um nicht neue Unruhen im Reich entstehen zu lassen. Ihm sei gewiß, daß er nicht wohl daran tat, sich zu sträuben. Die Kirche müsse belohnt werden für die unsagbare Hilfe der Gebete. Die armen Seelen, die in jenen Stiftern den Ketzern anheimgefallen seien, wiederzugewinnen, müsse er sich bemühen als gottergebener Mensch, geschweige als Kaiser. Ihm, seinem Beichtvater, müsse er gestehen, wie er geschwankt habe, sündig und zage. Er wolle von der Sünde befreit werden. Der Pater lächelte: „Glücklich der Mensch, dem es verliehen wurde, seine Macht zugunsten der Heiligen Kirche zu verwenden.“
Papst Urban der Achte, an seinem goldenen waffenklirrenden Hofe umgeben von Artilleristen Ingenieuren Landmessern Intriganten von Legaten Vizelegaten Notaren, nahm in Gegenwart des französischen Botschafters die Meldung seines Nuntius mit Freude auf. Er bezeichnete es im übrigen als Selbstverständlichkeit, daß diese Maßnahme des Restitutionsedikts getroffen wurde, und schließlich als eine kaum verzeihliche Lässigkeit, daß sie erst jetzt getroffen wurde. Die Franzosen beglückwünschten ihn im Auftrag des dreizehnten Ludwig, dessen Gevatter der Papst war. In Urbans Namen erklärte dem deutschen Gesandten Paolo Savelli der Kardinalstaatssekretär Franzesko Barberini, der Papst fühle sich durchaus nicht bemüßigt, eine Dankprozession angesichts der Verkündung der Restitution zu veranstalten, auch lehne er strikte ab, dem Kaiser die erste Besetzung der verlangten Bistümer zu konzedieren. Was dem Heiligen Stuhl zustehe, hielte er fest.
Eggenberg hatte mehr für den kaiserlichen Hof erhofft. Aber eisig kam aus Rom die Nachricht, der Papst gedenke die Hälfte der Renten aus den neu erlangten Stiftern der frommen Liga des bayrischen Maximilian zuzuweisen. Fein lächelte darauf Trautmannsdorf den Fürsten an, auch der Abt von Meggau sah auf den Boden; aber jetzt hielt Eggenberg alle Blicke aus. Sehr fest äußerte er, ihn freue, ja freue die Nachricht; den Kaiserthron auf breiten Fuß zu stellen, sei sein Bemühen; man werde mit Bayern zusammenarbeiten müssen, auf Bayern sich stützen können. „Zu welchem Zwecke“ — Meggau blickte vor sich — „haben wir den Herzog von Friedland gerufen?“ Eggenberg: „Ihr werdet es einmal lobpreisen, was ich sage; der Kaiser ist nicht vom Teufel befreit, um dem Beelzebub anheimzufallen.“
Die schmähenden Worte, die unverhüllten Drohungen, die aus den mecklenburgischen Quartieren an den Hof drangen, gelangten nicht an den Kaiser. In unbestimmten Wendungen überbrachte ihm Graf Strahlendorf die friedländische Ansicht; verschleiert, ernst, mit stiller trächtig schwerer Zärtlichkeit hörte Ferdinand den Bericht. Plötzlich fuhr er auf, warf erregte Blicke, ging auf und ab: „Wer ist dieser Friedland? Wie kommt er dazu, mich mit der Heiligen Kirche in Widerspruch zu bringen? Wie kommt irgend etwas dazu, mir mein Seelenheil zu nehmen?“ Er stand klein, mit gequältem Blick vor dem sehr stolzen Grafen, schwitzte. Und wie als Buße für Vergehen gab er doppelten und strengen Befehl, der Kirche nichts vorzuenthalten, weder an Gut noch an Seelen.
In diesen Tagen gab er das Edikt heraus, daß in allen neu eingezogenen und von kaiserlichen Truppen eroberten Gebieten der alte Grundsatz der Glaubensfreiheit aufgehoben und beseitigt werde, als nicht vereinbar mit kaiserlichen Pflichten gegen die Kirche; mögen die, die andern Glaubens seien, die eingezogenen Länder verlassen, dies sollte ihnen freistehen. Die herrscherliche Fürsorge und Verantwortung erfordere Anwendung des Satzes: Wessen Land, dessen Bekenntnis; die Auswanderer hätten den zehnten Teil ihres Besitzes zu hinterlassen.
Wie zur Sühne war das Edikt hingeworfen, und der Kaiser, von der fast irren Freude der Mantuanerin umfaßt und gestachelt, sättigte betäubte sich in der Übertreibung seiner Durchführung. Es dünkte ihm ein Glück, Vogt und Schwert der Kirche zu sein. Und einen Triumph empfand er über Wallenstein: er hatte sich über ihn erhoben, hatte ihn besiegt. Wallenstein war das Blinde, Mechanische, das Schwert; der Herzog verstand nicht, daß es noch etwas anderes gab als die Unterwerfung von Ländern. Er war Meister über ihn. Herzlicher als vorher liebte er Wallenstein, der Gedanke an Wallenstein machte seine Augen verschleiern, ein trunkenes Glücksgefühl schlug durch seinen Leib; die Knie zitterten ihm manchmal, wenn er an Wallenstein dachte. Er fühlte den Herzog sonderbarerweise noch fester an sich gebunden, weil er ihn abgewiesen, gestoßen und verwundet hatte. Wie ein warmer Dunst schwelte in ihm das angenehme Gefühl: der Herzog rast jetzt meinetwegen, er ist bestial, er ist ja ein Untier, er flucht mir, er möchte mich zerreißen. Zum Lachen schön war die Vorstellung.
Er ließ sich melden, welche Maßnahmen getroffen seien, welcher Stifter man sich bemächtigt habe. Wieder zogen vor ihn jammernde Abordnungen einzelner Städte und Hochstifter von protestantischer Religion, er nahm sie an, nur um über ihren Schmerz zu triumphieren und demütig die Anerkennung aus den Augen und Mündern der Jesuiten entgegenzunehmen. Die Mantuanerin war zugegen bei dem kläglichen Schauspiel, sie genossen es gemeinsam als ihr Werk.
Er hatte Maximilian von Bayern ganz vergessen. Er war der Kaiser, der es sich gestatten konnte, im Reich das Vogtamt des Papstes zu vollziehen. Er stand über Wallenstein, seinem Diener und Untertan.
In diesen Wochen stieg das Geschrei vertriebener Familien zu tausenden Malen aus südlichen und nördlichen Teilen des Reiches zum Himmel auf. In Ruhe dehnten sich die Heere des Wallenstein über die vielen Kreise; untätig lagerten sie, zehrten die Habe der Landbevölkerung, das Vermögen der Städter auf.
„Feiglinge, Lumpe, stinkige Jesuitenteufel“, waren die Schimpfworte, die in Güstrow und Wismar von der friedländischen Tafel an die Wiener Adresse gerichtet wurden. Der Herzog fluchte und haderte aber nach dem Edikt auffallend wenig mit seiner Umgebung, die er sonst bei Verstimmungen stark anfaßte. Der Vorfall arbeitete in der Tiefe in ihm. Er sah sich gereizt von einer Clique, gegen die er nichts vermochte. Sie konnten ihm nichts anhaben, er hielt den Kaiser in der Hand, aber sie waren da, sie wagten sich sogar jetzt herauf, sie errangen etwas wie Erfolge. Ein schlimmes Wesen, dieser Kaiser; schlapp bis zur Verächtlichkeit. Sie zogen und zerrten an ihm. Man mußte auf der Hut sein vor dem Volk; und er grimmte, daß er ihnen etwas abgeben sollte, was er nicht wollte.
Friedländische Truppen hielten die Seekante besetzt, Kurbrandenburg war mit Einquartierung niedergezwungen, von der Wetterau her hielten Regimenter Kurmainz in Schach, aus der Eifel wurde Trier eingeschüchtert, Köln war ganz ohne Schutz, Sachsen fühlte den friedländischen Stachel in der Lausitz. Seinen Freund, den Marschall Arnim, beruhigte der Herzog über den Wisch, das Edikt; man solle den Maulwürfen und Schnapphähnen am Hofe den billigen Triumph gönnen. „Der Kaiser ist schwach, er ist in der Hand der Memmen und Schelmen, die sich gegen mich nicht herauswagen. Es wird ihnen nichts fruchten.“ Und zu einer fast komödienhaft schwachen Aktion stattete er die gewünschte Aktion gegen Magdeburg aus, das er in Besitz nehmen sollte; er gedachte an dem Feuer nur sein eigenes Süppchen zu kochen. Er fragte noch einmal Arnim, ob er die protestantisch stolze Gemeinde für die Katholiken erobern wolle; und in der Tat stellte er dann Regimenter in das Expeditionskorps ein, die zum großen Teil lutheranische Offiziere führten. „Sie fuchteln“, höhnte der Herzog, „mit ihrem Edikt in der Luft herum, haben einen hölzernen Stiel und eine Klinge aus Pappe. Wir werden damit spaßhafte Kriege führen.“ Er verlangte von der Stadt die Einlagerung einer Garnison; die Stadt lehnte es ab aus Furcht vor dem Edikt. Dann, nach Verübung vielerlei Unbill, Scharmützeln zwischen Kroaten, Fischern und Roßknechten, Aufbringung von zweitausend Schafen und allen Stadtschweinen, Drohung mit Blockade, verhängte er eine Kontribution von zweihunderttausend Talern, von denen ihm hundertfünfzigtausend sofort hinterlegt wurden; für den Rest bürgte die Hansa. Die überraschten Syndici wurden bei einer Unterredung versichert, das Edikt habe keinen Bestand, sie sollten sich nicht fürchten, Wallenstein auch in Zukunft nicht die Besetzung des Elbpasses verwehren; die Zeit der Religionskriege sei im Reiche endgültig vorbei.
Dann zog er sich nach Mecklenburg zurück; das Geld war sein.
Der Herzog lag lang mit seinen Armeen an der nördlichen Seekante; er mußte sich des baltischen Meeres bemächtigen. Sein eigner Besitz, Mecklenburg, forderte es.
Die ungeheuren Güter, die Tag um Tag der graue Wasserrücken trug. Von Livland Hanf bundweise, Flachs in Fässern, Getreide. Aus Riga Wachs in Schiffspfunden für den Klerus, Wachs von der Wolga, Düna, über Smolensk und Polozk. Aus den Steinbrüchen der finnländischen Küste Leichensteine. Aus Rußland Pelzwerk von Zobel Wolf Marder Vielfraß Wiesel Hermelin Iltis Biber. Garn aus Stettin, geknotetes Gut, hamburgische, brüggesche, wittstocksche, ratzenburgische Laken. Auf diesem meilenweiten, scheinbar leeren Wasser, das niemandes Land war, fuhren stündlich die kostbarsten Waren der Welt, der Reichtum der Menschen: das riesig bezahlte Salz nach Abo Wiborg Narwa; Travesalz, Salz aus Lüneburg, Oldesloe, grobes, ungesottenes Bayernsalz, schottisches, französisches Salz; Fleisch Speck Malz Tabak Messer Kartenspiele Leder Leinen; die Kriegsware: Waffen Munition Pulver Blei eiserne Kugeln Schwefel Salpeter Harnische Panzer Röhren Rapiere Dolche Schlachtschwerte. Ähnlich Sklavenschiffen mit orientalischen Weibern brachten sie, erwartet von jung und alt, in Tonnen eingeschlossen, die Bodengeister, das Aroma fremden fernen, glutvollen Bodens: berauschende Weine, Alikante, kreischenden Korsiker, Malvasier, betäubenden Portugieser, von Bordeaux, Porto, aus der Pikardie, von Ungarn, von der Mosel, vom würzreichen Rhein. Aus den Kolonien vorüber in Holzlatten geschlagen, gebändigt, Anis, kandierter Ingwer, Kaffee, Kubatee, Kakao, Muskatblume, Paradieskörner, Manna, zwanzig dreißig Zuckersorten, Datteln. Duftende ölige Hölzer für die Apotheken: Terpentin Kampescheholz Pernambukholz. Metalle, Indigo, Weihrauch, Glas aus Rouen, Glas aus Flandern, englische Scheiben, hessisches Glas in Kisten, Kacheln, Klinken.
Zum Herzog kamen der vielvermögende Herr von Michna und de Witte aus Prag, über die Aufbringung der Geldsummen zu beraten, die unter Ausschluß Spaniens zu den Meeresplänen nötig wurden. Wie Fische schwammen sie auf den Köder, der sich ihnen an der fernen Seekante zeigte. Sie ritten durch Sachsen und die Mark, im offenen Wagen fuhren sie unter Bedeckung durch eine Rotte von Friedlands Leibgarde; mit Lust sahen sie überall kaiserliche Besatzungen in den Städten, die Einquartierungen. Den Zügen bettelnder Bauern, verbrannten Dörfern begegneten sie; es milderte ihre Lust nicht. Michna kniff die Augen, Verzückung über Brust und Magen; was war Wuchern Münzbetrug Kippen Wippen gegen dies: Krieg. De Witte erzählte von der Dankbarkeit, die der Judenprimus Bassewi gegen den Herzog fühlte und die er ihm in Güstrow äußern sollte mit der Versicherung grenzenloser Ergebenheit der Prager Judenschaft.
Wallenstein stand ihnen im Jagdschloß zu Güstrow, zwischen den riesigen Eichen- und Buchenwaldungen, im roten Mantel gegenüber, hager, hoch. Den vorsichtig vorgetragenen Schrecken der Herren über das Stifteredikt beruhigte er; auf die Wismarer Werft geführt, besahen die ausländischen Herren das graue rollende Meer, ließen sich bewimpelte Ausleger und Kaperschiffe zeigen, riefen den lübischen Bürgermeister Heinrich Brokes, ein verschimmeltes schlitzäugiges Männlein herüber, das ihnen gelassen jede Auskunft erteilte —, auch nebenbei, daß die Schonenfahrerkompagnie eine Defensionskasse der Stadt Lübeck eingerichtet habe gegen jegliche Überwältigung durch welchen Feind auch immer, durch Besteuerung aller Güter, die auf der Achse ein- oder ausgeführt wurden; kein Laken käme unbesteuert heraus.
Der graue träge Wasserrücken. Auf ihn geladen wie auf eine Tischplatte mit wallender Decke der fuderhohe ganze blinkende Reichtum der Menschen. Hier rann es wie in einem Engpaß vorüber, versucherisch; sie hingen am Fels darüber. Die Ausdehnung der Länder war verschwunden; Livland die Wolga Smolensk Stettin Wiborg Saragossa Ofen Venedig stießen aneinander. Und so nah, so schutzlos, wie kichernde Weiber, die baden gehen und spritzen.
Das lag vor den Füßen der drei Böhmen, die unter breiten federlosen Filzhüten, in langen weißen Mänteln am Strand neben dem gestikulierenden mißtrauischen Lübecker über den Sand schurrten. De Witte und Michna stampften erregt und fast betäubt von dieser Unterredung in das friedländische Quartier; der Herzog blies bedenklich vor der Weinkredenz die Backen, fächelte sich die Stirn mit einem Sacktuch. Ihr Schluß war, daß man sich der Hansa zu versichern habe. Ihre Augen funkelten, als sie schweigend hinter ihren Weingläsern phantasierten.
Neben Schwarzenberg, einem schmeerbauchigen Grafen vom Kaiserhofe, der auf eigene Faust spanisch-deutsche Meerpläne trieb, die Lübecker Kaufherren und Krämer mißtrauisch machte, tauchten in Lübeck die beiden Prager Herren, Friedlands Vertrauensmänner, auf, der kühle Kaufmann und der menschenkundige harte Serbe; sie nahmen Fühlung mit den einflußreichen Familien, den von Höveln, Bröntsee, Kirchring. Sie wurden auffallend oft von den höflichen Herren auf die Wälle geführt, die eben erst ein Italiener vom Holstentor bis zum Burgtor gezogen hatte. Mächtig war alles bestückt. Bei Travemünde stand ein steinernes Blockhaus für die Hafeneinfahrt; überall warnende Bastionen. Versteckte Gräben.
Auf die kaiserlichen Anträge an die Hansa, eine Flotte zu bilden und dem Admiral zu unterstellen zur Verteidigung gegen die dänische und schwedische Gefahr, wurde ein Lübecker Tag einberufen, beschickt von Hamburg, Köln, Bremen, Magdeburg, Braunschweig, Lüneburg, Rostock, Wismar, Stralsund. Hitzig rangen Wallensteins beste Sendboten mit den Weinherren, den Ältesten der Kompagnien, Frachtherren, Kaufleuten, Brüderschaften der Fahrwasser. Kein Lärm war in der dunklen Hörkammer im Niedersten Rathaus, aber ein unsichtbares, unnachgiebiges Schieben und Drängen, Überreden, Beschwören. So wichtig schien dem Friedländer diese Sache, daß er alle paar Tage Boten mit persönlichen Winken an die Deputierten herüberschickte. Der überreizte großspurige Schwarzenberg aber mit den spanischen Plänen und dem mörderischen Ungeschick, dazu das Edikt hatten die Luft in allen Trink- und Ratsstuben verdorben. Es wurde deutlich, daß die Lübecker und eben jener kleine Brokes sich schon längst mit den Generalstaaten verbunden hatten, in Furcht vor dem seegewaltigen Spanien; man glaubte in Lübeck nicht mehr an einen Krieg des Kaisers gegen das schon niedergeworfene Dänemark; man fürchtete die friedländische Faust und fürchtete die Jesuiten.
Die ehrenfesten hochgelehrten hoch- und wohlweisen Räte der freien Reichsstadt verneigten zuletzt sich vor den betroffenen Vertretern Wiens und des Admirals, ihrer großgünstigen Herrn, bestimmt erklärend: man könne sich nicht in einen Krieg einlassen mit den Potentaten, die Gewalt über die Meere und Pässe besäßen, welche ihre Schiffe täglich befahren müßten. Dem gräflichen Reichsboten verehrte der stolze Tag viertausend Taler und beglich seine Kosten, ehe er, von Wallenstein mit Groll beworfen, zum kaiserlichen Hoflager aufbrach.
Sie waren alle drei, die Böhmen, schon nicht mehr geldgierig. Sie waren an ihrem Reichtum hochgewachsen und hatten ihn gemeistert. Friedland kannte von je nur das Spiel, dessen Drang wuchs mit der Größe der Einsätze; er kannte nur umsetzen, umwälzen, kannte keinen Besitz. Er war nur die Gewalt, die das Feste flüssig macht. Er schauderte und zerbiß sich, wie sich ihm etwas Festes entgegenstellte.
In den ausgesogenen sumpfigen Meeresgebieten, dem dürftigen Kurbrandenburg, ließen sich die großen Truppenkörper nicht lange massieren. Zwar war genau bestimmt, wieviel Bauer Bürger täglich zu entrichten hatte, es war Vorsorge getroffen, daß ihnen nur soviel genommen wurde, daß sie dabei bestehen konnten; aber trotz grausam strenger Feldpolizei und Feldgerichts häuften sich die Beuteritte der Soldaten, kecke Erpressungen der Offiziere, Unterschleif des Proviantkommandos. Der Widerwillen der Kontribuenten wuchs; es half nicht viel, daß man halbe Dörfer einäscherte und Dutzende der böswilligen Ackerer an ihren eigenen Obstbäumen aufknüpfte; die Landschaften waren dürftig, ihre Pflege gering. Schon entliefen zahlreiche Söldner, führten als Vaganten weiter südlich Krieg auf eigene Faust. Man hatte in Wien und Prag an gewissen Stellen mit heimlicher Genugtuung von der stolzen Feindseligkeit der Hansa vernommen; man hatte ein zwiespältiges Gefühl.
Verbiestert, reglos lag der große Herzog von Friedland, der überreiche Böhme, ausgestreckt am Meer. Er kaute an dem Bissen, den ihm die Hansa zu essen gegeben hatte; langsam dämmerte ihm, was ihm geschehen war. Das Meer, das Verhängnis. Nicht die Reichtümer; es war der Weg: das Land war nicht zu halten ohne das graue, weißzottelige, schäumende Untier. Es rannte gegen seine Feste an, brachte sie zum Schaukeln. Rasch hatte er Mecklenburg an sich gerissen, konnte nicht hin und her. Wie zum Hohn verbrannten dänische Orlogs ihm fünf Schiffe im Greifswalder Hafen.
Plötzlich lief das Stichwort: Ungarn! Ungarn! aus dem Hinterlande über die Erblande. Täglich sah man klarer, was man zuerst nicht erkannt hatte — die Bayern sahen es, die Böswilligen in Wien, Strahlendorf und sein Anhang, das entzückte Paris, der mächtige Papst Urban —, daß sich Wallenstein seine Grube gewühlt hatte am Meer und daß es nicht ein endloser Siegeszug gewesen war von Schlesien bis nach Jütland; die Spitze war schon der Sturz. Die Hansa das Verhängnis. Er spannte sie nicht ein; nun konnte er am Meere liegen bleiben und sein Heer verfaulen lassen oder vom Meer sich zurückziehen, und der Däne stand wieder da! Christian, der Besiegte, der wieder ein neues Heer sammelte. Es war, wie man hörte, vom Grafen Pappenheim ein Kriegsplan ausgearbeitet worden auf Ersuchen des kaiserlichen Hofkriegsrats; darin wurde die Verteidigung der zweihundertfünfzig Meilen langen deutschen Küste als unmöglich bezeichnet; man könne es machen, wie man wolle — ziehe man die Truppen zusammen, lege man sie dünn auseinander — war das Land geöffnet für einen dänischen oder schwedischen Einfall.
Die Jesuiten hatte Friedlands Widerstand in der Stifterfrage gereizt. Sie hielten sich genötigt, ihn zu stacheln — nicht zu stark, aber deutlich.
Fanatische Mönche, jetzt von den Jesuiten nicht gehindert, hielten in Wien Predigten: es zeige sich wieder, wohin der Unglaube führe — frech ein Heer zu mischen aus Altgläubigen und Ketzern — und damit gedenken mehr als Eintagserfolge und Plündersiege zu erzielen.
Ungarn! Aus diesem Sumpfe werde er sich diesmal nicht ziehen.
Michnas Agenten arbeiteten in Mähren und Niederösterreich mit zäher Wut, um Getreide für das Heer heranzuschaffen; sie trieben, von ihren Herrn gejagt, die Preise in die Höhe. Michna erlebte es, wie eine zwei Wochen ihm Geldsummen aus der Hand nahmen, die er in Jahren gerafft hatte, aber er zögerte keinen Augenblick, alles hinzugeben. Schurken und Dummköpfe, dazu Neidbolde waren diese alle, ihre Stunde würde schlagen, sie sollen gerupft werden, wie sie sich nicht träumen ließen.
An der Spitze der böhmischen Landschaft stand im höchsten Vertrauen noch der schöne eisige Slavata. Der Herzog hatte ausgemacht, daß dem Heere ausreichende Getreidemengen aus Böhmen geliefert würden.
Die bösen, noch einflußlosen Kreise hielten den Augenblick, ihn zu schwächen, für sehr günstig; als Wallenstein von Güstrow scharf monierte, man hätte sich festgelegt auf zwanzigtausend Strich böhmischen Getreides und geliefert seien zehn Fingerhüte, log die Landschaftskammer. Und wenn auch der Herzog von Betrug offen redete, man hatte Zeit gewonnen, die Zeit, die Zeit, die Friedlands Heer zerschmelzen mußte durch Hunger Unordnung, wie einst Seuchen Durst im schrecklichen ungarischen Alföld.
Lange erfuhr niemand, was der Herzog unternahm, um sich zu retten. Wie würde er sich wehren. Es sprach sich herum, daß, wie immer, wenn Friedland in Gefahr war und einen neuen Schlag vorbereitete, der Jude Bassewi neben Michna und de Witte mit ihm konferierte und nach der Residenz Güstrow gereist war unter herzoglicher Eskorte.
Dann wurde offenbar, was geschehen war.
Während sich der Anblick der kriegerischen Maßnahmen im Reiche in nichts änderte, die Musterungen von Monat zu Monat beschleunigt wurden, Neueinstellungen im wachsenden Umfang erfolgten, besonders in dem fränkischen Kreise, waren aus dem Güstrower Hauptquartier Unterhandlungen mit dem Dänen angeknüpft.
Der Fuchs zog den Kopf aus der Schlinge.
Zug um Zug brachte den Herzog in Fühlung mit dem Dänen. Ein ruheloser Kurier lief zwischen Wien und dem Hauptquartier. Der Kaiser und der Hof wurden auf eine Probe gestellt. Sie hatten es in der Hand jetzt jeden Weg zu gehen, den sie wollten. Der Feldhauptmann erklärte: man hätte gesiegt, man hätte den niedersächsischen Kreis zur Ruhe gebracht, den Dänen zu Boden geschlagen; darüber hinaus sei nichts möglich. Als man scheinbar entsetzt gegenfragte, kam der Bescheid, ob man auf die Armeen für die Zukunft verzichten wolle.
Der Kurfürst verbrachte seine Tage mit Rechnen und Drechseln. Er saß in der Neuen Feste viel an der Drehbank zusammen mit dem Pater Adam Kontzen, einem jugendlich heftigen kleinen Manne, den ihm sein alter Beichtvater, der Lothringer Vervaux, zugeführt hatte. Kontzen, den das Raspeln des Kurfürsten nicht störte, trug ihm eindringlich und fordernd politische Grundsätze vor, die nach Ansicht des Paters das Mindestmaß darstellten, das man von einem katholischen Politiker verlangen könnte. Der Kurfürst, dick, blaß, leicht schwitzend, teilte seine Aufmerksamkeit zwischen den hastigen Reden des Dialektikers und seinem Elfenbein. Zornig fuhr der Pater über die Ketzerei her, die, wie er immer wieder drohte, in der Lasterhaftigkeit und dem Atheismus wurzelte; Prälaten und Fürsten seien von ihr angesteckt. Wenn der Fürst müde zu ihm aufsah, schleuderte er vor ihn ein Muß: alle Welt sei einig darin, daß Laster und Gottlosigkeit auszurotten seien; ihm, dem Pater Adam Kontzen, wurde zuteil, den Zusammenhang der Ketzerei mit Laster und Anarchie und Atheismus zu erkennen; sie müsse, die Ketzerei, sie müsse beseitigt mit Gewalt werden. In Sodom und Gomorrha hätten auch Menschen gelebt. Gott hätte kein Erbarmen gekannt, er der Herr selber, habe Feuer und Schwefel über die Sündenstädte gegossen. Dieses Beispiel der Heiligen Schrift müsse man verstehen; stehe es dem Menschen an zu verzeihen, wo Gott straft. Bekehrung oder Vernichtung: es bleibe nichts drittes. Und gerötet, gereizt, ingrimmig blickte der Priester auf den Fürsten, leidend unter seiner Ohnmacht, hier bitten und argumentieren zu müssen, wo er fordern konnte im Namen der Heiligkeit. „Was soll geschehen,“ fragte wie abwesend, mit dem kleinen Finger an dem Elfenbeinstäbchen rührend, Maximilian, „wenn wir nicht die Macht haben, zu zerstören oder zu bekehren.“ „Sünde ist es,“ zischte gequält der Priester, „ja, es ist Sünde, nicht die Macht zu haben. So lange wir leben, haben wir Macht in uns. Jedes Pünktchen davon gehört Gott, nichts einer Aufgabe, sie sei welche auch immer. Die Pest ist nicht so schlimm als der Gedanke, wir können nicht Gott dienen.“ „Was soll man mit Leuten tun, die Gott und der Kirche nicht dienen.“
Fassungslos der Priester: „Töten oder bekehren. Wir haben ja keine Wahl.“ „Würdet Ihr selbst, Pater, so handeln? Wenn Ihr einen Einzelfall vor Euch hättet?“ „Ich würde,“ glücklich hob der Pater beide schwarzbehängten Arme, „wie ich steh und sitze mich aufmachen und meine Pflicht erfüllen. Es gibt nichts Größeres, als Fürsten zum Glauben zu bringen oder sie zu töten.“
Im Feilen lispelte der Kurfürst: „Kontzen ich danke Euch ja. Wenn nur alle, oder nur viele so beseelt wären wie Ihr. Es ist schlimm, daß wir arbeiten, arbeiten müssen und nur so wenig erreichen. Allmacht ist nur Gott gegeben. Würde uns verliehen sein von Gott, Feuer und Schwefel zu regnen, so wäre das Heilige Römische Reich längst wieder rein vom Übel.“
Maximilians Leibkammerdiener führte die kleine zögernde Gestalt des grauen Tilly heran über den langen Läufer. Maximilians Unterhaltung mit ihm war kurz. Der Pater Kontzen wollte sich entfernen, der Kurfürst aber schüttelte den Kopf; es sei ihm angenehm, wenn der Pater da wäre; wieviel besser, wenn immer. Er befragte den steif stehenden Grafen, der aus Wiesbaden zurückgekehrt war, mit keinem Wort nach seiner Gesundheit. Orientierte ihn, wie die Sachen nach den letzten Meldungen an der Weser, Elbe, Ems stünden. Ob ihrer Liebden bekannt wäre, wie sich die Dinge bei der Armada der friedländischen Durchlaucht entwickelt hätten. Kurz so — ohne die Antwort abzuwarten, aber der Pater möge nur dableiben, sich nicht gekränkt fühlen, wenn sie militärische Sachen besprächen —, daß also es ganz zweckmäßig, zweckentsprechend, wünschenswert wäre, wenn sich die ligistische Armee in irgendeiner Weise als vorhanden erwiese. Vielleicht könne sie die friedländische bald ablösen. Man stehe jedenfalls nach allem Trübsal und offenbarem Unglück wieder vor Möglichkeiten. Er warf Werbungspläne hin, verwies auf die vorhandenen Geldhilfen aus Umlagen.
Plötzlich fixierte er den Grafen; ob er sich nun gesund fühle: „Ihr wißt, es wird mit den Dänen Friede geplant. Habt Ihr Verhandlungen aus Wiesbaden mit ihm angeknüpft?“ Verwirrt drehte der eisgraue General den Kopf zu dem Pater, zum Fürsten zurück. „Ich weiß, Ihr habt es nicht getan. Es ist ja nicht Eure Sache. Der Herzog von Friedland hat es getan und ist Euch zuvorgekommen. Oder uns; denn wir waren doch bis Pinneberg mit im Krieg, und unsere Artillerie hat noch in Jütland geschossen. Jedenfalls, Ihr sollt für mich als Kommissarius an den Unterhandlungen teilnehmen, bei standhaltender Gesundheit.“ Der Graf, bis in die Ohren errötend, erklärte, daß er sich feldfähig fühle und sich glücklich schätze, dieser Ehre für würdig erachtet zu werden.
Der Kurfürst ließ, die Bohrinstrumente auf die Drehbank legend, vom Kammerdiener die Fenster öffnen. Als sich nach einer Pause die Herren zum Gehen anschickten auf ein Nicken des Fürsten, endete sehr laut Maximilian, der Graf werde noch genaue Instruktionen erhalten. „Aber — der Herr Graf hat nicht den Frieden zu befördern. Versteh’ Er recht. Laß Er sich das von dem Pater hier erklären. Es hat keine Eile und keine Not, mit Ketzern Frieden zu schließen. Es ist nur ein Notbehelf. Seh’ Er zu, unsere Armee stark zu machen. Mir — merke sich der Herr Graf das, mir liegt nichts am Frieden.“
In Boitzenburg, auf dem Gute seines Freundes Arnim, begegneten sich der Herzog und der ligistische General, und wurden im Beisein kaiserlicher Legaten furchtbare Friedenspropositionen für den geschlagenen Dänen festgesetzt.
Der Wiener Hof im Überschwang seiner Stärke hatte von sich aus verlangt, daß dem Besiegten die schwersten Bedingungen auferlegt würden. Er sollte in Zukunft auf jede Einmischung in deutsche Angelegenheiten verzichten, sollte die Ansprüche auf niedersächsische Stifter verleugnen, alle Kriegsschäden vergüten, Kriegskosten an den Kaiser erstatten, und dann ganz Holstein, Schleswig, Dithmarschen an das Reich abtreten, den Sund den Feinden des Kaisers sperren, ihm und seinen Freunden öffnen.
Bei Pinneberg waren sich der ligistische ausgehöhlte Wicht und der gallige verbogene Böhme unter dem Donner der Belagerungsgeschütze begegnet. Von Wut zerfressen war der klappernde Tilly weggetragen worden; jetzt saßen sie sich am Tisch gegenüber, Friedland erwartete die Trümpfe des Kleinen.
Der dänische Generalwachtmeister Schauenburg empfing in Güstrow aus des Herzogs eigener Hand die Punktation; Friedland betonte, daß er den kaiserlichen Forderungen seinerseits noch einiges hinzuzufügen für nötig befunden habe. Es betraf die Entwaffnung der dänischen Armee, die unerhörte Forderung der Auslieferung der Hälfte der dänischen Kriegsflotte. Wallenstein trieb es zum Äußersten, er wollte Christian zur Verzweiflung reizen, die Liga an die Seekante zwingen und ihr Heer massakrieren lassen.
Während der Generalwachtmeister erschreckt abzog, lobte in hohnverschleierten Briefen nach Wien der Herzog die Proposition über alle Maßen, bat den triumphierenden Grafen Tilly zu sich, um mit ihm gemeinsam den Kriegsplan und die Heranziehung der Liga zu erörtern. Er war, wie er lippenzitternd, ein Lachen verhaltend, erklärte, bereit, mit dem bayerischen Kurfürsten und seinem General den Oberbefehl zu teilen und ihm auch die Kräfteverteilung zu überlassen.
Aus Dänemark vernahm man durch die ernannten Kommissare von der tiefen Bestürzung des geschlagenen Christian und der von Tag zu Tag wachsenden Leidenschaft und Begeisterung des Volkes; die grausamen Friedenspunkte des Friedländers waren das Signal zu einer ungeheuren nationalen Erhebung.
Die Prager Helfer des Herzogs hielten sich in dem Güstrower Schlößchen auf. In dem verräucherten schmalen Speisesaal vor Arnim und schweigenden Offizieren scholl der Lärm des Friedländers: „Der Krieg hat sich gewendet. Wir haben gesiegt, aber zum Schluß muß ich mich mit dem giftigen Dänen verbinden und über den Kaiser herfallen. Meine Freude, Ihr Herren!“
„Setze Euer Liebden den Wiener Hof her,“ schmähte Arnim, die Fäuste ballend und sich auf die Knie pressend, „soll er die Butter an der Sonne hart erhalten.“
„Ich schmeiße den Säbel nicht hin zum Gefallen anderer. Aber meine Freude, Ihr Herren! Täte der Spanier mit und wollte er uns nicht das Reich verderben, so könnte ich das Meer halten. Indianisches Gold und Silber: in dreißig Jahren regt sich nicht der Engländer noch Schwede noch Holländer. Nichts. Basta. Sie werdens bezahlen. Ich kämpfe mit den Dänen gegen den Römischen Kaiser. Es wird nötig, daß ich Offiziere nach Fünen schicke, um das dänische Heer zu organisieren. Mein Herr Bassewi hat schon verraten, er wisse, wohin er das nächste erhobene Geld schicken werde. Nach Kopenhagen. So ist’s.“ Seufzte der fette de Witte: „Wofür, mit Verlaub, führt der Herr denn Krieg? Um die Sache des Römischen Reiches? Wenn der Römische Kaiser glaubt, seines Rates nicht mehr zu bedürfen und er Euch für überflüssig hält.“
„Hat Er beinah’ recht, Herr Vetter,“ blinzelte auf seinem Faulbett der General, dessen rechter Fuß in einem gepolsterten Eisenkasten steckte, der von heißen Ziegeln getragen wurde, „Ulmer Zuckerbrot schmeckt besser als ein Brieflein aus Wien.“
Wieder seufzte der fette de Witte, besah seine ringgeschmückten Finger: „Wüßt’ ich mir nachgrade etwas Besseres an Eurer Statt. Trüge nicht meine Haut zu Markt. Ich vermeine, so wie die Sachen jetzt zwischen dem Kaiser und Euch liegen. —“ Da brüllte, keifte, röchelte der Herzog, der Schaum wehte über seinen Kinnbart: „Was wißt Ihr von meinem Verhalten mit dem Kaiser. Hab’ ich Euch was davon aufgebunden. Wollen die Herren nicht die Nase in meinen Topf stecken. Der Kaiser ist der Kaiser und mein freundgnädiger Herr. Diene ihm und dem Reich treu. Laß nichts wühlen zwischen ihm und mir.“
In Lübeck erschienen im Winter für den dänischen König des Reiches Kanzler Christian Fries und Jakob Ulfeld, der Reichsrat Albert Skaal, der Kanzler Levin Marschalk, Detlev und Heinrich Rantzau. Aus Wien war herübergefahren der rechtskundige Rat Walmerode mit den Offizieren, auch der vielgewandte Aldringen und Balthasar Dietrichstein. Tilly hatte abgeordnet den Rat Ruepp, gelehrt wie sein Begleiter, der Graf Gronsfeld. Die Schlacht war für Friedland gewonnen, als der weißbärtige straffe Walmerode die Wallensteinschen Quartiere durchfuhr und bis in die sumpfigen Dithmarschen geleitet war.
Die dänischen Kommissare, flanierend mit den lübischen Weinherren, zu Gast bei der Gesellschaft der schwarzen Häupter in Riga, im Hause der Schiffergesellschaft, hochangesehen als Vertreter des mächtigen Seestaates, setzten Gerüchte in die Welt: nächst der zunehmenden Neuformation des dänischen Heeres, das der wachsenden Interesse und Teilnahme des jungen Schwedenkönigs Gustav Adolf für das unglückliche Brudervolk. Drohend vor aller Welt spielte sich dazu im Pfarrhaus zu Ulfsbrück eine Zusammenkunft der beiden Könige ab, die sich sonst nicht über den Weg trauten. Man erfuhr nicht, daß der junge ehrsüchtige dicke Schwede vorhatte, den Dänen vor seinen Wagen zu spannen, daß zum Schluß beim Trinken halbgefrorenen Weins, der in den Gläsern klirrte, der gedemütigte Däne in die Worte ausbrach: „Was haben Euer Liebden in Deutschland zu tun?“ in Eifersucht giftend, daß jener unternehmen und ausführen konnte, was ihm mißglückt war. Für die Unterhändler in Lübeck war es klingende Münze: der Schwede beriet geheim mit dem Dänen. Das Wort des todeswilden Christian kam herüber: seine Kommissare mögen die Sachen rasch in Bausch abmachen; kämen sie zu einem günstigen Frieden: recht; sonst möchten die Herren die Dinge liegen lassen wie sie liegen.
Der Kaiser mußte aus seinen Träumen gestürzt werden. Walmerode reiste nach Wien. Schwer drang er zu Audienzen bei Eggenberg und Meggau. Er stellte den widerwillig Zuhörenden das ganz Unbegreifliche der Friedensbedingungen vor; das Heer war das kaiserliche; es würde nutzlos aufgerieben. Meggau, zugänglicher als der Fürst, erklärte offen eines Nachmittags auf einer Schlittenfahrt: niemand in Wien, der den Herzog kenne, glaube recht an die Jeremiade von der zerfließenden Armee; man fürchte ein politisches Manöver des Friedländers gegen die Liga. Und dies — nun: der Wind hätte sich am Hof gewandt; bei aller Ehrfurcht vor des Herzogs Genie, in solche wilden revolutionären Experimente hätte doch niemand Lust sich einzulassen. Ob es wahr wäre, fragte sehr ernst Meggau, als sie unter Schneegestöber zwischen den Stämmen des Praters klingelten, daß der Herzog an offener Tafel in Güstrow erzählt hätte, man müsse nach französischem Muster verfahren; ein Land, ein König?
„Wie entsetzlich, Euer Liebden, Herr Walmerode. Wir sind in Scham fast in den Boden gesunken vor dem sächsischen Gesandten, der danach anfragte. Solche Bemerkung kann uns teurer zu stehen kommen als eine verlorene Schlacht. Ich fasse es nicht.“
„Wir stehen gut mit allen Ständen des Reiches,“ glaubte auch Herr Eggenberg Walmerode warnen zu müssen. „Wie lange, meint Ihr, soll der dänische Krieg noch dauern?“ „Sagt und meldet seiner herzoglichen Gnaden: so lange, wie Kaiserliche Majestät ohne Einbuße an Macht und Reputation bestehen bleiben kann.“
Walmerode reiste ab. Er sah nach Gesprächen mit der Umgebung des Kaisers in Wolkersdorf: es bestand keine Möglichkeit, ihm mit den Wünschen des Herzogs zu kommen. Seinem fast unirdischen Machtgefühl hatte er das Zugeständnis des Stifteredikts abringen lassen; daß er gesiegt hatte über die Rebellen, in Böhmen, Süddeutschland, Niedersachsen, Dänemark war der Pfeiler seines Fühlens, seiner kaiserlichen Erhabenheit. Keiner seiner Umgebung hätte gewagt ihm zu sagen: der Krieg muß Hals über Kopf beendet werden, ein böses Ende drohe, keiner hätte es geglaubt.
Da, während Hungermeutereien in Holstein und Pommern unter den Söldnern stattfanden, als die Verhandlungen mit Tilly sich zerschlugen, baute Wallenstein selbst ab. Etwas Unerwartetes Kaltblütiges Feindseliges geschah.
Von Jütland her in langen Zügen marschierten die Truppen landeinwärts; in Pommern ballten sie sich bis auf kleine zurückbleibende Garnisonen zusammen. Es waren noch tausende über tausende, hinter denen das verlassene Land rauchte und verwüstet lag. Halbverhungert und von dem untätigen monatelangen Lungern verwahrlost strömten sie im niedersächsischen Kreis zusammen, fielen über Kurbrandenburg, standen da, bereit, das Reich zu überziehen. Der Herzog, des Kaisers Generalobrister Feldhauptmann schien die Gewalt über sie verloren zu haben. Die kaiserlichen Legaten vernahmen angstvoll in Lübeck das Gerücht, Friedland ziehe die Truppen zu einem neuen Offensivstoß zusammen. Sie liefen umeinander, die Kuriere jagten nach Güstrow.
Der Herzog reise, nach Berlin, Frankfurt, hieß es da; man traf ihn nicht. Sein Schwager Harrach hatte ein Handschreiben von ihm, das im geheimen Rat verlesen und besprochen wurde; es sprach von beliebigen privaten Dingen; dann zum Schluß: er gehe jetzt auf Berlin; der Soldat sei eine Bestie, wenn er hungere friere und nichts zahlen könne. Er bürde denen die Verantwortung für das Geschehene und Kommende auf, die auf ihn nicht gehört hätten.
In der Bestürzung fand man sich. Der Friede mußte geschlossen werden. Es war nicht klar, ob das Heer wirklich zusammenschmolz, oder was der Herzog vorhatte. Der Kaiser war zu verständigen. Man wandte sich an den Obersthofmeister, an den der Kaiserin, man verzagte.
Bis der Beichtvater der Kaiserin die hohe Frau informierte und sie den Kaiser aufklärte. Sie nahm es als ein vermutetes Glück hin, daß man mit dieser Aufgabe kam; sie hörte, der Entschluß müßte gefaßt werden, trotz aller Bitterkeit. Sie dachte an die Entzückungen und Zerknirschungen, die der Stifterhandel mit sich gebracht hatte; der Kaiser mußte wieder opfern.
Aber kaum sie zaghaft die Situation erläutert hatte, lächelte sie Ferdinand an. Es geschah etwas Unglaubliches. Der Kaiser hatte ein Übermaß von Lasten über den unglücklichen Dänen gehäuft, es war sicher, daß er sich mit der Mantuanerin weidete an den Leiden der befallenen Landstriche. Fast überhörte er alles, was ihm an Demütigendem gesagt wurde. Er hörte nichts; er hörte nur, es sollte der Friede gemacht werden. Er nickte; unberührt schenkte er alles weg, wie er zuletzt die Stifter weggegeben hatte, aus der Fülle seiner kaiserlichen Macht. Er war versteift in seine Majestät. Er ließ sich nicht noch einmal, wie durch den Zwischenfall der Stifter, aus seiner Starre bewegen. Jetzt rüttelte man vergeblich an ihm, alles veränderte sich vor seinem Blick. Die Mantuanerin war leicht enttäuscht.
Sie klagte, um ihm einen Schmerz zu entlocken, sich eine Hemmung zu bereiten: der dänische Übeltäter solle einen guten Frieden bekommen nach solchen Untaten und nach solchen Niederlagen? Das sei es ja, fand Ferdinand, mit dunklen weichen Blicken nach langem Besinnen, man könne ihm Frieden geben: man hätte es in der Hand. Er stockte wieder, nun völlig genesen, in einer dunklen genießerischen Trunkenheit. Man solle den Herzog tun lassen, gab er von sich; er hätte die Schlachten durchgefochten. Von weitem erinnerte er sich der Stifteraffaire; ein feiner kurzer Schmerz wirbelte durch ihn; in einer traumhaften Abwehrbewegung sagte er: nein, man solle den Herzog tun lassen; wenn er könnte, würde er ihm noch größere Ehren zuteil werden lassen. Und schließlich müsse man auch dankbar sein gegen den König Christian von Dänemark, an dem man sich so habe erheben können.
Er war mit leichter Schlaffheit und viel Fett aus dem letzten Anfall seiner Krankheit herausgekommen, langsam hatten sich die Prunkmähler und Bankette in Bewegung gesetzt, im üppigen Verschleudern fand er sich wieder, eine fast dankbarkeitgesättigte innere Freude am Menschen und allen Dingen hatte er. Er schenkte, schenkte.
Sie sah sich, die ekstatische Kaiserin Eleonore, wieder einem ganz anderen, aber ebenso wunderbaren, quellenden, blutenden, sprießenden, blütenrauschenden Wesen gegenüber. Er betete wie ein Kind mit hellen neugierigen Augen, freundlich, mit jedem vertraut, Priester, Abt, Chorknabe; zur Kirche ließ er sich sanft wie das Tier zu einer Krippe führen. Sie staunte, bog errötend den durchstürmten Kopf, hing sich an ihn.
König Christian hatte mit seinen gefräßigen Orlogs Kopenhagen verlassen, war in die Wismarische Bucht gedrungen, zum Hohn auf die deutschen Admiralsgelüste. Er erschien auf der Reede von Travemünde, in der Nähe des Verhandlungsortes Lübeck; seine Unterhändler, Jakob Ulfeld und Levin Marschalk, segelten zu ihm heraus, geschwollen gingen sie nachher in der Hörkammer des Niedersten Rathauses einher, die Kaufherren buckelten vor ihnen, die Kaiserlichen kniffen den Schweif ein, der Wind hatte umgeschlagen. Der Böhme fragte mit grausamer Ruhe an, welche Friedensbedingungen er nunmehr stellen solle. Die Küste war bis auf den Mecklenburger und einen kleinen pommerschen Streifen schon gänzlich entblößt, ohne Schwertstreich konnte alles dem Dänen wieder zufallen, was ihm nur die stärkste Heeresmacht wieder entreißen konnte. Niemand wußte, wo Friedland sich aufhielt und was er vorhatte.
Man gebärdete sich in der Hofburg verzweifelt. Es kamen Tage, wo man in Scham den Kaiser ohne Nachricht der Vorkommnisse ließ.
Christian aber war gar nicht mehr begierig, Krieg in Deutschland zu führen. Wenn er an Mitzlaff dachte, hatte er Tränen; er wünschte das Kapitel „Deutscher Krieg“ zu beenden. Er saß mit seinen Trinkgenossen und lieben Frauen auf den Schiffen, schweifte in den Küsten und Häfen des Heiligen Römischen Reiches, jeden Tag von neuem die Segel hissend, wie ein Ausgestoßener, der bereut, einen Winkel zum Schlafen sucht. Der böse Ehrgeiz des jungen Schwedenkönigs, die schlimmen Absichten Gustavs auf das Festland, machten ihm das alte Heilige Reich noch lieber. Ungläubig las er die neuen Friedenspropositionen, die ihm der Herzog von Friedland durch Schaumburg übersandte. Angewidert vernahm er, daß drei schwedische Gesandte in Lübeck aufgetaucht waren und versucht hätten, sich in die Verhandlungen einzudrängen, vielleicht nichts weiter vorhatten, als einen Kriegsvorwand für ihren Herrn zu suchen. Sein Nachfolger war sichtbar, sichtbar auf der deutschen Bühne erschienen.
Er wollte Frieden, er wollte Frieden.
Man gab ihm alle seine Provinzen wieder, verlangte keinen Schadenersatz. Die Bayern rebellierten in Wien, aber nur schwach. Auch sie waren in nicht geringer Furcht vor Friedland. Christian war von seinen Schiffen heruntergestiegen. In vieler Berauschtheit und halber Sinnlosigkeit irrte er in Schleswig herum mit einer kleinen Mannschaft, die den Resten der Wallensteiner unter seinem Befehl Treffen lieferte, je nach Laune auch die Bevölkerung überfiel, strafend für ihren angeblichen Abfall, oder mit ihnen ein glückliches Wiedersehen feierte. Die üppige Christine Munk begleitete ihn auf einem Maulesel; sie war schwanger. Als er auf dem Gute Kjärstrub auf Taasinge jubelnd und tränenströmend die Urkunde in Händen hielt, die Dänemark seine Krone ungeteilt beließ, als er aus dem verwirrten Stammeln: „Mein Dänemark! Mein Dänemark!“ nicht herauskam, Siewert Grubbe ihn zum erstenmal unter den Tisch trank, konnte sich die dralle schwarze Wibeke Kruse, ein Fräulein der schwangeren Christine, nicht enthalten; sie bat die eigene Mutter Christinens, sie möchte sie dem König zuführen; täte sie es nicht, würde sie die schwangere Frau umbringen. Mit dem unbändigen Grubbe, der schwangeren Christine und der Wibeke taumelte der König in das neue Frühjahr hinein.
Alleingelassen der Pfälzer Kurfürst, der schöne Friedrich. Saß wieder im Haag, im Asyl der Hochmögenden. Der grausame Krieg in Deutschland vorbei. Die Not in seinem Quartier. Verschuldet war er.
Der Hochmut verließ ihn und die leidenschaftliche Elisabeth nicht. Man beugte sich zu jeder Stunde vor ihnen als den böhmischen Majestäten. Wenn sie zusammenfallen wollten, umkreiste sie zornwütig die kleine Bremse Rusdorf.
Langsam gewöhnte sich Friedrich wie ein geheiligter Stein über Europa zu ragen: die Welt veränderte sich rasend um ihn; die Säule schrie „Recht, Recht“; zum Stein war er geworden, konnte nicht mehr kämpfen.
Er wartete, daß ihn einer nahm, auf einen Wagen lud, siegte.
Wie ein Schiff, das den Anker lichten kann nach langer beschwerlicher Hafenruhe, nahm der Böhme sein Heer zusammen und fing an, es über das Reich zu werfen.
In diesem Augenblick des Lübecker Friedensschlusses geriet das ganze Reich in einen Zustand atemloser Erwartung. Der Böhme war von seiner Kette losgebunden, das Reich lag vor ihm.
Seine Pläne waren gänzlich unbekannt; man wußte nur, daß er vorhatte, das Reich, wie er sich ausdrückte, auf einen sicheren Boden zu stellen.
Der Rest der Regimenter marschierte aus Schleswig hervor; die Hauptpässe der Küste und des angelagerten Inlandes wurden mit Garnisonen versehen. Alsdann zogen an fünfzehntausend Mann unter Arnim nach Polen; sollten dort schwedische Kräfte binden; der gefährliche Gustav Adolf kämpfte gegen Polen. Arnim rückte mit seinen vier Regimentern zu Fuß und dreitausend Pferden bei Neustettin über die polnisch-preußische Grenze, grollend, daß ihm diese Aufgabe in dem feindlichen Lande gegeben war.
Der Infantin in Brüssel wurden siebzehntausend Mann zur Verfügung gestellt gegen die Generalstaaten.
In das Magdeburgische wanderten sechstausend ab.
Zwölftausend Mann deckten die Seekante.
Unverändert im Reich die Regimenter.
Aus Niedersachsen her neue Regimenter nach Franken und Schwaben.
Der Herzog selber in Mecklenburg lagernd mit vier Kompagnien, die Merode unterstellt waren. Sie mußten aus Schwaben unterhalten werden.
In wenigen Wochen wurden acht neue Regimenter errichtet; bei Erfurt stellten sich drei zu Fuß auf.
Der Winter war vorbei, das Frühjahr da. Konfiskationen begannen an liegenden und fahrenden Gütern der Rebellen des letzten Krieges durch kaiserliche Kommissarien, unter Zuteilung des gesamten Erlöses an die Kriegsarmada. Die Hand der in Güstrow tagenden Finanzkommission wurde sichtbar.
Tillys Heer wurde bei der vulkanartig erfolgenden Ausdehnung der kaiserlichen Armada in einen Winkel Ostfrieslands gestoßen. Der ungeheure Reichtum, der in Friedlands Regimentern zutage trat, lockte ligistische Offiziere und Söldner in Scharen an, dazu das Konfiskationsdekret, der stolze Ton im Heer.
Lorenzo de Maestro, der Oberst, verließ Tilly. Dem ligistischen Obersten Gallas versprach Wallenstein das Patent als Generalwachtmeister; Tilly wollte ihn in Arrest werfen, aber Gallas ließ sich nicht einschüchtern. Graf Jakob von Anholt, der vorher in Jever und Oldenburg mit seiner Frau silberne Becher und goldene Ketten geplündert hatte, brauchte keinen schweren Entschluß fassen. Unverhüllt erging an Tilly und Pappenheim selbst die goldene Reizung; vierhunderttausend Taler waren Tilly zugesprochen für den entscheidenden Vorstoß über die Elbe; er sollte mit dem welfischen Fürstentum Kalenberg, Pappenheim mit Wolfenbüttel abgelöst werden.
Dann geschah nichts.
Im Sommer nichts, im folgenden Winter nichts.
Wallenstein und das kaiserliche Heer war da. Das Heer wechselte seine Standorte, schob sich aus unruhigen in ruhige Gegenden, aus abgegrasten in frische. Fatamorganahaft geschahen Wunder: ein Regiment, zwei Regimenter wurden aufgelöst, die Reiter tauchten an anderen Orten, bei fremden Regimentern auf, die auf das doppelte anwuchsen.
Wallenstein reiste nach Prag, Gitschin, vergrößerte sein Herzogtum Friedland durch den Ankauf der böhmischen Herrschaften Waldschütz, Sentschitz, halb Turnau, Forst, Chotetsch, Petzka. Durch kaiserliches Privileg war dem Herzogtum ein besonderes Recht und Tribunal verliehen, das es staatsrechtlich unabhängig vom Königreich Böhmen machte, befreite von der schweren ferdinandischen erneuerten Landesordnung im Erbkönigreich; Wallenstein traf Anstalten, eine eigene Landesordnung abzufassen. Die Pläne für Gitschin, das seine Hauptstadt werden sollte, wurden ausgearbeitet, Scharen von Handwerkern herangezogen. Der Ausbau der Klöster, gestifteten Schulen und Seminare wurde angegriffen.
Nach Polen war der biedere Arnim mit friedländischen Regimentern marschiert; er sollte den Schweden festbinden. Die Polen aber haßten die Deutschen; widerwillig war er in die barbarische Landschaft gegangen; nach rechts und links sich schlagend nahm Hans Georg seinen Abschied; der Herzog konnte ihn nicht bändigen, der Marschall vergrub sich grollend in Boitzenburg. Die friedländischen Regimenter rückten in das Reich ein. Die Armada war um fünfzehntausend Mann gewachsen. Einschnurrten die ligistischen Truppen.
Den Kreis Schwaben überflutete der Herzog plötzlich so, daß die ligistischen Regimenter Kronberg und Schönberg abgeführt werden mußten.
Stumm wartend das Reich; hielt an wie ein Stier, dem ein Schlag bevorsteht. Sichtbar war eine Diktatur über dem Heiligen Römischen Reich errichtet, deren Gesicht und Ziele unkenntlich waren.
Leise begann ein Schaukeln in den Ländern: die verarmenden Bezirke, Städte wurden unruhig, die Erregung erforderte stärkere Truppenmassen, der Druck stieg, die sich herausfordernden Mächte klatschten leise aneinander. Geschützgießereien, Gewehrfabriken stiegen aus der Erde; mit Schrecken sahen die Bezirke langsam das Bild ihres Landes sich verändern.
Mehr und mehr wagten sich die Offiziere, Beamten des Heeres in die Städte, in die Stuben der Bürgermeistereien, auf die Rentämter, fragten mit ihren Kontributionszetteln nach Einkünften der Bezirke, rechneten, schickten Kontrolle in die Häuser, waren nicht zu vertreiben. Sie nahmen, ohne zu fragen, Einblick in die landesfürstlichen Bezüge, in Brandenburg, in Schwaben. Erst wurden große zusammenhängende Erhebungen in das friedländische Hauptquartier geschickt, von da nach Prag, Hamburg, an die Fachmänner weiter geleitet, dann stellte auf Wallensteins Befehl Michna eine Zahl geschulter, meist böhmischer, Vertrauensmänner auf, die aus ihren Wohnorten verreisten, in die fremden Verwaltungen eindrangen, nicht davongingen, von einem festen Standort die Gegend überblickten. Die reichen fränkischen Bistümer Bamberg Würzburg wurden kontrolliert, das Gebiet der freien Reichsstadt Nürnberg, Bayreuth, das Fürstentum Ansbach, der württembergische Herzog, der Mainzer Erzbischof. Da der Breisgau dem österreichischen Kreis angehörte, auch das Gebiet von Rottweil, so lag die Hand des Herzogs von Friedland über dem ganzen südlichen Deutschland außerhalb Bayerns. Das Gebiet des Kurbrandenburgers war von Besatzungen nicht verlassen worden, Pommern Mecklenburg Braunschweig-Lüneburg Kalenberg Grubenhagen Wolfenbüttel durchsetzt.
Und während die Truppenmassen abwanderten, ergänzt, verstärkt wurden, neue zufluteten, bildete sich nach den Leitsätzen des Generalissimus von Woche zu Woche schärfer die Konstitution des Heeres heraus, Hand in Hand mit einem System der Schutzmaßregeln für das Volk. Edikte verkündeten an Landstraßen Märkten Dörfern den Grundsatz gegenseitiger Achtung des kaiserlichen Heeres und des Volkes deutscher Nation; beiden Parteien war Sicherheit zugesagt, Lebensberechtigung; man hätte im Hinblick auf die Wohlfahrt des bedrohten Heiligen Römischen Reiches sich zu stützen. Das Maß der Leistungen war für die Bevölkerung auf das ausreichende Minimum beschränkt; Obersten und Intendanten hatten im Einvernehmen mit den Zivilbehörden die Sätze zu bestimmen. Eine Befragung der Landesbehörden war nicht vorgeschrieben. Die Zeit der wilden Plünderer und Exzedenten sollte vorbei sein; Prag spie mit der Unzahl der Erlasse, die das Kontributionssystem regelten, Feldgerichte Oberstschultheiß Regimentsschultheiß Weibel Schreiber Profoß über alle Musterplätze Quartiere. Lorenzo de Maestro als Generalquartiermeister inspizierte die Plätze; die wildesten Auswüchse wurden beseitigt. Aber weiter vegetierten die Ausbeutereien: Obersten, die ihren Stab auf drei Orte verteilten, Kontribution für drei volle Stäbe erhoben, Offiziere, die Wohnung an zwei Orten nahmen; immer wieder Salvaguarden, Schutzbriefe, die unnötig waren und den Inhabern gegen hohes Entgelt aufgedrängt wurden für jedes Tor, jeden Wagen, jede weidende Gänseherde. In zollreichen Gegenden begünstigten Gemeine und Offiziere den Schmuggel, übten ihn selber, indem sie ganze Schiffsladungen an Korn als Proviant durchbrachten. Die Stände hatten sich nicht dazu verstehen können, dem Kaiser und dem Reich Steuern zu zahlen; mußten jetzt neben sich, über sich Offiziere Generalkommissare der friedländischen Armada dulden.
Unmerklich schlang sich eine kräftige Pflanze um ihren Stamm. Dies waren nicht mehr die verachteten verächtlichen Geschöpfe, der Abschaum Flanderns Böhmens Ungarns. Ein neuartiges herrisches hartes Wesen trugen alle diese Männer zur Schau, die als Offiziere der Armada durch die Städte und Landschaften ritten; gaben an Stolz den eingesessenen Patriziern nicht nach, hatten eine deutliche Nichtachtung gegen die Bürger, ehrten Besitz nicht. Setzten in Zweikämpfen Gefechten ihr Leben aufs Spiel; bewegten sich im Lande als Soldaten des Herzogs von Friedland, der als böhmischer Edelmann begonnen hatte, als reichsunmittelbarer Fürst vor der Römischen Majestät bedeckt bleiben konnte. Stärker strömten ihnen zu Söhne aus Patrizierhäusern, adligen Geschlechtern.
Im Lande wucherten Gerüchte über die Pläne des Herzogs; tolle Worte aus dem Munde von beliebigen Offizieren wurden kolportiert von Zunftstube zu Zunftstube, in die Ratshäuser, die Antikameren der Fürsten.
Von Zeit zu Zeit ließ der Herzog selbst über die hilflos fragenden Köpfe Gerüchte aufklingen von nahen Türkenkriegen. Plötzlich grellte durch die duldenden schlaffen Landschaften das Geschrei von Fortschritten, grausigen Siegen des Ofener Pascha; ängstlich, aufmerksamer sah man die sich sättigenden Söldner und Offiziere an, fürchtete für Kinder und Weiber, vielleicht mästete man die Armada dafür. Dann verhallte alles wieder; die Maschine zog straffer an.
In das Staunen Murren der Leute kamen andere Töne. Langsam übernahmen die Fiedler Schnurrer Bänkelsänger die ruhmredigen Lieder der Söldner. Sangen von der gebissenen halbaufgefressenen Ratte, dem Dänen, von Wallenstein, den der Kaiser schickte, der im Sieg zum Herzog aufstieg. Die Bürger gingen wie Mäuse an den Speck. Es gab geheime Dinge zu sprechen, gegen, die löbliche Ehrbarkeit Richter und Ratsmannen Geschlechter zu konspirieren, Korporäle Kornetts in den Trinkstuben zu empfangen. Es war eine dunkelgärende Rebellion, die wie eine Wolke über die Bezirke flog. Was bei Helmschmieden Pfeilschnitzern Plattnern Schwertfegern Ringlern Nadlern gepflogen wurde, blieb kein Geheimnis den Haffnern Mehlmessern Wildpretlern Wollschlägern Lebküchlern den Fellfärbern Mäntlern Joppern, in Reichsstädten, Bischofssitzen, Grafenresidenzen. Eben war es nur eine Belebung ihrer zünftlerischen Zusammenkünfte, bald eine unsicher tastende Bewegung, deren Stichwort noch nicht gesagt war.
Die stummen apathischen Massen der Edlen, die Patrizier, Gelehrten, katholische, protestantische. Sie bewegten sich. Was vorging, floß in sie wie ein elektrischer Schlag, der sie erzittern ließ. Der alte Barbarossatraum von dem freien großen deutschen Reiche lebte hier. Leidenschaftlich wollten einige wissen: Die Zeit sei erfüllt. Die Fiedler sangen so lieblich. Die Dinge aber enthüllten sich. Wallenstein zeigte sein grausiges Gesicht: „Ein einiges deutsches Reich, eine einige Knechtung.“ Söldner breitbeinig durch die Gassen, über die Märkte, Trommeln und Pauken hinterher. Die Sprache des neuen Herrschers Armut Entrechtung Versklavung. In Tierställe verwandelten sie das Heilige Reich. Aus ohnmächtiger Pein stiegen Bittschriften an den Kaiser. Die bezwungenen Landesherren schickten ihre Vertrauensmänner unkenntlich auf die Dörfer und Flecken, in die besetzten Städte, die Stimmung zu erforschen, Mut zu machen, aufzureizen. Da fanden sie wenig Liebe. Auf dem Lande wirtschafteten die Bauern, die Nachkommen jener stolzen, die vor hundert Jahren zu tausenden eingekesselt und niedergemetzelt waren von den Vorfahren der Edlen, die sie jetzt angingen. Sie fanden Grimm und Furcht nach beiden Seiten gegen Kaiserliche und Fürsten. Mißtrauisch, leidend sahen die Bauern auf die Musketiere und Reiter, mißtrauisch auf die flötenden bettelnden Abgesandten ihrer Herrschaften.
Nur ein Volk kicherte beim Anblick der finsteren Leiden Deutschlands: die Böhmen. Sie sahen die Rache sich vorbereiten, hörten das Knacken in dem Bogen des Kaisers, die Stücke der zerbrechenden Waffe würden ihm in Brust und Kopf eindringen. Sie jubelten, der Sieg konnte allein ihnen nicht entgehen. Wie ein Symbol über der Verderbnis des Herzog von Friedland, die Pest, in ihrem Lande geboren.
Zdenko von Lobkowitz war tot; seine Stelle als Oberstkanzler von Böhmen hatte ein leiser Mann eingenommen, Graf Wilhelm von Slavata. Man kannte seine Feindschaft zum Herzog; er hatte leidend das Amt angenommen, das man ihm anbot als einem Verwandten und Feind des großen Herzogs. Slavata stopfte sich gequält die Ohren, als man ihm erzählte von den Karlsbader unerhört glanzvollen Reisen des Herzogs; „was haben ihm die Juden dazu gezahlt, wieviel hat er erpreßt, was hat er gewuchert.“ Wallenstein zwang ihn zur Feindseligkeit immer wieder aus seiner menschenfremden Ruhe heraus. Er war sehr fein, mit Trautmannsdorf tauschte er skeptisch überlegene Worte aus, aber vermochte nicht wie der bucklige Graf dem schreckensvollen Experiment Wallenstein mit Neugier zuzuschauen und dem Herzog aus Interesse zuzustimmen. Die Maske zog er nicht vom Gesicht. Verschwiegen studierte er den Herzog, in dessen neuem Palast auf dem Hradschin er bisweilen erschien.
Eines Tages empfing der bayrische Geheimrat Richel den Besuch eines Kapuziners, der sich als Böhme legitimierte und einen schriftlichen Geheimauftrag vorwies: wonach er die Kurfürstliche Durchlaucht in einer Angelegenheit von höchster Wichtigkeit um die Entsendung eines Agenten nach Prag ersuchen sollte. Der achselzuckende Kapuziner wollte weder den Schreiber des Briefes nennen noch die Angelegenheit umschreiben; seine Legitimation stammte von dem sehr namhaften Abt des Klosters. Ein bayrischer Geheimagent, Alexander von Hales, Italiener, selbst Kapuziner, reiste mit dem Ordensbruder nach Prag ab. Ihm wurde von dem Abt der Eid abgenommen, daß er die Person, der er vorgestellt werde, nicht nach ihrem Namen fragen werde, wenn sie sich selbst nicht nenne, daß er ferner nicht niederschreiben werde, was er erfahre, jedenfalls nicht vor seiner Ankunft in München.
Dann saß der Italiener in der gewölbten Zelle des Abtes an der Ofenbank gegenüber einem ehrerbietig begrüßten, rot maskierten Herrn, der Ringe und Armbänder trug, sich, während er sprach und nachdachte, auf dem übergeschlagenen Knie aufstützte. Slavata sprach italienisch. Der Abgesandte möchte nach München von der Natur, dem Vorgehen, den Plänen des jetzt florierenden Friedländers einige Informationen bringen. Als der Agent erklärt hatte, er werde erst dann unterbrechen, wenn er glaube, sein Gedächtnis werde versagen, setzte Slavata hinter der Maske seine Worte hin, als wenn er mit sich spräche, langsam, sich wiederholend, einschränkend.
Er verglich den Charakter Wallensteins, mit dessen Zeichen er sich viel beschäftigte, mit dem Attillas, Theoderichs, Berangers, Desiderius, welche von Haus aus Herzöge waren, durch Verleihung auch Königreiche erwarben und Kaiserreiche erstrebten. Er ist von einer ungemeinen Arglist und Verschlagenheit, nur Gott durchdringt seine Gedanken, er verbirgt hinter seiner Barschheit weitausschauende Pläne. Schon sein böhmisches Einkommen ist höher als das der Majestät. Er ist von Natur zur absoluten Alleinherrschaft geneigt; nur den Bayernfürsten haßt er, denn dieser erscheint ihm als der einzige, der ihn in seinen Plänen hindern kann. Er beabsichtigt, die katholische Liga zugrunde zu richten, um alsdann als einziger Bewaffneter im Reich dazustehen. Das Spiel ist ihm schon zu zwei Dritteln geglückt. Sein Verfahren ist einfach: Bestechung des kaiserlichen Beichtvaters und der Geheimen Räte, Verlegung der Truppen in die kaiserlichen Erbländer, um dem Hause Österreich, das im Kriege völlig verarmt, einen Zügel anzulegen. Er kennt keine Achtung; vor dem spanischen Botschafter hat er den katholischen König einen Tropf genannt, ebenso den König von Polen; man darf nicht wiederholen, was er am Papst gefunden hat; es seien in Rom auch fünfundzwanzig Kardinäle, die man nach seinem Wunsche auf die Galeeren schmieden sollte.
Nach diesen Mitteilungen saß die rote Maske schweigend, drehte sich um, ob noch jemand im Raume sei, ging mit einer Verbeugung hinaus, dem Kapuziner winkend, dazubleiben.
Einen Monat später sprach die hohe Persönlichkeit den Kapuziner im selben Zimmer zum zweiten Male; der Agent durfte an sie einige Fragen stellen; zwei Entwürfe zog der Redner aus dem hohen weißen Stiefelschafte: einen Diskurs über Friedlands Absicht mit dem kaiserlichen Heere, eine Untersuchung über die Möglichkeiten, dem geplanten Umsturz im Reich entgegenzutreten. Nach diesen Entwürfen, über die die Persönlichkeit weichstimmig berichtete, plante der Herzog sich in Niederdeutschland festzusetzen; er hatte vor, im Reich die aristokratische Verfassung zu verändern zugunsten einer absoluten Monarchie. Er wollte zeigen, welche große Kraft Deutschland innewohne, wenn es ein einziges Haupt habe. Der Umwandlung Deutschlands konnte man nach der Untersuchung nur entgegenwirken, durch ein mächtiges ligistisches Heer, das unter Führung eines Gewalt nicht scheuenden Fürsten steht. Wallenstein rechnet mit der friedlichen Gesinnung des Bayernfürsten und Tillys, offener: er spekuliert auf ihre Ahnungslosigkeit.
Gefragt, wie der Kaiser sich verhalte, antwortete die Persönlichkeit: Ferdinand lasse nichts an sich herankommen, und was herankomme, schüttele er ab, um nicht aus seiner Ruhe geschreckt zu werden; es sei vom Kaiser nichts zu erwarten, er werde in seiner Unschlüssigkeit verharren.
Als Alexander von Hales Prag verlassen wollte, wurde er vom spanischen Botschafter am kaiserlichen Hof, der zufällig den Herzog aufgesucht hatte, angehalten. Der sehr stolze Mann wollte Empfehlungen und Briefe an seine Bekannten in München mitgeben; zwischendurch gab er eitelkeitsstrotzend von sich: die Dinge im Heiligen Reich nähmen ein rasendes Tempo an; es freue ihn, daß man sich der alten Beziehung mit Spanien besinne, Friedland verstünde die Zeit; er hätte davon gesprochen, wie ihm Graf Slavata vertraulich unterbreitete, bei einem Widerstand gegen seine Pläne und bei einem vorkommenden Thronwechsel zuerst an Spanien zu denken; man werde wieder in die alte gesegnete Verbindung kommen.
Drei Stunden Ritt bei München, in Schleißheim, hauste der Bayer in seiner Sommerresidenz auf der Schwaig; die kleine Mosach rieselte durch einen Hof, trieb ein Mühlrad, durch einen andern Hof das geschwätzige Wässerchen der Wurn. Breite, geblökerfüllte Stallungen, Wiesen an sanften Abhängen, Ährenfelder, Müller, Viehmeister, Schweizer, Allgäuer.
Sankt Urbanstag; im grauen Regenwetter schlugen im Dorf die Kinder ein Holzbildchen des Papstes. Im inneren Hof der Schwaig klopfte der Maienregen auf das Bretterdach einer kleinen Spielhalle; drin drängten sich auf ihren Sesseln hinter dem frierenden Kurfürsten — blauer Samtmantel bis auf die gelben Handschuhe, blauer aufgeschlagener Samthut mit Perlenschnur, altes gefälteltes schlaffes Gesicht — der übergroße glotzäugige schwere Fürst zu Hohenzollern, Obersthofmeister und Geheimer Rat, der gestrenge und hochgelehrte Herr Bartholomäus Richel, der greise spitzbärtige Oberstkämmerer Kurz von Senftenau, Knecht der Jesuiten, Kämmerer Maximilians, der Marchese Pallavicino, der Signor Cavalchino, der elastische hohe Graf Maximilian Fugger, Johann Verduckh, sein Guarderobba, die Geheimsekretäre Rampeckh und Schlegel, Kriegskommissare, Bildhauer. Sie saßen stumm vor der niedrigen schmalen engen Holzbühne, auf deren teppichbelegten Brettern sich zwei Menschen, nackt bis zum Gürtel, boxten, im trüben Nachmittagslicht hin und her sprangen. Leibwache mit Kopfhaube Hellebarde Schwert breitbeinig in Doppelreihe an beiden Längsseiten der Halle.
Der eine der Ringer, schwarzhaarig, breit, den Unterkiefer vorstreckend, ging im Hintergrund der Bühne wild, mit ängstlich verzerrtem Lächeln einher, zog meckernd hinter dem unbeweglichen braunen nach vorn, spazierte an der Rampe entlang, nach rückwärts schielend, nach vorwärts schielend, gegen den Saal sich unter Öffnen der Arme verbeugend. Er wartete vorn im Winkel, die Arme höhnisch übereinanderschlagend, den braunen unbeweglichen imitierend. Grinste keck, schlenderte drei Schritt gegen den anderen. Mit seinem rechten Knie berührte er das vorgebogene Knie des andern, schob, drückte gegen das Knie. Er stieß, der andere stieß. Sie holten ihr freies Bein heran. Der Braune schlank, kopfhöher als der Schwarzhaarige, aus einem Traum geweckt, drängte plötzlich heftig mit dem spitz vorgekeilten Knie, rot überflammt, daß sie aneinander vorbeirutschten, auseinander taumelten, der Kleine mit den Händen den Boden berührte. Wie er sich aufrichtete, umdrehte, funkte ein höllischer Schlag ihm in die Schläfe, daß er, wie verwundert, sich hinsetzte, den Kopf senkte. Er wollte wieder höhnisch, vertraulich dem Saal zulächelnd, hochklettern, als der Braune eine Fußsohle ihm auf die nackte Schulter legte von hinten und ihn leicht wippte. Mit verändertem Gesicht riß er seinen Rumpf beiseite, stand atemlos blaß auf den Füßen, stieß einen Arm krümmend hervor: „Mach’ nur Herrchen, immer mach’ nur. Ich zahl’ wieder.“ Der Braune hob reizend wieder den Fuß. „Komm nur heraus. Ich zahl’ jeden Schlag. An dich.“ Stammelnd näherte er sich dem Braunen, sabbernd, mit weiten Augen; der legte ihm, ehe er, wie geplant, in sein Bein hatte beißen können, zwei schwere Hiebe über die Schultern, daß der Schwarze umknickte, wie mit Säcken über den Achseln nach rechts schlich, nach links schlich, sich gegen die Rampe wandte, sich duckte, um die Beine vom Podium herunterzulassen. Vier Leibwächter liefen klirrend an mit gefällten Hellebarden; der Kleine brach in lautes Lachen aus, stellte sich schwankend vorn hin: „Ich fordere dich heraus, Herrchen. Glaubst mich zu besiegen, mit deinen plumpen Schlägen. Da steh’ ich. Schlag. Ich wehr’ mich nicht. Ich krieg’ dich schon.“ Der Braune mit dicken, knöchernen Fäusten gegen ihn. „Ich krieg’ dich. Du bezahlst mir jeden Hieb, entgehst mir nicht.“ Sie wechselten mit leichten Berührungen Stöße. Über den Schwarzen war plötzlich ein farbenstreuendes Summen, Dröhnen gefallen; halb besinnungslos lehnte er an der Seitenwand, murmelte: „Überleg’ dir, was du tust. Du richtest dich zugrunde.“ Versuchte zu lachen nach einem grausamen Hieb gegen seine Oberlippe: „Ich weiß nicht, wie du das wirst aushalten können. Das — haha — das ist entsetzlich. Das ist ja tödlich. Bist ja ein Mordsverbrecher.“ Hin und her wankend wälzte er sinnlos seine Arme wie Schlägel um seinen Kopf, dem ausweichenden Braunen nachschleifend. „Mein Gott,“ greinte er an der Hinterwand, ohne zu wissen, daß er nur mit einem Auge sah, „ich wußte nicht, mit wem ich mich einließ. Pfui, das bist du. Es war nötig, dich aufzudecken vor der Welt. Da sitzen die Zeugen, die hohen Herren. An dir soll keine Gnade geübt werden.“ Der schlanke Braune raste: „Was verleumdest du mich. Willst du schlagen, willst du nicht schlagen, Hundsfott?“ „Du spuckst mich nicht an. Ich warte, bis du dich ganz ruiniert hast an mir. Wir werden alle sehen, wie weit du gehen kannst.“
Tierartig hing der Lange über ihm, rammelte an dem schwankenden kopfverbergenden Körper; in den Pausen schluckte und schluchzte der unten: „Mann. Mann. Ja. Schlag weiter. Zwanzig. Wenn du fertig bist, ist die Abrechnung fertig. Ich zähl’ jeden Schlag. Unterhalten wir uns nicht; schlag’ nur weiter. Möchtest der Rache entgehen.“ Der Braune faßte den über den Boden gekrümmten von oben um die Hüften, hob ihn, schwenkte ihn. Einmal, zweimal sauste gerissen der Schwarzhaarige kopfabwärts, strampelnd herum. Am Boden, hingepoltert, spuckte er Blut, rollte, wackelte, blind, blöde auf: „Hähä. Weiter. Zwanzig.“ Der ruderte fünfmal durch die Luft; knapp an der Rampe krachte er, losgelassen, hin. Als er den Kopf drehte nach einer Weile, lispelte sein verquollener Mund: „He du. Eitler Hahn. Gearbeitet. Zwanzig. Ist noch nicht fertig. Wollen sehen, wann er fertig ist.“ Der Braune kreischte wie gebissen, kniete vor dem liegenden Schwarzen und nun, die Augen zukneifend, alle Gesichtsmuskeln zusammenreißend, schmetterte er, würgte, wühlte, klopfte, rollte, malmte an dem weichen Körper vor sich. Der richtete sich einmal, blau, japsend, auf, wollte die Augen aufreißen, brach einen Strom Blut, legte sich seitlich um. Der Braune, noch hingekniet, packte den Schwarzen mit beiden Fäusten beim Hals, zog den Rumpf lang am schlaffen Hals hoch, ließ ihn auf das Gesicht zu klappen. Wütend spie er sich in die blutbeschmierten Handteller. Unten lachte man schallend über sein böses Gesicht.
Der schmeerbäuchige Fürst zu Hohenzollern wechselte mit dem aufgestandenen Kurfürsten einige Worte. Die Wache formte sich zum Spalier. Maximilian sprach erregt auf Richel ein. Sie verließen die Halle. Leuchter wurden von Pagen in das Haus getragen.
Im kleinen Singvogelsaal bemerkte Maximilian, ohne den Jesuiten Kontzen oder Richel anzusehen: „Jedenfalls soll der Musketier belohnt werden und die ganze Patrouille, die den Boten abgefangen hat. Es war mir eine Genugtuung, diese Aufklärung zu erhalten.“
Richel auf dem Schemel: „Leider geht aus dem Handschreiben Meggaus nicht hervor, wie lange der Hof schon Geld für den Kaiser aus Kontributionen bezieht. Oder ob es nur eine einmalige Zahlung war.“
„Das Tüpfelchen auf dem I? Mir genügt es.“
Richel, den geschwollenen Zeigefinger an der Nase: Dieser Brief wiege so viel wie eine gewonnene Schlacht. Maximilian wechselte häufig die Farbe, er hatte die Knöpfe seiner Lederweste geöffnet, hauchte stark, von Hitze überströmt. Es dürfe nicht davon gesprochen werden, er werde selbst und allein mit dem Kaiser darüber verhandeln. Es kam zu keinen weiteren Debatten. Die Herren merkten, dies war eine Angelegenheit der Fürsten. Richel wurde entlassen.
Der Jesuit wurde mit funkelnden Augen gefragt, welche Treue ein Kurfürst seinem Kaiser schuldig sei. Kontzen sprang an: „Dem Kaiser alle Treue, dem Nichtkaiser keine.“ Des näheren ergab sich: Ferdinand der andere ist nur, und besonders nach dem eben aufgedeckten Vorgang, nur dem Namen nach Kaiser. Er hat die Machtfunktion an seinen General abgetreten. Man hat also keinen Kaiser, den man verraten könnte, und an dem Herzog von Friedland kann man keinen Verrat begehen. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder der Kaiser billigt willensfrei den Friedland oder er wird genötigt von ihm; im ersten Fall hat er sich seiner Herrscherattribute begeben; oder er steht in friedländischer Sklaverei. Man muß den letzten Fall bei seiner christlichen Frömmigkeit annehmen. Verrat an diesem Verratenen heißt ihm, als dem Kaiser, beistehen. Er konkludierte: Wie die Dinge liegen nach der Kapuzinerrelation und dem aufgefangenen Schreiben Meggaus ist es Pflicht jedes Deutschen, besonders jedes Fürsten, den Kaiser von seinem Vergewaltiger zu befreien.
Maximilian fragte leise: „Auch wenn die Befreiung des Kaisers mit Unterstützung fremder, ausländischer Mächte geschähe?“ Kontzen solle nicht gleich antworten, er möchte sich gut besinnen.
Wozu man, erhielt Maximilian zur Antwort, das Beispiel der Heiligen Kirche habe; ob sie Unterschiede zwischen den Nationen mache, ob es ihr nicht einzig auf die Sache ankäme.
Max ihn aus seinen kalten, traurigen Augen lange betrachtend: „Wenn meinen Untertanen meine Regierung nicht gefällt und sie zu meiner Beseitigung die Türken oder Schweden ins Land rufen, tun sie dann Recht?“
„Nur insofern tun sie Unrecht, als sie sich wahrscheinlich mit dem türkischen Einfall selber ins Fleisch schneiden; im übrigen —“
Der Kurfürst unverwandt den Jesuiten betrachtend: „Ich darf die Türken ins Land rufen oder ins Reich, wenn ich das Reich damit aufrichte?“ „Das ist nicht fraglich.“ Lächelnd schloß Kontzen aufstehend, es seien doch wohl nicht die Türken.
Wie ein Jäger seinem Hund pfeift, so hatte der sanfte Kardinal Richelieu seinem Volke das Signal gegeben, es hieß Habsburg. Deutsches und spanisches Blut lockte, duftete herüber; sich einwälzen, sich überkugeln, die Uneinigkeit vergessen!
„Wir müssen uns in Metz befestigen,“ sang er ihnen vor, „wir müssen nach Straßburg vordringen, um ein Eingangstor nach Deutschland zu erlangen. Geduld, Geduld! Ich will Euch nicht aufspießen lassen. Gebt mir noch Zeit, seid zart; ich werde mit süßer, offener Miene voranschreiten.“
Die Zähne seines Rades griffen in die Vertiefungen von Wallensteins Rad. Zu den Hanseaten, zum Dänen, Schweden, zu den Generalstaaten waren die verführenden Reden und Goldstücke gerollt, klirrten lauter in das Reich von Westen und Süden her ein.
Die Gesandten erhielten die Instruktion vom Kardinal: „Die Kraft Habsburgs ist der Herzog von Friedland; die Gegenkraft die Kurfürsten. Sie streiten sich um das Heilige Reich. Wir müssen sie streiten lassen, bis sie uns das Reich öffnen. Jetzt ist Habsburg stärker; reizt, stärkt die Kurfürsten.“
Wie eine sanfte Eingebung glitten die breiträdrigen Reisewagen mit dem großäugigen vornehmen Herren Marcheville, dem entschlossenen Soldaten Charnacé, Säbel über die Knie, über die hüglige Reichsgrenze, über den Rhein, in das Heilige Reich. Kaum beachtet in dem Lärmen der Durchzüge, schweigend, höflich wandten sie sich nach Süden und Osten, näherte sich Marcheville der Stadt Mainz, die Anselm Kasimir beherrschte, dem Gebiet Philipp Christophs von Trier, Köln unter dem Kurfürsten Ferdinand, in Dresden trat er vor Johann Georg.
Marquis von Charnacé war unterwegs von Fontainebleau, als Maximilian den Wunsch äußerte, einen Geheimvertreter des Königs Louis zu sprechen. Man hatte in Fontainebleau nichts versäumt; Charnacé trug Instruktionen mit sich.
Der Bayer saß unter einem Baldachin in der Ritterstube der Neuen Feste, saß vor einer langen ungedeckten Holztafel, an der der hochgelehrte Herr Bartholomäus Richel neben Kontzen schrieb und in Faszikeln blätterte, als Charnacé, ein unansehnlicher häßlicher Mensch mit rotem Gesicht und schielenden Augen von dem hohen Fürsten zu Hohenzollern hereingeführt wurde. Die Unterhaltung, bei der Charnacé es immer wieder ablehnte, sich vor der Kurfürstlichen Durchlaucht zu setzen, wurde fast allein zwischen dem Kurbayern und dem Marquis geführt; später holten die Räte Dokumente zu Hilfe, ein Sekretär des Franzosen im Vorraum durfte eintreten, das Akkreditiv des Gesandten diesem zur Vorlage überreichen, ferner eine große Blankourkunde mit der Unterschrift des katholischen Königs. Charnacé wurde vom Kurfürsten nach seinem kurzen Arm befragt; er erzählte in bescheidenem Ton von seinen Gefechten in Polen, dann: er käme auch von Larochelle. Näheres von dem Fall dieser Stadt, worauf Maximilian drängte, wollte er nicht hergeben; er erklärte streng, die hugenottische Angelegenheit sei ein Bruderzwist in Frankreich gewesen, sie sei erledigt. Es würde insbesondere der neu erstarkten gallischen Nation eine Freude und Genugtuung sein, Gelegenheit zu erhalten, ihre Macht und Einheit nun nach außen zu zeigen unter Führung des glorreichen dreizehnten Ludwig. Er sprach die Freude seines Souveräns aus, daß die Verhandlungen mit Bayern, die auf eine Beendigung des deutschen blutigen schreckvollen Krieges zielten, nun in rascheren Fluß kommen sollten.
„Ich habe,“ flüsterte Maximilian, der während der Unterhaltung müde an seinem Hut rückte, „seinerzeit den Herrn von Marcheville gefragt, was Frankreich in Deutschland für Ziele verfolge. Wollt Ihr mir darauf antworten.“ Charnacé, den Degen fest in der Linken, die Augen auf dem Teppich; ein Souverän hätte zum Ziel, und dies müsse er festhalten, die Zustände im Reiche, wie sie durch Reichsgrundgesetze, Goldene Bulle, Wahlkapitulation festgelegt seien, erhalten zu sehen; er möchte keinen gefährlichen revolutionären Nachbarn; er erblicke in der weiteren Ausbreitung der augenblicklichen inneren Gewaltvorgänge in Deutschland eine Bedrohung der französischen Grenze. Maximilian flüsterte nach einigen Worten: „Weiter.“
„Wir haben ein Interesse daran, im Reich eine Macht wie die Liga und einen Fürsten wie die bayrische Durchlaucht zu wissen, die den Stand des Reiches gewährleistet. Wir sind daher bereit, die Kraft der Liga auf jede erdenkliche Weise zum Schutz gegen den gewalttätigen ungesetzlichen Umsturz zu stützen — soweit man es von uns begehrt. Wenn ich genauer sagen soll, führen wir durch solch Vorgehen einen Präventivkrieg gegen das Reich. Unbedingt erkennt der katholische König daher die Kurfürstenwürde der gegenwärtigen bayrischen Durchlaucht an.“ Plötzlich endete der Franzose und fühlte sich auch durch den forschenden Blick des Fürsten nicht bewogen, weiter zu sprechen.
Richel rückte seinen Stuhl, überreichte herantretend dem Kurfürsten eine Note, auf eine Stelle mit dem Zeigefinger weisend. Ohne hinzusehen, nahm Maximilian das Blatt mit der Linken, mit der Rechten Mund und Kinn zudeckend, immer den Gesandten fixierend, der ruhig wartete. Dann Maximilian sehr bestimmt, keinen Ton lauter: „Der Herr kennt die Verhältnisse im Reich. Der Bericht des Kapuziners Alexander aus Prag soll, wie mir berichtet wurde, ihm vertraut sein. Ich habe wegen dieser uns überwältigenden Zustände den katholischen König ins Vertrauen gezogen, meinem Pariser Gesandten fleißige Korrespondenz mit den königlichen Funktionären befohlen. Die Liga, deren Oberster ich bin, hat kein Interesse, bei treuster kaiserlicher Gesinnung, diese Zustände hinzunehmen oder gar zu befördern. Sie wünscht Abschaffung der drückenden Fronden. Dies ist dem Herrn bekannt.“ Der verneigte sich. „Ich will nur angeben,“ präzisierte Maximilian, „welche Wege gemeinsamer Art denkbar sind. Es genügt die Erklärung der Liga, in kommenden Angriffskriegen des Kaisers sich neutral beiseite zu stellen, bei der Bewahrung der Neutralität aber im schlimmsten, ernstesten Fall der Hilfe Frankreichs gewiß zu sein.“ Hierzu seine Zustimmung zu geben, erklärte der Botschafter wieder gesprächig, hätte er Vollmacht und ausdrückliche Instruktion. Es läge dem katholischen König daran, ihre Friedensziele, die so segensreich für die Menschheit und die katholische Christenheit wären, auf eine möglichst sichere Basis zu stellen. Man werde glücklich sein in Frankreich, am glücklichsten am Hofe des Königs, eine katholische Phalanx mit der deutschen Liga geschaffen zu haben, die der Welt Friedensgedanken aufzwänge und die Rechtgläubigkeit unangreifbar machte. „Ich will,“ wiederholte nach einigem Abwarten Maximilian, „dann die Neutralität der Liga bei einem weiteren Angriffskrieg des Kaisers durchsetzen. Die bayrische Absicht ist weiter: Verteidigung gegen die Umsturzbewegungen im Reich, Verteidigung der Reichskonstitution, Verteidigung der heiligen Kirche; die französische Absicht darf dem in keinem Punkt widersprechen.“ Als Charnacé das Wort Bündnis hinwarf, hob Maximilian ablehnend beide Hände. Man möge nicht wie ein Holzfäller bei ihm eindringen. Die Not im Reich sei groß; dies vor dem kundigen Gesandten zu verhüllen, hätte er keinen Anlaß. Jedoch sei er deutscher Kurfürst und werde durch keine Vergewaltigung sich von der geschworenen Treue gegen die Römische Majestät abbringen lassen. Bei allen Einzelheiten sei festzuhalten: keine Präjudiz gegen Reich Kaiser und Kurfürstenkolleg. Die Räte sahen auf; Maximilian war erglüht, hatte die Zähne wie in Scham zusammengebissen; Charnacé blätterte gleichmütig in seinen Papieren: Durchlaucht werde freie Hand gegeben, sich der Hilfe des katholischen Königs nach Belieben zu bedienen; bei der Herzlichkeit der Gefühle Louis und Richelieus für das aus tausend Wunden blutende Deutschland sei ein Mißbrauch des Bündnisfalles unmöglich. Friede, Friede die gemeinsame Parole; geboren aus Erwägungen der Menschlichkeit Christlichkeit und Selbsterhaltung.
Weich schlich Maximilian in die Wilhelminische Residenz herüber in das enge Stübchen zu seinem Vater, dem Herzog.
Der Alte, im schwarzen Wollröckchen am Ofen, rieb seinem großen Sohn die Hand. Sie hockten über die Mittagsstunde zusammen. Den Kaiser Ferdinand bewarf Maximilian mit Bitterkeit. Dem Kaiser hat ein Satan diesen Wallenstein geschickt. Und nun floriert das Haus Habsburg und wirft seine Ketten und Schergen aus; es wiehert brünstig vor Glück, und er, der Wittelsbacher, muß es hinnehmen. Schande, Schande: er, ein Deutscher, müsse sich mit dem französischen König verbünden. Er sei gezwungen, mit Zähnen und Klauen und brüllender Offenheit den Stier, den Teufel anzufallen. Das Reich, das Heilige Reich, das er liebe, müsse er zerstören, weil es der Habsburger, der tolle, der Schalk, denn wolle. Nun käme es auf nichts an, als auf Habsburg und Wittelsbach! Die Masken, die lange festgeklammerten, endlich, endlich herunter! Zertrampelt das Römische Reich. Es gibt nicht mehr Kaiser, es gibt nicht mehr Kurfürsten; in den Abgrund alles.
Das graue Männlein ging neben ihm am Ofen hin und her, streichelte dem schmerzvoll Zerrissenen demütig die Hand, dankte innerlich Gott für seinen Sohn. Möge das Heilige Römische Reich sich selbst anschuldigen, schäumte der leichenblasse, die Tischplatte knetende Kurfürst, wenn es breit gewalkt werde, wenn die Sintflut der Ketzerei anwüchse, wenn die Grenzen durchbrochen würden. Es muß geschehen. Der Hüter des Reichs, der Vogt der Heiligen Kirche, der Mehrer des Reichs: Schande, Schande.
Den schieläugigen wartenden Charnacé behandelte er in seiner eigenen Kammer, das Degengehenk zu Boden werfend, sehr heftig. Ein Ende mit dem Gerede von dem mächtigen einigen siegreichen Frankreich. Er sei deutscher Kurfürst, Bayern und die Liga seien stark, er solle nach dem Haag gehen, sich vom Pfälzer darüber ein Lied singen lassen. Was habe Frankreich im Elsaß vor, was wühle es in Straßburg; der Bischof von Straßburg sei Mitglied der Liga; er werde keinen Angriff und Überfall da dulden. Er war erbittert und höhnisch. Man glaube nicht, sich die Not Deutschlands zunutze machen zu können und im Trüben zu fischen. Was habe Frankreich in Holland vor und plane mit den Generalstaaten. Nein, nein, Frankreich und der katholische König mißverständen ihn, den Bayern, gänzlich; er sei nicht der alberne Knecht, der in der Nacht die Tür zum Haus offen läßt, damit die Räuber einfallen können. Man wage es nicht, ihm so zu kommen. Da sei ihm der böhmische Schelm noch lieber.
Charnacé focht sicher. Er fühlte, der Kurfürst wünschte von ihm über Schwierigkeiten geleitet zu werden. Dunkle Punkte wurden im Dunkeln gelassen, helle beleuchtet. Maximilian wurde gegen den Schluß still.
Man kam so weit, über die Zahl der beiderseits aufzustellenden Söldner zu verhandeln. In dem Vertragsdokument war nach Maximilians Willen nichts zu vermerken von der Neutralität Bayerns und der Liga; das sollte brieflich abseits fixiert werden. Schweigend, ohne besondere Huld, wurde Charnacé abgedankt.
Maximilian fuhr in sechsspänniger Karosse auf den Berg Andechs. Der Heiland trug die bunte Wunderkrone der Heiligen Mechthilde. Wallfahrten zogen mit ihm, Prozessionen von Kindern mit farbigen Kreuzen, mit Geißeln, Speeren. Ungeheure, armdicke Kerzen wurden voraufgetragen; an seidenen, grell bemalten Fahnen kleine Glöckchen. Umschlungen von Kranken Gebrestigen der Pfahl mit dem Marienbilde vor der Kirche; sie lagen, von Priestern umgangen, in Krämpfen davor. Mütter hoben ihre Kinder hoch gegen das Bild, tasteten die Schmerzstellen der Kinder ab. Dabei sangen sie. Wie Balken stürzten einige hin, eben den freien Platz erreichend, schnellten übereinander; Kuttenträger beschworen die bösen Geister.
Selig Maximilian: Habsburg, nicht er hat das Römische Reich zerrissen.
Die Macht der Heiligen Kirche zu vermehren, war ihm, ihm und seinem Geschlecht zugedacht von den Himmlischen. Es sollte an ihm nicht fehlen.
Von der grauen windgefegten Meeresplatte bis auf Postenstellungen zurückgezogen, schob sich das Gros der Armee mit wachsender Stärke in das Zentrum Deutschlands und nach Süden. Es legte einen dichten Schleier über die kaiserlichen Erblande, stieg die Grenzberge hinauf.
Als die Fühlungnahme der Fürsten und Stände begann, die Proteste gegen die Anwesenheit und das grenzenlose Wuchern dieses Armeekolosses in allen Gauen schrillten, glomm im Süden plötzlich ein Funke auf, der sich im Augenblick zur Lohe entwickelte.
Ein Reichslehen jenseits der Alpen, Mantua, war durch den Tod seines Inhabers erledigt, die Nachfrage umstritten. Der Großneffe des Verstorbenen, ein junger Herzog von Nevers, glaubte nicht der Belehnung durch den Kaiser und Entscheidung des Rechtsstreites zu bedürfen. Da nahm der römische Kaiser, Ferdinand der Andere, Mantua und das zugehörige Montferrat in Sequester, und der Oberst eines Infanterieregiments, Graf Johann von Nassau, wurde als sein Sequestrationskommissar nach Mantua geschickt. Der junge Herzog leistete dem kaiserlichen Kommissar nicht Folge, gehetzt von Richelieu, der hinter ihm stand und einen Sprung in die Lombardei tun wollte. Der Römische Kaiser fragte in diesem Augenblick den Generalfeldhauptmann, ob er zu einem Zug nach Oberitalien bereit wäre, zur Exekution gegen Mantua.
Die Armee wurde formiert. Geschwollen fuhr es aus dem Prager Hauptquartier über das Reich, das Klagen dunstete wie eine Wiese in der Morgendämmerung: Man habe Krieg, möge jeder still sein, Kaiser und Reich sei beleidigt. Die alte Armee wuchs wieder; der Herzog brauchte zwei Armeen, eine zum Kampf, eine zu Kontributionen. Regimenter aus Schwaben marschierten südwärts, besetzten die Pässe der Graubündener Alpen, hingen wie eine Wetterwolke über Italien. Über das Meer war man nicht herübergekommen; die Alpen konnten nicht aufhalten. Und wie der junge Nevers noch schwankte, erschien der französische König Ludwig selbst mit einem starken Heer, rückte gegen die Stadt Susa und besetzte sie. Sie überschritten, eine neue Kriegsmacht, die Brücke der Doria; Richelieu, der schmächtige kinnbärtige Mönch, von allen Waffengattungen bejubelt, ließ im grellen Märzsonnenschein am Brückenkopf sein geharnischtes Roß voltigieren, zwei Pistolen trug er am Sattelbug, das lange Schlachtschwert an der Seite, den wallenden blauen Federhut. Pinerolo fiel, die Alpenpässe wurden geöffnet, das Heer stürzte an, zehntausend Mann, gejagt von ihren Marschällen Krequi, Schomberg, La Force.
Losgelassen die Kaiserlichen hinterher, unter dem Grafen Kollalto. „Der Herr Bruder ziehe Menschen an sich,“ schrieb der Böhme, „das Reich hat genug, ich vermag nicht zu bewältigen, was zu mir kommt. Je mehr ich aufnehme an kräftigen Männern, um so sicherer wird der Widerstand im Lande hinschmelzen; vor dem Knurren und Keifen alter Weiber und Kanaillen fürchte ich mich nicht.“
Kompagnienweise wurden die Söldner bei den ersten Scharmützeln verschlungen. Aus Wallensteins Quartier flogen der Kriegskommissar Metzger und der Rittmeister Neumann her; ein neues Lied hatte angefangen. Sie drängten gewaltig den schlachtengierigen strategielüsternen Kollalto zu Attacken; hielten verschlagen mit Artillerie und Harnischen zurück. Sie reizten durch verräterische Meldungen den Franzosen zu Angriffen; worauf die deutschen Verluste wuchsen.
Und Ludwig, wie er triumphierte über die albernen vielgerühmten Wallensteiner. Er machte sich anheischig, sie in fünf Monaten mit Stumpf und Stiel in Italien auszurotten. Und so gewiß war er seiner Sache, daß der noch ängstliche junge Herzog von Nevers, der Prätendent, die kaiserliche Fahne in Casale einzog. Die friedländischen Regimenter, deren Verluste furchtbar waren, meuterten nicht; die Landschaft blieb üppig, Ortschaft um Ortschaft wurde ihnen zur schonungslosen Plünderung mit Gütern und Menschen preisgegeben, zur Reizung und Betäubung.
In Prag wiegte sich Wallenstein; Patente für neue Truppenkörper flogen aus seiner Kanzlei; er hieß sie, für einige Monate die Zügel im Reich etwas schlaffer halten, der Kaiser brauche ein Heer, der italienische Krieg verschlinge Massen, man müsse locken, locken. Mit rasendem Pfeifen, Heerpauken durchzogen die Werber die Landschaften, fuhren Wagen voll des besten Geldes, jagten in die Wälder zu den neuen Siedelungen der Vertriebenen; schlugen eine gute Musik, bunte Schärpen, wilde Hüte, Macht über Männer und Weiber. Möchte lieber wer von den Verkommenden arm und Knecht sein. Der Krieg in der italienischen Ebene war ein Schlund, er schluckte und spie in die Gräber.
Bassewi ging den harten Herzog an. Der gab zurück: „Jammere er nicht, Bassewi. Er hat keinen Grund, über diesen Tod zu klagen, wo kein Deutscher einen Finger aufheben würde, wenn sein ganzer Stamm an einem Tage weggerafft würde. Wir kommen von der Stelle. Oder zweifelt er?“ Der weißhaarige Jude schüttelte mit weiten starren Augen den Kopf: „Ich werde nicht zweifeln, daß dem Herzog von Friedland irgendein Erfolg ausbleiben wird. Ich werde nicht daran zweifeln. Ich würde glauben, wenn der Herzog von Friedland ein Jude wäre, würde die arme Judenschaft morgen nach Palästina wandern können und das Reich Salomos neu begründen.“ Wallenstein lachte kräftig: „Hinbringen könnte ich Euch schon; aber der Großherr in Konstantinopel würde Euch verspeisen. Es wäre kein so schlechter Gedanke eines Christen, Euch hinzubringen.“ Der Jude runzelte die Stirn: „Bewahre mich Gott. Ich bin zufrieden, daß Ihr uns wohlgesinnt seid.“
Zwischen seinen grellgeputzten Vogelhäusern und Fischteichen spazierte Friedland mit seiner schönen Frau, im Vergnügen über das milde Winterwetter.
Sein Vetter, der klobige Oberst Graf Max Wallenstein führte neben der Herzogin ein Bologneserhündchen an der Leine. Friedland stand auf dem Kies, seinen Stock vor sich am Boden einstampfend: „Hätt’ ich geglaubt, daß die Dinge bei Mantua solchen Verlauf nehmen. Der Mund wird denen im Reich gestopft. Schaff’ mir Leute heran, Max; die Deutschen gehören nach Italien. Hast du bemerkt, was der Franzose macht. Er will ein Feind Deutschlands sein. Der! Richelieu, der überfeine, glaubt, uns in der Tasche zu haben. Sein Pater Joseph, der Kapuziner, er und der Tölpel Ludwig haben uns schon. Eine Freude! Er bringt unsere Feinde um, jeden Tag hundert mehr; wie gut sich die Menschen eignen zu unserer Bedienung. Und wir — wir haben jeden Tag ein Stückchen Sorge weniger.“ Gepeinigt pfiff die Herzogin ihrem tanzenden Hündchen; sogar Graf Max sah betroffen an seinem Zobelpelz herunter. Wallenstein prahlte, mit seiner knöchernen Linken heftig gestikulierend: „Wir werden stärker; aber er kriegt den Kaiser nicht herunter. Er kann es anstellen, der besessene Seidenspinner, wie er will, er tut uns einen Dienst. Die Franzosen, Max — die haben mir gefehlt.“ Er zotete vor der erblassenden Herzogin von der vortrefflichen Franzosenkrankheit, die sein Heer befallen hätte. Sprudelnd zog er die Arme der zu Boden blickenden Frau an sich.
In dem kleinen astronomischen Kabinett, in einem Flügel seines Palastes, mußte bei Fackelschein der paduanische Astronom Argoli, mit seinem sanftmütigen schmeichelnden Schüler, dem Johann Baptist Zenno, die Aussichten des Feldzugs berechnen. Pläne auf Pläne legte er ihm vor, sie hatten die glückbringenden Tage anzugeben. Die unermeßliche Nacht blickte zu ihnen herein. Erregt, vor sich murmelnd, ging Friedland unter der Bronzetafel, in die sein eigenes Horoskop eingegraben war: „Tiefsinnige, melancholische Gedanken macht Saturn, die menschlichen Gebote werden verachtet. Jupiter folgt. Der Mond steht im Zeichen der Verworfenheit.“ Friedland stellte sich unter Knurren und Lachstößen neben Argolis Fernrohr: „Ich bin ein frommer Christ, Argoli. Du weißt, was ich gestiftet habe. Man wird mich nicht für teuflisch halten, weil du mir die Geheimnisse Gottes deuten sollst.“
Die unaufhaltsam über die Lombardei niederströmende Menge breitete sich aus. Von der Schweizer Grenze blühend Gebiet neben Gebiet, das Herzogtum Savoyen, Piemont, das spanische Mailand, die große Republik Venedig von Bergamo bis Belluno, Gradiska. Was geneigt war, sich aufzubäumen, bäumte sich auf. Im Süden der Staat des gewaltigen von Civitavechio bis zum Kastelfranko herrschenden Papstes Urban.
Er hatte mit Ruhe den deutschen Krieg toben sehen; jetzt brüllte er über das Vordringen der Männer aus dem fluchwürdigen Lande, das die Ketzerei geboren und großgezogen hatte. Der brutale spanische Botschafter Gasparo Borgia fuhr stolzgebläht zur Audienz beim Heiligen Vater, der ihn nicht zuließ; aber feierlich holte der Kardinalstaatssekretär Franzesko Barberini, der Nepot, die bayrische Kreatur Krivelli aus seinem Quartier ab zum Papst.
Der Papst schnob gegen ihn: das Haus Österreich ist der Kirche abtrünnig geworden, daß es keinen Fürsten mehr achte; maßlos übermütig, mischt es sich in die Verhältnisse Italiens ein, mit gräßlichen Massen des Abschaums aller Nationen bewirft es den blühenden Boden der Lombardei; die Züchtigung Gottes wird nicht ausbleiben; von solchem Treiben des Hochmuts wendet sich der Gerechte ab.
Mit donnernder Stimme warnte er vor Eingriffen in seinen Machtbereich; der Papst sei vom Heiligen Geist selbst auf den Stuhl gehoben, er habe die Pflicht, die Gerechtsame Gottes wahrzunehmen. Die Verbrecher würden es so lange treiben, bis das Breve der Verdammung an den Kirchentüren angeschlagen werde und er alle Kreatur gegen sie aufrufe.
Der Gesandte des Wiener Hofes wagte sich zum Protest in den Vatikan. Der achte Urban, auf seinem Stuhl sitzend, ein ungeschlachter graubärtiger bäurischer Mann in weißseidener Soutane, einen roten breitkrämpigen Filzhut auf dem glühenden Kopf, übergoß ihn mit ätzenden Worten: „Die höchste Richtergewalt liegt beim Kaiser. Wie aber kann ich richten, kommt nicht mein Amt und Richterspruch von Gott? Wie kann ich mich vergreifen, wie darf ich es an Gottes Geschöpfen? Denn diese Menschen sind vielleicht kaiserliche Untertanen oder kaiserliche Unterworfene, aber sie sind auch Gottes Geschöpfe. Und wir wissen doch, daß wir im letzten Augenblick gleich sind vor dem himmlischen Herrn, gleich die Richter und Gerichteten. Sie werden beide nicht leicht zu schleppen haben. Fürchten sich die Herren dieser Welt, daß sie sich nicht gar zu viel aufbürden! Der Triumph des Rechtes wird nicht ausbleiben.“
An das umstehende Kolleg wandte er sich, sich schüttelnd vor Abscheu, den Gesandten keines Blickes mehr würdigend: „Es gibt Menschen, die ihre Machtgelüste auf das schamloseste, auf das tiefste beleidigend maskieren. Sie wagen es mit dem Schein der Frömmigkeit sich zu schmücken. Es ist schwer zu verstehen, wodurch sich diese Menschen, wenn sie richten, von Mördern unterscheiden und von Dieben, von Räubern. Die lombardische Erde wird davon zeugen. Ich will nicht mehr davon sprechen, es ist uns ein grausiges Geschick, daß dies in die Zeit unseres Wirkens hineinschlägt.“
Wie er sich wand, seine Flüche auswürgte, die Befestigungen an seiner nördlichen Grenze beschleunigte, Söldner anwarb, klangen die herrischen Wünsche aus dem Reich herüber: der Kaiser Ferdinand der Andere, der geliebte Sohn der Kirche, begehre sich krönen zu lassen vom Heiligen Vater; Urban möge ihm entgegenziehen bis Bologna oder Ferrara. Auch sollten die Lehensrechte des Kaisers über Montefeltro und Urbino untersucht werden. Das Schrecklichste an Drohung, was man im Vatikan vorausgesehen hatte, kam aus dem Hauptquartier des übermächtigen Böhmen: man möge sich nicht sperren in Italien; Rom sei vor hundert Jahren schon einmal geplündert worden, inzwischen wäre es noch viel reicher geworden.
Und während alles an der Nord- und Ostgrenze des Reiches ruhig blieb, die Armada bändigend mit eisernen Netzen über Deutschland lag, Italien aufschäumte, wurde im Triumph in die Wiener Hofburg der uralte Karmeliterpater Dominikus a Santa Klara eingeholt, der in der Entscheidungsschlacht am Weißen Berge den Siegeswillen der Ligisten hochgehalten hatte. Er wollte daran erinnern, daß alle Macht und Übermacht des Kaisers nur errungen sei durch die Kirche, die Fürsprache ihrer Gebete. Der Kaiser sollte ehrerbietig sein und ablassen von dem Mordversuch auf die heilige Mutter. Nach wenigen Tagen erkrankte der schwache Mönch, von der langen Reise angegriffen, starb unter Ferdinands Augen. Abends fand das Leichenbegängnis von der Hofburg nach dem Karmeliterkloster statt unter den Klängen aller Glocken; Ferdinand und seine Familie warteten in der Karmeliterkapelle.
An diesem Abend suchte durch den langen unterirdischen Gang der Kaiser seit langem wieder den Fürsten Eggenberg in seinem Hause auf. Er erklärte, es sei bei der überwältigenden Wendung der Dinge, bei dieser sichtbaren Erhebung des Hauses Habsburg durch Gott und die allerseligste Jungfrau notwendig, an die Sicherung des Erreichten zu denken. Er sei ein Mensch, hinfällig. Er wolle seinen Sohn neben sich sehen. Eggenberg möge die Nachfolgerfrage, die Wahl zum römischen König, in Angriff nehmen.
Es gab in den europäischen Ländern unzählige Orden von Männern und Frauen, die das Wunder des Jesus von Nazareth vereinte. Die erneuerten alten Orden der Dominikaner, Franziskaner, Benediktiner, die Kapuziner, Theatiner, die Kampforganisation der Jesukompagnie. Die Feuillantinen, Frauen, die maßlosen Bußübungen oblagen, so daß sie zu Massen hinstarben und der Papst einschreiten mußte, Nonnen und Mönche, die Tag- und Nachtwache sich auferlegten, Stillschweigen, unaufhörliches Anbeten des Mysteriums der Eucharistie. Die Nonnen von der Schädelstätte, die die Regel des Benediktus beobachteten: durch unausgesetztes Beten am Fuße des Kreuzes Buße zu tun für die Beleidigungen, die dem Heiland angetan waren, sie auszulöschen, wenn sie je auszulöschen waren. Der Orden von der Heimsuchung des Franz von Sales und Chantal, der vor Entzückungen warnte; man müsse durch Arbeit beten. Die Ursulinerinnen, die Männerkongregation von Sankt Maur. Über allen schwebte ein Hall des Schreis, der am Tiber von den fürstlichen Anhängern des Barberini und dem römischen Pöbel ausgestoßen wurde beim Gerücht, daß der deutsche Kaiser sich nach Rom durchkämpfen wolle, um sich vom Papst salben zu lassen, und daß ein neuer Ferdinand römischer König werden sollte: „Ghibellinen! Ghibellinen!“ An den Moles Hadriani, den neronischen Wiesen, an der neuen Mauer Urbans am Kapitol, Lateran, an den Thermen des Diokletian und des Karakalla, von der Skala santa, am Palazzo Caffarelli, Massini, Farnese. Wühlen in allen Gliedern der Kirche: man wolle dem Papst zu Leibe, es ginge wider den Vatikan. Wutausbrüche des gestachelten Urban, umgedeutet in ängstliche Klagen um den Bestand der Kirche.
Ein Fanal war der vom Papst genehmigte Raub der Asche der großen Gräfin Mathilde aus Mantua, die eine Freundin Gregors im Kampf gegen den sächsischen Kaiser Heinrich war: man werde sich wehren, sich nicht totquetschen lassen.
Und aus tausend Rinnsalen quoll nach Deutschland der Haß. Wallenstein schickte Truppen durch Graubünden, schwere Belagerungsartillerie ließ er mit Mauleseln herüberschleppen. Eines Tages riefen in Rom Mönche und Laien aus, was in Prag und Wien allen bekannt war. Daß der Herzog von Friedland sich selbst an die Spitze der italienischen Armee zur Aufrechterhaltung der Kaiserlichen Hoheit in Italien stellen werde. Sie kreischten frenetisch in Rom: „Die Barbaren kommen! Die Goten!“ Man stellte sich dem tollwütigen verfinsterten Papst für Schanzwerk Geschützguß Kugelguß zur Verfügung. Er reiste mit dem Kardinalstaatssekretär und dem venetianischen Botschafter an die nördliche Grenze seines Gebiets. Hundert römische Edle, gewappnet in leichten Eisenpanzern, die Pferde unter klirrenden Plättchenpanzern, ritten seiner Karosse vorauf; eine starke Rotte schweizer Gardisten, blaue Wämser, Piken, Birnenhelm mit aufgebogener Krempe aus blauem Eisen, prächtige Offiziere in rotem Samt umringten ihn. Außerhalb Roms sprengte der Papst, auf seinem schwarzen riesigen Gaul ragend unter einer goldgestachelten Stahlkappe, in einem schwarzen Panzerhemd mit Samtkragen und Ringpanzerbeinkleid, Bronzeplatten vor dem gewölbten Leib, vor den Knien Platten mit Stacheln, seine Stimme tobte, er drängte vorwärts. Französische Offiziere trafen aus Grenoble ein.
Sie krochen aus Erdhöhlen herauf, lehmbraune Männer, verkniffene ängstliche Mienen, schmierige Bauernkittel, suchten mit den blinzelnden Augen die flach unter ihnen abfallende Ebene ab, die grünen windgeschüttelten Gebüsche, winkten, pfiffen rückwärts. Kinder arbeiteten sich hoch, lichtscheu, verschüchtert, Weiber, langzopfig, mit sandigen Hauben, schüttelnd die braunen Röcke in der grauweißen Morgenluft. Der hohe Waldrand belebte sich, das Dickicht zwischen Kiefern und Buchen wurde durchbrochen; leise Pfiffe. Kleine weiße Zelte in Doppelreihen hinten in der Ebene, dünne, hohe Lanzen die Dorfhäuschen überragend; das Steinkreuz am Fuße der Berglehne umgestürzt; Pferdewiehern, einzelne Schüsse; Qualm in trüber Schicht unbeweglich über einigen Schindeldächern, weit am andern Ende des Dorfes Wägelchen die Allee aufwärts gezogen. Links am Horizont der Kirchturm von Zittau. Oben schleppten die Männer Spaten und Beilpiken aus dem Wald, wühlten einen angebrochenen Graben auf, tiefer, breiter, zogen ihn, immer still sich bückend, halblaut sich anrufend im Zickzack über den Hang durch lange Stunden. Vieh blökte im Wald; Weiber Kinder waschend kochend am Feuer, dessen Rauch durch breite hochüberspannte Rinderfelle verteilt zwischen den Baumwipfeln in losen Zügen sich verlor. Kleine Männertrupps, in der Mittagsstunde, verstreut, sich abwärts lassend, das Dorf umschleichend, umfaßten von zwei Seiten einzelfahrende Wagen, schlugen die Söldner nieder, schleiften die Säcke in die nahen Verstecke, stahlen sich abends wieder hoch.
Bäume gefällt, Pallisaden gezogen. Höhlenquartiere, Waldquartiere in der Lausitz. Gemeinden von rachsüchtigen Kompagnien angegriffen, zerschlagen, auf der Flucht bei andern unterkriechend. Aus der Lausitz, in Böhmen sammelten sich wandernde zigeunerartige Scharen, stiegen suchend die Felsgewände der Elbe entlang, zwischen den Rebenpflanzungen, den blühenden Feldern mit Hopfen, Raps, Rüben. Machten offene Städte unsicher, plünderten die Obstwälder bei Leitmeritz; auf den weidenbepflanzten Auen bei Melnek lagen Leichen von Verhungerten; viele Weiber, Kinder blieben in Dörfern zurück. Durch das finstere Moldautal drängten die Massen, ziellos, in einem leidenden Trieb. Dreitausend umschwärmten die Tore Prags. Man wußte nicht, was sie dort wollten. Die Bürgermeister der Alt- und Neustadt schickten Brot in Körben heraus, Wegweiser durch Böhmen. Das Gedränge gab sich nicht; sie wollten herein nach Prag; sie redeten sich ein, der Kaiser wäre da. Als der Verkehr an den Toren erheblich gestört wurde, eine Anzahl Boote auch an der Hatzinsel anlegten, bis vor die große Brücke vordrangen, befahl der Oberst der Garnison, sie zu verjagen. Die Flüchtlinge hatten sich durch ihre Weiber und Kinder verstärkt, wurden durch Peitschenhiebe Hellebarden Salven scharfer Schüsse auseinandergesprengt. Die großen Massen, bestürzt, ohne Fassung, ratlos verloren sich; nach zwei Tagen fand man im Umkreis Prags keine Rotte mehr. Im Judenviertel der Stadt jubelten manche bei den Schüssen, man stand in starker Hut; die meisten aber schlossen sich in ihren Häusern ein, viele bedeckten weinend die Gesichter.
Eine Welle verlief sich, andere kamen. Sie drängten zum Kaiser um Rettung. Rotten tasteten sich hungernd im Land herum vom Harz her bis nach Schwaben; während manche sich stumpf forttrieben, verfielen andere einem Götzendienst, flüchteten verwildert zu Wald- und Flurgeistern, Kobolden, Marzabilla, Waldschützen, Moosweibchen, schlichen gedrückt um Kreuzessäulchen. Wo das Gesindel in die Städte hereinverschlagen wurde, wurde es wieder herausgepeitscht. Gerüchte von Kreuzschändung, Ausübung todbringender Malefizien schleppten sie mit sich; man hing es ihnen an, aber vor manchen Städten wurden viele belauert, umstellt, nach kurzem Verhör aufgeknüpft, auch gerädert.
Wie anklagende Chöre erschienen Menschenscharen immer häufiger vor den Toren der größeren Städte; hinter ihnen her ritten Abgesandte ihrer Bischöfe Herren Fürsten, drohend, sie sollten an ihr Werk gehen, auf die Äcker, an die Mühlen, in die Bergwerke, warnend vor der Abwanderung. Sie wollten immer zum Kaiser, wußten nicht wozu. Der Kaiser war mächtig, seine Armada mächtig, er solle Frieden machen. Unterwegs sagten sie sich vor, was sie bedrückte: Kriegslasten auf ihren Schultern, Getreideabgaben, Abgaben für Fallholz, Schweinehafer, Kapaun, Kleinvieh, der dritte Pfennig vom Gemeindeholz, der kleine Zehnt, Salzsteuer, Brennöfen, Mühlen, Wegzoll, Jagdgeld, Marktgeld, Siegelgeld, Heiratsabgaben. Lachten, der Kaiser ist mächtig, er wird noch mehr können als dies. Im Brandenburgischen erschienen sie mit Fahnen, bald tausend stark, demütig in Ehrbarkeit, Schöffen, Ratsmannen und Richter um Speisen bittend, man möchte ihnen nichts antun, sie wollten zum Römischen Kaiser mit Bittschriften. Man gab ihnen, schob sie ängstlich ab. Viele verdarben am Wege. Als sie sich der bayrischen Grenze näherten, ließ sie der Kurfürst durch seinen Kriegskommissar fragen, ob sie dem Bauernaufgebot, den Landfahnen, eingereiht werden wollten. Antworteten, sie kämen gerade des Krieges wegen, dessen Beseitigung ihnen am Herzen liege, sie hätten so viel Kontributionen zahlen müssen an Freund und Feinde, dazu den großen Zehnt, den kleinen Zehnt, den Schweinehafer, Salzsteuer, Brennöfen, Wegzoll, Kleinvieh, Kapaun. Darauf wurden sie von einer kleinen Söldnerrotte und fünfzig Pferden mühelos versprengt, gefangen, in die Büsche gejagt. In Klöstern fanden manche Zuflucht. Da erfuhren sie, daß der Kaiser alles bewältigen und niederschmettern wolle, Kaiser und Friedland sei ein und dasselbe, auch den Papst wollten sie beseitigen, man müsse beten zur himmlischen Jungfrau, daß der Papst die Oberhand behalte und dazu die ergebenen Fürsten des Reiches.
Die Kaiserin war mit dem rebellischen Herzog von Nevers verwandt. Sie war an Ferdinand, als die Stifter der Kirche zurückgegeben werden sollten, herangegangen wie Flamme an Holz, hatte um ihn unbändig gewallt. Jetzt erschrak sie. Ein geheimer Stich; von Tag zu Tag stach es tiefer. Sie mußte sich zurückziehen. Was hatte sie getan, wie hatte sie gelebt. In welche Verderbnis trieb sie der Mann neben ihr, in brütender Besessenheit rührte er an Italien. Sie war ihm nichts. Von Mantua fühlte er nichts. Sie keuchte aus dem Schlaf auf, ekelte sich vor schwarzen Männern, die in großen Mänteln nach ihr liefen, hinter ihrem Bett mit Messern und Federhüten vortauchten. Die ekstatische Frau war plötzlich aus ihren Fiebern gerissen. Erkühlt unter dem unfaßbaren Schrecken, die Horden Friedlands, des Schlächters, könnten über ihre süße Heimat kommen. Sie besann sich mit hereinbrechendem Wohlgefühl auf ihre sonnenklare Jugend; es war ein Blick durch den Spalt eines finsteren Zimmers.
Widerstrebend strich sie um Ferdinand, näherte sich ihm. Sie zwang sich ab, zu betteln für ihren Vetter Nevers und ihre Stadt. Lauschend kniete sie vor Ferdinand, dem dunklen Mann, horchte gepeinigt in ihn hinein. Es war keine Frage um Mantua, sondern um ihn.
Ferdinand in sakraler Ruhe verstand nichts. In eherner Überlegenheit hing er über den Parteiungen in seiner Umgebung, sah grau auf das Gezänk herunter, mißtrauisch, gefühllos. Er schenkte, schenkte. Was für Jesuiten geschah, betäubte die Patres selbst. Cäsarisch duldete er nicht, daß man ihm danke. Er sagte aus seiner Starre heraus der Mantuanerin, der junge Herzog werde zu seinem Recht kommen, nach erfolgtem Spruch und nicht früher werde die Belehnung erfolgen. Sie flehte, seine braune schlaffe Hand küssend: „Du hast den Patres so viel gegeben, deine Räte sind reicher als ich.“ „Haben meine Räte und die Väter von mir Geschenke erhalten? Ich weiß nichts davon. Sie mögen sich nichts anmaßen.“ Sie betrachtete ihn, das goldene Vlies über der Brust, von unten herauf, der graue zitternde Bart, hörte das rauhe Murmeln. Das war der unverständliche Barbar, der sie durch den galanten Eggenberg aus der Lombardei geholt hatte. Durch ihren Kopf irrte, sie wußte nicht wie, plötzlich und hartnäckig die Erinnerung an ein fremdes Gespräch rechts von ihrem Fenster: „Hast du mich gern, tanze morgen Nacht mit mir.“ Es waren lustige Kavaliere mit ihren Damen gewesen, die so zueinander sprachen; warum ihr das zarte Geflüster einfiel. Aufgewühlt verließ sie den schnalzenden Kaiser, der ihr wie eine Pagode nachblickte.
Vor einem lärmendem Vogelhaus, nahe der Brunnenstube ihres Schlosses Schönbrunn, saß Eleonore in einer Rosenlaube; in Mantel und schwarzen Schleiern gingen zwei italienische Damen draußen auf und ab, Paula Maria a Jesu und Maria Theresia von Onufrio. Sie sagte zum alten Eggenberg: sie habe Zutrauen zu ihm, sie bitte ihn bei der Liebe Gottes, den edlen Frieden zu befördern, soweit er vermöchte. Er fragte sie, vor ihr stehend, bei aller Ehrfurcht mitleidig ihr zuhörend, was sie befehle. Warum man ihn so selten sehe, beim Quintanrennen nicht, bei keinem Reiterkarussell, bei keiner Hetzjagd; er scheine eine Abneigung zu haben gegen sie oder den Kaiser. — Ach, er sei krank. — Nicht so sprechen, ob sie noch Zutrauen zu ihm haben könne: sie bange um ihre Heimatstadt; der Krieg sei ungerecht vom Zaun gebrochen, der junge Nevers sei von Frankreich verführt worden: mein Heiland, und es könne doch nicht so gehen, daß man Italien verwüste, wie man Niedersachsen oder Böhmen verwüstet habe; man könne doch nicht mit aller Welt Krieg führen, mit dem Heiligen Vater; warum denn, warum denn nur.
Da stand im Schatten am Pfosten der Laube Hans Ulrich Eggenberg; auf den Stock stützte er die linke Hand mit dem blausamtenen Hut; auf dem hohen steifen Mühlsteinkragen bewegte sich sein weißbärtiger Kopf wie auf einem platten Teller; das spanische goldene Vlies über der Brust blitzte unter dem Spiel des Sonnenlichts; er lächelte für sich still, seinen Stock entlang blickend; er hätte sich niemals unterfangen, gefährliche kriegerische Praktiken anzuspinnen; die Dinge hätten den schweren Lauf selbst genommen; wie schwer sei es, ihnen zu gebieten.
Sie saß gerade auf ihrem Stuhl, die Augen zwinkernd; die schwarzen Haare gescheitelt, zu einem Knoten in den Nacken herabfallend, aus dem senkrecht nach oben eine mächtige vornübersinkende Reiherfeder stieg. Sie ballte die Hände in den weißen Reithandschuhen über den zusammengedrückten Knien; ihr gelbes Kleid lag in vielen Falten lose weit um sie: er hätte sie geholt aus Mantua, ihm sei sie in Vertretung des Kaisers angetraut; an ihn hänge sie sich. Habe man Glauben, um an der Gerechtigkeit und dem Glück zu zweifeln; es müsse verhindert werden, daß aus ihrer Geburtsstadt eine Trümmerstätte werde; sie könne es nicht zugeben, und wenn sie —. Dabei bückte sie sich, hob eine Hand vor das Gesicht, richtete sich rasch hoch, sah starr seitlich in einen Winkel. Als wenn sie ein Kind wäre, studierte Hans Ulrich ihr Gesicht, die trotzig aufsteigende Feder über den hilflosen zerrissenen zitternden Mienen; rasch, geschäftsmäßig erklärte er: es sei nicht Schuld des Kaisers, wenn es zu diesem Krieg gekommen wäre, lose Stücke hätte noch kein Habsburger unternommen. Schlimm sei es, daß der junge Nevers sich habe von Frankreich zu respektloser Haltung erregen lassen; vielleicht sei es möglich, ihn von Frankreich zu trennen. — Sie wolle, äußerte sie, nicht von Schuld und Unschuld reden; man möchte ihr nicht ihre Geburtsstätte nehmen; sie habe, brach sie aus, so viel opfern müssen, als sie Italien verließ, man möge doch an sie denken. Stand auf, reichte ihm, der seinen Hut fallen ließ, die eisige Hand, blieb vor ihm stehen. Er lächelte herzlich, erwiderte ihren Händedruck; es sei schwer, rasche bindende Versprechungen zu geben, es sei allen im Lande schmerzlich, den Heiligen Vater gegen sich zu sehen; er nehme Gott zum Zeugen, daß er den edlen Frieden nach Kräften fördern werde; Frieden müsse werden, schrecklich wüte die Christenheit gegeneinander, vielleicht arbeite man für niemand anders als den Großtürken in Stambul. Sie freute sich, heftiger seine Hand umklammernd. „Mir ist ja nicht mehr gegeben,“ flüsterte sie, schon den Rock raffend, „als Euch meine Wünsche zu sagen.“
Die durch den kaiserlichen Wunsch auf Wahl seines Sohnes zum römischen König entstandene Sachlage wurde im hohen Rat erörtert.
Da saßen die, die verzaubert waren vom Herzog zu Friedland, und lachten. Man solle den Herzog lassen, sagten sie, und den Papst und Frankreich; es sei das beste, was der Geheime Rat jetzt tun könne; das Spiel sei vorzüglich im Gange; sie hätten den Vorteil, gänzlich außerhalb der Partie zu stehen, einzugreifen, wenn es ihnen gutdünke. Welche Entwicklung aber die deutschen Dinge durch ihn nehmen würden, das sei geradezu phantastisch abzusehen, ja phantastisch. Sie spiegelten sich in diesen Gedanken. Friedlich saß der verwachsene Graf, gelbweiß von Gesichtsfarbe, mit den Fingern spielend im Lehnstuhl, lächelte überlegen, gähnte viel. Die Wahl zum römischen König würde ihnen wie eine Frucht zufallen.
Der lange Strahlendorf brauchte mit Hinweis auf Trautmannsdorf die Wendung vom friedländischen Anhang am Hofe; schreiend, der Wagen sei verfahren, er hätte genug dagegen rebelliert; wälze die Verantwortung dafür ab. „Wofür? Wofür?“ spöttelte der Bucklige, „für den Sieg Habsburgs?“ Brüsk warf sich der steife glattrasierte Mann im Stuhl zurück.
Im violetten Seidenmantel, das schwermütige olivfarbige Gesicht mit den starken Brauen auf die beringte weiße Hand gestützt, blickte Slavata gegen den Ofenwinkel, der mit einem blaugrünen Gobelin verhängt war. Seine blauen Augen schweiften zu Trautmannsdorf, der sich in seinen Stuhl verkroch, gingen oft hin; er sprach anders: es bestände keine Aussicht, den kaiserlichen Wunsch auf legale Regelung der Nachfolge durchzuführen, denn die Kurfürsten seien über die Gewalttätigkeiten im Reich, die Verarmung, den drohenden Umsturz erbittert. Dennoch müsse die Nachfolge des Kaisers gesichert werden. Man müsse also die Kurfürsten eventuell zwingen.
Strahlendorf lachte höhnisch: „Wie denn, Herr Graf?“
„Durch dieselbe Gewalt, die sie zur Erbitterung gebracht hat.“ Dazu klatschte leise der Bucklige, dem Böhmen zuwinkend, Beifall.
Es sei wohl auch das Beste, so zu verfahren, höhnte Strahlendorf weiter, in anderer Hinsicht. Man käme dann zur Klarheit überhaupt über die Herrschaftsverhältnisse im Reich; zum Beispiel in Pommern, in Brandenburg, in den meisten Kreisen mit kleinen Landesfürsten. Da würde sich herausstellen, wer herrsche. Trautmannsdorf jubelte fast: natürlich, so sei es, es würde fesselnd bis zum äußersten werden; Konsequenzen über Konsequenzen könnten noch gezogen werden: wie notwendig — er wandte sich armeausstreckend an alle Herren — nicht einzugreifen, um nichts zu verderben oder zu komplizieren; das beste, diese Frage der Nachfolge nur in die öffentliche Diskussion werfen, an diesem Punkt könnte sich der Streit auf das bequemste entzünden: nun hätte man den Zankapfel in der konzentriertesten Form, alle Kräfte würden aufgerufen, um — nun, man würde sehen.
Ihm fehle, klammerte stolz Strahlendorf seinen Degen zwischen die Knie, die Munterkeit und der leichte Sinn, um Angelegenheiten des Kaiserhauses in solcher Weise zu behandeln. Slavata hob sein dunkelblondes Haar mit der Linken von den Schultern ab, als wenn er seinen Nacken kühlen wolle; er betrachtete sinnend einen Sprecher nach dem andern, lief gebunden dem Gespräch nach: man hege doch gleichmäßig die schuldige Treue und Liebe gegen den Kaiser; nun möge man sich auch nicht trennen in den Mitteln, die Treue zu erweisen. „Ich schlage vor,“ sagte er gedämpft, „einen Kurfürstentag einzuberufen zur Königswahl. Im übrigen dem Herzog freie Hand zu lassen, wie man es bisher getan hat. Weigern sich die Kurfürsten, den jungen Ferdinand zu wählen, so nimmt der Kaiser dies zur Kenntnis, wie er anderes zur Kenntnis genommen hat. Aber ignoriert es.“
„Liebster,“ legte sich Trautmannsdorf vor, „wie kommt Ihr zum Ziele. Der junge König von Ungarn wird nicht römischer Kaiser vom Ignorieren.“
Still legte Slavata beide Hände in den Schoß, senkte den Kopf, seine braune Haut wurde blasser, seine Augen funkelten einen Moment, bevor sie sich auf die Finger richteten: er schob Silbe um Silbe zwischen Zähnen durch und stellte die Gegenfrage an alle Herren, was wohl dann geschehe, wenn der Kaiser dem Herzog von Friedland freie Hand wie bisher lasse und die Kurfürsten die Königswahl ablehnten; die löblichen Kurfürsten können belfern und keifen, die Zähne sind ihnen ausgebrochen!
Rasch wandte sich Slavata mit einem eigenartigen Lächeln an Trautmannsdorf, das sei der Streit auf der Höhe und — er flüsterte — noch mehr: der Sieg Habsburg auf der Höhe. Vielleicht ernenne dann der Kaiser den neuen König.
Strahlendorf donnerte mit der Faust auf den Tisch, zitterte am ganzen Leib, blickte mit verzerrten Mienen gräßlich auf den böhmischen Grafen; der Bucklige warf sich bewundernd, den Mund offen, den Kopf schüttelnd, hin und her im Sessel; der dicke Questenberg blies mit menschenfresserischen Grimassen glücklich unter seinen struppigen Schnurrbart, saß geschwollen, glotzäugig, als hätte ihn einer gestreichelt, am kurzen Quertisch. Strahlendorf jappste: „Das nennt Ihr das Y und X im Friedländischen Abc. Wir sind erst in der Mitte. Kurfürsten ohne Kur ist noch lange nicht das Letzte, den römischen König schüttelt er so aus dem Ärmel, wie er die mecklenburger Herzöge verjagt hat; dann kommt — der Kaiser selber. Wer soll den wählen, als derselbe einzige Kurfürst — Wallenstein. Herr Slavata, Ihr dachtet auch einmal anders über Euren Vetter. Dann kommen die Schwerter gegen den geheimen Rat, dann ist das Abc zu Ende.“
Questenberg knurrte bissig gegen ihn her: „Will man uns den Braten versauern, soll es doch nicht gelingen. Kommt sein Schwert gegen uns, so wird es sich nur bestimmte Hälse suchen.“ „Es wird sie suchen, Herr Questenberg, Euren und meinen, wie die liebe Sonne, die über Gerechte und Ungerechte scheint.“
Ganz unhörbar hatte Eggenberg seinen Stuhl zurückgeschoben; lautlos klemmte er seine ungehefteten Faszikel unter den Arm, stieg hinter der Stuhlreihe auf Zehen vorbei. Wie ihn Trautmannsdorf sich umwendend, anstarrte, bei der Hand faßte, wehrte er ab; es gelang ihm weiterzugehen, bis der Querbaum der Questenbergschen dicken kurzen Arme sich vor ihn legte. Hans Ulrich schien seinen Gram beiseite tragen zu wollen. Leidend bat er Questenberg: „Lieber, laßt mich.“ Sie standen um ihn; er blieb einsilbig dabei, wolle gehen.
An dem kleinen Treppengeländer bedrängten sie den freundlich behäbigen Fürsten, der den Kopf schüttelte: „Wir werden uns alle besinnen müssen. Wir werden unsere Gutachten schriftlich vorlegen. Die Zeit drängt. Der Kaiser wird eine höhere Instanz um Einsicht bitten müssen. Das ist alles.“ Was der Verwachsene, der seine Einfälle nicht zügeln konnte, nicht gefährlich fand; es sei schließlich allemal das beste und das letzte, den lieben Gott um Einsicht zu bitten; sie seien, lächelte er fast frivol, ja nicht verpflichtet, als Geheimer Rat den Himmel überflüssig zu machen. „Wie denkt Ihr, Slavata?“ Eggenberg wollte sich mit kurzem Nicken verabschieden, da drückte ihn Questenberg auf einen Stuhl, setzte sich neben ihn. „Weh unserm kaiserlichen Herrn,“ stöhnte matt zusammenfassend Eggenberg, „er wird sich verlassen sehen von uns allen, mag der Schutzgeist Habsburgs ihn nicht vergessen.“ Und bezwungen von seinem Gefühl kniete er, Hut und Faszikel vor sich auf die Diele legend, neben seinen Stuhl hin, betete, während auch die anderen die Köpfe senkten, das Rosenkranzgebet. Sie bekreuzigten sich, standen nebeneinander. Auf der kleinen Treppe Eggenberg: „Habsburg hat eine schwere Stunde vor sich. Was war es für ein Geist, der unserem gnädigen Herrn dies eingegeben hat, an sein Ende zu denken und die Nachfolge zu bestimmen. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht bei euch bleiben, liebe gestrenge Herren.“
Slavata, mit Trautmannsdorf und Questenberg allein, sanft höhnend: „Der Kaiser schütze sich vor seinen Freunden. Man will ihn um den Sieg, um das lauterste gerechteste Symbol des Siegs bringen.“
Sie gingen. Trautmannsdorf schlang ihm einen Arm um die zuckende Hüfte: „So ist mein Herr Slavata von seinem alten lästerlichen Haß ins friedländische Lager abgeschwenkt. Ich hör: mit Pfeifen und Flöten.“
„Mit Pfeifen und Flöten. Noch vergnügter, noch üppiger. Warum sollt ich’s leugnen. Ob ich ihn liebe, weiß ich nicht. Aber es kränkt mich, wenn ich sehe, wie man ihn kränken und hindern will.“
Und heftig atmend, gequält den Arm Trautmannsdorfs duldend, ging er mit den schwatzenden zweien. Zum Äußersten herausfordern hatte er Friedland wollen. Er wollte ihn locken, er wollte sein Teil daran haben, an der Entwicklung dieses Geschicks. Dunkel wie Wunder, halb Glück, halb Entsetzen, bewegten sich Gefühle in ihm, hoben sich, senkten sich, verrauschten. Er wies sie ab, verbarg sie sich. Sie drangen ihm manchmal über die Lippen und trieben ihn zu Handlungen. Er fühlte, daß er sich einem Strudel näherte, aber er konnte dem Geheimnis nur folgen, dieser Sehnsucht zu Wallenstein.
Der Weg, den Fürst Eggenberg in der Stifterfrage beschritten hatte, mußte weitergegangen sein. Vergänglich Ferdinand, vergänglich Friedland. Habsburg bestand. In seiner Bibliothek hielt Eggenberg eine bunte Chronik in den Händen, ein Buch, das er liebte; las von den Staufenkaisern, wie ihre Welt riesenhaft aufgebaut und mit ihnen zusammengesunken war. Die vergeblichen Kriege mit dem Papst. Ecclesia triumphans. Unmerklich sicher hatte sich Habsburg ausgedehnt. Reichtümer fielen ihm wie einem spielenden Kinde zu.
Der Kaiser machtgeschwollen. Er konnte das Haus in den Abgrund reißen. Eggenberg wiegte das alte Buch zwischen den Knieen. Zurückdrücken den Kaiser.
Die Gutachten durchlas der Kaiser, forderte dann den Fürsten Eggenberg vor sich.
Er faßte es als ein himmlisches Zeichen auf, daß der Kaiser ihn trotz der Einhelligkeit der anderen Gutachten rufen ließ. Zum Nachgeben den Kaiser zu bewegen, war keine Möglichkeit. Eggenberg sah, daß diesem Mann gegenüber kein Argument verfing. Und mit seherischer Klarheit gab Eggenberg selber plötzlich nach.
Der Regensburger Tag sollte stattfinden.
Aber als Ferdinand den Alten, der ihn starr ansah, umarmte und freundlich an sich drückte, ihn vielfach lobte und über die vermeintliche Niederlage wegtäuschte, mußte sich der Fürst seufzend entziehen. Scham füllte ihn ganz aus. Ein Verräter, ein giftiger Judas war er. Denn der Kaiser sollte zur Schlachtbank. Er würde keinen Triumph erleben. Er würde alles selbst entscheiden müssen — den ungeheuren Entscheid im Streit der Kurfürsten gegen Friedland, und er wird — nachgeben. Wie er in München vor Jahren dem Bayern nachgegeben hat. Das war dem alten Eggenberg, während er den lächelnden Kaiser, seinen Freund, starr anblickte, klar.
Die Kurfürsten werden kommen, das alte Reich muß zerstört werden: er wird es nicht befehlen können.
Friedland wird sich über die Kurfürsten werfen, der Kaiser wird sich neben die Fürsten stellen.
Rasch mußte sich Eggenberg von dem herzlich bewegten Kaiser, der ihn mit Konfekt beschenkte, verabschieden.
Jubel im Geheimen Hofrat.
Ein kurzer grimmiger Ligatag fand in Mergentheim statt. Die Herren und ihre Gesandten sahen sich nach eintägiger wütender Klage über das Zugrundegehen des Reichs einem kaiserlichen Vertreter gegenüber, der von ihnen Einberufung und Beschickung eines Kollegialtages zwecks Wahl eines Römischen Königs verlangte.
Sie gellten ihm ihr Nein und ihre Verzweiflung entgegen. Sie gellten von dem eigenmächtig begonnenen italienischen Krieg, von seinen grenzenlosen Menschenopfern, Kosten. Frankreich würde sich gereizt im Westen Deutschlands erheben.
Bis sie auf einen Schlag plötzlich verstummten; es war die Parole aufgetaucht: zustimmen der kaiserlichen Einladung und nicht zustimmen dem Wunsch, einen Habsburger zu wählen.
„Den Kaiser fassen, gegenschlagen.“
Wie sie sich von einander verabschiedeten, wußten sie: entweder sehen wir uns auf dem nächsten Tag als Sieger wieder, oder dies war unsere letzte Tagung.
Die Finsternis dieser Beratungen verbreitete sich nicht nach München. Der Bayer hatte eine gute Stunde. „Der Kaiser will seinen Gegnern im Reich den Siegel seiner Macht aufdrücken; noch eine Stunde und er bedarf der erlauchten Kurfürsten nicht mehr.“ Maximilian hing vor Richel in seinem Sessel, bedeckte seine Augen mit den Händen: „Ich danke der himmlischen Jungfrau für die Gnade jetzt und immer; sie will uns wieder Freiheit geben und uns den Entschluß erleichtern.“ Dann: „Jetzt, du mußt verstehen, Richel, jetzt hat sich der Kaiser in unsere Hände gegeben. Er drängt sich selbst an den Ort des Gerichts hin. Denn wir werden seinen Sohn nicht wählen. Bis wir sicher sind, daß er klein beigibt.“ Als Richel nach einigem Stillschweigen den Namen Wallenstein aussprechen wollte, stand Maximilian auf. Und Richel erkannte diesen Mann. Er sah in dem marmorfeinen Gesicht denselben höllischen Ausdruck, den es getragen hatte, als Kaiser Ferdinand, von der Frankfurter Krönung in München eingekehrt, neben Maximilian die schöne und reiche Kapelle verließ; im fast schweigenden Hin und Her wurde dann dem Kaiser die Führung im kommenden Krieg abgerungen. Und als der Kaiser unterschrieben hatte, war es an einem Montag, dem herzoglichen Gerichtstag gewesen, daß der Kaiser eine volle Stunde in der Sommerstube eingeschlossen mit Max verweilte. Die flüsternde, beschwörende Stimme des Habsburgers; die knappen, befehlerischen Sätze Maximilians, Hinfallen eines Degens. Jähe Abreise des gebrochenen Kaisers.
Ordonnanzen gingen an die französische Gesandtschaft. Charnacé traf ein. In größtem Geheim wurden unter ständiger Korrespondenz mit Fontainebleau Verabredungen getroffen.
Eine schwere Erregung bemächtigte sich in diesen Tagen, in denen die Einberufung eines Kollegialtages zu Regensburg beraten wurde, des ganzen Volkes. Die Professoren der Tübinger Universität beobachteten nächtliche Schlachtordnungen am Himmel, beschrieben das Kriegsgetümmel, hörten das Rasseln der ansprengenden Kürassiere. Bauern verbreiteten Gerüchte, sie hätten Kämpfe einzelner deutscher Stämme und Fürsten gegeneinander gesehen am Himmel, Wagen mit Stangen seien gefahren, Sturmleitern wurden geworfen. In Dillingen trug ein Rechtsbakkalaureus sein Traumgesicht vor: der Kaiser ermordet von Wallensteinschen Kroaten.
Vom Reichserzkanzler, dem Mainzer Erzbischof Anselm Kasimir, wurde auf das Drängen des Kaisers das Ausschreiben zu einem Kollegialtag nach Regensburg erlassen. Da fuhr der Bayer wieder auf den heiligen Berg Andechs in einer unbezwinglichen Spannung. Auf die nackten Altarstufen hingepreßt, betete er in einer krampfhaften Aufwühlung; er dachte an die Schweißtropfen Christi auf dem Ölberg, der Dornen, die sein heiliges Haupt umgaben, der Schläge, die er in der Geißelung litt, der heißen Zähren, die er vergoß, der Seufzer, die er tat, der süßen Rosen seiner fünftausend Wunden. Er flehte, geknechtet verwirrt auf den Bahnen des Gebets laufend, Herr Jesus möchte durch die flüsternden, perlenden, quirlenden Brunnen, die aus all seinen heiligen Wunden sprudelten, so reichlich, seine arme durstige Seele zu erquicken geruhen.
Schwarz stand im Schatten auf einem Seitenaltar das mannshohe Kreuz mit dem sinkenden Heiland: anblicken sein verwundetes Herz, ringen um die Erlösung; anblicken die rechte Hand, die Sünden zu erkennen gab; anblicken die linke, den rechten Fuß, den linken Fuß, Barmherzigkeit, Buße, Gerechtigkeit. „Gnade, Herr Jesus!“ Maximilians Pferde jagten wieder herunter nach München. Stöhnend saß der Kurfürst vor dem Jesuiten Kontzen, wischte sich den Schweiß von der Stirn, beruhigte sich nicht. Und während Kontzen den Entschluß des Bayern, die Franzosen an sich zu ziehen, maßlos lobte, durchzuckte den Kurfürsten der Gedanke: mit Wallenstein selbst in Verbindung treten! Wallenstein im letzten entscheidenden Augenblick vom Kaiser abziehen, ihm Mecklenburg und was er sonst hatte anerkennen. Ihm Reichsfürstenwürde zugestehen!
Sich Wallensteins bemächtigen!
Woher diese Verwirrung! Woher diese Befehle, dieser Zwang!
Maximilian erblaßte unter der Raserei dieser Gedanken. Sie waren wahnwitzig; seine Augen wurden matt. Halb ohnmächtig sank er seitlich über die Lehne seines Sessels. Und dann, als der ängstliche Jesuit ihn aufrichtete, drückte der verwirrte Fürst seinen Arm. Er ließ sich von Kontzen hochziehen, und wie er auf den unsicheren weichen Füßen stand, fiel er umarmend gegen die Brust Kontzens, mit den Zähnen klappernd, wimmernd, an allen Gliedern zuckend. Schritt um Schritt führte Kontzen den verzerrt blickenden Kurfürsten in die Nachbarkammer vor den kleinen Marienaltar. Da beruhigte sich der Fürst; der Leibkammerdiener konnte gerufen werden, Kontzen wurde mit einem unverständlichen Lächeln entlassen. Der Fürst wankte in die Schlafkammer.
In derselben Nacht besprach Maximilian mit dem Pater im tiefsten Vertrauen das Notwendige. Staunend, ergriffen hörte der Pater die Pläne des Bayern. „Rede Ehrwürden sanft mit dem Böhmen. Er ist jähzornig. Warte Er einen guten gleichmäßigen Tag ab. Melde Er der herzoglichen Durchlaucht meine Zuneigung und Wohlmeinung. Wenn sich Irrungen und Zwietracht gelegentlich zwischen unseren Heeren gehalten haben, so werde das in Zukunft sich beheben lassen. Wage Er sich offen damit heraus, daß der Franzose sich an mich herangemacht hat. Die friedländische Partei ist in Kürze verloren. Wir haben beide Macht, ich und der Böhme. Es wird sein Schade nicht sein, wenn wir uns gut im Reich miteinander verhalten.“ Erst frühmorgens, als es im Hof der Burg von den Wagen des abreisenden Jesuiten rasselte, legte Maximilian sich auf dem Bett zurück. Fast augenblicklich verfiel er in einen betäubten Schlaf. Nicht einmal die Zeit fand er, den Rosenkranz aus der Hand zu legen; der klapperte neben dem Bett auf die Diele.
Die Freudigkeit, Glückseligkeit, Munterkeit des Fürsten, die langen folgenden Tage; eine Bräutigamsunruhe und zwangsartige Rastlosigkeit. Seine Drechseleien ließ er liegen, er gedachte seiner verflossenen Italienfahrt, ihn trieb es aus München fort. Die feierliche Donnerstagsprozession machte er noch mit, selbst barhäuptig im Zuge mit einer brennenden Kerze vor dem ganzen Hofstaat; dann wurde Alexander Abondius, der Florentiner Bildhauer, in die Residenz befohlen; der Kurfürst reiste mit ihm ins Land, Verduckh, der Kunstkämmerer und Guardarobba folgte, eine Handvoll Hatschiere. In Nürnberg stand das neue Pellerhaus, reiche Front, prächtig die vier Stockwerke, Fenster bei Fenster, hoch die Giebelfassade; Galerien des Hofes, Säulengänge. Sie ritten in der heißen Augustsonne, von Ratsmännern geleitet, durch die langen Gassen, über Märkte und Plätze. Teppiche von den farbig bemalten Balkons, Stockwerk vor Stockwerk sich herausschiebend, überschattend die tieferen Fenster, Dächer von Zinnen umgeben, vorgeragte Ecktürmchen. Das Nassauerhaus. Der junge Abondius lobte den Herkulesbrunnen zu Augsburg, die Nymphen, Wasserspeier. Der Wittelsbacher fragte nach Kurieren, drängte, von Süßigkeit und Schrecken erfüllt, zurück.
Wie sie vor München am Isartor erschienen, meldete der starke Torwächter, es seien gestern nacht fünf kaiserliche Obersten angekommen, die der wohledle gestrenge und hochgelehrte Herr Bartholomäus Richel empfangen und in ihr Quartier zum Goldenen Kreuz geleitet habe. Mit Staunen sah sich Maximilian am nächsten Morgen in seiner Audienzkammer sitzen, Ehrengeschenke des Herzogs von Friedland in den Händen drehen, die metallenen Schalen und Krüglein befühlend, hinstellend, ihnen an die Kehle fassend. Er hielt, während die Offiziere Abschied nahmen, einen Arm über die Metallwölbung, zwei Finger in die Höhlung hinein; es schien ihm, zwischen Entsetzen und Gelächter schwebend, als ob er mit Wallenstein spräche. Und sonderbar war ihm dabei, als ob er in einer Unwirklichkeit lebe, hier säße; ihn mußte etwas verzaubert haben, eine leise Angst schwelte über ihm: wenn das Spiel erst zu Ende wäre. Und während die Türen geöffnet wurden, Kammerdiener, Oberstkämmerer erschienen, ihn zur Messe einzukleiden und abzuholen, passierte ihm, daß er gedankenlos dastand, nicht wußte, was er dachte, nicht einmal, was mit ihm geschah. Saß gebannt in seiner Residenz; wie in Scham vermochte er nicht hinüber zu seinem Vater; ließ viele Stunden am Tag unbesetzt, man wußte nicht zu welchem Zweck. Die Depeschen kamen. Kontzen meldete übergroße Freundlichkeit des Generals, dabei die gänzlich fehlende Geneigtheit, das geringste von Maximilians Plan zu verstehen; er, Kontzen, müsse natürlich aufs äußerste vorsichtig sein und sich vor direkter Deutlichkeit bewahren; der Herzog sei ergötzt von dem Zugeständnis in Sachen Mecklenburgs, aber bisher hätte sich nicht einmal eine Andeutung des bayrischen Plans ermöglichen lassen; nun wolle er noch nicht verzagen vor diesem absonderlich treuen Diener des Kaisers. Gleich hinterher ritten aus dem friedländischen Hauptquartiere zwei Offiziere ein: sie sollten vertraulich verhandeln über das Verhalten der Armeen zueinander; wie weit die Liga abzurüsten gedenke; die beiden Herren waren sehr aufgeräumt, schienen die Auffassung aus Gitschin mitzubringen, die Kurfürsten täten den ersten Schritt zur Unterwerfung. Richel bearbeitete sie kühner, wagte gleichnisweise von einer Abschwenkung Friedlands von Habsburg zu reden, da Wallenstein selbständiger Reichsfürst sei, auf der Fürstenbank mit den andern säße und sich wie sie seiner Haut zu wehren hätte. Taube Ohren, Unwillen über das ärgerliche Beispiel. Richel verblüfft vor dem Kurfürsten: er stände vor einem Rätsel; man könne es Treue nennen, es sei auch Borniertheit. Oder Friedland sei auf noch Höheres aus, etwa gegen den Kaiser.
Weich glitt es von Maximilian ab, trübe Augen, ein stumpfes mattes Gefühl behielt er zurück. Schläfrig dankte er Richel; er möge in dieser Sache nichts weiter unternehmen. Er saß eine, zwei Stunden dämmernd auf demselben Stuhl, allein in seiner Kammer; eine Hilflosigkeit hielt ihn befangen; er räkelte sich, seufzte. Ja, nun werde er wieder zu Hause sein, zurück von der Reise. Da lag auf dem Tische die Rolle Torquato Tassos, die der Dichter ihm in Italien gewidmet hatte. Neue Briefe seiner Bundesverwandten, vom Kölner, vom Bischof von Bamberg. Sie wollten Hilfe; die alte Last, die alten Ketten. Ein glühendes Weh überflutete mitleidlos seine Brust, Gram, tiefer Widerwillen. Wie er an den Kaiser und Friedland dachte, ballte er die Fäuste vor Schmerz, spannte sich auf seinem Sitz hoch, rang sich zur Ruhe.
Maximilian ließ den Wallensteinschen Offizieren erklären, er müsse über die angeregten Punkte mit seinen Bundesverwandten korrespondieren; eisig, wie sonst, gab er Richel den Auftrag, die Herren mit Geschenken zu verabschieden. Sie ritten schmähend ab, die Bayern hätten sie nur aushorchen wollen.
Vervaux, Maximilians Beichtvater, war über Land; Eilboten mußten ihn zurückholen. Der alte Herzog Wilhelm, Maximilian, Vervaux saßen zusammen beim Essen; die stille, gespannte Runde; sie gingen mit dem Kurfürsten auf sein Kapellenzimmer. Der Kurfürst sprach mit einer lieblichen Stimme, die grauenhaft aus seinem leblos sitzenden Körper klang; er bitte sie beide, ihn zu fragen. Er antwortete dann anders als sonst; während er sonst die Worte in seinem Munde sich ansammeln ließ, bis sie vereist und gefroren waren, stürzte er sich auf jede Frage und gab blindlings, lechzend Bescheid, gesangreich. Er wußte zuerst nicht, was er vom Friedländer gewollt hatte, er schien von der Erinnerung gepeinigt zu sein, dann äußerte er, er hätte sich mit einem verächtlichen Menschen eingelassen, mit einem Knecht, einem toten Leibeigenen des Kaisers; ein satanischer Trieb habe ihn plötzlich bewegt, dem er nicht hätte widerstehen können. Er schien eine Bestätigung dafür von ihnen zu verlangen. Ein Ekel vor sich selbst erfüllte sichtlich den Kurfürsten, als hätte er etwas Tiefgemeines berührt. Er bat um Strafe. Vervaux sprach zu ihm. Während der Pater und der alte Herzog sich voreinander verneigten, der Herzog in Glückstränen über seinen Sohn, stand der schnaubend in seinem Schlafzimmer, ließ Läden und Vorhänge schließen. Eine einzige Wandkerze brannte neben der Tür. Der Oberstkämmerer nahm dem stummen Fürsten Seitengewehr Gurt Barett Überkleid Mantel ab; zwei Kämmerer nestelten an dem Wams, zogen es ab; Schuh Hosen Leinenhosen streiften sie herunter, als er auf der gepolsterten Truhe saß; sie schleiften hinaus mit den Sachen. Flüsternd mühte sich der Leibkammerdiener um ihn, zog ihm das Schlafhemd über die zwinkernden Augen. In seidenen Pantoffeln; er schüttelte den Kopf, als der Leibbarbier eintrat, ihn mit Tüchern zu frottieren. Unbeweglich, allein stand der bärtige Mann eine Zeitlang im leeren Zimmer im Hemd, vom Bett auf den Boden blickend, vom Boden auf das Bett. Ließ das Hemd auf die Hüften herab, band es mit den Ärmeln zusammen. Auf dem kleinen polierten Tisch neben seinem Bett stand ein schwarzes viereckiges Kästchen. Mit ruhigen kalten Fingern, während er tönend, fast schluchzend zu atmen anfing, zog er das Schlüsselchen hervor, das in einem Seidenbeutel an seinem Hals hing. Einen ledernen Stachelgürtel griff er bei den Enden, schlang ihn um die Weichen, zog, sich gegen die Tür schleppend, die brennenden Augen auf das Mariengesicht unter der Kerze gerichtet. Geriet in Atem, stöhnte, sein Mund blieb weit offen stehen. Er konnte sich nicht genug tun. Seine Blicke blind, erloschen; schnürte den Gürtel fest. Nach der kleinen Peitsche mit den Stahlkügelchen tastete er zitternd mit der Linken, die Zähne verbissen, schwarz hüllte sich alles um ihn ein. Klatschend schlug er links herum auf den Rücken. Und während er schlug, flossen ihm die Tränenwasser aus den Augenhöhlen über den Mund auf den Teppich. Von den Flanken rieselte Blut. Es wurde ihm, als ob ein anderer ihn schlug, diese Arme eines Fremden, gewalttätige, unbarmherzige, unerbittliche Werkzeuge, unter denen sich sein Körper leidend bog; ächzte, wühlte, bäumte sich, wich aus, fuhr zurück; die Arme ließen nicht nach, ohne Gefühl. Und da war die Hand in der Luft erstarrt, der Hand in der Luft die Peitsche plötzlich entfallen, die Peitsche lag da, er zuckte zurück, zuckte, zitterte; und bevor er erkaltete, wühlte er um sich auf dem schlüpfrigen Teppich, bis seine Finger das lange, feine, vergiftete Stilett in der Scheide berührten, das er immer suchte in der Verzweiflung des Geißelns, auf der Höhe, um das Verderben von sich abzuwenden, um sich zu beruhigen, zur Besinnung zu bringen. Er drehte es, die Scheide löste sich, fiel herunter, er drehte, suchte es durch die Tränen zu erblicken; drehte es. Er hielt es liebevoll an der Brust, drückte es an seinen bloßen Hals, an die gekräuselten Barthaare; lag stöhnend, schnaubend, sich wälzend auf dem Boden; der Stachelgürtel löste sich, krampfartig erbitterte Stöße fuhren durch seinen Leib. Dann schob er sich schnaubend, verwüstet, besudelt, ein Winseln unterdrückend, unmenschlich auf die Knie, in die Höhe, wackelte blutäugig auf dem Schemel. Klingelte später nach Wein.
Der dicke Rambold von Kollalto, Herr von Pirnitz, Deutsch-Rudolatz, Tscherner hielt Mantua blockiert. Er selbst lag schlemmend, trotz seiner Kehlkopfschwindsucht, zu Marignan am Lago maggiore; seine Untergenerale Gallas und Aldringen regierten die Armee. Der spanische Feldherr Ambrosius Spinola, ein alter Mann, stieß gegen Montferrat, vertrieb die Franzosen, jagte sie in Casale zusammen.
Der Krieg blühte. Neue Truppen führten französische Marschälle heran.
Da wurde dem Herzog zu Friedland, der in Karlsbad zur Kur war, die Nachricht von Wien überbracht, daß zu Regensburg ein Kollegialtag stattfinden werde, da des Kaisers Majestät die Wahl seines Sohnes zum deutschen König fordern werde. Der Friedländer riß in seiner Ritterstube sich den Hut ab, trampelte darauf herum: Den Kopf müsse man den Kurfürsten vor die Füße legen. Sie zusammenrufen zu einem Tag! Auseinanderpeitschen die Verschwörer. Er wütete. Man mußte ihm von Wien Kuriere schicken; die Botschaft sollte aufgeschoben werden. Niemand hatte Neigung, die Sache zu betreiben. An Ferdinand selbst schrieb er, zweimal mit stärkster Dringlichkeit, erreichte nichts, als daß der Kaiser lächelnd sagte: „Der Krieger! Er will nichts als Soldaten und Schlachten. Und schon ist ihm nicht wohl, wenn wir andern uns friedlich und verwandtschaftlich zusammentun.“
Die Kur in Karlsbad brach der Friedländer ab, tobend über die kaiserlichen Räte: „Sind nicht genugsam mit Dukaten gestopft, die Herren. Sind sie nicht schlechte Lumpe, so sind sie trunkene Bärenführer. Der deutsche König! Sie erbetteln ihn bei den Pfennigfuchsern. Aber ich will ihnen allen die Suppe versalzen.“
Er verschwur sich, trotz Kaisers und Wiener Räte sollte den Schelmen das Spiel verdorben werden, daß sie seufzen und Tränen vergießen würden. Er bestimmte augenblicklich die Stadt Memmingen, südlich der Donau, nicht weit von Ulm und nicht gar zu weit von Regensburg gelegen, zu seinem Hauptquartier und Truppensammelplatz. Mit größter Beschleunigung, hieß es, sollten alle Regimenter, die aus dem schwäbischen und fränkischen Kreis abkömmlich waren, aufbrechen hierhin. Transporte nach der Lombardei wurden umgewendet; verbreiten ließ er, sie sollten dort in einem Zentralpunkt rasch verfügbar stehen gegen französische Aspirationen auf das Elsaß und als Reserve des italienischen Heeres Kollaltos.
Er selbst machte sich, um alles selbst in die Hand zu nehmen, ungesäumt von Karlsbad auf den Weg. Der italienische Krieg hatte plötzlich für ihn kein Interesse mehr. Er war tief erregt.
Siebzehn Sechsspänner trieb er mit sich, siebenundzwanzig Kaleschen zu zwei und vier Pferden, sechzig Gepäckwagen, hundertundfünfzig Berittene; allen voraus sein Kanzler Elz mit hundertundzwanzig Leibrossen, sechsundzwanzig Sechsspännern und Gepäckwagen. Die Gelder für die Reise wurden in Mecklenburg durch Kontribution erhoben. Der Herzog rastete in Nürnberg, wo er die Bitte des Magistrats um Ermäßigung der monatlichen Abgabe von zwanzigtausend Gulden abschlug; in Ulm wurde ihm als Ehrengabe gereicht ein Silberpokal, ein Samtbeutel voll Goldstücke, eine silberne Handkanne und Handbecken, ferner ein Wagen Wein und achtundvierzig Hafersäcke. Sein Quartiermeister bestimmte als täglichen Verbrauch für den Hofstaat schwere Abgaben: neben zahllosen Laib Brot, Schock Eiern Weizenmehl, Roggenmehl, zwei gute Ochsen, zwanzig Hammel, zehn Lämmer, vier Kälber, ein Schwein, zwei Speckseiten, eine Tonne Butter, fünfzehn alte und vierzig junge Hühner, dazu Rheinwein, Franzwein, Kümmel, Koriander, Anis, Zimt, Ingwer. Nach Memmingen streiften Arkebusiere vorauf; sie trieben alles brüllende und blökende Vieh aus der Stadt, schossen Hähne und Singvögel ab, legten Leimruten für Spatzen aus; die Glocken auf den Kirchtürmen banden sie fest. Der Herzog mit seinem Hofstaat, Leibgardisten, Kanonen, astrologischem Gerät rückte an.
Die Kuriere liefen; der Herzog stellte fest, welche Gesinnung der Wiener Hof, der Kaiser selbst hätten; große Summen wurden durch de Witte angewiesen an den Kaiser selbst, den Abt von Kremsmünster und andere. In aller Stille versammelte sich im Gelände um Memmingen ein großes Heer.
Der Kaiser Ferdinand befahl gegen die Mitte des Jahres Anstalten zum Aufbruch nach Regensburg zu treffen. Vom Herzog zu Friedland, von den niederösterreichischen Ständen, vom Erzbischof zu Salzburg, aus Böhmen wurden Darlehen erhoben; der Antrieb an Ochsen, Kälbern, Lämmern, Schweinen aus Ungarn begann. Ferdinand nahm die Mantuanerin und seinen Sohn mit, den blassen, ehrgeizigen König von Ungarn, der eifersüchtig auf Wallenstein war.
Wie ein Schnitter, der die Ernte einbringen will, ging der Kaiser, Eleonore sollte mit, weil ein Kaiser mit einer Kaiserin fährt — und sie war maßlos finster und prächtig, sollte jeden der Fürsten beschämen; er wollte sie an seiner Seite mitbringen, die Tochter des Landes, um das er Krieg führte.
Sie fuhr, bezwungen, mit ihm in dem Prunkschiff, verschlossenen Gesichts, aber auf freudig straffen Gliedern, gedachte dem schweigenden Menschen neben sich in Regensburg eine schwere Niederlage zu bereiten. Sie hoffte auf Eggenberg. Von dem Groll der Fürsten auf den Friedländer hatte sie gehört. Ihr Beichtvater hatte sie ganz aufgerichtet. Reitend, in Karossen, auf Schiffen gezogen hinter ihnen zwischen dem lustigen, erregten Hofstaat Geheimräte, kummervoll seufzend, in aller Munterkeit und dem Glanz bedrückt, zu einander fliehend, heimlich mit einander murmelnd, mit jeder Stunde beklommener.
Der Kaiser hatte nicht abgelassen, auf den Regensburger Tag zu dringen, sein Sohn sollte gewählt werden, es hatte nicht verhindert werden können, obwohl das Drängen und Drohen der Kurfürsten anzeigte, warum sie kommen wollten: nicht seinen Sohn wählen, aber ihn selbst zur Verantwortung ziehen, den Herzog zu Friedland beseitigen; sie drängten auf Abrechnung. Und was hatte man von Wallenstein zu gewärtigen; wie würde der rasende Böhme sich benehmen; man hatte schon schwer Beunruhigendes von seinem Vorhaben in Memmingen gehört. Der weinrote kleine Eggenberg selbst, Triumph der Slavata und Trautmannsdorf, hatte den Stein zur Konferenz aus dem Weg geräumt. Er war umgefallen. Sie wußten nicht, was er tat, Slavata und Trautmannsdorf so wenig wie Ferdinand selber. Als die Kurfürsten und Stände so bereitwillig der Tagung in Regensburg zustimmten, begriff er, daß er klar gesehen hatte. Und er wich nicht; er führte den Kaiser auf die Schlachtbank.
Wie Eggenberg dies geleistet hatte, den Kaiser auf das Schiff nach Regensburg zu bringen, brach er zusammen. Auf der Fahrt schon befielen ihn körperliche schwere Beklemmungen und Ohnmachten. Die Tat war größer als er.
Er verabschiedete sich unterwegs von Ferdinand. In einem Grauen reiste er nach Wien. Die leere Stadt besserte ihn nicht. Nach Luft ächzend fuhr er weiter. Nach Krumau auf sein Gut Worlik. Die Angst vor dem Kommenden wuchs. Er fuhr, um sich zu verstecken, nach Dunio in Istrien. Es war weit, Kuriere würden ihn nicht finden. Dürften ihn nicht finden.
Inmitten ungeheurer Viehherden, Wagen voll Bier und Weinfässern, marschierender Söldnerfähnlein näherte man sich Regensburg, dem Höllenkessel. Noch zuletzt protestierte die Stadt selber; sie hatte angstvoll von den Memminger Gerüchten und sonderbaren Vorkehrungen vernommen; sie schützte ihren beschwerlichen Zustand, ihre Armut vor, eine derart prächtige und riesige Versammlung könne ihr Rahmen nicht fassen. Der Kaiser gab nicht nach; die Kurfürsten gaben nicht nach.
Der Kaiser und sein riesiges Gefolge tauchten in den gefährlichen Bannkreis Regensburgs ein. Die Kurfürsten kamen lange nicht. Sie erschienen auf dem Tag wie unschuldig Verurteilte, die vor aller Welt Schande über ihre Richter bringen wollten. Und wenn er sie auch erwürgte und aufs Rad flöchte, sie wollten es ihm nicht schenken. Mit Entsetzen und dann mit ingrimmigem Vergnügen hatten sie gehört, wie sich Wallenstein auf den Tag rüstete; sie verbreiteten es nach allen Seiten; die Notlage des Reiches lag vor allen Augen. Mit geringer Begleitung stießen sie nacheinander an in den blühenden Junitagen, gehässig und verzweifelt wie magere Wölfe, wollten schlingen oder erschlagen werden.
Der Kurfürst Ferdinand von Köln, der jüngere Bruder des Bayern, fuhr ein, klein, dünn, listig blickend, mit den Lippen und hängenden bebenden Wangen des Schlemmers. In einem bedeckten Reisewagen, achtspännig, der Reichskanzler Anselm Kasanio der Kurmainzer, gebücktes graugesichtiges Männlein, den breiten dünnen Mund spannend, das harte Kinn, mühsam gehobene Augenlider. Das violette Käppchen weit rückwärts auf dem nackten erbärmlichen Schädel. Neben ihm gewaltig im Wagensitz unter dem Bischofshut, golddurchwirkte Schnüre an der Krämpe schaukelnd, der phlegmatische Kurtrierer, Philipp Christoph, glotzäugig, mächtige Halswampen, der breite Gürtel über einem gequollenen Leib; die Beine steif vor sich ausgestreckt, ein unerschütterlich schwerer Körper. Der Bayer fuhr an. Er hatte sich gesträubt zu gehen; Herzog Wilhelm hatte ihm weinend abgeraten. Um ihn ging eine starke Leibwache; bayrische Regimenter waren seit Wochen bei Kehlheim Fürth Cham Rain auf Kriegsfuß gebracht, marschfertig; es war besiegelt, daß ihm auf seinen Ruf fünfzigtausend Franzosen zur Seite stehen würden. Mit Maximilian zog Tilly in Regensburg ein, sein Feldmarschalleutnant, dessen Offiziere die Gegend rekognoszierten, der weißbärtige Zwerg, der nicht erlosch.
Ins Quartier des Erzkanzlers, der die Bundesverwandten bei sich hatte, wurden auch die acht Beauftragten des Kurfürsten von Brandenburg und des Sachsen geleitet. Ruhig erklärten die Herren, daß ihre Fürsten nicht kommen würden; die Kriegsnot ließe sie nicht aus ihren Ländern; sie selbst hätten Instruktion, sich an den Beratungen zu beteiligen.
Auf die Frage Maximilians stellte sich heraus, daß sie nicht ermächtigt waren, einer Absetzung Wallensteins zuzustimmen; auch über Bedrängnis protestantischer Stände durch das ligistische Heer klagten sie; Protest sollten sie über die Einziehung evangelischer Güter erheben. Scharf wandte sich der Bayer an die geistlichen Herren: „Man sieht, wir sollen den Herren die Kastanien aus dem Feuer holen. — Und wenn man euren Fürsten den Kurhut vor die Füße wirft?“ „Der evangelische Glaube wird nicht untergehen. Wir werden Hilfe finden.“ Max höhnte, als sie gegangen waren, die Hände gegen die Herren erhebend: „Sie erhoffen Hilfe von dem Schweden. Der Satan hole die Ketzer.“
Streng übergab Ferdinand in Gegenwart der zitierten Kurfürsten und Gesandten dem Reichserzkanzler die versiegelten Propositionen in der Ritterstube der bischöflichen Burg. Er vermißte den sächsischen Kurfürsten, mit dem er sich über Jagden unterhalten wollte; er hätte sich so lange vom Waidwerk fernhalten müssen. Mit jedem sprach er einzeln, auf dem roten weichen Teppich neben dem Eichentisch gingen sie bedeckt hin und her. Man lachte über den Schweden, von dessen munteren Angriffsgelüsten man gehört hatte. Mitten in der Unterhaltungen tönte von draußen vor der Stiege Blasmusik; der Habsburger freute sich über die Verwunderung der Herren, er hatte seinen Johann Valentin mitgebracht; man setzte sich wieder, trat an die Fenster, hörte schweigend zu. Die Herren flüsterten verwundert; neben dem Bayern stand Ferdinand am Fenster, legte seinen weißgekleideten Arm freundschaftlich auf die Schulter des erbebenden Wittelsbachers. Der Geheimsekretär Doktor Frey erhielt vom Kaiser einen Blick, öffnete die Tür zur Antikamera. Ferdinand begleitete die Kurfürsten, denen sich ihre Kanzler anschlossen, durch das lange blinkende Spalier der Hatschiere an die Stiege, wo man eine Weile die Kapelle anhörte und die warmen Windstöße fühlte.
Man hatte sich noch nicht zurechtgefunden von der Begegnung, als der Mainzer in seinem Quartier aus den Propositionen vorlas. Der Kaiser erwähnte die Königswahl nicht, fragte, was mit dem landesflüchtigen Ächter Friedrich von der Pfalz endgültig geschehen solle, dann wie man Holland Schweden Frankreich im Einmischungsfalle abweisen solle, zuletzt an fünfter Stelle die Mängel des Kriegswesens anlangend: man möge angeben, wie und welchergestalt eine bessere Ordnung geschaffen werden solle.
Hitzig warf am Schluß sogleich der rotäugige Kölner auf, sein Käppchen auf dem Knie wippend: „Sauber disponiert! Der zu Friedland hat sich recht tapfer versteckt.“
Der fettwamstige Christoph Philipp von Trier ächzte: „Wir haben dem Kaiser nichts entgegenzusetzen, wir haben keine Armee.“ „Nein,“ lachte grell Maximilian. Der Erzkanzler milde: „Wir werden ihm unsere Klagen vortragen, wir werden nicht nachlassen zu drängen, er ist ein Mensch, ein frommer katholischer Christ, es wird seine Wirkung auf ihn nicht verfehlen.“ „Die Lutherischen singen: ein’ feste Burg ist unser Gott,“ spottete Maximilian. Ruhig der Mainzer: „Unsere Gebete werden erhört werden, Durchlaucht.“
Trotz Zagens und Remonstrierens des Mainzers, der versöhnlich bleiben wollte, ging der Beschluß durch, daß in zwei Schritten der ganze Weg durchschritten werden sollte. Man sah sich auf einem Vulkan, Friedlands Armee bei Memmingen wuchs. Sie erklärten: „Die übermäßigen Werbungen im Reich, Abdankungen Abmarsch Rückmarsch Kontribution Einquartierung haben die Wohlfahrt des Reiches untergraben; das Vermögen des Heiligen Reiches, seine Kraft und Stärke, wodurch es sich bei seinem hohen Stand und christlichen Glaubensbekenntnis gegen Türken und Heiden bisher vor allen andern Königreichen der Welt erhalten hat, ist ganz verzehrt, verwüstet, seine Habe in fremdes Land geführt, vornehme Länder und Provinzen, die eine Zier und Vormauer des Reichs gewesen sind, sind verheert. Die Kurfürsten und Fürsten, gänzlich allen Ansehens beraubt, haben sich den kaiserlichen Kommandanten, die sich mit ihnen im Stande nicht vergleichen können, zu unterwerfen und müssen unzählige Drangsale stillschweigend über sich ergehen lassen. Das kurfürstliche Kollegium, kraft getroffenen einstimmigen Kollegialbeschlusses, will deshalb nicht allein aus treuem Herzen ihrer kaiserlichen Majestät geraten haben, sondern auch untertänigst und ernstlich darum bitten, hier Verbesserung zu schaffen, der kaiserlichen Armada ein solches Haupt vorzusetzen, das im Reich sitzt, ein ansehnliches Mitglied des Reiches ist, dafür auch von anderen Ständen geachtet und erkannt wird, zu dem Kurfürsten und Stände ein gutes zuversichtliches Vertrauen haben. Dieser Feldherr möge in allen vorfallenden wichtigen Sachen ermahnt sein, gemäß den Reichskonstitutionen getreulich zu disponieren und sich mit den Kurfürsten zu verhalten, möge sich nicht anmaßen, im Reiche zu dominieren, weil solches nicht Herkommen noch zulässig ist.“ Wenn aber ihre Kaiserliche Majestät in ihren Erbkönigreichen und Landen ein besonderes Heer halten wollte, daran wollte man sie nicht hindern noch ihr Maß geben, so lange es ohne Gefahr, Schade und irgendwelche Beeinträchtigung von Kurfürsten und Ständen geschehen kann. Kontributionen sollten niemals mehr direkt, sondern nur durch Anrufung und Vermittlung der Reichs- und Kreisversammlungen erhoben werden, Durchzüge und Musterplätze nur mit deren Zutun Genehmigung und Mithilfe.
Während die deutschen Kavaliere die Reitbahn und Tummelgarten bei den Barfüßern frequentierten, Räte Dompröpste Dechanten Kanzler verschwiegen beim Postmeister einkehrten, Geld in ein Lotto einlegten — an der Wand war mit Kreide gemalt italienisch: Wer das Kleid nicht schätzt, dessen Leben dauert länger als das Kleid — Stände sich im Bischofshof versammelten, in die Antikamera geführt wurden, tauchten schon die fremden auffälligen reichen Gestalten in den Gassen auf. Die Herren trugen einen ungeheuren Putz mit sich herum, sie ertranken in den Gewändern, die sie mit sich schleppten; so viel des Zobels, der Bordüren Aufschläge Spitzen Besätze, der überfallenden Stulpen Wehrgehenke Schärpen. Das raschelte und knisterte an ihnen; ihre gebrannten Haare verkrochen sich unter den Umhängen oder blähten sich duftend im Wind auf. Damen begleiteten sie, in bequemen Wagen fahrend, mit Regenschleiern über Kopf und Schulter, mit flachen Stirnmützchen, von denen der Staubmantel nach rückwärts wallte. Bei klarem, warmem Wetter gingen sie über die Wiesen, bei der Grube kaum verschleiert, mit tief entblößten Schultern, so einfach, als stiegen sie eben aus dem Wasser mit ihrem glatten, am Hals sich lockenden Haar; weißes und rosa Leuchten der Übergewänder; über den Knieen wichen die Oberstoffe rückwärts; golddurchwirkte Untergewänder mit hingehauchtem Blau wurden von den Bewegungen angestrafft, in weißen Schuhen bewegten sie sich leicht und völlig graziös. Es waren die Welschen, die von Grenoble vor drei Wochen aufgebrochen waren, über Solothurn, Konstanz Ulm erreicht hatten, zu Schiff anlangten. Sie fanden Quartier bei der Grube. Herr von Brulart führte sie, der braune kuttige Kapuziner, der ihn begleitete, schmalschultrig, kurzsichtig, blaß, mit einer starken Nase, war der Pater Joseph, François du Tramblay, die Seele des Kardinals Richelieu. Sie mischten sich unter die andern. Kavaliere und Damen küßten sich, wenn sie sich begegneten, auf den Mund. Sie hatten viel Berührung mit dem bayrischen Hofstaat, aber auch mit den vier sächsischen Herren und ihrem Anhang.
Trautmannsdorf forschte Brulart aus über den Grad der Einheit in der französischen Nation, welchen Stämmen die mitgebrachten Kavaliere angehörten. Der Welsche fand die Frage erstaunlich: „Eine Nation hat in unserem Königreiche keinen Platz. Franzosen sind die Leute, die dem Sehr Katholischen König Ludwig untertan sind. Bisher hat keine Regierungsakte Kenntnis von dem Wort Nation oder Volk genommen. Und ich wußte nicht, wovon ich reden sollte, wenn ich französische Völker oder Stämme sagte; mit König Ludwig ist alles gesagt.“
„Man würde hierüber im Reich klagen, der Deutsche würde gleich den Verlust seiner Freiheit argwöhnen.“
„Es ist ja nichts ehrenvoller,“ zog der Welsche die Augenbrauen hoch, „als dem König leibeigen zu sein. Wenn am Himmel die Sonne scheint, so nimmt alles freudenvoll die Helligkeit und die Farben der Sonne an; die Franzosen werden königlich; jedem ist, als ob das Auge des Königs auf ihm liegt, er bemüht sich, ihm zu gefallen. Er sieht seine Kleider, die Tracht des Hofes, hört den Ton des Gesprächs. Hat es ihm geschadet? Es scheint, als ob uns fremde Völker nachahmen.“
„O man achtet auf eure Kavaliere und Damen; ich fürchte, man wird noch schärfer auf sie achten müssen.“
Stolz der Franzose ablenkend: „Man achtet überall auf die Art Ludwigs. Man wird seine Sendboten überall mit Freude aufnehmen.“
Brulart und Pater Joseph wurden in der mantuanischen Sache vom Kaiser empfangen, ihre Legitimation war nicht vollständig, der Kaiser wollte dennoch sehr gnädig verhandeln. Pater Joseph durfte in Gegenwart des großen Lamormain lange zu ihm von geistlichen Dingen sprechen. Man redete über das Mysterium des göttlichen Erdenwallens; Pere Joseph, hinreißend sich ergehend, war in seinem Fach. Er drang auf Vereinigung der Seele mit Gott, ihr Eintauchen und Plätschern in Gott; alle irdischen Leidenschaften, die sich zwischen Gott und uns stellen, müßten abgelegt werden, die Liebe müßte den Verstand lehren, ihn im Gehorsam und der Demut des Glaubens gefangen halten, die Liebe müßte den Verstand zwingen, zu glauben, was er nicht sieht, zu bewundern, was er nicht versteht. „Immer muß man an die Taten des Heilands denken, seine Göttlichkeit durchleuchten sehen, ihn umarmen in seinem Wesen. Man muß den Mund nicht gemein öffnen, als wenn man essen will, muß nicht demjenigen gleichen, der lange hastig gelaufen ist nach einem Ziel, das er zu erreichen strebt und der ganz außer Atem ist. Nicht öffnen den Mund, wie um zu essen, innere Süßigkeiten zu empfangen, nicht sich erholen wollen von innerer Erstickung. Das ist Notdurft, Zwang, das ist nicht vollkommene Gottesliebe. Man muß herausstoßen aus sich das Leben der Eigenseele. Aufeinander der Mund Gottes und unser Mund, um die Seele fließen zu lassen über die königliche Tür seiner Lippen.“ Oft wiederholte er auf Fragen Lamormains: „Einschlummern im Dunkel des Geistes und der Natur.“
Ferdinand hielt Lamormain bei sich fest; was er von dem Kapuziner hielte; er selbst müsse als Tölpel gestehen, er besitze so geringen Verstand, daß es keines Zwanges mehr bedürfe, um zu glauben; wie groß müsse der Verstand des Pere Joseph sein, daß er solcher Gewalttätigkeiten bedürfe, und vielleicht auch wie ungläubig sei der Pere. „Welch ein Glaube,“ staunte er dann wieder, „dieser Mund Gottes, dieses Begeisterte, Absonderliche.“
Eleonore wurde gerufen; sie setzte sich erst kalt in der feierlich strengen Tracht an das Tischchen, die sie in Regensburg immer trug. Dann hörte sie zu, fragte abwesend, von wem die Rede sei, begehrte erregter und mit einem dunklen Blick den Franzosen kennenzulernen. Ferdinand lächelte schwer: „Du wirst sehen, er redet dir die Gedanken aus dem Hirn; man hört ihn besser nicht oft.“
Die Besprechung der kurfürstlichen Forderungen in der Wohnung des erkrankten Grafen Strahlendorf, — zugegen war neben anderen auch der junge König Ferdinand, — erhielt durch das unangemeldete Erscheinen und das Eingreifen der Majestät einen sehr ernsten Charakter. Die pointierte sächsische Schrift mit ihrem Jammer. Das unter lautloser Stille von Doktor Frey vorgelesene gräßliche Register des Herzogs Bogislaw von Pommern, vierundfünfzig schauerliche Punkte dem Mehrer des Reichs vortragen, von Eltern, die das Fleisch ihrer Kinder verzehren, von Leichen im Lande, die ungekochtes Gras im Munde hatten. Der Kurbrandenburger: zwanzig Millionen Gulden seien seinem Land erpreßt. Die ligistische Schrift endend: „Nachdem die Reichsfeinde, der Pfalzgraf, Mansfelder, Halberstädter, Baden-Durlach geschlagen, die dänische Armada zerstreut, fast kein Feind mehr vorhanden ist, hat man einen Feldhauptmann ohne Vorwissen und Einwilligung der Stände, ohne Geldmittel mit einer so ungemessenen absoluten Gewalt ins Reich verordnet, daß er nun alles nach eigenem Gutdünken regelt.“
Der junge König: „Wenn es richtig ist, was eine Schrift besagt, es seien von Friedland zweihundertvierzig Millionen Reichstaler an Kontributionen erhoben, so wird man den Herzog um Verrechnung ersuchen müssen. Wohin sind diese Summen gekommen? Sind sie wirklich nur zur nötigen Abfindung des Heeres und der Obersten benutzt und wer hat von ihnen profitiert?“
Peinliches Stillschweigen. Strahlendorf: „Das Gefährliche der Vorgänge liegt in der Verbindung der katholischen mit den protestantischen Kurfürsten.“
Der Kaiser: „Sie kommen mir mit Dingen, an denen jeder Erwählte Römische Kaiser zu beißen hat. Das Reich führt Krieg, man gewährt ihm keine Mittel. Der Ächter Friedrich hat das Reich angegriffen, man hat mir keine Mittel zur Gegenwehr gestellt. Der Herzog nimmt, was mir zusteht. Sind Vergehen vorgefallen, werde ich Strafe vollziehen lassen.“
Trautmannsdorf: „Das Reich bequemt sich zur Ordnung. Es ist ein Unverstand, mit Sätzen zu kommen, wie: Kontributionen nur durch die Kreise. Daran scheitert der Krieg.“
Der Kaiser griff seitlich nach den beschriebenen Bogen, warf sie auf den Boden: „Sie wollen kaum ein Reich. Jammern zum Schein. Sie wollen das Reich nicht.“
Der junge Ferdinand: „Wozu aber wählen sie einen Kaiser?“
Der Kaiser: „Sie tun es noch heute und morgen. Eines Tages werden sie versuchen, es nicht zu tun.“
Leise Trautmannsdorf: „Der Herzog zu Friedland war vielleicht zu stark. Man empfehle ihm größere Behutsamkeit.“
Graf Strahlendorf begründete angesichts der Erbitterung Ferdinands vorsichtiger als sonst die Fürstenlibertät, warnte davor, den ganzen Reichskörper gegen das Oberhaupt sich einen zu lassen; es sei schon nicht mehr die Frage nach der Wahl des jungen Ferdinand, sondern nach dem Abfall aller Kurfürsten vom Reich; er glaubte, historisch kommen zu müssen, sprach vom Beispiel Karls des Dicken, Heinrichs des Vierten, Wenzeslaus.
Am Tisch sitzend mit bald gelangweiltem, bald drohendem Gesicht Ferdinand: „Ich habe nicht vor, den Herzog fortzuschicken. Man wird mich durch alle Treibereien nicht irre machen.“
Trautmannsdorf: „Danach ist ein Riß wahrscheinlich.“
Der Kaiser ließ die Augen aufleuchten, lächelte den Grafen warm an.
Der Geheimsekretär: „Welche Antwort soll formuliert werden auf die Replik der Kurfürsten?“
Die Herren durften sprechen.
Strahlendorf: „Hinhalten. Wenn der kaiserliche Standpunkt so bleibt, versuchen, die Kurfürsten zu drücken, sie auf die Unmöglichkeit ihrer Forderungen hinweisen, die Erfüllung des Möglichen zusagen.“
Trautmannsdorf: „Die Majestät wird sich den Eingriff in ihre Autorität und Präeminenz verbitten. Die Schuld für einen Riß muß von vornherein der kurfürstlichen Maßlosigkeit zugeschoben werden.“
Der Kaiser dankte. Nach langer, scheinbarer Besinnung dankte er nochmals; es sei besser, auf diese Replik nicht zu antworten. Er antworte nicht. Er gäbe den Kurfürstlichen Durchlauchten, die in einem Jähzorn gehandelt hätten, Zeit sich zu besinnen.
In das Refektorium der Karthause wurde eines regnerischen Abends Pater Joseph gerufen; es wolle ihn eine hohe Person sprechen. Zwei Damen in Schleiern, auf deutsche Art gekleidet saßen da; die eine sprach ihn italienisch an, es war die Kaiserin. Er möchte ihr von seinem Orden erzählen.
Und als er gesprochen hatte, glühten hinter ihrem Schleier ihre Augen, Gräfin Khevenhiller trat an das Fenster hinter eine Säule.
Sie freue sich, solche Stimme der Gottesinbrunst zu hören, man vernehme es so selten in diesem Lande.
Ob er Italien kenne. Und dann plötzlich, kaum das Schluchzen unterdrückend: so weit sei es gekommen, daß man nicht Anstand nehme, ihre Heimatstadt zu belagern. Er meinte tröstend, so sei Politik der Deutschen. „Helft Ihr mir,“ bat sie, „ich habe Briefe von meinen Freundinnen, Geschwistern; was ich Euch tun kann, sollt Ihr haben.“ „Wenn unsere Heere siegen werden.“
„Sprecht mit dem Kaiser, mit Lamormain. Ich bin eine Frau; kann man keine Rücksicht auf ein Frauenherz nehmen; bin ich hier nichts.“
Kopfschüttelnd Joseph: „Es ist nicht der Kaiser oder Lamormain. Es ist der Herzog von Friedland.“
Sie keifte leise: „Schickt ihn fort; ich hasse ihn, sein Name ist mir zuwider, der falsche Böhme.“
„Man kann ihn nicht fortschicken. Es ist leichter für ihn, uns alle fortzuschicken.“
Sie wütete mit ihren Fäusten gegen ihren Schleier: „Ihr habt es gehört. Es ist unsagbar, wir sind seine Gefangenen. Man soll ihn entlassen.“
„Wer ist Kollalto bei Mantua? Seine Puppe. Der Herzog ist das oberste Gericht im Reich. Wir spielen hier in seinem Schatten. Der Kaiser fühlt es nicht.“
Sie sah ihn erstarrt, weitäugig an: „Und dies ist wahr, der Herzog macht mit uns, was er will?“
Joseph lächelte traurig: „Es ist schon keine Neuigkeit mehr, Majestät. Fragt Euren Schwager, die bayrische Durchlaucht.“
Die Kaiserin stand von der Bank auf: „Ich will den Kaiser befragen, er soll hören, wie man spricht.“
„Fahrt lieber zum Herzog; er residiert in Memmingen, nicht weit von Ulm. Er wird Euch helfen, wenn Ihr dringlich bittet um Mantua. Aber sprecht nicht von mir zum Kaiser. Die Deutschen lieben nichts Fremdes.“
„Oh, sprecht Ihr wahr, Ehrwürden; ich danke Euch.“
„Dankt nicht, Majestät. Auch mein Land leidet. Der Herzog von Nevers ist ein Franzose.“
Solche Auseinandersetzung hatte Ferdinand noch nicht mit der Mantuanerin gehabt. Die Frau war unnachgiebig, bitter, verächtlich gegen ihn. Sie hätte geglaubt, Kaiserin zu sein. Sie sei Italienerin. Dulde man in Deutschland solches, so sei das deutsche Art. Sie nehme es nicht an, sei nicht herübergekommen als Vasallin des emporgekommenen Friedländers. „Zu essen von seinem Geld, zu leben hinter seinem Rücken, das nehme ich nicht an; ich bleibe die Tochter des Herzogs von Mantua.“ Er war nur erstaunt, welcher Narr ihr das beigebracht habe. Etwas Haßartiges war in ihr aufgestiegen. „Narr? So wahr ich selbst Narr bin, sind dies Narren, die mir das beigebracht haben. Du bist versunken, du träumst. Mir sind die Augen aufgegangen. Der von Wallenstein muß weg.“ „Ich träume, ich bin versunken. Er dient mir, wie es beinah nicht mehr menschlich ist. Sie beneiden mich um ihn und beneiden ihn selber, den ich hochgehoben habe.“ „Der Giftspritzer, der Unband, der Teufel. Das gesegnete Geschenk, der von Wallenstein.“ „Sie beneiden ihn, wie sie mich beneiden.“ „Keiner wird an unsern Tisch sich setzen wollen, nur der Teufel. Der Heilige Vater wird seinen Fluch über uns aussprechen.“ „Dir bangt um Mantua.“
Sie schrie und überschrie sich: „Ja, mir bangt um Mantua. Und ich will zu befehlen haben, daß mir nicht darum bangt. Ich bin Kaiserin, es ist meine Heimat. Ein Hund soll nicht hingehen können und sie zerreißen.“
Sie warf sich in einen Stuhl: „Ich lebe nicht mehr, wenn dies geschieht.“
Diese hatte er einmal geliebt.
Ein unscheinbares Brieflein wurde bei dem Meßgang dem Kaiser übergeben, in dem Wallenstein auf die Truppenmassen aufmerksam machte, die dem Kaiser zwischen Memmingen und Regensburg zur augenblicklichen Verfügung ständen.
Und plötzlich sah Ferdinand, daß die Entscheidung ganz bei ihm lag. Er konnte träge noch einen Tag nach dem andern hinziehen, die Wirklichkeit war nicht wegzuschlafen. Kein Kollegium eines Hohen Rates bedrängte ihn. Sie hatten sich in den Hintergrund gezogen, wagten sich nicht an den Wurf; der tapfere gute Eggenberg lag krank irgendwo in Istrien.
Er fühlte, in der Nacht sich aufrichtend, daß er satt war, daß er Sieger war, Kaiser durch Wallenstein, und daß er sich wenden könne, nach welcher Seite auch immer, es war die rechte Seite. Es stand in seiner Gewalt, zu wählen, es konnte auf keine Weise fehlgehen. Und darauf legte er sich zurück und schlief wieder ein.
Finstere Gestalten umgaben ihn bei Tag. Die Mantuanerin sah er nicht; er freute sich, sie wollte ihr Spielzeug.
Der Mainzer und Maximilian saßen stumm und äußerlich voll Ehrfurcht an seiner Tafel. Mit großem Auge betrachtete sie der Herrscher, vertiefte sich in ihre Gedanken.
Brulart saß da, er dachte an nichts, als die Spanier aus Italien zu vertreiben.
Der Herzog von Doria, Gesandter Philipps saß da; dachte an nichts, als die Welschen aus Italien zu jagen.
Über Memmingen, glanzvoll von Wallenstein empfangen, langte als päpstlicher Legat der Kardinal Rocci an.
Da hielt es Ferdinand in einem tief aufsiedenden Gefühl der Verachtung für angezeigt, die Verbrennung zweier Juden, die verurteilt waren, zu befehlen und sich an ihrem Anblick zu weiden.
Ein Jude, ein getaufter, war mit drei anderen beim Diebstahl erwischt, darauf von ihnen beschuldigt worden, nur zum Schein übergetreten zu sein, mehrmals die Hostie geschändet zu haben, indem er sie in einen stinkenden Ort versenkte. Das Geweihte, der Leib Christi, wurde von dem Büttel, in ein Sacktuch gewickelt, aus einem Unratkübel seines Wohnhauses gefischt, der Malefiziant wurde zum Tode verurteilt. Als der Jude aus dem Stock eines Tages mit den drei anderen, die der Strang erwartete, abgeholt werden sollte, stellte sich dann heraus, daß nicht er, sondern sein Weib sich hier befand und sich zur Strafe erbot. Aus Kreuzverhör Folter ergab sich der Aufenthalt des Verurteilten; er wurde aus seinem Verstecke in der Stadt, in Böttchertracht, herangeschleppt.
Der Scharfrichter schleifte auf einer Stierhaut hinter zwei Mähren einen schwächlichen Mann auf den Rathausplatz, Wams und Hose in Lumpen, die Hände über den Kopf zusammengebunden, samt dem Ochsenschwanz am Zaumzeug der Mähren mit Riemen befestigt; er wälzte sich auf Gesicht Rücken unter den Stößen der Steine. Sechs Henkersknechte, scharlachrot wie ihr Herr, ritten vorauf, bliesen Schalmeien, schlugen das Kalbsfell. Abgeschnallt, auf die Beine gestellt von den Schergen, den abgefallenen Hutkegel aufgestülpt, wurde der fahle, ins Licht zwinkernde Wicht vor die Schrannenstiege gestoßen.
Auf dem Esel rückwärts reitend, hinter ihm, herabsinkend, wer prangte so herrlich! Die Frau in den gebändigten Reizen des Südens, die Farben der Wangen bronzebraun, die eisenschwarzen Haare in Strähnen über kleinen Ohrmuscheln, folgte mit schmachtenden Blicken dem wankenden Schächer; neben dem Grautier an seinem Hals schauerte ihr zierlicher Leib, die Zähne schlugen schnarrend im Mund zusammen.
Mit rotem Tuch waren die Schrannen ausgeschlagen, das Stadtgericht saß oben mit bloßem Schwert; der Schächer kniete zwischen den Spießen der Schergen an der Stiege. Eine monotone Stimme machte sich laut durch die Unruhe des Marktes, ließ sich verschlingen von dem Lärm der Zuströmenden, der holzschleppenden Schinderknechte, dem Scharren Wiehern Hufschlagen der kaiserlichen Pferde neben der Stiege. Das Verbrechen verlesen, das Urteil verlesen, ein schwarzer Stab über den Juden gebrochen, geworfen. Der Unterrichter bestieg sein Pferd.
Sie hielt sich am Nacken des Eselchens, wandte sich still rückwärts mit hochgezogenen Augenbrauen, schmerzvertieften Linien um den gepreßten Mund, gegen die Menschenmenge, die tausendäugig um sie wimmelte, Mönche Priester Jesuiten Soldaten Kinder Studenten Edelfrauen Handwerker Bettler Franzosen; ließ ihre Arme fallen, blickte auf ihre gelben Schuhe. Sie trug, wie ihr gestattet war, ein schwarzes, loses, hoch geschnürtes Seidenkleid, mit Perlen bezogen, die Ärmel bis zum Ellenbogen pludernd. Ein durchsichtiges schwarzes Seidentuch war rückwärts über den Scheitel gesunken, unter dem Kinn geknotet. Und über den glühenden erstarrenden Augen die Stirnspange mit grünen, blauen Steinen. Trug es, man wußte nicht warum; es war, weil sie so ihrem Mann am lieblichsten erschien. Einen Gürtel aus den gleichen grünen, blauen Steinen hatte sie an, daran hingen Kettchen mit Kinderzähnen. Alles bewegte sie an sich, wies es ihm, ließ es lebendig sein.
Er stieg auf die weite Holzbühne; man band ihn an einen Pfahl; an einen Pfahl am andern Ende der Bühne band man sie.
Der Scharfrichter riß ihm Wams und Hemd herunter, die Hose band er mit einem Strick fest. Drei Knechte schleppten den rauchenden Kohlentiegel herauf; der Scharfrichter griff an den Enden die glühweiße Zange. Ihre beiden geöffneten Kiefern ließ er an den Oberarm des wimmernden Gesellen hauchen, biß zu; steil aufsteigend scharf der Geruch, schwarzrot das Loch im Fleisch. Biß, ließ nicht los. Den Mund riß der Gefolterte auf, weiter, stürzte gegen den Arm hin, bog den Kopf zurück, grölte, während seine gebundenen Füße rückwärts am Stamm hochzuklettern versuchten. Die Zange ließ los, der Henker griff eine neue, wischte sich die Nase; ließ spielerisch den Gluthauch des Eisens über den ganzen Arm laufen, bis er einschlug. Schweißverklebten Haars der Schächer in seinen Stricken, die Spinne biß, sog, sog, sog, sog — es lief aus dem Kopf, aus den Augen her, aus dem Mund, hin zu ihr, hin zu ihr. Weg aus den Knien, weg aus den Ohren, die Wolken, der blaugraue Himmel. Murren des Marktes. Klebrig löste sich die Zange ab, brauste in den Tiegel.
Die Hälse unten reckten sich, die Nasen schnüffelten aufmerksam. Dritte Zange. Mit einem Griff gehoben, geschwungen, angesetzt. Wuchtig geschmettert gegen den anderen Arm, gepreßt in das aufzischende, schmierig sich blähende Fleisch. Und wie mit einem Satz die Zange ansprang, sprang der Malefiziant ihr entgegen, wühlte, krampfte, zuckte um sie herum, mit blassen Blicken, weißen, speicheltriefenden Lippen, verzehrend, in einem Strudel dünn, blind, taub, überschäumend herumgewirbelt. Bis ein kleiner schwarzer Punkt größer am Himmel wurde, Kreise sich bildeten, größere hereinschwangen, weißer wurden.
Die letzte Zange: ein inniges, Zahn in Zahn vergrabendes, tobsüchtiges Wiedersehen, Zotteln, Schleudern rechts, links, atemloses Schaudern und Verkeuchen, Backenaufblasen, helles Pfeifen aus den tiefsten Luftröhren.
Der Kopf baumelnd vor der Brust. Der Scharfrichter triumphierend beiseite. Ein Knecht bespritzte den Stöhnenden aus einem Bottich. Der Kopf hob sich unsicher, sank auf eine Schulter, hob sich unter neuen Wassersalven.
Aus seinem Ledergurt zog der Scharfrichter ein kurzes Messer, wetzte es an der Schuhsohle. Gleichgültig schwankte, wie eine welke Blüte, der Kopf des Schächers, da schnitt ihm blitzschnell der Henker zwei lange, breite Bänder aus der Brusthaut, ritsch, ritsch, riß sie heraus, ein queres Band über den Leib, hinten zwei lange, breite Bänder aus dem Rücken. Schwang sie, blutfließende weiße Riemen, in der Linken hoch vor dem kaum atmenden Volk, gab sie dem Gehilfen, der das Bündel dreimal grinsend schwenkte, bevor er es in den Bottich klatschte.
Sie kreischte angstvoll.
Das Volk mäuschenstill. Er ließ den Mann stehen, nahte ihr.
Mit weiten Pupillen, irren Augen, die neugierig erschienen, begleitete sie ihn; dann glitten ihre Augen zu dem blutenden traumverlorenen Schächer; sie schrie, den Kopf an den Pfahl legend, von neuem. Der Scharfrichter wusch sich, breit gebückt über dem Bottich, die Hände vor ihr. Plötzlich, weit ausholend, knallte er seinen nassen Handrücken um ihr Gesicht. Sie behielt den Mund offen, ein feiner Blutstreifen rieselte über das Kinn; von unten schmetterte er ihr die Zähne zusammen. Sie blickte ihn wirr an, begann mit den Knien heftig zu zittern, am Platz zu treten.
Er beäugte einen Moment ihre Stirnspange, hob sie vorsichtig ab; das seidene Kopftuch blieb daran hängen. Lippenspitzend, nachdem er die Spange dem Knecht in die Hand gedrückt hatte, öffnete er den feinen Gürtel, zog ihn ab, wog ihn in der Hand.
An der Tuchlaube standen fünfzig schwarzgewandige Zöglinge des Jesuitenkonvents hinter ihrem Profoß; Rosenkränze spielten in den Händen; mit wissenschaftlicher Kälte folgten Scholaren und Patres dem Gebaren des Scharfrichters, prüfend, nachdenkend, erwägend.
Ein Pater kniete neben einem Scholar, der in den Schlamm gefallen war; sie blickten sich schweigend an; der blasse junge Theolog senkte beschämt sein Gesicht. Nach einer Pause sagte der andere: „Du mußt an Gott, Jesus und Maria denken. Du hast an die Menschen gedacht, nicht wahr?“ „Ja,“ flüsterte der, „mir wurde schlecht, ich habe an die Menschen gedacht.“ „Der Heiland war Gott, und jene haben ihn an das Kreuz genagelt in ihrer Bosheit. Seinen heiligen Leib, seine wonnige Mutter, den Quell unseres Lebens, haben sie beschimpft; dafür haben sie zahlen müssen und werden noch mehr zahlen. Was ist ein Leib, was sind tausend Menschenleiber! Wie können die Juden danken, daß man sie nicht samt und sonders erwürgt. Wer weiß, ob wir gut daran tun, daß wir sie dulden; wie wir uns versündigen am Heiland.“
Bürger, Zünftler, Gewerker, in Scharen um den Brunnen nahe dem Heringshaus, viele auf den Knien. Aus ihren Haufen fuhren die Drohungen gegen die beiden Judenmenschen über den Markt, immer von den Rufen und Spießen der Schergen niedergehalten. Weiber rotteten sich beim finsteren Linnengäßchen vor dem Haus zum „Silbernen Häslein“, mit Abscheu, mit Widerwillen die Verbrecher betrachtend, ihre Kinder zwischen sich versteckend, bei jedem Zangenbiß und Schnitt heulten sie auf, die Tränen liefen ihnen über die Backen, manche erbrachen, manche blieben bei einem stummen Zittern, konnten sich nicht von der Stelle bewegen.
Nonnen, braune Minoriten, weißkuttige Dominikaner über das Pflaster geworfen, stundenlang unbeweglich, die Lippen auf den kleinen Kruzifixen, durchschauert von dem unausdenkbaren Verbrechen am Leib Jesu; Gnade, Verzeihung erbettelnd, ringende Zerknirschung ohne Ende.
Der Hof auf fliegenumwehten Rossen, edle Herren unter der Balustrade der Stadtschrannen, ernste, müde, feierliche, seidebehängte Männer, verächtliche Blicke auf die Delinquenten, manche freudig die Masse musternd, sich anhebend unter bewundernden Mienen.
Ferdinand auf dem Balkon des Stadtrichters; erhöhter Sitz; der Beichtvater im schwarzen Jesuitenkleid neben ihm, kalt saßen sie, halb abgewandt von der Bühne. Zerstreut hörte der Kaiser auf die Belehrung des alten Mannes. Wie kam es: Dighby fiel ihm ein, die Saujagd bei Begelhof, der Graf Paar. Wo war Dighby? Übermüdet gähnte der Kaiser, verkniff den Mund unter dem faden Geschmack aus dem Magen.
Ein lateinisches Lied hoben die Scholaren zu singen an.
Der Scharfrichter tastete den biegsamen Leib des Weibes ab, zog sich zusammen, flüsterte etwas; er beugte sein Ohr gegen ihren Mund; sie flehte wie ein Kind: „Ist jetzt gut? Ist jetzt gut?“
Inzwischen war der blutrieselnde, gebrannte Schächer aus seiner Ohnmacht erwacht; den Kopf mit Gewalt hochstemmend, krähte er, wühlte mit den Gliedern in den Stricken. Wildes Gelächter erhob sich bei den Zünftlern, pflanzte sich zum Hof fort; exaltiert schüttelten sich die Weiber, schrieen sich mit übertriebener Freude zu, küßten ihre Kinder, rafften die Röcke. Gekräh erscholl aus dem Hahnengäßlein, am Brunnen. Leicht wogte der Markt. Die Schergen gaben nach, man wallte hinunter, herüber zwischen Arkebusen und Stangen. Die süße Angst der Weiber hatte zugenommen, sie konnten sie mit allem Lärm nicht bewältigen, drängten zu den Männern. In grausiger Ruhe, wie Grabsteine, lagen Mönche und Nonnen am Boden.
Im weiten Halbkreis schichteten Henker und Gehilfen unter dem Pfahl des Mannes Holz; seine Stricke waren ihm gelöst worden, Säckchen von Salz und Pfeffer wurden von weitem gegen seine Wunden gestäubt; er ging an einer Eisenkette um den Pfahl, drehte die Kette kürzer und kürzer, rollte sie wieder ab; rieb seine Wunden an dem Pfahl, bedeckte seine Arme, spie, bespeichelte seine Brust. Die Frau zog ihre Kette lang, sie rannte zu ihm, bis die Kette sie hielt, blieb armstreckend stehen, klirrte mit den Kinderzähnchen, rief zärtlich, unverständlich, kam unvermerkt, vorschreitend, abirrend, in einem zärtlichen Schritt, sich selbst mit ihrem Gurren und Zwitschern begleitend. Die Arme wiegte sie, das Atlaskleid schleifte sie keusch, die Augen, zwischen Husten und ersticktem Luftringen, erstarrt auf ihn dort, jenseits, in den Flammen, die Backen tränenüberströmt, auf Sekunden lächelnd hinschmelzend, wieder versteinert.
Die Menschen, die andrängten, schob man zurück; ein Qualm erhob sich aus dem Holzhaufen. Als sich nach Minuten der Rauch verzog, stand der Schächer fest am Pfahl, das blaurot gedunsene Gesicht mit den gepreßten Augenlidern nach dem Platz, sperrangelweit den Rachen, gebläht und schwingend die Nüstern, als wenn er niesen wollte, die Knie übereinander, den Bauch hohl eingezogen. Plötzlich blies er die Luft von sich, zog die Arme voneinander, atmete, schnappte gierig. Langsam begann um ihn die Luft einen Wellenschlag anzunehmen, er wurde sichtbar in kleinen zitternden Bewegungen, wirbelte flüchtig nach oben, schief und verzogen wurden die Erscheinungen hinter ihr. Er tanzte, sprang rückwärts, seitlich. Die Arme hatte er frei, er trug sie wie Fühler vor sich, raffte sie wieder an sich. Kleine Quellchen sprudelten aus seinen Wunden, spritzten aus der Brust im Strahl ins Feuer. Wer es unten sah, schrie: „Schelm! Schelm! Er will löschen“. Da langte ein kaum sichtbarer, blau in weiß vorschwebender Flammenarm von hinten nach ihm. Er wirbelte herum, torkelte zur Erde, kletterte in die Höhe, seine Lumpen flammten, er nahm den Kampf auf; war fast nackt. Die letzten Lumpen wollte er sich vom Bauch, von den Lenden reißen, sie saßen fest, schwarz verbacken, verklebt mit der Haut; er schauerte mit den Ellenbogen dagegen. Auf seinem Kopf standen keine Haare mehr, runde Kohleballen, die abrollten, die er sich über das Gesicht schmierte, über die großen platzenden Blasen. Er blies über die Handteller, die Brust, die Asche stäubte, die Lumpenfetzen bröckelten. Auf die Zehen stellte er sich, den Körper hochgezogen; schluckte die Luft mit vollen Blasebalgbacken, in leidenschaftlichen Zügen von oben ab. Schwarzrot, durchlöchert, aufgebläht raste er suchend um den Pfahl, hingeschleudert von der Kette tauchte er zum Boden, schnappte die Luft über den heißen Brettern. Die brodelnde blaßblaue Luft ging dicht an ihn.
Sie sah es, bedeckte mit den Händen das Gesicht. Plötzlich schrie er auf; eine glühende Zange lag da, die dem Scharfrichter aus dem Tiegel gefallen war. Der, hinblickend, brüllte: „Die Zange her! Wirf die Zange herunter, Hund“, tobte gegen die Knechte, warf einen Kloben Holz, brüllte: „Zange!“ Der Schächer wich zur Seite. Eimer auf Eimer goß der Scharfrichter vor sich in die Flammen, drang vorwärts, schlug mit einem Haken nach der Zange. Irr sah der oben den schwarzen Haken sich nähern, griff danach, stürzte gestoßen um, kroch zurück. Wallend der dünne Feuerschleier zwischen ihm und den Menschen. Und wenn der Schleier fiel, frohlockte das Volk, daß es ihn sah, das wilde, tanzende Geschöpf, das hüpfende, das schwarz und rot, immer ähnlicher dem Satan wurde. Er atmete, rannte dicht vor, soweit die Kette ließ, haarlos, stumm, nackt. Die Flammen wälzten sich in Ballen hinter ihm, jäh hob sich vor ihm der rotweiße, glühe Vorhang.
Da durchdringender Schrei, drei, vier, fünf, Knäuel von Schreien, wieder! Schreie auf Schreie! Jache Stille. Schwarzer dünner Qualm. Wütendes Bersten, Prasseln.
Jetzt griffen ihn die Flammen umsonst an; wie aus Holz lag eine menschenähnliche Gestalt, den Kopf auf den Balken gedrückt, inmitten der Glut; kleine Feuerchen spielten um seinen Schädel, strichen an seinen Leib. Rasch lief eine braunschwarze Haut über ihn, als überzöge sie ihn mit einem Lederkleid. Dampf aus der Nackengegend. Er ließ sich ruhig umfassen von der Hitze. Kippte um; die Beine angezogen, schaukelte er auf dem Rücken; die Beine zogen sich fester an den Leib, in dem Knarren und Wühlen des Feuers, während in der Nähe ein leises Puffen, wie Erbsenspringen, zu hören war, feines Knallen, und neben ihm sich Bächlein Rinnsale bildeten.
Er kräuselte sich schwarz, wurde kleiner.
Sie blickte nicht mehr nach rechts.
Jetzt war ihr Geliebter geschwunden.
Sah eine kleine Minute in Gedanken vor sich. Das Haar auf ihrem Kopf loderte auf. Sie kreischte, duckte sich. Lief an den Pfahl, wich nicht, als wäre sie angeschmiedet. Als die Kleider um sie aufflammten, kauerte sie hin, beugte sich über ihre Knie, ein verzagtes Hündchen. Einen Augenblick erkannte man zwischen dem wütenden Ineinander der Flammen ihr dunkelrotes, aufgehobenes Gesicht, den Markt mit erstorbenen Blicken anstierend. Der lodernde Pfahl stürzte über sie, die Bühne krachte mit den beiden Toten ein.
Der Kaiser war schon früher mit dem Hofe aufgebrochen.
Der Pater Mutius Vitelleschi mußte die kochende Kampagna durchfahren. Urban nahm seine Entschuldigung, daß er hinfällig sei, nicht an. In Kastelfranko sagte ihm in einem Soldatenzelt der schwarzbärtige Mann: „Dieser Säufer, der Kollalto, macht unerhörte Fortschritte auf Mantua; gegen die Sintflut von Menschen, die der Kaiser über die Alpen warf, ist man machtlos.“ Er fing an, scheußliche Schimpfworte auf Ferdinand zu werfen, den er nur den Idioten nannte, und auf Wallenstein, auf dessen Kopf er Millionen setzte; Priester müßten ihn vergiften oder niederstoßen, wo sie ihn träfen. Der weißgesichtige General machte fragend auf die Ergebenheit des Kaisers, die Freigebigkeit Wallensteins aufmerksam. Der Papst raufte sich mit wilden Blicken den Bart: ergeben sei der Kaiser den Jesuiten, freigebig gegen die Jesuiten; ob man die heilige alte Kirche mit der jungen Jesugesellschaft verwechsle; gegen ihn sei weder Kaiser noch Feldherr freigebig; ihn bettle man an, suche seine deutschen Einnahmen zu kürzen; nun breche man noch in Italien ein, damit die Spanier den Fuß auf ihn setzen könnten.
Mit sehr großer Strenge setzte er dem schweigenden General die Sachlage auseinander: in diesen endlos wütenden Kriegen der europäischen Menschheit sei die Heilige Kirche die einzige Gewalt, die das Spiel der Menschheit im Auge behalte. Der europäische Erdteil biete den Anblick eines Höllenpfuhls. Und dies, weil die Herrschaft Roms längst übergegangen sei an beliebige Menschen mit irgendwelchen Machtmitteln und Geburtsdaten wie Philipp, Ferdinand dem andern, Wallenstein; von den Ketzern zu schweigen. „Sofern es eine Würde der Menschheit gibt, muß sie aus dem Kothaufen aufgehoben werden, in den sie tobsüchtige Weltlichkeit, verruchte Gewalttätigkeit und Ketzerei gestoßen haben. Es kann uns in diesen Tagen begegnen, daß wir, die Christi Stellvertreter auf Erden sind, unsere letzten ärmlichen Kräfte verlieren; wir können nicht die Menschheit regieren, nicht erheben, zur Besinnung rufen, sondern müssen spurlos verschwinden und dem Wunder Gottes ihre Rettung überlassen. Wir, das heilige süße Wort Christi verwaltend, machen Platz Schakalen, Untieren; man wird die Schönheit, Reinheit, den Glanz eines Menschengesichts nur noch aus frommen Bildern kennen. Nach solchen tausendjährigen Triumphen der Kirche verzagen, wie ich.“ Vitelleschi erbat die Erlaubnis, zu sprechen: er bittet um Verzeihung, daß er geglaubt hat, wegen seiner Hinfälligkeit mit der Reise zögern zu dürfen; er hat den Umfang des Unglücks nicht vorausgesehen. Nördlich der Alpen ist ein Land, das die Kirche schon oft in die tiefste Betrübnis versetzt hat, es ist schwer, das rohe Volk dort zu einer Haltung zu bewegen, die sich ertragen läßt. Dort ist auch derjenige Luther geboren, von dem seine eigenen Zeitgenossen sagten, er ist kein Mensch, sondern der Teufel selbst unter menschlicher Gestalt.
Laut rief der Papst aus: „Wir unterwerfen uns nicht kampflos. Wir haben rechtzeitig erkannt, daß die Vorbedingung der Wirksamkeit des göttlichen Wortes unsere Unabhängigkeit von den tierischen Mächten ist. Wir haben ein Land, in dem wir residieren, mit dem wir den blinden Naturmächten zeigen, welche Gewalt den göttlichen Ideen innewohnt. Jeder Pfennig, der uns zugeht, wird zu nichts benutzt werden, als unser Land eisern zu machen, zu einem unerschütterlichen Wall. Wir sind keine Phantasten. Wir sind keine Dichter. Wir sind für die Erde eingesetzt auf unserm Stuhl, man wird uns nicht in die Luft blasen. Wollt Ihr mich verstehen?“ Darauf verwies Urban, die Meldung eines Artilleristen auf später verschiebend, den Jesuitengeneral bei dem geschworenen Gehorsam auf die verfügbaren Machtquellen Deutschlands, auf die Lehrer Professen und Scholaren aller Grade, die das Volk meistern und im Notfall es widersetzig machen sollten, vorerst auf die Beichtväter der Fürsten.
Pater Lessius, gerade anwesend in Rom, erhielt von Vitelleschi Instruktion und Auftrag, sich nach Deutschland zu begeben. Er besaß die Kühnheit, die Route über Memmingen zu nehmen und nach Durchbrechung des tobenden militärischen Gürtels um die Stadt in die totenstille Ortschaft einzudringen, die auf jedem gangbaren Weg fußhoch mit Stroh belegt war. Der Herzog nahm ihn an, inmitten eines riesigen Zulaufs von Kriegsoffizieren Kurieren. Es war dem Jesuiten wunderbar, vom General dieselben Gedankengänge zu hören, die er gegen ihn in Regensburg ausspielen sollte: der Krieg der Christen gegeneinander müsse aufhören, man müsse sich auf Konstantinopel werfen. Der General schien ihm ein listiger, gefährlicher Gegner zu sein; er behandelte seinen Gast mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit; undurchdringlich wünschte er ihm gute Verrichtung in Regensburg, wohin er leider selbst aus Zeitmangel nicht reisen könne.
Lamormain wurde in einer Halle des Karthäuserklosters vor der Stadt von Lessius belehrt. Ein fürstlicher Beichtvater nimmt sich ohne weiteres, indem er sich des geistigen Wohls seines Beichtkindes annimmt, des kirchlichen Wohls an. Über das kirchliche Wohl befindet der Papst. In politische Dinge hat sich der Beichtvater nicht zu mischen. Hat aber das fürstliche Beichtkind Interessen, die das päpstliche berühren, so ist das Beichtkind auf den maßgebenden päpstlichen Weg zu führen. Dies erhellt ohne weiteres.
Schwer schlug auf den Luxemburger die Kunde ein, daß der Papst sich auf einen Kampf auf Tod und Leben mit dem Kaiser gefaßt mache, daß die heilige Kirche bedroht sei von dem übermächtigen Wallenstein, der die Spanier unterstütze. Wieder nahe eine Entscheidungsstunde der Kirche. Der Luxemburger fing leise an von der Grundlosigkeit der päpstlichen Sorge zu sprechen; Lessius blieb taub. Sie kamen auf das Thema: wie weit muß der Papst im Besitz weltlicher Macht sein und hat er sich an anderer weltlicher Macht zu messen. Die Antwort lautete: der Papst ist von Haus aus Führer der Menschheit, daher höchster Erdenkönig, der Städte und Staaten zerstören kann. Die Schwertgewalt hat sich ihm zu unterwerfen oder zu dienen.
Lamormain fragte gebeugt, wie lange Lessius in Regensburg verweilen wolle. Bis Lamormain den befohlenen Auftrag ausgeführt hätte.
Am begrasten Ufer der breiten, schnellfließenden Donau ritten die Majestäten auf hochbeinigen Tummelpferden, langsam, ohne Gespräch. Das Ufer wurde steiniger, schmaler. Sanfte Berge erhoben sich rechts und links. Bald war der Weg durch kleine Steinblöcke verlegt. Felsige Wände fielen in den Fluß ab. Man bog oberhalb des Ufers auf Hügel und Waldwege ein.
Die Mantuanerin, in weiß und grünem Jagdkleid wie die Herren auf dem Schimmel hängend, streckte die Linke mit der goldenen Peitsche aus: „Wie schön ist das Land.“ „Es ist schön. Wir wollen öfter hierher.“ „Ich möchte nach Hause.“ „Wohin, Eleonore?“ „Nach Wien.“ „Ich möchte mit dir.“ „So komm. Tu mir ein Liebes an. Das Land ist so schön. Komm nach Laxenburg. Nach Wolkersdorf.“ „Ich will nicht lange mehr bleiben, Eleonore. Die Tagung wird nicht mehr lange dauern. Mich hält hier nichts mehr.“ „In Wien haben die Kapuziner unsere Gruft gegraben. Ich möchte einmal sehen, wo ich begraben werde.“ „Wie sprichst du.“ „Regensburg verpestet mir das Blut, Ferdinand. Die Leute sehen mich an, als wenn sie etwas von mir wüßten.“ Und obwohl er verstand, was sie sagte, bewegte sich in ihm nichts. Von Zeit zu Zeit drehte sie ihm ihr strenges zuckendes Gesicht zu; die weiße Hutkrempe warf sie sich mit einem Ruck an die Stirn; sie konnte vor Grauen vor ihm vergehen. Er hatte einen vertieften Ausdruck. Wie fremd sah er auf sie. Der Mann ist gestorben, fühlte sie. Er schlug sein Tier.
Hinterher ritt der spanische Sondergesandte, der Herzog von Doria, und Graf Trautmannsdorf. Der Herzog lachte viel, daß es zwischen den Bäumen scholl. Schön sei das Wetter und die Wege breit, bequeme Wälder zum Rasten, schattig. Welch prächtiges Terrain für Soldaten; hier könne sich Kavallerie nach Lust ergehen. „Welche Kavallerie meint Euer Liebden?“ „Es wird nicht mehr lange dauern, daß wir hier spazieren reiten. Wallenstein ist schon gespannt wie eine Arkebuse. Das alte Holz birst, wenn es zu lange malträtiert wird.“ „Glaubt Ihr. Ich habe schon die Hoffnung aufgegeben, den Herzog zu Friedland kriegerisch in meiner Nähe zu sehen.“ „Geduld, Ihr Leckermäulchen. Die Katze wird kommen, wenn die Milch schön kühl geworden. Dann wird ein Schlürfen anfangen, daß man es bis nach München und Paris hört.“ „Der Kaiser besinnt sich sehr lange. Der Friedländer wartet und wartet.“ Der Herzog von Doria, dickwamstig, wie er auf dem Hengst saß, brüllte vor Lachen so, daß man sich vorn umsah und sie seitwärts reiten mußten: „Leckermäulchen. Leckermäulchen. Wartet nur mit. Seid nur so gnädig. Bringt Euch nicht um vor Gier. Kuriosa von Regensburg. Wallenstein ist auf dem Sprung nach Norden, Süden, Westen; springt er auf Italien, Elsaß oder Regensburg? Mantua steht vor dem Fall, Casale auch. Die Kurfürsten werden dann die Schwänze einziehen. Es wird ihnen übel ergehen. Sie werden anbeten in Regensburg.“ „Wir werden’s sehen.“ „Wir werden’s, Leckermäulchen.“
Als auch die Kaiserin Eleonore durch ihre italienischen Begleiterinnen erfuhr, daß die Einnahme Mantuas bevorstände, tat sie im Karthäuserkloster einen Fußfall vor Pater Joseph und flehte ihn um Hilfe und Schutz an. Sie war unordentlich gekleidet; nur ihre Kämmerin ging hinter ihr und stand abgewandt an der Tür. Der leise Franzose tat die Läden zur Hälfte vor die Fenster, damit die Kaiserin sich nicht plötzlich im Hellen ihres Zustands schämte. Sie schluchzte den Boden um seine Füße naß, stammelte, winselte: „Mantua hin, Mantua hin“, und weiter brachte sie nichts hervor. Und er dachte, während er sitzend ihr zuredete, nach, was sie mit diesem Mantua hätte; es könne doch nicht Mantua sein. Wie er vom Kaiser sprach, rauschte sie mänadenhaft auf, feindselig schlug sie die Fäuste gegeneinander, ohne mehr zu rasseln als: „Er, er, er“, stürzte vor seinem Blick wieder wie abgebrochen hin.
Er riet ihr, ihren Scheitel berührend, eine Weile Regensburg zu verlassen. Nach einer Weile war sie ruhiger, drehte sich noch kniend nach der Dienerin um, wies sie kurz hinaus. Sie trocknete sich das Gesicht ab, ging zu seiner Verwunderung zum Fenster, bat, die Läden zu öffnen. Da atmete sie ihre Brust ruhig. Sie war ganz die Kaiserin Eleonore, schien keine Scham über ihren Zustand zu haben, erwog sanft und ehrerbietig mit ihm die Lage. Der Welsche genoß verschwiegen und entzückt ihre hüllenlose Gelassenheit; sie bewegte sich keusch vor ihm, als wäre er das Wasser, in dem sie badete. Sie sollte Regensburg und den Kaiser verlassen, bis er von seinem sündhaften Vorhaben abgegangen wäre. Ohne Trauer, sicher, mit gesenkten Augen, verabschiedete sie sich von dem Priester, der das Zeichen über sie machte.
Vier Tage darauf wurde Ferdinand, als er nach ihr schickte, zugetragen, daß sie und ihre Kämmerin nicht zu finden seien. Er las in ihrem leeren Empfangssaal, in dem die Luft vom Qualm der ganz abgebrannten hohen Kerzen erfüllt war, — über einem Stollenschränkchen im Winkel sorglich hingebreitet die Schärpe mit seinem Namenszug, die er ihr vor der Hochzeit geschenkt hatte —, daß sie den schweren Ereignissen des Augenblicks und der Zukunft an einem stillen Platz auswiche. Sie werde versuchen für den Frieden auch seiner Seele zu beten.
Er dachte vor der Schärpe an ihre Begegnung in der Hofkirche zu Innsbruck. Vor dem Altar sahen sie sich, von Priestern einander zugeführt. Er, nach den würgenden Griffen des bayrischen Maximilian, gramzerrissen, hilfesuchend, unter den ungeheuren Prunkmänteln, den Agraffen Spitzen Bordüren, das verquollene ältliche Wesen, versteckt in der Schale, mißtrauisch und leidend. In hochrotem Kostüm sie; die Perlenkrone auf dem braunen spröden Haar hatte nicht mehr Farbe als ihr kleines Gesicht mit den drolligen dicken Augenbrauen und dem unentwickelten Mund. Wie sich sein Herz vor ihr in Haß leise zusammenzog. Vor Eleonore. Unter der Monstranz saß Maria und die Engel sangen. Jetzt lief das Kind vor ihm weg, hatte sein Spielzeug nicht bekommen. Durch irgendein Städtchen, ein Kloster lief sie klagend, gedachte ihm wehe zu tun. Ihm wehe zu tun.
Die Stirn gerunzelt, stand er vor dem Stollenschränkchen. Neulich war der Jude und sein Weib verbrannt worden. Wie ein Funken vom Dach lief die Erinnerung durch ihn und erlosch. Je mehr er die Schärpe ansah, war er lieblich von ihr befangen. Seine Finger nahmen sie zart an den Enden hoch. „Was ist es für eine schöne Purpurfarbe,“ dachte es in ihm. Es gibt Dinge in der Welt von großer Schönheit und Dinge von minderer Schönheit: das erfüllte ihn. Die Schärpe legte er sich sanft, fast kokett um die Hüfte über seinen Silbergurt. Die Damen blickte der Herr unter dem weißen Reiherhut schelmisch an; ob es nicht ein prächtiges Stück sei, diese Schleife. Ein guter Einfall der Kaiserin, sie einmal herauszuhängen. Hängte sich das Band an den Gurt, lud, den Mantel zusammenziehend, sanft die Damen zu einem außerordentlichen Karussell ein.
Dumpfes Wiegen der Parteien. Dumpfes Warten und Verharren der geistlichen Kurfürsten. Die kaiserlichen Räte, auf Regensburg mit Widerwillen gezogen, immer stärker der Verwirrung und dem Schrecken der Situation erliegend. Sie fühlten schon, daß sie sich zwischen zwei Feuer begaben, als sie das Schiff in Wien bestiegen. Sie fühlten, daß es biegen oder brechen hieß; sie sollten es entscheiden, wichen leidend, ratlos, zerrissen zurück. Ihr Entsetzen über die Krankheit Eggenbergs; es war wie eine Rache des alten Fürsten; er hatte ihnen den Teller mit der Giftsuppe zugeschoben, die sie sich bereitet hatten. Man schickte Briefe, Kuriere nach Eggenberg, er hatte in Wien vor der gräßlich sich erhebenden Machtprobe gewarnt, er war ihr Haupt, dem Kaiser lieb; jetzt schoben sich zweideutige Welsche und Jesuväter an seinen Platz. Eggenberg war nirgends zu finden; er reiste, hieß es. Sie mußten in allen Ratsstuben herumhorchen, bezahlten Spione in den fürstlichen Kanzleien. Vergessen der glanzvolle Plan der Königswahl. Die Stunde mußte kommen, wo man — unausdenkbar — kapitulierte vor den Kurfürsten, oder — niemand faßte sich das Herz — die Kroaten herrief, damit sie das Kollegium aufhoben, die Kurfürsten gefangennahmen. Sie barmten und fluchten. Der Bayer hielt die Kurfürsten eisern gefesselt; sie mußten bleiben. Er ließ sie täglich durch den Brabanter Grafen besuchen, kontrollieren; die geistlichen Herren bemerkten, ohne es gegeneinander auszusprechen, daß sie die Wahl hatten, Gefangene des Kaisers oder des Wittelsbachers zu sein. Sie besprachen sich, um sich aus ihrer Lage zu befreien, mit dem päpstlichen Legaten Rocci, der ihnen die sicherste Gewißheit geben wollte, daß in Kürze, in nächster Kürze alles zum Guten gewendet werde. Einzeln und gemeinsam fragten sie beklommen den Franzosen nach seiner Auffassung. Er versicherte sie der innigsten Teilnahme des französischen Königs, der sich überall der Unterdrückten annahm, wie es Christenpflicht sei; sie flehten ihn in aller Heimlichkeit an: ob sie sich auf seine Hilfe verlassen könnten.
Brulart hatte inzwischen noch einen andern Gast: den Pfälzer Vertreter Rusdorf, der mit einer kleinen Begleitung eingetroffen war. Rusdorf sah sich neugierig in dieser Umgebung um, bemerkte zu seiner Verwunderung, daß die gehaßten Bayern ihm freundliche Worte gaben. Er attachierte sich an die welsche Opposition. Marquis de Brulart und Pater Joseph berichteten ihm mit Vergnügen von der Unordnung im deutschen Lager; Rusdorf tuschelte entzückt geheime Neuigkeiten von dem Schweden: „Drängt sie nicht, Exzellenz. Laßt sie zanken: warum wollt Ihr Wallenstein verjagen? Laßt Wallenstein und Tilly sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Inzwischen trifft der Schwede ein.“ Entzückt schrieb Rusdorf nach dem Haag von der kostbaren deutschen Situation; die Geier schlügen sich um die Beute, man wolle dem andern an den Leib. Er säße mit den Franzosen behaglich dazwischen; sie keiften rechts, wimmerten links, hetzten weidlich, daß der Satan dabei grunze.
Die Ankunft des jesuitischen Abgesandten fiel in der Stadt nicht auf. Schwallartig füllten sich zu bestimmten Stunden Gassen und Plätze, zu Andachten Märkten Gerichten Komödien. In den Hallengängen der einstöckigen Häuschen lungerten Händler vor ihren Auslagen, hielten Passanten fest. Fürkäufer, die vor den Toren den Bauern die Ware abgekauft hatten, wurden vom Büttel getrieben. Unter den zu- und ablaufenden Fremden vor den Gasthäusern walteten die städtischen Gewaltboten mit Visitationen Inquisitionen. Die Leibwachen der hohen Fürsten patrouillierten mit Hellebarden nahe ihren Herbergen, verjagten Krüppel und Bettler. Morgenlich fuhren sehr langsam in Prachtkutschen sechs- und zehnspännig die Herren in die Kirchen. Die Spieße der Berittenen vorauf und hinterdrein; der Kaiser in die Pfarrkirche zu unserer lieben Frau, auf deren reichen Altar ein Beutestück prangte: das goldene Marienbild, auf der Brust ein Herz aus Rubin geschnitten; die Hoheiten und Durchlauchten und ihr Gefolge bei den Augustinern, Barfüßern, im Spital. Neben den Kutschen zu Fuß die Geistlichen, durch den tiefen Kot, zwischen den gackernden Hühnern, manchmal getriebenem Vieh ausweichend. Bischöfe, Domherren, Kapläne, Vikare, die schwarzseidenen Hüte quastenschwenkend rechts und links, violette Hüte. Priester schwatzend in schwarzen Sutanen, weißen Chorhemden, auf dem gesenkten Kopf das schwarze Solidarkäppchen. Schwärme von eiligen Chorknaben in weißen Umhängen, klappend mit ihren Rosenkränzen. Gelegentlich durch das Geschrei der Zuckerküchler Kesselflicker Kaminfeger in offener Sänfte ein schwarzäugiger Kardinal; den breitrandigen flachen Hut mit mächtigem Quastenbehang trugen Diener voraus; er selbst blickte mit runzligem Gesicht um sich in purpurner Sutane.
Sie beschlichen ihn im Bischofshof, die Jesuiten, Dominikaner, Franzosen, Spanier.
Durch einen gewaltigen Schwung, den der Kaiser sich gab, bekam das Leben an seinem Hofe einen prächtigen geräuschvollen Zug. Als wollte er zeigen, wer er war, schüttelte er den Druck, der auf ihm und seiner Umgebung lag, ab, begann in Regensburg zu residieren, als hätte er vor, hier jahrelang zu hausen. Zu den ungeheuren Massen von Bedienten mußten noch Baumeister Tapezierer Maurer Schreiner und andere Gewerke aus Niederösterreich herüberkommen, eine Zahl Nachbarhäuser, die der Magistrat dem Hof vermietet hatte, für seine Zwecke herrichten als Gemäldegalerie, Kunstkammer, astrologisches Kabinett. Er ließ sich seine Vogelsammlung anfahren. Man baute die Fundamente für ein großes Aquarium, eine Schauspielbühne. Alchimisten aus Wien wurden eingeladen; der alte polnische Taschenspieler und Alchimist Sendiwoy von Skorski, ein Günstling Kaiser Rudolfs, schweifte an. Die Lust am Bankettieren wurde rege. Und nun erst kamen die Prunktafeln zu Ehren, die die Stadt im Bischofspalast in der Abtei der Karthaus Prüll aufgestellt hatte. Die schmetternden Musikkapellen ritten hinaus an die Spitze des Hofes.
Die Kurfürsten wurden nacheinander eingeladen; sie erschienen herausfordernd, in ärmlichem Aufzug, Ferdinand pokulierte mit ihnen vor dem ganzen Hofe. Er ignorierte ihre steifen widerspenstigen Manieren.
Und nach langen Bemühungen, zahllosen Sonderkurieren glückte es ihm, den Herzog von Friedland herüber nach Regensburg, in seine neue Residenz zu ziehen. Die Stadt schwang vor Erregung unter der Ankunft des Feldherrn. Zweihundert bis auf die Zähne bewaffnete Leibwächter eskortierten ihn. Der Weg wimmelte von leichten Kroaten; eine leere kaiserliche Prunkkarosse empfing ihn am Tor. Erstorben die Stadt, die geistlichen Herrn in ihren Quartieren; die Welschen lachten höhnisch. Wie Eroberer zogen die Friedländischen ein, einen halben Tag dauerte der Besuch. Ferdinand zeigte dem Herzog seine Anlagen, schmauste mit ihm. Zur Linken des Generals saß der glückberstende fette Herzog von Doria.
Die Jesuiten beschlichen den Kaiser im Bischofspalast. Zu ihrer Verwunderung wurden sie vom Kaiser mit großem Verlangen angenommen; sie glaubten, er sei weich geworden durch die Flucht der Mantuanerin; er ließ sich stundenlang von ihnen erzählen, was sie wollten, ruhte unter ihren Gesprächen aus. Sie stellten fest, daß er nicht gequält wurde durch das, was sie vorbrachten. Er schien sich unter ihren Sätzen gesättigt und dankbar zu strecken; stärker und gelassener erhob er sich von diesen Gesprächen.
Dann setzte sich langsam, fast hoffnungslos der große Lamormain in Bewegung. Es konnte nicht sein, daß er den Gehorsam verweigerte; die Welt konnte untergehen, das Befohlene war zu vollziehen. Er kannte, wie er seinen viereckigen Hut haltend, stockgestützt vor Ferdinand stand, nicht den Kaiser Ferdinand, den Papst, den Pater Lamormain; die vier Gelübde hatte er abgelegt, seine Mission erfüllte er, der eisern konstruierte Apparat. Bitter hatte er sich bei seinen abirrenden Spaziergängen dem Dunstkreis der klingelnden jubelnden Stadt wieder genähert; die Sommerzelte der Dienerschaften passierte er, kleine Truppenbiwaks, Massen von Herden, Heuwagen. Bitter näherte er sich dem weithin abgesperrten Bischofspalast. Er atmete beim Anruf der ersten Wachen auf; als wenn eine Kapsel in ihm aufsprang und sich wieder schloß, war ihm; noch starrer zog er sich hoch, streckte sich in seinem gewaltigen Leib.
Er prüfte im Beichtstuhl den Kaiser, sein Hochmut war sicher, läßliche Sünden traten hervor; er bestrafte ihn mit nächtlichen Bußen. Ferdinand, noch schwach von seiner Krankheit, bat um Nachlaß; der Pater schlug es ab. Als nach einigen Tagen Ferdinand, weißer als sonst, aber aufrecht lächelnd gemahnt hatte, er hätte auf diesem Kongreß große Aufgaben zu lösen, er fürchte, ihnen nicht gewachsen zu sein, beschied ihn der Pater, ob er meine, die Aufgaben gegen den Himmel ließen einen Aufschub zu und die Pflichten gegen den Kongreß seien belangvoller als die gegen Gott. Auch er sah zu seiner Verwunderung, daß der Kaiser, obwohl ihm die Ausführung der Bußen schwer fiel, sich in sie demütig, zustimmend einfand, ja sich ihrer bemächtigte und durch sie in nichts erniedrigt werden konnte. Lamormain, an dem Kaiser tastend, fand einen anderen Menschen vor, als den, den er nach dem Münchener Unglück unterworfen hatte. Sein Erstaunen über diesen Menschen war so groß, daß er eine Unruhe in sich fühlte, öfter den Wunsch hatte, mit dem scharfen Lessius über die schreckliche Sachlage zu sprechen, wenn er sich nicht geschämt hätte und ihm nicht klar geworden wäre, daß er nur zu gehorchen hatte.
In der Kirche der Jesuiten wie im Kloster sah man niemand um diese Zeit so lange sitzen und beten, als den grauen riesigen Pater Lamormain. Wie ein Kind, das nach langer Abwesenheit, reif und klug und überraschend schon zurückkehrt, oder wie ein Kirschbaum, der nach einem Mairegen plötzlich sich in einen weißen lieblichen Blütenträger verwandelt, so war dieser Habsburger geworden und gegen diese Zartheit sollten Waffen erhoben werden. Der Pater war glücklich, sich mit dem Gehorsam abzublenden. Zu Lessius ging er hinaus: er werde wohl, wenn ihm mit Gottes Hilfe dieses Werk gelungen sei, bitten, ihm sein Amt beim Kaiser abzunehmen. Der schwarze Lessius unbewegt: dies zu prüfen sei Sache des Generals Vitelleschi.
Durch den geschwätzigen Kardinal Rocci erfuhren der Kurfürst Maximilian und Pater Joseph, daß die Jesuiten sich ihnen angeschlossen hätten; sie jauchzten, die mächtigen Jesuiten werden Ferdinand völlig brechen. Brulart meldete nach Paris, der deutsche Kaiser sei wie ein Wild jetzt von den Hunden gestellt; sie hätten auch ihr Teil an dem Jagdverlauf, wie erst mündlich berichtet werden könne. Und Spione trugen die gefährliche Nachricht nach Memmingen.
Aber Pater Lamormain ging mit Ferdinand um, wie der Arzt mit einem Kind, dem man keine Schmerzen bereiten will bei der notwendigen Operation, mit Sanftheit und über alles hinwegtäuschend. Er ging mit dem Kaiser in einer Weise liebreich um, daß der Kaiser in seinen eigenen Willen aufnahm, was der Pater ihm zutrug, und meinte von sich aus alles zu finden und von sich aus den Weg zu gehen, den man ihn zwang. Lamormain leise begehrend, aber nicht fähig, von sich abzuwälzen, was ihm aufgetragen war, wünschte innig, sein Beichtkind an sich ziehend, den Triumph seiner Gegner nichtig zu machen und hier nichts zu ändern. Ein Brieflein des Vitelleschi war ihm gebracht worden, darin hieß es: „Der Papst Urban ist uns nicht gnädig, denk daran, Bruder Lamormain, du frommer Christ.“ Wie Irrlichter kreuzten seinen täglichen Weg zum Kaiser die buntgemäntelten französischen Kavaliere, die bösen verschwiegenen Herren; er erschrak vor ihnen.
Er widmete sich inniger dem Kaiser. Morgens und abends aber las ihm ein junger Scholar den Brief vor: „Der Papst Urban ist uns nicht gnädig; denk daran, Bruder Lamormain, du frommer Christ.“
Mariä Himmelfahrt; mit Körben voll Obst und Kräutern gingen hinter Fähnchen und bunten Figuren die weißen Kinderscharen in die Kirchen; viele trugen Birnen- und Apfelzweige, auf denen Holzvögel saßen. Kavaliere ritten barhäuptig neben den Sänften ihrer Damen. Studenten fuhren neugierig auf Troßwagen durch Gassen, über Märkte vorüber an den breitbeinigen Trabantenwachen der Römischen Majestät und geistlichen Kurfürsten. Pfeifer und Flötenspieler zwischen ihnen, bald nach rechts, bald nach links herunterblasend. Franzosen traten mit Fächern aus ihren Quartieren, wichen zurück, wie die Studenten höhnend und drohend ihre schweren Säbel schwangen.
Weit war aller Verkehr von dem Bischofspalast abgedrängt, seit dem Kaiser von seinen Beratern eine Entscheidung nahegelegt war. Er verließ meist die saalartigen Wohn- und Empfangsräume. In einem schmalen Musikzimmer nach dem Garten zu fand man ihn bei Tag. Der Fußboden einfach gedielt, der Raum wild ornamental verschnörkelt. Flammenräder in gelb und rot an die Wand gemalt, eins neben dem andern. Flammenräder, deren Achsen Strahlen warfen. Die Strahlen fuhren aus immer neuen grellbunten Rädern über die Wände; inmitten der Längswand gebannt in Ruhe ein Viereck in Gold von byzantinischer Strenge; große gotische Buchstaben mahnten rot an die Stille des himmlischen Reiches. Darüber ein schwarzes Kreuz, zu seinen Füßen die Ebenholzfiguren Marias und Johannes. Ein einziges riesiges Fenster in die Gegenwand gebrochen, breit das dicke Mauerwerk durchdringend. Im Raume unter dem Kruzifix eine breite gepolsterte Sitzbank, mit Decken belagert, eine geschnitzte Truhe neben der Tür. Gedämpft klangen die Stimmen in dem gewölbten steinversenkten Zimmer.
Mit Herzlichkeit sah sich Lamormain an dem heißen Tage empfangen, Ferdinand zog ihn ernst an sich. „Es ist nicht möglich“, sagte er, „in Dingen solcher Wichtigkeit nur mit weltlicher Vernunft auszukommen. Wo so Ungeheures und Ernstes auf dem Spiel steht, muß ich den Heiland und die Jungfrau bitten, daß sie mir Hilfe bei den Entschlüssen leihen.“ Sie plauderten von Ferdinands Erziehung in Ingolstadt und von seinen Lehrern, Gregor von Valencia, dem berühmten Mann, dem Historiker Gretser.
Ferdinand öffnete träumend den Mund zum Oval; er hätte es leicht gehabt, auf den rechten Weg zu gelangen, seiner Mutter hätte der Glaube am Herzen gelegen; es sei ihm in Erinnerung, daß sie oft erzählte, wie Khevenhüller, der Gesandte in Madrid, ihr einprägte, es hinge ewiges wie zeitliches Wohl der Kinder davon ab, wem ihre Erziehung anvertraut werde; Leute müßten es sein, die innerlich wie äußerlich untadelige Katholiken seien. „Ich habe es darin gut getroffen; wie haben mich Gregor und Gretser geführt; dann Pater Bekanus, mein würdiger entschlafener Beichtvater, Dominikus a Santa Maria, der nun auch in Gott ruht. Nun habe ich Euch, Pater Lamormain. Ich sehe auf Schritt und Tritt, daß Gott mich segnet.“
Lamormain, sein krankes Bein ausgestreckt, saß gebeugt und verwirrt auf der Truhe. Das Trillern der Studenten, Rufen der Hatschiere klang herein. Er hätte, brachte er leise hervor, das Amt eines Beichtvaters des Kaisers zögernd angenommen; hätte in Ruhe im Cimetarium des heiligen Klixtus Ausgrabungen gemacht von heiligen Leibern, die den Jesuitenkollegien Schutz und Segen geworden seien; am Schluß der Romreise, wo er den achten Urban gesprochen hatte, den er schon als Kardinal Barberini kannte, hatte er seine acht Exerzitien gemacht, um sich den Studien und der Lehre der Syntax und Rhetorik zu widmen: da bestimmte ihn der Pater Vitelleschi zum Beichtvater; eine große Auszeichnung und ein schweres Amt, einen Fürsten geistlich zu führen, eine Aufgabe, die man kaum bewältigen kann. Es gab einen frommen Pater Klaudius, der fünfte General der Gesellschaft Jesu, der schrieb aus dem Drang seines Herzens und seiner Besorgnis einen Beichtspiegel für die Geistlichen der Fürsten; und überließ letzten Endes doch alles sich selbst. Denn wo soll man im Leben eines Herrschers zwischen Politik und geistlichem Gebiet scheiden.
Ferdinand, halb liegend, den Kopf über den verschränkten Armen, hörte aufmerksam zu. Er redete, sich oft mit Lächeln unterbrechend und eine Antwort des Paters abwartend. Vielleicht sei es nicht unzweckmäßig, was jener Beichtspiegel den geistlichen Beratern empfehle; er bedaure, daß ihm dies gewiß sehr interessante Buch nicht zugänglich sei; aber es gäbe sicherlich genug Fürsten, die grausig eigensinnig seien; sie erinnerten ihn an Narren, die ein Bein mit einer Menschenhose bekleideten, das andere mit Vogelfedern und Krallen. Er sei nicht mehr jung genug zu solchen Scherzen oder sogenannten strengen Trennungen; ja, es freue ihn, daß Lamormain erkenne, wie schwierig, wie unmöglich die Trennung von Politik und geistlichem Gebiet sei. „Denn seht, Pater Lamormain, wozu haben wir die langen Jahre in Ingolstadt verbracht und warum hat man uns so unsäglich behütet vor der Ansteckung der Ketzerei: nur damit wir fleißig und sorgfältig zur Messe gehen, zur Vesper, beichten? Es hätte dazu der großen Mühe nicht bedurft. Ich bin kein Kaiser von der Art der grimmigen Sachsen, Ihr entsinnt Euch, die gegen die Päpste Sturm liefen. Was will man eigentlich. Die Masse des Lebens, auch des politischen, mit dem Geiste der christlichen Kirche durchdringen; eine größere Aufgabe kann ich mir nicht denken.“
„Eure Majestät haben mir meine Aufgabe nie schwer gemacht.“
Ernst flüsterte der Kaiser, einen Finger hebend, gegen Lamormain, ganz hochgestützt: „Pater, ja ich muß Euch verraten, was ich schon bisweilen geträumt habe, in jüngster Zeit. Daß wir Nebenbuhler sind, der Papst und ich. Aber anders, als man es sonst meint. Ich meine im Geistlichen. Ich bin nicht sein Vogt, sein Schwert. Ich will die Kirche nicht neben mir haben, darum habe ich die Jesuiten zu mir gerufen, so viele sollen kommen, als erzogen werden, sie sind besser als Soldaten für mich. Das Heilige Reich muß selbst eine große Kirche sein.“
„Der Heilige Vater würde sich sehr freuen, eine so fromme Gesinnung von Euch zu hören. Er weiß, welche Hilfe die Vorsehung ihm in Euch gegeben hat.“
„Und Ihr, Pater, was denkt Ihr über die schwebenden Dinge? Ihr haltet so zurück. Mißtraut Ihr mir — noch immer.“ Ferdinand lächelte ihn an. Lamormain senkte den Kopf. Ferdinand leise, fast zärtlich: „Ich bin Euch ja zu so vielem Dank verpflichtet.“
„Es ist die Furcht oder die Beklemmung, sich auf einem Wege zu sehen, von dem man nicht weiß, ob man ihn mit Recht betritt.“
Erregt drehte Ferdinand gegen ihn, die Arme hebend: „Ich kenne solche Wege nicht, die ich gehe und die Ihr nicht gehen dürft. Ich habe es Euch gesagt. Ich will sie nicht kennen.“
„Warum wollt Ihr mich hören?“
„Seht, Pater Lamormain, ich will mir nicht Unrecht tun. Ich brauche Euch nicht, weil ich unsicher bin oder weil ich mich fürchte. Aber ich — habe Euch hier, Eure Stimme ist mir wie eines Vaters. Wollt Euch nicht zurückhalten, versagt Euch mir nicht. Es ist mir eine Wohltat, Eure Seele diese Dinge berühren zu sehen.“
„Ich weiß, daß es mein Amt ist, Eure Seele zu führen. Wenn ich lange schwieg, — so geschah es, um Euch nicht zu betrüben.“
Der Kaiser bat, er möchte weiter sprechen. Der Pater, sich zusammenkrampfend, nahm einen Anlauf. Er öffnete den Mund und ließ es schnurren. Wie die Worte klangen. Er hörte sich wie ein Fremder zu. Er schämte sich und blickte nicht auf. Was war ihm aufgelegt. Es sei nicht viel zu sprechen. Diese grauenvolle Verwüstung in Deutschland, diese Schrecken, die sich über die Alpen wälzen, Zwist im Reich, der Kaiser einsam: man müsse betrübt sein, wenn man an christlichen Frieden denke.
„So ratet, Pater. Ich habe nicht gelacht über diese Zeit.“
„Frieden. Frieden. Der Heiland, als er noch auf Erden wandelte, hat gesagt: gebet Gott, was Gottes ist. Man redet zu viel: gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Davon sind die Gassen und Plätze voll. Wer den Lärm in der Welt hört, denkt wohl an das Wort: des reifen Getreides ist viel, der Arbeiter aber sind wenige, bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter auf sein Erntefeld schicke.“
Die Fältchen an Ferdinands Augenwinkel zitterten, er drückte die Handteller zusammen, in der Ecke der Bank sitzend: „Ratet, Pater.“
„Du wahnsinniger Mensch,“ schrie der Pater sich innerlich an, „du schlimmer Mensch. Du kannst dich nicht so schänden. Bruder Lamormain, der Heilige Vater denkt schlecht von uns.“
„Gebt mir Antwort, Majestät, wie Ihr selber hierüber denkt.“
Da wurde Ferdinand, nachdem er dem Pater einige Zeit in die blitzenden Räder gestarrt hatte, unruhig, stand auf: „Ich hab’ es Euch gesagt, man soll mich nicht für einen Gewaltherrn und römischen Cäsar verschrein.“
„Wenn Ihr kein Gewaltherr sein wollt, so ist es Euch bitter ergangen, daß alle Welt Euch verkennt und Euch für nichts als dies, für nichts als dies ansieht. Und wenn Ihr das weltliche Papsttum gründen wollt, so wird es wohl auch Euch bedünken, daß im Augenblick die Welt sehr anders blickt: aus Augen voll Grauen. Wie wollt Ihr dies vereinen: so mächtig dazustehen, daß man Euch wahrhaft Kaiser nennen muß, und so wenig das zu können, was Ihr wollt. Seht, nicht einmal so viel, wie die Herrscher vor Euch, die viel schwächer waren.“
Dies mußte Lamormain alles sagen und hinlegen.
„Pater, der Heiland hat dies gesagt, was Ihr nanntet. Er hat aber auch gesagt, was Ihr selbst uns gepredigt habt, daß er nicht nur gekommen sei, Frieden auf Erden zu bringen, sondern Vater, Sohn, Mutter, Tochter und Schwieger gegeneinander zu erregen.“
„Wohl, so spricht Lukas: Zwietracht. Um das himmlische Feuer auf die Erde zu werfen.“
Ferdinand legte sich halb auf der Bank zurück; er sagte nichts. Nach einer langen Pause Lamormain: „Eure Majestät schweigt.“
Tonlos: „Ihr seht, daß ich schweige.“
Wie sich Ferdinand wieder zwischen den Teppichen zurecht geschoben hatte, rieselte seine tonlose langsame Stimme: „Worauf sollen wir hinaus?“
„Es scheint, als ob Ihr etwas Irriges gemeint habt bis jetzt. Ihr glaubtet —“
„Ja, war ich kein Christ?“
Vor diesem weißen Blick, dieser langsamen erschütternden Stimme fand der Pater lange keine Antwort. Dann legte er viele Wärme und Herzlichkeit in seine Sprache und mußte sich sehr bezwingen, um sich nicht völlig bewältigen zu lassen: „Ihr wart die langen Jahre mein Beistand, Majestät; Ihr wart ein guter katholischer Christ. Als ich die kirchlichen Wünsche Eurer entschlafenen Gemahlin, der seligen Maria Anna, durchführte, bin ich Euch gefolgt in Eurer Gottesfurcht.“
„Seht Ihr Maria Anna an. Würde ich mit ihr so lange glückliche Jahre haben leben können ohne den rechten Glauben.“
„Ihr wart fromm.“
„Ich mache dem Menschen Ferdinand von Habsburg keine Vorwürfe. Der römische Kaiser, der deutsche König Ferdinand der Andere glaubte sich rühmen zu können, ein Nebenbuhler des Papstes zu sein. Inzwischen glaubt es niemand, sieht es niemand. Die katholischen Kurfürsten selber stehen gegen ihn.“
Er legte all das fragend hin; ein Wind hätte gegen ihn blasen können und er wäre verstummt. Aber Ferdinand drängte zart immer weiter.
Nachdem der Kaiser sich fest mit dem Rücken gegen die Banklehne gedrückt hatte, schlug er mit mildem Ausdruck die Arme über der Brust zusammen, blickte mit zusammengezogenen Mienen auf die Gegenwand: „Indem mir dies Amt überkommen ist, habe ich es übernommen, die Geschäfte des Heiligen Reiches gewissenhaft zu versehen. Das ist meine Bibel, die mir an die Hand ging. Neben mir stand die Wahlkapitulation, das Reichsgrundgesetz, die Goldene Bulle. Man hat mich hergesetzt und mir vertraut. Das Weitere kommt von mir, die Macht und Verantwortung.“
Rotes Abendlicht zuckte sich ausbreitend über das sich rasch verdunkelnde Zimmer; der große Luxemburger stand vor der Truhe, den Kopf tief vor der Brust, die Hände gefaltet. So sei es und nicht wie vorhin die Rede war. Wo sei jetzt von Christentum die Rede. Dann als Ferdinand den bestimmten sicheren Ausdruck des schwingenden Gesichts nicht aufgab: der Kaiser möge überlegen, wie es mit ihm stünde. Als er den Kaiser verließ, saß der noch unentwegt mit der gleichen Miene vor der rotbestrahlten Wand, über der wild die grellen Flammenräder rasten.
Und mit derselben bestimmten klaren Miene empfing ihn gleich nach der Messe am nächsten Vormittag der Kaiser. Ferdinand, von gesünderer Farbe als sonst, bedauerte, gestern abgebrochen zu haben, er könne den Pater noch nicht dispensieren von diesem Thema. Darauf schüttelte er ihm die Hand, hieß ihn freundlich sich setzen. Es sei gewiß, daß er es sich überlegen müsse, wie es mit seinen Sachen stände. Gewiß müsse sich dies aber auch der Pater überlegen. Damit blickte er frei forschend den Luxemburger an: „Ich bleibe dabei, Ehrwürden, lieber Vater, mir sind nur Bulle, Reichsgesetz, Wahlkapitulation gegeben. Ihr meint, ich verfehle den christlichen Weg als Kaiser. Geht mir zur Hand.“
In großer Freude verneigte sich der Luxemburger, seine Stimme tief ehrerbietig. Diese Aufforderung und Bitte hat er erwartet; er weiß, daß der Kaiser nicht allein dies leisten kann; der Kaiser mußte es erst erkennen. Langsam erwog der Kaiser: „Ich habe es in der letzten Nacht selbst wieder angestaunt, Pater. Ich will es Euch nicht verheimlichen. Daß Kaiser und Kirche so aneinander vorbeiregieren. Der Kaiser hat seinen Palast, seine Burg, dazu Edle, Berater, Offiziere, Heere; der Papst hat die Geistlichkeit, den Vatikan, die Peterskirche, tausend Kapellen, Klöster und Kirchen. Der Papst gibt seine Gesetze, ich, meine Landesfürsten ebenso. Wir regieren dieselben Völker. Und — wir haben keine Berührung miteinander. Nun erst, in solchem einzelnen Augenblick kommen wir zusammen. Um uns zu tadeln. Es ist kein gesundes Verhältnis.“ Und dann legte Ferdinand, heimlich und inständig zu ihm redend, die Umstände dar, die zu diesem Kollegialtag führten, die gefährliche Situation, die heraufbeschworen sei. „Und ich habe die Entscheidung. Lehne ich sie ab: wißt Ihr, was geschieht? Wie wenn ein Pfeil abgedrückt wird, schießt von Südwesten mein Feldhauptmann herauf, schlägt die Kurfürsten nieder, das Reich hat ein neues Gesicht. Ich will Euch gestehen, ich bange nicht, ich bin in keinerlei Sorgen. Wer Sorgen haben muß, sind die Kurfürsten des Reichs, die ich niederdrücken kann, wenn ich will. Ich kann sie hinlegen lassen, als wenn sie an Armen und Beinen gefesselt sind. Ich habe die Macht dazu.“
„Wie beschließt Ihr?“
„Nichts, noch nichts. Ich lasse die Herren warten. Ich kann mich ohne Zwang nach beiden Seiten entscheiden. Ich will ihnen kein Unrecht antun. Ich will mich ganz auf mich besinnen. Den Augenblick abwarten.“
„Wie große Macht hat Euch der Herr des Himmels verliehen. Wenn sich ein gemeiner Mann, ein Edler auf sich besinnen will, kann er in einen Winkel oder in die Kirche gehen; das Gespräch mit sich und Gott ist alles, was er vollbringt. Ihr habt so viel Freiheit, daß Eure Selbstbesinnung über Millionen Seelen verfügt.“
„Ich würde dies nicht wagen, wäre ich nicht Christ.“
„Majestät, mein Beichtkind, ich bin bei Euch in diesem Augenblick. Ich bin glücklich, daß Ihr mich ruft. Habt Ihr Furcht oder Beklemmung, den Herzog zu entlassen?“
„Nein. Ich bin ihm dankbar. Aber ich verfüge über ihn.“
„Ist es Euch schlimm, die Kurfürsten zu unterdrücken?“
„Ihnen soll kein Unrecht geschehen. Sie werden mich durch ihr Gebaren nicht zum Unrecht verleiten. Wenn es muß, werden sie beseitigt werden.“
„Sie sind fromme Männer, darunter Bischöfe der Kirche.“
„Mein Feldhauptmann hat mich wieder in den Besitz meiner Erbkönigreiche und Länder gebracht. Er hat das Heilige Römische Reich vergrößert und mächtig gemacht wie keiner dieser Kurfürsten.“
„So laßt ihn hermarschieren, die Kurfürsten verjagen oder in Eisen legen.“ „Wenn es gut ist, daß dies geschieht, soll es den Kurfürsten bereitet werden.“
Der Pater schüttelte langsam und lange den Kopf, studierte seine Handteller, rieb sich die Schläfe; plötzlich legte er die Hände zusammen.
Jetzt, fühlte der Pater, war er im Begriff, den Kaiser zu schänden. Jetzt konnte er die Zertrümmerung vornehmen. Ferdinand setzte sich nicht zur Wehr. Das reine Gesicht konnte er verwüsten.
Und plötzlich war es ihm in die Seele gelegt, das Geschick zu versuchen. Er hatte gebetet, ihn vor Sünde zu bewahren. Aber er ging schon führungslos den Weg. Und während er zitterte, kam aus ihm heraus: „Ich finde keinen Gesichtspunkt.“ Und fühlte dabei, seinen Kopf duckend, die Stirn von einem nassen Schauer überzogen, daß er in einer Krise stand und daß ihm weiter nichts mehr übrigblieb. Er flehte und sündigte in einem Atem. Lächelnd weitete sich das Gesicht des Kaisers, er breitete gegen ihn die Arme aus: „Nun, lieber Vater Lamormain, so werde ich wohl keine große Schuld begehen können.“
„Sprecht Ihr selbst,“ drängte angstgetrieben der andere, „haltet Euch nicht zurück. Kommt heraus.“
In Ferdinand wallte es, seine mageren Wangen zitterten, sein Blick wurde stier: „Ihr wollt mich versuchen. Ich habe nichts mit Wallenstein und nichts mit den Kurfürsten. Es soll sich keiner von beiden anmaßen, daß ihm Unrecht von mir geschehen soll. So ruhig wie einer einen Würfelbecher umstülpt und die Kugeln zählt, wird mein Entschluß folgen. Wißt Ihr —“ er flüsterte geheimnisvoll, „warum ich dies kann? Weil ich die Macht habe. Ich kann den Augenblick abwarten. Sie wird mir nicht genommen werden.“
Wie durch ein Bad von Pein wurde der Leib des Paters gezogen, er konnte sich nicht rühren, in ihm schrie es, die Bannung möchte weichen.
„Seht Pater, so unumschränkt verfüge ich in dieser Sache, daß ich mich versucht fühle, die Entscheidung von einer Kinderei abhängen zu lassen: ich rufe meinen Kammerdiener und tritt er mit dem linken Fuß über die Schwelle, hat Wallenstein gesiegt, mit dem rechten die Kurfürsten.“ Da preßte Lamormain hervor, dunkel hörte er sich seufzen: „Lästerung.“
Langsam wankte Ferdinand auf ihn, griff seine linke Hand, die er sich an die Brust zog und drückte: „Ihr seid mein Freund. Ihr werdet nicht verraten, was ich unternehmen will. Es wird bald ruchbar sein, ich möchte es einige Zeit bei mir behalten. Wißt Ihr, warum? Um mich daran zu weiden. Denn sobald ich es herausgesetzt habe, wird man es umgehen und erklären und wird seine Torheiten und Roheiten über meinen Entschluß häufen. Ich will ihn einige Tage bei mir behalten. Ihr werdet zugeben, daß ich Grund dazu habe. Ihr sollt Euch mit mir freuen daran, mein lieber Freund.“
Der Kaiser schien zu delirieren. Seine Brust wogte auf und ab. Er schien sich mit den Händen des Paters beruhigen zu wollen. Seine Augen konnten sich an keinem Punkt befestigen. Sein Mund schnappte wortlos, die Lippen von Wasser überflossen; dabei knickten seine Knie häufig ein. In ihm strömte es dumpf: ich folge, ich folge, ich halte mich nicht zurück.
Der Jesuit stöhnend, in großer Furcht: „Welche Lösung Ihr auch findet, ich flehe Euch an, daß Ihr in diesem Augenblick nichts beschließet. Ich rufe Euch an, Majestät.“
Schreiend, lachend, die Last aus sich wälzend, der Kaiser: „Mir sollt Ihr es nicht verwehren, in diesem Augenblick zu sprechen. Wann soll ich zu einem Entschluß kommen, wenn nicht jetzt. Wie soll das aussehen, was ich meinen Entschluß nennen soll, als was ich jetzt in mir habe.“
„Ich will es nicht hören, laßt davon ab.“
„Doch müßt Ihr hören, Pater, doch. Ihr sollt mir sagen, was Ihr denkt. Ihr seid der einzige, der daran teilhaben soll, und könnt Euch mir nicht verschließen.“
Der riesige Mann rang mit dem Kaiser, suchte ihn an die Bank zu führen. Der wollte mit den fliegenden Augen vergeblich ihm ins Gesicht sehen: „Wie seid Ihr, Pater.“
„Setzt Euch. Besinnt Euch. Wollt Ihr Wein?“
„Hört einmal. Laßt meinen Wams. Liebster Pater.“
„Ich will Euch nicht hören, Majestät.“
Ferdinand auf die Bank gedrückt, blickte sprachlos an dem schwarzen Rock, dem strengen Kinn hoch; erzitterte stark. In seinem Gesicht stand ein verzerrtes, unklares, fragendes Lächeln, er hauchte: „Was ist das? Was hab’ ich verbrochen?“
„Der Satan bewältigt Euch.“
„Ich weiß alles, was kommen wird.“
„Seid still. Herr, führe uns nicht in Versuchung.“
„Pater, leibhaftig steht vor mir, was kommen wird, wie Ihr.“
„Herr, führe uns nicht in Versuchung. Schließt die Augen, seht nicht um Euch. Betet mit mir.“
Als er gemurmelt hatte, haftete der starre helle Blick Ferdinands an der Stirn des Jesuiten: „Es ist noch alles wie vorher. Ich kann mich kaum bezähmen, zu Euch zu sprechen.“
Lamormain, in der furchtbaren Angst über die Dinge, die er heraufbeschwören mußte, hielt sich kniend für sich, preßte den Rosenkranz an seine Lippen. Die Strafe raste über ihn. Von rückwärts berührte ihn der sehr stille Ferdinand: „Ich weiß: Eure Aufgabe ist schwer. Eure Qual ist groß. Ich will Euch gehorchen. Was habe ich zu tun?“
Da brachte der Pater in der Bitterkeit der Verzweiflung hervor, fast brüllend stieß er es aus sich heraus: „Ihr müßt den Herzog verabschieden, nicht behalten.“
Über die Schulter des Knienden beugte sich der Kaiser von rückwärts, ganz naiv und erstaunt, streichelte seinen Arm.
Ja, dies hätte er beschlossen: ob wohl der Papst etwas anderes beschlossen habe?
Und als sich Lamormain entsetzt herumwarf, murmelte Ferdinand, die Arme verschränkend, so hätte der Pater selbst gesagt, was ihm, dem Kaiser, nicht gestattet war.
„Ihr werdet Euch des Herzogs begeben? Der Krieg um Mantua soll aufhören?“
„Seht Ihr, wie Ihr alles wißt. Und jetzt sagt Ihr selbst alles.“ „Mein Heiland, Ihr! Ihr! — Wie wird Euch der Heilige Vater loben, wie werden Euch die Fürsten loben.“
„Seht Ihr“, lächelte Ferdinand völlig ruhig und freudig stolz wie ein beschenktes kleines Mädchen. „Und warum durfte ich es nicht sagen?“
Um Mittag kam der Luxemburger, noch immer fassungslos und verstört sich zerknirschend, in das bischöfliche Musikzimmer. Dem Kaiser sagte er, er käme sich zu weiden an seinem Beschlusse.
„Leise, leise“, warnte der andere.
Ferdinand bog sich über den Fensterrahmen; es zirpte von unten herauf, Fasanen stürmten über den Sand. Ja, man könne froh sein; das sei nun eine Säule in ihm und die sei nicht umzustürzen. „Ich freue mich, Pater, daß Ihr mich hören wollt. Es ist geschehen in meiner grenzenlosen Liebe zu beiden, zum Herzog und zu den Fürsten. Jedem habe ich ein Liebes angetan. Jeden an seinen Platz geführt.“
Der Jesuit saß ratlos ungläubig vor den mysteriös gesprochenen Worten. „Ihr wolltet ein Unglück vermeiden“, fragte er gequält. Er hatte kaum ein Ohr für das, was er hörte. Er war in seiner Verwirrtheit hierher getrieben worden, um sich zu beruhigen. Was soll mit mir geschehen, fragte er sich. Er verzerrte sein Gesicht: „Ich freu mich ja mit Euch.“ Er suchte ein freundliches Wort vom Kaiser zu erbetteln, und daß Ferdinand ihn anblickte, ihn erkannte, ihm half.
Der Kaiser blieb still. Er hatte einen milden nachdenklichen Ausdruck, hielt den Kopf leicht auf die rechte Schulter geneigt: „Sie dachten mich mit Anwürfen zu reizen, die Kaiserin grollt mit mir, weint irgendwo. Der Herzog war auf dem Sprung, es fehlte nur mein Signal. Wozu dies alles. Kommt jedes zu seiner rechten Stunde.“ Und dann wandten sich seine sehr ruhigen, ganz hellen Augen dem sitzenden Pater zu; er lächelte ihn an: „Seid froh, daß Ihr nicht die Verantwortung habt. Ihr hättet Euch nicht regen können vor der Gewalt, die man Euch antäte.“ Er faßte den Pater bei den Händen, zog ihn hoch, legte, neben ihn tretend, seinen rechten Arm unter den linken Lamormains: „Aufgeregt seid Ihr, Lamormain! Ihr blickt noch ganz wirr. Laßt es fallen. Nur sinken lassen. Es geht schon. Kommt.“
Sie gingen zusammen in den Garten. Wie ein krankes Kind ließ sich Lamormain führen. Er fror, war demütig und fühlte, daß ihm verziehen werde.
Sie gingen zusammen zwischen den Beeten. Der Fürst blinzelte die Reseden und Hühner an. Er freute sich seiner Blindheit.
Als der Kaiser vier Tage hatte verstreichen lassen, während derer er mit sich und seinem Entschluß umging, ließ er noch einmal das Theater der Beschuldigungen, Bedingungen, des Grolls, der Wildheit an sich passieren. Es geschah, um sich noch einmal zu kontrollieren. Als er merkte, daß keine Feindseligkeit in ihm entstand, schien es ihm gut, seine Räte zu sich zu bescheiden. Obwohl die Einladungen in größtem Geheim erfolgten, verbreitete sich ein Wispern in der Stadt. Die Spannung im Quartier der Kurfürsten und Fremden war auf das höchste gestiegen; vor dem Hause des Grafen Tilly hielten zehn Berittene Tag und Nacht, gesattelt, mit Mundvorrat; er selbst verließ sein Haus nicht. Man hatte es verstanden, nahe der Stadt, am Donauufer, leichte Kanonen mit Artilleristen zu verstecken; es war vorauszusehen, daß, ehe die geringste feindliche Belästigung erfolgte, die Stadt in ligistische Hände fiel. Die Franzosen gingen hin und her, gaben ihre Ratschläge. Man schwirrte um den Pater Joseph, um die Jesuiten, den Kardinal Rocci. Der Beichtvater war unsichtbar.
In der Konferenz in der bischöflichen Ritterstube, die in Gegenwart Lamormains und des jungen Königs von Böhmen stattfand — er saß weißgekleidet, schmächtig, mit sehr mürrischem, hochmütigem Ausdruck neben seinem aufgeräumten Vater — wurde der unveränderte gefährliche Stand der Dinge vom Grafen Strahlendorf resümiert. Dann äußerte sich der Kaiser; es sei ihm nicht fremd, daß die Fürsten geneigt wären, es auf das Äußerste ankommen zu lassen; man werde ihm auch einen Entschluß, nachzugeben, als Schwäche ausdeuten. Das sei ja schlimm. Aber ihm sei das Wichtigste, daß mit Glimpf bei der zur Beruhigung des Reiches notwendigen Abdankung des Herzogs von Friedland vorgegangen werde. Mit aller Deutlichkeit solle ihm zu erkennen gegeben werden, daß er nicht, wie es Blinden scheine, als ein Opfer der Kurfürsten falle, sondern daß die Reichsinteressen von ihm dies Opfer verlangen; er täte mit seinem Rücktritt dem Reich einen Dienst, wie wenn er eine Schlacht gewönne. Unendlich sei das Reich ihm dankbar.
Der König beschränkte sich auf ein paar Redensarten; er fand sich sichtlich mit dem kaiserlichen Entscheid nicht zurecht, obwohl er Wallensteins Abdankung verlangt hatte. Über der ganzen Versammlung der Geheimen Räte lag Verblüffung; der Entschluß war da, den man selbst nicht hatte fassen können, der so oder so hatte fallen müssen.
Einsam saß Lamormain. Man blickte von ihm weg. Dieser hatte gesiegt. Die Jesuiten herrschten.
Strahlendorf fragte, was man tun wolle, wenn der Herzog den Oberbefehl nicht niederlege. Darauf schwiegen die anderen; der Kaiser hielt die Frage für gegenstandslos.
Der kleine Abt von Kremsmünster fuhr in raschestem Tempo mit Trautmannsdorf in dessen Quartier. „Wir sind geschlagen, Graf. So hat Eggenberg auch von Istrien her gesiegt. Eggenberg hat seinen Willen. Was wird Slavata sagen. Wollen wir unsere Ämter niederlegen.“ Kremsmünster von Minute zu Minute entsetzter; die ungeheuren Schulden des Hofes bei Wallenstein, es sei unausdenkbar, der Beschluß müsse rückgängig gemacht werden. Der verwachsene Graf kam nicht aus dem Staunen heraus, er gab zu, daß er den Kaiser bewundere. „Dies ist ein anderer Mann als der in München. Er fürchtet uns auch nicht.“ Der Abt schrie, Wallenstein dürfe nicht nachgeben. „Herr,“ wiegte der Graf den Kopf, „der Kaiser weiß, was er tut. Der Herzog gibt nach.“ „Er tut es nicht. Ihr werdet sehen.“ Und plötzlich in Kremsmünsters Kammer war Trautmannsdorf ganz erschrocken: „Nun hat Eggenberg recht behalten; der Kaiser will sich nicht mehr auf den Herzog stützen. Was hat er aber vor?“ Der kleine Abt todblaß und wild: „Wir haben diesen Kongreß auf dem Gewissen. Er war verkehrt. Wir sind ärmer als vor dem Münchener Vertrag.“ Bis Trautmannsdorf nach langem Hocken hinter einer Harfe von sich gab: „Jetzt wird es wieder Zeit, sich zu regen. Wahrhaftig, ich komme mir übertölpelt vor. Wir waren im Taumel, als wir zu dem Kongreß rieten. Der Kaiser muß bezahlen, was wir verschuldet haben. Verdammte Logik. Wir haben nicht darum den Kaiser von dem Bayern befreit. Wir werden den Herzog von Friedland versöhnlich halten müssen. Jetzt laß ich mich nicht binden. Wir wollen ihn nicht loslassen.“
Lamormain machte sich um dieselbe Zeit schwermütig auf nach der Karthaus zu Lessius. Stumm saß er eine Weile dem gegenüber; der fürchtete einen bösen Ausgang, fragte nicht, blieb sehr kalt. Sein Mißtrauen verließ ihn nicht ganz, als der Pater das Ergebnis der Unterredungen berichtet hatte. Er fragte, ob den Pater ein persönlicher Kummer bedrücke und ob er ihm etwas zu sagen hätte. Lamormain, unfähig, vor dieser gelassenen Stimme zu sprechen, brachte heraus, das Unternehmen hätte ihn sehr angestrengt. Der Gesandte lächelte mitleidig, fast geringschätzig: die Sache hätte sichtlich in Gottes Hand gelegen. Von einer Nachbarzelle wurde geklopft; Lessius stand auf; eine französische Konversation mit entzückten Ausrufen begann drin. Hemmungslos laut stöhnte Lamormain, gräßlich riß es an seiner Kehle, als er Lessius nebenan einem welschen Emissär den Ausgang der Streitigkeiten berichten hörte.
Am Nachmittag strömten in sein Quartier gegenüber dem Bischofspalast die Besucher; Kardinal Rocci umarmte ihn mit hahnenmäßigem Geschrei, zuletzt bewegte sich der kleine Pater Joseph herum. In Widerwillen schleuderte gegen ihn Lamormain heraus: er hätte seine Hände nicht dabei gehabt, der Beschluß sei fertig bei Ferdinand gewesen. Worauf sich Joseph mit Freudenschreien zurückzog, in seiner Kurzsichtigkeit gegen die Tür stoßend: das sei ja herrlich, der Kaiser sei also von sich aus den Franzosen geneigt.
Lamormain beichtete bei den Jesuiten; er war verbrannt. Er nahm sogleich Abschied vom Kaiser, um seinem Drang zu folgen, den kranken Fürsten Eggenberg in Göppingen aufzusuchen, dessen Seele er mit dem Bericht von dem Entscheid Ferdinands erquickte.
Nach Göppingen war Eggenberg gefahren, die Todesstille in Istrien war ihm unerträglich; in der letzten Woche hatte er sich unter der Qual der Ungeduld, Sorge, ja Reue zwingen müssen, nicht nach Regensburg zu reisen. Lamormain traf den grämlichen alten Mann in Reisevorbereitungen. Und so tief erquickte der Pater ihn, daß er weinte. Er pries das Geschick des Hauses Habsburg; der gute Genius sei nicht entschwunden und habe den Kaiser berührt. Erst als er gebetet hatte, wollte er Lamormain weiter anhören, sprudelte aber selber glückselig, welche Gefahr vom Erzhause abgewendet sei. Immer wieder warf er sich auf die Knie, betete, jubelte, umarmte den stillen Pater: „Ich hab’s gewagt. Gott war mit mir.“ Nun werde bald der allgemeine edle Friede kommen, nach dem sich Kaiserhaus und Fürsten und nicht zuletzt das arme ausgesogene Land sehnten.
Erst an den nächsten Tagen merkte der Fürst Eggenberg, daß der alte Jesuitenpater zerstreuter und unruhiger als sonst war, von ihm Tröstliches einsog. Und als er tagelang neben ihm spaziert war zu dem Quell und durch die Felder, erfaßte der Fürst, daß der stammelnde Lamormain um sich selbst in Angst war. Stöhnend, fast wie ein Tier, brachte im Walde Lamormain eines Abends hervor, daß er das gütige nachgiebige und machtbewußte Gesicht des Kaisers nicht vergessen könne; er hätte ihn verführen wollen. Der Kaiser hätte ihn beschämt, verächtlich beiseite gelassen. Er schäme sich. Wie ein Begnadeter hätte er ihn, den Sünder, angeblickt.
Über die hügeligen bewaldeten Straßen die Donau entlang brausten die Kroatenschwärme des Isolani. Von Regensburg her kam das Rufen, Fahnenschwenken, rastlose Trommeln; erst einzelne Patrouillenreiter, dann, mitgerissen, Wachen, halbe Fähnlein. Überall schrien sie sich zu, winkten mit den Händen. Aufbruch! Bagage warfen sie auf den Boden; Heuschober angezündet als Signale für die zerstörten Fouragemacher. Hinter ihnen der Schwall des Staubs und die Öde. Wie ein Igel wulstete sich der Schwarm ein, stülpte sich südwärts um. In stummem Bangen ließen sie die leeren Dörfer zurück, halb erloschene Lagerfeuer, brüllendes, angebundenes, weidendes Vieh. An Kaufwagen, Händlern, Reisenden, die nach Regensburg wollten, flogen sie vorbei; Wiehern, Peitschenknallen, Klappern der Waffen im Nu verschollen. Hinüber ins Augsburgische. In einer Herberge in den Waldrand gedrückt, dicht vor den Augsburger Toren, Oberst Max Wallenstein. Um den Wald ballte es sich tobend zusammen, Isolani drang mit triefendem verwüstetem Gesicht zu ihm hinein, der Oberst lag, ohne Stiefel, betrunken in seiner Kammer, lallte, geiferte, plötzlich ernüchtert den Kroaten an, schlug sich vor Stirn und Brust. Aufgesprungen, die Schreibtafel des Isolani nahm er an sich, band sie sich um den Hals. Zum Kroaten und seinem Leutnant: sie wollten zusammen reiten. Käme er nicht durch, sollten sie die Tafel zum Herzog tragen, ihn liegenlassen wo er liege und wenn’s in einem Wassertümpel wäre. Gestiefelt, Hut und Wehrgehenk, aufgesessen.
Max wippend auf dem Pferde rechts, links, in die Höhe wie ein Korkstück auf brodelndem Wasser; bald nur in einem Schimmer von Bewußtsein; stumpf lernten seine Lippen: „Es ist vorbei, wir sind hin.“ Pferdewechsel. Die Nacht durchrast. „Es ist vorbei, wir sind hin.“ Vormittags durch die weiten lärmenden Truppenansammlungen in Memmingen hinein. Gezogen vor den Herzog: „Es ist vorbei, es ist hin.“
Während Max schlafend fiel, als er die Tafel abgegeben hatte, ächzte Isolani, ob sie absatteln sollten. Dann erst sah der Herzog den schnarchenden Obersten unten an, schrie: „Raus!“ Der ließ sich forttragen.
Sieben Tage lang ließ Wallenstein alle Arbeit liegen. Gelähmt vor Wut an Armen und Beinen. Er hätte alles erwarten müssen, denn Zenno hatte diesen Ausgang berechnet, aber er hatte es nicht geglaubt. Und als Zenno zu ihm kam, um wieder eine Berechnung vorzutragen, schoß der Herzog eine Pistole hinter ihm ab. Jetzt trampelte er nicht auf seinen Hut, sondern zerriß ihn. Er war völlig blind. Die Truppen auf Regensburg werfen, den Kollegialtag gefangen nehmen, den Kaiser aufheben. Er traf mit Neumann und Max einige lahme Vorbereitungen. Bis er selbst alles hinwarf, die Herren davonjagte. Er war dem unheimlichen, zu plötzlichen Gedanken nicht gewachsen.
Sie hatten ihn. Zum zweiten, dritten Male. Nachdem er ihnen das Reich wiederhergestellt hatte. Zum Zerknirschen des eigenen Gebeins und Eingeweides.
Er hatte nie etwas Persönliches für den Kaiser empfunden. Der war der erwählte Regierer des Heiligen Römischen Reiches, dem er diente. Das riß jetzt an ihm; der Damm geborsten; der Kaiser war etwas, das ihn angriff. Er konnte sich dazu nicht finden. Er mußte, er mußte den Kaiser und das ganze Pack schlagen, wenn er leben wollte.
Und wie er reglos in seiner Kammer saß und sich zusammenhielt, heulte es in ihm, daß sie ihm noch Hunderttausende, Millionen schuldeten. Und es labte, labte ihn. Noch Millionen. Sie waren ihn nicht los. Sie konnten sich ihm nicht entziehen.
Oder sie — konnten — auch das wagen. Er fletschte die Zähne. Es wäre das richtigste. Er würde es tun in ihrer Lage. Dem Feind den Knebel in den Mund stecken. Ihn noch bezahlen lassen. Werden sie es?
Werden sie es?
Und während sie nacheinander im Hauptquartier eintrafen, die Trzkys, Bassewi, Michna, De Witte, seine sanfte Frau, wurde ihm zugetragen, daß die heftigen Kämpfe in Regensburg, von denen man ihn ausgeschlossen hatte, noch anhielten; die Fürsten betrieben seine Beseitigung aus Mecklenburg, verlangten Schadenersatz, Rechnunglegung. Die Stadt Memmingen war still, aber brüllend wie eine Kirchenglocke Wallenstein. Sein Zustand lebensgefährlich, die Aderlässe gegen die schrecklichen Kongestionen blieben fruchtlos, man konnte nur auf halbe Stunden an sein Bett, neben dem die Frau Isabella demütig saß und nicht zu weinen wagte. Der Kaiser mußte angegriffen werden; er war dem ungeheuerlichen Gedanken nicht gewachsen. Der lange magere Herzog war ein sterbendes Untier zwischen seinen Laken und Kompressen, den Tod wünschte er sich herbei, zerreißen wollte er den Bayern, den Kaiser, die Jesuiten, die Franzosen. An seinen dünnen Unterschenkeln brachen Gichtgeschwüre auf, das erleichterte ihn; seine Augen verschwollen rot und liefen; sie standen wie Beulen zwischen den fleischlosen Wangen, neben der hohen Nase. „Sie haben mich am Spieß, sie werden mich wie einen Juden brennen“, wälzte er sich.
Als der Bescheid eintraf, er werde mit Glimpf entlassen, eine Deputation des Wiener Hofes werde zu ihm gesandt werden, riß er sich, halbtot wie er war, auf, schleppte sich ins Freie vor sein Haus, wurde sogleich ohnmächtig die Stufen wieder zurückgetragen. Am nächsten Tag erhob er sich wieder, erst auf Stöcken wandernd, dann zwischen den Schultern zweier Trabanten hängend: „Der geile Mansfelder ist auch nicht im Bett gestorben. Und ich sterbe noch nicht.“
Vom Regensburger Hofe kamen Trautmannsdorf und Questenberg; sie hatten diese Mission übernommen, um ihn milde zu stimmen; sie brachten Ferdinands gnädiges Schreiben. Sie unterhielten sich freundlich; zwei Kutschzüge mit sechs Pferden schenkte er dem Grafen; Questenberg ein neapolitanisches Tummelpferd. Friedland sah und sollte sehen, es gab Männer seines Anhangs am Hofe. Sie waren Besiegte; der Kummer stand auf ihrem Gesicht.
Damit stieg der Herzog aus dem furchtbaren Angriff, den man gegen ihn unternommen hatte, und schüttelte sich. Sie waren zu dumm. Hatten ihn leben lassen, nicht einmal die Federn hatten sie ihm gerupft.
Er ging noch viele Wochen nicht aus Memmingen. Er ließ aus dem Reich beitreiben, was ihm noch zustand. Allerorts wurden jetzt noch schwere Kontributionen erpreßt. Täglich hatte er mit Michna und De Witte Verhandlungen, ihre Aufstellungen waren genau, Wallenstein stachelte sie an; sie sollten nichts verlieren. Er lud sie ein, bei ihm zu bleiben, sie sollten ihn nicht verlassen, ohne völlig befriedigt zu sein. Die drängten, er ließ sie nicht. Michna und De Witte kamen auf die Vermutung, der Herzog werde doch nicht klein beigeben und irgend etwas Unversehenes versuchen; Bassewi äußerte skeptisch, der Friedländer sei krank, noch ein zwei Monat, so werde er froh sein, sein Getreide eingefahren zu haben. Als Graf Trzka sich freute, daß Friedland zögerte mit dem Abschied, es sei ein heilsamer Schreck für den Kaiser, dachte Friedland einen finsteren Augenblick nach: „Für den Bayern ein heilsamer Schreck; der hat noch nicht gewagt, seine Truppen nach Hause zu schicken. Die Landfahnen kommen nicht zur Ernte; ein mageres Jahr für Bayern.“ Aber er ließ keine hetzenden Reden aufkommen, hatte keinen Sinn für Kindereien. Es sei bald Zeit. Er wolle nach Prag. Das Heer solle der Bayer übernehmen oder der alte Tilly. Wallenstein stand straff, blickte böse und drohend: er hinterlasse ein vortreffliches Heer; man werde einen spaßhaften Krieg jetzt führen; vielleicht brächten die Jesuiten den Frieden vom Himmel.
Der Herbst war schon da, als er dem Hofe schrieb, daß er nunmehr die Geschäfte dem Grafen Tilly übergebe, selbst nach Prag übersiedle.
Durch ein klagendes Heer fuhr er von Memmingen aus. Straßen hinter Straßen standen die ruhmreichen Regimenter mit Fahnen und Regimentsspiel Spalier. Der Herzog saß düster in seinem roten Mantel; er hob von Zeit zu Zeit vor den Obersten, die heranritten, den Hut, winkte den und jenen heran, gab ihm die Hand. Er fuhr lange und fuhr in kaltem Behagen: diese Regimenter hatte er zusammengeführt, sie würden auseinanderfallen, wenn sie in fremde Hand kämen. Der Weg ging über Ulm, zu Lande weiter; es ging nicht nach Gitschin. Der Herzog drängte auf Prag. Und alle, die mit ihm ritten und fuhren, waren von großer Freude erfüllt: der Herzog lebte, wollte noch leben. Man fuhr keinen Toten des Wegs.
Über Nürnberg zogen sie, vierhundert Mann der Leibgarde, zahllose Wagen und Pferde. Und so groß war die Bestürzung in der Stadt bei dem Gerücht, daß er verabschiedet sei und sich nähere, daß der Große Rat der Stadt zusammenlief, in Eile Geschenke beschloß, die auf dem Ansbacher Weg entgegengeschickt wurden, eine Maßnahme, die man später nicht verstehen konnte. Als Friedland über das Bayreuther Gebiet kam, war die Nachricht von den Regensburger Vorkommnissen schon allgemein; tiefe Beklemmung und Bangigkeit hatte sich weithin verbreitet.
Nur wenige tausend Menschen sahen den prächtigen stillen Zug sich schwerfällig über die Äcker, zwischen den Wäldern winden. Aber das ganze Heilige Reich hing mit geistigen Augen an seinen Bewegungen. Man sah, wie eine grauenvolle Unverständlichkeit im Reich es dahin gebracht hatte, daß dieser Drache, dieser Herzog zu Friedland, der Wallenstein, sich offen vor aller Blicke in seine Höhle zurückzog, sich versteckte und als entsetzliches Geschick für die ruhigen Landschaften auf seinen Augenblick wartete. Aus kleinsten Flecken wurden die schutzflehenden Deputationen hervorgequetscht; sie berieselten seinen Weg; er grollte nur über die Kanaille, die ihm den Weg versperrte. Seine Garde hatte nicht nötig auf Requisition auszugehen. Mann und Pferd wurden unter einer Flut von Beteuerungen und Heimlichkeit das Zehnfache von Fourage gebracht. Bei den Begleittrupps, den Kriegsoffizieren, stellte sich eine Neigung heraus, selber das Glück zu versuchen, sahen die Furcht und Untertänigkeit rechts und links, wurden mit Gewalt gebändigt. Sie fanden Wallensteins Rückzug ebenso sonderbar steif wie einflußreiche andere Männer.
Aber alles veränderte sich, als man sich Eger näherte und die böhmischen Grenzen überschritt. Hier war das dunkle zerrissene Land, aus dem er gekommen war. Er kam zurück. Mit Weltruhm, dem größten Reichtum Europas, von Memmingen. Ohne Amt. Im Berge Blanik schlafen die Wenzelsritter bei Wlasin. Es heißt, daß es dort eines Tages trommeln wird, ein Getöse erhebt sich, die Baumwipfel werden dürr, aus den Quellen werden Flüsse, Blut fließt in Strömen von Strähow bis zur Prager Brücke; Wenzel tötet alle seine Feinde. Das Land sog ihn ein. In zahllosen Krümmungen floß die bräunliche Eger, über Moorwiesen kamen sie, hinter ihnen strahlten tagsüber die Schneegipfel des Riesengebirges. Das hüglige Land ließ sie von einem Rücken auf einen andern gleiten. Aus dem Egerland und Ascher Gebiet, von Grünberg, dem Kennerbühl fuhren und ritten die Bauern über seine Straße, begierig ihn zu sehen, wie er aussehe, wie er blicke, der den Dänenkönig zerschlagen hatte und den der mißgünstige Habsburger nach Hause schickte. Ei, mit Kaisern und Königen Kirschen essen! Zwitscherten und geiferten untereinander: „Er hat den Kaiser schön geschoren. Seht die silbernen Partisanen, die Tummelpferde. Hat’s dem Kaiser nicht hinterlassen, war nicht dumm.“ Sie waren nicht feindselig, wie sie auf den Wiesen und Hügeln standen, zogen klirrend die Kappen, fuhren Heu und Stroh an.
Hinein fuhr er, aufwühlend wie mit einem Schiffskiel in die fassungslosen, ihrer Sinne nicht mächtigen, die in den Konventikeln, den ansässigen Adel, Utraquisten, zwangsweise Konvertierten. Die Rache, die wonnige, die ungeahnte Fürsorge des Geschicks. Abgeschüttelt der Verräter von seinem Herrn, heimatlos, sippenlos. Sollten sie ihn fasten lassen; sollen wir ihn kommen lassen. Die grunzende Inbrunst der Zusammenkunften, Jubel, der wohlig quietschte, wirbelte: Wallenstein gezwungen, ihre Partei zu halten oder als Privatmann zu verrecken!
Mütterchen Prag am Hradschin sah schweigend, nicht fragend den menschenumschwärmten Zug nahen.
Die Moldau floß unter der grauen Brücke. In seinem orientalisch reichen Palast stieg Friedland ab. Er wohnte abgeschlossen für sich. Nach Sachsen, Brandenburg flogen die leisen Botschaften. Als italienische Maler anfragten, wann sie die Bilder in den Sälen vollenden sollten, kam aus dem Palast der Bescheid, überall hin kolportiert: „Die Herren sollen warten, bis ich davon bin. Glauben die Herren, der Palast werde mein Sarg sein?“
Hinbrütende Demut vor dem verlorenen, wiedergekehrten Sohn, Hin- und Herschlüpfen der Juden, Berater. Wie Paukenschläge einige schwelgerische Feste, dann kühle Empfänge der Sippenverwandten, Worte, als hätte sich nichts ereignet, ein Brief von Eggenberg, einer vom Kaiser, Ärzte.
Wer war das, der in dem neuen Palast hauste?
In der Stille des Sonnabends wurde der Kardinal Rocci vor das bayrische Quartier getragen; der Kurfürst war von einer Jagd noch nicht zurück. In der Vorkammer schwatzte der kleine Kardinal mit jedem Ankömmling von dem großen neuen Sieg, den die heilige Kirche errungen hätte; der Priester vergab sich etwas, indem er Bediensteten und Kämmerern auf die Schultern klopfte; wenn er allein saß, lachte er laut: „Sie ziehen ab, der Wallenstein und der Spanier. Ist bald die ganze Lombardei leer und gesäubert.“
Als der kreischende Purpurträger Maximilian mit der Neuigkeit entgegenlief, war dem Bayern einen Augenblick, als zischte vor ihm ein Blitz nieder. Er saß mit Rocci nieder, fahlblaß von der Jagd und der Erregung, mit dicken Schweißtropfen um den gespitzten Mund; lächelte gedankenlos zustimmend zu dem Geschwätz des Italieners.
Als der ihn verließ, blieb er, die geöffneten Hände auf den Knien, mit gerunzelter Stirn, Bitterkeit in der Kehle, sitzen. Richel trat ein, freudig bewegt. Kalt tönte die weiche klare Stimme Maximilians: „Habt Ihr etwas anderes erwartet?“ „Ich freue mich, daß die Römische Majestät nachgegeben hat.“ „Er hat immer nachgegeben, Richel, wo man etwas von ihm wollte. Es war kein Entschluß von ihm. Mein Schwager kennt keine Entschlüsse. Er schickt den Friedländer weg, weil man ihn drängt und wird ihn wieder holen, wenn man ihn drängt.“ „Der Herzog hat ja nicht gewollt zu uns stehen.“ Der Kurfürst aufrecht, fest: „Der Vorfall ist lehrreich. Ich werde den Vorfall verstehen. Diesmal besser und erbarmungsloser als voriges Mal. Er hat die Situation verstanden. Wir werden sie ihn weiter fühlen lassen. Wir haben unser Äußerstes anwenden müssen, um dies herbeizuführen. Ich versteh’ jetzt weiter keinen Spaß mit ihm.“ Er schlenderte an Richel vorbei, setzte sich wieder, den Zeigefinger steif ausstreckend: „Die freundschaftliche Maskerei werde ich in Zukunft nicht dulden. Mir, uns allen ist der Kaiser diese Rechenschaft schuldig. Er hat geglaubt zu versuchen, die Tyrannei uns aufzulegen. Es ist jetzt nicht damit genug, wenn er erklärt, er stehe davon ab. Weil es ihm nämlich nicht geglückt ist. Ich verlange Sühne.“ Der Kurfürst sprach den Rat mit feurigen seltsamen Augen an: „Verträge brechen und dann ein Dank schön verlangen, wenn man bereit ist sie wieder zu halten.“
Maximilian ging mit raschen Schritten an die Tür, an der er rüttelte; er prüfte, ob die Fenster geschlossen waren; er schrie leise: „Wir nehmen dies nicht an. So füttert man hungriges Vieh. Wer sind wir. Ich bin deutscher Kurfürst, dem übel mitgespielt wurde von ihm.“
„Und was gedenkt Kurfürstliche Durchlaucht vom Kaiser zu verlangen?“
„Ich lege eins zum andern. Der Berg reicht bald an den Himmel.“ Vor der schmerzlichen Erregung seines Herrn sah Richel, seinen Degen schaukelnd, auf den Teppich; ruhig sagte er nach einer Weile, als sich der Kurfürst im Sessel reckte: „Vielleicht wird es nötig sein, nunmehr zu Präventivmaßregeln zu schreiten und sich vor Schwierigkeiten in Zukunft zu schützen.“
„Ihr erklärt den Wiener Herren, ich könnte mich mit dem Entscheid nicht zufrieden geben. Ihr habt keine Spur von Freude zu zeigen und verbreitet es auch den Kämmerern und anderen. Wir haben keinen Grund zur Freude. Wir verlangen den Schutz des Reiches und der Kurfürstenlibertät vor Übergriffen, wie sie vorgefallen sind. Die Armee ist jetzt ohne Haupt. Wir verlangen nunmehr Übergang des Generalats an uns.“ Richel blickte groß; scharf fuhr Maximilian fort: „Was denkt Ihr? Sie werden dazu nicht lachen. Ich glaube das. Ich habe auch nicht gelacht, als der Friedländer General wurde. Das Lachen wird ihnen vergehen. Es wird keine Ruhe im Reich sein, bis die Kurfürsten die Armee führen. Ich werde mich mit den geistlichen Herren noch verständigen. Es wird keine Ruhe, bis der Kaiser auf seine Erbländer zurückgedrängt ist.“
„Die Armee im Reich wird vom Kaiser und dem Kurfürstenkolleg dirigiert.“
„Sie wird von mir geführt. Ich bestehe darauf. Die Protestanten haben sich selbst ausgeschlossen.“
„Es wird schwer halten, hier den Gewaltstandpunkt zu verheimlichen.“
„Man hat ihn mir gegenüber nicht verheimlicht.“
Bei der Zusammenkunft der katholischen Fürsten im Mainzer Quartier war der Bayer isoliert. Die Herren waren siegestoll, von Jubel beherrscht. Sie hatten sich nicht nehmen lassen, vor Beginn ihrer eigenen Besprechungen durch eine Hinterpforte den Marquis de Brulart und den Pater Joseph zu sich einzulassen und deren Glückwünsche entgegenzunehmen. Die Franzosen taten sehr beschämt, als der Trierer, dem sie eine Pension zahlten, und der sehr geldbedürftige Ferdinand von Köln ihnen allen Verdienst zuschoben an dem fast unglaublichen Ausgang. Der Kaiser, radebrechten französisch die beiden rheinischen Herren, wisse, welche starke katholische Macht hinter der Liga stünde. Der Trierer insbesondere tat, als wäre König Ludwig sein spezieller Bundesgenosse.
Maximilian, das Gebaren seiner Freunde ignorierend, lenkte in Gegenwart der stolzen Welschen die Unterhaltung auf das kaiserliche Heer. Die Franzosen hörten mit Staunen den bayrischen Plan; sie fühlten den Stoß, hielten es für gut, zu verschwinden. Die Fürsten zappelten gespießt an Maximilians Vorschlag, das Generalat in Zukunft ihm, dem Ligaobersten, zu übertragen. Sie bissen und drehten sich. Grämlich sahen sie, daß sie zustimmen würden. Und ehe sie’s dachten, hatten sie zugestimmt. Sie wollten den Antrag unterschreiben. Verfechten mochte ihn der Kurbayer selbst.
Und dann ließen sie ihren Grimm los und ließen ihn poltern vor Maximilian, vor dem sie ihre Ohnmacht verstecken wollten. Sie wollten Rache und Schadloshaltung. Der glotzäugige schwerleibige Philipp Christoph von Trier, breitbeinig auf zwei Sesseln ausgestreckt, ließ aus der Kehle quellen, die Lider wenig hebend, zweihunderttausend Taler versudele der Böhme an Küche und Keller und sei dabei dürr wie ein Faden; Halberstadt habe ihm ein wöchentliches Tafelgeld geben müssen von siebentausend Gulden. Er keuchte: „der Tropf!“ Das harte graugesichtige Männlein unter dem violetten Käppchen, der Reichserzkanzler, kläffte mit seinem breiten gnadenlos dünnen Mund, es hätten sogar in vielen Landesteilen die Leute sich selber auffressen müssen. Auch er hätte mit Mühe gegen solche Fälle einschreiten müssen und geradezu mit Gewalt das für seine Tafel, den Unterhalt der Küche Nötige, und für die Abgabe an Rom beitreiben müssen. Vorgebückt der verlebte Ferdinand von Köln rieb sich unruhig die dünne rote Nase; sein Bruder schwieg so lange; dann konnte er sich nicht zähmen, lispelte, gestikulierte: mit Glimpf zu entlassen den Herzog, das sei ein Betrug an allen Landesfürsten. Und darauf murrten knurrten sie zu dritt, bäumten sich, und ihr Groll war nur gerichtet auf den neben ihnen sitzenden feisten kurzleibigen Bayern.
Der gab von sich, daß man sich hier nicht einmischen wolle. Man möge es auf sich beruhen lassen. Denn daß Wallenstein mit Ehren entlassen würde, versöhnte ihn leise mit dem kaiserlichen Entschluß; er begriff, daß Ferdinand diesen Mann nicht so wegschicken wollte. Wenigstens fürstlich hatte Ferdinand gehandelt, den er als Kaiser hinnehmen mußte.
Im bischöflichen Garten unter den kaiserlichen Gemächern lief der Abt mit dem verwachsenen Grafen. Sie rupften im heftigen Gespräch eine kleine Buche rundherum kahl. Der Abt knallte wieder Blätter vor dem Mund auf. Der Graf Trautmannsdorf schwang die Arme, schlug die Hände vors Gesicht: also es finge alles wieder von vorne an; alles sei umsonst gewesen. „Es ist so, es ist so“, der Abt drückte fast besinnungslos Trautmannsdorfs Arm. „Wozu sind wir da?“ sie stöhnten, stampften den Boden.
Der Kaiser sah sie von oben. Er schickte seinen Leibkämmerer herunter, sie möchten ihn erwarten. Dann kam er barhäuptig, der Diener trug Reiherhut Handschuh und Wehrgehenk hinter ihm. Er freute sich, frisch blickend; die Herren, sie möchten es sich recht bequem machen in Regensburg, man sei zwar über den höchsten Berg hinweg, aber es gebe noch allerlei Schwierigkeiten; das würde viel Zeit beanspruchen. Als er die zerknüllten Blätter in den Händen des Abtes sah, meinte er, mit ihnen vorwärts schlendernd, er wisse schon, daß es sowohl vor dem Schiff als auch hinter dem Schiff Wellen gebe. Er plauderte noch allerhand, bis der hagere Graf Strahlendorf, der hinzugetreten war, von einem Besuch Richels begann. Die Herren drängten vor den Kaiser, um sein Gesicht zu sehen. Er riß die kleinen Augen auf, befragte lebhaft den frommen Grafen nach der Sache, dann auch die beiden anderen Herren. Dann schüttelte er mit freudig überraschtem Ausdruck in das Gras blickend den Kopf: „Was! Was! Wünscht er das? Wünscht mein Schwager das? Will er eine so enge Verbindung zwischen mir und ihm? Mein Schwager hätte alles Mißtrauen gegen mich aufgegeben?“ Auf die starre verlegene Zustimmung Strahlendorfs, — die beiden andern senkten die Köpfe, — drängte Ferdinand mit größter Heftigkeit gegen den langen Grafen, ihn am Wams berührend: „Was, das hat Euch der Richel aufgebunden! Er geht hin und her, mißversteht hier und dort.“ Jetzt stammelte mit rauher Stimme Strahlendorf, nein, Richel hätte von Dienst- und Amtswegen ein quasi Verlangen, um nicht zu sagen Anspruch Bayerns auf die Generalatstelle angemeldet. „Ein Verlangen. Ein Anspruch. Wißt Ihr, daß dies beinah undenkbar ist! Bayern wird sich damit ruinieren. Es soll versuchen in dies Wespennest zu stechen, Obersten mit großen Gehältern, verwöhnte Soldaten und Reiter, diese Überzahl an Menschen ernähren, kleiden, bezahlen, und — dabei keinem Unrecht tun. Nein, sagt meinem Schwager, es sei sehr lieb von ihm, aber ich könne es nicht von ihm verlangen. Es ist auch nicht richtig, sagt doch!“ Strahlendorf Trautmannsdorf gingen fast träumend neben und hinter dem Herrn. Wie aus einer andern Welt kam es Trautmannsdorf selbst vor, als er sich genötigt fühlte zu sagen, daß Habsburg diesen Vorschlag ablehnen müsse, da es sonst machtlos werde. Mitleidig lächelnd zog ihn Ferdinand, ihn um die Hüfte fassend, an sich: „Ist mein treuer Trautmannsdorf, der Edelstein in meiner Krone, noch so rückständig. Sind die Zeiten vom Haß zwischen Wittelsbach und Habsburg noch immer da. Wittelsbach hat gesehn, wie gewaltig, unnahbar gewaltig ein Kaiser sein kann. Seht doch um Euch, Herr Graf; nicht so historisch gedacht. Habsburg braucht sich vor keinem Haß mehr zu fürchten. Schon lange nicht mehr.“ „Ich sehe es nicht“, murmelte Trautmannsdorf. „Aber ich,“ lachte die Majestät, „bald werde ich Euch auf den Thron erheben und mich zum Berater anbieten.“ Er ließ den Grafen los; in einem Rosenrondell stand er tiefsinnig, die Arme verschränkt, da vor den Herren; ein junger Fuchs sprang spielend neben einer Buche an seiner Kette herum. „Der Papst macht Schwierigkeiten mich zu krönen. Inzwischen hat mein lieber treuer General Wallenstein, der Herzog zu Friedland, mich zum Kaiser gekrönt. Das kann mir keiner strittig machen. Was grabt Ihr die alten Märchen aus.“ „Nein,“ brach er ab, „vorläufig glaub’ ich nicht ganz an den Ernst meines Schwagers, das Kommando meiner Armee zu übernehmen. Was sagt Ihr, Ehrwürden von Kremsmünster, zu meinen Rosen. Wenn sie Euch gefallen, will ich es dem Gärtner bestellen lassen. Euer Lob ist ihm eine Erhebung in den Adelsstand.“
Den sich bäumenden Widerstand der Herren drückten ganz nieder der Fürst Eggenberg und der Beichtvater, die aus Göppingen hereinkamen; beide noch erschüttert von dem Ereignis, das sich vollzogen hatte, und in Erwartung der bayrischen Übergriffe. Als Kremsmünster die Frage der Zuziehung des Erzherzogs Leopold aufwarf, war schon klar, daß man einer andern Situation als früher gegenüberstand. Der Beichtvater, bleich und schwer sich erhebend, erklärte seine Hände von allem, was geschehen sei, abzuziehen; er sagte offen, er vermöge gegen den Kaiser nichts anzustiften und zu unternehmen. Eggenberg las ihm vom Gesicht, daß er von dem jüngsten Erlebnis noch geblendet war. Lamormains Gesicht gab deutlich das Gefühl wieder, das sie alle unsicher hatten, daß mit dem Kaiser eine neue rätselhafte Gewalt unter ihnen aufgestanden war. Man wußte nicht, ob man sich dieser Gewalt anvertrauen konnte. Dann vor der feierlich traurigen Figur des Beichtvaters wurde man ruhiger. Der Kaiser, der neue Kaiser wirkte.
Langsam stellten sie ihre Gedanken auf ihn ein; langsam erinnerte sich Trautmannsdorf des Satzes Ferdinands, es seien neue Zeiten da. Und als Trautmannsdorf, der kühnste, am meisten elastische von ihnen zögernd fragte: „Und wenn es wirklich so wäre, wenn er die Dinge richtig sähe und einen Weg aus der deutschen Zwietracht wüßte?“, da bezwangen sie sich alle. Sie fühlten sich bewegt, der Gedanke vom Staatsstreich beschämte sie. Sie hatten sich feurig und erschüttert zusammengesetzt; nachdenklich trennten sie sich.
„Was sind das für Zeiten,“ flüsterte erstaunt der verwachsene Graf zum Abt, als sie an dem stumm daliegenden Bischofspalast vorübergingen, der Beichtvater sich zum Kaiser begab, „ich hielt mich noch für jung und bin schon verbraucht, verstehe kaum etwas.“ „Ach,“ seufzte Kremsmünster, „es ist eine Zeit der Experimente. Hätten wir nur den Herzog noch.“ „Denkt Euch, ach denkt Euch, der Kaiser will Frieden im Reiche machen, er steckt das Schlachtschwert ein, er will so, so Wittelsbach entwaffnen. Der Gedanke, der Gedanke!“ „Gebe Gott und alle Heiligen, daß uns nichts widerfährt.“ „Denkt Euch, es sah aus, wie ein drohender Kampf zwischen Kaiser und Fürsten, Bayern und Friedland bis aufs Messer, und jetzt, — hat der Kaiser den Sieg an sich genommen, ohne auch nur den Degen berührt zu haben. Er hat den Wittelsbach nicht einmal an sich herankommen lassen und schon war er besiegt. Ohne Friedland! Denkt Ehrwürden.“ „Phantasien, lieber Graf. Der Kaiser denkt es und Ihr denkt es.“ „Wer kennt die Wege des Schicksals. Warum sollte nicht einmal eine neue Methode versucht werden. Unsere heilige Kirche, Ihr seid mir nicht böse, ist stark im Hintergrunde; Urban soll auch viel Artillerie im Kopf haben. Da besinnt sich der Kaiser auf sein Herz.“ „Hättet Ihr doch Recht.“ „Nein, nicht bloß auf sein Herz, auf unser Herz. Es könnte so sein, es könnte doch wenigstens in der Phantasie so sein. Und mit einem winzig kleinen, ameisenkleinen Phantasieaufwand hat der Kaiser unsere gewaltigen Schwierigkeiten behoben. Bah, stehen die Kanonen da, bah, wissen die Generäle nicht, was mit ihnen ist.“ „Phantasie, Phantasie.“ „Das eine Heilige Römische Reich.“ „Ach, es ist ja zum Lachen, Graf Trautmannsdorf. Ich möchte in Friedland und den Bayern gucken.“
So stolz und entschlossen war Maximilian, daß er nach wenigen Tagen sich selbst im Bischofspalast eine Audienz erbat und den Kaiser um Erledigung der schwebenden Heeresfrage anging. Ferdinand hatte noch einmal mit seinen Herren beraten; es waren sonderbarerweise alle Einwände verstummt, gegen die Bestellung des ligistischen Generals Tilly zum kaiserlichen Feldherrn wußte in halber Beschämung niemand etwas zu sagen; ja man hatte sich gewundert unter den Suggestivreden Trautmannsdorfs, wie glatt diese einfache Lösung war und wie fruchtbar sie sein konnte.
Ferdinand ging sanft dem Bayern, der trübe blickte, an die Tür entgegen: „Wie, lieber Schwager, Ihr solltet Euch wirklich zu diesem Opfer entschließen? Ihr wollt Frieden im Reich stiften? Wißt Ihr, es ist ein Einfall von Euch, der so den Kern meiner Erwägungen und innerlichen Beschlüsse trifft, daß ich noch jetzt erschrocken bin. Ja, wie kann diese Tagung besser geschlossen oder gekrönt werden, als indem Ihr oder Euer General meine Armee in die Hand nehmt. Jeder Streit entfällt. Eure militärische Tüchtigkeit ist ohne Zweifel. Und, nein —“ Er strich des Bayern Ärmel und lachte ihn herzlich an. Maximilian, finsterer im Anhören geworden, fragte ihn nach dem Lachen. Ferdinand schritt mit ihm in den Saal; nun werde einmal der Bayer alle Sünden auszubaden haben, und in ein zwei Jahren werde es einen Tag zu Regensburg mit vertauschten Rollen geben. Der Bayer, unsicher die anwesenden Herren Eggenberg und Trautmannsdorf fixierend, drängte fort, um sich durch seine Unterhändler der Wirklichkeit der kaiserlichen Erklärungen zu versichern. Er fühlte sich seiner Sinne nicht mächtig, hielt sich mit Zwang von neuem zurück, um wieder zu hören, mit welcher befremdenden Leichtigkeit der Kaiser sprach. Und die seriösen Räte waren zugegen! Zu Boden geschmettert war er; das Geplauder des Kaisers regnete auf ihn.
Dann saß er in der Karosse, nahe in ein nervöses Schluchzen auszubrechen. Unklar kam er sich besiegt vor. Wie ein Mann, der einen Anlauf nimmt, um eine schwere Last fortzustoßen, blind losgerannt ist und die leere Luft zerrissen hat. Unfaßbar das Benehmen des Kaisers; was war das, was war das. Der träge freche Stolz dieses Mannes, diese hochmütige trächtige Liebe. Das Sicherste war in Maximilian gelockert; wie eine Handvoll Bohnen, zwischen Granit geworfen, quellend die Quadern hebt. Maximilian blies die Luft von sich. In dem Logement mit Richel und dem Fürsten von Hohenzollern speisend, betäubte er sich durch klangreiches Reden. Triumphgeschrei rechts und links. Boten von Brulart herüber, Boten an die geistlichen Kurfürsten. Die fuhren am nächsten Morgen vor. Übernächtig genoß Maximilian ihre Angst, die sich nicht äußern durfte, ihr verlogenes Schmeicheln und Jubeln. Maximilian fühlte, er war aus seiner Bahn geworfen; es war ein Zustand, wie in den heißen Tagen, als er mit Wallenstein sich verbinden wollte. Wallenstein, dieser klägliche überschätzte Mensch, dieser Lump und Knecht, der sich von seinem Herrn wegschicken ließ, und der auch ging, ohne zu murren, wahrscheinlich froh über die Tonne Gold, die er davonschleppen durfte. Heiß rollte der Triumph durch den Kurfürsten. Er hatte das fürstliche Spiel gewonnen. Die Franzosen wurden angemeldet. Maximilian fertigte sie hochmütig ab, und plötzlich haßte er sie, weil sie ihn an seine Angst erinnerten. Abstoßen! Ob sie ihn wohl knebeln zwirbeln und pressen wollten. So früh und rasch erscheinen, um wie Juden Schulden einzutreiben. Schulden, Schulden! Bei der erstaunlichen Szene war Fürst von Hohenzollern zugegen, der nicht daran zweifelte, daß der Kurfürst in einem Schwermutsanfall sprach und die beleidigten Herren zum formlosen Weggehen bewegte. Ihn aber, den Hohenzollern, überfuhr der noch unausgeleerte Kurfürst mit wilden und höhnischen lustgeschwollenen Rufen: ja, es sei nicht nötig, diese Herren sanft fortzukomplimentieren. Man sollte sie aufheben auf deutschem Gebiet oder sie in die Donau stürzen, weil er sie durchschaue, die neidischen, die streitsüchtigen. Sie sollten ihre Finger vom Reich lassen.
Bacchantische und kulinarische Exzesse überschwemmten wieder den Hof. Die Majestät gab sich nach langer Enthaltsamkeit den Ausschweifungen hin. Es wurde erzählt, der Morgen beginne mit Bordeaux, der Abend sinke mit Likören; was in der Mitte flösse, sei auch kein Wasser. Gepränge an den Tafeln mit den geistlichen Herren. Mit der wieder eingetroffenen Mantuanerin. Mit Welschen Spaniern Italienern. Schiene es doch, als sei ganz Regensburg aus dem Häuschen und der Kaiser feire die Leiche Friedlands weg. Es wurde erzählt, Ferdinand wolle Frieden um jeden Preis; die Mantuanerin bedränge ihn; was Lamormain leiste, würde bald offenbar werden. Und da griff Maximilian zu. Er war auf bekannter Fährte: Ferdinand, der freche Säufer und Fresser! Das war ja das dicke Wildschwein, auf dessen Jagd er sein ganzes Leben über war. Und sein inniges atemloses Gelächter.
Der Kaiser hatte die Kurfürsten an sich gerissen, als wenn er nach ihnen verdurste. Zusammengerufen und einzeln konnte er von ihnen nicht genug haben. Und von den Welschen, den Spaniern, Italienern. Und sie kamen. Der Riß in Regensburg war beseitigt. Nach Maximilian rief er am heftigsten, und freudig, heftig gereizt, innerlich brüllend vor Gelächter, machte sich Maximilian auf die Füße. Er sah darüber hinweg, daß dieser Glanz erpreßter Reichtum deutscher Kreise war; es machte ihm heißes, unter Spott wucherndes Vergnügen, daß der Kaiser ihnen allen diesen Glanz hinhielt, als wüßten sie nichts, ahnungslos leichtherzig wie einer. Ferdinand, der Kaiser blieb, weil ihm keiner ernsthaft böse wurde. Und der seinen Feldherrn geopfert hatte, wahrhaftig, aus keinem andern Grunde, als um Frieden zu haben, mit ihnen allen, und — wieder ruhig zu pokulieren.
Und dieser selbe Gedanke stieg in einem andern stillen Teilnehmer der Feste auf, Lamormain, wie Maximilian auf Suche nach der Gebärde Ferdinands, den Kaiser betastend; den Kaiser anbetend, sich vor ihm kasteiend. Er wurde von dem allgemeinen Erstaunen über den verwandelten Herrscher mitgerissen.
Dieses Zwitschern Fragen Horchen am Hofe. Herübergeholt die Meisterküche aus Wien, mit dem Stab der Pastetenbäcker, Zuckerküchler, Erbauer der Riesentorten; auftauchte die Schar der Truchsesse Vorschneider Mundschenke Kredenzer. Mit dem schwarzen Stab spazierte zur Musik herein der Oberstabmeister vor den dunstumhüllten Speiseträgern. Auf den Tafeln vor den zerreißenden Menschenzähnen das getötete Getier des Waldes, das singende fliegende tänzelnde, Auerhahn Schwan Pfau weißer Reiher Kranich roter Fasan. Zuckerbrot Marzipan Sülzen. Inmitten der überflutenden Leckereien auf der Tafel die weiße Pyramide, um die die vier Elemente saßen; Fortuna goldgelockt, purpurgekleidet auf einer Kugel, die unter ihren spitzen Zehen rollte. Gemisch der Nationen an den Tafeln, erfreute Münder, erbitterte Stirnen; der Deutsche vertreibt den Schmerz, der Italiener verschließt den Schmerz, der Spanier beklagt den Schmerz, der Franzose besingt den Schmerz. Musik: wer weiß was Schmerz oder Freude ist. Feuerwerk Ballett Stechen Jagden Frühstück.
Entsetzt der schwarze hinkende Lamormain hinter dem aufgeblähten glückvollen Kaiser: „Den Herzog hat er verstoßen, als war es nichts. Er hat ihm seine Königreiche gerettet. Jetzt weiß er nichts mehr davon. Er hat es vergessen. Er hat den Friedländer schon vergessen.“ Ein gräßliches Gefühl durch den Pater. Wie ein Kind sah Fürst Eggenberg den Habsburger sich zwischen den schlemmenden Herren und Fürsten bewegen; er zuckte die Achseln: „Wohl uns, wir sind über den Berg.“ Unvermerktes Abreisen der Räte Trautmannsdorf und Kremsmünster aus Regensburg vor dem erschreckenden Anblick ihres Herrn.
Auf Wagen Pferden neben dem Kaiser die Mantuanerin. Die Sicheln der schwarzen hochgeschwungenen Augenbrauen, die brennenden Blicke, die straffen glatten Wangen. Um sie reitend auf weißen Gäulen anmutige Franzosen, die rechte Hand in die Hüfte gestützt, mächtige Goldschärpen. Beim ersten festlichen Empfang der Fürsten im Bischofspalast schritt sie neben dem Kapuziner Joseph durch die Säle spitzfüßig auf weißen Schuhchen, den gelben Rock mit beiden Händen vorn gerafft, daß das purpurne Unterkleid schimmerte; bis über die Knöchel entblößte sie ihre Füße, die weißen Strümpfe. Goldgelbes Kostüm bis zu den Achseln ausgeschnitten, Perlen um den Hals in fünffacher Reihe; feine gelenkige ebenmäßige Büste, die Arme in weißen weiten Atlas geschlagen. Das Haar schwankte in Locken seitlich über den Hals, aus dem Nackenknoten stieg schwer eine tellergroße Sonnenblume. Der siegreiche strenge Mund. Der Herr gab ihr nach, daß für Italien die Friedensverhandlungen begannen. Sie hatte nicht genug daran, Kasale stand vor dem Fall. Sofort mußte der Waffenstillstand beschlossen werden. Mit Flüchen auf die Welt gehorchte der alte Spanier Spinola, nach drei Tagen war er wahnsinnig, bald tot. Die Kaiserin erschauerte vor Wonne. Ihrem Oberstkämmerer sagte sie, dem Pater Joseph schrieb sie: „Meldet Kollalto, er belagere Mantua und mit Mantua meine Seele. Ich werde ihm goldene Ketten, Land und alle Auszeichnungen verschaffen, wenn er mir und meiner Stadt wieder Freiheit verschafft. Er möchte nach Wien kommen, er soll es sich nicht überlegen, wir erwarten ihn.“
Nur noch gelegentlich wurden in der Sommerhitze Verhandlungen gepflogen, die Kurfürsten baten um Aufhebung des Kollegialtages. Man schaffte die Ernte in die Scheuern. Tilly, der eisgraue kleine fromme Mann aus Brabant, war Feldherr der beiden Heere. Das kaiserliche Heer vermindert wie das ligistische. Friede im Reich und bald Friede an allen Grenzen.
Vor den Quartieren der Kurfürsten standen die breiten Reisewagen. Die Räder hoch, tief hängende Kästen, mit Kronen an den Schlägen und über den Decken. Der Lärm der Bankette in der Stadt ging weiter. Hinein stieg seufzend der schwere Trierer, sah sich müde um, schlief ein. Hinein behaglich grunzend der pergamentene Erzkanzler; der Wagen rollte. Widerstrebend der lüsterne Kölner, den das Klirren und Juchzen der Stadt hielt. Mit starken Sprüngen Maximilian, Richel neben sich, der Wagen geschlossen, die Vorhänge zu; mit Frankreich al pari, die kaiserliche Macht in seiner Hand.
Die Franzosen hielt es lange in Regensburg, sie konnten sich vor dem unglaublichen Anblick dieses deutschen Untiers nicht losreißen. Die hoheitsvolle Maske des Kaisers, des Schlemmers, neigte sich täglich über sie; sie schworen ihm, keinen Feind des Reiches zu unterstützen.
Seine Augen waren wie die eines Schielenden; man wußte nicht, ob man ihn ansah.
Über die Wogen der graugrünen Ostsee kam die starke Flotte der Schweden windgetrieben her, Koggen Gallionen Korvetten. Bei Kalmar unter Öland, bei Westerik, Norreköping, Nöderköping hatten sie die gezimmerten Brüste und Bäuche auf das kühle Wasser gelegt, schwammen daher. Die bunten langen Wimpel sirrten an den Seilen und Gestängen. Voran das Admiralsschiff Merkur mit zweiunddreißig Kanonen, dann Westerwik mit sechsundzwanzig, Pelikan und Apollo mit zwanzig, Andromeda mit achtzehn; dreizehn auf Regenbogen, zwölf auf Storch und Delphin, zehn auf Papagei, acht auf dem Schwarzen Hund. Der Wind arbeitete an der Takelung, die Segel drückte er ein, die breiträumigen Schiffe bogen aus, stießen vor, glitten wie Wasser über Wasser. Dann griff der wehende Drang oben an, sie beugten sich vor, schnitten, rissen schräg-wirre sprühende Schaumbahnen in die glatte fließende Fläche, stellten sich tänzelnd wieder auf. Die tausende Mann, die tausende Pferde auf den Planken. Das Meer lag versunken unter ihnen. Die Schiffe rannten herüber aus Elfsnabben, dem weiten Sammelplatz, nach einem anderen Land. Da stand die flache deutsche Küste. Wie Urtiere rollten torkelten watschelten die brusthebenden geschwollenen Segler, tauchten, hoben sich rahenschlagend aus dem herabrieselnden Wasser. Als die flachen Boote, die Kutter Briggen Schoner vom Ufer anschwirrten, erschien der weiße Strand. Triumphierend leuchteten die nassen bemalten Gallionen und Koggen. Auf den stillen verlassenen Strand stiegen Menschen nach Menschen, fremdländische Rufe. Drohend schlugen von den Schiffskastellen Kanonensalven über das Land.
Die Männer aus Swealand und Götland, von Söderhamm Örebro Falun Eskilstima, Fischer Meerfahrer Bergmänner Ackerer Schmiede, die starkbeinigen kleinen Menschen aus dem seenreichen Finnland, die noch mit den Bären und Füchsen zu kämpfen hatten, in Waffen geübt, schwärmten in Eisen und Stahl, Pferde Wagen und Kanonen führend über die wehrlose Insel. Hinter ihnen kleine schwarzhaarige scheue Männer, behende Lappen, mit Pferden Pfeil und Bogen. Sie führten Faschinen Körbe, schleppten Brot und Bier.
Sie liefen Schloß Wolgast an; überschwemmten es im Nu. Die Oder floß breit und ruhig in die Ostsee; an ihr lag die Stadt des Pommernherzogs Boguslav Stettin. Er hatte jahrelang die Aussaugung und Bedrückung der friedländischen Truppen geduldet, war an die Kurfürsten gegangen, an den Kaiser in Regensburg. Weißhaarig mit einer kleinen Leibwache stand er auf dem Bollwerk, zitterte trotz der Wärme in seinem silbergestickten Röckchen. Im blauen Wams mit plumpem Wehrgehenk verhandelte ein schwedischer Kapitän mit ihm in der Sonne drei Stunden. Währenddessen fuhren langsam die achtundzwanzig Kriegsschiffe näher, Merkur mit zweiunddreißig Kanonen, Westerwik mit sechsundzwanzig, Apollo, Pelikan mit zwanzig, Andromeda mit achtzehn, Regenbogen mit dreizehn, Storch Delphin mit zwölf, Papagei mit zehn, Schwarzer Hund mit acht. Hinter und zwischen ihnen schwankten die riesigen Transportschiffe. Da zog sich der Herzog, den Hut lüpfend, einige Minuten in ein Zelt zurück, das man hinter ihm aufgestellt hatte und sprach mit seinem Oberst Danitz, der Pommerns Neutralität mit den Waffen der Bürger zu verteidigen schwur. Boguslav schüttelte ihm, Tränen in den Augen, die Hand; es sei zuviel, erst die Kaiserlichen, dann die Schweden. Ging, nachdem er sich geschneuzt hatte, gebrochen zu dem stolz wartenden Parlamentär hinaus. Nach ihrer Unterhaltung zogen sich die Kriegsschiffe zurück, ließen den Transportern Platz; hunderte auf hunderte Schweden bestiegen das Bollwerk; der Herzog stand noch starr vor seinem Zelt, wurde nicht beachtet. Viertausend Mann nahm Stettin auf; die Bürgerfahnen zerstreuten sich ängstlich.
Nach fünf Tagen saß der Herzog im Stettiner Schloß mit dem beleibten blonden Gustaf Adolf an einem Tisch; der erklärte ihm, während er schlaff zuhörte, sie hätten gemeinsame Interessen, die sie auch schriftlich formulieren müßten; der römische Kaiser sei ihrer beider Feind. „Es ist mein Kaiser,“ sagte Boguslav, „dem ich Treue als Reichsfürst schuldig bin.“ So einigten sie sich nach Gustafs mitleidigem Lächeln; demütig unterschrieb der Herzog, daß er sich mit dem Schweden zu gemeinsamer Verteidigung gegen die Landesverderber verbünde; „unbeschadet Kaiserlicher Majestät“, das setzte der Herzog selber zärtlich hin. Die pommerschen Stände fanden sich im Schloß ein; ihre große Not erörterte der König beredt vor ihnen; er suchte ihren Zorn auf den Kaiser zu entfachen. Nach einer Konferenz mit ihrem Herzog fanden sie sich bereit, dem schwedischen Ansinnen entsprechend zweihunderttausend Taler zu zahlen und eine dreiprozentige Hafenzollabgabe zu gewähren.
Wie die Schweden aus der traurigen Stadt, in der sie eine Besetzung zurückließen, hinausritten und marschierten, stießen sie in ein leeres Land. Die wenigen Bauern liefen erstaunt um die fremden starken Scharen, die Lappen mit den Bogen, hörten durch Dolmetscher, daß diese Männer alle über die Ostsee gekommen seien, um sie zu beschützen in ihrem Glauben und gegen die Bedrückungen der Kaiserlichen. Sie verbreiteten das Gerücht von der anschwemmenden Menschenwelle weiter, retteten ihre Pferde und Vorräte an feste verborgene Orte. Durch Vorpommern verbreiteten sich die Fremden, zehntausend Infanteristen, zweitausendfünfhundert Reiter, in völliger Einsamkeit, bei Damgarten wippten sie über die Mecklenburger Grenze. Wie rann es durch die erwartungsvolle Seele des Königs und seiner Umgebung, daß dies das Land des gigantischen böhmischen Mannes war, das wehrlos vor ihnen lag.
Das Wort ließ der König wieder schwellend aus seinem Munde los, Trommler trugen es über die Dörfer: er sei der schwedische König, ein Bekenner der lutherischen Lehre, der mit seinen Männern zu Schiff herübergekommen sei, weil er von der Not seiner Glaubensverwandten gehört hätte. Er hätte es kühnlich gewagt herüberzukommen und die Löwenhöhle zu betreten, wenn auch ihn das Untier anspringen sollte. Sie aber seien zu seiner Verwunderung vom alleinseligmachenden Glauben abgefallen und in des bösen Wallensteins Dienste getreten. Sie sollten achtgeben. Wenn sie seinem Rufe nicht nachkämen, Hab und Gut mehr achteten, als ihre Seligkeit, so wolle er sie als Meineidige, Treulose, Abtrünnige, ja ärgere Feinde und Verächter Gottes als die Kaiserlichen mit Feuer und Schwert verfolgen und bestrafen.
Vor dem harten Geschrei der Eindringlinge grinsten die Leute. Das Stillschweigen und Lächeln verbreitete sich wie ein Luftraum um das marschierende Heer, bis sie auf Savelli stießen, den kaiserlichen Feldmarschall, vor dessen stumm wartenden Massen sie grollend und fauchend zurückwichen, zurück durch den Paß von Ribnitz nach dem ausgemergelten Pommerland. Die prunkvollen Orlogs, die breiten Transporter schaukelten auf der Oder bis nach Dievenow; die Wochen aber schlichen hin. Untätig lungerten die Fremden auf dem pommerschen Boden, ihr feister König stieg mit seinem Sekretär, dem hinkenden Lars Grubbe, durch die Lager, sprach ihnen, äußerlich sorglos, zu, lachte gezwungen, wenn sie ihm nachriefen „Dickkopf, Schmerbauch“, gab, sich gemein machend, ihnen ihren Ton wieder. Sie duzten ihn: „Monsieur König, wenn du so streng bist, schaff uns auch Schuhe.“ Er zog sich auf der Lagergasse seine hohen Stiefel aus, ging barfüßig weiter; sie schwenkten auf Stangen die Stiefel und warfen sie hinter ihn: „Zahl uns Sold!“ Es hieß kurzen Prozeß machen; man konnte nicht in Pommern verkommen. Aus Preußen kamen schwedische Reiter herüber, man wartete auf sie in den eisigen Winter hinein.
Dann zogen sich die Schweden aus Stettin und Pommern, von den Schiffen aus den Inseln, zusammen wie ein Geschwür, das aufgehen will, belauerten vor Damo ein paar Wochen die Kaiserlichen, die drüben in Greifenhagen in Massen verdarben unter Schaumburg, dem Nachfolger des toten Torquato Konti, der das Land verelendet hatte. Am Weihnachtmorgen um fünf Uhr begann drin das Läuten, die Kanonenschläge aus Eisen Kartätschen und Granaten legten sich über das gräberübersäte Vorgelände, die armseligen Häuschen draußen, in die verzweifelte Söldner aus der Stadt geflüchtet waren, schoben sich blitzend über Mauern und Kirchen, sprangen mit Geröll und Gekrach auf die verriegelten Tore. Die gingen auf nach Süden, und ehe eine Bresche geschlagen war, ergossen sich die armseligen Söldner über die Brücke, ihr Leben rettend durch die Flucht, wateten durch die mörderische Kälte des Stromes, trollten klagend durch den Schnee, viele ohne sich umzublicken, bis die Kanonen hinter ihnen verhallten, auf Frankfurt zu.
Zersprengt die ruhmreichen Regimenter Sparr Wallenstein Götz Altsachsen. In der Mauer ein Loch so groß, daß zwanzig Wagen einfahren konnten. Hindurch warfen sich im Schwung die Schweden, sprengte die schnaubende Kavallerie, weg über die Toten im Mist, über die Häuser hin, über die Bewohner, an deren Leib und Gut sie sich sättigten, bis die Trompeten bliesen. Geschrei Geächz Gejubel zum Himmel auf am Tage der Geburt des heiligen Christkindes.
Das Tosen der Fremden hielt tagelang an, ganz Pommern hatten die Deutschen geräumt. Wie ein Tänzer, der auf der Zehenspitze steht und sich wie zum Hinstürzen schräg nach vorn fallen läßt, um im wilden Wirrwarr davonzurasen, so blieben die Männer von Götaland eine Woche in Garz und Greifenhagen; dann riß es sie über den pommerschen Boden, die flache breite Tenne.
Und in einem Sturz herunter nach Brandenburg. Der apathische Kurfürst Georg Wilhelm flehte, an seinem Land sei nichts mehr als Sand und Kiefern. Gustav richtete Kanonen auf Berlin. Den schwächlichen Schloßherrn ließ er zu sich in einer Kutsche ins Lager holen, dankte ihm für die endlich gefundene Entschlossenheit, und er werde ihm Gelegenheit geben, sich an dem Kampf für die evangelische Sache zu beteiligen, mit dreißigtausend Talern monatlicher Abgabe.
Der König erhob sein Herz. Sein Hauptquartier schlug er in Bärwalde auf. Sein Gesicht bekam Farbe. Er suchte Parteigänger.
Im Schlosse zu Upsala hatte er zwei Jahre zuvor zu acht Männern gesprochen: „Der Stein ist auf uns gelegt, daß wir den Kaiser entweder in Kalmar erwarten oder in Stralsund begegnen. Nun muß mein letztes und höchstes Ziel sein ein neues Haupt der evangelischen Christenheit, das vorletzte eine neue Verfassung unter den evangelischen Ständen, das Mittel dazu der Krieg. Zugrunde gerichtet muß der Katholik werden, sonst kann der Evangelische nicht bestehen; ein Vergleich oder Mittelding besteht nicht.“ Er hatte Männer und Kapital aus seinem Reich genommen, daß die Menschen in Ost- und Westgothaland und Swealand sich von Baumrinde und Eicheln nährten; den Alleinverkauf von Getreide, ein Kupfer- und Salzmonopol hatte er an sich genommen, den Münzstand verwildert. Sein hahnenlautes Gekräh in Bärwalde: „Der König von Schweden ist hier“, lockte einen schuldenverkommenen verluderten deutschen Fürsten an, einen Landgrafen von Hessen-Kassel. Der verschwur sich, breitbeinig und feige vor dem lauernden König sich bückend, ihm seien seine Prozesse verdorben und verloren durch die Parteilichkeit des Kammergerichts gegangen; kein Recht hätte mehr der Evangelische im Reich. Der König, die Verlogenheit des bramarbasierenden Schlemmers vor sich erkennend, versprach mit tränenden Augen, empört zitternder Stimme, sich des Hilfeflehenden anzunehmen zur Ehre Gottes und zur Verteidigung unschuldig bedrängter Christen. Sie gingen nicht auseinander, ohne daß der Landgraf einen Geldvorschuß vom Schweden annahm unter ehrfürchtigem Speicheln vor dem ritterlichen Amt des Eindringlings, dem er versprach, das Hessenvolk gegen den Kaiser rebellisch zu machen. Wogegen ihm der leutselige Fremde das Fürstbistum Paderborn, Höxter, das Eichsfeld, Hersfeld, in baldige Aussicht stellte. Trunken zog der Hesse ab.
Eine geängstigte Sondergesandtschaft der alten Stadt Magdeburg lief ihm auf dem Wege unversehens zwischen die Beine; er führte sie im Triumph selbst in das Haus des schmerbäuchigen frommen Schweden, von dessen Lippen noch einmal Lobsprüche ableckend, ehe er sich in sein Land verkroch.
Den Magdeburgern hatte der Hesse das Herz schon mutiger gemacht mit seinem verführenden Jubelpreisen des Messias aus dem Norden; lecker rückten sie an vor ihm, der noch seinen Zorn ausschrie über das Unrecht, das der Hesse erfahren hatte. Sie standen zu fünf nebeneinander. Und nun erst, wo sie die sanfte unverständlich sprudelnde Sprache der Türhüter, des einführenden Kämmerers hörten, fuhr ihnen ein kaltes peinliches Gefühl über die Haut. Sie verloren ihre Angriffskraft und brachten es auf das Zureden des listig sie anblickenden mächtigen Mannes auf dem Sessel nur zu matt gezimmerten Wendungen. Nur einem unter ihnen, einem jungen Habenichts, gelang es, über sein Unbehagen hinwegzukommen; er floß über von Scheltreden auf die Ligisten, den weiland Friedländer und sein Pack, stimmte ein, als jener liebreich nach dem Römischen Kaiser fragte, daß der nichts sei als ein gierig weites Maul, und das sündhafte Restitutionsedikt das Tranchierbesteck, mit dem er sich den Braten zurecht machen wolle.
Die Worte fand der rot werdende Gustaf verständig, schrie wieder des Hessischen Unrecht aus, und nach zehn Minuten standen da im hitzigen sich steigernden Wechselgespräch die fünf Männer mit geschwollenen Köpfen, schmähend auf den Römischen Kaiser, den blinden Hund, schändlichen volksverräterischen Papisten, gestikulierend, triefend vor Genugtuung, sich gegenseitig anrufend ermahnend, und ihnen korrespondierte das aufgewühlte schwerblütige Geschöpf aus Schweden, der überseeische König, der gierig den Kaiser schwur anzupacken gerade wie ein Hund den andern, bei der Schnauze, der Flanke, ihm die Seite aufzureißen, den Kiefer zu brechen für alle Schmach, die er der evangelischen Brüderschaft angetan habe. Ihre brühende Hingerissenheit verdampfte und sie spuckten noch; der König freute sich satt. Er dankte ihnen. Sie würden voneinander nicht lassen. Er schickte ihnen einen gewandten jungen Menschen mit, der ein unwiderstehliches Mundwerk hatte, Stallmann, der die alte Stadt Magdeburg in den Rausch der nahenden Befreiung setzen sollte. Die fünf zogen mit ihm, wie königlich belohnt, ab.
Gustaf Adolf saß noch am Abend, wie sie ihn verließen, mit dem hinkenden blassen Grubbe und einem kahlen Riesenschädel, Oxenstirn, dem Kanzler, zusammen, prustete, schäumte. Sein Werk gedieh. Die Magdeburger wollte er nicht lassen. Lachte, grölte: trefflich hätte der Kaiser sie malträtiert, das Diversionswerk Magdeburg sollte geschmiedet, die halbe kaiserliche Armee daran gebunden werden, inzwischen werde er sich auf Frankfurt werfen. Auch Oxenstirn hegte volles Vertrauen auf die evangelische Festigkeit der Magdeburger, seufzte hoffnungsfreudig über Stallmann.
Noch in diesen Tagen beschlich den König in Bärwalde der Mann, den er lange erwartet hatte, der glotzäugige rotbäckige aus Bayern flüchtige Charnacé. Der Franzose fuhr ihm mit einem Jubelschrei an die Brust; nun sei endlich die Stunde da, wo er auf dem Boden des verruchten heimtückischen gewalttätigen Deutschland neben einem anderen Fremden stehe. Ja, sie stünden hier im Deutschen Reiche; der Kaiserliche sei von seinem Boden geflohen und er sei glücklich und freue sich, freue sich. Und er wiegte sich in den Hüften, öffnete liebevoll demütig die Hände vor dem König. „Ich bin,“ tat Gustaf grimmig, „nicht wie eine Maus an diese Scheuer gekrochen, um drin fremdes Korn zu beknabbern, sondern Ordnung zu schaffen und zerrissenen Glaubensverwandten zu helfen.“ „Unermeßlich ist die Grausamkeit Habsburgs, Mörder und Totschläger sind seine verhungerten Soldaten. Wir wollen helfen, das Reich von dieser Plage zu befreien. Rechnet auf uns.“ „Ihr seid katholisch. Hä! Ich mag die Katholischen nicht.“ „Wir lieben Euch, Majestät von Schweden. Ich kann nur jubeln vor Euch, seht mich an. Was kommt es jetzt darauf an, ob katholisch oder evangelisch. Ihr steht in Pommern; wir betrampeln deutschen Boden, ohne daß es uns einer verwahren kann. Wir schlucken ihre Luft. Wenn Ihr Trompeterkorps Trommler habt, laßt sie schmettern und schlagen, schwedische Weisen; ich will Franzosen heranholen, daß sie blasen, man soll hören: Fremde sind im Heiligen Römischen Reich; der Habsburger sitzt in Wien: er soll kommen, uns verjagen.“ Gustaf staunte: „Habt Ihr einen abgründigen Haß, Herr.“
Dann begann das Feilschen; Soldaten hatte der Franzose nicht, aber Geld. Er leitete die Unterhandlungen ein mit dem grinsenden Hinweis auf seine Schlauheit; es sei ja im Regensburger Vertrag geschrieben, Frankreich dürfe keinen Feind des Kaisers unterstützen. Und er täte es doch. „Aber“, dabei lachte er wie ein Narr, „heimlich!“ Wenn er sagte „hunderttausend Reichstaler“, schrie der König „nicht genug“. Sagte er „zweihunderttausend“, „nicht genug“. Gustaf Adolf neben dem Riesenschädel Oxenstirns trieb den Franzosen höher und höher, schwur, er verkaufe seine Seligkeit nicht so billig, wenn er einen Papisten an sich hänge, müsse mehr haben dafür. Auf vierhunderttausend Reichstaler kam der Franzose. Da hatte der Schwede genug. Soviel sollte ihm der Franzose, lachte er mit Wonne, jährlich beisteuern, damit er den Götzendienern den Garaus machen könne und zuletzt vielleicht ihm selber, dem zarten Franzosen. Er wolle dreißigtausend Mann zu Fuß bereit halten, dazu sechstausend Reiter. In lärmender Freude, Hohn im Herzen schied man voneinander.
Und wie der Hesse die Magdeburger geführt hatte, lockte der Welsche die Holländer hinter sich. Fast versprach sich Charnacé, als er mit der holländischen Deputation tuschelte: „er ist ein Tölpel,“ wollte er sagen, „man muß ihn vorsichtig nehmen, er ist verbissen in seinen evangelischen Aberwitz, man darf ihn nicht stören.“ Dann fiel ihm ein, daß er Protestanten vor sich hatte, und schaukelte sich vergnügt neben ihnen: auf ganze vierhunderttausend Reichstaler hätte ihn stolz der Schmerbauch getrieben; fünfhunderttausend, nein, eine Million hätte er bieten können. Seien sie gewarnt. Sie dankten mürrisch, mißtrauisch ließen sie ihn nicht zu den Verhandlungen zu; die Hochmögenden im Haag zahlten dem Schweden soviel sie vermochten, weil es ihr Glaubensverwandter war.
Die Schweden hatten bei Greifenhagen am Sieg gelutscht, Stiefeln Brot Bier Geld strömte ihnen zu, man hatte nicht Lust zu verweilen, schob sich über Neu-Brandenburg, Klempenau, Treptow auf Demmin an der Mecklenburger Grenze, zwischen Morasten gelegen. Der römische Herzog Savelli, der den päpstlichen Dienst quittiert hatte, schlemmte hier. Den Bauern pflegte er die Pferde vom Pflug zu nehmen, um die Haut an den Schinder zu verkaufen. Nach drei Tagen Kapitulation. Der Schwede sagte lustig im Zelte dem Italiener, er bedaure, daß er zu Rom seinen herrlichen Posten verlassen habe. Dann, nachdem er trompetenblasende Abordnungen mehrerer Regimenter versammelt hatte, ließ er den eleganten Herzog mit goldenen Ketten, langem Zobelpelz, prächtigem ins Gesicht gezogenen Federhut vor einen Pflug spannen; ein aufgegriffener Bauer mußte ihn anzäumen. Die Soldaten trommelten, Hunde sprangen über den keuchenden Herzog, eine Pferdehaut mit Hufen und Schwanz wurde von rückwärts über seinen Prunk gebunden, er stürzte zusammen. Der König stand auf, die Knechte schwangen die Peitschen: „Mag sich das Fell seiner erbarmen. Pflüge! Pflüge!“
Auf das Gerücht von dem landfreundlichen Vorgehen des überseeischen Söldnerführers sammelten sich an der Brandenburger Grenze, aus der Gegend von Schwedt und dem Finowkanal, Bauern, zogen in dichten Rotten und Fahnen dem König nach, den sie bei Anklam im Schneesturm mit seinem jubilierenden Heere stellten. Er wollte wieder südwärts, auf Kurbrandenburg. Die zehn alten Männer, die mit drei buntbemalten Fahnen demütig vor ihm standen, blickte von seinem ungeheuren Streitroß Gustaf freudig an, gedachte eine evangelische Gesandtschaft zu begrüßen. Er war so ungeduldig, zu hören was sie hatten, daß er ihnen nicht nachgab, sie im Quartier anzuhören, sondern sofort auf durchwehter kahler Landstraße zwischen dem Rollen des Trains und dem Flöten und Klappern der Soldaten. Sie mußten mehrfach die Plätze wechseln, weil der König sie nicht verstand, Dolmetscher dazwischen liefen, der Schnee ihnen in den Mund stäubte. Wenn der fremde König denn sich so der Bauern annähme, wie er vor Demmin an dem Landesverderber Savelli gezeigt hätte, so möchte er an sie denken. Und dann zählten sie ihre Leiden auf; das Pferd des Königs bäumte sich, Gustaf tauschte zornige Blicke mit seinen Begleitoffizieren. Mit einem Fluch warf er seinen Reitstock auf den Boden. Er zwang sich zur Ruhe, bückte sich herunter, als man ihn wieder aufhob, schrie dicht bei ihnen, ob sie evangelischen Glauben wirklich hätten, wie sie vorgäben, ob sie ihn nicht belögen, nicht wüßten, daß der Heiland für sie am Kreuz gestorben sei, aber nicht, damit sie das heilige Bekenntnis wie ein faules Stück Fleisch wegwürfen. Sie beteuerten, sie seien fromme lutherische Christen, aber sie verkämen, verhungerten mit Weib Kind und Vieh, wenn noch ein Heer in ihr Land fiele; baten mit aufgehobenen Händen ihn um ihres gemeinsamen Glaubens willen um Verschonung mit dem kriegerischen Einfall. Er wütend und speiend, sie umkreisend. Sie verstanden nicht, was er sagte, im Toben stotterte er mit gedunsenem Gesicht schwedisch; er hätte sein Volk geplündert, um den alleinseligmachenden Glauben zu bewahren, für sie an erster Stelle, und sie bettelten bei ihm. Sein Pferd sprang um sich; er ließ sie nicht von der Stelle. „Herr, wir sind fromme evangelische Christen, der Krieg verdirbt uns.“ Da nahmen sich die Offiziere der Wut ihres Herrn an, der sich von ihnen nicht losreißen konnte; sie ritten auf die Bauern los, schlugen mit flachen Klingen auf ihre Köpfe. Gustaf selbst, sich befreiend, riß sein Pferd herum; und sein schweres kettenschaukelndes Tier zu langsamem Schritt gebändigt, stampfte zwei Bauern an; andere warfen sich in den Schnee. Er ritt davon, die Herren hinterdrein. Kreischend beluden sich die Bauern mit den getretenen Männern, die Fahnen zerschlugen sie: „Das ist kein Evangelischer, das ist kein Evangelischer.“ Kreischend marschierten sie Tag und Nacht durch die Dörfer. Jubilierend das schwedische Heer hinterher.
Der kleine eisgraue Brabanter war von Regensburg wie ein Glücksbetäubter aufgebrochen. Er hatte vor der Kriegsbühne gestanden, an dem Spiel neiddurchwühlt gemäkelt; durch einen Vorgang wie im Traum war er von seinem Platz bewegt, er, der Tilly, mitten ins Spiel gestellt. Der klagende strenge uralte Marbliß von Tilly regierte die ungeheure Szene von dem weithin sichtbaren Platze, gegen den sich eben Kurfürsten und Stände erhoben hatte. Er wollte nicht mehr Tilly sein, der dem quälenden bayrischen Maximilian unterstellt war; verwischt, versenkt der fabelhafte Feldzug in Ungarn, die Jagd hinter Mansfeld, gnadenlose Vertilgung der Rebellen, Verschlingen der Dänen. Die Taten Wallensteins liefen wie Doggen, die man tritt, neben ihm; eines Tages werden sie verrecken. Heimlich schwellte es ihn, als er nach Norden zum Heere fuhr, das ihm von Wallenstein überkommen war; die prächtigen sechzehnspännigen Karossen Wallensteins trabten durch sein Gedächtnis, rotjuchtenüberzogene Troßwagen in langer Reihe, silberne Partisanen der Leibgarde. Es labte ihn; dabei stieg hinterrücks ein unheimliches Gefühl der Ohnmacht über ihn, er suchte ihm bang auszuweichen.
Und wie er nach Norden vorstieß, wehten wilde Gerüchte um ihn; es wurde deutlicher: das schwedische Heer hatte sich spielend der Außenforts des Reichs bemächtigt, auseinandergestoben die Regimenter des Savelli. Das konnte wahr sein. Tilly rang mit sich. Seine Nächte waren durchtobt vom keuschen sorgenvollen Widerstreben gegen seinen Ehrgeiz, die Sehnsucht. Es hieß Farbe bekennen. Er war tief verstrickt in diesen Kampf. Die Gerüchte wehten an ihm vorbei. Er wollte ein frommer Christ bleiben, nicht rebellieren, wie es auch kam.
Und zittrig schwur der alte Wicht eine Stunde, sich im Zaum zu haben, schüttelte in der nächsten Stunde den Friedländer am Kragen, schwitzte vor Freude, war matt und arm.
Draußen unter den Schneestürmen begann es von Tag zu Tag lebendiger zu werden. Der Lärm war kriegerisch, Reiter, Wagen, schreiende Marketender; einmal kämpfte die Begleitung des Brabanter mit bewaffneten Wegelagerern.
Da mußten die Vorhänge des Wagens geöffnet werden. Auf der Chaussee, auf den Feldern: es hatte sich etwas begeben!
Da lag nicht nur Schnee! Zertrümmerte Fähnlein schamlos unter ihren Führern vorbei! Bauernhöfe, vor denen Kanonen standen, riesige Rohre auf Wagen, um die sich keiner kümmerte. Diese Welt; es hatte sich etwas begeben. Der Schwede hat sich der Außenforts des Reichs bemächtigt, er steht bei Frankfurt.
Wo stehen die Wallensteiner? Wo ist Savelli?
Überall Verhungerte, aufgelöste Verbrecherbanden. Sie wollen ins Reich; hier ist alles kahl gefressen; der Schwede ist hinter ihnen. Den Herzog Savelli hat der Schwede bei lebendigem Leib geschunden, aus Rücken und Brust Riemen geschnitten. Bei Stettin steht kein Wallensteiner mehr, in Mecklenburg haust der Schwede, aus Brandenburg läuft alles davon.
Die Vorhänge blieben offen. Wimmelnde Felder. Rotten von versprengten Wallonen, Musketiere, die ihre Gewehre verkaufen. Sie gehorchen nicht; Weiber — wessen Frauen und Töchter —, Kühe, Ziegen treiben sie, die verruchten Wallensteiner. Schwappen, wie er sie angreifen will, ins Reich zurück, an ihm vorbei. Wie Sand durch Fugen, sind nicht zu stopfen. Als hätte der teuflische Friedländer, bevor er das Haus verließ, alle Balken eingesägt, Fundamente mit Pulver gelockert, Wände durchstoßen. Der Brabanter, mit Abscheu Entsetzen gefüllt, wurde von seiner Karosse in diese brandenburgischen Gegenden gerissen, vor das widrige Zerstörungswerk des bösen ungeheuerlichen Menschen. Die Schweden auf Usedom; Stettin eingenommen, Schaumburgs Truppen in Görz, Greifenhagen verjagt; Demmin, Bärwalde. Nichts von Savelli, Torquato Konti, Schaumburg, die er anspannen wollte vor seinen Wagen.
Die Karosse, vom Strom der Flüchtenden zur Seite getrieben bei Brandenburg, hielt. Er sah: das war das Ende, stand im Schnee, war allein, der Feldhauptmann des Kaisers und der Liga. Vor dem sich Europa beugen sollte. Zerrissen lag er einige Tage im Brandenburger Schloß. In schwerer Erschütterung trug er sich herum; inwendig ausgekühlt unter der Niedertracht des Böhmen. Er suchte sich zurück. Kaum ein einziges Regiment fand er kriegsbrauchbar; die Verwüstung der alten Armee, seiner Armee, war bis ins einzelne gegangen. Noch sangen sie rechts und links Lieder vom Friedländer.
Er begann sein altes kleines Handwerk. Um Truppen zu haben, schleppte er seine eigenen herauf; drei Regimenter aus Oldenburg und Ostfriesland, sechshundert Reiter. Stumpf erwartete er sie. Und wie sie anrückten, war keine Nahrung für sie, kein Futter für die Pferde da. Kaum seiner Sinne mächtig, schrieb er; seine sehr matten Hände schrieben dem Bayern, dem bayrischen Maximilian Briefe wie früher; die Bundeskasse mußte um Hilfe angegangen werden; abgezählte zweihunderttausend Gulden schickte man herauf. Die Maschinerie arbeitete wieder, die Truppen waren da, da lagerten sie, sie wollten Futter Heu Brot. Aus Mecklenburg war nichts zu holen: Wallenstein, kam es zurück, hatte in sein Herzogtum Beamte seiner böhmischen Verwaltung geschickt, die an sich nahmen, was nicht niet- und nagelfest war; es konnte ihn keiner mehr beerben.
Vom Zorn angestachelt fand der Brabanter seine alte Zähigkeit und Klarheit wieder; er wollte hier im Eis nicht zum Gespött verkommen. Mit Sack und Pack rückte er gegen den König vor, reizte ihn zum Kampf. Der König wich aus, wich nach Pommern zu. Tilly gab nicht nach. Es mußte gefochten, geschlagen werden.
In der alten festen Stadt Magdeburg verpesteten Stallmann und der neu entsandte Falkenberg, Gustafs Hofmarschall, die Luft mit Lästerungen des Kaisers, Triumphliedern auf den Erretter Gustaf Adolf, solange, bis alles, was evangelisch und eigensinnig in der Stadt war, zu den Schweden schwor und ihnen glaubte: der König kommt bald.
Der Raufbold Graf Pappenheim, dessen Gesicht eine einzige Narbe war, der in der Schlacht am Weißen Berg für tot unter Leichenhaufen gelegen hatte, umzingelte die Stadt, knirschte sie in seine Arme hinein. Sie weigerte sich, kaiserliche Besatzung aufzunehmen. Der Graf vermochte allein nichts gegen die Stadt; er rief nach seinem Herrn. Der Brabanter ließ den Schweden. Er schwenkte. Langsam trollte er auf Magdeburg. Man sollte nicht über ihn spotten. Warnte voraus die Stadt im guten: „Man hat fremde undeutsche Potentaten ins Reich gelockt. Sie treten auf unter einem glänzenden Vorwande, als wenn sie Glaubensgenossen Beistand leisten, die deutsche Freiheit und Libertät verteidigen wollten. Und was dergleichen Redensarten sind. Sie suchen nichts als eigene Herrschaft; werfen Fürsten, Herren und Städten das Joch der Knechtschaft über den Hals.“ Drin änderte sich nichts. Rückte mit vielem Geschütz und großer Macht vor die Stadt; nach sieben Tagen waren alle Schanzen vor der Stadt im Sturm erobert, oberhalb Magdeburg eine Brücke geschlagen. Ein kaisertreuer Alter Rat drängte zu kapitulieren, in der Stadt hielten sich Innungen und Gilden bei den Hälsen; eisern arbeiteten Stallmann und Falkenberg gegen den sinkenden Mut; auf die Kirchtürme lockten sie zweifelnde Räte, zeigten in der Ferne Feuer und Rauchwolken, die vom Schwedenlager aufsteigen sollten, lasen in den Stuben erlogene Briefe des Königs vor, mieteten zum Schein schon herrliches Quartier für ihn. Denn ihre Order lautete: die Stadt muß den kaiserlichen Feldherrn fesseln, bis der König mit Brandenburg fertig geworden ist und genugsam Truppen hat; jeder Tag ist gewonnen.
Stallmann, ein listiger langleibiger Mensch, machte sich rechtzeitig an die verwilderte Gilde der Schiffer und Fischer heran, die rebellisch in der Stadt herumlungerte, von ihm Lohn empfing. Er stachelte sie damit: die Reichen seien wankelmütig, wollten nur ihr verruchtes Regiment vom Kaiser stärken lassen, fürchteten die Gerechtigkeit des Schweden. Da fand man täglich Drohbriefe an gewissen Häusern, Überfälle, Totschläge fanden statt. Stallmann hatte die Stadt in der Hand; Falkenberg redete pathetisch im Rat: „Haltet aus! Habt Geduld!“
Prangend die alte feierliche Stadt am mächtigen Elbstrom, von einem starken begrasten Wall hinter dem Graben umgeben. Vom Sudenburger Tor quer durch die Stadt der köstlich gezierte Breite Weg, an den hohen Türmen des Kröckentors endend; zu beiden Seiten Gewimmel von Gassen und Märkten entlassend. Nahe dem Sudenburger Tor und der düsteren Pforte der riesige Neue Markt, an dem sich die Gewalt der Domkirche erhob, die königlich hinüberblickte zu den Spitzen der andern Kirche Sankt Sebastian, Peter Paul, Sankt Katharina, Sankt Jakob, Sankt Peter, Sankt Johannes, Sankt Ulrich, Sankt Nikolai.
Und als Stallmann und Falkenberg sahen, daß ihr König nicht herankam, weil er gebunden war in Brandenburg, faßten sie, abgesperrt von ihm, aber seinen Gram mitfühlend, den Entschluß, ihm zu helfen wie sie konnten. Magdeburg war nichts, die deutschen Bürger jämmerlich verzagtes Lumpenpack. Sie sollten nicht die Freude haben, sich und die schwedische Sache an den kampflüsternen Tilly zu verkaufen, so daß alles umsonst wäre, alle Hoffnung ihres Königs, ihrer Männer, umsonst wäre Schweden geplündert worden, umsonst Borke von Bauern verschlungen von guten Schweden. Solche Erbärmlichkeit sollte dem kläglichen Gesindel, das sich Sonntags evangelisch gebärdete, nicht gestattet werden.
Am Elbstrom, dicht vor dem Kirchhof von Sankt Johannes, lag das Fischerbollwerk und Fischerufer mit den Häuschen der Gilde. Den gefährlichsten unbotmäßigen Gesellen von ihnen, den kahlköpfigen heiseren Hartmann Wilke, kaufte Stallmann. Sie wurden Brüder; seine eigene Magdeburger Liebste, ein ehrsames Fräulein, zwang Stallmann, sich dem rohen Wilke in die Arme zu werfen. Wilke hatte bald seinen Spaß daran, daß die Stadt sich nicht würde halten können; hereinkommen sollten nur die Kaiserlichen, verwüsten sollten sie, was die reichen Stände zusammengeschart hatten: er würde sie nicht daran hindern; aber er und seine Gildeverwandten, dazu die wilden Brüder aus der Diebshenkergasse, würden helfen. Unmittelbar am Bollwerk beim Breittor waren die Pulvermassen im Pulverhof aufbewahrt; es vergingen nicht acht Tage, Tage der zunehmenden Verwilderung unter den Städtern, daß zahllose Tonnen Pulver verschwanden aus den Magazinen, die Vorräte verteilt an die entschlossensten gehässigsten Gesellen.
Ein blauer süßer Maientag kam heran. Der Himmel prangte in Sanftheit, alles war zum Leben hingebreitet. Da trug sich vom Neuen Werk her bei Sankt Jakob das knurrende Untier aus der unkenntlichen Finsternis der blütendurchhauchten trunkenen Nacht an den Wall heran, zerbrach mit den Klauen Pfoten Bollwerk und Rondells, klatschte mit Ruck und Schwung seinen bunten prallen Leib mitten auf die morgenlich leeren Straßen, in denen hie und da einer gähnend die Fensterladen aufstieß, ein Mädchen im Vorgarten seine Blumen begoß. Mitten auf die Straßen.
Minutenlang lag es wie verzaubert still, öffnete dann das Maul zu dem herzlähmenden vereisenden Gebrüll. So daß die Menschen ihre Stunde wußten.
Nach wenig Zeit sollten sie alle bis auf einen kleinen Rest, Männer Frauen Kinder Kaisertreue Wankelmütige Herzhafte Alter und Neuer Rat als sonderbar stille Kadaver auf der Erde, in den Stuben Kellern liegen mit trüben fragenden lächelnden bittenden verzweifelten Grimassen, in tollen ungekannten Stellungen, nachdem ihnen ihre Seelen entrissen waren, wie man einem Hahn den Kopf abreißt. In die Elbe gestürzt auf Karren Betten Wagen, was nicht auf Böden und zwischen Hafentrümmern faulte.
Als der riesige Kürassier Pappenheim, Todesverächter seitdem er Mensch war, mit den Regimentern Gronsfeld, Wenglas, Savelli das Neue Werk auf Leitern erstiegen hatte, durch das Stücktor in die große Lakenmachergasse gestürzt war, blies der Küster auf Sankt Jakob Sturm, hängte eine schwarze Fahne heraus. Mit Springstöcken liefen schon kaiserliche Pikeniere, rote Feldbinden, die Lakenmachergasse herunter, über den Weinberg, durch die Gärten. Ihr Geheul, blutdürstige Gesichter: „All gewonnen, all gewonnen!“
Die Türen sprangen auf; die ersten Menschen niedergestoßen. Der Strom der Kaiserlichen wurde von rückwärts gespeist; in kochender Lavaflut überwallte er die Straßen. Vom Alten Markt zogen ihm fünfhundert kaisertreue Bürger, die rote Feldbinde schwingend, Weiber und Kinder in der Mitte, entgegen. Waren im Augenblick von Kroaten und Wallonen bäuchlings rücklings seitlings hingestreckt und zertreten.
Sie ritten schon, schwangen von oben die Klingen. Am Neuen Markt fluchte Falkenberg unter dem Sturm von Sankt Jakob auf die schreienden Räte und Innungsmeister, die über ihrem Gezänk die Gräben hätten vertrocknen lassen. Sein Knecht schnallte ihm, während er ungeduldig stand und sich bewegte, Halsbrünne und Beinschienen um; den eisernen Topfhelm riß ihm Falkenberg aus der Hand, er entglitt ihm, klirrte auf die Steine. Der Schwede wechselte, die Faust gegen sie aufhebend, zehn leise Worte seitlich mit dem langen springfertigen waffenlosen Stallmann. Wie Falkenberg mit hundert Reitern gegen die Kaiserlichen vorstieß, hallte schwedisches Feldgeschrei unverhüllt und stolz im Breiten Weg. Viermal rannte er an, tausend Kaiserliche wurden erschlagen, nahe dem Stücktor krachte er stöhnend unter Musketenschüssen vom Pferde; das Tier bockte, schleifte ihn im Steigbügel im Kreis herum. Sein Herz im Sterben erzitterte vor Freude, weil er sah, wie an der Mauer die bettelnden Bürger gespießt wurden und ein dünner Qualm von allen Seiten wehte.
Denn zwischen schweren Reitern Pikenieren Musketenträgern flitzte vom Fischerufer und Fährgarten massenhaft lumpiges unheimliches Pack, kleine Säcke und Taschen auf Schultern Armen, erbrachen Häuser, ehe die Sieger eindrangen, stießen mit Dolchmessern beiseite, was sich in den Weg stellte, schütteten in die leeren Dachböden, in die Keller Pulver. Feuer, kleine Explosionen in allen Stadtteilen.
Flammen, Flammen, Flammen, Flammen, Flammen.
Stallmann schlug sich keuchend mit Wilke durch Bürger und Soldaten, Pulver werfend, die Kirchen sollten nicht vergessen werden. Raublüsterne Dragonerfähnlein rauschten prasselten durch die Straßen: „All gewonnen, all gewonnen!“ Die splitternden aufgeschmetterten Türen.
Rauch, beizender brodelnder unendlicher Rauch. Unter dem blauen Himmel, gegen den Himmel auf eine trübe weit auseinanderquellende Last, von Feuer durchzuckt. Der Qualm zischte schwarz auseinander, fiel in die Stadt zurück.
Vor der Domkirche lagen hundert Zentner Pulver; Wilke spannte die Zündschnur: ein Rittmeister stieß ihm den Säbel von hinten durch den Hals, daß das Blut neben der Kehle aus ihm stürzte und er nach kurzem Zucken auf den Mund fiel. Stallmann, gebückt mit der brennenden Lunte, wurde von Pferdehufen getroffen; wurde umgeworfen, von Kroaten gefaßt wurde er mit Stricken gefesselt, um vor den Profoß geschafft zu werden. In ein Haus am Neuen Werk geworfen sägte er den Strick an den Händen mit einem Glasscherben an, den er zwischen den Zähnen packte; ein glimmender Balken sengte den Rest durch, bis ins Fleisch brennend.
Am Abend plauderte Gustaf Adolf vor seinem Zelt mit Lars Grubbe. Mit wachsendem Staunen den feierlich übergluteten Himmel betrachtend. In der Nacht drang Stallmann zu ihm. Der König bei der Kienfackel aufstehend küßte ihn stumm, als er verwirrt geredet gejammert und geflucht hatte. Und wie sie vor dem Zelt standen, die Röte immer ungeheurer stieg, weinte Gustaf Adolf; in Wut schwur er: „Ich hoffe den Geier noch beim Aas zu ertappen und ihn zu packen, wenn ich gleich meinen letzten Soldaten dransetzen sollte.“
Pater Wiltheim ging mit Ordensbrüdern nach zwei Tagen durch das glimmende Sudenburger Tor in den Mauritiusdom. Wimmernde splitternackte Kinder, halbtote Frauen hingen auf den hohen geschnitzten Stühlen vor dem Chor, am Altar, im Schiff. Er wies sie, ein Dankgebet im Ornat sprechend, auf die Heiligenbilder, die allerseligste Jungfrau, den heiligen Mauritius, mahnte sie an ihren Abfall. Alle sprachen ihm den englischen Gruß nach. Soldaten, goldene Ketten um den Hals, Becher Schinken Kleider in Säcken, halbnackte Weiber treibend, grölten zum offenen Tor herein: „Vor Jahren hat die alte Magd dem Kaiser einen Tanz versagt, jetzt tanzt sie mit dem alten Knecht, geschieht dem alten Mädchen recht.“
Plötzlich saßen die evangelischen Kurfürsten und Stände in Leipzig und jubelten über ihre Stunde. Das Reich war bedroht vom Schweden, von einem fremden Einbrecher, der Kaiser in Gefahr, sie wollten ihre Rache nehmen. Mit ihren Hoftheologen zogen sie an, ihre eigenen Streitigkeiten begrabend. Der sächsische Prediger Hoe von Hoennegg eröffnete den Konvent mit den schallenden Worten des Psalmisten Assaph wider die Feinde Israels: „Gott mache sie wie einen Wirbel, wie Stoppeln vor dem Winde.“ Man blies die Backen auf; mit dem Schweden sollte der Kaiser gezüchtigt werden für seinen Übermut, das Restitutionsedikt, die Pression der friedländischen Soldateska. Man hatte keinen, keinen Grund, sich dem Schweden entgegenzustellen. Das war ein Krieg zwischen dem Kaiser und Gustaf Adolf; die Stunde der Rache war da.
Von Leipzig gingen entschlossene Briefe nach Wien: sie wollten von den großen unerhörten und ganz unerträglichen Drangsalen des Krieges befreit sein, wollten in Zukunft Kontribution Einquartierung Durchzüge nicht dulden. Man kicherte in Leipzig: wie soll der Kaiser Krieg führen, wenn man ihm Quartier und Kontribution abschlägt? Gegen die katholischen Kurfürsten hoben sie die Hände auf, warnten mit Kriegsvolk sie zu beschweren, unter welchem Vorwand auch immer. Man umarmte sich in Leipzig: dies hieße reinen Wein einschenken. Der Brandenburger und Sachse waren da mit vielen Ständen, man trank in allen Quartieren so viel, daß der schwedische Gesandte aus dem Lachen nicht herauskam. Die Deutschen aber saßen auf ihren Bänken und ließen sich bewundern wegen ihrer stolzen Briefe an den Kaiser. Wiederholten unter schwedischem Applaus nach Wien: was die Liga könne, könnten sie auch; wollten keinen, keinen in ihr Land lassen, würden sich ihrer Haut wehren.
Und damit gaben sie sich mutig eine Kriegsverfassung. Kursachsen begann ein Heer auf die Beine zu stellen. Viele Lobsprüche ernteten sie von Gustaf Adolf. Am Tage Palmarum redete noch einmal Herr Hoe von Hoennegg, mit Geschmetter preisend die tapferen Entschlüsse des Konvents, zeigend auf das gräßliche Geschick Magdeburgs, der stolzen evangelischen Hochburg, die der Papist eingeäschert habe in unbezähmbarer Wut. Umsonst aber werde er die Krallen auf die sächsische und brandenburgische Brust legen. Der hochbetrübten Kirche würden glückliche Stunden nahen. Dem allgemeinen lieben Vaterlande deutscher Nation sei der ewige Friede in Aussicht.
Zwei Sätze machte der Feldherr des Kaisers: einen nach Thüringen, den zweiten auf Sachsen.
Den ersten von Magdeburg auf Thüringen. Stadt und Land war kahlgefressen, brandverwüstet. Tilly suchte Entschädigung, weidete sein Heer in Thüringen. Jetzt erhob er schwere Kontribution, sah die Freude seiner Soldaten, wies die klagenden Bürger ab. Er kaiserlicher Feldherr. War schon verwittert, daß ihn der Fluchname Brandstifter nicht berührte; ja wehrte das Wort nicht ab; es labte ihn heimlich, weil niemand zu merken schien, welch Unglück ihn in Magdeburg betroffen hatte durch schwedische Infamie. Nicht einmal der Triumph der Eroberung Magdeburgs war ihm zugefallen. Kirrte in Thüringen den Landgrafen von Hessen, der einen großartig burlesken Widerstand gegen ihn inszenierte. Geschwollen rollten die vierundzwanzigtausend Mann auf Sachsen, hielten an der Grenze.
Tilly sah die Entscheidung kommen. Das eitle trotzige Benehmen des dicken sächsischen Bierkönigs reizte ihn. Wenn der Sachse so bliebe, er würde ihn binden. Von Süden strömten ihm neue guterhaltene Truppenmassen zu. Mit vierzigtausend Mann fing er über die Grenze eine Unterhaltung mit dem Sachsen an; hatte Vollmacht den Kurfürsten zur Vernunft zu bringen. Er fragte, wie es wäre mit den Reden, die am Tage Palmarum in Leipzig gehalten wären, wer die Stoppeln und der Wirbel wären. Der Kurfürst stammelte, man möchte gut zu ihm reden, sei des Heiligen Römischen Reiches Kurfürst.
Wer, fragte Tilly, kaiserlicher Feldherr, zurück, die Stoppeln und der Wirbel wären: wenn drüben des Reiches Kurfürst rede, ob hier nicht des Römischen Reiches Feldherr Wörtlein zu sagen habe.
Zu sagen, zu sagen! Er sei ein sanfter Landesvater, wolle sein Volk und Land vor den Pressuren und Qualen des Krieges bewahren; man verdenke es ihm nicht.
Sein Land ist Reichsland, wir müssen hinein. — Er möchte es nicht darauf ankommen lassen; man habe ein Heer, er wisse es vielleicht schon, aufgestellt, um sich zu schützen.
Her mit den Soldaten; es sind kaiserliche; der Kurfürst hat kein Recht auf Truppen.
Da zog sich Johann Georg Socken über die Füße, tapste nach Torgau. Klagte und plärrte unterwegs viel; sei der treueste Reichsfürst, ihm tue man dies an; was ihn die Händel des Kaisers mit dem Schweden scherten, wolle sie gewiß nicht stören. Und dieser Gedanke rührte ihn so, daß er noch einmal zurücklief an die Grenze Tilly gegenüber, ihm dies zu verkünden. Als wäre es eine Erleuchtung bedeutete er den Feldherrn; ihre ganze Unterhaltung sei verkehrt gewesen, vorbeigeschossen; denn worum drehe es sich? Doch nicht um den Kaiser und ihn, den untertänigen Sachsen. Sondern um den Kaiser und den Schweden. Den Schweden. Hallo, große mächtige Reichshändel zwischen der Römischen Majestät und der königlichen Würde aus Schweden.
Und? — Und? Vermöchte er, der beliebige Fürst, sich anzumaßen, sich in die Händel solcher Potentaten einzumischen und ihnen in den Weg zu treten.
Gewiß nicht, grunzte es von drüben. — Warum also wolle man es ihm verargen, wenn er seiner Wege gehen wolle.
Was, was wolle er mit seinem Heere. — Man lasse das doch mit seinem armseligen, unglückseligen Heerchen, es wäre ihm lieber, er hätte es nicht.
Also gebt mir euer Heer. —
Wieder wartete der Sachse, ob er mehr hörte. Zog sachte, ängstlich plärrend auf Torgau. Gustaf Adolf hatte sich mit kleiner Kavalkade da eingefunden, er empfing schmunzelnd in seinem Quartier den alten betrübten Herrn. Der jammerte, dies sei der Dank dafür, daß er sich neutral habe halten wollen. — „Habt Ihr das wollen?“ drohte mit einer sehr lauten Stimme der riesenhafte Schwede. „Nicht doch, nicht doch. Nur sozusagen, vor dem Kaiser. Wißt doch, was ich meine.“ Ratlos winselte der betrübte Mann.
Gütig gab ihm der Schwede zu verstehen, es sei das beste, gerade Wege zu gehen; man könne nicht dem Kaiser dienen und der evangelischen Kirche Beschützer sein wollen. — „Er hat mich nie angegriffen.“ Grob der Schwede: „Also rund: was hat der Herr vor?“ Nach langem Drücken brachte der Sachse seinen Kummer heraus: ob Gustaf schon vernommen habe, daß der Kaiser ihm Meißen, Naumburg, Merseburg abnehmen wolle auf Grund des Restitutionsedikts. — Kalt bejahte der Schwede. Die Finte stammte von seinen Unterhändlern. — Traurig legte Johann Georg seinen Kopf auf den Tisch, weinte. Er saß rechts und links in der Klemme.
Man brachte Bier, um ihn zu besänftigen. Er schwur Stein und Bein, daß er treu zum Kaiser gestanden habe und dies nicht verdient habe. Vom Schweden und seinen zudringenden Begleitern wurde ihm auseinandergesetzt, daß Tilly nichts weiter vorhabe im Augenblick, als ihm die Stifter wegzunehmen. Lange zögerte Johann Georg. Man gab ihm viel zu trinken, um ihm den Entschluß zu erleichtern. Plötzlich stand er auf: Zum Schaden den Spott wolle er nicht tragen; er wolle später nicht mit Schimpf in der Geschichte seines Hauses genannt werden; man solle ihm noch einmal sagen, was der Kaiser von seinem Besitz fordere. Wortlos schüttelte darauf lange Minuten der Sachse den dicken Kopf unter der Pelzkappe, während er starr vor sich glotzte: „Es soll ihm nicht gelingen!“ Den begleitenden Herren seines Hofes rief er zu, ob sie gehört hätten; ihr Vaterland sei in Gefahr; die evangelische Sache werde bedroht. Lebzelter brachte ihn zu Bett.
Am nächsten Morgen schloß er, den die Unruhe um seine Treue zum Kaiser und um seine Stifter die Nacht schlecht hatte schlafen lassen, mit dem Schweden einen Vertrag. Mit resignierten Blicken erklärte er seinen Räten: es sei dahin gekommen, daß er sein Haus gegen den Römischen Kaiser verteidigen müsse. Sie bestätigten es; Gustaf Adolf hatte ihnen goldene Ketten und Geld geschenkt.
„Wie ein Mann wollen wir zusammenstehen“, sagte Johann Georg zum Schweden, als sie sich die Hände reichten. Rührungstränen vergoß der weiche Sachse, segnete beim Abschied den Schweden.
Der stand mit Oxenstirn, einem kümmerlichen Menschengestell, das ein Schädelmonstrum auf dem Hals vorsichtig balancierte, und dem hinkenden Grubbe, seinem Sekretär, hinter der abfahrenden sächsischen Karosse. Schaute die beiden abwechselnd an, perplex. „Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Der Kursachse hat sich mir verschworen? Ist es wahr?“ Und dann ins Haus steigend: „Ich hätte eher geglaubt, der Bayer verbündet sich mit mir als der Sachse. Was hat er denn für einen Vorteil davon?“ „Aber Meißen, Naumburg, Merseburg!“ „Mein Gott, Allmächtiger. Er fragt nicht einmal nach beim Kaiser, er glaubt es mir!“ Grubbe grinste: „Eure Majestät wirken sehr überzeugend.“ „Oxenstirn, was sagt Ihr dazu. Er glaubt das mit Meißen. Ist die Welt verrückt?“ „Wir können ruhig sagen, Eure Majestät ist von Gott gesegnet. Ihr könnt füglich noch ganz andere Sachen sagen, man wird sie glauben.“ „Da fährt er hin. Erlaubt, Herren, ich muß mich erst beruhigen.“ Grubbe kraute sich am Kinnbart: „Wenn man es recht ansieht: was bleibt dem Sachsen weiter übrig als Euch zu glauben. Wir hätten ihm die Insel Bornholm anbieten können; er hätte es glauben müssen.“ Der Schwede staunte noch: „Um dreier Stifter willen fällt ein deutscher Kurfürst von seinem Kaiser ab und verrät ihn. Was für ein Reich.“ „Längst reif, von schwedischen Händen auf seine Baufälligkeit geprüft zu werden.“ „Oxenstirn, der Sachse macht mir Mut. Es ist eine Freude, im Reich zu sein. Melde nach Haus: unsere Sachsen stehen gut, — besser als ich ahnen konnte.“ Sie stiegen in ihre Wagen, lachten Tränen zu dritt als Oxenstirn meinte: „Es läßt sich schön arbeiten in dem Wald, wo die Bäume laufen und betteln: Holz uns doch ab.“
Es waren heiße Sommertage. Dem Brabanter entgegen wälzte sich mit vollkommener Ruhe Gustaf Adolf. Über Frankfurt nahm er seinen Weg, in der Stadt verschüttete er an einem Tage sieben kaiserliche Regimenter zu Fuß, eins zu Pferde. In seine Hände fielen einundzwanzig Kanonen, sechsundzwanzig Fahnen, neunhundert Zentner Pulver, zwölfhundert Zentner Blei, siebenhundert Zentner Lunte, tausend eiserne Kugeln. Siebzehnhundert Leichen waren zu begraben.
Er war schon kein schwedischer König mehr. Seine Stimme ertönte metallisch von dem Religionskrieg, den er führte. Man möge zu ihm kommen wie der Sachse Brandenburger und Pommer gekommen wäre. Die Stunde der Abrechnung mit dem katholischen Übermut war gekommen. Herrisch trieb seine Stimme, trieb zu Wut und Angst. Den Nahesitzenden, Geistlichen und Weltlichen jagte er Schauer von Zorn über. Sie wurden, erst fade lächelnd, dann verstört schwankend aus ihren Höhlen gescheucht, legten die Hände suchend an ihre Degen, mühten sich den Rumpf gerade zu halten und ihm entgegenzugehen. Gerächt würden werden die Menschen — dröhnte es von drüben —, die armseligen, die in Magdeburg dem Feuertod durch Tilly übergeben seien. Die Pfälzer, deren Land verwüstet sei. Die beklagenswertesten aller Geborenen, die Böhmen, die gefoltert und gepeinigt würden, ihre Habseligkeiten verloren, ihre liebe Heimat verlassen mußten, Böhmen. Man werde als evangelischer Christ dies Land nicht vergessen, solange es einen reinen Glauben gebe, werde des Scheusals nicht vergessen, das sich der Kaiser aus diesem Land gezogen habe, damit er das Reich zu einem Höllenpfuhl mache, des Friedländers, der bis nach Dänemark seine Untaten trieb.
Mehr und mehr kamen aus den Höhlen, schwankten in sein Lager.
Wie er sich auf Wittenberg schob, hatte sein Heer dreißigtausend Mann zu Fuß und fünftausend Reiter. Und zahllose davon waren Deutsche. Liefen mit dem Schweden, weil er viele Städte erobert hatte, mit gutem französischen Geld zahlte.
Er war so dick und schwer in seiner Rüstung, daß es im ganzen Heere nicht fünf Pferde gab, die ihn tragen konnten. Streng und bigott war er. Bigotterie gehörte zu seiner Geradheit, Entschlossenheit, Wucht. Er dachte nicht nach, glaubte an Luther und das Evangelium so stier wie an die Festigkeit seines Streithammers. Kannte keine Furcht vor irgend einer Überlegenheit.
Aber auch der gespenstige kleine Brabanter, der die Saale überschritt gegen ihn her, kannte sie nicht. Er hatte einen tiefen Ekel vor dem Mann, der die Religion ohne Unterlaß im Munde führte und ohne Unterlaß den frommen katholischen Glauben schmähte, er, der Kriegsmann, den es anwiderte, daß der andere kein ehrlicher Krieger war. Er sehnte sich, ihn zu beseitigen, drängte heftig vor. Nie hatte er, in keiner früheren Schlacht, solch heftiges Verlangen gehabt, seinen Gegner zu schlagen. Wie er einfältig nach Wien berichtete: dies sei kein rechter Feind. Genoß die Freude, seinem Herzensdrang ungesäumt nachzugeben.
Die Höhen nördlich Breitenfeld bezog er unter Trommelschlag und klingendem Spiel mit seinen Massen. Sechzehn Regimenter zu Fuß, sechzehn zu Pferd zog er hinauf. Der Schwede und Sachse kamen an.
Sie konnten nicht rasch genug ihr Blut mischen.
Von morgens neun bis mittags vier wurden achttausend zu Leichnamen aus Tillys Soldaten, fünftausend aus den schwedischen und sächsischen gemacht. Unter den schweren Kürissern zerriß sich vor Kriegswut Gustaf Adolf, sein ungeheurer Gaul mochte ihn tragen wohin er wollte. Ihm war die Welt versunken. „Gott mit uns“, schrie er automatisch, sein Schwert raste, hatte teil an seiner Bestimmung. Das Leben der Leichen stieg stürmisch in ihn über, machte sein Gehirn trübe und trunken, dehnte ihn zum Klagen und Platzen. Er prustete im Schlachten, wieherte wie ein Hengst. Sein Schwert kämmte, er kämmte die Kaiserlichen, war ein Barbier. „Gott mit uns“, brüllte er. Die Leben blühten ihm erstickend zu, er konnte sich ihrer nicht erwehren, es war zuviel. Kanonenkugeln sausten über ihm; eine fegte ihm den weißen Hut mit der dicken grauen Feder ab; er atmete tief den Luftzug, der mit ihr kam; wenn bald wieder einer käme.
Sie schlachteten sich mit großer List ab, suchten sich den Wind abzufangen, um den andern vom Staub blenden zu lassen. Als ein einziger mächtiger Klotz auf spanische Art gefügt, stand Tillys Heer da, das Treffen zehn Glieder tief, gespalten in sehr große tiefe Vierecke. Der Feind kam an, Livländer Kurländer Finnen Schweden Sachsen, den Wind im Gesicht, den breiten Loberbach überschreitend, sein Gestrüpp durchbrechend, bewegliche Brigaden, auf den Flügeln Reiter mit Musketieren wechselnd. Seine Kavallerie sprengte drei Reihen hoch, schoß, wie sie das Weiße im Auge sah, zwei Salven, zog den Degen.
Tillysche Regimenter gaben eine Salve ab. Die Sachsen warfen das Hasenpanier auf, Fahnen und Geschütze lassend. Tobend sprangen die Kaiserlichen in die Lücke, drehten die sächsischen Kanonen um auf die schwedischen Regimenter. Die klammerten sich an den aufgerissenen Boden, massierten sich dichter von Minute zu Minute.
Und wie ein Trompeter nach langem Ziehen aus tiefster Brust einen endlosen schmetternden Schrei von sich gibt, der sich wie eine Schwalbe in den Wolken verliert, so stießen die Schweden aus vierundfünfzig Geschützen eine Feuerwoge über die Deutschen, eine viertel Stunde, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, die Luft anfüllend mit Fünfpfündern Zehnpfündern, anwachsend und nicht nachgebend mit halben Kartaunen, stampfend stampfend mit ganzen Kartaunen. Wie eine Mauer, im Fundament erschüttert, brach lange an sich haltend schwer das deutsche Heer über das Schlachtfeld hin. Stürzte die Reiterei, wurde begraben das Geschütz, das Fußvolk.
Auf die rieselnde staubende menschenstreuende Flucht nahm Regiment Kronberg den verlorenen Brabanter mit. Das Morden in ihrem Rücken ging weiter. Sie hörten den frenetischen König im Dunkel Viktoria auf dem Felde schießen. Er schrie schweißtriefend, halb besinnungslos lachend, nach allen Seiten winkend: „Gott ist lutherisch geworden, Gott ist lutherisch geworden.“ Tote wurden in der hereinfallenden Nacht weit und breit gesät, die Schweden blieben an der Arbeit.
Tilly floh, floh, tat nichts als fliehen.
Hinterher marschierten die Regimenter Starrschädel schwarzgelb, Löser rotweiß, Klitzing blauweiß, Arnim rotschwarz, Schwalbach rotgelb, Ställhanske, Wunsch, Tott, Westgotland, Smaland, Ostgotland.
Als von den Wiesen und vom See her weiße Nebelschwaden unter den Brücken gegen die Stadt zu schwammen, die östlichen Straßenzüge Mantuas durchwanderten, stieg fröstelnd der Kaiser, weißgekleidet aus dem Wagen, um an die Häuser zu treten. An der Karmeliterkirche, bei der Brücke Sankt Giorgio, wo sie als Mädchen die erste Kommunion empfangen hatte, wollte ihn die Kaiserin in ihrem Wagen erwarten. Die voranreitenden Hatschiere suchten unter den Ruinen; an einer abschüssigen Gasse sah man unten einen Wagenzug, Reiter voraus, sechsspännige kaiserliche Wagen, Türen geschlossen. Die Hatschiere Ferdinands gaben den kaiserlichen Trompetenruf; die Türen blieben geschlossen. Langsam wanderte Ferdinand die verödete morastige Gasse herunter; wie er den ersten Wagenschlag öffnete, schluchzte es drin. Er hatte es erwartet, setzte sich neben Eleonore.
Die Tiere zogen an; sanft sagte er, die Schulter der Schwarzverschleierten umfassend: „Bei den Karmeliterinnen habe ich dich gesucht. Aber du konntest wohl das Kloster nicht finden.“ „Hast du es gefunden?“ kam nach langem leisen Weinen unter dem Schleier hervor. „Die Stadt sieht schlimm aus, Eleonore. Was ist dies für ein Glück Krieg führen. Dein Vetter hätte es besser gehabt, wenn er zugegriffen hätte bei meinem Friedensantrag. Nun liegt alles verderbt da; er muß die Franzosen bitten, seine Schulden zu bezahlen.“ „Mir ist an meinem Vetter nichts gelegen. Du hast Frieden mit ihm gemacht; warum ist Mantua nicht geschont worden.“ „Er kam meinen Generalen zu spät, Eleonore, mit seiner Nachgiebigkeit.“ „Und ich? Und ich? Warum hast du mir das angetan?“ „Weine nicht. Ich will dir alles wieder aufbauen.“ „Ich will es nicht. Es ist geschehen. Du hast es getan. Es nützt nichts mehr. Es ist geschehen.“ Er blieb still: „Wie sollte es anders kommen. Ich konnte es nicht mehr aufhalten.“ „Du hattest es in der Hand, doch und dennoch. Du hast in Regensburg deinen Feldherrn entlassen, es lag bei dir.“ „Ihm ist kein Unrecht geschehen; Nevers hat kindisch gehandelt, er wollte mit mir spielen, ich war es meinem Amt schuldig, Eleonore, nicht nachzugeben.“ „Deinem Amt? Nein dir, dir. Und mir? Mir bist du nichts schuldig. Mir wird meine Heimat zerschlagen, wie man eine Ketzerstadt zerschlägt, wie man Magdeburg zerschlagen hat.“ „Auch in Magdeburg haben Frauen und Kinder geweint. Ich hab’ es vorher gewußt.“ Sie hatte ihren Schleier zurückgeworfen, ein weißglühendes Gesicht bot sie ihm, der Wagen hatte angezogen, sie fuhren langsam über Schutt. Dicht saß sie an ihm, beide Hände an ihren Schläfen, flüsternd: „Versteh mich doch recht, Ferdinand. Wenn in Magdeburg die Frauen weinen und du dennoch befohlen hast, die Stadt zu verwüsten, — ich fasse es nicht. Und wenn die Frauen weinen, meinetwegen, sag’, es sind beliebige Frauen. Aber ich, Mantua, sieh doch, Mantua, wohin du mit mir reist.“ „Ich muß trauern, mein Kind, gewiß, mit dir. Um diese schöne Stadt und für dich.“ Sie stierte ihm lange ohne Verständnis in die ruhigen wehmütigen Augen; sagte dann zögernd: „Weißt du, Ferdinand, böse sein von Natur ist ein Unglück, der Mensch ist wohl dann wehrlos gegen seine Mitgift. Aber wie du, böse sein wollen, wissen daß man böse ist, das ist mehr als schlecht und sündhaft.“ „Wie ist es dann?“ „Grausig, du fragst noch? Das willst du auch wissen? Ekelhaft. Ich hab’s gesagt.“
Ihre Augen brannten gegen ihn, sie riß den Schleier wieder herunter. Sie fuhren schweigend in einem Nebelmeer. Er fing an: „So ist mein Amt, so bin ich durch mein Amt geworden. Es gab einmal eine Zeit, wo ich dich in jedem Punkt verstanden hätte, als ich diesen Wallenstein nach Ungarn hinter den Mansfeld geschickt hatte und mir Schandtaten gemeldet wurden. Damals wollte ich ihn wegschicken. Er bot es selbst an, meine Zweifel erschienen ihm komisch. Alle Räte widersprachen mir, die frommen Patres. Ich habe mich gewöhnt daran. Jetzt kenne ich nichts anderes.“
Beim Kloster der Ursulinerinnen vor der Stadt hielten sie im Nebel. Nach einer Weile stiegen sie aus. Durch ein Seitentor traten sie in die Kapelle. Der langgedehnte dunkle Raum, schwankendes Licht von brennenden Kerzen am Altar vor aufblinkenden bunten Bildern. Seitlich von oben tönte eine männliche tiefe Stimme. Die Nonnen kniend, kopfgebeugt, Reihe hinter Reihe.
„Ihr fühlt, es graut euch, ihr seid ausgestoßen, weil ihr Weiber seid. Ja, ihr ängstigt euch, der Fluch liege auf euch. Der Teufel treibt sein Spiel mit euch; gegen wen Satanas am grimmigsten seine Zähne fletscht, dem hält er ein Weib vor; so wäre es das beste, man rotte das ganze weibliche Geschlecht auf einmal aus.
O, verzagt nicht, christliche Schwestern, o gedenket, daß ihr Menschen seid. Gedenket dessen, der für uns alle am Kreuze hing.
Seine Mutter war Maria. Ja, Jesus hatte eine Mutter. Stündlich seht ihr Christum, den Herrn, am Kreuze hängen, seht seinen klagenden Mund, seine brechenden Augen, ihr weint über die Löcher, die in seine heiligen Glieder gerissen sind, ihr seht den strömenden Blutquell aus seiner Seite, mit dem er die Welt begleiten kann.
Ihr seht Jesum hängen.
Maria habt ihr nicht gesehen.
Es ist nicht ihr Bild, das glückselige Lächeln der Mutter, die Hingestrecktheit vor dem Kreuze, der Graus, die Erstarrung unter dem, was ihrem Sohn geschah.
Die goldenen Haare, die wonnigen Lippen, die Brust, mit der sie ihn einmal stillte, die Arme, mit denen sie ihn einlullte, der Schoß, in dem sie ihn trug, die Füße, auf denen sie mit ihm herumwandelte. Maria habt ihr nie gesehen.
Sie hing nicht am Kreuze wie ihr Sohn. Ehe ihr Sohn geboren war, war sie fast vernichtet worden, hatte sie schon alles durcherlebt. Allen Schmerz, den ihr Sohn grausend und zu unserm Heil durchfühlen mußte, hatte sie vorgefühlt. Denn in ihres Leibes Fleisch fraß die Liebe Gottes, die zehrende, zerreißende, schmelzende. Gottes Liebe zu Maria ist nicht wie das Blatt einer Rose, das über ein Gesicht fällt und streifend einen Duft hinterläßt, unter dem sich die Augen glückselig betäubt schließen. Es ist kein Flötenhauch, Sommerfaden vor dem Wind. Wen Gott berührt, der weiß nur, was Sterben heißt. Bitter, so bitter voller tötender Stacheln ist seine Wonne. Wen Gott berührt, der weiß nicht, daß dies die Berührung Gottes ist. Er kennt keine Beruhigung. Wer so empfangen wird, dem kann nur Tod und Ewigkeit mitgegeben sein auf seinen Weg und kann nicht lange auf dieser Erde verweilen. Als Gott Maria berührte, wurde für Jesu das Kreuz aufgerichtet. Er ist der Sohn seiner Mutter; das Entsetzen der Menschheit aus der Berührung mit Gott trug er mit sich in sein Leben und in unser Dasein. Siedendes Berühren von Feuer und Wasser; sein Leben nichts als ein Rauch, eine schmerzensreiche Flucht aufwärts.
Maria!
Maria! Mutter Christi!
Laßt sie uns lobpreisen. Von allen Frauen sie die erwählte, von allen Menschen die erwählte, unsere Fürsprecherin beim ewigen Thron, unsere Besinnung, unsere Befreiung, Befriedigung, Beseelung. Himmlisch war sie, zu unserem Glück, daß sie Gottes Blick auf sich zog, sie das Wunder der Welt. Der Wein ihres Bräutigams, seine seufzerquellende Traube. Maria! Du Schönste, du Süßeste, du Herrlichste, Gottes erschlossener Garten. Der Wohllaut der Erde.
Aus ihrem Körper quillt alle Stärke, ihre Adern dehnen sich aus und senken sich in unser Herz, in das Herz der Erde, wie Wurzeln. Das Lebende, Sonne und Gestirne zieht sie an sich. Ihr Herz drängt sich hoch, uns zu tragen, alle, Schwestern euch, Brüder uns. Ihr Leib wälzt und wühlt sich. Ihre Füße zittern und schlagen wie ein Frost unter ihren Kleidern. Sie blutet, sie gebiert unser Glück.
Laßt uns weinen, liebe Schwestern, weinen und beten zu Maria. Laßt uns auf sie hoffen und uns freuen.“
Durch das Bistum Brixen, über Lienz, Judenburg kehrte der Kaiser langsam nach Wien zurück. In der Hofburg begannen die Empfänge; Adlige und Stände wollten den zurückgekehrten Kaiser begrüßen.
Man machte einen ungeheuren Saal für sie auf. Wer auf die glatte weitquadrierte Fläche hinblickte von der Tür, wurde hilflos, Schwindel erfaßte ihn. Die Decke war ein Urwald von Quadraten, Rechtecken, Achtecken, Balken um Balken, schwarze, überwuchert von Bildern, die über ihren Rahmen hinausgriffen, über die halbe Decke fluteten, plötzlich abrissen. Und dicht unter der Decke, an den Pfeilern, der von zwanzig Fenstern aufgerissenen Längswandungen spießten Hirschgeweihe hervor, Pfeiler um Pfeiler gekrönt von ungeheuren Hirschköpfen, wild herausblickend aus gemaltem Rankenwerk von Blättern, Blumen, Ästen, oft noch Tierbeine auf die Wand aufgesetzt. Riesige Tafelbilder von den Wänden herunter, die Stirn nach vorn senkend, knapp über dem Boden aufgestellt. Aus dem niedrigen Prunktor der Schmalwand, das von steinerngrauen lanzentragenden Römern bewacht wurde, über dem sich bis zum Plafond ein wimmelndes Schlachtengemälde auswirkte in greller Buntheit, aus dieser dunklen engen Spannung quoll der farbige Hofstaat.
Auf der purpurbezogenen Thronbank unter dem goldenen glatten Holzbaldachin saßen hutbedeckt nebeneinander Kaiser und Kaiserin. Helles weißes Morgenlicht aus den zwanzig Bogenfenstern. Da kamen über den Parkettboden die Männer und Weiber angeschritten, die schloßentstiegene fröhliche Erdenherrlichkeit. Sie schritten wie bei einer Hochzeit zum Fackeltanz, die schmuckreichen Paare, wehende Bärte, schaukelnde Röcke. Ein Balken über dem Tore, durch den Aufbau eines silbernen Ritters Georg, von Löwen besprungen, geteilt; abwechselnd klangen Stimmen von einer Seite, bliesen aus langen goldenen Posaunen von der anderen Seite rotgekleidete Männer herunter. Die weitröckigen seidenbeschuhten Damen, Kornähren im Haar der blonden lachenden Gestalten. Stolze nackenbiegende Köpfe, zähneentblößend, Hälse von Ketten umspielt, gedeckt die Schultern von Hermelin, die fleischstrotzenden Arme nackt, offen im breiten Ausschnitt die geschwellten Brüste wiegend. Die Knie langsam fügsam wechselnd unter den fließenden Atlasvorhängen, Schleppen hinter sich lassend, wie Hündinnen ihren Geruch. Die weißen Arme, peitschen- und zügelgewöhnt, schleppten rafften die Masse der Kleiderpracht. Auf dem Postament der starken Schenkel trugen sich biegsam mit der Posaunenmusik die feinhäutigen gepflegten duftgebadeten Leiber, in denen sich bewegte wie in einem Zauberkessel das verwöhnte begierige Herz, die tiefatmenden Lungen, der weinsüchtige Magen, der lange weiße Darm gesättigt und gestopft mit Pasteten, Pfirsichen, gebratenen Kramtsvögeln, die heißen kostbaren Verstecke und Wege der Zeugung. Die Augen, die offen sind für prunkende Bilder Maskeraden Schlittenfahrten, pürschende Hunde, Tänze in gedrängten Sälen, die Münder, die befehlen beten küssen, Lieder singen, Ohren, die offen sind für glückliche Worte. In Atlaskleidern, gebändigt von weißen sinkenden Armen. Das kniewiegende stolze Chaos heranschreitend, das der Sonne, der Luft, den Blumen, Gewittern trotzt.
Gebückt auf der Purpurbank sitzend, den graubärtigen Mund leicht geöffnet, empfing der Kaiser ihren Anblick, warf ihnen Hände entgegen. Sein Kopf versank zwischen den hochgedrängten Schultern, der hohe weiße Hermelinkragen schob sich über den Nacken und hinter die Ohren herauf. Seine Beine breit nebeneinander gestellt schoben seinen Körper hoch. Er wand die manschettengeschmückten Arme aus dem schweren Thronmantel. Sie rauschten sicher an ihm vorbei, ihre starken lächelnden Leiber beugten sie vor ihm, er schwang stumm, wie er ihnen entgegenstrahlte als einer glücklichen Selbstverständlichkeit, beide Arme seitlich zu der herrischen trauervollen Frau neben ihm, als wenn er sagte: Nicht mir. Sie lächelte, und als wenn sie sich an der schmetternden stoßenden Musik und der herangeführten Menschenpracht wärmten, verdunkelten sich ihre Augen und schwammen in Feuchtigkeit.
Immer erneut die festen Münder zum Essen Trinken Beten Singen, knierauschende Atlaskleider, von weißen bloßen Armen gebändigt, ohne Scham auf den wandernden Postamenten das begierige Herz, der weinsüchtige Magen. Die goldenen Posaunen bliesen, das Tageslicht verfinsterte sich unter Wolken, es wurde in dem ungeheuer durchschrittenen Saal keinen Augenblick bemerkt.
Die Kaiserin, von blauem Samt lose umflossen, an ihrem goldenen Brustkreuz spielend, saß auf einem überdeckten Balkon die Füße auf eine niedrige Bank ausgestreckt. Die stumpfgesichtige Gräfin Kollonitsch, vollbusig milde, lehnte sich über das marmorne Balkongitter, einen Arm um das Bein einer Amourette, blickte freudig und erschöpft in das grüne Blättergewühl des Parkes trällernd: „Wem siehst du nach?“ fragte die Kaiserin. „Ich? Wem sah ich nach? Ich sah in die Bäume.“ „Wer läuft da? Ich höre doch jemand laufen.“ „Im Park, Lore?“ „Ja, wo denn. Wer läuft da?“ Die Gräfin noch in Atlas, dunkle Nelken in dem hochfrisierten Haar, gegen den Stuhl der Kaiserin, die sich auf dem linken Ellenbogen hochstemmte, sah zu ihr fragend herunter.
Wie die sich ganz aufgerichtet hatte, gespannt nach dem Park hinhorchend, klang von unten ein unsicheres Scharren, absatzweise, als riebe jemand an einem Baume, als fiele ein Ast, glitte einer vorsichtig über Sand. Im Nu war die Kaiserin auf den Füßen. Blick, Mienen, Hände rasten: „Hörst du nicht, wer ist da. Da unten geht einer.“ Die junge Kollonitsch wich ängstlich gegen die Balkontür, die Kaiserin scharf herunteräugend, wo nur grüner Park und Kieswege waren, sprang zurück, suchte an der Gräfin: „Was hast du da. Hast du keinen Stein oder ein Messer.“ Sie lief in das Zimmer, die Gräfin wollte zur Tür, die Wache rufen, die Kaiserin hielt sie mit wildem Ausdruck fest: „Ganz still.“ Riß eine Pike, ein kleines Handbeil von der Wand; die Pike ließ sie neben sich fallen, mit dem Beil stürzte sie an das Balkongitter, nach kurzem Suchen schleuderte sie die angehobene aufblitzende Waffe zwischen die Bäume. Horchte herunter; als alles still blieb, lief sie an der sprachlos stehenden Gräfin vorbei wieder in das Zimmer, zerrte die Pike hinter sich, keuchte, suchte den riesigen Schaft auf das Gitter zu ziehen.
Und als er da oben lag, keuchte sie sich hochrot: „Komm hilf.“ Die kam langsam an, faßte, immer die Kaiserin anblickend, den Schaft mit an. Einen Moment streifte die Kaiserin ihr bewegungsloses fragendes Gesicht mit einem Blick, blieb dann an ihrem Gesicht hängen, Hand an Hand mit ihr den Schaft haltend. Sie sahen sich an.
Die Kollonitsch fragte bittend, leise: „Was machen wir?“ Die andere schob noch an dem Schaft, suchte unten zwischen den Blättern, heftete sich ruhig an die ratlosen Mienen der Gräfin, ließ mürrisch, verlegen, noch fliegend von der Stange: „Sieh, wer da unten ist.“ Die Gräfin stand steif: „Es kann doch niemand in deinem Park sein.“ Lange sah die Kaiserin, leicht am ganzen Körper zitternd, vom Balkon herunter; dann sich zurückwendend: „Denk, wenn das ein Mensch gewesen wäre, wäre er tot.“ Die Kollonitsch schleifte die Stange ins Zimmer; wie sie bei der anderen stand, sich die Handteller rieb, hauchte sie: „Es ist ja keiner unten gewesen.“ „Laß mich, laß mich“, wehrte die Kaiserin ab, die sich heftiger zitternd und sehr blaß, seufzend auf ihren Sessel fallen ließ, um ihre Fußbank bat. Sie wiederholte mit grellen Blicken gegen den Balkon: „Denk, ich hätte ihn umgebracht, wenn es ein Mensch gewesen wäre.“
Nach kurzem Besinnen setzte sich die schwarze Kollonitsch, die Schleppe heraufwerfend, neben sie: „Aber ich habe ganz vergessen, dich nach dem Empfang zu fragen. Es waren so viele, weil wir dich trösten wollten. Und nun sag’, hat es dich erfreut.“ „Ihr seid freundlich und lieb. — Was war das eben nur? Verstehst du es. Ich hab’ mich erschreckt, nicht wahr?“ „Ich hab’ mich selbst erschreckt, Leonore. Es war nichts. Also: es hat dich erfreut.“ „Eins aber sag’ ich dir, Angelika,“ damit beugte sich die Kaiserin vor, drehte den Kopf, runzelte drohend die Stirn, „ich habe nichts dazu getan, wenn es einen getroffen hätte. Ich habe mich erschreckt, und — wie sonderbar, ich bin eine Frau und kam auf den Einfall, ihn totzuschlagen.“ Sie zitterte wieder heftiger, ihr Kleid raschelte.
„Es war herrlich, wie der Chor sang.“ Die Kaiserin schüttelte den Kopf, träumte mit wandernden Augen: „Ja, Angelika.“ Später: „Ich bin besessen, Angelika, ich fürchte mich. Sag es nicht weiter. Wenn es der Bamberger Bischof erfährt, der Philipp Adolf, macht er einen Hexenbrand aus mir. Lache nicht. Wie ist es möglich?“
Sie nahm, als die Kollonitsch gegangen war, gedankenlos den kleinen Spiegel vom Tisch. In einem sechseckigen Elfenbeinrahmen stand er; ihn umgaben Menschen, Männer und Frauen, nacktleibig sich um seine geschliffene Randung hebend, schwimmend gegen die Höhe, auf der der Weltenrichter Christus thronte mit dem Schwerte, angebetet kniefällig von zwei Gestalten. Ohne sich zu sehen, hielt sie ihn vor ihr Gesicht; dann erblickte sie sich, bedeckte den Spiegel mit der Hand: „Wie kann ich ihn verwünschen, wenn ich selber so bin. Ich bin vom Teufel besessen. Ich bin’s. Er ist in mich gefahren und hat mich.“
Aus Halberstadt am vierten Tag nach der Schlacht machte sich der blasse deutsche Leutnant Regenspurger mit einem Brief des verwundeten frommen Generals auf. Wurde in Wien sogleich vor den Fürsten Eggenberg geführt. Die Girlanden wanden sich am Plafond des langen rechteckigen Raumes in dem Kerzenlicht; dem jungen Reiter, der zu erzählen anfing, träufelten die Tränen aus den Augen. Der alte Fürst behielt ihn bei sich. In vollster Bestürzung bat er seine Freunde Trautmannsdorf und den Abt Anton zu sich. Sie fanden ihn, als sie nach Stunden eintrafen, noch auf demselben Stuhl sitzen, auf dem er den Leutnant angehört hatte, grau im Gesicht, vergrämt das Kinn aufstützend. Er sei, gab er kopfschüttelnd von sich, keines Gedankens mächtig, sie möchten selber lesen, was des Feldmarschalls Tilly Liebden geschrieben habe von der Schlacht mit dem König aus Schweden.
Und während sie lasen, jammerte er, er könne nicht denken, er werde gehen, er müsse sich zurückziehen vom Hofe. Im seidenen blauen Schlafrock schlürfte er über den Teppich; sie sprachen unter sich; er saß da, spielte mit seinen kalten blauen Händen, hörte nicht zu und plötzlich blickte er sie kläglich nacheinander an, horchte, was sie redeten, als wenn er sein Urteil erwarte.
Der bucklige Graf sezierte mitleidlos, die Augen klein kneifend: jetzt könne jedenfalls das Reich auseinanderfallen, auch mit den Kurfürsten; man hätte sich ja vorher gefürchtet, ohne sie zu bestehen. Der Fürst wandte sich fast verzweifelnd an den Abt, der ihn traurig ansah: aber er hätte ja gerade die Kurfürsten gewählt, weil sie ihm sicher schienen für das Reich, sicherer als der Friedländer. Trautmannsdorf schob frostig die Arme aneinander, beschnüffelte den Brief: man habe sich eben getäuscht, getäuscht, getäuscht. „Was nun?“ flehte der Fürst. Abt Anton strich ihm die Hände, Trautmannsdorf blieb dabei, die Hauptsache sei, zunächst zu sehen, daß man sich getäuscht habe. Eggenberg winselte: „Was wollt Ihr von mir. Ihr wißt, wie ich mich dem Erzhause und Kaiserhause gewidmet habe, wie ich es gemeint habe mit dem Kaiser von seiner Jugend auf. Ich habe mich getäuscht, Ihr hättet es verhindern können. Rettung, seid gnädig, Trautmannsdorf.“ Anton stellte sich hinter den Fürsten, sanft sprechend neben seinem Ohr: „Ihr tut ihm ja Unrecht, Fürst. Er will Euch nicht quälen, er will nur Klarheit. Ihr kennt ihn doch.“ Trautmannsdorf: „Schlüsse zu ziehen aus der Situation ist ganz überflüssig. Man braucht nur die Ausgangsdaten nebeneinander zu stellen, so ergeben sich die Schlüsse von selbst.“ Angstvoll hing Eggenberg an seinem ruhigen Gesicht, drängend: „Wie also?“ Der Graf trommelte nervös, er wolle seine Weisheiten schon dem Fürsten nicht aufdrängen, geschweige denn die Trivialitäten. „Was denn, was denn?“ bettelte der Fürst. Auf den vorwurfsvollen Blick Antons wurde der Graf herzlicher, sprach leise, las mit ihnen den Brief noch einmal durch und erklärte: einrenken sei die richtige Behandlung. Wenn man ein Glied, mit dem man bisher gut gegangen sei, ausgerenkt habe, in der Hoffnung noch besser zu gehen, nun, so renke man es wieder ein, wenn man den Schaden bemerke. Der Fürst war aber viel zu verwirrt. Er verfiel in ein verzweifeltes Selbstanklagen, man mußte ihn beruhigen, dann beteuerte er wieder seine Unschuld.
Tags drauf empfing ihn der Kaiser; der Leutnant Regenspurger war zur Audienz geladen, erstattete zaghaft seinen Bericht. Milde erkundigte sich Ferdinand nach seinen Eltern und wo er in der Schlacht gefochten habe, sprach seine Freude aus daß er entronnen sei. Er ließ seinen Obersthofmeister rufen: man möchte den Leutnant bei Hof gut unterhalten, ihm hundert Taler zum Dank für seine Meldung verabfolgen, und der Leutnant möchte sich vor seiner Abreise noch melden.
Dann, allein mit dem Fürsten, der noch kaum gesprochen hatte, betrachtete der Kaiser lange seinen unglücklichen alten Freund. Was in ihn gefahren sei, wie er aussehe, ob er sich wieder krank fühle; er hätte sich dann hinlegen mögen; warum habe er sich in diesem Zustand bemüht. Eggenberg nach langem Schlucken gab nach, stürzte dem Kaiser, der vor seiner Schreibkommode stand, zu Füßen, weinte schluckte und schnarchte hilflos. Verwundert trat Ferdinand zurück: was er denn wollte. Dann stammelte Eggenberg, der jede Haltung verloren hatte, um Verzeihung. Ja, wofür, ob er die Schlacht bei Breitenfeld gegen den schrecklichen Ketzer verloren hätte; ob sich sein lieber alter Eggenberg einbilde, der liebe Gott zu sein, der alles füge; und schließlich, „wir müssen uns fügen und nachdenken, wie alles zusammenhängt.“ Der kleine Fürst stand mit blutrotem Gesicht auf; Ferdinand lächelte, wie er an seinen Spitzenmanschetten zupfte, nähertretend: aber krank sehe Eggenberg aus und er sei doch damals beim Regensburger Tag nicht folgsam genug in Istrien geblieben. Eggenberg hauchte aufblickend: er hätte nicht ruhen können aus Sorge um das kaiserliche Haus.
Der Kaiser, dem Geläut von Sankt Stefan lauschend, setzte sich auf seinen breiten Stuhl, einen Abtstuhl, dunkles Buchsholz, über Armlehnen, Rückenlehnen, braune stille Figuren, die sich gegen Hand und Nacken des Sitzenden bewegten, faltenwerfende Männer, betende Frauen, singende haarflechtende Mädchen. Frauen mit Säuglingen an der Brust, segnende stabgestützte Bischöfe. Er hätte es sich gedacht, gab er von sich, sie drängten ihn, drängten ihn, wollten die Gewalt in ihren Händen haben und nachher könnten sie sie nicht meistern. Nun stünden sie da wie arme Sünder und es sei ihnen kläglich ums Herz.
Ferdinand hatte die Knie übereinandergelegt, seine Hand befühlte einen Säugling, der am Bein der Mutter herunterrutschte. Am meisten jammere ihn sein Vetter Maximilian, der stolze Mann; ein unerbittlicher Feind stünde nicht weit vor seinen Grenzen. Daß man sich nicht niederdrücken lasse von dem Zufall, daß man dem Bayern gleich ausreichende Hilfe gewähre. „Wir sind ungerüstet, Kaiserliche Majestät; wir wissen jetzt nicht, wie uns unserer Haut wehren.“
„Schreibt ihm, er solle unbesorgt sein. Wenn er sich fürchtet um seinen Vater, solle er ihn herschicken zu mir. Sie sollen bei mir als Gäste wohnen.“
„Majestät, wir wissen nicht, wie wir uns unserer eigenen Haut wehren. Der König aus Schweden rückt mit einer so furchtbaren Macht heran; die Kurfürstliche Gnaden von Sachsen hat sich ihm angeschlossen. Tillys und unsere eigenen Truppen sind auf der Flucht.“
„Bewahre Gott, lieber Eggenberg, Ihr wäret jetzt auf meinem Platz. So wäre das Erzhaus verloren. Seid doch wieder munter; listenreicher Odysseus. Wie seid Ihr gedrückt, Eggenberg. Warum?“
Der bewegte seine zittrigen Arme nach vorne, ließ sie fallen; freundlich winkte der Kaiser ab, sich die Augen bedeckend: „Laßt, lieber Freund. Was ist die Lage leicht für uns. Friedland ist als Freund von uns geschieden. Die Fürsten werden ihren Widerspruch gegen ihn aufgeben. Wir können uns alle auf ihn verlassen, er war schon schwereren Lagen als jetzt gewachsen.“
Und so, leicht und beruhigend sprach der Kaiser, der sich wohlig schwer zurücklegte, daß Eggenberg den Eindruck hatte, die Sache ginge ihm nicht nah, ginge ihn nichts an. Mit weißlichhellen Augen blickte Ferdinand leicht zerstreut auf den kleinen Geheimrat, in den Raum hinein, seitlich auf die bernsteinbesetzten Fächer seines Schreibkabinetts.
Ferdinand brachte seine irrenden Blicke einen Augenblick zur Ruhe, heftete sie weich auf das ängstliche fragende Geschöpf, das ihn liebte: „Eggenberg, treuer Eggenberg, was seid Ihr verstört. Hat Euch der Regenspurger solche Furcht gemacht. Geht hin zum Friedländer. Er ist unser Schwert. Nehmt es nur wieder.“ Vergnügt fuhr er fort: „Ich weiß zwar nicht, ob er jetzt zarter zugreift als die vergangenen Jahre. Auch wird er sich einen guten Lohn im Reich holen. Dafür ist er unser alter werter Friedländer. Holt ihn nur. Er soll wieder kommen. Er wird sich freuen, daß es ohne ihn nicht gegangen ist.“
Und als der alte Mann sich verneigte, verabschiedete er ihn zwischen Summen und Pfeifen, sich tiefer zwischen die faltenwerfenden Männer, die betenden Frauen, singenden Mädchen drängend.
Ohne Mantel Hut Wehrgehenk kam abends Ferdinand der Mantuanerin an der Tür seiner Antikamera entgegen; man schloß die Türen. Eleonore raffte ihr goldfarbenes Kleid vorn, drückte ihn, auf ihn rauschend, auf die Fensterbank, drückte auf seine Schultern mit den Füßen, das Gesicht an seine stopplige Wange reibend: „Tu mir das nicht an. Nimm ihn nicht. Ich will es nicht haben.“ Dann: „Willst du mich ermorden, nimm ihn. Was hast du es auf mich abgesehen?“ Dann: „Ich laß es nicht zu. Niemals, niemals. Und wenn ich dich wieder und ganz verlassen sollte.“ Das Gesicht von ihm entfernend, ihn anstierend: „Mann, du, wer bist du, daß du das alles anhörst. Daß du hier so sitzt. Vor mir. Nein, ich laß es nicht zu. Ich siedle mich auf den Trümmern von Mantua an. Bei den Ursulinerinnen, und zeige der Welt: so geht es einem Weib, einer Ehefrau, der angetrauten Frau des deutschen Kaisers.“ Er ließ sie gewähren, zog sie an der Hüfte neben sich, an ihrer langen Perlenkette spielten seine Finger, leise begütigte er: „Du warst schon in Regensburg so wild. Ich muß überall herumgehen und trösten. Ich hatte noch nie soviel gutzumachen und zu besänftigen wie jetzt. Eben erst unseren guten Eggenberg.“ Und er ging zum Nachtmahl. Sie begleitete ihn nicht.
Hinterher schmauste und pokulierte er im langen spanischen Saal, wo die ganze Wand quadratisch gefeldert war und aus jedem Holzquadrat ein Fürstenbildnis des Pietro Rosa aus Brescia herblickte. Sechzig Fürsten blickten in der Runde, wie Ferdinand, zwischen seinen lustigen Kämmerern, Offizieren, Gästen Bären Tannenzapfen, Windmühlen Lastwagen Schiffe als Trinkgeschirre vor sich anfahren ließ und sie im Kreise fuhren; wie man Hund und Katze zusammen ans Bein eines fetten Schweins band, das der Kaiser mit seinem goldenen Degen durch den Raum jagte. Ein Affe, brauner kurzschwänziger, saß in der Mitte der Tafel, trank in Kannen, stieß sie im Sprung um. Der Kaiser war alle Abende von gleichmäßiger unbeweglicher Heiterkeit.
An Maximilians Hofe hielt man ein kleines mißwachsenes menschliches Geschöpf als Narren, ein Wesen von einer unglaublichen Gefräßigkeit. Meist lungerte er um die Küchen Keller Tafeln Bankette, — wie er sagte, den Mist prüfen, auf dem sein Spargel wuchs. Er verabscheute ehrlich die Fresser und Saufer, sie hatten mit ihm nichts zu tun. Bäuche von Schweinen, Kälberknorpel, der schön gedämpfte und gepfefferte Rindermagen bedeutete ihm mehr als Leibesfüllung. Wie ein Pferd beim Klingen der Musik ins Tänzeln gerät, so bewegte sich sein schlaffaltiges blaurotes altes Gesicht, sein Herz belebte sich, seine Hände griffen zum Gabelrapier, wenn die würzigen Gerüche in sein Näslein zogen.
Er ging den Speisen wie ein Kämpfer entgegen. Mit seiner Beute hockte er sich beiseite hin, hielt sie wie einen noch nicht bezwungenen Widersacher unter sich. Er liebte es, daß man ihn allein ließ, ihm nicht zusah. Knurrte wie ein Hund beim Essen. Lang ließ er die dicke wulstige Zunge über die Zähne hängen, die Hände hoben die Speise, der Mund schnappte ihr entgegen. Wenn die Vertilgung der Speisen vor sich ging, die Soßen wie Blut aus den Mundwinkeln rannen, fing das Schnalzen Schmatzen Knacken Knuspern Reißen Schlürfen Knirschen an. Hier wurde nicht gefressen und geschlungen, sondern völlig vernichtet und restlos einverleibt. Und dies war der Vorgang, der ihn berauschte. Er konnte es nicht unterlassen, wüste Bemerkungen dabei auszustoßen, obwohl er bisweilen halbtot dafür geschlagen wurde; er lästerte von dem neuen besseren Meßopfer, das er vollzog, jetzt werde er Kalb mit dem Kalb, Schwein mit dem Schwein, Fisch, Kapaun. Er vollziehe das Meßopfer nicht zum Himmel herauf, sondern nach unten herunter. Rachedürstige Äußerungen stieß er aus, ihnen die frommen Gedanken zu besudeln, widerstandlos von der Inbrunst des Wütens und Wühlens geschleudert. Und so empfing er bisweilen, wenn er böse gelaunt war, irgendwelchen Edlen vor der Kirche oder der Neuen Kapelle, würdevoll gespreizt einen Rinderknochen mit einem Fähnlein auf seinem Spieß vor ihnen tragend, wie ein Chorknabe Räucherbecken oder Kruzifix, keifend, näselnd: „Auf zum Gebet vor dem Rehbraten. Auf zum Speikübel und Nachttopf. Auf, meine lieben Herren, lasset nicht nach, nicht nach im Eifer. Gehet in euch!“
An diesen Tagen waren die Herren und Damen an der Tafel sehr empfindlich gegen Lärm, man mochte ihn nicht hören. Der Zwerg wurde unter dem Tisch aus seinem Winkel hervorgezogen; wie schlaftrunken hing er, kauend speichelnd stöhnend knurrend, in den Händen der Pagen, die ihn schüttelten. Er schlug um sich, wußte, daß er nicht wie ein Hund knacken und knirschen sollte. Gestäupt und wieder eingelassen schleppte sich das gebückte klingelnde Mißgeschöpf an den Tafeln entlang in seine Ecke, bald schweigend in Wut, bald die Tische mit einem Wust von Giftigkeiten überquasend, ruckweise anhaltend, unter seinem Asthma keuchend, beschämend mit Zoten und Unflat die jungen Hansen und Pagen, die wartenden Kämmerer.
„Er tut es gern, das Knirschen, er tut es gern,“ schrie triumphierend der jesuitische Beichtvater, nach hinten blickend auf ihn, wie er vorbeigetrieben wurde. Mit Abscheu sah der Zwerg, wie die Herren vor den vollen Schüsseln speisten, sanft gedankenlos die erlesenen Gerichte in die Münder steckten, sich leise unterhielten, der Musik lauschten. Der Verrat an den Speisen; die Lumpen vor diesem Braten. Er taumelte vor die Tür. Der seidenbehängte Oberstkämmerer wandte sich angewidert über seinen Teller.
In den Grottenhof der Residenz wurde am Nachmittag der Zwerg geführt. Da ging eben hinaus der alte langbärtige Angermeyer, Elfenbeinschreiner, traurigen Gesichts; einen ganzen Tisch mit Elfenbeinmustern trugen ihm zwei Gehilfen nach. Zwischen ausgebreiteten Kartons und Wandteppichen stand inmitten des blumigen Hofes der üppige schwarzlockige Hans von der Biest, Maler; Maximilian hörte ihm nicht zu. Neben dem Kurfürsten, der im knappen spanischen Kostüm am Springbrunnbecken saß, stützte sich der junge Kuttner, der Rat, auf den silbernen Kavalierdegen, sein Gesicht zuckte. „Ich will mich ekeln“, spielte Maximilian mit dem Messer; der Maler zog sich auf Kuttners Handbewegungen unter stolzen Verbeugungen zurück.
„Kuttner, der Arzt hat mir befohlen, ich soll mich ekeln. Das helfe mir am raschsten.“ „Ich weiß, Kurfürstliche Gnaden. Das ist der Narr.“ „Fang an“, stieß Maximilian hervor. „Was soll ich?“ schrie der angetriebene Narr bleich. „Fang an, Bärenhäuter.“ „Was soll ich anfangen?“ „Willst du anfangen, Schelm!“ „Was schimpft Ihr mich Schelm, Schuft, Bärenhäuter. Reißt doch Euer Maul selbst auf und sagt was Ihr wollt.“ Müd drehte Maximilian den Kopf zur Seite leise: „Sprecht Ihr mit ihm, Kuttner. Macht es kurz.“ Kuttner, der feine junge Mensch, stolz, französisch, elegant, ging, den Degen in der Hand, auf den Narren mit den weiten Nasenlöchern los, wispernd: „Mach’ deine Späße, Hund; du weißt, wozu du da bist.“ „Der Hund, wozu der da ist? Zum Fressen, du geleckter Welsche.“ „Du, du bist Narr, weißt nicht, was du zu tun hast.“ Kuttner schwenkte zornig die Klinge; er kam aus Paris, lebte wenig am Hof, wußte nicht, was die Künste des Geschöpfes waren. Der Kurfürst blickte beiden stier und erbittert zu; so apathisch war er, daß er nicht imstande war zu sprechen: „Fang an, fängst du an!“
Von der Terrasse stieg ein zahmer Storch mit seinen hohen roten Stelzen feierlich näher, von Zeit zu Zeit wuchtig in den sumpfigen Boden hackend; er ging dem Wasserlauf nach, der zu dem Springbrunnen führte. Kuttner begann in seiner Ohnmacht den Zwerg mit der flachen Klinge zu prügeln. Maximilian, die Fäuste ballend, verfolgte die Szene. Der Zwerg sprang erbost unter dem Hageln der Hiebe herum. „Friß. Er soll fressen“, schrie Maximilian. Der Zwerg machte sich heulend los: „Was soll ich fressen? Was soll ich fressen? Bringt mich nicht um.“ Unter den steifen Blicken Maximilians, den in den Sand spritzenden Schlägen Kuttners stürzte er sich kreischend, verzweifelt die Arme aufwerfend, in den Saal vor dem Becken.
Und da kam mit gravitätischem Schritt der langbeinige Schnabelträger her. Wie der Zwerg das Geräusch hörte, zuckte er zusammen. In Todesangst kroch er hoch und nun warf er sich auf den Storch. Er war nicht höher als die Beine des Vogels waren. Mit den Armen packte er nach der Brust des Tiers, das krächzend flügelschlagend zurückwich, sich schüttelte, sogleich gegen das kleine Wesen losging. Es hieb wie ein Drescher mit dem Schnabel auf den Zwerg herunter, der ungeschützt einen Hieb dicht unter dem Hals empfing. Seine Kappe zerriß, er knickte auf die Knie; schien aber sonst nichts zu bemerken. Nur auf die federbesetzte Brust des großen Vogels starrte er, schon hing er mit beiden umschlingenden Armen an seinem Hals, der sich wand, drehte, sich zu entziehen versuchte. Seine Beine zappelten unten, das starke Tier stand krächzend krächzend einen Augenblick, bis es vornüber sank. Der Narr wälzte sich mit dem Storch im Sand. Sein Gesicht war nicht zu sehen, es war in die Brust des schreienden fast menschlich kreischenden Tieres vergraben. Er spie Federn, kaute und biß an der zähen Haut, dem krampfhaft zuckenden Fleisch; sein eigenes Blut lief unter ihn; das Tierblut leckte und schlürfte er. Und nun, noch eben in der Angst der Degenhiebe, vergaß er, wer hinter ihm stand, wer auf dem Stuhl sitzend vornübergebeugt mit langgezogenem Gesicht ihm zusah; er fing an seine Kiefern zu bewegen und erst mit Widerwillen, dann mit wilder Besessenheit zu fressen, zu vernichten, das zuckende schreiende Tier zu vernichten. Der Storch auf der Seite liegend suchte wie ein gefallenes Pferd den Hals reckend mit den Beinen ausschlagend hochzukommen. Das schwere Gewicht des malmenden Zwerges zerrte ihn herunter. Wie der Vogel einen hellen durchdringenden Trompetenschrei ausstieß, verlangte der Kurfürst, daß Kuttner, der seitwärts schielend dastand, mit seinem Degen spielte, den Zwerg abrisse. Kuttner bückte sich herangehend, packte den Zwerg am Rücken. Der verbissen ließ das Tier nicht los. Als Kuttner ruckartig an dem Geschöpf zog, ließ der Zwerg die Arme vom Hals des Tieres los, aber in gräßlicher Weise hing er mit dem Gesicht wie verwachsen im roten klebrigen Sudel an der Brust des Vogels; rechts und links lief und spritzte hellrotes Blut den Boden. Mit einem Fluch klemmte der Kavalier seinen Degen zwischen die Beine, laut hörbar wurde das brünstige Mahlen, Knurren, Schlürfen, Schlucken des Zwerges, der mit den Armen wieder versuchte, nach dem Hals des Vogels zu hangeln; der Storch hielt den Hals senkrecht über ihn, entsetzliche Hiebe mit dem Schnabel fuhren blitzschnell auf die Waden und Rücken des Mörders, dazwischen die schrecklichen hohen Schreie. Kuttner griff zu, die Beine des Menschen packte er, ein Zug, er schwang den Zwerg um sich, ließ ihn ins Beet absausen. Der Vogel schwankte mitgerissen, krächzte, stand im Augenblick auf den Beinen, von oben troff das Blut, flügelschlagend macht er kehrt, taumelte davon. Aus dem Blut kam der grauenvoll beschmierte Zwergenkopf hervor; Wutgeheul, Tränen. Der Kurfürst ging rasch an ihm vorbei; er nahm Kuttners Degen, stieg ausspeiend auf das Beet zurück, spießte senkrecht von oben stechend den anstrebenden Zwerg mit dem rechten Oberschenkel am Boden an.
In der Kunstkammer vor einer kostbaren Truhe, Stuckrelief mit keulenschwingenden Kentauren, die vergeblich andrangen gegen die sanfte Menschengruppe der Gerechtigkeit Weisheit Stärke Mäßigkeit, standen sich Maximilian und Kuttner im Halbdunkel eines Pfeilers gegenüber. Maximilian hieß ihn sich seinen Degen holen; der Zwerg zeterte noch. Als Kuttner mit der blutigen Klinge wiederkehrte, saß der Kurfürst nahe einem Fenster. Sie hörten dem sich entfernenden Gejammer zu. In der Stille schüttelte sich der auf der Truhe, Maximilian: „So sollte mein Arzt schreien.“ Stieß ein hitziges Lachen aus, seine Augen blitzten erregt. „Wißt Ihr, Kuttner, was heute für ein Tag ist?“ „Michaelstag, Durchlaucht.“ „Sankt Michael. Das ist der Schirmherr der Deutschen. Wir haben eben gut gekämpft; er wird uns loben.“ Maximilian lachte sanfter und erschöpft. Kuttner bog seinen frauenhaften weichen Leib vor, hob die langfingrigen Hände vor die spitzenbesetzte Brust: „Der Narr war ein Vieh, Euer Durchlaucht. Wo gibt es so etwas in der Welt.“ „Wir haben beide tapfer gefochten. Sankt Michael hat im Lande Moab dem Satan die Leiche Moses abgerungen. So habt Ihr gerungen. Ich bin matt, Kuttner, und fühle mich besser.“ Der lächelte verbindlich, schwieg. „Ihr seid mir der liebste Mensch am Hofe, Kuttner; Euch vertraue ich wie fast keinem.“ Plötzlich hob, nach einigem Suchen, Maximilian leidenschaftlich die Arme, hauchte aufflammend: „Kuttner, was soll geschehen!“ Er zog den anderen an der Hand zu sich herunter: „Ich bin verloren. Ich —“ Er stammelte. „Vor dem wüstesten Menschen der Erde liege ich, vor diesem Goten. Er wird sich eine Freude daraus machen, mich zu beschimpfen. Heiland, mein Heiland, wohin sind wir geraten.“ Der Fürst schien vor einem Tränenausbruch, jammernd und zähnekrachend sah er zu Kuttner auf. Verlegen wich der mit den Augen aus; es gäbe himmlischen Schutz für Deutschland. „Sagt mir das noch einmal, Kuttner. Ihr seid soviel jünger als ich. Wenn es keinen himmlischen Schutz für uns gibt: ich sehe keine Rettung. Ich hab’ mich übernommen. Es war zuviel für mich. Setzt Euch neben mich. Habt keine Scheu. Laßt mich an Euch anlehnen. Ich habe keine Frau, keinen Freund. Mein Vater ist krank. Ich will mich aussprechen, Ihr werdet mich nicht verraten. Regensburg ist mir nicht geschenkt worden. Ich bin wie ein Lump, der alles verwettet hat. Ich kann nur greinen.“ Nun weinte er wirklich, Kuttners Schulter umfassend.
Der hatte seine Scheu rasch überwunden; er kannte die Krankhaftigkeit des Kurfürsten, gab nach: „Was soll dies für ein Michaelstag in Deutschland sein, wo Eure Durchlaucht zerknirscht ist. Wir geben nicht nach, der Satan wird unserer nicht Herr werden und wenn er sich mit den ledernen Kanonen der Finnen und allen schwedischen Neuigkeiten bewaffnet.“ „Mir wär’ wohl, Kuttner, ich hätte diesen Tag nicht erlebt. Wie hab’ ich mich hoch über meinen Vater gefühlt, der mir das Land hat abgeben müssen, weil es fast ruiniert war. Aber ich! Aber ich! Seht hin, nein, seht nicht hin. Sehe keiner hin. Es ist ein Grauen. Wir haben den Krieg über die Pfalz und Böhmen getragen; es hat uns nichts ausgemacht die brennenden Dörfer, die Leichen auf den Straßen haben uns eine Freude gemacht, wir sind als Sieger durchgezogen. Was haben wir gesehen. Wir waren Sieger. Kuttner, jetzt soll Bayern, mein Land, für das wir gesorgt und gegeizt haben, alles dulden. Ich hab’ mich lästern lassen als Geizkragen und schlechten Filz; seht hin, wie alles gediehen ist, wie alles prangt und wohl ist. Für dies Land hab’ ich alles eingesetzt, mich selbst mit, mein Haus, die Ehre meines Namens, den Ruhm der vergangenen Geschlechter. Wißt Ihr, was nun kommen wird, wer das ist. Ein dicker roher plumper Mann, der die lutherischen Schimpfworte vom Morgen bis Abend wie einen Wohlgeschmack im Mund führt. In unseren reinen reichen Kirchen wird er sich wälzen wie ein Schwein. Meine gehegten geliebten Städte, o Ihr kennt sie ja, er wird drin herumschnüffeln, Feuer wird er auf sie werfen, arm wird er sie erpressen. Ich werde nicht da sein, ich werde irgendwo mit dem Hof sitzen. O ich will nicht. Ihr Menschen, was ist über mich verhängt. Wie hab’ ich das versündigt.“ Den jungen Gesandten hatte er losgelassen, sein Kopf hing seitlich über der Brust, er schluchzte, stammelte.
Kuttner kniete vor ihm, streichelte sein Knie: „Sprecht nicht so laut, gnädiger Herr; man könnte Euch hören. Seht doch mich an, hebt Euren Kopf, wo ich bin. Ich bin Euer Gesandter in Paris. Erinnert Euch des Königs Ludwig. Laßt Eure Seele nicht so im Sumpf. König Ludwig will Euch wohl, er braucht Euch. Graf Tilly ist bei Leipzig nicht vernichtet. Der Schwede wird aufgehalten werden.“ „Das glaubst du, Kuttner? Freu’ dich. Ich bin schon halb auf der Flucht. Ich jammere schon und beklage meine armen Münchener, die frommen Klöster, die ganze Herrlichkeit. Es gibt keine Rettung.“ „Man rechnet in Paris auf Eure Durchlaucht. Man hofft, Ihr werdet den Augenblick verstehen.“ „Was ist, Kuttner.“ „Ihr seid kein Freund Habsburgs, glaubt man zu wissen, und sicher kein Freund Spaniens, weil es Euch die Pfalz mißgönnt. Man meint in Paris, Ihr werdet nach dem Leipziger Schlage begreifen, worum es sich dreht. Ihr werdet irgendwie mit dem Schweden paktieren. Frankreich hat es schon getan.“ Der Kurfürst wischte sich das Gesicht; abgewandt bat er: „Setz’ dich neben mich, Kuttner. Knie nicht da. Erzähle.“ „Ich hab’ Euch nur zu melden: der Pater Joseph sagte mir, als die Nachricht von Breitenfeld einlief: ich sollte verhindern, daß mein kurfürstlicher Herr sich von diesem Unglück getroffen fühlt. Das kaiserliche Heer sei geschlagen. Es sei eine Warnung über den Regensburger Weg hinauszugehen — nach Wien; ein Wink für Eure Kurfürstliche Durchlaucht, nicht mit der falschen Partei zu halten.“ „Ich bin nicht geschlagen, ich bin nicht geschlagen.“ „Vielmehr meinte der so gelehrte und weltkundige Pater: Ihr hättet sozusagen einen Vorteil errungen. Ihr hättet es in der Hand, den Kaiser wissen zu lassen, wie es steht und wie Ihr es auffaßt. Schließlich habt Ihr nicht Pommern und Niedersachsen zu verteidigen. Die Liga ist nicht gegründet, um Pommern zu befreien.“ Mit gezwungenem Lächeln betrachtete Maximilian ihn von der Seite: „Du, lieber Kuttner, meinst, ich bin nicht besiegt. Es wird alles wieder gut.“ „Kurfürstliche Gnaden, Eure Stunde kommt. Ich spreche, was mir der Kardinal und der Pater oft eindringlich nahegelegt haben: Ihr solltet Mut haben. Der Kaiser ist gerichtet. Alle deutschen Stände wenden sich nach den friedländischen Untaten, die er begünstigt hat, von ihm ab. Greift zu. Jetzt seid Ihr in Notwehr. Es geht um Euer Land und Euer edles Haus.“ „Was hat Richelieu gesagt?“ „Stellt Euch dem Schweden nicht in den Weg. Haltet es wie der allerchristlichste König: begünstigt ihn und sucht Euren Vorteil. Frankreich rät Euch das. Es rät Euch das, weil Ihr sein Bundesgenosse, sein natürlicher Bundesgenosse im Kampf gegen Habsburg seid. Frankreich hat einen Vorteil von Euch; es wird Euch nicht Schlechtes raten.“
Maximilian, den Arm auf der Schulter des schlanken Jünglings, blieb still, sein Gesicht wurde länger, seine Nase rümpfte sich, leise: „Glaubst du, daß er den Storch umgebracht hat?“ Leicht verwirrt Kuttner: „Sehr tief war die Wunde nicht.“ „Ein ekler Mensch. Laß dich doch ansehen. Das ist also ein Mensch, der mich nicht aufgibt. Ich muß mich wohl an dich halten. Und wie hat Richelieu gemeint, Kuttner, besänftige ich den Schweden am besten?“ „Besänftigen, Durchlaucht — ich rede mit aller Offenheit, die Ihr erlaubt —, es ist ja nicht nötig. Wer, glaubt Ihr, sei der Schwede. Ich habe mir viel von ihm erzählen lassen. Er rechnet wie Ihr und ich. Er hat seinen Haß wie ein dummer Lutheraner, aber das verwirrt seine Rechnung nicht. Zuerst Eure Liga aus dem Spiel: seid gewiß, Ihr braucht ihn nicht mehr mit Worten zu besänftigen.“ „Daß ich so wie von einem Fall gelähmt bin. Mir liegt — ich habe ein dumpfes Gefühl — eine ziehende Angst in den Knochen. Bin ich nicht in einem wilden gräßlichen Traum, der mich nicht losläßt.“ „Also hätte Eure Durchlaucht nur darüber anzuordnen: wie sich Graf Tilly verhalten soll. Befehlt ihm, Waffenruhe anzubieten.“ „Ich wäre nicht besiegt, ich wäre nicht geschlagen, meint Richelieu.“ „Ein Entschluß hilft Eurer Durchlaucht.“ „Es ist nicht denkbar. Mein Arm, meine Knochen.“ „Die Lage hat sich zu Euren Gunsten gewandt; Ihr könnt eine entscheidende Rolle spielen.“ „Nun will ich aufstehen. Du hilfst mir, Kuttner, und begleitest mich auf meine Kammer. Ich freue mich. Es geht mir besser.“ Maximilian schwankte am Arm des schlanken sanften Kuttner durch die lange Kunstkammer. Sie gingen über den Hof. Dem Fürsten schauerte es in der Herbstluft. Er sah lächelnd seinen Begleiter an. Der Oberstkämmerer erwartete ihn auf der großen Freitreppe. Der Kurfürst hatte das Gefühl, bald froh zu schlafen wie lange nicht. Nur als er in der finsteren Nacht erwachte, fühlte er auf dem Rücken liegend die fremdartige Geschlagenheit, Zerbrochenheit, Zermalmung in seinen Gliedern. Er flüchtete, mit ihr ringend, in den Schlaf.
Der französische Gesandte Charnacé, der rothäutige Soldat, und Kuttner, am nächsten Tage vom Kurfürsten und seinen Geheimen Räten gemeinsam empfangen, reisten zu Gustaf Adolf ab. Sie brauchten nicht weit zu reisen. Jenseits des Thüringer Waldes stand er in Erfurt, nachdem er Leipzig Halle und Erfurt überzogen hatte. Vierzehntausend Schweden bevölkerten die Stadt. Der König wohnte im Gasthof zur Hohen Lilie. Er nahm die Gesandten auf einem Umritt mit; auf dem Petersberg, wo das Jesuitenkloster stand, fingen sie ihre Gespräche an. Der dicke König war von deutschen Fürsten umringt, er war lärmend freundlich zu ihnen, sie kamen zu keinem Ende. Er lud sie bei seinem Aufbruch, als sie mißmutig ihre Lage bedachten, ein, ihm noch einige Tage zu folgen.
Über Gotha und Schmalkalden in einem Haufen, über Arnstadt und Schleusingen im andern schob sich das Schwedenheer durch den Thüringer Wald. Während dieses Marsches ließ der König und keiner seiner Umgebung sich sprechen; die Gesandten wurden herrlich verpflegt; mit Jammern und Schmerz sah der weiche Kuttner, mit welcher Schnelligkeit man südlich kam, Charnacé erklärte fluchend, er werde nach zwei drei Tagen das Lager verlassen. Ihm graute auch; er sagte: zwei drei Tage, konnte sich aber von dem betäubenden Vormarsch nicht trennen; er mußte sehen, wohin das ging, ob es gar gegen Westen auf den Rhein zu ging. Vor ihnen ergab sich die Würzburgische Festung Königshofen auf das Anblasen der Trompeter. Mit stiller Trommel wich die kleine kaiserliche Besatzung aus Schweinfurt. Der panische Schrecken lief dem Schwedenheer voraus. Würzburg näherte man sich, der reichen Stadt des Fürstbischofs Franz von Hatzfeld. Die Stadt kapitulierte auf den Trompetenruf. Am linken Mainufer auf steilabfallendem Felsen das feste Schloß Marienberg: der Kommandant übergab es nicht. In der Nacht wurde es gestürmt innerhalb einer einzigen Stunde, keiner von der Besatzung entkam.
Man besichtigte die Beute: Reliquien, silberne vergoldete Brustbilder Ornate Kelche Kirchenschätze. Alles ritt in die Stadt ein; aus der fürstlichen Silberkammer wählte Gustaf, den Franzosen mit seiner plumpen Hand einzelnes weisend, für sich Edelsteine Perlen Gold und Silbergerät aus; die Hauptmasse stellte er seinen Offizieren zur Verfügung. Da war noch die berühmte fürstbischöfliche Bibliothek, für die der hochgelehrte Echter von Machspalbrunn jahrzehntelang gesammelt hatte; an ihr ritt man vorbei; der König gab Befehl, sie und die Bibliotheken der Universität und des Jesuitenkollegs in Ruhe einzupacken für den Transport nach Upsala.
Endlich ließ im Zeughaus der Schwede sich zu einer Unterhaltung mit den beiden fremden Herren herbei; Charnacé sprach erst für sich mit dem König. Der setzte sich auf den Rand einer Pauke, schlug vergnügt mit dem Seitengewehr auf das brummende Fell, umarmte Charnacé, brüllend: „Zu saufen, Marquis, zu saufen, zu saufen. Was hat uns unsere Freundschaft soweit geholfen. Laßt sie uns begießen.“ Man trug auf das Rufen des Königs Wein in Kannen und Becher her; flau trank Charnacé; er hoffe noch größeren Gewinn des Feldzugs und worauf der König hinauswolle. Das wollten sie alle, schluckte Gustaf, von ihm wissen; wisse es selbst nicht so genau; die Fortuna des Kriegs sei die Meisterin. Er tat dann, als verstünde er den Welschen nicht, wie weit er gegen den Rhein wolle; zeigte ein übermütig joviales Verhalten; nur nebenbei konnte der andere anbringen, daß sein König auf Metz gezogen sei, das ja seit Jahrzehnten unter französischem Schutz stünde, und daß er die Bevölkerung dort, die ihn gerufen habe, beruhigen wolle. Schmetternd lachte der Schwede und freute sich; ja er wüßte, daß sie ihn fürchten, sei wohl der Gottseibeiuns für sie, fräße und verschlucke sie, es sei ein Spaß. Er war nicht zu fassen.
Beim Hinzutritt des Bayern wurde der Schwede, der sich in übertriebenen Komplimenten erging, noch lärmender. Nun mußten Stühle und Bänke herangeschleppt werden; Grubbe und Oxenstirn sollten mit ihnen festieren hier im Zeughaus, wo alles sich so freue. Kuttner mußte vorbringen, daß er um besonderes Gehör mit seinem französischen Freund bäte. Das fand Gustaf kostbar und auch sehr schön. So würden sie denn zu dritt hier sitzen, miteinander schwatzen; er, der Kuttner, von dem er schon gehört habe, sei ja ein prächtiger junger Herr; wie spaßhaft: man könnte glauben, der Herr sei ein Edelfräulein, so schön und vornehm sei er; darum sollte er auch doppelt festlich aufgenommen werden von ihm und seinem Hofquartier, nach echt schwedischer Art. Nun fing Kuttner, der blaß und traurig war, da der fremde König nicht auf sein Geleis biegen wollte, mitten im prahlenden Gewäsch und Gekicher sein leises Vorbringen an; Gustaf veränderte sein Gehaben nicht, sie sollten nur abblasen, dieses hier, dieses außerordentlichen Weins zu verschmähen; aber Kuttner solle sich nicht stören lassen, er sei ein prächtiger junger Herr, er höre ihm mit wirklichem Behagen zu. Und so mußte Kuttner, vorsichtig von Charnacé, der neben ihm saß, sekundiert erzählen, was sein Herr ihm aufgetragen hatte: von dem bayrischen Wunsch, den gewaltigen Siegeslauf des Schweden nicht aufzuhalten und in Neutralität zu treten. Gustaf schrie, sich von der Pauke erhebend und seinen Becher absetzend, das sei ja ein Glückstag, ein unerhörter Glückstag; was sei ihm denn lieber als mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Er streckte, gewaltig im Lederwams mit der Riesenschärpe stehend, zu beiden Seiten seine Arme in die Höhe: so möchten zerschmettert werden, die Feindschaft und Tod durch ihr gehässiges tyrannisches Gebaren in die Welt trügen; er freue sich über alles Maß, daß alles so käme, wie er sich gedacht habe. Er umarmte den errötenden Kuttner; Charnacé lächelte melancholisch. So umarme er mit ihm den bayrischen Kurfürsten. Und darauf rülpste er stark. Sie sollten bald Bescheid erhalten. Er verabschiedete sich herzlich und immer wieder menschenfresserisch lachend und schmetternd von ihnen, die er seinem Kanzler empfahl.
An der Würzburger Domkirche vor den Gittern unterhielten die schwedischen Soldaten vier offene Spieltische; Säcke mit Talern und Dukaten standen neben ihnen; auf dem großen Platz brüllte zusammengetriebenes Vieh; für einen Reichstaler wurde die Kuh losgeschlagen, ein Schaf für einige Batzen. Wie in dem allgemeinen Lärm der Regimentsmusiken Spieler Tiere die Gesandten nach einigen Tagen über den Domplatz ritten, kam der königliche Kurier hinter ihnen her mit einem Brief. In ihrem Quartier lasen sie dann den schrecklichen schwedischen Bescheid. Neutralität des Bayern nähme der König herzlich gern an, jedoch müsse die Liga ihre herzliche Gesinnung ihrerseits auch beweisen, so, indem sie ihre Truppen auf zehntausend Mann vermindere, natürlich auch alles zurückgebe, was sie Evangelischen genommen habe, den König in allem Besitz lasse, den er okkupiere und okkupieren werde. Dafür werde der König Bayern nicht überziehen; er gewähre einen vierzehntägigen Stillstand zur Überlegung.
Nur dies war Kuttner sicher, daß er sogleich aus Würzburg aufbrechen wollte; wohin, wußte er nicht. Er klagte: „Ich kann nicht zu meinem Herrn mit diesem Bescheid.“ Ihm stand vor Augen der ernste Abschied von Maximilian. „Kommt!“ lockte Charnacé; den reizte die Begegnung mit dem Bayern, der sich so lange gegen das Bündnis mit Frankreich gesträubt hatte, „Ihr müßt hin.“ „Helft mir, Marquis, ach unterstützt mich vor ihm.“ „Habt Ihr Furcht vor Eurem Herrn? Ihr habt Eure Sache so gut gemacht.“
Maximilian nahm den Franzosen nicht an; vor Kuttner hingesunken stöhnte er: „Es ist eine Rettung; vierzehn Tage Zeit; ich kann es noch abwenden. Oder es ist eine Folter: ich muß es vierzehn Tage hinziehen und es muß doch geschehen, ich muß mein Land und mich vernichten lassen, wenn ich in Ehren bestehen soll. Verratet mich bei meinem Vater nicht, Kuttner; bleibt bei mir die Wochen. Es könnte doch sein, daß sich alles ändert. Glaubst du nicht, daß sich noch alles wenden kann. Es kann doch nicht wirklich sein, was mir jetzt passiert.“
Kuttner weinte, wie er allein war.
Unter der Annäherung der fremden Eroberer entstanden Revolten bei den bayrischen Landfahnen; viele flüchteten, suchten ihre Habe zu verstecken, sich und die Angehörigen in Sicherheit zu bringen. In dem straff regierten Lande ereignete es sich zum erstenmal, daß die Landstände gegen die neu auferlegten Kriegssteuern protestierten, auf der einberufenen Versammlung in München fehlten viele: Aufrührer gingen durchs Land. Vor Preising stellte sich ein kurzer Kerl hin, das Gesicht wie ein Waldmensch umwachsen, die Leute liefen ihm zu, predigte vom Schindeldach eines Häusleins:
Da käme der Schwede und juch, sie hätten den Krieg im Land. Würde ihnen das behagen! Der Krieg ist Sache der großen Herren. Bevor man ihnen nicht die Köpfe abschnitte, verharrten sie dabei, den Krieg auf die kleinen Leute zu jagen. „Der Kurfürst in München hat es in der Hand Frieden zu machen; es wird ihm nicht passen; er hat Pferde und ist bald davon. Legt die Fürsten lahm, alle zu Hauf. Es geht um eure Haut, ihr habt nichts weiter zu verlieren. Wollt ihr Lumpen und Hundsfötter werden, bis der gnädige Herr euch beim Schopf hat? Bis er euch gepreßt hat mit Weibeln, Profossen, Korporalen und seiner ganzen Teufelsgarde, daß ihr ihm dient im Krieg als seine Söldner und totgeschlagen und geschunden werdet, während der Schwede euer Vieh frißt, eure Scheunen ansteckt, euer Weibsvolk verschändet, die Kinder ins Feuer wirft. Des Kurfürsten Korporale werden mit euch ihr Spiel treiben, seht euch vor. Träges faules Volk ihr. Was ist denn ein Fürst, ein Herr, ein Kurfürst und großgewaltiger Kaiser. Macht einen krummen Buckel vor ihm und er ist euer Kaiser. Zeigt ihm den Steiß alle zusammen und ihr werdet sehen, wie lange er noch Kaiser ist. Er ist ja nur mächtig, weil ihr Furcht habt und Angsthasen seid. Er hat keine Macht. Aber seht eure Hosenböden an, da findet ihr sie. Betrug und Einbildung ist die Regiererei, auf dem niedrigsten und höchsten Thron. Ihr seid schuld daran, ihr alle, daß es uns so geht, man müßte euch mit Knüppeln totschlagen, daß ihr so dasteht und die Mäuler aufreißt. Der Krieg täte euch gut, damit ihr seht und fühlt und schmeckt, was ihr für gottvergessene Schurken und Hundsfötter seid. Was ihr versündigt habt durch Dummheit und Narrheit, wird kein Heiland gutmachen; er könnte zu euch kommen und ihr würdet ihn noch nicht ansehen, wenn er euch helfen will. Durch eure Dummheit und Furcht regieren die Fürsten, in eurem Kopf steht ihr Thron, für ihre Schandtaten und ihren Übermut bürgt ihr. Eure Jämmerlichkeit ist so groß, daß ich ein Maul wie der babylonische Turm haben müßte, um sie zu beschreiben. Es ist ja an der ganzen gefürchteten Macht der Fürsten und Tyrannen nicht viel mehr als an einem Traumschrecken, einem eingebildeten Alb. Feige Schufte haben die Fürsten groß werden lassen. O ihr jammerbaren Schufte und Klötze. Die Fürsten sind eine Schande, sie sind eure Schande. Sind die leibhaftigen Teufel und ihr seid des Teufels Mutter und Großmutter. Bald wird der Schwede da sein und ihr werdet sehen, wie sich der Teufel seine Gehilfen ausgesucht hat zum Dank, daß ihr ihn so dick gemästet habt. Lauft nach München. Da sitzt einer auf dem Thron, den ihr ihm gebaut habt, damit er in Ruhe Riemen aus eurer Haut schneiden kann. Sagt, es wird Krieg, Herr Kurfürst! Kommt der Schwede herein oder kommt er nicht herein. Helft uns. Er wird euch totschlagen lassen für sich. Tut euch zusammen zu einem Gewalthaufen. Nehmt eure Messer. Und wenn er nicht sagt, was euch gefällt, so könnt ihr eine Freude haben: die Fürsten haben einen Hals zwischen dem Kopf und den Schultern; macht euch einen Spaß. So ein Mann spritzt nicht mehr Blut wie ein Kalb.“
Über den Thüringer Wald herüber auf Königshofen, Würzburg. Westwärts mainabwärts durch den winterlichen fränkischen Kreis. „Die Goten kommen, die Vandalen kommen!“
In Würzburg inthronisierte sich der Schwede als Herzog von Franken; die Stiftsangehörigen, geladen auf den Markt von Statthalter Kanzler und Räten, schwuren betäubt mit handgebender Treue einen Eid zu Gott und auf das aufgeschlagene Evangelium, niemanden anders als die Königliche Majestät von Schweden, deren Nachkommen und Regierung als alleinige Landes- und Erbherrschaft anzuerkennen. In dem Tosen des Marktes feierte ein schwedischer General, von einer Freitreppe radebrechend, die Würzburger, die die Köpfe senkten, als seine neuen Landsleute und gute Schweden. Ausschwärmend nahm der Schwede von dem Land Besitz. Abteien und Klöster Frankens fielen seinen Generalsoffizieren zu. Es gab nur herrenloses Land, Menschen und Gut. Dem ehemals schwedischen General Herzog Georg von Lüneburg wurde die Stadt Minden, das mainzische Eichsfeld zuteil. Die freie Reichsritterschaft schickte huldigend ihren Direktor, den großmäuligen Adam von Rotenhan, samt zwei Grafen von Erbach; sie erhielten hingeworfen die Benediktinerabtei Amorbach. „Der evangelische Glaube siegt!“ brüllten die beladenen Finnen, die Schweden auf ihren keuchenden Beutepferden; es durfte niemand ihnen etwas verwehren, sich und seine Habe verschließen. Sie übten Gerechtigkeit mit Feuer Schwert und Torturen, in schmachvoller Knechtschaft hatte das Reich bis da gelegen, den Papisten durfte es nicht gut ergehen, den Lutherischen nicht besser: so stachelten sich die Fremden.
Immer mehr Deutsche schlichen um den leckeren Tisch. Dem Grafen Löwenstein-Wertheim stopfte man den Rachen. Der Rat der Reichsstadt Schweinfurt verbeugte sich vor den Knechten Offizieren Generalen und der königlichen Würde selber; vierzehn würzburgische Dörfer, dazu Güter des Hauses Echter und Klöster waren für die Stadt zu haben. Nürnberg lag im Rücken, man ließ es nicht vorbei, es sollte sich entschließen; die Korona der städtischen Hochgelehrten und Genannten beriet sich, der schreckliche Herzog von Franken fragte sie dringend durch seinen Unterhändler nach ihrer Gesinnung; sie unterwarfen sich, versprachen zu liefern, was er wollte. Der ganze Kreis, mit Peitschenhieben und Sporenstößen angefahren, gelobte zweiundsiebenzig Römermonate für das gemeine evangelische Wesen zu bewilligen. Zu Regensburg hatten die drei geistlichen Kurfürsten das große Heilige Reich mitordnen helfen, sie hatten das gewaltige Tier Wallenstein von seiner Armee gejagt, die Armada zerblasen. Ihre Macht waren jetzt Buchstaben, geschrieben auf brennbarem Papier; Reichsgrundgesetze, kaiserliche Wahlkapitulation: der König der Schweden Goten und Vandalen wollte nicht lesen. Er fragte nach der Zahl ihrer Knechte. Dann fragte er, ob sie seine Freunde wären, und sie sollten ihm für diesen Fall monatlich vierzigtausend Reichstaler zahlen, Proviant liefern, ihre Festungen überlassen. Sonst werde er ihre Städte verwüsten, und wenn sie rebellierten, das Kind im Mutterleibe nicht schonen. Die geistlichen Herren spien.
Er zog mit zwölftausend Mann auf Frankfurt am Main, zum Bockenheimer Tor hinaus auf Höchst. Kastell, Bingen und Mäuseturm in seiner Gewalt. Eisiger Winter. Er bedurfte schon keiner Truppen mehr zum Sieg. Acht schwedische Reiter überfielen die Stadt Eberbach am Neckar, nahmen sie ein; Beute machten sie, die Behörden ließen sie einsperren. Mit sechstausend Mann zu Fuß, dreitausend Reitern, dabei vielen Engländern richtete sich das Heer auf Mainz. Das steckte nach zwei Tagen die weißen Fahnen heraus; von Wittenhorst saß drin, mit Sack und Pack, Ober- und Seitengewehr, zwei Feldstücken zog er aus nach Luxemburg.
Dann saß die schwedische Majestät, die aus Upsala über die Ostsee mit Schiffen gefahren war, Pommern und Brandenburg unterworfen, bei Breitenfeld Tilly den kaiserlichen Feldherrn beiseite geschleudert hatte, in der Sankt Martinsburg und überwinterte. In Ruhe, barbarischer Lust breiteten die Schweden sich in der Stadt aus. Furchtbare Summen wurden der Geistlichkeit und Bürgerschaft auferlegt. Die Brandschatzung konnte nicht gezahlt werden, da liefen die Fremden in die Kirchen Klöster Kollegien, versteigerten zum Fenster hinaus die Ausstattung an Bürger aus Frankfurt und Hanau. Die Schatzung der Bürger wurde auf sie häuserweise verteilt, die Häuser der Schuldner niedergerissen straßenweise, das Holzwerk verkauft. Rasch ging man ans Schanzen, riß Klöster und Kapellen nieder, die Kirchen verwandelten sich in Ruinen für Festungswerke. Beim Abbruch sang man den Katholischen zum Hohn: „Ein feste Burg ist unser Gott“, die Sankt Albanskirche streckte man hin als Schanze Gustafsburg an der Einmündung des Mains; so half sie, sagte der schwedische General, Gott loben.
Der Schwedenkönig ruhte monatelang in Mainz. Er lag in dem grellen Licht des Schreckens. Die Deutschen liefen um ihn. Von drüben, von Schweden hörte er nicht viel. Einsilbig waren die Nachrichten, klagend über den schweren Druck, der auf dem Lande liege, grollend über das verzehrende deutsche Wesen: daniederliegt der Handel, kein Silber im Land, die Kupfermünzung betrügerisch; unerhörte Teuerung, verödet ganze Bezirke, Kirchspiele ohne einen kräftigen Arm. Der König fragte vorsichtig an um sechs Regimenter zu Fuß, der Reichsrat bewilligte knapp drei. Es kam in der Antwort heraus: so wild eroberisch sei der deutsche Krieg nicht gedacht gewesen. Seinen Ärger blies Gustaf von sich; so war die Sache nicht gedacht, aber er hatte Deutschland, sie würden sich ändern. Er wollte die evangelische Vormacht in Europa an sich nehmen und sich dem Kaiser, dem Haupt der Papisten, starr gegenübersetzen als Haupt des evangelischen Wesens.
Und in der Tat: wenn er schon gläubig gewesen war, nach seinen Siegen ließ er Taten sprechen. Gnadenlos fielen in diesem Winter alle fremden Gotteshäuser und Kapellen; er sagte: es solle, soweit er gebieten könne, kein Spott mit dem Namen Gottes getrieben werden. So gewalttätig fest er war, hier fürchtete er, etwas zu versehen. Oxenstirn selbst wunderte sich, wie wahnsinnig die Augen des Königs flackerten, wenn Flüche um ihn laut wurden, wie er mit eigener Hand gottlästernde Knechte den Profossen übergab und sich nicht eher beruhigte, bis er sie am Galgen sah. In der Martinsburg sprach er zu Weihnachten die Herren aus Nürnberg an, wies ihnen eine Schrift, das Buch eines Archidiakonus zu Rochlitz, von dreifachem schwedischen Lorbeerkranz und der triumphierenden Siegeskrone; darin nannte man ihn Josua, Gideon, Matathias; man berief sich auf die Apokalypse, sprach davon, er solle nach Rom gehen und die Stadt zerstören. Um die nürnbergischen Herren wogte der Schrecken, sie hörten demütig zu. Der schmerbäuchige Riese stand vor ihnen mit einem mächtigen schmucklosen Hut, unwiderstehlich sicher wie Lämmern blickte er ihnen ins Gesicht: was Bayern und die katholischen Erblande früher vermocht hätten! Wenn sich alles zusammentäte: Pommern, Mecklenburg, Ober- und Niedersachsen, die Pfalz, Franken, Schwaben, Reichs- und Hansastädte. Sie waren froh, entlassen zu werden.
Und wie vor den ausruhenden Löwen immer neue Gesandte der deutschen verängstigten Stände zogen, bündnisbeladen, kontributionspflichtig abrückten, der Herzog von Celle, Bischof von Minden, Graf von der Wetterau und vom Westerwald, Räte der Stadt Braunschweig, Ulm, Lübeck, Lüneburg, Bremen, der vertriebene Herzog von Mecklenburg, da nahm auch der schöne feine Friedrich von der Pfalz Abschied von den Hochmögenden im Haag. Der Stein sollte wieder auf einen Wagen gehoben werden. Die ganze Versammlung stand auf von den Bänken, als er an der Tür erschien, den buntfedrigen Hut zog, sein schlaffes leicht gedunsenes sehr ernstes Gesicht bot und den linken Arm schwenkend über sie mit strengen blauen Augen blickte, die wie Glocken läuteten. Nun gehe er glücklichen Zeiten entgegen, nickte schwer der greise Vorsitzende, der, den Hut auf dem Kopfe, sitzen blieb; sie freuten sich, seine Wirte, ihren Gast und Freund so nahe an der Erfüllung seiner Wünsche zu sehen; wer ausharre werde gekrönt. Friedrich bewegte stumm die Lippen. Er war mit den Gedanken nicht anwesend, nickte nur; hörte, daß man ihm eine Ehrengabe von fünfzehntausend Talern zudachte. Niederländische Reiter nahmen ihn, die englische jubeljauchzende Elisabeth und den Hof in ihre Mitte; bis in das wintervergrabene Hessen gaben sie das Geleit. Das war Hessen, das war Frankfurt, das war Mainz. Die Karossen fuhren hinter den Trompetern in die Stadt. Vor der fahnenschwingenden teppichbehängten Martinsburg, zwischen den Ruinen der Häuser, wimmelnden Schweden und Finnen auf einem gepanzerten Pferd der ungeheure Gelächter abprotzende Gustaf Adolf. Schnee fiel über ihre Schultern. Am Arm der schwedischen königlichen Würde kletterte die aufblühende üppige Engländerin in den weiten Speisesaal, auf dessen Kredenzen der Raub deutscher Landschaften prunkte. Hinterher schleifte verschwiegen und wehrlosen Blicks der schlanke Winterkönig, die gehobenen Finger einer mageren langen Frau berührend, hektische Wangen, purpurnes schweres Brokat, die von Minute zu Minute vor Hysterie schrie, das Weib des Fremden.
Ein leichter Schwindel befiel den Pfälzer bei Tisch, als der Fremde ihn „Majestät“ nannte. Woran wurde er erinnert; man reichte Waschbecken und Handtuch, der Fremde wollte sich erst nach ihm waschen, der König aus Schweden: warum tat er das? Man wollte ihn mit Kunst lebendig machen. Maskenball. Pechfackeln auf vier Ecksäulen in allen Sälen; Halbdunkel in der Flucht der geöffneten Säle. Geigenmusik von bischöflichen Kapellen, Trompetenbläser, Hatschiere. Der König tanzte im russischen Kleid plumpe Nationaltänze; sein Kaftan aus Goldstoff, sein Kopf unter der weißen eiförmigen Mütze versank im hohen Zobelkragen, die Füße traten und stampften in stumpfen roten Schuhen, vorn mit Perlen besetzt; die Arme warf er nach rechts und links, sie steckten in röhrenförmigen weiten Ärmeln. Die pfälzische Dame sprang als türkischer Krieger daneben, wies ihre dicken Beine in schwarzsamtenen Strümpfen, geschlitzten Schuhen; bis auf die Knie fiel ihr weitfaltiger violettgeblümter Rock; der grüne Turban schlang sich um die Ohren; man sah die blonden Haare nicht, nur das sprühende glührote volle Gesicht. Unkostümiert mattäugig der Pfälzer, trinkend in einem dunklen Erker, allein einen Tisch rundum umfassend. Der kleine spitze Rusdorf trat grüßend an. „Rusdorf! Was willst du, Rusdorf? Tanz mit, Rusdorf!“ „Ich bin nicht geladen, Kurfürstliche Gnaden.“ „Ksss—s, tanz! Der König ist auch nicht geladen, er tanzt auch.“ „Der König? Der König ist Wirt.“ „Laß mich in Ruhe. Er ist nicht geladen.“ Rusdorf hielt seinen Herrn für betrunken, suchte ihm über den Tisch ins Gesicht zu sehen. „Ihr hetzt mich, Ihr hetzt mich, Ihr laßt mir keine Ruhe.“ „Der Herr Kurfürst ist so allein, ich rufe die durchlauchtige Frau.“ „Ich sag’s dir laut: ich lebe und sterbe als der ich bin. Das hättest du hier mir nicht zeigen sollen, dazu hättest du mich nicht holen sollen, daran hab’ ich kein Teil.“ Leise Rusdorf: „Dann blieb Euch nichts als Euch dem Kaiser zu unterwerfen.“ „Hätt’ es sollen. Ihr habt es mir nicht geraten.“ „Der König!“ flüsterte Rusdorf; die Schwedenmajestäten näherten sich. Friedrich trank, trank, stöhnte; seine Augen begannen zu glitzern.
Nicht einmal, als die erschütternden Nachrichten aus dem Westen kamen konnten sich die Wiener Räte zu der Wiederberufung des Friedländers verstehen. Man nahm zu der Schreckensnachricht von Mainz die Botschaft hin, daß sich der Trierer Philipp Sötern unter den Schutz des Franzosenkönigs gestellt, die Festungen Koblenz und Ehrenbreitenstein aus Entsetzen vor dem Schweden den Franzosen übergeben hatte. Eine tief beschämende Kunde lief ein aus Köln; dorthin hatten sich die Fürstbischöfe von Mainz Würzburg Osnabrück Worms geflüchtet; sie versicherten durch den Mund des Kölner Ferdinand, in kaiserlicher Devotion zu verharren. Aber der Kaiser sei weit, ihre Lande, die Kirche, ihr eigenes Leben in furchtbarster Gefahr; sie hätten, ohne die kaiserliche Zustimmung abwarten zu können, sich entschlossen, den Allerchristlichsten König Ludwig um Hilfe anzugehen. Ihre Vertreter seien nach Paris unterwegs.
„Was kann uns noch geschehen?“ fragte Trautmannsdorf, „wir sind in Deutschland ein wurmstichiger Apfel; Habsburg ist faul, der Schwede ist der Wurm und der Franzose ist der Wurm. Hilft nur schneiden.“ „Was bleibt von dem Apfel übrig.“ „Es wird uns bald nichts übrigbleiben, mein lieber Freund Eggenberg, als der Schwedentrunk oder ein schmerzloser Schwertschlag durchs Genick von unserem alten Gönner Wallenstein.“ „Ich weiß, daß Ihr den Friedländer wollt und der Kaiser ist nicht abgeneigt. Und wie lange dauert es, bittet der bayrische Maximilian ihn wieder zu bestallen. Wir werden ihn holen müssen. Es ist kein Gut daran, Trautmannsdorf.“ „Nun dacht’ ich, mein liebwerter Freund sei von seiner Abneigung durch das Breitenfelder Treffen befreit.“ „Der Friedländer ist stark wie der Teufel; ich hab’ es von Anbeginn gewußt. Wir hätten gewiß den Schweden nicht gehabt, wir hätten aber ein anderes Unheil gehabt. Wer weiß, ob der Kaiser noch in Wien säße, ob Ihr und ich uns über Reichsangelegenheiten unterhalten könnten.“ Der Graf lachte: „Wär’ es ein Schade? Ihr meint, der Friedländer säße dann hier. Ihr wißt, ich konnte mich auch nicht dafür begeistern. Aber ich meine: ist es angenehm, den Schwedentrunk hier zu schlucken? Angenehmer als sich vom Friedland den Kopf schmerzlos abschlagen zu lassen?“
Es blieb Rettung bei Spanien und dem Papst zu suchen. Spanien war zu jeder Leistung bereit. Zum Papst Urban reiste aus Preßburg Pazmany, der Erzbischof von Gran, die Leuchte des Glaubens. Liebevoll hatte Ferdinand seinen alten Ratgeber Eggenberg empfangen, hatte angehört, was er unternehmen wollte, den Brief gelesen, den er für den Heiligen Vater entworfen hatte. „Wir werden verlassen von denen, deren Sache mit der unsrigen gleich sein sollte. Und nicht bloß das: der König, der den Namen der ‚Allerchristlichste‘ führt, gibt dem Schweden Geld und andere Mittel, uns zu bekriegen. Es betrifft nicht nur uns, sondern den Bestand der Kirche und damit Eurer Heiligkeit. Zu Eurer Heiligkeit strecken die Angehörigen der Kirche in Deutschland um Hilfe flehend die Hände empor. Wir bitten, daß Euer Heiligkeit den Allerchristlichsten König abmahne von dem schwedischen Bündnis, das er geschlossen hat wider den Regensburger Vertrag, und ihn auffordere gegen den Zerstörer der Kirche an unsere Seite zu treten.“
„Wie könnt Ihr schöne Briefe schreiben, Eggenberg. Schön stilisieren! Schlau setzen. Welcher Advokat ist an Euch verlorengegangen.“ „Unsere Not ist groß, gnädigster Herr, sie ist ungeheuerlich, kaum aussprechbar. Das Reich war noch nie in solcher Gefahr.“ „Und ist es nicht recht beschämend für uns, dem Heiligen Vater solchen Brief zu schreiben.“ „Nur eins bitte ich Eure Kaiserliche Majestät, mir diesmal willfahren zu wollen.“ „Warum so ernst, Eggenberg; will Euch ja gern willfahren.“ Und als Eggenberg ihm nur stumm die Feder hinhielt: „Sieh da, wie Ihr zittert!“ Steif hielt Eggenberg die Feder, wortlos schrieb Ferdinand nach einer Weile.
Und lautlos, als er unterschrieben hatte, stand Ferdinand, wie von einer Eingebung berührt, von seinem Stuhle auf; das rieselnde Gewimmel der geschnitzten Männer und Frauen an den Lehnen sank hinter ihm herunter, sein Gesicht gesenkt, von einem Lächeln der Spannung verzogen, seine Stimme hoch leise fragend: „Es ist gut, daß ich dies unterschrieb. Der Weg ist gut, Eggenberg. Ich billige ihn. Ich bin dabei. Ihr wollt den Heiligen Vater befragen. Es soll mir eine Freude sein ihn zu hören. Ich möchte eine Stimme von ihm hören.“ Und dann als Eggenberg dankbar antwortete: „Eggenberg, dies hat dir die Jungfrau eingegeben. Woher hast du das? Du willst den Heiligen Vater befragen. Siehe da, wir werden den Heiligen Vater sprechen hören. Wir werden ihn hören.“ „Er wird uns nicht im Stich lassen.“
Ferdinand hob den linken Arm, streckte den Zeigefinger in die Höhe: „Die Frage wird an ihn herantreten. Er wird ihr nicht aus dem Weg gehen können; sein Geist wird antworten müssen. Ein Versuch. Eine Versuchung.“ Mit den Händen rückwärts den Stuhl abtastend ließ er sich nieder; er lachte wieder gutmütig und zerstreut, den Kopf auf den Tisch über dem Schriftstück aufstützend: „Ich weiß, wie er antworten wird, Urban der Achte in Rom.“
Der große Pazmany hatte sich auf den Weg gemacht, den Heiligen Vater zum Schutz des alleinseligmachenden Glaubens im Römischen Reiche zu bewegen. Einen Monat reiste er aus Ungarn, während der schreckliche Schwede seine Verwüstungen weiter trug. Ehre erweisend kamen ihm römische Edle und Kardinäle vor Rom entgegen. Den Kardinalshut verlieh ihm der Papst, ehe er sprechen durfte. Dann suchte ihn der Papst zurückzuschrecken, indem er ihn warnte, sich zum Gesandten herzugeben, ein Kardinal, der im Rang eines Königs stände. Die Nachgiebigkeit Pazmanys ebnete alles; der Papst konnte nicht ausweichen.
Wohin der Heilige Vater es kommen lassen wolle in seiner Furcht vor Habsburg; ob die vielen Millionen frommer rechtgläubiger deutscher Seelen es bezahlen sollten mit ihrer Seligkeit, wenn der Ketzer über sie käme. Da verbat sich der Italiener, nervös die Zähne fletschend, die vulgäre Rhetorik. Pazmany gab nicht nach, obwohl ihn schauerte; er dachte an das, was ihm Lamormain vom Kaiser gesagt hatte; mühte sich für den Kaiser. Der Papst, starkknochig herumwandernd um den stehenden Ungarn, grollte heftiger, je mehr er fühlte, daß der Fremde ihn bloßlegen wollte; er schrie drohte höhnte wurde giftig. Bei der zweiten Begegnung kam es wie erwartet zu keiner Unterhaltung; Urban, seinen Schnauz- und Backenbart reibend, gab schmatzend und wohlgelaunt von sich, was er den Bescheid nannte; ein Zettelchen, auf dem er die Punkte notiert hatte. Den Franzosenkönig abziehen vom schwedischen Bündnis? Er hätte König Ludwig immer für einen frommen Katholiken gehalten, versehe sich von ihm nur Gutes für den Glauben, werde ihn ermahnen. Ein Bündnis mit Spanien und Habsburg? Nein; er kämpfe so wenig gegen Habsburg wie gegen Frankreich. Geldunterstützung? Er hätte kein Geld. „Genug; weiter kein Wort. Ihr seid als Kardinal hierher gekommen, ich habe genug von Euch als Gesandten gehört; entwürdigt Euch nicht, raubt Euch nicht selbst kostbare Zeit.“ Sitzungen, Feiern, Messen.
Und dann in seinem Rücken der ausbrechende Jubel des Adels auf dem Kapitol: „Der Kaiserliche zieht ab! Gottes Rache! Gottes Rache! Gottes Barmherzigkeit hat sie ihr Ziel nicht erreichen lassen. Jetzt werden sie Rom nicht plündern.“
In Scham fuhr der große Lehrer Pazmany ab; der päpstliche Pomp begleitete ihn eine Strecke. Scham und Erschütterung; es war erwiesen, daß die Kirche nicht einte. Die Fahrt ging ihm zu schnell, er wollte zwei Monate drei Monate reisen. Und nach drei Monaten war nichts gebessert; er wollte schneller hin, alles ablegen, sich in die Bücher verstecken. Die Schmach vor den Ketzern.
Wie ein feuersprühender Drache stand der unscheinbare kleine so freundliche Eggenberg vor ihm: „Ihr braucht Euch nicht zu entschuldigen. Ich weiß, Ihr habt getan, was ein Mensch tun kann. Dieser da in Rom hat nicht getan wie ein Mensch. Das ist der Ruin. Das ist der Verrat am päpstlichen Stuhle. Wir in Not, unser Land mit Millionen Katholiken, und an Politik gedacht! Wir am treusten ihm anhängig, am reichsten der Kirche spendend, und er kann uns nicht unterstützen, hat keine Waffen und kein Geld.“ Trauervoll besänftigte ihn Pazmany; Eggenberg wurde bitterer, stand vernichtet. „Dies heißt, der Papst legt uns Wallenstein auf. Befiehlt uns, selber Hand an uns zu legen. Ein niederer, o so niederer falscher Zug. Das hat ihm Richelieu zugeflüstert; es ist so unmenschlich schlau, ich weiß nichts dagegen. Sie haben wohl schon alles beredet mit dem Friedländer, es läßt sich mit ihm leicht regieren. Sie werden sich täuschen. Wie er über das Reich und über Habsburg fallen wird, so über den Papst und Frankreich. Sie werden bereuen, was sie uns angetan haben. Daß sich die Waffe nicht gegen sie wende, daß sich das Verbrechen gegen sie selber richte.“ Stundenlang sprach Pazmany auf seinen verstörten kleinen Freund ein, dann Abschied mit verwirrten Worten, Hals über Kopf aus Wien; nach Ungarn.
Eggenberg zog sich mit Riemen am nächsten Tag vor Ferdinand, jeden Schritt bezahlte er mit einem Entschluß. Wie Ferdinand ihn kommen sah, richtete er sich mit demselben sonderbar gespannten Ausdruck aus dem Stuhl auf ihn, hauchend: „Seht, seht, da kommt Ihr.“ „Nun, was werdet Ihr mir berichten.“ Eggenberg berichtete, Pazmany sei erzürnt zurückgekehrt aus Rom, wo er den Papst gesprochen habe. Der Kaiser immer stehend: „Seht, er hat den Papst gesprochen. Und der Papst, ja, was hat er gesagt?“ „Er hat nichts Schriftliches mitgegeben. Hat auf einem Zettelchen sich drei Punkte notiert und das hat er dem Kardinal vorgelesen.“ „So ist es. Dies hat er vorgelesen.“ „Es soll nicht möglich sein mehr Geld zu steuern an uns wie jetzt; es ginge nicht an, den französischen König scharf zu verwarnen oder an unsere Seite zu verweisen, und uns anschließen könnte sich der Papst gar nicht.“ „Es ist nicht möglich Geld zu steuern und sich mit mir zu verbünden.“ „Er kann den König Ludwig nicht scharf verwarnen.“ „Seht Ihr! Seht Ihr!“
Fassungslos heulte der alte Eggenberg an seinem Kaiser, die Tränen liefen ihm in die breitgezogenen Mundwinkel; er weinte, ohne das Gesicht abzuwenden, wiegte in Schauder und Schmerz den Kopf hin und her. Gleichgültig spielte Ferdinand mit seiner Schärpe, schlenkerte das Goldene Vließ. Als wenn es nichts wäre, meinte er, Eggenberg möchte doch nicht weinen. „Weinen. Wer wird weinen. Was im Leben alles geschieht. Sind wir denn verlassen? Was einem begegnet.“
Und er gähnte, während sein Blick plötzlich, schielend abwich. Aufstehend und blaß tiefsinnig an seinen Gamaschen heruntersehend rekelte er sich: „Das war also diese Geschichte. Vom Papst. Man muß nicht alles tragisch nehmen.“ Legte heruntersteigend, munter schwatzend seinen Arm von rückwärts um Eggenbergs Leib, zog ihn: „Ich weiß etwas. Wißt Ihr, wie spät es jetzt ist? Bald vier. Es ist Schneewetter, daher diese Trübe. Kommt mit, mein Freund, Schlittenfahren.“ Und er pfiff und sang: „Wer läßt sich Lasten auf die Schultern legen, die er nicht mag.“ „Ich bin noch glücklich,“ lächelte abwesend verlegen, plötzlich dunkel bestürzt der Rat, „daß Majestät es leicht nehmen.“ „Ach, wenn Ihr wüßtet, was einem für Dinge über den Weg laufen.“
Ferdinand gähnte laut an der Tür, rollte seinen Rumpf plötzlich welk zusammen. Er seufzte, aus sich klagevoll und irre heraus, sagte sanft etwas zu sich selbst.
Verabschiedete sich schwärmerisch zärtlich, heiter gespannt, stolzierend wie ein Schauspieler von seinem Besucher, dem er die Hände drückte und vor die Brust klopfte.
Auf dem baumbestandenen Hradschin über der breitfließenden Moldau kauerte der Böhme. Michna, der fette kurzatmige Riese, wie er ihn so sitzen sah, wollte sich vor ihm retten; die friedländische Herrlichkeit war erloschen, er wollte sich losreißen und fuhr nach Wien. Mit Wonne empfingen ihn die Herren; Abt Anton schnurrte wie eine Katze um ihn; der würde sie vom Friedländer loskaufen. Wie sich Michna zurechtmachte, einen Teil seiner Güter zu verkaufen, um sich am Kaiserhofe mit Darlehen festzusetzen, traf ihn Wallensteins Schlag. Er hatte den Böhmen für tot und abgetan gehalten, sein Platz schien ihm frei zu sein; da sauste die Hand des andern gegen ihn. Die Güter waren verkauft, der größte Teil seines Vermögens; ehe aber die neuen Besitzer zahlten und das Land übernahmen, rückten Gewalt brauchend Wallensteiner, Musketiere und Kürisser, die in Prag auf Kosten des Herzogs hausten, über den Boden, besetzten ihn, ließen, einen unerhörten Rechtsbruch begehend, nicht davon, obwohl aus der Kanzlei des böhmischen Gouverneurs Schreiben über Schreiben bei ihnen und dem Herzog einliefen.
Michna, am Wiener Hofe tobend, glaubte leichtes Spiel gegen den abgedankten General zu haben. Aber die Kriegsräte wollten unerwarteterweise mit Maßnahmen nicht heran. Michna forderte Truppen, die Schweden zogen alle auf sich. Die Räte legten sich darauf, den Herzog zu bitten, die Söldner zurückzuziehen. Vom Hradschin herunter kam erst kein Bescheid und dann: Wallenstein vermöge nichts über ausschreitende Kompagnien. Man mußte biegen oder brechen; die Räte baten den Serben, die betrübliche Sache nicht weiter zu verfolgen, er kenne die Notlage des Reiches, den Zerfall des Heeres; schließlich: sie könnten nichts gegen den Herzog von Friedland unternehmen, man könne es nicht wagen; ob sich denn versöhnlich nichts in der Sache machen ließe. So sah sich Michna, im Begriff, ins Nest des Friedländers zu fliegen, genötigt, mit ihm zu verhandeln.
Mußte zurück von Wien, mußte nach Prag, mußte, als Briefe und Kuriere nicht angenommen wurden, auf den Hradschin und wurde auch nicht angenommen. Jeder Tag verminderte seinen Reichtum, die Soldaten verpraßten seine Habe, verschleuderten seine Geräte, trieben die Verwalter heraus. Eine halbe Woche lang lief Michna im Hut durch die Gassen, stand besinnungslos in seiner Stube, wartete an der Tür. Als er auf dem Hradschin empfangen wurde, zählte Wallenstein, der leise sprach, die Silben, gab ihm einen Teil der Güter wieder heraus, aber nur einen Teil. Auf einem Zettel hatte der Herzog vor sich ein Verzeichnis der freigegebenen Güter; Michna, seufzend und ohne Gedanken, tastete nach der Feder, um das Verzeichnis durch seine Unterschrift anzuerkennen. Er blieb in Prag.
Der Vorfall lockte den gewaltigen de Witte in die Stube des niedergeschlagenen Mannes. Mit stummer Neugier und Kopfschütteln hörte er die Einzelheiten; man müsse vorsichtig sein, warnte er, aus dem Ereignis ginge hervor, daß der Herzog das Spiel nicht verloren gebe und daß man sich in Wien vor ihm fürchte. Auf der Hut müsse man sein, es werde von allen Seiten gesagt, der Herzog plane etwas. Michna möge sich aufrichten; es sei im Reich noch immer der Friedländer, durch den man zu Besitz komme; er lächelte: „Der Schlüssel zu allen Schränken.“ Mit breitem grämlichen Mund Michna: „Ich mag nicht mehr.“
Der Herzog wartete auf dem Hradschin. Spielerische höfliche huldvolle Briefe des Habsburgers kamen an; die Kuriere wurden verschwenderisch belohnt, die Briefe mit immer größerem Behagen gelesen. Auf dem Schloß stellte sich häufiger der Schwager aus dem Hause der Trzka von Lipa ein, der Graf Adam Erdmann, ein fröhlicher blondbärtiger Mensch, der einen kollernden Baß sprach, im Tanz seine süße Maximiliane herumführte, mit ihrer Schwester, der Frau des Herzogs, ein sanftes Getue Kosen und Lärmen trieb. Der Herzog sah es gern, er liebte seinen Schwager. Die böhmischen Vettern, die den Herzog aufhetzen wollten, die Rebellion in Böhmen zu organisieren, half der Trzka lustig verjagen. Nicht aus dem Hause nach Dimerkur, seinem Sitz, wollte ihn der leidende Friedländer lassen; auch die Herzogin bat ihn zu bleiben.
In eine sonderbare Verfassung war Wallenstein geraten. Er alterte furchtbar. Sein hartes Gesicht war mit Runzeln übersät. Die Haare über den Ohren wurden weiß, standen in Büscheln ab, die Augenhöhlen waren zu weit für die kleinen Augäpfel, ganz im Grunde lagen sie da hinter ihren Häuten, im Begriff, völlig in den Kopf zu schlüpfen. Die Breitenfelder Affäre war in dem kritischen Augenblick über ihn gestürzt, als er mit de Witte plante, nach Hamburg zu gehen, seine gesamten böhmischen Liegenschaften zu verkaufen, von dieser Ecke des Reiches zusammen mit den Hansastädten, vielleicht dem sehr still gewordenen Dänen Christian etwas zu unternehmen. Der Kurier, der die Breitenfelder Nachricht brachte, sah — er glaubte wie alle, dem Herzog etwas Freudiges zu melden — bestürzt den verabschiedeten Generalissimus, der im herbstlichen Gartenhaus neben Trzka auf einer Bank saß und mit Muscheln vor sich warf, tief erblassen, die dünnen Lippen sich öffnen. Die scharfen Äuglein irrten zitternd von Lidwinkel zu Lidwinkel, wichen schielend auseinander; sachte rutschte der lange Oberkörper die Lehne herunter über die Bank, hing mit baumelnden Armen zum Parkett herunter.
Nach einer Stunde stand Friedland, torkelte am Arm des Trzka vor den Bogenfenstern seines Pfeilersaales auf und ab, schob den Kiefer vor, kaute gräßlich: „Er ist mir zuvorgekommen, der dicke Schwede. Ich habe es mir gedacht. Hat den Tilly zerschlagen. Er kommt über den Kaiser. Sie sind wehrlos. Für den Schweden hab’ ich gearbeitet, für das Großmaul aus Upsala.“ Er spie, fuchtelte höhnend, mordsüchtig mit der Faust: „Aber der Tilly. Der gute Alte. Gute Alte. Der Spaniole. Gedachte mich zu beerben. Beim heiligen Blut Jesu, ich hätte ihn gern verenden sehen. Der Schwede wird glauben, er könne kommen, das Reich liege da, es warte nur auf ihn. Wo steht der Schwede. Du mußt hin zu ihm, zu Arnim. Ich bin noch nicht tot.“
Krächzend, laut brüllend, jammernd: „Zottel nicht herum. Setz’ mich ab. Wo der Schwede steht. Mich schlägt er selber tot. Wie lange sind wir noch in Böhmen. Wir sind ja wehrlos. An jedem Tag rückt das Vieh vorwärts; und ich kann mich nicht regen.“ Wimmernd von Wut betäubt ließ er sich auf seiner Fensterbank gegen die Rückenlehne schieben: „Mit mir ist es aus für alle Welt. Der lutherische Lump, nun hat er sich den Augenblick ausgesucht, schluckt den Braten. Du wirst sehen, er schluckt ihn. Mich mit.“ Er suchte mit seiner schüttelnden schlagenden Hand in den Taschen seines grünseidenen Schlafrocks, ein Papier knisterte: „Der Ferdinand. Mich hat er beschwichtigen wollen, damit ich ihm nichts tue. Nun kommt der andere. Dem schreibt er keine Briefe. Ich — ich — ich kann nicht denken.“ Er wollte verzerrt lachen, wieder wurden seine Lippen weiß. Trzka hielt ihn fest, schrie nach Wein. Sie trugen ihn auf seine Schlafkammer.
Nach Zuziehung des Rittmeisters Neumann besprachen sie sich in die Nacht hinein. Da kam heraus, daß der Friedländer durch verschwiegene Leute längst mit dem Schweden angebunden hatte; der Herzog hatte um eine Zahl Regimenter nach Böhmen gebeten, wollte mit dem Schweden gemeinsam über den Kaiser fallen; der Schwede hatte heimtückisch die Sache hingezogen; wie sich gar Johann Georg mit seinen sächsischen Regimentern anschloß, schwieg sich der Satan ganz aus. Der Herzog ballte die Fäuste auf der Decke: „Er hat mich betölpeln wollen und hat’s getan. Glaubt jetzt sein Spiel gewonnen. Der Tilly hat mit der Schlacht seinen Ruhm und Ehre verloren. Ich nicht minder, wenn ich mich nicht rühre.“
Frühmorgens war der verschüchterte Kurier in Trzkas Kammer geschlichen, bat um Urlaub; seine Schlafkammer lag über der des Herzogs, er hatte die ganze Nacht gehört, wie der Friedländer ihn schmähte, ihm die Pestilenz anwünschte. Das Gebrüll war erst vor einer Stunde verstummt.
Hinter dem Kurier war schon der Reisewagen Trzkas angefahren. An den Toren trennten sie sich; der Graf galoppierte mit seinen vier Pferden auf Tod und Leben nach Norden. Im Wagen neben ihm saß ein armseliger glutäugiger Schächer in einen Winkel gedrückt, eine federlose Pelzkappe auf dem struppigen Tschechenhaar, Jarosla Raschin, Exulant, einer der Geheimboten Wallensteins an den Schweden, der unter Lebensgefahr aus Sachsen verkleidet zum Herzog drang. Hinter Teplitz nahmen sie Pferde, ritten über das Gebirge durch die nebligen Tage. Allein schlug sich Raschin weiter, rief den Arnim, jetzt sächsischen Feldmarschall, nach Chemnitz.
Ob, fragte Graf Trzka, Arnim den Herzog zu Friedland hasse oder bereit wäre, mit ihm über Dinge des Gemeinwohls zu verhandeln. Dann: ob der Feldmarschall bereit wäre, augenblicklich und gänzlich ohne Zögern zum Besuch des Herzogs zu Friedland auf Schloß Raudnitz, zwischen Pardubitz und Prag, aufzubrechen. Die leidenschaftliche Dringlichkeit der beiden Männer bestimmte den Arnim, Wagen und Pferde mit ihnen gemeinsam zu bestellen. So überfallen war er von der Plötzlichkeit ihres Verlangens, daß er erst hinter Chemnitz den Befehl an seinen Leutnant abgab und in einem unsicheren Vorgefühl schriftlich anordnete mit jeder erdenklichen Deutlichkeit, nichts und gar nichts von den Anordnungen des schwedischen Hauptquartiers durchzuführen, das ihm nicht zu Gesicht gekommen wäre. Dann saß der Uckermärker unter den Massen der Schafpelze zwischen den beiden, ließ sich gebirgwärts rasen, dachte mit zunehmender Bedrücktheit an seine Lage. In ihm schwang frisch angestoßen ein heftiges Gefühl der Anhänglichkeit an den einsamen Herzog. Sein Herzog rief ihn, sie hatten sich seit den glückshohen Augenblicken nicht gesehen, wo Friedland ihn nach Polen schickte. Der große Friedland brauchte ihn; beschämt und fast gequält machte er den Weg über das Gebirge. Wallenstein war noch nicht auf Raudnitz, als sie ankamen. Der Marschall nahm einen Gaul; mit Raschin traf er den Herzog in der langsamen Sänfte auf der Landstraße. Ein wehes Stechen in der Kehle und hinter dem Brustbein fühlte der Marschall beim Anblick seines alten Herrn; der winkte aus der Sänfte, lachte ihn verrunzelt an, den Kopf hervorstreckend, wünschte ihm gurgelnd Glück zu den neuen Ereignissen: „Ich wollte doch teil daran haben, darum ließ ich Euch bitten.“ Und er kollerte in seiner alten verschmitzten Weise.
In seiner schon geheizten teppichbeladenen Schlafkammer stieg Wallenstein am spanischen Rohr rastlos herum. Vor Arnim stand ein Tischchen mit Wein. Der lange Herzog: „Es weiß niemand, daß ich von Prag abgereist bin. Mein Arzt sitzt in meiner Stube. Sie glauben, ich bin krank, ich liege im Bett. Ich habe lange genug im Bett gelegen. Findet Ihr nicht auch, Arnim? Ist eine herrliche Zeit jetzt. Ein prächtiger Mann, Euer Schwede. Bringt Wind in die Welt.“ Flüsternd: „Und er hat ihn am Schopf. Der Tilly ist gelaufen. Ihr seid tapfere Kerle. Hat mich gefreut. Ihr wollt mich gar rächen an ihnen. Muß mich bedanken.“ Arnim, um seine Erregung zu verbergen, berichtete Lobendes von Gustaf Adolf. Ein stechender Blick Wallensteins.
Als er schweigend rasch das Zimmer durchstiegen war: „Er hat Euch auch im Sack, Arnim? — Wir wollen Ruhe schaffen in Deutschland. Macht der Metzelei ein Ende. Der Augenblick ist günstig, ich wollte Euch das sagen. Ihr dürft nichts versäumen. Und Ihr dürft Euch nicht vom Schweden mißbrauchen lassen. Mich freut, daß Ihr beim Kursachsen in Gunst steht. Denkt daran, daß Ihr auch mir ein Teilchen davon verdankt. Es heißt jetzt kurz und gründlich handeln. Nach rechts und links entschlossen sein. Das wollt’ ich Euch sagen.“ Nachdem er Arnim über seine Pläne ausgeforscht hatte, brachte er hervor: der Kaiser und die Liga seien in größter Schnelle vor ein Ultimatum zu stellen; Friede oder völlige Niederlage mit gnadenlosen Bedingungen. Er verlangte zum Erschrecken Arnims von ihm den Einmarsch in Böhmen. Gab sehr genaue Zahlen über die Truppen des sehr wenig aufmerksamen Marradas, der jetzt in Böhmen kommandierte; der sächsische Einmarsch werde das Signal des böhmischen Aufstandes sein, der Kaiser umklammert. Er stand vor Arnim, der sich auch erhoben hatte. Redete stoßweise dicht am Gesicht des andern, die Augen niedergeschlagen, mit dem Knöchel des Zeigefingers auf den Tisch klopfend. Nur beim Abschied blickte er lange scharf seinen ehemaligen Untergebenen an. Der hatte leidend zugehört; unverhüllter schmerzvoller Rachedurst schien sich vor ihm zu entblößen. Die Angaben Wallensteins über Böhmen, er kannte die Zahlen ungefähr, waren wahr; der Herzog setzte bei dem geforderten Einmarsch seine eigenen riesigen Güter aufs Spiel. In einer Mischung von Besorgnis Erregung Freude Verwirrung reiste er ab mit Raschin, der ihn leidenschaftlich auszuforschen suchte: „Ist es soweit?“ Es war die Frage, die täglich von den böhmischen Vertriebenen im Hauptquartier gestellt wurde.
Friedland und Trzka rasselten trompetenblasend in den Hof des verschneiten Palastes auf dem Hradschin. Seine liebe anlaufende Herzensfreundin begrüßte mit Küssen der glückliche leicht gedämpfte Trzka. Den Herzog selber faßte die weiche Elisabeth bei den Händen, führte ihn umfassend und vorsichtig in den Flur. Wie sie alle schauerten unter seiner wilden kalten Stimme. Sie hatten sie viele Monate nicht gehört. Mit wem gingen sie da, wer führte die weiche Herzogin an den Händen. Wer hinkte da und erzählte lachend von der erfreulichen Begegnung mit seinem alten Arnim. Die Herzogin ließ die Hände los, aber nur für einen Augenblick, dann zog sich ihr Herz in einer beseligenden Erinnerung zusammen: wie sie, das höfische Fräulein, vor langen Jahren zum erstenmal unter dieser Stimme gebebt hatte und dann diesem als Unmenschen verschrienen Böhmen verfallen war, der durch sie, wie man warnte, nur Hofbeziehungen suchte. Zaghaft nahm sie die Hände wieder, die sie küßte. Sie hörte wonnevoll und demütig die schnarrende metallische Stimme an. Und schon an der Tür zu seinem Empfangszimmer drehte sich der Herzog, seinen Pelz abwerfend, zu Trzka und seinen Begleitern um, beugte sich schief herunter, listig ihnen zuflüsternd: das Schäkern hätte nun bald ein Ende in diesem schönen Schloß; sie müßten mit allen sieben Sachen wandern, eher heute als morgen; trara, bläst der Postillon, und wer sagt, wohin es geht. Und zu der rasch erblaßten Elisabeth: aber sie führe diesmal mit, er stürbe ihr auch nicht so leicht weg, wie sie fürchte; sie müßten ja fliehen, ob sie’s nicht wüßten; vor wem doch?
Zu aller Schrecken befahl er in der Tat noch am Abend, und der ernste straffe Rittmeister Neumann verbreitete sehr geheim den Befehl, zu packen, was man Wertes und Wichtiges besäße. Die weitere Dienerschaft wurde nicht benachrichtigt. Von Tag zu Tag fuhren nun unauffällig ein zwei Wagen stark bedeckt aus dem Palasthofe. Nach Mähren, hieß es. Nach einigen Wochen war eines späten dunklen Winterabends der Herzog mit seinem Anhang abgereist. Dies war, während der Schwede in Kurmainz thronte, zwei Tage vor dem Einfall Arnims mit den sächsischen Truppen in Böhmen.
Denn unter dem maßlosen Wehegeschrei der Landbevölkerung trieben schon die Sachsen Arnims heran. Marradas stand als Oberkommandierender in Prag; Wallenstein hatte ihm noch, als die Gefahr sichtbar geworden war, achselzuckend geraten, Widerstand zu leisten. Aber bei dem rasenden Tempo des Anmarsches war kein Widerstand möglich. Plötzlich, als wenn sie einen Traum erlebten, sahen die Böhmen die Kaiserlichen aus der Hauptstadt flüchten; tags drauf scholl der Gesang der Sachsen auf dem Altstädter Ring, vor der Theinkirche.
Auf den Zinnen des Altstädter Brückentors ragten an Stangen und Spießen verdorrte Menschenköpfe, denen die Rümpfe abgeschlagen waren. Sie hießen, als sie noch lebten, Kaplir, Budovak, Dovorecky, Bila, Otto von Loos, Valentin Kochan, Tobias Steffek, Michalovik, Kober, Heimschild, Jessenius. An diesem Freudentag der Sachsen war den Finken kein Spaß bereitet; ihre Nester in den Mündern und auf den Köpfen der Rebellen wurden zerstört. Prächtige Särge wurden gefertigt. Hinein wurden gelegt die Köpfe samt den Stangen, auf denen sie gesteckt waren und die ihnen in der langen Zeit zum zweiten Leib geworden waren. Aus der blendenden Helle gingen die müden Gesichter in die stillen Kammern unter der Erde.
Plötzlich war die Schlacht am Weißen Berge — nicht geschlagen.
Plötzlich war das Land — frei.
Der Gouverneur flüchtig.
Friedland, der Hauptverbrecher, flüchtig.
Die Bürger liefen aus den Häusern, besahen sich den Ring, liefen auf die Brücke. Sie stand, wie sie stand, die Köpfe waren weg. Sollte man sich freuen. Und vor der königlichen Burg stand eine unwahrscheinliche Gestalt, von der man sich erzählte, an die man nicht mehr glaubte: der weißbärtige Graf Thurn. Stand da, im Getümmel johlender frenetischer Böhmen auf dem wasserflutenden Hradschinplatz unter den verhängten Fenstern der Burg, die Libussa und Wladislaus gebaut hatten; die Schutztürme Daliborka und Mihulka. Matthias, der Kaiser, Rudolf, der Kaiser wohnten nicht mehr hier; wohnte der blinde Hund Ferdinand, der Idiot, noch in Wien? In den kaiserlichen Zimmern hauste der Böhme Thurn und der schützende sächsische Feldmarschall Arnim von Boitzenburg. In dem erstickenden Jubel dieser Wintertage wurden die Türen der Geheimkonventikel gesprengt, die Träger der alten gefeierten Namen rannten auf die Gassen und Plätze; ungeheure Umzüge spontan wachsend in allen Stadtteilen. Sie stiegen in glorreichen Gedanken vor die Stadtkanzlei, wehten unter Gebrüll und Gesang die alten Fahnen, vor sich die Fenster der Landtagsstube, aus denen von den Männern der Befreiung die Verräter Martinitz Slawata Fabricius in die Wallgrube geworfen waren. Im Wladislaussaal, im alten Huldigungssaal der Burg, standen sie vor Thurn und faßten es nicht. Einmal stürzte ein tumultuarischer Zug in den Veitsdom, marschierte hüte- und waffenschwenkend in die reiche Wenzelkapelle; ein Priester aus ihrem Haufen griff nach dem Bronzering an der Kapellentür. Sich biegend vor Hingerissenheit jubelte er weitäugig; an diesem Ring hatte sich ihr Wenzel sterbend und unverzagt in Altbunzlau gehalten. Schon wollten die lüsternen und rachedurstigen Massen in der Stadt und auf den Ländereien plündern. Da besetzte Arnim eine Anzahl der verlassenen Häuser und Schlösser; die friedländischen zuerst; seine Söldner patrouillierten mit Pike und Muskete die Straßen ab. Erschießungen von Plünderern fanden statt.
Ein Schreck fuhr in die Menge. Graf Thurn suchte besänftigend einzugreifen. Die Adligen, ihr wirres Gefolge bezichtigte ihn des Verrats, weil er nicht den Sturm auf die Häuser der Kaiserlichen befahl. Man hatte recht, Rache zu üben. Er wies auf die Sachsen hin, die es nicht dulden wollten. Nicht die Böhmen hatten das Land erobert. Sie verlangten sofortige Berufung und Bewaffnung der Emigranten und Verjagten aus Sachsen, Herstellung ihrer Habe. Entschädigung. „Gerechtigkeit, Rache!“ tobte es vor der Burg. Thurn warf vor Wut und in Zerrissenheit seinen Hut aus dem Fenster, verfluchte die Stunde, die ihn nach Prag zu ihnen geführt hatte. Man ließ ihn nicht weitersprechen, Steine und Waffen krachten durch die Luft. Draußen führten der prahlende Sohn des Berka, der sich aus der Gefangenschaft nach der Prager Schlacht befreit hatte, und Saul von Hodojewski. Sie waren als Jünglinge aus ihrer Heimat geflohen, keine Freude hatten sie gehabt in Sachsen, die ihnen nicht durch Sehnsucht nach dem Mütterchen an der Moldau getrübt war; sie klirrten als ungezügelte entschlossene Männer gepanzert vor den Haufen einher, die sich so wenig wie sie einschüchtern lassen wollten. Die Waffen wurden ihnen abgenommen, sie selbst in der Burg in Eisen geworfen.
In den Häusern schwoll die Enttäuschung, rachsüchtig schlugen die Konventikel die Türen hinter sich zu. Es mußte zu einem Ausbruch kommen. Die Sachsen waren froh, als das randalierende Volk die ersten Angriffe auf die Judenstadt machte.
In Znaim nahm der Herzog Privatlogis; die Bewohner von fünf Häusern mietete er aus. Doktor Ströpenius sah mit Verwunderung, wie die Gichtknoten an Wallensteins Händen, den Ohrläppchen Zehen aufbrachen, der Herzog hellere Farben bekam, rastlos durch die Zimmer ging, in denen Raum neben Raum rasch für besondere Zwecke eingerichtet waren, wie der Herzog nur abends keifte, auf den Kammerdiener losschlug, in der alten gehässigen Weise ihn selbst mit dem Tod bedrohte, weil er ihn verderben ließe. Briefe und Kuriere liefen wieder täglich aus.
Der Herzog bat vertraulich die Obersten der in der Nähe stehenden Regimenter zu sich, dann weiter entfernte. Er stellte fest, wie es sich mit der Auffüllung ihrer Truppen verhielt, mit Armierung Verproviantierung Kriegslust; wies sie an, Mut auf Werbung und Ausbildung zu legen, seiner Kasse gemäß nichts zu versäumen. Das Reich liege in Nöten; wenn der Kaiser sie nicht rufen würde oder nicht für sie aufkommen könne, er würde nicht verschlossenen Mundes zusehen, wie der Schwede sein Höllenspiel auf deutschen Gassen zu Ende führen würde. Möchten sich im schlimmsten Fall um ihn, den Reichsfürsten und Herzog zu Mecklenburg, stellen.
Aus den Äußerungen der Herren, die einzeln, dann in kleinen Rotten sich in den dürftigen Znaimer Häusern versammelten, klang, gelockt von diesem Anruf, hervor, wie sie die Niederlage unter dem Schweden empfanden und den Kaiser anklagten, das Heer in die Jauche gedrückt zu haben.
„Es ist kein Gut am Grafen Tilly,“ schrien sie an der klirrenden Weintafel, an der sie mit dem langen Herzog saßen, „er hat den evangelischen Obristen die Patente abgenommen. Die Ligisten sind Mucker. Wir sind keine kaiserliche Armee mehr. Wer regiert? Seine Knausrigkeit die Durchlaucht von Bayern.“ „Wir beten zu Jesus und Maria. Aber unsere protestantischen Kameraden sind tapfer und brav. Man hätte sie nicht davonjagen müssen, als wären sie Heiden.“ „Man hat getan, als führten wir einen Krieg für die Mönche. Wir sind Soldaten. Wer uns Ehre gibt und wacker zahlt, ist unser Mann. Tilly ist geschlagen, wir sitzen im Mauseloch und knabbern an Strohhalmen. Das walt’ die Sucht.“ „Haben bei der Durchlaucht zu Friedland getreulich gestanden; hat uns die Schnödigkeit seines Loses genugsam gejammert. Sitzen als seine Gäste, um ihm nicht bloß zu versaufen, was er uns vorsetzt; wollen auch bekennen, daß wir seiner mit Verlangen denken.“ „Haben ihn nicht davongehen heißen, die Durchlaucht zu Friedland. Haben Tränen nach ihm vergossen, als wäre uns Mutter und Vater an einem Tage gestorben und wir selbst an den Bettelsack geraten. Da wir ihm einmal mit Handschlag und Mund die Treue gelobt als Feldhauptmann des Römischen Kaisers, wollen wir ihn, wenn uns keiner mag, in seinem Gram nicht verlassen. Sei er unser gewiß.“ „Sei er auch unser gewiß.“
Im Geschrei und erhitzten Stampfen und Tischschlagen — der lange Friedland im braunen Lederkoller ließ still hockend und Blicke werfend die Reden um sich gehen, als säße er wie ein Rabe auf dem Ast, der Wind schaukelt ihn spielerisch und bläst ihm unter die Federn — stieg ein schärpenschleppender breiter hoher Mann mit glattgeschorenem kleinen Kopf auf seinen Schemel, hatte ein glühendes geschwollenes Gesicht, hielt seinen Becher im Stehen noch dicht vor seinen bärtigen Mund, schwieg, als ihn schon alle anriefen. Dann keifte, krähte er unter Gesten der linken Hand: „Der Schwedenkönig steht im Reich. Bis Mainz steht er jetzt. Der Sachse steht in Böhmen. Mit wieviel Mann? Mit sechstausend. Wo sind unsere Armeen? Sie sind weggelaufen. Wo steht Konti, Savelli? Weggelaufen. Marradas? Weggelaufen. Wir sind Hunde. Wir sind zum Krepieren reif. Ich lasse die Herren wissen, wir sind für den Schinder reif. Das bitte ich nicht zu vergessen, wenn man von uns spricht.“ Stieg vom Stuhl, kaute mit leerem Mund, trank stierend an seinem Becher.
Zuerst bezogen die Obersten der in Mähren gelegenen Regimenter vom Herzog zu Friedland Geld, Darlehen, Winke für die Werbung, den Proviant. Dann zog er rasch, sich ihrer bedienend, die entfernten Regimenter in seinen Bereich. In seinen Zimmern zu Znaim arbeiteten die aufgetriebenen Beamten seiner früheren Verwaltung. Er erklärte mit dem Kaiser in dauernder Korrespondenz zu stehen; sei ermächtigt, mit Umgehung der Wiener Herren den Obersten mit Rat und Tat beizustehen, wie er als Privatperson von Sachkenntnis und Vermögen fähig wäre. Was niemanden quälte.
Die Gräfin Trzka, spät abends mit dem Grafen und der Schwester antanzend, erhielt einen raschen Schlag auf die Hand, als sie den Herzog vom krachenden Schreibkabinett wegziehen wollte. Seufzend zog er sich am Arm des Rittmeisters Neumann hoch: „Trzka, du stehst nicht auf, wenn du Würfel spielst und im Begriff bist zu verlieren. Du wirst es nicht tun, wenn du anfängst zu gewinnen.“
Er gluckste zwischen den beiden Frauen hinaus, den Kopf zwischen den Schultern einziehend: „Weißt du, weißt du, herzliebes Weib, wer ich bin?“ „Aber ich weiß, mein herzlieber Gemahl, wer du bist.“ „Willst du mir Botschaft geben?“ „Mein herzlieber Gemahl.“ „Ich bin ein Mensch, der einen Kopf auf dem Rumpf trägt und auf den zwei Beinen steht, die ihm seine Mutter in der Geburt mitgegeben hat. Hä. Sie werden es merken. Die jesuitischen Stinkböcke, die verzagten schulfuchsigen Herzen. Und der dicke Schelm. Äußert Euch unbeschwert, sagt unverhohlen, daß Ihr mir kein Vertrauen schenkt, Ihr.“ Er fuchtelte gegen Abwesende: „Jetzt springt links, jetzt dreht Euch. Es heißt bezahlen. Müßt heran, ob Ihr wollt oder nicht. Bezahlen heißt es. Siehst du, herzliebe Elisabeth. Hä. Sie werden bezahlen. Sachte, sachte will ich ihnen das Pfötchen bieten und an das Hälschen gehen.“
Seine Tafeleien und Verhandlungen mit den Obersten ließ er in die Welt schreien. An den Wiener Hofkriegsrat schickte er, Briefe des Kaisers lässig beantwortend, einen Kurier mit der Frage, ob die Kammer wüßte, daß sein Mecklenburger Herzogtum, dazu sein böhmischer Besitz, Friedland Sagan Großglogau, alles hin und verloren seien, und was man ihm, dem Reichsfürsten, an die Hand gebe, sich vor unverschuldeter Armut zu schützen. Dann drohte zwei Wochen darauf ein zweiter Kurier: man schweige sich aus, der Erwählte Kaiser des Heiligen Reiches ließe ihn im Stich; er sitze in Znaim auf der Flucht, nur mit dem Notdürftigsten versehen. Sei das Reich zerbrochen? Müsse er sich selbst schützen? Man möge es sagen. Er warte, träfe Anstalten, sich seiner Haut zu wehren, wie es ihm geblieben sei.
Graf Trzka bekam den Auftrag: ihm gäbe er, sagte Friedland, mit auf die Reise seine beiden blauen Augen und die treue Miene. Damit solle er sich vor den Schweden oder Oxenstirn stellen, sie fangen und sagen, er, der Friedländer, sei im Begriff, ein meuterndes kaiserliches Heer an sich zu ziehen und damit nach Belieben zu verfahren. Ob ihm das Königreich Böhmen garantiert werde? Ferner wieviel schwedische und sächsische Truppen rasch zu ihm stoßen könnten im Augenblick des Losbruchs. Den Bescheid möchte er sich schriftlich von Oxenstirn oder dem Schweden selbst geben lassen. Möchte sich beeilen.
Trzka war einen Augenblick erschreckt und unsicher. Friedland schrie: „Lacht nicht. Behaltet Euer Gesicht im Zaum.“ Stieß ihn drohend mit den hageren Armen zur Tür hinaus.
Unter dem niederdrückenden Bescheid des Kardinals Pazmany, den Nachrichten, die die Gefahr einer Umklammerung greifbar nahelegten, getrieben von stöhnenden Briefen des Kurfürsten Maximilian, trat Fürst Eggenberg mit dem Hohen Rat in der Burg zusammen.
Maximilians Lage war ihnen allen klar. Er hatte in der furchtbaren Not nach der alten Verbindung mit den Franzosen gegriffen, diesmal aber nicht, um Habsburg Paroli zu bieten, ja er hatte sich durchzuschlagen versucht, indem er den Schweden selbst erweichte: nicht anders konnte ja sein neulicher Waffenstillstand gedeutet werden. Und dann sah der Bayer ein, daß er kein Erbarmen von dem Vandalen aus Skandinavien zu vergewärtigen hätte, daß es doch nur ein kleiner Aufschub war. In einer Verzweiflungstollheit war Tilly, ehe noch der Stillstand ganz beendet war, losgebrochen und hatte in dem Entscheidungskampf dieses neuen Jahres als erster auf den menschenmordenden Schweden losgeschlagen, auf den Mann, der ohne Erbarmen trompetete: er werde keinen Pakt zwischen Evangelischen und Katholiken zulassen, es müsse einer von beiden in das grüne Gras beißen.
Der kleine Fürst Eggenberg, gebückt und übermüdet hinter seinem Schemel stehend, verkündete mit schmerzlichem Kopfnicken den anderen Herren, daß jetzt, zum ersten Male vielleicht, kein Zweifel an der Gutwilligkeit des Bayern möglich sei, und der Bayer selbst ließe die qualvollsten Briefe, die heftigsten Bitten durch seinen Gesandten an den kaiserlichen Hof ergehen: zu helfen, nicht zuzusehen, wie man, Kaiser und Liga, vor das äußerste, die glatte Kapitulation gestellt würde. Es sei das Schreckliche, kaum Wiedererzählbare Wirklichkeit geworden, daß der Mann, der jetzt auf dem Thron des Stellvertreters Christi säße, den Fischerring trüge, daß eben der Mann, Barberini, sich in einer Kälte, die an Hohn grenze, apathisch für das Interesse des katholischen Glaubens gezeigt habe. Er habe es in seiner Gewalt gehabt, was katholisch in der Welt sei, zu einigen gegen den unheimlichen alles verheerenden Ansturm des Ketzerkönigs aus dem Norden. Man habe ihm den vertrauenswürdigsten Menschen zur Unterhandlung geschickt, den Erzbischof von Gran, den Primas von Ungarn; beschämt, zerschmettert sei der von Wien nach dem Bericht abgereist, habe nichts seinem Bericht zugesetzt, als: er wünsche sich in Zukunft nur seinen Arbeiten zu widmen. Und nun ist es zu allem Unglück auch noch geschehen, daß die letzte Säule des Hauses Habsburg, der gewesene Feldhauptmann zu Friedland, zu wanken beginne. Unter dem überraschenden Einmarsch der Sachsen habe er fliehen müssen; wieviel an seinen Gütern, die seinen Reichtum ausmachen, noch unversehrt ist, könne er nicht feststellen. Der Herzog sitze mit seiner Familie und Anhang in Znaim. Das Wetter zieht auch über ihn herauf. „Woran sollen wir uns halten?“
Aus der gespannten beieinander sitzenden Gesellschaft fand Questenberg, der kurzbeinige schnäuzbärtige, ein Wort; das Unglück habe dann wenigstens das mit sich gebracht, daß bis da zweideutige Freunde sichere Freunde geworden seien, ob sie wollten oder nicht; man könne sich auf den Bayern und den Friedländer verlassen; ja der Friedländer müsse sich glücklich preisen, wenn Habsburg mit ihm zur Erlangung seines Besitzes gemeinsame Sache machen wolle.
Stillschweigen.
Um die Unterhaltung weiterzuführen, beugte sich der verwachsene Graf gegen Questenberg hin; freilich habe dieser Friedländer, wie auch seine Briefe zeigten, nun auch nichts und warum solle also dann Habsburg mit ihm gemeinsame Sache machen. Und indem er forschend den welk in seinem Armsessel ruhenden Fürsten Eggenberg anblickte: man habe vielleicht Interesse daran, dem Herzog nicht zu helfen; Friedland spräche auch jetzt sonderbar drohend. Er sondierte: bekanntlich ist es gut und zweckmäßig, Schlangen, die man fürchtet, die Giftzähne auszubrechen, um des Heilands willen ihm keine neuen einsetzen.
Eggenberg hielt die Augen des anderen fest; leise, pointiert tropfend; das sei der entscheidende Punkt: wie denke man sich ohne Wallenstein die Situation? Die Faust setzte Questenberg auf den Tisch: „Wir brauchen Wallenstein zum zweiten Male und dauernd, bis Ruhe ist.“
Am Tisch im weißen Mühlsteinkragen der schlanke Fechter, der Spanier Ognate; er hob den Zeigefinger: „Wir bieten eine Million Gulden, wenn Wallenstein das Heer organisiert.“
„Seht Ihr“, breitete Eggenberg gegen Trautmannsdorf den Arm aus.
„Nichts sehe ich, als daß wir vermutlich auch noch das Fell des Löwen verteilen, bevor wir ihn haben; zunächst steht es ja nicht fest, daß der Herzog zurück will.“
Ognate: „Er will. Er will.“
„Ja, wie er will.“
Ognate einfach: „Als Generalfeldhauptmann wie vorher, zugleich als Haupt der spanischen Armee im Reich.“
„Mein Gott, wißt Ihr denn, Graf Ognate, von wem Ihr redet? Seine Briefe sind sonderbar. Es könnte sein, daß er in der Situation, in der er sich jetzt befindet, nach Schwund seines Vermögens, bereit ist zum Kommando. Vielleicht. Vielleicht hat er auch etwas anderes vor. Der Wallenstein! Er wird schnappen! So groß wird kein Rachen eines Wolfes sein wie seiner, wenn er schnappen wird. Er freut sich unserer Lage; sie verspricht ihm viel. Was meint Ihr, Eggenberg und Ihr, Graf: wird es nötig sein, daß Ihr Euch noch retten laßt von ihm? Er wird Euch retten, soweit es ihm Spaß machen wird, und von dem Braten speisen, mit Fettsoße, Zwiebeln, Gemüse und Pastete, soviel er mag. Das Reich wird anders aussehen nach dieser Rettung als vorher. Ich wünsche Euch guten Geschmack — für ihn.“
Eggenberg: „Was ratet Ihr?“
„Mit Schweden paktieren. Rasch.“
Eggenberg: „Nein sagt, Graf Trautmannsdorf, laßt dies einen Augenblick: ist der Herzog nach Eurer Meinung so gefährlich?“
„Euer Feind. Weiter nichts. Gewiß nicht meiner. Er kann Euch jetzt vielleicht nicht viel scheren; Ihr müßt damit zufrieden sein. — Ihr wißt übrigens, daß ich ihn liebe und hochschätze. Die Dinge haben es leider dahin gebracht, daß er mit dem Erzhause verfeindet wurde.“
Trautmannsdorf war traurig und stützte den Kopf. Wieder Stillschweigen. Am Tisch saß neben Questenberg der Beichtvater, der große Lamormain. Man müsse sich der Menschen bedienen, wie sie sind. Man hätte Machtmittel in der Hand gegen den Herzog. Friedland scheine sich schon jetzt zu irgendeinem Schlag zu heben. Er sei offenbar noch kräftig. Man müsse sich seiner in beliebiger Weise bemächtigen.
Questenberg bitter gegen Trautmannsdorf: ob der Herr Graf wisse, daß der Friedländer fast alle Obersten Mährens und Niederösterreichs an sich gezogen habe, die kaiserlichen Obersten? Zerschmettert die Armeen, verzweifelt, schlecht entlohnt, in ihrem Ehrgefühl gekränkt die Offiziere. „Es kann geschehen, daß unsere Regimenter zu Wallenstein übergehen, ohne daß wir etwas dagegen ausrichten können; wir sind ja nichts. Wir sind Geschlagene, schlechte Politiker, da wir ihnen diesen Wallenstein weggenommen haben. Und er: er ist imstande, nimmt die Regimenter, die Juden zahlen, was er braucht; er erobert sich seine Güter, verträgt sich mit dem Schweden. Es ist alles möglich. Läßt man ihn, ist man vor nichts sicher.“
„Und wer ist schuld daran?“ Trautmannsdorf zog brüsk die Arme vom Tisch, schrie: „Ihr. Er war nicht unser Feind. Ihr habt ihn dazu gemacht. — Aber ich will davon nicht sprechen.“ Er preßte sich erglühend in seinen Stuhl: „Wenn es wahr ist, daß der Papst diesen Bescheid dem ungarischen Primas gegeben hat, so wird man diesen Bescheid den geheimsten Geheimbüchern des Erzhauses einverleiben müssen. Man wird es nicht nur in die kaiserlichen Erinnerungsbücher für die Richtung der kommenden Politiker schreiben, sondern für jeden im Reich und außerhalb des Reichs, der Interesse am katholischen Glauben hat. Es ist unmöglich und zum Himmel schreiend, daß die grausige Not, vor der sich Bayern und Österreich, alle Königreiche und Erblande krümmen, blinde Augen beim Heiligen Vater findet. Er hat es abgelehnt, das in höchster Not schwebende und fast zu gänzlichem Untergang neigende Römische Reich aufzurichten. Er wird seine Schuld vor dem zu verantworten haben, dessen Stellvertreter er ist. Und nicht ist. Die Schuld liegt auch bei Euch, Fürst Eggenberg. Es war alles unnötig. Wir waren in Macht, wir saßen im Sattel, dann kam der böse Anzetteler, der treulose baumstarke Verderber des Reiches, der Bayer. Er hat die Kurfürsten gegen Habsburg aufgewiegelt; wir hätten stark bleiben können und sollen. Statt dessen hattet Ihr Furcht. Von Anbeginn. Ich sage Euch: Friedland war treu bis zu dem Augenblick in Memmingen, wo wir ihn fallen ließen und wo er sah: dem Kaiser liegt nichts an ihm. Er wurde nach solchen Diensten für uns wie ein räudiges Tier zur Tür hinausgestoßen. Kaum daß die Kaiserliche Majestät selber in ihrer persönlichen Liebe für den General ihn vor dem Äußersten bewahrte: vor der offenen Infamie, der Degradierung, Absprechung der Titel und Besitztümer. Warum? Die Herren wissen alle: um nichts. Wegen des alten Hasses des Bayern, der hinter Habsburg wie die Bremse ist und in den Wahnsinn stachelt. Was wäre geschehen? Fast wäre Deutschland ein Kaiserreich geworden. Nun sitzen wir da, winseln vor dem Papst, werden vor dem Herzog winseln. Jetzt hat er Rebellisches vor, ich zweifle nicht daran. Er macht sich unsere Not zunutze. Wär’ er doch ein Seraph, wenn er’s nicht täte. Er haßt uns alle, wie wir hier sitzen. Ich kann meine Liebe zu ihm nicht verbergen und ihm nur recht geben. Ich muß es tun. Ihr seid schuld, Fürst Eggenberg. Ihr habt einen Keil in uns getrieben und uns schwach gemacht. Ihr habt uns und dem Kaiser den Mut genommen, daß wir in Regensburg nicht sprechen konnten. Das Reich wird es Euch nie vergessen dürfen. In hundert und tausend Jahren nicht.“
Verzweifelt lächelnd blickte der kleine Fürst auf seine zitternden kalten Finger: „Wollt mir doch wenigstens das auch nicht vergessen, daß ich das Beste gewollt habe, daß wir alle doch schon so schwer gebüßt haben.“ „Noch nicht genug. Der Schwede wird noch andere Register ziehen. Es ist soweit gekommen, Fürst Eggenberg, daß ich ein offenes Wort hier sprechen muß. Ihr hättet Euren Kopf dem Kaiser nach der Breitenfelder Schlacht anbieten müssen. Sie war das Resultat Eurer Politik. Ihr habt die Versöhnungstaktik dem Kaiser geraten. Habt Ihr das getan?“
Gedankenlos blöde lächelte ohne Aufblick der Fürst: „Liegt Euch soviel an meinem Kopf?“
„Habt Ihr ihn dem Kaiser angeboten?“
Der Fürst fahl, eingefallen, einen Moment die Augen beschattend: „Nun will ich Euch sagen, Trautmannsdorf, daß das, was Ihr mit mir tut, anfängt unertragbar zu werden. Was habt Ihr mit mir vor?“
„Sollen wir nicht das Recht haben, über Euch zu Gericht zu sitzen und seid Ihr hier nicht Rechenschaft schuldig?“
„Was ich getan habe, verantworte ich. Ihr seid in Eurer Liebe zu Wallenstein ohne Verstand.“
„Meine Liebe zu Wallenstein. Ich will nicht nur Rache nehmen dafür, daß ich gezwungen wurde, gegen ihn aufzutreten. Ich muß Protest erheben gegen die Verwüstung der stärksten Position in der Welt, die das Reich hatte. Friedland hätte das habsburgische Reich halten können. Nun ist er zunichte geworden, verschandelt, in einen gräßlichen Dämon verwandelt, vor dem wir zittern müssen. Aber eins gegen das andere: ist Wallenstein nichts und ist Habsburg nichts: ist es da recht, daß Ihr etwas seid, der beide zu nichts gemacht hat. Das sag’ ich hier am Tisch: ich liebe Habsburg und hänge unserer Kaiserlichen Majestät an — aber Ihr, Fürst Eggenberg, tätet gut, Euch jetzt und für alle Zukunft zu verstecken, weil Ihr und kein anderer schuld seid an diesem vermaledeiten Regensburger Tag.“
„Die Herren werden alle einsehen, daß diese Debatte nicht so fortgehen kann. Ich habe stets alles frei aufgenommen, was hier beraten wurde und dem Kaiser berichtet. Er kennt alle Standpunkte und Gesichtspunkte. Man hat es hier mehr auf meinen Kopf als auf etwas anderes abgesehen. Ich will Euch einladen, Graf Trautmannsdorf: kommt mit vor den Kaiser.“
„Wozu soll das? Der Kaiser ist jetzt machtlos.“
„Er ist Richter.“
„Was soll das?“
„Kommt mit. Ich bin Euch Genugtuung schuldig für Euren Wallenstein. Ich begehre es von Euch.“
„Was soll das?“
„Ich bin Euch wohlgesinnt. Ich versteh’, was Ihr fühlt.“
Der Kaiser in dem menschenfließenden Abtstuhl: „Das ist wohl eine Art Gericht. Ihr seid der Ankläger und Fürst Eggenberg der Malefizer. Oder umgekehrt.“
Eggenberg: „Ich möchte wissen, was die Kaiserliche Majestät urteilt.“
„Was, Urteil, Eggenberg?“
„Ich habe viel gelitten unter den letzten Ereignissen. Majestät weiß davon. Aber die Dinge sind in der Tat so ungeheuerlich in ihren Folgen, Nebenumständen, können verhängnisvoll werden, daß ich mich nicht mit einer bloßen Besänftigung und Hinnahme begnügen kann, sondern rund um ein Urteil bitte. Ich habe alles verschuldet. Es muß mir abgenommen werden. Oder der Kopf, der die Erinnerung an das alles aufbewahrt, muß herunter.“
Der Kaiser: „Und dies scheint auch die Meinung unseres Trautmannsdorf zu sein?“
Trautmannsdorf: „Ich habe den Fürsten, meinen alten Freund, nicht hierher gezogen.“
Der Kaiser: „Jedenfalls — steht es wahrhaft um uns so?“
Beide Herren sahen zu Boden.
„Und an dieser Lawine begehrt mein guter Eggenberg schon wiederum schuld zu sein? Regensburg, Abdankung des Generals. Schweden, Breitenfeld und so weiter?“
„Ich nehme die Abdankung des Generals auf meine Kappe.“
Der Kaiser sich hochstemmend schleifte herum um die grüne Marmorsäule: „Schon gut. Ich dachte es eigentlich anders.“ Er legte die leichten Hände auf Eggenbergs Schulter mit dunklen Blicken leise redend: „Sprecht nicht von Regensburg. Laßt das. Ihr seid nicht daran schuld. Ich hab’ mit Euch ja gar nicht darüber gesprochen. Da ist nichts von Schuld. Wollt das nicht bemäkeln.“
Eggenberg öffnete den Mund, der Kaiser fuhr fort: „Sprecht nicht. Es ist wie ich sage. Man soll an den Dingen nicht deuteln und sich nicht versündigen.“ Streckte die Arme von sich breit nach beiden Seiten: „Frieden, ihr Herren.“ Er ließ seine Arme sinken. Sah sein Spiegelbild über die Säule fließen. Ging gegen die hohe Tür; die beiden Herren betrachtete er; seine Miene nahm etwas Überdrüssiges, Feindseliges an. Das verließ ihn erst langsam, wie er wieder im Stuhl saß. Da lachte er in kleinen leisen Stößen, streckte die Arme von sich breit nach beiden Seiten: „Frieden, ihr Herren. Wir sind nur Werkzeuge, wer weiß in wessen Händen. Ich hoffe, in Gottes, Marias und der Heiligen.“
Die beiden Herren blickten aneinander vorbei.
Der Kaiser träumerisch herumwandernd, an den Puscheln seines Schlafrocks spielend: „Es nimmt alles so guten Verlauf. Wenn ich nur wüßte, wovon ihr redet.“
Eggenberg: „Der Schwede —“
Der Kaiser: „Ah der Schwede. Ihr werdet ihm, ich sagte es schon, den Wallenstein entgegensetzen müssen. Ich — möchte diesen Wallenstein gern wieder sehen. Seht, wie gut, daß ich den Wallenstein nicht von mir reißen ließ. Das hab’ ich gut gemacht, nicht wahr?“
Er dachte vor ihnen angestrengt nach: „Also, bringt ihn vor mich. Ich möchte ihn sehen.“
Als sich der Fürst und der höchst betretene Graf voneinander trennten, waren sie übereingekommen, sich umarmend, sich drückend und einander alles abbittend, angesichts der erschreckenden unfaßbaren Apathie des Kaisers sich nicht voneinander zu trennen und alle Entschlüsse gemeinsam zu fassen; für den Augenblick den, das Generalat Wallensteins zu erneuern, als Gegengewicht aber sich des Bayern und Spaniens zu versichern.
Die Ankündigung des Besuches Eggenbergs wirkte auf den Herzog, der in ruhelosem Konspirieren begriffen war, so erschreckend, daß er im Zimmer des Rittmeisters Neumann einen Nervenanfall erlitt. Er schluchzte eine halbe Stunde, auf dem Stuhl am geöffneten Fenster sitzend, nach dem öden Garten zu sitzend, hatte eine wachsfarbene schmale Nase, griff oft nach seiner Brust, war nach seinen leeren Blicken nicht ganz bei Besinnung. Nachher schmähte er noch schluchzend auf den Rittmeister, auf seine Ärzte. In seiner Schlafkammer saß er weitäugig, verstört, schlaffrückig neben Elisabeth, flüsterte: „Ich bin nicht mehr der alte, Elisabeth. Irgendwie bin ich wurmstichig. Irgendwie haben sie mich wurmstichig gemacht.“ Und wütend aufstehend, brüllte er, fäusteschüttelnd, tierisch herumtrampelnd: „Sie haben mich wurmstichig gemacht. Sie haben mir die Federn ausgerissen. Das haben sie erreicht. Sie sollen es bezahlen. Wenn es im Himmel einen Gott gibt, wenn Maria die Mutter Gottes ist, wenn mich die Heiligen beschützen, bei meiner Seligkeit und Ehre, ich will ein Erztropf und Schindhund sein, wenn sie es mir nicht bezahlen mit allem, was sie haben. Daß sie die Hand Gottes rühre.“ Vor dem Bildnis des Christophorus, der die Fluten überschreitet, stehend, schäumte er gierig unter Anschwellen der Venen an dem dürren glühen Hals, mit beiden Unterarmen gegen die Tapete trommelnd: „Galgenschelme, Galgenschelme.“ Kreischte heiser. Elisabeth ließ ihn, weinend das Kinn auf die Brust legend, stehen.
Am späten Abend saß er nach Verabschiedung der Herren in seiner kleinen Gaststube mit ihr allein vor der unabgedeckten Tafel, lächelte plötzlich, sich zusammenziehend, grimmig haßvoll, mit glückstrunken funkelnden Augen: „Gott hat sie mir in die Hand gegeben. Ich werde sie wie einen Floh zwischen den Nägeln zerknacken.“
Sie drückte sich an ihn; sie konnte sich nicht erwehren, sie liebte ihn in seinem Unglück von Tag zu Tag mehr, schämte sich unklar ihrer Liebe.
Der Herzog ging an seinem spanischen Rohr dem Fürsten Eggenberg auf der gefrorenen Znaimer Landstraße einige hundert Schritt entgegen. Sie sprachen über ihr gemeinsames Podagra. Drin wurde der Herzog der Freude des Kaisers über seine alte unveränderte Anhänglichkeit versichert, Wallenstein bot, ohne sich zu binden, die Aufstellung einer Armee von vierzigtausend Mann an, die er allmählich auf hunderttausend bringen wolle. Aber er lehnte jede Abmachung über seinen Eintritt in das Generalat ab, klagte über seine Hinfälligkeit.
Und Eggenberg, der gefaßt die Verhandlung führte, mußte zugeben, wie er den langen gelben Mann hohläugig vor sich im überweiten Lederkoller fuchteln und stöhnen sah, daß es gut sei, mit solchem Mann nicht gar zu lange Verträge zu machen. Und in Eggenbergs Seele kam ein leichtes unsicheres Staunen und wehe Müdigkeit, wie sonderbar unerwartet sich die Dinge gestalteten. „Wir müssen alle sterben“, seufzte Eggenberg, über sich sinkend. Der Herzog zog, den Kopf zurückbiegend, spöttisch die Mundwinkel herunter, ließ von oben einen lauernden freudigen Blick über den andern spielen.
Man wollte am Hof wissen, welche Forderungen der Herzog gestellt habe. Der alte Fürst gab schwermütig von sich, sie sollten sich erst den Herzog ansehen, er werde bald kommen.
Und nach Wien eingeladen kam der Herzog. Nicht wie beim Antritt des ersten Generalats, mit zwanzig Karossen; versilberte Partisanen der Vorreiter, Zaumzeug und Schabracken, wie der Kaiser sie führte, Lakaien und Pagen in feinsten französischen Stoffen, eine halbe kriegsstarke Kompagnie voraus, eine halbe hinterher.
Sondern geräuschlos mit zwanzig Mann Bedeckung und drei Leibwagen. Er führte auf der eisigen Stiege seines Znaimer Häuschens noch ein murmelndes Gespräch mit dem heißblütigen jungen Sesima Raschin und seinem Trzka. Keinen Augenblick sollten sie sich durch die Änderung in seiner Stellung zum Kaiser in ihren Aufgaben stören lassen; jede erreichbare Bindung an den Schweden und den Sachsen für ihn erstreben. Es solle alles so weitergeführt werden, als geschehe nichts. Gab keine schriftlichen Vollmachten von sich; er mache sich nicht, räusperte er sich aus dem Fenster des Wagens heraus, bevor er die Decke vorzog, zum Sklaven des Kursachsen oder Gustafs. Sie begriffen, der Herzog, der langsam auf der Landstraße fuhr, hatte etwas Besonderes mit dem Kaiser vor.
In dem schneidend klaren Januarlicht stellte sich der Böhme, am Stock herangeschleift, hoch und mager vor dem Kaiser auf, der ihm selbst einen Sessel heranrückte.
Beide fanden in der gräßlichen Deutlichkeit des Tages, daß der Tod den andern an Auge, Nase, Mund, ja an den Händen gezeichnet habe. Beide wußten es nur von dem andern.
Ferdinand las in seiner Verwirrung dem Herzog einen Brief der Mantuanerin vor, den er eben erhalten hatte aus Schönbrunn, worin sie ihre baldige Rückkehr nach Wien anzeigte. Währenddessen und nach den ersten heiseren Worten des Herzogs veränderte sich dessen Bild vor ihm und in ihm tauchte wieder auf der unersättliche regsame Lindwurm, der kriechende langschweifige tausendfüßige Leib. Den hatte er einmal gefürchtet. Nun war es klar. Es sollte wieder etwas wie Krieg geben; er mußte sich einen Augenblick wirklich besinnen, gegen wen; dachte im ersten Moment an den Bayern. Also jetzt ist der Schwede an der Reihe. Dieser Herzog hat es auf den abgesehen. Er wird ihn wahrscheinlich besiegen. Vielleicht wird ihn auch gelegentlich der Schwede besiegen; diese Dinge sind unübersehbar. Eine sonderbare Sache.
Der Herzog sprach von den schon getroffenen Maßnahmen zur Aufstellung eines Heeres, und daß in der Tat der Schwede und Kursachse alle Vorteile haben. Heiser schrie er; wie seine böhmischen Augen dabei feucht schillerten.
Man braucht solche Menschen hier. Sache des Kaisers ist es sie zu belohnen. Sie hungern zu lassen und zu füttern, je nach den Umständen, um sie desto willfähriger zu haben. Das ist das Geschäft des Kaisers. Die Aufgabe der Krone. Es ist in allen Ländern so. Man verliert die Krone ohne dies Spiel. Man sollte vielleicht diese Menschen auf den Thron lassen, das wäre wohl das Richtigste, das Glatteste.
Als sie ihr Gegenüber beendet hatten, ließ der Kaiser, ohne den Platz zu wechseln, stumm den Fürsten Eggenberg kommen, fragte ihn, was er nun zu tun hätte. Plötzlich war es dem Kaiser geworden, als ob er die Balance verlor, schwindlig wurde und in einer kichernden bewußtlosen Freude nicht wußte, was heute war, was morgen sein wird, in welchen Zimmern er ging, in wessen Zimmern er ging. Ja, das große Geheimnis, das ihn tief beglückte, wollte er dem Fürsten Eggenberg nicht verraten, vielleicht aber der Mantuanerin, die bald kommen mußte: daß er manchmal nicht wußte, in wessen Kleidern er hier herumging, er auf zwei hebenden fühlenden Beinen, mit einem beweglichen Kopf; daß ihn die Unterschriften tief fesselten, die seine eigenen Hände zogen; manu proprio hieß es, mit eigener Hand. Sieh da, sieh da, der Ferdinand.
Und Eggenberg wurde von ihm umarmt, Ferdinand scherzte mit ihm, daß er sich von Trautmannsdorf nicht habe in den Tod jagen lassen. Nun werde er wohl auch wissen, was mit dem Herzog zu geschehen habe, wie man ihn belohnen und abfinden müsse; nun sei doch der Geheime Rat ganz beruhigt. Friedland sei bei ihnen, der Schwede werde bald nicht mehr auf der Landkarte zu finden sein.
Der Fürst kniff schwermütig die Augen zu; ob man den Herzog werde abfinden können, wisse keiner, er schwiege sich aus. Man wisse nicht, womit nach der Aufstellung der Armeen der Herzog kommen werde; nicht viel geben, nicht viel geben sei der gemeinsame Wunsch aller Herren. Auf seiner Schreibtafel stand, als er sich verabschiedete, die Bestätigung des Herzogs als Reichsfürsten zu Mecklenburg, ein Geschenk des Kaisers von vierhunderttausend Reichstalern, soviel der Friedländer noch für gekaufte Güter der böhmischen Kammer schuldete; man gedachte ihm schließlich pfandweise für die Auslagen das schlesische Herzogtum Großglogau zu überlassen.
Als am folgenden Nachmittag die Mantuanerin den Kaiser nicht aufgesucht hatte, obwohl ihre Ankunft am letzten Abend gemeldet war, ließ sich der Kaiser zu ihr hinüberfahren. Sie war nicht in ihren Zimmern, nicht auf den Höfen, nicht in den Gärten. Mit ihrem Fräulein Kollonits war sie vor kurzem, hieß es bei der Wache, zu Fuß, tief verschleiert zur Burg hinausgegangen. Daß ihn solche Sehnsucht nach ihr erfaßte. In einer herzlichen Trauer lag er allein eine halbe Stunde in seiner Kammer, ließ sich dann umziehen mit brauner Kniehose, glatter Jacke, weiter loser Hose, wie ein gewöhnlicher Mann, ein Handwerker, ein Bieranstecher; farbige Strümpfe und fliegende Bänder trug er, eine braune niedrige Kappe stülpte er sich gedankenlos auf; der Leibkammerdiener folgte ihm nach wenigen Minuten, hinterher in zwanzig Schritt Entfernung wie eine Magistratsperson wandernd mit kleinem Degen, in einem hohen braunen Filzhut; der einfache Anzug gelb, die mageren Waden in roten Strümpfen.
Der Handwerker, eine Weide in der Hand, irrte erst vor der Burg hin und her, schritt am Zeughaus vorbei, an der niederösterreichischen Kanzlei, kehrte wieder um. Es war ein regnerisches Wetter, der Kot lag hoch, es war neblig, bald mußte es dunkel werden.
Wie Ferdinand das schwerfällige Gebäude der Minoriten passierte, sah er jemand laufen. Und eine unerklärliche Bewegung zwang ihn zu folgen. Sie bog in Gäßchen auf Gäßchen ein, blieb in Torwegen stehen, nestelte an sich. Durch den Kohlenmarkt zum Graben. Zurück; man ging, durch Sänften und Karren getrennt, über eine lange schmale Holzbrücke. Eine Scheu bedrückte ihn, sie könnte eine Dirne sein; er zögerte. Die Kirchtürme von Sankt Niklas. Da ging sie in das kleine Schwesternhäuschen neben der Kirche. Die Türe fiel zu. Er stand draußen. „Wie sonderbar, daß ich hier stehe. Und daß ich nicht weggehe.“ Er hob den Klöppel der Glocke, fragte, wer eben gekommen sei; ein Mädchen hatte geöffnet; man schrie entfernt: „Man hat geschickt.“
Über den dunklen Gang lief etwas an, sah ihm ins Gesicht, stand zitternd da. „Was ich will? Eleonore, ich weiß selbst nicht, was ich will. Ich weiß nur, ich möchte mit dir gehen.“
„Siehst du. Jetzt holst du mich. Jetzt bereust du deinen Starrsinn.“ Er hing an ihrem Arm, sie wickelte den Schleier um den Hals. „Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Eleonore. Wir wollen davon nicht reden. Es ist weiter nichts, als daß ich gern mit dir gehe.“
Über die Brücke. „Versprich mir. Ich will nichts von Mantua reden und nichts von dir. Versprich mir, du wirst den Teufel von Herzog nicht wieder holen.“ „Sprich weiter.“ „Wenn du ihn brauchst, wirst du ihn zwingen, Ferdinand. Du mußt ihn wie einen Knecht, einen schlechten Demütigen, in der Hand haben, dem man nicht traut.“ „Sprich nur weiter.“ „Machst du dich lustig über mich?“ „Nein, ich gehe gern mit dir.“
Stumm kamen sie vor die Burg. Im Regen gingen sie durch eine Seitentür, die ihnen der Diener aufschloß. „Komm zu mir, Eleonore.“ „Weiter nichts?“ Sie weinte.
Er leise: „Eleonore. Ich weiß selbst nicht, was ist. An mich kommt nichts heran. Alles beglückt mich. Deine Stimme beglückt mich, dein Weinen beglückt mich, dein Klagen beglückt mich. Als wenn ich um mich eine Schale zugemacht hätte.“
Sie weinte weiter. Er: „Könnte ich dich nicht auch erfreuen?“
Vom Main her südwärts schwoll verendend die Armee des unglücklichen Grafen Tilly.
Mit dem Rest seiner Truppen, zwölftausend Mann, dazu achttausend gepreßten Bauern, griff er in der Schärfe des Winters den schwedischen General Horn an, trieb ihn in die Stadt Bamberg hinein. Drin ließ er die Schweden bis auf den flüchtigen Rest massakrieren.
Da hatte sich der mordgewaffnete König schon aus seinem Mainzer Lager erhoben, ließ den Rhein los. Hinter ihm blieben ein junger Herzog Bernhard von Weimar und der Pfalzgraf von Birkenfeld.
Und wie der Schwede anschnob, wich Tilly erzitternd aus Bamberg, wich die geschwollene Regnitz entlang, durch das Ansbachische, an Nördlingen vorbei auf Donauwörth. Wollte sich hinter die Donau verstecken.
Der Tritt des Schwedenkönigs tapprig schwer hinter ihm, langsam. Rechts schlürfte er, links fraß er; er kaute, spie, schnüffelte. Er legte sich über Nürnberg; der Hohe Rat wischte eingezogenen Schweifs zu ihm heraus vor das Tor, goldene Trinkgefäße auf den kalten Händen tragend. Sie kreischten und pfiffen: „Der Makkabäer!“ „Gideon!“ „Josua.“ Er rollte die Augen und ließ es sich, da es ihn kitzelte, wohlgefallen.
„Es war ein schöner Winter dies Jahr,“ gönnte er den Ratsherren, „gebe Gott, daß auch der Sommer gut wird. Ich predige euch das Evangelium auf eine Weise, wie ihr nicht wieder hören werdet.“ Er setzte die Beine vorwärts, Staub und Dampf von sich gebend: „Seid fromm, daß Gott weiter hilft.“ Hinter sich ließ er die Besatzung. Hunderttausend Taler stopften sie ihm bei, wie er wanderte.
In Donauwörth konnte Tilly nicht bleiben; der Kurfürst warf Boten nach Boten gegen ihn: wie weit er denn fliehen wolle, wie weit noch München entfernt sei. „Ich will schon nicht mehr fliehen, als ich muß,“ knirschte die Augen verdrehend der kleine General, das Papier in den Händen zerreibend, „ich will mich schon stellen. Nur Ruhe, Ruhe.“
Aber der Schwede plumpte, murrte, knurrte, trampste näher. „Ich will stehenbleiben.“ Und zitternd in einem unsäglichen Hinschmelzen gab er schon wieder den Befehl nach rückwärts. Hinter die Donau, über die Lechbrücken. Schwindlig, den Mund weit offen, stand er da auf den Stoppelfeldern, Bayern lag in seinem Rücken. Schwindlig mit verwehenden Gedanken sagte er, lächelte er, die Zähne kaum entblößend, zu seinen Offizieren: „Wir werden hier nicht weggehen. Der Schwede kommt heran. Wir werden Bayern schützen.“
Es wurde befohlen, auf Ingolstadt Truppen zur Verteidigung zu werfen, die Zugangsstraßen von Augsburg und Ingolstadt mit vierzehn Kompagnien zu sperren. Dann lagerte das Heer sich hinter dem Lech in einem dichten Wald. Und wie Tilly das rückwärtige Terrain besichtigte, stoben Alarmreiter an, Alarmreiter, Alarmreiter. Flüchtende Bauern. Flüchtende Bauern. Auf Wagenreihen Dörfer, Dörfer, ganze Dörfer. Als hätte der Schwede sie entwurzelt, warf sie ein Orkan mit Sack und Pack vor sich. Tag und Nacht, Tag und Nacht. Es regnete Städte.
Der geborstene Tilly hielt sich steif. Lief, ein schallendes Knochengestell, flach mit Muskeln Sehnen Nerven gepolstert; der Bauch, die Brust, der Schädel breit geöffnet. Hervorquoll seine blutbegossene Seele selbst. Geschrei, Kreischen, Brüllen, Knirschen, Knurren, dünnes Piepsen umging ihn. Seine Gedanken schlugen wie überlange nasse Haare über sein Gesicht, über Stirn und Augen, blendeten ihn.
Er lächelte süß, in bewußtloser Hingerissenheit, hin und her dunkel flutender, sich hebender Verzweiflung. Er betete und erreichte sich nicht. Er war ein Mensch, den man mit Pech bestreicht und in Federn wälzt; ganz hinter seinen Taten verschwunden. Keine Gedanken an Wallenstein hatte er mehr. Er suchte zu umdenken sein Leben, seine Oberkommandantin Maria, mit der er jeden Tag seines Lebens angefangen hatte; knickte zusammen. „Ich bin ein frommer Katholik gewesen all meine Zeit“, winselte er vor seinem Feldkaplan, der verwundert vor ihm stand, ihm tönend zusprach.
Als die ersten Kanonenschüsse fielen, sauste er auf den Feldern herum, suchte von irgendwoher zu hören, ob er sich nicht noch auf Ingolstadt zurückziehen sollte. Fürchtete sich, fürchtete sich: begriff mit einmal, daß er sich fürchtete. „Ich bin ein alter Mann, habe keine Messe versäumt“, zuckte es staunend in ihm.
Zweiundsiebenzig Geschütze ließ Gustaf auffahren gegen den Wald, in dem die Kaiserlichen lagen. Unter grausamem Krachen und Prasseln barsten die Stämme. Als die Feinde eine Insel bei Oberndorf fanden, die schrecklichen Finnen, schwammen sie Trupp auf Trupp wie Wasserratten an. Man schlug einige tot, es kamen neue. Schwedische Kanonen fuhren über einer Brücke auf, die niemand über Nacht hatte entstehen sehen. Ein heulender zähnefletschender lehmwühlender Kampf halb im Wasser, halb auf der Erde fing an. Die Schweden Finnen, es waren keine Menschen. Kaum gab es Tiere, die ihnen glichen, wie sie schlammbedeckt, graubraune Hautfarbe, tangtriefend, armschwenkend sich aus dem Wasser erhoben, krumm anwateten, schluckten, kauten, spritzten, pfiffen. Sie waren so schlecht, so ekel, so totschlagwürdig, daß erst zaghaft die Kaiserlichen, die Bauern auf sie eindrangen, geführt, gelockt, dann von dem Grimm und der Scham, dem Entsetzen gerufen geworfen: „Um des Heilands willen.“
Sie schrien zu Hunderten und Tausenden, die Kaiserlichen, auf dem überhöhten Ufer des Lech, als sie das beispiellose kotige regsame Grauen aus dem Wasser auf sich zukommen sahen. Es gab wenige unter ihnen, die nicht in diesen Augenblicken die blinde Entschlossenheit angewandelt hätte, zu sterben oder diese Unwesen sich aus dem Gedächtnis zu wischen. Sie drangen herab auf die Fratzen.
Mörderisch tobten die Kanonen in ihrem Rücken; Sprengen Klatschen Reißen von stöhnender unterirdischer Gewalt. Aber Tilly auf seinem hochbeinig tanzenden Schimmel irrte zwischen den Fremden und den Kanonen hin und her; träumte, ohne zu wissen, was, lachte wimmerte. Die Fragen seiner Offiziere beantwortete er nicht. Seine bis zur Weiße aufgerissenen Augen wurden immer wieder von den silbernen brandenburgischen Aufschlägen angezogen an seinem eigenen linken Ärmel. Um diese Aufschläge war ein Geheimnis. Bei jedem Kanonenschuß zuckte er zusammen, duckte sich, sah um sich. Das Wort „Maria“ mahlte er zwischen den Zähnen, während seine Augen suchten auf dieser Holzbrücke, in dem plantschenden Wasser. Wie an einem vom Himmel herabhängenden Faden zog sich seine Sehnsucht und Ratlosigkeit in die dünne Höhe. Ein Dreipfünder, dessen Abschuß er nicht einmal gehört hatte, warf seinen Schimmel um, zerschmetterte ihm selbst den rechten Schenkel über dem Knie. Er dachte und träumte lange nichts.
Aus der bodenlosen Schwärze tauchte er auf; es schneite. Abend, ein Troßwagen, wühlender Schmerz im Bein. Wagenknarren, Getümmel um ihn. Im Stroh neben ihm hockend der Feldscher. Tonlos auf durchbluteten Wolldecken der General: was sei, wo man sei. Bei Ingolstadt; der Widersacher habe versucht, sie von Bayern abzuschneiden, es sei mißlungen, der König selber hätte beinah sein Leben dabei gelassen.
„Was, was!“ Tilly, der Totenkopf, furchtbar erregt, „abschneiden, was ist!“ Und dann ächzte er, ließ seine Offiziere kommen, die in der Nähe ritten. Sie krochen einzeln herein, wiederholten ihm, der halb taub schien, dutzend Male die Ereignisse. Er rieb sich die Nase, die Stirn, fragte ängstlich von neuem, stöhnte: „Regensburg! Regensburg!“ faßte sie bei den Händen, bittend. Dann erst bemerkte er die lähmungsartige Schwere, diese sonderbare dumpfe, in allen Gelenken, tief in den Knochen, in die Därme, Lunge, die Schultern aufsteigend; die Dürre in seinem Mund.
Der Kaplan kauerte neben dem Feldscher. Der Wagen ratterte über die Chausseelöcher, oft legte er sich schief auf die Seite. Aus der bodenlosen Schwärze wieder auftauchend, langsam, nicht ganz entlassen: „Der Kaplan! Ah, Regensburg, das Heer auf Regensburg führen.“ Der Kaplan. Dies waren die Sterbesakramente. Jetzt daran festhalten, fest einbeißen. Maria, der Himmel, die Heiligen; das waren nur leere Worte, man konnte sie sprechen, sie ließen sich nicht denken. Das Bohren, Sägen, Drehen im Bein, das wogende Unbehagen den Leib hinauf, die alles überflutende zurückebbende wieder anschwemmende Lähmung, diese verdunkelnde knochenfüllende knochenzerknackende wirbelverschiebende tödliche Lähmung. Jetzt hieß es sich entscheiden. Aus dem Wege alles. Maria, Jesus. Er spie, rollte die Augen; hier ist nicht die Rede vom Schweden. Der Kaplan hielt seine Hände; Tilly bat, ihm Maria zuzurufen, wenn ihm das Bewußtsein schwinden wolle. Scharf blies der Schneestaub in den Wagen. Er weinte in sich: „Ich habe mein ganzes Leben Maria gedient, ich will sie jetzt halten, ich darf sie nicht verlieren. Der Kaplan hat mir Absolution erteilt, es wird alles gut.“
Die Wellen der Lähmung und Verdunklung rollten stürmischer an, mit kaltem Schmerz gemischt. Alle Glieder fielen von ihm ab. Und er fing an zu ringen. Zwischen jeder Welle schrie er „Maria!“ Der Kaplan im Wechselruf: „Maria!“
Schlagartig rollte es heran. Aus gelben grasgrünen braunen Wolken fuhren die Stöße gegen Bein und Leib. Sie knatterten zwischen die Schulterblätter in den Hals. Die Wolken waren widrig, schwammig feucht, wühlten ineinander. Es waren die Finnen, die anwateten, die aus Blutschande gezeugten. Er spie, schrie heftiger, kreischte, röchelte vor Entsetzen.
Der Kaplan rief: „Maria!“ Tilly sah entsetzt, wie er die Lippen bewegte.
Furchtbare Hammerhiebe aus den Wolken. Mit jedem Hiebe zuckte er zusammen. Den Atem benehmend; er war der Amboß. Was sagte der Kaplan. Er mußte wissen, was der Kaplan sagte.
Dumpf wetternd, zermalmend, niederklafternd.
Niederklafternd.
Zusammengezogen lag er, auf die Seite gestoßen.
Verröchelte, die Arme schützend vor der Brust.
Da löste sich das Gespensterheer von dem warmen blutsickernden kleinen Körper. Zappelnde Rümpfe der gemetzelten Türken Franzosen Pfälzer, die jaulenden hängenden zertretenen Hunde, kletternden Pferde, die mit den Hufen sich an ihn hielten. Zwischen ihnen gezogen matt, noch naß, seine eigene erstickte Seele.
Verknäult flogen sie unaufhörlich rufend durch die verschneite Luft, ihrem dunklen Ort zu.
Hinter dem toten Tilly zog der Schwedenkönig, Torstenson auf dem linken Lechufer mit schwerem Geschütz deckend. Er stieß auf Nürnberg. In sein Lager zu Fürth schleppte man täglich sechsunddreißigtausend Pfund Brot und hundert Eimer Bier. Er klatschte sich den Leib vor Freude, als er durch das Laufertor ritt. Die Ratsherren boten ihm eine silberne Erd- und Himmelskugel, zwei Fuder Wein und zwei Fuder Hafer: „Ich hätte mich eher des jüngsten Gerichts versehen, als nach Nürnberg zu kommen.“ Nichts hielt mehr vor ihm. Aus seiner herrlichen Residenz scheuchte er den Bayernfürsten, der hinter sich ließ, woran er sein Leben über gebaut hatte. Der Schwede wußte, daß bei diesem Gedanken an München sich das Herz des Bayern in Todesschmerz zusammenziehen würde. Nach Freising waren ihm entgegengeritten der Münchener Bürgermeister Friedrich von Ligsalz, die Patrizier Barth und Parstorffer, ihm die Schlüssel ihrer Stadt zu bieten. Er hob auf der musikschallenden Landstraße den Degen: den Schlüssel habe er schon; was machten sie für Scherze; er werde sie mit einer halben Million Talern beschweren. Und so ritt er, eskortiert von drei Infanterie- und Kavallerieregimentern, an der Spitze von Dutzenden deutscher Fürsten in die Stadt ein, deren Kirchen er durch seinen Besuch schändete.
Es war warmes sprießendes Frühjahr geworden; die Jesuiten berief der König in den Garten ihrer Kirche zusammen, verächtlich grob sprach er zu ihnen: „Es ist Frühjahr geworden, die Macht der katholischen Kirche neigt ihrem Ende zu. Wie Strohhalme sind ihre Säulen geknickt, der Kaiser und der bayrische Kurfürst. Seid friedlich und besinnt euch. Ihr seht selbst, Gott ist nicht wider mich.“ Erst dachte das schwedische Heer an Plündern und der Kriegsrat kam stundenlang nicht zur Entscheidung; denn von hier war unermeßlicher Haß gegen den evangelischen Glauben in das Reich ausgegangen. Satt erklärte der König, man solle sich mit dem Betrag von dreihunderttausend Gulden begnügen. Einen kleinen Teil der Summe verehrte er den ihn begleitenden Fürsten, besonders dem Pfälzer Friedrich.
Der blonde Friedrich überwand seine Melancholie nicht. Er spazierte in der Stadt des anderen Wittelsbachers herum, dem er sein Unglück verdankte. Nicht einmal nach Prag zu gehen in das ihm entrissene Königreich hatte der Schwede den Pfälzer vermocht. Am Schönen Schrannenplatz residierte Gustaf. In einer verschwiegenen Resignation folgte der noch immer schöne stark gedunsene Mann dem König, folgte ihm wie seinem Schicksal, gesenkten Kopfes und ohne Widerstreben. Die unzerstörte Üppigkeit seiner Frau ging, erschreckend unberührbar, menschenunähnlich neben ihm, riß ihn manchmal zu Orgien mit. Rusdorf, der Kleine, lockte ihn, sich zu freuen. Zu freuen! zu freuen! Wo gab es auf dem Festland soviel Siege wie bei dem Schweden! Gingen sie nicht hinter dem König wie hinter einer Feuersäule.
Sporenklirrend wanderte, die Hände auf dem Rücken, der Pfälzer mit seinem Rat den langen runden Gang in der Neuen Feste entlang, dessen Wände mit den Bildnissen der Wittelsbacher tief behängt waren. Er sah das Gemälde Esthers, die verzweifelt Ahasver um Gnade für ihr Volk bat. Schweigend hörte er den Rat schwatzen. „Ihr habt recht, Rusdorf,“ brachte er heraus, sein schlaffes Gesicht mit den Händen bedeckend, „und ich bin verloren. Ich bin verloren. Ich muß mich gewiß freuen, wie Ihr sagt.“ Später: „Ich tadle Euch gewiß nicht. Ich will Euch in Eurem Eifer nicht lähmen, Rusdorf. Wahrscheinlich werden meine Nachfahren Euch wie einem Held danken. Ich? Wir verkommen alle samt und sonders. Ich wie der Kurfürst von Brandenburg und Sachsen. Wie der Maximilian von Bayern, der meinen Kurhut trägt. Wir werden zu nichts. Die schwedische Zeit bricht an für das Deutsche Reich. Ich — ertrag’ es nicht. Wie ich Euch sagte: ich bin verloren.“ Dann hielt er an einer Fensternische den kleinen Rat fest: „Eins sage ich, Rusdorf,“ dabei blitzten seine blauen großen Augen heiß, „wer mir das widerraten hat, den Kaiser in Regensburg um Verzeihung zu bitten, den Kniefall vor ihm zu tun, der hat nicht gut an mir getan. Wißt Ihr! Ich hätte gebüßt, es wäre mir manches verlorengegangen. Jetzt sitz’ ich in der Falle. Ich bin zum Bettler und zum Fremdenknecht, zu einem Verräter geworden: ja, so steh’ ich vor mir. Glaubt Ihr, ich könnte vor diesen Wittelsbachern meines Hauses gehen, ohne mich zu schämen, bis in meine Nächte?“ Die Beruhigungen des Rates nutzten nichts; Friedrich legte den Arm um die Schultern des kleinen tiefbedrückten Mannes, leise sprechend: „Die Welt ist noch nicht zu Ende. Glaubt Ihr nicht, daß der Schwede noch eines Tages geschlagen wird? Gott läßt die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ich warte, ich weiß, was ich tue.“ „Was?“ „Der Kaiser ist ein gütiger Herr. Er wird mein Unglück mitfühlen. Meine Reue ist tief. Ich bin jung und kenntnislos gewesen. Er wird mir verzeihen.“ Und er wanderte leise weiter mit Rusdorf. Zwischen den hängenden Bildern der Wittelsbacher auf und ab.
Und Rusdorf erfuhr nicht und konnte nicht verhindern, daß Friedrich im größten Geheim einen eigenhändigen Brief an den flüchtigen Maximilian schickte, in dem er um Verzeihung bat, daß er sich ohne seine Einladung zum Besuch in München aufhielte. Nicht er hasse Maximilian; sie seien Wittelsbacher, von einem Blut; Max möge gewiß sein, daß nichts an seinen Bildern und Gebäuden zerstört würde. Nicht er hätte den Schweden in das Deutsche Reich geführt. Nein, er sei es nicht gewesen. Und fast demütig bat er ihn, bei Kaiserlicher Majestät zu versichern, daß er sich unverändert als des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation treu anhänglicher Sohn fühle.
Dies war ein Brief, nach dem er sich wohler als in vielen Jahren fand; es klang in seinen Ohren gut: „Als des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation anhänglicher Sohn.“ Rusdorf hatte es nicht leicht in diesen Wochen, ihn beim schwedischen Herrn zurückzuhalten. Seine Fluchtneigung gelangte sogar an den König, der gutmütig bei Tisch meinte: „Laßt ihn. Deutschland ist ein Kranker, der nur durch starke Mittel gesund wird. Ich bin erst im Beginn der Kur.“
Nach Warschau verkündete Gustaf dem Reichstag durch Boten: er gedenke die Krone Polens, die ihm zustehe, in nicht zu ferner Zeit mit der Böhmens und Ungarns zu vereinigen. Venetianer, die mit Briefen und Geschenken vor ihn traten, führte er an dem stummgrüßenden Pfälzer vorbei durch die Residenz. Im Vierschimmelsaal setzte er sich zum Verschnaufen. Er danke ihnen; die Signoria solle gewiß sein, daß das Haus Österreich auch in Italien noch heute lache und morgen nicht mehr.
So mächtig war, bis über die Donau, bis nach Straßburg vorgedrungen, das schwedische Heer, daß die Herren in Paris ins Zittern gerieten. Ein unerträglicher Anblick war dieser Gotenkönig, wie er über das gefürchtete Riesenreich ähnlich einem mittelalterlichen Belagerungsturm hinschwankte, Pechströme und Bomben werfend; der alberne schlaue Klotz aus Upsala. Sie fingen beim Kurfürsten von Sachsen zu stechen an, ob es sein deutsches Selbstgefühl ertrage, dem Schweden Bütteldienste zu leisten, und ob man in ihm oder Gustaf Adolf das evangelische Oberhaupt des Reiches zu sehen habe. Sie irrten unruhig von protestantischem Hof zu Hofe. Die katholischen fast verzweifelten Herren beschworen sie fest zu bleiben.
Der gereizte König Ludwig konnte seine Nervosität nicht zähmen, weder der Kardinal noch der Pater Joseph konnten ihn mehr zurückhalten. Seine Furcht, der Schwede würde ihm im Elsaß und am Rhein zuvorkommen. Man ließ ihn.
Das Heer in der Hand stieg er auf Metz, nahm Moyenvik, Pont à Mousson. Es befriedigte ihn noch nicht. Da war Nancy. Er mußte rasch, rasch an den Rhein, ehe Gustaf in Bayern fertig war. Er mußte auf Trier. Es war alles reif für ihn.
Indessen mit aller Ruhe der Friedländer sein ungeheures Heer in Mähren auf den Fuß stellte. Die Klagen des Bischofs von Bamberg, der Reichsstadt Regensburg, des flüchtigen Bayern, die Rufe aus dem Elsaß, den westfälischen Stiftern fanden ihn taub. Er sammelte, ließ im Reich geschehen, gab nicht eine Kompagnie ab.
Seine Güter besetzt. Die Geschäftsfreunde zögerten keinen Augenblick mit ihrem Vertrauen. Die Börse in Hamburg, Bankhäuser in Augsburg gewährten ihm und dem Herrn de Witte und Bassewi alle geforderten ungeheuren Kredite. Auf Schleichwegen wurden aus Prag von der verzweifelten Judenschaft mächtige Barren Gold und Silbergefäße in gewöhnlichen Heuwagen in sein Quartier gefahren.
Das Reich barst. Er schob sein Heer in die Winterquartiere. Sie sollten ihn nicht bedrängen, sagte er nach Wien; drei Monate brauche er zum Sammeln des Heeres.
Der alte Apparat war wieder in Funktion. Seine Werbepatente galten für das Reich Spanien und die Staaten Italiens. Obrigkeiten wurden im Augenblick für die Zweige des Heeres geschaffen, Generalkommissare bestimmt für Böhmen, darunter der Graf Michna von Weizenhofen, der wie vom Blitz getroffen war, als ihm die Ernennung zuging; für Schlesien Stradeli von Montain, für Mähren Oberst Miniati, für Niederösterreich Questenberg. Holk wurde Kapo der Reiterjustiz, Obristschultheiß Ludwig von Sestoch. Das Generalvikariat füllte aus der Pater Florius von Cremona. Des Herzogs Generalleutnant nach Kollalto, der bei Mantua hingerafft war, wurde Gallas, der Welschtiroler, mit Aldringen in spanischen Diensten aufgewachsen.
Die Trümmer, die Tilly hinterlassen hatte, zehntausend Mann, übernahm er, ein mißmutiges geschlagenes fast waffenloses Heer. Etwas Rasendes, Zerbrechendes war jetzt in der Art des Böhmen, sich über die Dinge zu werfen. Er hatte in dem Augenblick, wo er sich den Arbeiten näherte, etwas von einer Flamme an sich, die aus einem langen Schornstein gequalmt hat und nun heulend den Schornstein am Boden umbricht, wütend in die entsetzte Luft hineintobt. Die Vertreter der Banken, die sich in seinen Kammern bewegten, staunten über die Verwendung des Geldes, das sie heranbrachten. Es lief scheffelweise von ihm, verdampfte an ihm; er schien es nicht rasch genug unter die Menschen werfen zu können. Seine Glut, sagten die einen, stamme daher, daß er sich bei seinem eingetretenen Verfall das letzte Leben auspresse; die andern spotteten, er sei zu gierig nach seinem verlorenen Besitz.
Seine nahe Umgebung aber fühlte längst, daß er sich veränderte, wilder und brutaler als je, daß er etwas Unklares leidenschaftlich betrieb. Er hatte kein Wort des Interesses oder Trauer über seine Güter verloren. Sie wußten auch, daß etwas Besonderes mit diesem Verlust an den Hans von Arnim war, der diese Güter und Schlösser wie seine eigenen schonte. Die Fremden an Wallensteins Hauptquartier schwankten zwischen Schrecken und Widerwillen; so arbeitete ein Größenwahnsinniger. Daß Wallenstein in den dänischen Feldzug mit zahllosen Karossen und Juchtenwagen gezogen war, war weltbekannt. Jetzt standen die Karossen und der Marstall verwahrlost in Prag, er kümmerte sich nicht um sie und um keinen anderen Prunk.
Die Sturmtruppen waren mit Piken und Bruststücken auszurüsten; in Pardubitz wurden ganze Straßen von Holzschuppen gebaut für die Unzahl der angeforderten Waffen. Es wurde bekannt, daß Wallenstein jede kalkulierte Zahl eines Bedürfnisses mit zwei und drei multiplizierte und dann noch unbefriedigt war und hinzuforderte. Abenteuerliche Mengen Pulver lagerten entlang der böhmischen Grenze; bei Pardubitz waren alle Brotfrüchte Böhmens aufgespeichert, die mit Steuerabschlag verrechnet wurden. Wallenstein hatte erklärt, das Heer auf eine begrenzte Zahl bringen zu wollen; er schien aber keine Grenze zu finden. Oberst auf Oberst wurde ernannt; auf die Frage des erschöpften Hauptquartiers, wieviel Patente annähernd noch ausgegeben würden, bekam man den Bescheid, soviel sich bis März vergeben ließen. Die Träger der Namen Fugger, Kolloredo, Holk, Merode, Chiesa erschienen wieder an einem Hauptquartier des Herzogs zu Friedland, der zuletzt in Memmingen furchtdrohend nach Italien und dem Elsaß residiert hatte und von ihnen gegangen war wie das Licht, das die Erde verläßt. Sie ritten selig zu ihm, der sie zu Merode, Chiesa, Kolloredo gemacht hatte, zu ihrem wahren Vater. Sie standen betroffen in seiner Nähe wie die anderen vor dem Prasseln und geradezu höllischen Verderb und Wachsen. Einige Vertreter der Börsen reisten Hals über Kopf ab, unfähig, diesen Weltuntergang, der sich um den Herzog vollzog, mit anzusehen. Michna konnte sie nicht beruhigen, sie verstanden das Lachen dieses klugen Mannes und gar Bassewis nicht, welche beteuerten, so sei es immer um den Friedländer. Die Obersten schwammen flossenschlagend in ihrem Element, schluckten, atmeten die besondere lichtbrechende Luft, die um den Herzog schwebte, erlebten die blitzartige Versengung und Verkohlung aller Besorgnis, die Verzauberung. Sie zogen nach sich Montard von Noyal, Pychowicz, Korpasz, Wiltberg, Lambry, Gissenberg, Filippi Corrasco.
Im frühen März, als Monate um waren, seit die ligistischen Scharen mit dem toten Tilly anrollten, hielt Friedland, mürrisch gegen den Wind die Augen kneifend, seine schärpenprunkenden Herren ignorierend, mit Ordonnanzen scheltend, bald in der Sänfte, bald zu Fuß, bald auf dem Pferde, Heerschau zu Rackonitz auf dem Hügel ab. Zweihundertvierzehn Reitergeschwader, hundertzwanzig Fußkompagnien, vierundvierzig Feldstücke, zweitausend Wagen mußten vorbei. Er hielt nur einige Stunden aus; nach fünf Tagen war man fertig.
Dann wollte er sich verabschieden. Und als die kaiserlichen Herren, Ognate und Eggenberg, ihm den Brief Ferdinands gaben, er möchte bleiben und den Oberbefehl im Kriege führen, nörgelte er erst, erhob dann das alte heisere Geschrei: ob sie ihm noch nicht genug getan hätten, von Ungarn ab bis Regensburg, ob sie ihn für einen Verurteilten oder Verrückten hielten; er wolle seiner Wege gehen, vor ihnen sicher sein. Er machte, wie er hinkte, am Stock durch das Zimmer in Rackonitz schlich, einen verbrauchten Eindruck.
Die Herren hatten nichts anderes erwartet; sie saßen, warteten. Fürst Eggenberg wußte, daß er als Geschlagener vor dem häßlichen Sieger saß und im Begriff war, die schrecklichen Bedingungen entgegenzunehmen. Es tat ihm wohl, an die früheren guten Zeiten erinnert zu werden; er wurde hart dabei, konnte sich wappnen. Es wurde klar, daß der Herzog vorhatte, an ihnen eine unerhörte Grausamkeit zu verüben; Eggenberg und Ognate wollten sich nicht wehren, der Herzog würde an ihnen erlahmen. Das Keifen zu Ende, fragte Wallenstein, gehässig und listig auf sie blickend, was sie ihm brächten; es klang: wie sie sich denn freikaufen wollten. Dies war der Augenblick, wo sich die beiden zum Abschied erheben konnten, um zu sagen, sie sähen in ihrem Quartier seinen schriftlichen Vorschlägen entgegen; er möge in aller Muße den Kreis seiner Wünsche aufzeichnen.
Sie nahmen dann ohne weiteres an, was Wallenstein in dem überbrachten Schreiben forderte, das Ungeheuerlichste, was ein Mensch von einem Kaiser des Heiligen Reiches verlangen konnte, ohne ihn zu töten: Absolutes Generalat, Bestallung als Generalissimus des Hauses Österreich und Spanien, Konfiskationsrecht im Reich ohne Einspruch des Hofrats, der Hofkammer und des Kammergerichts, Versicherung auf die Erblande als Rekompensation, Lieferung aller begehrten Unkosten; die Erblande stehen ihm zum Rückzug beliebig offen, er muß in die Friedensverhandlungen eingeschlossen werden. Dies unterschrieben schaudernd die beiden Unterhändler, nachdem sie es gelesen hatten, im Namen des Kaisers, von dem sie Blankovollmacht hatten. Waren dabei von einer wütenden Lust erfüllt: sie hatten ihn entlarvt, nun sah man, woran man war. Hier verhandelte kein Feldherr wegen seiner Anstellung, sondern ein Tyrann, der seine Rachsucht befriedigen wollte.
Auf der Rückfahrt erwogen sie: der Schwede wird in seinem Vormarsch aufgehalten werden, Böhmen befreit, Bayern befreit werden; dann kann sich die Liga erholen, ein spanisches Heer kann vom Elsaß erscheinen. „Wenn er sich nicht mit den Widersachern verbindet, mit Schweden und Sachsen“, murmelte der Spanier. „Er wagt nicht,“ dachte Eggenberg nach, „zunächst folgt ihm die Armada dazu nicht. Für den nächsten Augenblick haben wir das nicht zu fürchten.“ „Wer weiß“, murmelte Ognate. „Und dennoch! Und dennoch!“ jubelte Trautmannsdorf, als sie in Wien vor Wallensteins Kapitulation saßen und nichts sprachen. Er streichelte liebevoll tröstend dem alten Fürsten die Hände unter dem Tisch und drückte ihn an sich.
Sofort brach der Herzog die Verhandlungen mit Gustaf und dem Sachsen ab. Ohne Zeitversäumnis alarmierte er seine Armada, bat durch Eilboten Arnim zu sich, den Führer des sächsischen Heeres in Böhmen. Der Herzog war gegen seinen Freund in Znaim kalt und entschlossen: „Arnim, Ihr müßt aus Böhmen heraus mit Euren Sachsen. Ihr werdet das einsehen; es bleibt zu fragen, was soll dann geschehen.“ „Ich werde mich in Sachsen verteidigen.“ Darauf war der Herzog erregt; das sei eine trotzige verkehrte und verbohrte Denkweise. Was wollte er denn in Sachsen verteidigen? Wen? Ob sie Erzlappen seien, daß sie sich die Köpfe zerschmissen für nichts. Auf Arnims Frage, was denn weiter geschehen solle und ob Arnim etwa vor dem Herzog auf schimpfliche Weise samt seiner Armee das Gewehr ins Korn werfen sollte, schnitt Wallenstein die Unterhaltung ab: Arnim möchte sich überlegen, was er, der Herzog, eben gesagt habe; es sei ihm lieb, drüben bei den Widersachern ihn zu haben. Er werde begreifen, daß dieser Krieg nicht so weiter gehen könne, diese Schmach, diese Gaukelei für Affen. Verteidigung in Sachsen! Nach weiteren Schimpfworten auf den Schweden und auf die Wiener Politik verabschiedete der Herzog den andern, der fluchte, sich einen Tölpel nannte, über das Gespräch nicht ins klare kam.
Wallenstein gab ihm einige Wochen Zeit. Dann warf er das Heer, das sich an Ort und Stelle nicht mehr ernähren konnte, nach Böhmen, die Sachsen liefen auseinander. Friedland stürzte vom weißen Berg über Prag her. Die Stadt war wieder kaiserlich.
Arnim, noch zweifelnd, ob der Herzog wirklich etwas Ernstes vorhatte, suchte sich in Leitmeritz zu halten. Zu seinem Schrecken, der sich mit Widerwillen mischte, umzingelte ihn Friedland und schien ihn vom Heer abschneiden zu wollen. Da raffte er, was er an Truppen hatte, zusammen, bereitete den Friedländern Schaden rechts und links, schlug sich von Ort zu Ort. Böhmen mußte er ganz aufgeben.
Die Juden lachten. Die unterdrückten Böhmen höhnten, warteten. Thurn, der alte Graf, Arnim nachkriechend, flüchtete vergrämt nach Dresden. Und ein Angstschauer lief über Sachsen, als Friedland in Böhmen nicht haltmachte, sich dem Erzgebirge mit weit ausgebreiteten Armen näherte, an die Überwältigung des Erzgebirges ging.
Plötzlich wandte er sich auf Bayern. Keiner wußte, ob er etwas gegen den Kurfürsten oder den Schweden vorhatte.
Der Schwedenkönig, sich mästend am südlichen und westlichen Deutschland, hatte nur zwanzigtausend Mann bei sich; am Rhein, Main, nördlich und südlich standen vier Armeen unter Baner, Tott, dem Weimarer Herzog, dem hessischen Landgrafen, verwüsteten das Land, trieben ihr Spiel mit der Bevölkerung.
Erst war der feiste König nur verblüfft, wie Wallenstein als Generalhauptmann des Kaisers auftrat, wartete ab, wessen er sich von dem verschlagenen Mann zu versehen haben würde, machte sich Vorwürfe, daß er ihm bei den Unterhandlungen nicht mehr entgegengekommen war. Er hoffte noch. Dann erfolgte der Angriff auf den Hradschin, die unglaubliche treulose Umzingelung Arnims. Ein Sturm von Unruhe ging durch Gustaf. Ehe er noch mit dem Herzog Fühlung nehmen konnte, hatte der sich erklärt. Wallenstein hatte kehrt gemacht. Front gegen ihn selbst. Das Spiel war klar. Wallenstein wollte Gewalt mit ihm reden.
Der König stieß nach Osten, um den Friedländer nicht mit dem Bayern zusammenströmen zu lassen. Zu spät. Bei Eger nahm Friedland die Trümmer des ligistischen Heeres auf. Von Weiden und Eger stieg die feindliche Heeresmacht herunter, schob sich auf Tirschenreuth. Der Friedländer wollte mit ungeheurer Überlegenheit ihm seinen Willen aufzwingen. Tief erschrocken, an Haß erkrankend, über Friedland erstaunend, gab der König nach, und Flüche auf Deutschland werfend, setzte er sich in Nürnberg fest. Der Herzog hatte ihn bei den Ohren; wenn er wollte, konnte er ihn zerschmettern, so schwach war er. Von Pegnitz zu Pegnitz zog der Schwede in gewaltigem Bogen Schanzen. Die Stadt wurde angerufen, den evangelischen Glauben zu verteidigen; mit leichter Unsicherheit, nur seinen nächsten auffallend, hielt der König eine seiner schmetternden Ansprachen an den Rat. Es glückte; der Rat schwur, wie Magdeburg zur evangelischen Fahne zu stehen bis zum Verderben.
Mit viertausendachthundert Söldnern, dreihundert Reitern stellte sich Nürnberg in seinen Dienst, dreitausend Bürgersoldaten kamen hinzu, alle Waffenfähigen vom fünfzehnten bis vierundzwanzigsten Jahr. Sie wollten Gott und dem wahren Glauben dienen. Vierundzwanzig Abcfähnlein ließen sie fliegen; der König musterte sie trübe. Auf den Fähnlein stand: „Dies Fähnlein fliegt zu Gottes Ehr, fürs Gewissen, frei und reine Lehr.“ „Saul, Saul, was verfolgst du mich? Laß ab, laß ab und bessre dich!“ Der König hatte kein Gefühl von Dankbarkeit für sie; mit einer sonderbaren ihm fremden Rachsucht griff er in diesen Wochen Deutsche an, erging sich unaufhörlich bei festlichen Tänzen in der Stadt in Schmähungen über die deutschen Fürsten; sie müßten hart hart kuriert werden. Auch der Pfälzer war zugegen, als er sich so ausließ bei einem großen Bankett in Ayrmans Saal beim Laufertor. Friedrich verließ offen den Saal mit dem Markgrafen Christian, der das Bankett veranstaltet hatte. Der flehte draußen auf der dunklen Stiege den Pfälzer mit Tränen in den Augen um Verzeihung. Sie umarmten sich; „keine Rettung“, schluckte der Markgraf. Friedrich: „Manchmal denke ich, der Friedländer könnte uns helfen.“
Schanzen, Redouten, Palisaden, Gräben, Batterien wurden um die Stadt in den warmen Junitagen aufgeworfen, die Vorstädte Wöhrd und Gostenhof mit einbezogen. Das Lager ließ sich der König errichten vor Wöhrd bis auf den Gleishammer, das Weicherhaus und den Lichtenhof; bei Lichtenhof stellte er das stärkste Werk hin. Er rückte ein mit vierundneunzig Kornettreitern, hundert Fahnen Fußvolk, achtunddreißig Geschützen, zweitausend Wagen.
Von Tirschenreuth nahte über Sulzbach der Kaiserliche. In das wandernde Volk geriet Oberst Taupadel mit Dragonern und vier Kompagnien des schwedischen Regiments Sperreuter hinein und wurde zermalmt. Sie umgingen wandernd Nürnberg, schoben sich zu beiden Seiten des blanken glatten Flüßchens Bibart an Zirndorf heran. Da in der lieblichen von grauen Schafherden begangenen Landschaft fanden sie eine niedrige Hochfläche, von Wiesen eingenommen, die rückwärts in einen kühlen dichten Wald führten. Nur wenige Kilometer von dem Schweden entfernt machten sie halt, setzten sich hin und verschanzten sich.
Der bayrische Maximilian von Kuttner begleitet ritt täglich durch das Lagergewühl zum Herzog herüber, nicht vom Hals seines Schimmels aufsehend. Er war ein Gefangener und ging seine Gefangenschaft beenden. Friedland wohnte mitten im Lager in einem erbeuteten rosaroten Türkenzelt, das weiß und blau orientalisch bestickt war. Einen riesigen viereckigen Raum bedeckte es; darüber erhob sich eine wimpelgeschmückte Leinwandkuppel. Am Eingang hielten Reihen von Bambusrohren einen goldbefransten Baldachin. In dem teppichbeladenen Empfangsraum nahm ihn der Herzog inmitten der Obersten und Generalspersonen an, selten sprachen sie sich allein.
Der Herzog sollte angreifen, war der Tenor der bayrischen Reden; er zeigte auf die ungeheure Überlegenheit, die man im Augenblick besaß und in zwei drei Wochen verliere. Erst kam der Herzog, zwischen tausend Geschäften, trinkend, ihn mißachtend, mit allgemeinen Einwänden; man müsse die Stärke des Schweden noch besser erkunden; eine Schlacht sei leicht begonnen und schwer beendet. Der Kurfürst hörte nicht das Gespött des Friedländers hinter ihm: „Nun habe ich den Maximilian so weit gebracht, daß er mir nicht allein gehorsamen, sondern mit der Pike auf der Schulter aufwarten muß.“ Wie der Bayer zäh drängte — mit jedem Tag wurde sein Land verwüstet, er durfte nicht sagen, daß eine kaiserliche Niederlage ihm Land und Leben kosten würde — traten die Obersten des Herzogs mit den Resultaten ihrer Beratungen hervor. Der Refrain lautete: wir sind zahlenmäßig überlegen, aber man kann nicht auf den Mut der Söldner bauen; sie müssen sich erst an Gefechte gewöhnen; es genügt, den Schweden zu stören, ihn zu zwacken und beuteln. Dabei blieb es. Sie zogen es hin; sein Land verdarb. Aus dem Kreise dieser Herren, die in alter friedländischer Üppigkeit lebten und fürstlich satt stolzierten, kam einmal die hochmütige Frage, ob man im bayrischen Lager vermeine besser Krieg zu führen als der Herzog; man habe bei Breitenfeld Gelegenheit gehabt sich zu beweisen. Hindurch durch die fünffachen Spaliere der Leibwache des Herzogs, starre Reihe der aufgestellten niederländischen Helmbarten, riesig ausgezogene Spießklingen mit Quasten und Kugeln am Klingenansatz, gräßliche Totenköpfe und hackende Schnäbel eingeätzt. Durch das Getümmel der ausschwirrenden ungarischen und polnischen Reiter, auf den Pferden am Sattel die kupfernen Kesselpauken; sie ritten über den aufgerissenen Wiesengrund, schneller, schneller, die Münder gespitzt, grell wirbelnd das Schlagfell aus Menschenhaut.
„Was hat der Herzog vor?“ fragte der Kurfürst seine Räte, die er aus Regensburg kommen ließ. „Er säumt.“ „Er säumt nicht“, der Kurfürst mit leeren Augen.
Die Widersacher lagen sich Wochen um Wochen gegenüber. Der Juli zog herauf, August; brünstige Hitze fiel hernieder. Sumpfig war der Wiesengrund von Friedlands Lager, das Wasser der Pegnitz nur mit Kampf erreichbar. Sie fochten täglich um das Wasser, schickten ihre Kranken und Verbrecher immer zuerst voraus, ließen sie abschießen, später erst stürmten sie vor unter dem Schutz der abgefeuerten Musketen. Fünfzehntausend Weiber strömten in das Lager, zu den Menschen kamen dreißigtausend Pferde. Mensch und Getier hatte nur die Aufgabe: zu liegen, zu liegen, dem Schweden die Fourage abzujagen, ihn zu ermatten. In des Schweden Lager stürzten die Scharen der Flüchtlinge ein. Nürnberg lief voll von ihnen. Wie eine Geißel umlauerten die Kroaten und Ungarn des Böhmen die Stadt, rissen das Lebendige nieder.
Heimlich betrieb Friedland seine Sachen. Gab Arnim keine Ruhe. Aus Böhmen sei er mit seinen Sachsen verjagt; die Kurfürstliche Durchlaucht von Sachsen möge gewarnt sein; sie sollten sich verständigen. Aus Sachsen kam Bescheid: der Kurfürst gedenke in Treue sich nicht von seinem schwedischen Bundesgenossen zu trennen. Da lösten sich Kavalleriemassen aus dem Zirndorfer Lager, erst Hunderte, dann Tausende. Holk mit seinen Kroaten setzte sich in Bewegung auf das offene Vogtland. Sie machten unterwegs Vaganten Versprengte Gesindel beritten; sollten um sich ein solches noch nicht gesehenes Verderben anrichten, daß man ihre Kraft erkenne. Unter dem von Plauen und Zwickau her einsetzenden Lodern der Städte und Dörfer, den Abschlachtungen und Schändungen der Menschen flüchteten selbst Arnim und der Kurfürst. Die bodenzerstörenden Unholde verkündeten hinter ihnen, sie seien nicht lange allein; Graf Gallas käme mit einer Schar doppelt so groß wie sie.
Bei Nürnberg lagen sich die Widersacher gegenüber.
Im Schwedenlager mußten die Pferde trockenes Gras rupfen. Eine Pest schlich unter den Menschen. Der Schwede auf Verstärkung wartend predigte Mut Manneszucht. Blaß und zornig ritt er täglich die Palisaden entlang, blickte herüber. Dies war kein Feldherr, kein Krieger, der zehnfach überlegen sich nicht zur Schlacht zu stellen wagte. Der hatte etwas Unmenschliches vor: Ermattung. Wenn erst Baner da wäre, sollte es ihm bezahlt werden. Und täglich fraß der dicke Gustaf an seinem Widerwillen. Die deutschen Fürsten wichen vor ihm, der Pfälzer betrieb offen seine Abreise.
Da hatte der Schwede an sich gezogen, was er suchte. Regimenter des Oxenstirn vom Rhein, Baner und Herzog Bernhard mit Truppen aus Oberschwaben, viertausend Hessen, der Herzog Wilhelm mit sechstausend Mann. Sie trafen bei Windheim zusammen. Der vergrauste Sachse, seine ganze Hoffnung auf den Schweden setzend, warf sieben Regimenter zu Fuß, zwei zu Pferd herüber. Sie drangen gemeinsam in die Stadt Nürnberg ein, die von Leichen stank, in der man sie mit Weinen und Schreckensgeschrei empfing, daß man nun vor Hunger ganz zugrunde gehen müsse. Und so bitter war die Not, so grausig schmolzen unter der Pest die Menschen zusammen, so wutgespannt war der König, daß auch nicht ein Tag mit der Entscheidung gewartet wurde.
Sein Heer hob sich gegen die Nordseite des kaiserlichen Lagers. Die Sachsen überschwemmten die Schanzen. Eine so furchtbare Artillerie arbeitete gegen sie mit brüllenden Salven, daß die Baumwipfel des Waldes in Dampf verschwanden, die Hochfläche des Lagers in Feuer und Rauch begraben wurde. Zwölf Stunden rannten die Schweden an. Als sie den östlichen starken Ausläufer des Höhenzugs, den Burgstall, hatten, regnete es; sie konnten die Geschütze nicht hinaufziehen. Bis in die Nacht wühlten die Massen ineinander, zweitausend Schweden blieben liegen. Finsternis und strömender Regen. Der Schwede ließ los.
Lag wieder in Nürnberg.
Tastete nach Verhandlungen, dachte, der andere habe auch genug. Keine Antwort. Ließ nach drüben gelangen: man solle ihm Mecklenburg lassen; der andere möge sich Franken nehmen. Verbissen und finster gab Gustaf das Signal zum Aufbruch. Von sechzehntausend Mann war die schwedische Kavallerie auf viertausend gesunken; die Fußkompagnie hatte statt hundertfünfzig Mann nicht sechzig. Die meisten deutschen Fürsten, auch der Pfälzer, hatten ihn in den letzten Tagen verlassen. An der Nordseite des Lagers marschierte er vorbei; noch einmal forderte er durch Kanonenschüsse den Feind zur Schlacht heraus. Drin rührte sich nichts. Eine Handvoll Weiber lief vergnügt an das unverteidigte Wasser. Johlten durch die hohlen Hände: „Wir haben dem Kaiser eine Schanze gebaut und haben dem Schweden den Paß verbaut.“ Sogar das Gepäck ließ der Friedländer unbehelligt passieren. Eine kleine Besatzung war in der Stadt geblieben; der Friedländer nahm von ihr keine Kenntnis. Wie der Schwede westwärts zog, langsam, unter großer Sicherung, dachte er, der Herzog werde folgen. Der blieb bei Zirndorf liegen. Brach erst nach fünf Tagen sein Lager ab; seine Vorhut fühlte nordwärts auf Forchheim vor.
Noch einmal wurde der träg hinziehende geschlagene Schwedenkönig von einem wilden Angriffsdrang befallen, als er sah, daß Friedland sich nicht um ihn kümmerte. Er verteilte seine Streitkräfte, machte plötzlich mit elftausend Mann kehrt, wandte sich auf den alten sieggezeichneten Weg südwärts nach Donauwörth, über die Donau. Nur den Bayern zog er vom Herzog ab, der sein Land schützen wollte, eine armselige Schar mit sich führte. Der Herzog blieb starr. Maximilian hatte es nicht erreichen können, daß Friedland sich Bayerns annahm. In den bayrischen Regimentern wußte man, daß der Kurfürst bei seiner letzten Bitte an den Herzog um Truppen von ihm angeschrien wurde. Maximilian suchte seine Räte über die Situation mit schmerzlichem Lächeln wegzutäuschen: „Nun sind wir alle froh, daß er uns entlassen hat. Er hätte uns noch alle umgebracht.“
Sie brauchten dem Schweden nicht lange folgen. Es war nichts als eine qualgeborene Selbsttäuschung Gustafs gewesen, daß er noch Entschlußfreiheit habe. Inzwischen meldeten alle Kundschafter, daß der ungeheure Wallenstein weiter nach Norden marschiere. Es war klar, er ging nach Sachsen, wollte nach den Untaten Holks den Kurfürsten knebeln, wollte ans Meer, die Schweden von ihrer Basis abschneiden.
Bei Donauwörth stand Gustaf, krampfhaft erregt auf eine Tat aus, die ihn aus der Verstrickung löse, als ihn diese erschütternde Nachricht traf. Zwei arme sanfte Tage ruhte sein Heer in der bergigen Sommerlandschaft. Hier war Friede, kein Feind in der Nähe. In ein Wäldchen zog sich der König zurück, lag wie ein Kranker vor einem geöffneten Zelt. Lautlos gingen in weitem Bogen um sein Zelt die Wachen; sie trugen die einheimischen braunen langen Röcke; sicher saßen auf ihren runden blonden Köpfen die hohen blauen rotgeränderten Mützen. Von Zeit zu Zeit schlichen Weiber flüsternd über das weiche Gras an sie heran; die schönen blonden Haare, Zöpfe bis zur Brust, märchenrote grelle Mützen aufgesetzt; kaum bewegten sie ihre faltigen blauen Röcke. Das war Schweden.
Der König wollte mit jemand sprechen. Der blanke kolossale Schädel Oxenstirns; Grubbe, sein Sekretär, mit stiller diskreter Miene. Gustaf hatte sich aufgesetzt. Es sei kein Grund zu verzagen; was sie meinten. Als sie sich geäußert hatten, schwieg der große schwere Mann, dessen Gesicht bleigrau und schweißbedeckt war; er sagte in Scham, während der Kopf zwischen die Schultern einsank: „Die Sachsen sind ja nicht mehr mein. Was werden unsere Frauen sagen?“ Auf ihre Berechnungen: „Ich bin zu groß daher gefahren. Es hat dem Herrn nicht gefallen. Ich war eitel. Ich habe seine Sache nicht rein erhalten. Wenn das Licht im Innern Finsternis ist — welch eine Finsternis! Niemand kann zwei Herren dienen. Schweden war mir alles. Jetzt kommen die Deutschen daher. Darum wollen sie mich vertreiben. Darum wird der Sachse und Pommer und Brandenburger nicht mehr bei mir halten. Hätt’ ich nicht dem Götzen gedient, wären sie bei mir geblieben. Wäre der Herr über mir geblieben. Mein Auge taugt nichts mehr. Darum ist der Pfälzer davongegangen.“
Sie blieben, während er grübelnd den Tag und die Nacht über mit sich rang, in seiner Nähe. Am nächsten Morgen war es heller, er zog sich sein Kettenhemd an, gab Befehl zum Aufbruch, predigte selbst seinem Leibregiment über das Matthäuswort: „Häuft auch keine Schätze an auf Erden, wo Motten und Rost zerstören, wo Diebe einbrechen und stehlen; sammelt euch aber Schätze im Himmel.“
Die Herren erfuhren von ihm, der straff zwischen ihnen ritt: „Hochmut taugt nicht. Man muß sich nicht vermessen, alle Dinge meistern zu wollen. Wir werden eine klare Linie ziehen müssen zwischen dem, was erforderlich, und dem, was überflüssig und schädlich ist. Der Friedländer wird in Kürze von uns eine Bataille zu bestehen haben, die ihm zeigen wird, auf welcher Seite Gott steht. Noch müssen wir Gott erringen und auf unsere Seite zwingen. Gedenkt auch ihr daran, wie ich daran denke. Wenn wir Gott zu uns gezogen haben, sind wir unbesiegbar.“
Auf diesem Rückmarsch nach Norden, den die Truppen mit Drohen und Murren antraten, gab es kein Ausreiten, wildes Fouragieren, Plündern. Der König war selbst Tag und Nacht unterwegs.
Nach Wolkersdorf war der Kaiser aufgebrochen zur Jagd, die Mantuanerin hatte er in der Burg zurückgelassen.
Das Sausen und Schütteln des mächtigen Herbstwindes gegen seine schmale holzgebaute Schlafkammer. Er stand, während die Kerze von dem einströmenden Luftzug flackerte und erlöschen wollte, mit nackten Füßen auf dem Teppich, an dem losen Schlafmantel zerrte er, die Mütze lag am Boden. Arbeitete mit den Armen: „Gebt Raum!“
Schnaufend, schnaufend. Glänzend vor Lachen sein Gesicht, inbrünstig stampfend seine Beine, vorwärts drängend. Mit den Ellbogen seitwärts ausschlagend, als arbeite er durch Gestrüpp. „Gebt Raum!“ Lange Zeit. Erschöpft in den Sessel sinkend, lachend.
Bei Tag kamen Eggenberg und Trautmannsdorf herüber. Sie lobten den Herzog Friedland und daß alles ein besseres Aussehen gewinne. Bei Nürnberg habe sich der Schwedenkönig gewaltig die Hörner eingerannt, laufe jetzt hinter dem Friedland her, der ihm bald den Rest geben werde.
Der Kaiser dachte: der Schwede und der Friedland, diese werfen sich jetzt übereinander; sie zerfleischen sich, dann werden sie voneinander lassen. Ruhig und freudig besprachen die beiden vor ihm, daß man hoffe, auch den Friedland in der Gewalt zu behalten.
Was war das? Bald den besiegen, bald den besiegen. Jetzt wieder den Friedland. Jeder will die Macht haben.
Der Kaiser fragte nach dem Friedland und was sie da Sonderbares besorgten.
Er hätte zuviel Gewalt an sich genommen; man müsse bei seiner Leidenschaft auf der Hut vor ihm sein.
Auch das. Auf der Hut vor dem Friedland. Wie sich die Welt rasch verändert, wenn man sie nicht dauernd im Auge behält.
Die Herren fragten sonderbar, ob die Majestät lange in Wolkersdorf zu bleiben gedenke, und ob die Majestät ihnen für dringliche Fälle Vollmacht gebe.
Sie sahen ihm etwas an? Wollten die Hunde den Erzherzog Leopold wieder hervorziehen? Wie in den wonnesamen Tagen. „Ich weiß noch nicht“, brachte Ferdinand heraus, seine Augen bedeckend. Er grollte; es war nicht entschieden in ihm. Er zitterte, wie er sich den beiden, die ihn beobachteten, gegenüber sah; sie kamen ihm wie Inquisitoren vor. Er entließ sie leise drohend und abweisend. Sah, wie sie gegangen waren, den Saal noch im Nebel. Entwich auf die Jagd.
Sie fanden auf der Rückfahrt, man müsse Lamormain gegen den Kaiser vorschicken. Der Kaiser versinke in unheimlicher Weise in sich; beide dachten, ohne es auszusprechen, an den geisteskranken Kaiser Matthias.
Wie es Abend wurde und der Mond aus dem Birkengehölz trat, stand der Kaiser mit nackten Füßen auf seinem Teppich, schnaufend, arbeitend: „Gebt Raum, gebt Raum!“ Inbrünstig lachend, stampfend; ein lakenweißes mondgetauchtes kleines Menschenwesen. Alles war wieder klar vor ihm. Er erschöpfte sich nicht. Pelzschuhe zog er sich an, einen wattierten grünen Mantel warf er um die Schultern. Träumend, gierig, fast lüstern legte er sich in das offene schmale Fenster, sah in die scharf gezackte raschelnde Blättermasse.
An ihm sauste es vorbei. Aus dem Zimmer heraus. In das Zimmer hinein. Über den Schultern, neben den Ohren. Ungeniert ging es hin und her. Sauste mit Schwung, klirrend in den strahlenden Kiesboden. Schlich warm dicht neben seinem Hals, neben seinen Armen hinaus, eine große Katze, ein langes behaartes geschwänztes Tier. Wesen, die ihn kannten. Vielerlei Wesen, die hier ihren Aufenthalt hatten, keine Notiz von seiner Anwesenheit nahmen. Er war gerade zwischen sie geraten. Schwindlig und müde machte es ihn in der ziehenden Aufgeregtheit, daß er den Kopf fallen ließ und die Augen schloß.
Die Kammer war zu ebener Erde. Er fühlte sich gedrängt, einen Sessel zu nehmen und über das Fensterbrett ins Freie zu steigen. Sie halfen ihm rechts und links steigen. Faßten ihn bei den Händen, wie er herunterstieg. Er ging ein paarmal zwischen den schwarzen Bäumen. Lief plötzlich, um es zu machen wie sie, rasch laufen, weich andrängen, sich anheben, fliegen. Sie schwirrten in Äste und Gipfel, stürzten ab, blieben klatschend liegen. Man konnte sie zertreten, sie zerflossen wie Schatten in die Erde. Dieses Anrufen, Lärmen, plötzliches Verstummen.
Ein Teufel, dessen Größe er im Dunkel nicht erkennen konnte, legte ihm die Hand auf die Schultern, fragte ihn, wo er entlang gehen wolle, sagte mit sonderbar schluchzender Stimme immer wieder: „Lieber Ferdinand, lieber Ferdinand.“ Der führte ihn riesengroß wie er war an sein Fenster zurück, hob ihn auf das Fensterbrett, so daß er herunterglitt. So groß war der Rücken des Teufels, daß das ganze Fenster schwarz war.
„Gebt Raum“, lispelte Ferdinand angezogen auf dem Bett, schlief.
„Ich muß zu einem Priester gehen“, sagte er sich, als die Hähne krähten. Und wunderte sich, daß er gar keine Angst vor Lamormain hatte. „Wenn ich einen Priester sprechen könnte. Ich muß wissen, wie es bei Gott ist.“ Tiefsinnig dachte er es, ohne sich über seine Gedanken Rechenschaft abzulegen.
Man ließ ihn an den jagdfreien Tagen ungestört sich in den Waldungen ergehen. Er ging im weißen und grünen Rock hinaus. Langsam spazierte er, versuchte an Wallenstein zu denken. Daß man die Macht über so ungeheure Tiere hatte; er wollte sie gar nicht. Er wollte nur tiefer in den Wald gehen.
Während er tiefsinnig dachte, führte man ihn rechts und links. Nicht schneller gingen sie als er, breite behagliche Tiere, eins an der rechten Hand, eins an der linken. Er ging mit.
Als er wieder zu Hause war, meldete ihm ein Bericht Questenbergs den näheren Verlauf des Nürnberger Treffens und wie der Herzog zu Friedland jetzt vorhabe, dem König den Weg zum Meere abzuschneiden, nachdem er ihm schon den Weg nach Süden abgeschnitten hatte.
„Kostbar“, sagte in sich der Kaiser.
Und plötzlich schüttelte er sich; erinnerte sich des dicken Tausendfußes, des Drachens Wallenstein; umpackten sich diese zwei da, an den weißen Hälsen, an den Knien, den glatten widrigen Bäuchen. Ihn ekelte so, daß das Wasser ihm im Schwall aus dem Mund hervorquoll.
Zaghaft schlich er vor das hohe silberne stehende Kruzifix, legte sich still und sehr langsam davor hin. Wartete, hob den Kopf, sah es an. Seufzte.
Der Kurfürst Maximilian war ohne Lärmen in das leere München eingezogen. Über die Höhe der gezahlten Kontributionen wurde ihm Bericht erstattet. Gebeugt saß er in seiner Neuen Feste. Die reichen Bauten Münchens waren ihm ein zu weites Kleid; der Herzog zu Friedland ging das Reich erobern. Ihn hatte er kujoniert. Keine Hilfe bei den geistlichen Kurfürsten; die lagen in französischen Armen. Vom Kaiser hieß es, er werde abdanken, hätte keinen Sinn mehr für das Reich. Doktor Leuker meldete vertraulich aus Wien, der König in Spanien habe ein starkes Heer für Deutschland ausgerüstet, es werde für spanisch-niederländische Zwecke dienen, aber eine Reserve bilden, die das Kaiserhaus gegen jede, jegliche Gefahr, auch vor Friedland schützen sollte. Man könnte mit Spanien zusammen gehen, von Richelieu war nichts zu erwarten. Es tröstete den hilflosen Kurfürsten, daß er sich an Richelieu rächen könnte, indem er die spanische Partei nahm.
Aber alles lag noch in weitem Felde. Man hörte, der Herzog rücke weiter nach Norden; noch ein Schlag für den Schweden wie Nürnberg, und niemand konnte an Friedland heran. Er würde die Despotie über Deutschland errichten. Maximilian fühlte, er konnte sich nicht rühren. So verlassen wie jetzt war er noch nie. Eine so schaurige Gefahr drohte ihm.
Hinter Holk kam Gallas, über Wunsiedel Hof.
Hinter Gallas der Herzog. Durch Forchheim, Bamberg, die Grafschaft Reuß, ins Land Meißen, das gebrandschatzt wurde. Auf die Saale zu. Die Flußübergänge sollten gesperrt werden.
Dem Heere liefen voraus die Boten auf dampfenden Pferden an Arnim, der in Schlesien stand, durch Sesyma Raschin an den Grafen Thurn: der Kursachse solle, solle sich von dem Schweden trennen. Es solle müsse und werde Friede gemacht werden, ob er sich sperre oder nicht. Und Johann Georg, schwer verzagt über den Landesverwüster Holk, beim Aufbruch des entsetzlichen Schwarms von Nürnberg, schlug sich die Brust, er werde Frieden machen, sonst werde es ihm gehen wie dem Pfälzer. Er werde wandern müssen mit leerem Säckel hinter dem Schweden her, der Deutsche, das Haupt der Evangelischen. Und schon hatte sein Rat ein Angebot an den Friedländer und den Römischen Kaiser ausgefertigt, als eigene Kuriere Gustafs den Kurfürsten hießen, Ruhe zu bewahren. Gustaf renne hinter dem Herzog her, er werde helfen, es geschehe nichts, er werde ihn nicht weit kommen lassen. Arnim selbst meldete Eilmärsche aus Schlesien. Wütend, alles Widerspruchs überdrüssig, erklärte Johann Georg im Kabinett: „Friede muß sein. Irgendwie. Befehlen soll mir keiner etwas. Bringt der Schwede keinen, bringt ihn der Kaiser. Wir sind alle Christenmenschen, kein Vieh, das so unsäglich leiden muß. Dies Mal noch. Ich hab’s satt.“
Quer über Sachsen warf sich krachend der Herzog, in Leipzig nahm er Quartier, auf Torgau stieß er. Bald war der Schwede da. Die Pässe bei Hildburghausen und Schleusingen hatte ihm in rasenden Kavallerievorstößen der Herzog Bernhard von Weimar offengehalten, den Thüringer Wald durchbrauste der König; er mußte zurück in die Nähe seines ersten entscheidenden Sieges über den toten von der Erde weggewälzten Tilly. Durch Arnstadt Kösen Naumburg. Verzweifeltes hilfeflehendes Volk lag geworfen auf den Straßen, an den Wegen. „Was wollen sie von mir,“ zuckte zähneknirschend der König die Achseln, „ich tue meine Pflicht, Gott muß sie erretten.“ Er gedachte wie bei Nürnberg sich erst zu verstärken, bis er angriff.
Als aber Friedland seinen General Pappenheim ausschickte, um Hans von Arnim, der sich ausgeschwiegen hatte, schon auf dem Marsche zurückzuschlagen, hielt der Schwede, von feierlicher Sicherheit durchströmt, seinen Augenblick für gekommen. Er wollte nicht warten, bis der Winter hereinbrach, er hatte keine Zeit bis zum Frühling: „Der Friedländer ist in meine Hand gegeben“, fühlte er, als er von dem Abritt Pappenheims auf Halle hörte.
Um ihn wimmelte es von Menschen, den Männern aus Smaland, Ost- und Westgotland, den Leuten Horns, Baners, Totts, Stallhanskes, Klitzings, Lösers, Bernhards; sie werden zermalmt sein wie ein Ameisenhaufen von einem Fußtritt, sah er, wenn sie nicht siegen. Sie haben den rechten Glauben; Schweden, ganz Schweden hat seine Habe hierhergegeben, sie werden nicht unterliegen. Während er besessen die Augen schloß, dachte ihm dies.
„Wir werden siegen,“ beschloß er. Er ritt befehlend in den nebligen Herbstabend. „Sie werden keinen besseren Markt haben als der Tilly bei Breitenfeld.“ Inbrünstig ging er das Werk schmieden.
Widerwillig kam der Friedländer. In seinem Hauptquartier war, wie sie den rachedürstigen Schweden nahen sahen, die Parole ausgegeben: nicht siegen, den Widersacher schwächen, schrecken, gedeckter Abmarsch, sobald die eigenen Verluste stark werden. Nach Pappenheim rief man: der Herr solle alles stehen und liegen lassen und herwärts jagen. Um die Steigbügel des Pferdes Wallensteins, der reiten wollte, wurden Seidenbäusche gewickelt.
Regimenter der Schweden: Karberg, Herzog Bernhard, Wrangel, Dieshauen, Kourville, Stechnitz, Stenbach, Brandenstein, Anhalt, Löwenstein, Hofkirch. Dann Ußlar, der hessische Landgraf, Burlacher, Goldstein, Wolf von Weimar, das gelbe Leibregiment, das blaue Regiment unter Wrangel, Generalmajor Graf Brahe.
Regimenter der Deutschen: Savelli, Gallas, Holk, achtundzwanzig Schwadronen Ungarn und Kroaten mit Isolani, vierundzwanzig Schwadronen Kürassiere mit Oktavio Pikkolomini, Strozzi, Gonzaga, Koronino.
Vom nebligen Herbstmorgen bis zum Abend acht Stunden zerhieben sich die Heere zwischen dem dünnen Mühlgraben und Floßgraben bei Markranstädt und Lützen; der Galgenberg buckelte dazwischen mit vierzehn Riesenhaubitzen Wallensteins. Am Abend und in der Nacht standen die beiden Heere noch auf dem Feld und rissen aneinander.
Tot war Gustaf Adolf und Tausende aus allen Regimentern der Schweden und der Kaiserlichen.
Den Grafen Pappenheim donnerte eine Drahtkugel in den Tod.
Unbekümmert um die Nachrede schnurrte der Herzog davon, nach Leipzig zurück, aus Sachsen heraus.
Die Schweden tasteten ihm auf dem Schlachtfeld nach. Vor Schwäche konnten sie sich nicht rühren. Tage vergingen. Sie lagen in Angst. Kroaten, die Kanonen rauben wollten, verscheuchten sie. Was um Gustaf gewesen war, schwur sich nicht zerreißen zu lassen. Oxenstirn nahm die Zügel in die Hand. Die Armee sollte Bernhard von Weimar führen. Der Winter sollte sie nicht verderben, sie wollten sich keine Furcht anmerken lassen.
In das winterliche Prag zog Wallenstein ein, hielt Gericht. Geschenke bis fünfundachtzigtausend Gulden fielen über den Grafen Merode, den Marquis de Grana, das Komargische Regiment, Brenners.
Vor dem Rathaus in Prag, auf der mit schwarzem Tuch behangenen Bühne, wurden hingerichtet elf Offiziere aus den vornehmsten Familien, die meisten vom Regiment Sparr. Eine Anzahl wurde an einen neuen Galgen gehängt, einigen der Degen unter dem Galgen zerbrochen, sie selbst für Schelme erklärt, die Namen von vierzig flüchtigen Offizieren an den Galgen geschlagen.
Die Finnen, das braune Rattengewimmel Tillys, Reiter des Stalhanske, fanden den schwerleibigen Gustaf Adolf, das abgelebte breitgequetschte Gesicht an die Erde angedrückt. Vierhundert smalandische Reiter, den Palasch gezogen, der Rest des Regimentes, an dessen Spitze er gefallen war, eskortierten ihn über Weißenfels nach Wittenberg, nach Wolgast, wo die Totenfeierlichkeiten erfolgten an dem Meere, über das er gefahren war mit Koggen Gallionen Korvetten, das Admiralsschiff Merkur mit zweiunddreißig Kanonen, dahinter Westerwick, Pelikan, Apoll, Andromeda, Regenbogen, Storch, Delphin, Papagei, Schwarzer Hund.
Hier am salzigen ruhelosen Meer, unter dem Tosen der Winterstürme, hatte sich eine stumme Gesellschaft aus Metall Holz Tuchen versammelt, um den verwesenden ausgeweideten Leib zu erwarten: hohe silberne Gueridans, florumwickelte Wachskerzen, ein Trauergerüst in der Kirche, der Katafalk, das Schmerzenspult. Lebende Menschen und Tiere wogten um die bewußtlosen Gegenstände, den bei Lützen vor Monaten zuletzt fühlenden Leib, der jetzt nicht mehr war als die Gegenstände, die für ihn geschnitzt, genäht, geschmiedet wurden. In einen Zypressensarg war die verhüllte triefende Zentnermasse von Fleisch und Knochen geschoben, auf einen samtbeschlagenen Leichenwagen gestellt. Den bloßen Degen unter dem Arm gingen die Leibgardisten voran, das Bataillenpferd folgte, die Blutfahne, Hoffouriere, Marschälle, Trabanten mit verkehrten Gewehren, Herolde, Pauker, das Wappen. Die Zipfel der Sargdecke trugen Offiziere Kavaliere in stumpfen Tüchern, ohne Handschuh neben dem schleppenden Wagen, Trabanten mit umgekehrten umflorten Partisanen. Hinter dem Wagen Marschälle mit Stäben, Minister, Hofkavaliere, Beamte, geführte schleierübergossene Frauen, deren Schleppen man trug. Die Königin, grau und weiß gekleidet.
Ihr war noch kein Sarg gezimmert wie dem toten Gemahl. Mit Entsetzen ging sie in dem Zug. In einem Zypressensarg vorn unter einer schwarzen Samtdecke, an der Offiziere zerrten, lag eine gedunsene dicke Masse, zerfließend, die ein blauschwarzes Gesicht hatte, an der Arme und Beine hingen, etwas das an Fleisch erinnerte und das Gustaf Adolf, der starke singende jähzornige Mann, der Vater ihrer springenden kleinen Tochter, sein sollte. Es ekelte, graute sie; sie konnte nicht entrinnen, man führte sie; eine Brechneigung stieg in ihr auf; sie wurde hier vergewaltigt; blind taumelte sie am Arme ihrer Hofdamen, Zittern in den Beinmuskeln.
In das dunkle hochgeweitete Kirchenschiff hinein. Trompeter bliesen vorn: „Mit Fried’ und Freud’ ich fahr’ dahin.“
Hinter dem kostbaren Trauergerüst riesengroß in sich bäumender Bewegung ein metallener Schmerzensmann am Kreuz; angenagelte Hände und Füße, Stöhnen aus dem offenen Mund, Blutrinnsale vor den Ohren, keuchend zusammengepreßte Rippen, muldenhaft eingezogener Leib.
Gebrüll der Kanonen.
Wallenstein ging nicht aus Böhmen. Die Bitten, die der Wiener Geheime Rat aussprach, schon als er auf dem Marsch über Leipzig war, nicht nach Böhmen zu kommen, die Lande des Kaisers zu schonen, waren erfolglos geblieben. Es erfolgte keine Antwort, bis das ganze Heer sich über Böhmen ausgebreitet hatte, und dann eine ungenügende: es sei hier am sichersten, man könne am besten den Feind beobachten, sich selbst am raschesten wiederherstellen. Das Reich bot bessere Kreise zu Quartieren als das Erbland Böhmen; aber der Herzog lehnte Verhandlungen ab. Er dehnte sogar die Quartiere über Mähren aus. Niemand in Wien hatte etwas anderes erwartet; man erschrak doch, als es eintrat. Der Herzog war so logisch wie ein Verhängnis geworden. Er wollte auf die rascheste Weise den Kaiser unter die Sohlen nehmen. Die Einnahmen des Kaisers, seine einzigen aus den Erblanden wollte er zum Schrumpfen bringen, aus der schweren Verschuldung eine förmliche Armut machen. Der grausame Wucherer und Geldeintreiber stand über ihnen.
Bittreisen nach Prag und Gitschin traten der Abt von Kremsmünster, Breuner und dann persönlich Trautmannsdorf im Winter an. Trautmannsdorf war der Gast des Feldhauptmanns in der heiligen Zeit der zwölf Nächte; sie hatten gemeinsam Spaß an den ländlichen Gewohnheiten. Die Kinder liefen mit geschwärzten Gesichtern vor die Häuser, holten sich Gebratenes. Ernsthaft stiegen Männer von Baum zu Baum auf den Chausseen, umwickelten sie mit Stroh, um sie vor dem Bösen zu bewahren. Trautmannsdorf horchte an dem Herzog wie an einem interessanten Naturgegenstand herum, unternahm es dann, ihn zu verlocken, ihm gütlich zuzusprechen, damit doch diese sonderbare große Erscheinung Wien nicht verloren ginge. Es sei unendlich schade, sagte er offen, daß sie nicht Freunde sein könnten; es seien Fehler vorgekommen, Mißverständnisse; man könnte erwägen, die Dinge zurückzubiegen und auf ein vernünftiges Geleis zu kommen. Er redete sich, klug phantastisch wie er war, in eine Wärme hinein, die beinah herzlich war, aber leicht in eine respektvoll beobachtende Entfernung zurückging. Er sah darauf nichts am Herzog; es schien ihm nur, als ob er den Friedland reize; sie sahen sich tagelang nicht; bei neuen Begegnungen war der Herzog wie er immer war — höflich, falsch, zu Drohungen geneigt, undurchdringlich. An der Maßnahme der Belegung Böhmens und Mährens wurde nichts geändert. Der Böhme hielt fest, es sei nach den Abmachungen sein Recht, sich in die Erblande zurückzuziehen. Trautmannsdorf erkannte, daß also Wallenstein schon früher diesen Plan gehabt hatte, staunte den Böhmen an.
Da er angeblich für neue Rüstungen nicht flüssig sei, verlangte der Friedländer die rasche Eintreibung bestimmter Beträge durch den Reichshofrat. Bevor sich Abt Anton zu dieser schlimmen Maßregel entschloß, wandte er sich an den spanischen Botschafter, was man antworten solle nach Prag. Der erklärte sehr geheim, man sei in Madrid gewiß geneigt und habe es den drängenden Herren Eggenberg und Trautmannsdorf versprochen, den Kaiser gegen etwaige friedländische Übergriffe zu schützen, aber bisher sei doch die Lage nicht dringend; unbotmäßig sei der Herzog nicht; man wolle einmal sehen, wie er sich gegen das spanische Heer für die Niederlande verhalten werde, das bald aus Mailand heranrücken werde.
Seufzend sah der kleine Abt, daß Spanien wieder nur seine Interessen vertrat; die Beträge mußten eingetrieben werden. Schatz- und Säckelmeister bekamen Befehl, die Auflagen an den Friedländer zu zahlen. Nieder- und Oberösterreich mußten steuern in einer nicht gekannten Weise: Karossen- und Kutschensteuern wurden eingeführt, Schlittensteuern; jeder Eimer Ungarwein schlug für den Kaiser mit fünfzehn Kreuzer auf, Bankiers und Juden entrichteten eine zweiprozentige Vermögensabgabe, fünf Gulden hatten in allen Erblanden zu zahlen Baumeister, Organisten, Schulmeister, Musikanten, Spielleute, Meßner, Rauchfangkehrer; zweiundfünfzigtausend Gulden monatliche Kontribution die Bauernschaft in Oberösterreich. Und wie man nicht wußte, woher noch mehr nehmen, als die Beträge für den kaiserlichen Hofstaat und die herzoglichen Ansprüche nicht reichten, kam aus Gitschin die höhnische Anregung: Vermögenskonfiskationen aus religiösen Gründen vorzunehmen. Anton und andere Herren rebellierten; nur die Jesuiten bissen, wie sie es hörten, scharf an. „Wie hat sich der Herzog geändert,“ lachten sie heftig, „wie hat er sich gesträubt bei der Restitution der kirchlichen Güter.“ Die Kalamität in einigen Hofämtern wurde unmittelbar dringend; man ließ sich stoßen.
Ein kaiserliches Patent im Beginn des neuen Jahres bestimmte für das Herzogtum Österreich unter der Enns, daß jede adlige Person, die nicht der heiligen römischkatholischen alleinseligmachenden Religion zugetan sei, binnen vierzehn Tagen bei Verlust ihrer adligen Freiheiten, bei Vermeidung kaiserlicher höchster Ungnade, Leib- und Geldstrafe sich in Person durch den Hofkammer-Türhüter anmelden lassen solle. Wer sich nicht bequemte, wurde verwiesen, oder hatte einen Revers zu unterschreiben, in Kürze das Land zu verlassen; von seinem Vermögen fiel ein Teil an den Kaiser. Nichtkatholische fremde Kaufleute wurden ohne weiteres Landes verwiesen unter Konfiskation ihrer Handelsware und eines beliebigen Teils ihres Geldbesitzes.
Den meisten Räten wurde flau bei der Maßnahme; vor den Berechnungen der Finanzleute wichen sie zurück. Nur einige am Hofe wußten, daß man schon in Verhandlungen stand mit reichen Männern, getrieben von Wallenstein, um Städte zu verkaufen, in Ungarn und anderswo, die sich unter kaiserlichen Schutz gestellt hatten, kaiserliche Schutzstädte, ein tiefbeschämendes Vorhaben, vor dem man immer wieder zurückzuckte.
Aus Nürnberg war von dem Schweden der Mann abgewichen, den er „Majestät“ „Königliche Würde von Böhmen“ nannte, der Pfälzer Friedrich. War gegangen, weil es ihn nicht reizte, noch mehr von der schwedischen Herrschaft zu sehen. Mit der englischen Elisabeth reiste er gemächlich auf Frankfurt.
Seltener wurden die schwedischen Streifkorps; er wurde ruhiger, gewann es manchmal über sich, seine Frau anzublicken. Die klagte viel, daß man den Schweden verlassen habe und welche Irrwege Friedrich jetzt gehen wolle, wo er nicht mehr jung war. Sie fuhren durch die traurige Herbstlandschaft in den offenen Karossen; Friedrich lag nach rückwärts über die Ohren in Pelze gehüllt; sie blickte aufrecht sitzend rechts und links, machte ein schnippisches enttäuschtes Gesicht, gähnte viel, klopfte mit den Füßen. „In Frankfurt wird es besser sein“, lächelte Friedrich.
Und sie war auch beruhigt, als in dem schönen Quartier, das die reiche freie Stadt ihnen zur Verfügung stellte, ihr alter Freund, der galante graubärtige Ludwig Kamerarius, der lange in Hamburg und Stockholm gewohnt hatte, vorsprach. Er hatte wohl einen dringenden Auftrag schwedischerseits, sich des Pfälzers zu versichern und dafür Sorge zu tragen, daß er der schwedischen Sache nicht abtrünnig werde. Ein lächelnder spöttischer Herr, klug und überall interessiert, liebevoll, bewegte er sich um seine pfälzische Herrschaft, zeigte ihnen frankfurtische Kuriosa, kaufte Pferde für die Dame, trieb von unbekannter Seite für sie Gelder auf, sorgte für Pracht im Quartier, arrangierte Unterhaltungen für die Damen des Gefolges. Inzwischen bewachte er mit dem kleinen entschlossenen Rusdorf die Korrespondenz des Pfälzer Kurfürsten, besonders als es schien, daß Friedrich, ohne ein Wort davon zu verlautbaren, an mehrere Verwandte schrieb, denen er lange nicht geschrieben hatte, Männer, die mit dem Kaiserhof in einiger Verbindung standen.
Rusdorf war außer sich: „Die schwedische Majestät ist daran schuld. Der Kurfürst war dem König in allen Dingen freundwillig. Da hat der König den Bogen überspannt. Der Kurfürst verdenkt dem Schweden nicht, daß er sich einige Genugtuung für seine Auslagen und Opfer im Reiche verschafft, aber es scheint um mehr als bloße Genugtuung und Kostenersatz zu gehen.“ „Wie könnt Ihr das sagen“, Kamerarius lächelte zurückhaltend. „Zunächst wird ja gefochten und der Friedenskongreß ist noch in weitem Felde.“ „Und er wird uns niemals beschert sein, wenn der Eigennutz und die Selbstsucht in so gräßlicher Weise triumphiert. Die sächsische Durchlaucht hat längst gerochen, worauf der Schwede hinauswill: uns deutsche Protestanten unter seinen Hut zu bringen. Und das will unser gnädiger Herr nicht. Und sagt selbst, Kamerarius, hat er nicht recht.“ „Der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Es kommt alles in ein Gleichgewicht. Man soll nicht das Gute aufgeben um das Bessere zu suchen.“
Rusdorf trat dicht an Kamerarius, der an seinem Stuhl stand und sich den grauen Bart strich, flüsterte erregt: „Ich habe nicht weniger Geld von Schweden bekommen als Ihr. Gewiß. Ihr braucht nicht staunen. Ich weiß, daß er Euch zahlt. Mich zahlt er längst. Viel behalte ich nicht. Ich wäre ein reicher Mann, wenn ich alles hätte, was unser gnädiger Herr mir schuldig ist. Ich nehme es für nichts weiter an. Ich weiß ja auch, daß Ihr daran denkt, wenn Ihr schwedisches Geld empfangt; es ist unser Herr und wir sind nicht so unglücklich wie er. Aber Ihr übertreibt: Ihr habt darum nicht nötig, so dem Schweden zu dienen. Was wir nicht verhindern können, können wir nicht verhindern. Sucht der Kurfürst Anschluß an den Kaiser und ist der Kaiser gnädig: mit Gott! Wir haben genug geduldet; Ihr seid grau wie ich geworden.“ Kopfschüttelnd schritt der andere durch das Zimmer, untersuchte, ob die Türe fest geschlossen war: „Schon gut. Wir sind einer Meinung. Er wird den Anschluß nicht finden.“ Die Fäuste ballend Rusdorf: „Und ist dies richtig, was der Schwede in Nürnberg erklärte als sein erstes und letztes Wort?“ „Was ist das?“ „Wieviel er vom kurpfälzischen Besitz am Rhein erhalten wird?“ „Nun?“ Er bedrängte den anderen, bis der den Mund auftat: „Wir werden nicht mehr hergeben als wir müssen. — Vielleicht ist es nicht so töricht, wenn wir unserem Herrn eine kleine Korrespondenz mit dem Kaiser gestatten. Und davon etwas verlauten lassen.“ Sprühend Rusdorf: „Wir sind in Wucherhänden beim Schweden.“ „Seid nicht so laut.“ „Es ist Zeit laut zu werden. Er ist nicht besser als die britischen Herren, die uns kujoniert haben, mich und Pavel.“ Kamerarius drückte ihm die Hand: „Einigkeit, Rusdorf.“
Aber kaum schrieb der Kurfürst, kaum öffnete er einen Brief. Er freute sich der Stadt, trank viel, war herzlich mit seiner Frau Elisabeth. Dann erlag das pfälzische Quartier der Nachricht vom Tode Gustafs in Sachsen. Im Augenblick fiel alles in Zuckungen: ratlos schweifte man umeinander. Die Kurfürstin drängte, weiter zu reisen, nach dem Haag, verlangte fort nach England, schmähte das Reich.
Da begann Friedrich lebhafter die Wiener Korrespondenz aufzunehmen. Ungestört festierte er in seinem Quartier, die Engländerin betäubte ihre Erregtheit in heftigen Vergnügungen, pompösen Reitereien, Schlittenfahrten und Späßen, die sie zum Getuschel der Stadt machten.
Gegen Weihnachten wollte eines Abends Friedrich seinen Trinkkumpanen in einem sonderbar heftigen Drange seine Ansicht über den toten Gustaf, über die Kriegsdinge und allerlei sonst sagen. Es kam aber niemand, sie waren zu Festlichkeiten in der Stadt verstreut. Er saß allein mit seinem Narren, der auf dem Stühlchen bald einschlief. „Ich habe so heftig und herzlich ihnen allerlei zu sagen“, dachte Friedrich; er wußte nicht, was; alles nahm solchen guten Verlauf, er kam zum Reich zurück; er hatte ein großes Ungestüm in sich.
Wie dann der nächste Morgen graute, setzte er sich in den ungeheuren Saal, in dem Becher Hüte Degen herumlagen, zog eine Kanne an sich, fing zu trinken an. Die anderen würden schon kommen, er würde auf sie warten. Er trank. Auf einem Thronsessel saß er, den er sich in einen Winkel geschoben hatte. In die Ecke geduckt saß er.
Die Sonne schien hell, als Elisabeth hinten die Tür öffnete. Die kurze Nase von Kälte gerötet, die schwarze hohe Pelzmütze über die Ohren gezogen, blonde Stirnlöckchen zwischen die Augen fliegend. Sie stolperte über einen schlafenden Lakaien; drei Tabourets standen auf dem Kopf; die Matten auf dem Parkett waren zu Türmen verschoben. Das perlenbezogene silbergraue Seidenkleid mit beiden Händen anhebend strich sie zu dem Thronsessel herüber, an dessen Außenseite eine Hand baumelte. Sein Gesicht — sie hatte ihn seit Tagen nicht gesehen — blickte sie ernst und klar an, so daß ihr Herz freudenvoll erbebte. Sie zog ihre weißen Handschuhe aus, wischte ihm das weinbespritzte Haar ab, wischte ihm den fetten schweißbestandenen Hals unter der zerknickten spanischen Krause, und faßte ihn, wie er sie nur stumm ernst anblickte, am Kinn, um ihn auf den Mund zu küssen. Sein Nacken war weich und schwer, der Kopf wich an der Rückwand des Sessels leicht links ab. Vornübergebeugt zu ihm, die pelzbezogene Wange an seinem Gesicht, rief sie nach rückwärts: „Tischwart, Schenk, Wein.“ Da wehrte es ab: „Nicht, nicht“, aus dem Munde vor ihr, aus dem Körper vor ihr. Der Körper hob sich wenig, sie abdrängend, auf die Füße. Er strahlte sie innig, armhebend an, blieb starr mit dem Blick auf sie. Sein Mund ging auf, er schien lachen zu wollen oder zu weinen oder trübselig zu klagen. Die Nase, die Oberlippe hob sich in einem Weh. Er plumpte schwer zurück. Sein Hals, sein Kopf lief rotblau an, schwoll unter leisen, dann heftigen Zuckungen der Wangenmuskeln, rollte, während sich die blauen Augen trübten, von der rechten Schulter auf die Brust. Die Beine standen eingeknickt unter dem Sessel, der Körper schien herabrutschen zu wollen. Lautes Schnarchen, der linke Arm griff abwärts in die Luft neben einem Sesselbein. Die Fürstin schrie angstvoll mit zusammengebissenen Zähnen auf. Dann torkelte der Kopf mit einem brüsken Stoß wieder auf die Schulter, die Wange zuckte noch, die weißlichen Augen stellten sich blicklos in eine Ecke, der ganze Körper wiegte sich leicht in einigen Wellen.
Sie stand da, ging nicht weg, biß sich auf die Finger, watete langsam durch den Saal zurück, immer mit gedankenlos bebenden Bewegungen der Arme, erst an der Türe sich umdrehend, als es hinten dröhnte und polterte und der Mann in der Ecke kopfaufschlagend auf das Parkett rutschte. Sie ging ohne zu sehen über den Hof, indem sie sich den Nasenrücken rieb, den Schnee von ihrer Schleppe schüttelte. Bei jedem vierten fünften Schritt blickte sie rückwärts, an sich herunter, schüttelte die Schleppe.
Ein Roßbube sah sie vom Stall aus gehen, pfiff zwei aus dem Fenster schauenden Damen, wie stirnrunzelnd auf die langsam wandernde Frau. Die zitternden weißen Damen legten die Hände an ihre fortzuckenden Arme. Sie schrie auf, knirschte mit den Zähnen, stürzte wälzte sich nach einigem Stöhnen in sie hinein.
In Wien wuchs nach dem Tode Gustafs und des Pfälzers die kriegerische Stimmung. Nicht einmal die Wissenden an der Spitze taten ihr Einhalt. Die Waffenerfolge der kaiserlichen Armada schollen durch Europa.
Der Heilige Vater in Rom, der eben Wien kalt abgewiesen hatte, hatte es fast zu einem Bruch auch mit Spanien kommen lassen, als ihn der brutale spanische Gesandte Borgia, der Kardinal, unverblümt im Konsistorium der Herzlosigkeit und Saumseligkeit gegen katholische Interessen zieh. Urban, der große buschbärtige Kriegsmann, wußte, daß das Schlachtenglück wechseln könne. Hielt, den Kardinal aus Rom verjagend, mit einem letzten Entschluß an. Nun kirrte den Goten dieser andere Barbar, der Friedländer, der Mantua hatte verwüsten lassen; es schien fast, als ob er der Lage in Deutschland Herr werden würde. Ein Breve Urbans traf in Wien ein, der Nuntius las in der Burg dem Kaiser Ferdinand und seinem stolzen feierlichen Hofe vor, was der Papst unter dem Fischerringe im zehnten Jahre seines Pontifikats verkündete; welche Wohltat allen verliehen sei durch den Tod Gustafs. Dem Sitz Seiner Heiligkeit hätten sich die Klagen und der Jammer seiner Söhne genähert und wären seinem Gemüt zu beständiger Trauer vorgeschwebt. Der ganze christliche Erdkreis empfände Genugtuung, der mit Schrecken vernommen habe, daß ein König als Feind des katholischen Namens, trotzend auf seine Waffenmacht und seine Siege, von den Ufern des baltischen Meeres bis zum Fuß der Alpen alles mit Feuer und Schwert verwüstend sich rühmen durfte, den ganzen Landstrich mit höchster Schnelligkeit unterworfen zu haben. „Darum haben wir in der Kirche der allerseligsten Jungfrau Maria dell’ Anima der deutschen Nation mit hoher Freude das heilige Meßopfer dargebracht und zugleich mit unseren geliebten Söhnen, den Kardinälen der heiligen Kirche, und dem stark zugeströmten römischen Volke für die große Wohltat Gott unseren Dank dargebracht.“
Ferdinand, freundlich still auf seiner purpurbezogenen Bank dem kloßigen Redner zuhörend, küßte ihm aufstehend die behaarte Hand. Schweigend, als wenn er sich besinne, sanft stand er eine kleine Weile vor dem verbindlich wartenden Mann, um langsam von sich zu geben: „Lasset uns in Demut voranschreiten und in Ergebung Gott die Sachen befehlen.“
Hinter ihm Siegeslärm. Mit Unruhe bemerkte der Nuntius, der eine klägliche Rolle spielte, welche Wellen die Erregung schlug; er sah sich genötigt, abzureisen. Die Väter vom Orden Jesu verlangten, wo sie sich am Hofe sehen ließen, Krieg bis zur Vernichtung des schwedischen Heeres. Die traurigen Meldungen aus Bayern hatten sie in äußersten Zorn gebracht; sie ließen an allen Stellen, die ihnen zugänglich waren, beim Beichtvater des Kaisers, der Kaiserin, des ungarischen Königspaares, bei den anwesenden Herren des Zivilstaates, besonders beim Grafen Schlick, dem Präsidenten des Hofkriegsrats, erklären, daß in allen eroberten Gebieten als Schadenersatz die höchsten erträglichen Kontributionen eingetrieben werden müßten; jeder protestantische Besitz dort müsse der Konfiskation verfallen. Des Herzogs von Friedland, der die religiösen Vermögenskonfiskationen angeraten hatte, fühlten sie sich gar nicht sicher. Sie gedachten jetzt ihn mit Gewalt zu sich zu zwingen und ihre Position auszunützen. Bei Regensburg hatte er ihre Macht gefühlt; er sollte nicht glauben, jetzt seiner unberechenbaren Laune und bloß militärischen Politik folgen zu dürfen. Die Herren am Kolleg formierten eine Spezialdeputation aus sich, bestehend aus dem Provinzial, einigen Rektoren und Präfekten, die in einer Schrift niederlegten, wie der Krieg zum Ruhme der katholischen heiligen Kirche zu einer Entscheidung geführt werden müsse, wobei weder Gut noch Blut eine Rolle spielen dürfe. Wie ihre Beteiligung und Eingreifen nicht in solchem Augenblick als anmaßlich gelten könne, besonders wenn man mit Azorius, Kornelius a Lapide, Santarelli der Auffassung sei, daß die Menschheit ein übernatürliches Ziel habe und die Geistlichen Vertreter des höchsten Erdenkönigs, des Papstes, seien. Sie sprächen aus dem Sinne ihres Generals. Und wenn dies, was sie erwähnt hätten über die Beendigung des Krieges, schon sicher sei, so noch mehr, was die sächsischen Punkte anlange. Und nun folgte ein zornsprühender Erguß über den Herzog von Friedlands Liebden Verhandlungen mit dem Kursachsen, einem Häuptling und der Stütze der Ketzer im Reich neben dem von Gott und der Jungfrau weggerafften und in das Höllenpech verstoßenen schwedischen König.
Aus Residenzhäusern Bursen Kollegien quollen die gelehrten Streiter, scharfe Gesichter, breite langsame Menschen, heiße Augen, strenger Blick, entschlossene Münder. Lange schwarze Kleider, offenes Obergewand, sehr weite Ärmel, Unterkleider talarartig mit offenen Überröcken, flachrandige Krempenhüte, Krempen mit Schnüren rechts und links hochgebogen, schwarze viereckige Mützen. In die große Aula des Profoßhauses flossen sie ein; von weißem Stuck war sie ausgekleidet, phantastische Heiligensonnen waren in üppigen Farben auf den meterbreiten Wandbildern gemalt, Maria stand überlebensgroß mit goldenem Gesicht, weißen Seidenkleidern, schmucküberladen, unter einer rubinbesetzten Krone auf einer getigerten Marmorsäule hinter dem Katheder an der Wand. Sie sangen ein Lied zum Preis Marias, als sie sich nebeneinander barhäuptig auf die knarrenden Bänke gesetzt hatten.
Der schwammige Beichtvater der Königin von Ungarn sprach: Wohin Jesuiten kämen im Reich, sollten sie auf die Gefahren hinweisen, vor Fürsten und Untertanen, in denen das Reich schwebe. Die höchste Gewalt, hatte der große Mariane erklärt, liege beim Volk, das einen rechten Gebrauch von seiner Einsicht machen müsse. Führer und Herrscher könnten so irren wie jeder Mensch und ebenso in Sünde verfallen. Die Armeen sind nicht zum Dienst der Herrscher und Heerführer, sondern des ganzen Volkes. Nur dann darf sich der Heerführer ihrer ungestört bedienen, wenn er des Vertrauens des Volkes sicher sein kann. Wenn er aber gegen den Willen und das Glück des Volkes handelt, muß sich das Volk und ebenso das Heer von ihm abwenden und ein Fluch über ihn ausgesprochen werden. Ein doppeltes Gesicht, wie der heidnische Götze Janus, habe der kaiserliche Oberste Generalfeldhauptmann von Wallenstein, der Herzog zu Friedland; eins blicke liebreich der Heiligen Kirche und ihren geweihten Söhnen in die Augen, die Hände verschwenden Gaben an sie wie wenige Fürsten. Das andere Gesicht aber ließe Hauer aus dem Maul herabstoßen, blicke und grinse gierig und gehässig; die Hände dieser Seite ringen mit denen der anderen, und wem hier ein Scheffel Korn geschenkt sei, rauben diese wütigen eisernen Arme zwei drei. Dieser liebreiche Mund spricht das Ave und den Rosenkranz, dieser Kopf senkt sich fromm bei der beseligenden Darbringung des Opfers — jenes grimmige Maul hat nur Freude an dem Trübsinn der Ketzer, lobt ihre bösen Begierden und Ansprüche, und der Kopf ist von Anschlägen auf die Freiheit und Macht der süßen katholischen Kirche voll. Solch Mensch sei er, entstanden auf böhmischem Boden, mit Sorgen hätte man ihn dem falschen Glauben entrissen, aber nicht entschlossen genug das widrige Unkraut mit der Harke gejätet. Der zum Schmerz aller Frommen mit dem sächsischen Kurhut bedeckte trunkene Ketzer, Johann Georg benannt, glaubt Anspruch auf Güter und Gebiete zu haben, die er und seine Vorfahren der katholischen Kirche in ihrer einstigen Schwäche gestohlen haben. „O, grenzenlos war der Schmerz, als uns diese Stifter, Klöster und Güter geraubt wurden, viele verzagten an dem Glück unseres Schiffleins. Grenzenlos ist unser Frohlocken, wo uns unsere Habe wieder zufallen soll auf den Spruch eines weisen gerechten frommen herrlichen Kaisers. Aber der doppelgesichtige Mann hat unser Verderben vor. Er will sich mit dem Ketzer in Dresden über den Raub verständigen und sich mit seinem eigenen Gewinn rechtzeitig aus dem Krieg schleichen. Ihm liegt nicht an Sieg und Niederlage. Wir hören es von allen Seiten. Ja er will Frieden, und wenn der Friede auch die Ohnmacht und Schmach unserer heiligen Kirche besiegeln soll.“
Darauf sangen sie ein lateinisches Lied, indem sie aufstanden. Sie sprachen in Gruppen. Der große hinkende Luxemburger, Beichtvater der Römischen Majestät, trat während der Rede in den Saal, blieb an der Tür stehen, mischte sich horchend in die Gruppe. Er hatte ein unentschlossenes müdes Gesicht und sprach kein Wort.
Als sie sich niedergesetzt hatten, sank ihr Tuscheln vor der scharfen aufreizenden Stimme eines jungen Rektors. Wie Fanfaren fing er an: „Ecclesia militans! Ecclesia militans. Das sind die Diener der Jesusgesellschaft. Wir, wir. Ein Fähnlein hat uns unser geheiligter Stifter genannt, die Sturmkompagnie des Papstes sollen wir bilden zum Kampf gegen Heiden im Ausland und in der Christenheit. Kein Frieden! Kampf unser Ruf, bis zum Sieg des Papstes. Wir stehen dem ungeheuersten Geschick gegenüber: der gewaltige Krieger des Kaisers will uns zum Frieden zwingen. Wir sollen aufhören zu sein. Die Kirche soll verkrüppeln. Wir werden nicht aufhören zu leben, sein Reichtum soll uns nicht töten, Armut wird das Bollwerk unserer Kompagnie sein. Es sind Boten aus Sachsen zu uns gekommen, Boten aus Böhmen, die erkennen lassen, daß der Kampf auf Bestehen und Vergehen jetzt entbrennen soll; der Krieger des Kaisers hat ihn uns angesagt. Er will das Reich einigen. Wir sind katholisch und bleiben katholisch. Daran scheitert alle Einigkeit. Die Lauheit seines Religionsfriedens entlarven wir: sie deckt die Niederlage des allein seligmachenden Glaubens. Ecclesia militans! Provinzial, Professoren, Magister, Adjutoren: die Armeen des böhmischen Wallenstein marschieren gegen uns. Ich rufe auf: wollt ihr weniger sein als seine Feldzeugmeister, Wachmeister, Obersten, Hauptleute, Leutnants und Kornetts. Der Geist gegen Waffen! Die Seligkeit gegen Politik! Im Zeichen des heiligen Ignaz: wir werden des Friedländers Herr werden.“
Sie murmelten freudig, bildeten gestikulierend Gruppen, von den Bänken aufstehend. Der bayrische Doktor Leuker war in Wien, von dem jungen Kuttner begleitet. Maximilian hatte seinen jungen Gehilfen ungern gehen lassen. Der vermochte das hilflose Herumsitzen in den kaiserlichen Räumen des Münchener Palastes nicht zu ertragen, konnte die schreckliche Vereinsamung, in der sich sein Herr befand, nicht ansehen, und ohne zu bedenken, daß er seinem Herrn die einzige Fröhlichkeit der langen langen Wochen war, riß er sich los, reiste nach Wien, zu Leuker, um auf eigne Faust etwas zu unternehmen. Der Jesuitenspektakel gefiel ihm, die Väter begriffen den Augenblick, waren nicht mächtig genug. Er suchte aufzustöbern, wer Bayern helfen wollte. Wie Doktor Leuker, ratlos wie er, herumwanderte bei den Herren des engeren Konferenzrates, des Hofkriegsrates und der Kammer, fand der scharf beobachtende Resident, daß man ihn zu Klagen über den Generalissimus förmlich anregte. Als wenn man eine Genugtuung darin fand, solche Klagen zu hören. Man wollte etwas auch von ihm, als geheimen Verbündeten gegen irgend jemand. Er sah rechts und links: es ging etwas am Hof gegen den Herzog vor. Man wurde nicht deutlich.
In diesen Tagen begegneten sich in den Burgkorridoren der bayrische Resident und der böhmische Oberstlandmeister Wilhelm Slawata. Langsam schritten sie durch die Höfe in die Stadt. Der Graf zog den Bayern mit sich. Er sprach Gleichgültiges, suchte die Gesinnung des anderen zu erforschen. Sie trieben im Gedränge der inneren Stadt hin und her, umgingen mehrmals die Pestsäule am Graben, in schwere Pelze gemummt; wichen vor den Gesellen des Rumormeisters, die auf sie aufmerksam wurden, nach dem Hohen Markt, zwischen dessen Krämergeschrei sie verschwanden.
Wie die Kurfürstliche Durchlaucht zu Bayern ihre schweren Verluste verwunden habe, fragte der schöne Slawata, und was sie weiter zu tun vorhabe. Der Bayer klagte heimlich: das sei ja das Unglück; Bayern sei verbündet mit Habsburg und so sei alles glatt; aber wer könne denn verschweigen, daß dieses Bündnis zum Lachen wäre. Im Ernst: niemals sei es dem Kurfürsten Maximilian so schlimm gegangen wie in dem Feldzug des verflossenen Jahres; alle die ihn vor Nürnberg begleitet hätten, hätten darüber lamentiert. Er begann die Zahl der Kränkungen weitläufig aufzuzählen, die der Friedländer dem Kurbayern bei Zirndorf und schon vorher, von Eger her, angeboten hätte; halbtot, hätte Maximilian seinem Vater gesagt, sei er von dem rachsüchtigen Mann gequält worden. Ja, es sei ein Unglück, meinte verstohlen lächelnd der andere, in die Hände seines Feindes zu fallen, denn man könne es ja dem Friedländer nicht verdenken, wenn er den Regensburger Konvent nicht so leicht vergesse.
Indem sie über den Lobkowitzer Markt zwischen den Hühnerkörben streiften, begegnete ihnen der lustig durch den Schnee schlürfende Kuttner, der in einfacher federloser Kappe und ohne Degen ging und lachend gestand, er sei auf Diebeswegen und wolle in die Rotenturmstraße, wo es den schönsten Honigtrank in einem Methkeller gebe. Der dunkel blickende Slawata wurde zum ersten Male des rotwangigen Menschen ansichtig. Sie reichten sich die Fingerspitzen. Nach kurzem Plaudern wollte Kuttner weiter. Da schlug Slawata einen gemeinsamen Weg nach der Rotenturmstraße vor; Leuker nahm nach einigem Wandern Urlaub, da der böhmische Herr wesentlich mit dem jungen unbedeutenden Fant sprach. Der Böhme hatte sich an Kuttner verhakt. Etwas lockte ihn an dem Knaben.
Vor der Wirtshaustonne mit Meth gab der gesprächige Kuttner Schnurren von sich; wie er zuerst von dem sonderbaren Zwergenprofessor, dem Genueser Licetius, hierher geführt sei, der ihm allerlei Taschenkunststücke vorgemacht habe und so weiter. Nach Maximilian gefragt, wurde er stiller, äußerte sich dann in heftigem Schmerz; wie er den Kurfürsten verlassen habe, daß solch Unglück über den frommen klugen tiefen Mann habe hereinbrechen können. Nun säße er wieder in München; wie lange, und die Schweden seien von irgendeiner Seite wieder da; wer könne dies mit ansehen, er sei fast davongelaufen. Das nahm im dunkeln Winkel sitzend, den Pelz über den Knien, Slawata mit niedergeschlagenen Augen entgegen; mit seinen stumpfen samtnen Blicken betrachtete er gelegentlich rasch den erhitzten Jüngling. Er drängte den anderen auf den Weg, den er wollte, und als der nicht weiterfand, meinte er zweideutig vor sich lächelnd, an einem Lebküchel spielend, man sei eben so weit wie vor Jahren in Regensburg; Karthago müsse zerstört werden. Kuttner fand das fast naiv, von der Art der Jesuitenväter; unwillig fragte er, ob man nichts Konkretes zur Abhilfe wisse. Noch einmal, Karthago müsse zerstört werden. Gutmütig gab der Bayer zu, es könne auch das Haus Habsburg abgesetzt werden; was solle zunächst geschehen. — Soll also Karthago zerstört werden oder nicht? Nun ja; der Bayer lachte und trank; aber zur Sache. Darauf wollte aber der zähe sehr langsame Vornehme nicht eingehen; sie müßten sich erst über das Prinzip einig sein. Und da erst, auf diese unbeirrbare Dringlichkeit und Gewißheit, wurde Kuttner unsicher, hörte auf an seinem Becher zu ziehen, betrachtete den feinen kopfsenkenden Mann vor sich genau. Was also.
Slawata merkte den Umschwung in dem andern, blickte ihn von unten fest an; wie es nunmehr mit Karthago stände. Man kann es vielleicht zerstören; es scheint, als ob auch der bayrische Herr das wünscht. „Man kann“ und „vielleicht“ und „es scheint“, die bayrische Durchlaucht hat nichts Sehnlicheres als dies; man kann nicht, man wird, und wird müssen. Oder? „Ihr denkt, Ihr kluger junger Herr, sogar ein Oder. Dieses Oder, das etwas von einer Sintflut an sich hat. Wißt, ich denke nicht im Schlaf an dieses Oder. Mir ist es nicht von Gott verliehen, so weit zu denken.“ „So, meint Ihr, steht es.“ „Es wird ja schon von vielen begriffen; sie warten aber so lange und freuen sich so lange am Begreifen, bis es nichts mehr zum Begreifen gibt.“
Kuttner über die Tonne gebückt, tippte mit dem Zeigefinger der linken Hand eine Weile rhythmisch auf das Holz. „Weiter“, brachte er heraus. Slawata erhob sich, warf ein Silberstück auf den Schanktisch; sie trabten durch die schnell sich verdichtende Dunkelheit.
Als der Böhme allein auf sein Quartier zog, wunderte er sich über dieses plötzliche Winterabenteuer, das Sitzen in einer Methstube, den kecken eigentümlich herzlichen und kindlichen Kuttner. Wie war er plötzlich in dieses Gespräch mit dem Knaben hineingezogen worden. Er hatte etwas Schönes Süßes Lyrisches an sich; es zwang ihn hinein und jetzt schwang noch das Freudige rätselhaft Belebende davon in ihm. Als wenn er selbst junge glückliche Wege schwebte. So dachte er im dunklen Erker sitzend. Es hat beinah nichts mit dem Friedländer zu tun, dachte er in sich, sich zärtlich betrachtend; es ist für sich genug. Während sein Gesicht im Dunkeln ein Lächeln war, dachte und träumte er: ich werde den Friedländer mit dem jungen Knaben umwinden; er ist meine Waffe. Was habe ich denn für Waffen gegen den Friedländer. Ich bin auch nur eine Nachtigall, die um den Löwen fliegt. Was wird das für ein sonderbarer Tod des Löwen werden, wenn ich ihn töte. Und er freute sich an dem schönen weichen Vorgang. Und was will ich auch von dem gelben starken Löwen; was tut er mir. Wieviel fehlt dazu, daß ich ihn anbete. Aber ich bin dabei und bin im Begriff, ihn zu töten. Es ist sonderbar, die Dinge sind in dem Laufe, gerade in diesem Laufe.
Zur Fastnacht wurde im friedländischen Palast eine Maskerade abgehalten. Türken Ungarn wilde Männer Kobolde drängten sich, der Satan schlich in rotem Kostüm mit entsetzlich schlagendem Schwanz dazwischen. Bei dem Narrengericht auf einer Bühne im geheizten Treppenflur wurde gegen einen grünhaarigen Wassermann verhandelt, der sich weigerte, die Ehe unter Menschen anzuerkennen und schließlich unter Toben und Gewieher verurteilt wurde, sich mit einem schmierigen dicken Wiesel zu verheiraten. Darauf führte der ungarisch verkleidete Graf Trzka den schweren Grafen Schlick, den Präsidenten des Hofkriegsrats, der aus Wien sich eingestellt hatte, Friedland zu. Der Herzog schrecklich anzusehen, ein Produkt seiner furchtbaren Leiden und der Rastlosigkeit, bewegte sich hinter einer Palmengruppe, ausgemergelt lang und gebeugt, auf zwei Stöcken, die kurzen Haarstoppeln schneeweiß, der spitze Kinnbart grau und weiß gemischt, über blauroten Augensäcken die kleinen spielenden Augen mit peitschenden Blicken, die Nase herabgezogen auf die dicken Lippen. Die Herzogin und einige Vornehme saßen auf Polsterstühlen um einen Tisch. Der Herzog zog den Fremden neben sich.
Während sie lebhaft sprachen, trat ein wüster Mensch aus dem Saal an ihre Gruppe heran, mit langem blonden Bart, den wilden Haarwuchs bis über die Schultern. In steifen braungelben Schäften bis an die Hüften stieg er, die Muskete trug er in der Rechten, stellte sie aufstoßend vor sich wie einen Totschläger. Er hatte sich mit dem mächtigsten weißen Kragen geputzt und einen ungeheuren Federhelm aufgesetzt, eine braune Dogge zog er mit der linken Hand beim Nacken. Er griff nach einem Becher, trank ihn aus. Dann legte er unmittelbar vor dem Tisch seine Muskete in die Gabel und schickte sich trunken lachend an, einen Schuß auf den Herzog oder den Grafen zu lösen. Mit einem Fußtritt warf im Augenblick Trzka die Gabel um.
Mit dem Menschen, der grunzte lachte gluckste, tschechisch stammelte, balgte er sich eine Minute, dann krachte ausrutschend der Strolch zwischen die Palmen hin, die sich auf dem Parkett in ihren Riesenbehältern rückwärts auseinanderschoben und raschelten. Die Herzogin in ihrem weiten roten Rock, dem weißen Mühlradkragen war aufgesprungen, hatte geschrien. Masken schwankten an. In ungestümen Sprüngen riß sich mit den Partisanen schlagend die Saalwache Raum, brach durch, räumte sich immer verstärkend einen Kreis um die herzogliche Gruppe. Zwei Pikeniere schleppten den juchzenden Betrunkenen, der nach seinem Köter greifen wollte und rückwärts die Masken anlachte.
Der Herzog stand mit den Stöcken da, brüllend mit glitzernden Augen: „Vorbeigeraten! Graf Schlick, ha! Seht Ihr, vorbeigeraten.“ Der murmelte etwas. „Seht. Wer steckt dahinter. Man wollte kommen. Sie haben es nicht gekonnt. Haha.“ Friedlands wildes verzerrtes Gesicht; er schnaubte schwer, tastete sich zu einem Satz, blickte alle an. Der halbe Saal war vor ihnen gesperrt.
Schlick, der ungeheuer schwere Mann, der Kopf war ihm abwärts zwischen die Schultern gerutscht, saß da, betrübt, mit langem weißen Bart, buschigen schwarzen Augenbrauen, die sich hoch sträubten: die Arme lagen ergeben auf dem Schoß; stumpf verwittert grau saß er wie aus porösem Stein. Er brummte beruhigend, wie stark die herzogliche Leibgarde sei. Wallenstein, beide Hände auf die stehenden schweren Stöcke, noch atemknapp, bissig; man müsse sich gründlich vorsehen, im Haus nicht weniger wie im Feld; man könne nicht wissen, von welcher Seite man angegriffen würde. Ob übrigens Graf Schlick glaube, daß der schwedische König, was man sich erzähle, von seinen eigenen bestochenen Leuten erschossen sei. Der Gast nickte; vielleicht haben die Schweden oder ein Deutscher ihn beseitigt; es sei keine schlechte Kriegsmethode, den Führer zu erschlagen; das spart Kanonen. Er, knurrte Wallenstein, möge die Methode nicht; es sei doch etwas Verruchtes darin. Er schickte Trzka fort, beim Obersten der Leibgarde nachzuforschen, was man von dem Betrunkenen ermittelt habe. Noch höher hob Schlick die Schultern: ruchlos oder nicht, wer will die Mittel wählen; überall entstehe die weltliche Gewalt niedrig, durch Mord und Waffen; man wisse ja, daß die Fürsten erst mittelbar von Gottes Gnaden seien. — Was? der Herr billige solchen Mord am eigenen Herrn und Fürsten. — „Nicht doch; ich sage, solch Mord ist unvermeidlich. Bisweilen. Wenn der heilige Glaube es verlangt.“ — Wallenstein kniff aufmerksam die Augen, fixierte den versunkenen Fleischblock lange: so, so; der Herr Bruder sei Anhänger der frommen Jesuväter; das freue ihn zu hören, denn auch er hielte zu ihrer heilsamen Lehre. — Ja, kam aus dem schweren Block, die Gewalt entstehe überall niedrig; man müsse sich an das Bessere anlehnen überall, um sich zu rechtfertigen. — Abbrechend begann der trinkende Herzog, der sich ganz beruhigt hatte, auch die verlegene Isabella zum Tanzen hinausschickte, von Bernhard von Weimar zu sprechen, der nach dem dänischen Krieg beim Kaiser wieder anklopfte, ein tapferer junger Fürst, und jetzt hinge er am Oxenstirn. Es sei leicht von Verrat zu sprechen. Schlick möchte am Hof dafür sorgen, daß man Leute nicht zur Verzweiflung treibe durch starrsinniges Behaupten von Gehässigkeiten. — Was der Herr Bruder meine. — Das Aufflackern der religiösen Politik. Man müsse die Protestierenden anerkennen im Reich. Er hätte davon gehört. Man müsse nicht alte Dinge aufrühren. — Verbrechen verjähren nicht. — Damit komme man nicht vorwärts. Sie hätten einen kaiserlichen und keinen katholischen Krieg zu führen. Sollen die Jesuiten den Sack selber tragen, statt einen Esel treiben zu wollen. Und als Schlick nicht antwortete, rückte Wallenstein lippenbeißend von ihm ab: die Lügen der Federfuchser; ob Schweden nicht mehr vorhanden sei, Frankreich nicht abseits warte. — Schlick lächelte zum erstenmal: der Herr Bruder möge die Jesuiten wohl nicht recht. — Friedland kaute an seinem Schnurrbart. — Stumpf blickte der graue Mensch vor sich: jedenfalls werde, den Bernhard anlangend, ein Reichsfürst wissen, was Verrat sei.
Friedland schob, die Stöcke gegen die Tischkante fallen lassend, die Arme an seinem Säbel nach vorn: nun, auch er sei Reichsfürst. Er habe ehrlich und legitim die Gewalt vom Kaiser erhalten, vertrete, wie man ihm ja nachschreie, die Monarchie und habe in Regensburg verspürt, was die Reichsfürsten könnten. Am eigenen Leibe habe er ihre, ihre Kraft verspürt. Und so singe er mit aller Ehrerbietung auch dieses Lied: es möchte ihm keiner zu nahe treten und seine Reichsfürstenschaft für nichts achten; es sei begründet: das Reich ist nichts ohne den Kaiser, aber auch nichts ohne die Fürsten. — Als Wallenstein nach langer Pause nichts zufügte, sagte Schlick, der Herzog habe in der Tat früher anders gesprochen; er wünsche ihm, daß er sein Herzogtum Mecklenburg bald von dem Schweden erobere. — Dies oder ein anderes werde ihm durch kaiserliche Gnade zufallen; er dränge auf den Frieden, nichts, nichts sei wichtiger. Sie wollten gemeinsam daran denken, dem lieben Frieden näher zu kommen.
Die Herzogin und ihre Schwester schlüpften von Trzka geführt heran, hatten noch Gesichtsmasken vor, kicherten von den Späßen im Saal. Der Herzog griff nach einem Stock, schrie im ersten Augenblick: „Fort mit euch!“
Finster saß er nach Schlicks Abgang neben Isabella: „Sie zahlen es mir heim. Feinde, Feinde, immer mehr Feinde. Und so soll ich zum Ende kommen.“ Im Gefühl der Schwäche senkte er den Kopf, blinzelte: „Du hältst mich für böse, Isabella. Ich sehe es dir an. Ich habe Schlimmes in meinem Leben getan. Gott wird viel Gnade an mir üben müssen. Ich will meine Bosheit jetzt eine gute Zeit fahren lassen und den Frieden für die gequälte Welt befördern.“
Er ließ das Frühjahr anbrechen, den April vergehen, ohne sich aus Böhmen zu rühren. Es hieß, daß er seine Geldgeber und sich selbst bis zum letzten erschöpfte. Man wußte, daß die Börsen erzählten, so könnten die Rüstungen nicht lange fortgehen; alles dränge auf den Ruin des Reiches; der Herzog werde versuchen einen entscheidenden Schlag zu tun und dem Krieg eine entscheidende Wendung zu geben, weil er die Verhältnisse überblicke und weil besonders das Haus Habsburg vor dem nahen Bankerott stehe; er werde sich dann mit seiner gebietenden Macht als Reichsfürst und finanzielles Oberhaupt des Kontinents zurückziehen, so oder so. Dies war bekannt von ihm wie von seinen Freunden Michna und de Witte und den hinter ihnen stehenden mächtigen Geldhäusern, die gedachten dem Krieg den Faden abzuschneiden durch Verweigerung der Kredite. Der Druck, den diese Finanzleute mit den befreundeten Börsen ausübten, sollte die Friedensneigung zum Durchbruch bringen; in ungeheurer Spannung sahen die Informierten den Dingen des Jahres entgegen; es hieß allgemein, die Würfel würden fallen. Und die Spannung wuchs um so mehr, als die Jesuitenpartei am Hofe ihren Einfluß täglich vermehrte, mit ihrem Drang dem alleinseligmachenden Glauben zum Sieg zu verhelfen, und der Abneigung gegen Kompromisse. In Hamburg und London sagte man sich: es wird dem Herzog zu Friedland nichts nutzen zu siegen, er wird sich mit dem kaiserlichen Hofe auseinandersetzen müssen — oder der Hof wird es mit ihm tun; das Jahr wird die Absetzung des Herzogs oder den Frieden bringen.
Einflußreiche Männer und Bürgerschaften großer Städte suchten sich der verhängnisvollen Entwicklung entgegenzuwerfen. Fromme katholische Männer Mitteldeutschlands, Bischöfe traten miteinander in Korrespondenz, faßten den verwegenen Plan, dem Jesuitentreiben am Hofe das Wasser abzugraben. Massenhaft Broschüren und Bilderbogen warfen sie unter das Volk, ließen sie an die Söldner verteilen, schickten sie den Regenten und herrschenden Körperschaften, Schriften, die Versöhnlichkeit atmeten, die Kriegsnot beklagten, mit glühenden Worten die Verantwortlichen beschworen, das Reich nicht das Letzte, den Satz des Kelches trinken zu lassen; das Verderben stünde vor der Tür; es sei die Stunde, wo Beelzebub sich zum Triumph anschicke. Die Bischöfe, die es wagten nach Wien zu reisen und die Väter aufzusuchen, wurden von ihnen herzlich aufgenommen, darauf mit andeutenden Worten der Tölpelei, des Micheltums geziehen. Vor der überlegenen Dialektik der Väter wichen sie; ihre Wärme kam nicht auf neben dem sengenden Feuer der Fanatiker; manche der Reisenden wurden in ihrer eigenen Auffassung wankend. Die Jesuväter kannten nur dies Ziel: reiner Glauben; sie waren schrecklich in ihrer Folgerichtigkeit, man konnte sie nicht von der Erde wegleugnen, sie zogen betörend auf allen Wegen Menschen an sich, Christentum ihre Parole: wie konnte man sich vor ihnen retten. An vielen Orten vergruben sich die Kundigen: jammernd über Deutschland, auf dessen Boden diese furchtbare Entscheidung gesucht werden sollte, und heimlich das Land segnend, dessen Menschen in sich den Drang fühlten, diesen großen Kampf auszutragen.
Träge erhob sich im Mai der Herzog aus Prag; prunkhaft wie früher: vierzehn sechsspännige Galawagen, für ihn vierzig Hofkavaliere, hundertzwanzig neulivrierte Diener; Packwagen; zehn Trompeter vorauf mit silbervergoldeten Trompeten. Bei Königgrätz musterte er die Armada: sechzig Regimenter mit vierhundertfünfundachtzig Kompagnien. Dann schob sich alles unversehens ostwärts, nordostwärts; eine kleine Armee deckte das nordwestliche Böhmen.
Nach Schlesien schob sich die Armee, auf Glatz zu. Dort hielten Kaiserliche unter Matthias Gallas, gegen eine feindliche Armee, der Kern Kursachsen, von Hans Arnim von Boitzenburg kommandiert, bei ihm der weißköpfige Böhmenführer Thurn, Oberst Düwall.
Stumm ruhte Friedland ihnen gegenüber. Laues Scharmützeln, Geplänkel.
Nach zehn Tagen unterschrieben Parlamentäre in Heidersdorf einen Waffenstillstand.
Die ungeheure Maschine stand still.
Gellendes Gekreisch, vielstimmig, in Wien.
Sie bogen sich wie Weiden zusammen, schnellten pfeifend hoch. Da stand er, stand, in Schlesien, ein Gigant an Kraft, zahllose Kompagnien, Massen von Artillerie Munition, bezahlt aus den Steuern der gepreßten Stände, rückte sich nicht, zuckte nicht, nicht einmal vor Schande über das, was geschah. Es war bewiesen: er wollte nicht, ging eigene Wege. Ein Hundsfott Verräter an allen Erbländern, an jedem Einzelnen, am Habsburger Hause, am Reich, am katholischen Glauben. Man mußte ihn strafen, zwingen. Mußte ihm die Armee wegnehmen. Es mußte ein neues Haupt über die Armee gesetzt werden. Der Friedländer, der Erzschelm mußte weg.
Mit grenzenlosem Tosen erfüllten die Jesuväter die Ämter, liefen grade und ungrade Wege, die Ruhe war aus ihren Konventen entfernt. Niemand unter ihnen, der nicht blitzartig begriffen hätte, daß in Heidersdorf auch für ihn die Würfel geworfen wurden: der Friedland mußte ihnen jetzt oder später an den Leib. Es gab keinen Ausgleich zwischen ihm und ihnen. Wie er dastand, der Koloß, entlarvt, war er ihnen scheuseliger und bedrohlicher als Schweden und Sachsen und alle Protestierenden. Sprünge der Jesuiten in ihrer Aufregung: sie suchten sich des Mannes zu versichern, der dem Friedland die Beichte abnahm, aber es kam heraus, daß er keinen ständigen Beichtvater hatte. Boten durch ihre Freunde im schlesischen Lager dem Doktor Ströpenius, Wallensteins Arzt, Geld, große geistliche Versprechungen, wenn er ihm die Sorgen der Kirche vorhielte und wie die heilige Kirche in Gefahr schwebe. Erreichten nichts, als daß sie den kleinen schon ängstlichen Arzt noch unsicherer vor dem Herzog machten und daß er beim Beginn mit dem geistlichen Sermon ein heftiges Gelächter seines Patienten auslöste.
Sie brandeten vor den Mann, den sie für den kompetentesten hielten, den Präsidenten des Kriegsrates, Kollaltos Nachfolger, den plumpen Schlick. Der wie ein Stier gläubig fragend sie anblickte. Er stimmte ihnen bei, es kam kein Leben in ihn. Was er tun sollte; der Herzog werde Gründe angeben. — Er muß herbeigezogen werden, es muß jemand ins Lager. — Schmerzlich runzelte sich die Stirn des Mannes in breite Querfalten: ihn herbeiziehen; es könnte sein, daß er käme — mit der gesamten Armee; sie durchschauten die Verhältnisse nicht. — Sie drangen tiefer in ihn; er wies sie reglos an den Abt von Kremsmünster und Breuner, die Finanzkammer. Die sagten ihnen vieles. Und mit dieser Beute zogen sie knirschend raschelnd ab, planend, sich betäubend, aufstachelnd, begierig nicht nachzugeben, von neuem ausschwärmend; fielen über die Herren des zivilen Hofstaates. Die wollten sich nicht einreden lassen, daß sich der Herzog gegen Wien selbst wende, wichen von den Vätern, die ihnen folgten. An die Herren des Geheimen Rates wagten sich die Jesuiten nicht. Eisiges Schweigen um die Herren. Ein paar böse Worte warf Fürst Eggenberg hin: er werde sich von den Vätern nicht das Heft aus der Hand winden lassen.
Ein Schauern ging durch die kontinentalen Hauptstädte, als der Herzog unbeweglich der sächsischen Armee gegenüber lag. Der Herzog hatte den Kampf aufgenommen. Der letzte Akt des Stückes hatte begonnen.
In ganz loser Fühlung mit dem kaiserlichen Hofe hatte der Friedländer den Feinden einen förmlichen Friedensvorschlag zugehen lassen. Er werde verhandeln, hatte er nach Wien melden lassen, nicht was wie warum. Auf diese erschütternde Selbständigkeit war niemand vorbereitet. Im Kirchlein zu Heidersdorf Arnim begegnend enthüllte Wallenstein: die Feindseligkeiten zwischen kursächsischem und kaiserlichem Heer sollen aufhören; beide werden vereint die Waffen gegen den richten, der sich unterfange das Reich weiter zu stören und die Religionsfreiheit zu hemmen. Sie saßen mit Trzka auf der vordersten Kirchbank nebeneinander; Arnim machte Notizen auf seiner Schreibtafel. „Der Herr Bruder sieht das Heer, das ich aus Prag mitgebracht habe, und das des Feldmarschalls Gallas. Er weiß, wie es Sachsen im vorigen Jahre ergangen ist. Ich kann ihn heute und morgen zerschlagen. Er kennt, da er mein Freund ist, meine Meinung; daß ich zum Frieden kommen will. Der Kaiser läßt sich von Pfaffen anführen.“ Noch einmal: sich zusammenwerfen, rasch und ohne Lärm; jeden fesseln, der Friedensverhandlungen widerstrebe. Im Gespräch rührte Arnim mit keinem Wort an Friedlands Stellung zum Kaiser. „Ich habe keine Lust,“ sagte der Herzog, mit steifem Kreuz am veilchenbestellten Marienaltar entlangschleichend, „nur einen Heller und einen Soldaten noch für fremde Interessen zu opfern. Sagt der Kurfürstlichen Durchlaucht in Sachsen und in Brandenburg: meine Vollmacht ist ausreichend groß, ich tue kein Unrecht; ich habe gewußt, was ich festsetzte, als ich mein Kommando übernahm.“ Später wagte der Herzog einen Vergleich mit dem Bernhard von Weimar: „Seit ich Reichsfürst bin und vor dem Römischen Kaiser mich bedecke, bin ich selbstherrlich. Ich stehe dem Reich bei, nicht mehr und nicht weniger als meinen Absichten entspricht. Zwischen mir, Bernhard und dem Bayern, der dem König in Schweden Neutralität angeboten hat, ist kein Unterschied, Hundsfott, wer mir das bestreitet.“ Auf diesen Punkt, erklärte Arnim, wolle er nicht eingehen.
Bei der Tafel an diesem Tage, zu der Arnim und der Oberst Düwall zugezogen war, verfolgte Wallenstein noch zäh diesen Gedanken. Sowohl der schwedische Oberst wie Arnim hatten, soweit sie bei der schallenden Trompetenmusik verstehen konnten, den Eindruck, daß sich der Herzog festbiß in seiner Wut auf den kaiserlichen Hof. Während die anderen den Luxus des herzoglichen Tisches speisten, saß der Herzog selbst hinter gerösteten Semmeln, bröckelte daran, schluckte mit angewiderter Miene einen Brunnen, den man ihm eingoß. Er bohrte an dem schwachen Punkt der kaiserlichen Politik, die habsburgischen Hausmachtinteressen; das Reich sei verfehlt konstruiert, werde darum verfehlt regiert. Man soll offen sagen, ob man ihn mit dem Titel eines Reichsfürsten zum Besten habe. Er werde wie ein Löwe um seine Rechte kämpfen. Wenn es sein sollte, schlüge er sich auf schwedische Seite. Der Oberst Düwall wurde beauftragt, den Herzog dem Bernhard von Weimar zu empfehlen: „Ein forscher Herr; ich bedaure, daß er nicht bei mir ist.“ Die Obersten, die am Tische saßen, akklamierten dem Herzog lebhaft.
Arnim reiste nach Sachsen. Darauf lagen sich die Heere ruhig gegenüber, aber es war ein. Beißen, Ringen, Niederdrücken. Sie verstärkten sich, bogen sich, warfen sich herum, verschoben sich. Eine unruhige Bewegung machte das sächsische Heer, schon riß sich Holk drohend los, mit seinen Reitern hinfahrend auf Sachsen. Als gäbe es keine Verhandlungen, begann er das Plündern und Morden. Diesmal brach die Pestilenz unter seinen Regimentern aus. Vor Adorf verendete Holk selber mit tausenden seiner Leute. Der Herzog stöhnte eine Woche, der Tote war sein Liebling, er fluchte auf den Krieg. Heftiger drückte er auf das sächsische Heer.
Breslau war nicht weit; da sollten gute Astrologen hausen. Zenno wurde aus Gitschin berufen; welche Chancen man für bestimmte Eventualitäten im Augenblick oder bald danach hätte; er sollte sich mit den Breslauern in Verbindung setzen. Eine Woche war Zeit für Berechnungen.
Zenno kam ins Lager zurück mit einem der Sterndeuter, der unter dem Merkur geboren schien: ziegenäugig, schwärzlich, schlank. Mit dünner Stimme berichtete der: der unheildrohende Saturn sei eben im Eintritt in das Haus der Zwillinge begriffen; die Situation war für Maßnahmen nicht schlecht, da der Stern zum Horoskop in keinem wirksamen Aspekt stand; sie sei auch nicht einladend.
Im letzten Augenblick schlug der Herzog, durch das wochenlange Warten auf Arnim aufs höchste gereizt, eine Verbindung zu Oxenstirn, den er um einen Unterhändler bat. Es traf ein Generalwachtmeister ein, mit dem er allerhand vor dem offenen Feldlager besprach; er wollte die Sachsen in die Zange nehmen. Um die Vertraulichkeit der Verhandlungen zu erhöhen fuhr der Herzog mit dem Unterhändler, der von Haus ein böhmischer Emigrant war, nach Gitschin. Keine Ruhe werde im Reich herrschen, solange Habsburg regiere, erklärte der schwedische Sendling. Der Herzog warnte vor dem Wankelmut Sachsens; er werde Sachsen Geld schwitzen lassen, wenn es sich nicht dem friedlichen Ansinnen füge. Zurück mit dem Unterhändler nach Nimptsch kehrend, ließ er sich von ihm um den Mund gehen mit Versprechungen der Krone Böhmens.
Der Sommer ging schon um. Da schleppte sich müde und langsam Arnim mit seinem Trompeter an. Der Herzog saß im Nimptscher Schlosse. Arnim bat ihn viel um Entschuldigung, klagte über den lauen Mut der beiden Höfe. Friedland gab grollend und böse lachend zurück, also man traue ihm nicht, er solle erst Beweise bringen. Er dem Sachsen. Ob er das nötig hätte. Wer ihn gezwungen hätte hier in Schlesien Monat um Monat still zu halten. Sei ihnen das nicht als Beweis erschienen. Er forschte Arnim stärker aus. Er bekam es fertig den Sachsen den Tod seines Holk in die Schuhe zu schieben. Während der Unterhaltung kam der Herzog erst allmählich dazu, die Tragweite der Antwort zu überblicken. Die Evangelischen hofften noch auf einen Sieg Schwedens. Die Evangelischen waren wie die Jesuiten; sie hatten es mit ihrem Glauben zu tun. Blödsinnige Kinder; die Eselsköpfe. Die Evangelischen waren noch nicht reif, sie waren zu stolz. Plötzlich faßte er den Feldmarschall am Wehrgehenk, stierte ihn an: so wollten sie zusammen ihr Geschäft abmachen. Es sollte nicht gegen den Kaiser gehen, dem wolle man Zeit geben, sich zu besinnen; aber gegen die Schweden. Gleichviel gegen wen von ihnen: Düwall, Thurn oder wen. Arnim konnte sich knapp aus dem Schloß retten. Friedland verlangte tollwütig Antwort in vierundzwanzig Stunden. Und hinterher ein friedländisches Ultimatum durch einen Oberst: „Die Schweden werden in drei Tagen angegriffen oder vom Heer des Herrn Bruders bleibt nicht ein Mann neben dem andern.“ Dicht bei Strehlen auf dem Wege zu seinem Lager war Arnim in Gefahr von Kroaten gefangengenommen zu werden; der Herzog hatte sie hinter ihm hergeschickt. Der Küster in Strehlen auf seinem Dache mit dem Ausnehmen von Taubennestern beschäftigt sah den Schwarm, gab durch Steinwürfe vom Turm herab dem Feldmarschall und seinem Trompeter Winke; sie entkamen.
Das friedländische Heer war im Augenblick losgebrochen. Graf Gallas auf Sachsen, Arnim hinterdrein. Wallenstein schob sich nach, bei Goldenberg warf er die Kroaten unter Isolani nach Sachsen, schwenkte nach Osten, packte, auf die Oder zugehend das Schwedenlager des Grafen Thurn an, siebzig Kanonen auf das Lager richtend; sechstausend Mann ergaben sich, traten in seinen Dienst, Thurn und Düwall hatte er in Händen. Thurn gab er frei, Düwall ließ er entkommen. Glogau Krossen fielen. Zurück von der Oder auf die Lausitz hin; Görlitz geplündert, Bautzen. Nach Brandenburg das Heer; Frankfurt ohne Schwertstreich besetzt, Landsberg, bis Pommern Kroaten. Wallenstein stand vor Dresden.
Bernhard von Weimar mit dem Schweden lag in seiner Flanke. Vorbei, in Friedlands Rücken brauste er.
Und dann die Schweden wie von einer abschüssigen Ebene gegen die Donau vorrollend, Regensburg angegriffen, erobert, Bayern bedroht, die Erblande in Gefahr.
Verblüfftes Stocken, Schnüffeln des Herzogs. Er ließ Sachsen los. In zehn Sturmtagen marschierte er von Leitmeritz über Rackenitz Pilsen auf Fürth. Zuletzt war er langsamer geworden, in Fürth stand er, mürrisch, sich besinnend. Er griff den Schweden nicht an.
Wortlos machte er Kehrt. Das Jahr war vorgerückt. Nach Böhmen ging er in Winterquartiere.
Keiner wußte, was das war.
Sechs ein halb Regimenter zu Fuß, dreizehn zu Pferde hatte der Bayer, dazu im letzten Augenblick Truppen des Aldringen, die aber auf Befehl des Generalissimus nichts riskieren durften. Die Schweden hingen, wieder und wieder die Schweden, wie Schmeißfliegen an faulem Fleisch an seinem unglücklichen Land. Maximilian schrie nach Wallenstein. Es entspannen sich beispiellose Szenen in Braunau, wohin er wieder floh, der Kurfürst beschuldigte seine Räte Geschäftsträger des Verrats, der Faulheit. Er hätte durch sie jeden Einfluß auf die Wiener Hofkreise verloren. Wie hätte er dagestanden vor einigen Jahren, Wien hätte gezittert vor München, die Mißlaune des bayrischen Gesandten wäre ein politisches Ereignis gewesen, Verträge hatte er mit dem Kaiser gemacht, die ihm, ihm die Oberhand gewährten. Als Böhmen abfiel, die Dänen sich zeigten, immer hieß es: die Liga, Bayern. Jetzt Flennen Kriechen Speichellecken.
Gerüchte über Revolten bei den bayrischen Landfahnen traten auf, die sich bestätigten; Hinrichtungen in der Zahl von sechshundert setzte der Kurfürst an. Eines Freitag mittags meldete ihm der verzagte schneeweiße Marchese Pallavicino, sein Kämmerer, die dringliche Audienzbitte einiger Herren vom Landschaftshaus. Es erschienen vom großen Ausschuß Valentin von Selbitz, Hugo Beer, Rieter von Kornburg, Hans Hundt. Sie könnten nicht durchhalten, furchtbares Unglück breche über sie her, sie müßten allesamt verderben. Er ließ sie nicht weiterreden, fragte, wer sie seien. Und rief dann, sich vom Sessel erhebend, gegen die Tür: man solle den Abt von Tegernsee, von Metten, den Propst von Vilshofen, die Dekane hereinlassen. Die Herren erst stumm, dann wispernd einige, während sich in Maximilians Gesicht nichts verzog: es sei niemand mehr da. Aufstampfend der Kurfürst in Ungeduld und Erregung: man möchte nachsehen, auf den Gängen, auf dem Hof. Ging, während sie zurücktraten, rasch hinaus; höflich zu den Verwunderten: sie möchten sich gedulden, er würde gleich wiederkommen. Nach knapp einer Viertelstunde stand er vor dem Sessel, blickte unter die Herren, zischte sehr leise: „Nein, nein.“ Seine Augen halb geschlossen, der Mund verzerrt. Wer sie seien. — Vertreter der Vierundsechzig. „Ihr seid der Landschaftsausschuß und Ihr da und Ihr da? Wer ist die Landschaft von Euch? Wer hat Euch zusammenberufen?“ Er hielt ihr Audienzgesuch in den zitternden nassen Händen: „Ihr seid nicht die Landschaft. Ihr seid der Herr Hundt und der Herr Kornburg, Selbitz. Ihr habt die Form zu wahren. Ihr habt nicht meine Verordnungen mit Füßen zu treten. Ich bin es, der die Landschaft beruft. Meine Berufung, wo habt Ihr sie, Herr Hundt, Herr Selbitz, Ihr.“ Er rief sie in steigender Wut, wie sie wachsbleich vor ihm zurückwichen, bei Namen. „Es ist nichts da,“ schrie er, „Kämmerer, Signor Pallavicino, die Herren haben Euch belogen. Das soll die Landschaft sein, es sind Lügner. Jagt sie fort, sperrt sie ein.“ Pallavicino öffnete mit kläglichem Lächeln die Tür; Leibwache mit Musketen rissen die Herren, die keinen Ton von sich gaben, auf den Flur.
Er drohte offen nach Wien, jetzt nicht mit den Franzosen, sondern daß ihm die Verzweiflung gebiete, alles auf eine Karte zu setzen. Entscheide man sich dort nicht rasch, setze er seine ganze Armee in Bewegung — gegen Wien. Mit den Schweden.
Dazwischen gellten seine Briefe mit dem trostlosen Geheul: er sei im Stich gelassen von dem Kaiser, werde verraten.
Da nahm Kuttner, zitternd im Gedanken an das Gesicht Maximilians, unfähig der Aufforderung nach Braunau zu folgen, dem hilflosen Leuker die Führung aus der Hand. Neben Kuttner ging der schöne aufgeblühte vergnügte Slawata, die Augen wenig aufgeschlagen, den Arm des Jünglings umschlingend. Die blonden Haare schaukelten dem Bayern in den Nacken; sie standen im Wintergarten von Slawatas Quartier. Kuttner mit dem Degen im Kies spielend dachte an den Zwerg Maximilians und seinen Zweikampf mit dem Storch: „Ich soll mich ekeln“, sagte Maximilian. Slawata setzte sich auf eine Bank:
„Ihr werdet nichts schaffen mit euren Petitionen Querellen und Deputationen beim Römischen Kaiser und seinen Räten. Bin ich doch selber ein Rat, will Euer besonderer Bayrischer, Kuttnerscher sein. Der Kaiser ist weit. Ich weiß nicht wie weit. Wir hatten uns geeint, daß Karthago zerstört werden muß. Unsere Ratssitzung kann beginnen, oder seid Ihr zerstreut?“ Von der Seite her über die lange weiße Nase kamen große leicht sentimentale Blicke zu ihm: „Die Sitzung kann beginnen. Ich dachte an meinen gnädigen Herrn, wie schuldlos er dieses Unglück trägt.“ „Da, seht Ihr, Karthago nicht im Augenblick zerstört werden kann, ist es gut, Karthago zu schwächen und uns zu stärken. Laßt nur euren Degen; denkt nicht an München und doch mehr an München; gehen wir. Habt Ihr Durst? Uns kommen die spanischen Wünsche genehm. Wir haben seit lange geplant, uns der Spanier zu bedienen, wenn sie einmal von Mailand heraufkommen wollen. Ihr werdet mitmachen müssen.“ „Was könnten wir tun?“ „Mitmachen; ich sagte schon. Denkt an München. Träumt nicht davon, Kuttner. Habt Ihr mir wirklich zugehört? Ich sagte: Spanier kommen von Mailand herauf, oder sie wollen, sie möchten gern. Sie wollen nach den Niederlanden. Sie haben nichts Böses gegen Bayern. Der Herzog zu Friedland will sie aber nicht dulden, er will sie nicht auf dem Kriegsschauplatz, auch nicht für den Durchzug; sie sollen sich eben ihm unterstellen. Ihr seht, Kuttner, Kompetenzschwierigkeiten, Eifersucht, Ehrgeiz: das alte Lied.“ Kuttner lächelte: „Vielleicht fürchtet Friedland die Spanier für sein Spiel, von diesem Rivalitätsstreit wird mein Kurfürst nicht satt.“ „Nun also setzt Euch dahinter, daß ihm der Braten mundet. Er muß erst angerichtet werden. Wenn man Karthago zerstören will, braucht man nichts als Feuer und Holzscheite. Diese Speise erfordert Geschicklichkeit, Talente. Nicht zu große. Sagt etwa: Ihr schert Euch nicht um Habsburg. Ihr hättet vor eigenen Schmerzen keine Neigung zur Rücksichtnahme auf Wien. Ich hab’ doch übrigens gehört, die Briefe Eures Herrn seien auf diesen Ton gestimmt. Auf einen schlimmen Ton; Fürst Eggenberg klagte; er sagte, der Bayer ginge schon fast zu weit. Nun wollen wir auf keinen Fall den Spanier hier haben, wir dürfen ihn nicht wollen; es ist uns gleich, es muß uns als kaiserlichen Räten pflichtgemäß gleich sein, ob ein Infant oder der Mailänder Gouverneur kommandiert. Wir sind nun einmal an unsern Herzog zu Friedland gebunden. Wir dürfen ihm nicht die Laune verderben.“ „Es ist ein Elend. Warum greift Ihr nicht durch.“ „Seht Ihr. Ich bin so schlau: ich bin kaiserlicher Rat; das sollt Ihr für mich tun, das Durchgreifen. Mir sind die Hände gebunden.“ „Ihr habt ihn doch angestellt. Ich bitte Euch, Graf Slawata.“ „Wir haben ihn angestellt, er hat uns angestellt; wir kommen damit nicht weiter. Ihr paßt jetzt übrigens lobenswert auf, mein zerstreuter Kavalier.“
Kuttner stellte sich dem Grafen Slawata gegenüber auf, stützte sich mit beiden Händen auf den Degen, seine rotseidenen Ärmel fielen über den Degenknauf, er lachte offen dem Böhmen ins Gesicht: „Meinen Segen zu Eurem Plan. Wir sollen die Spanier rufen. Ihr werdet dazu schweigen. Die werden kommen, und wir werden Krieg führen nach hinten mit den Schweden, nach vorn mit Wallenstein, nach links mit den Sachsen. Habt Ihr guten Weizen auf Eurer Mühle.“ „Einem jungen Menschen steht Lachen immer gut. Wer Euch lachen hört, wird nie Euer Feind sein.“
Er führte den feingesichtigen Mann vor eine junge Zypresse, die hinter einer Marmorbank aus einem riesigen Kübel im schwarzen Erdboden wuchs: „Kennt Ihr meine junge Zypresse. Ich habe sie so lieb wie ein Hündchen. Was glaubt Ihr, wie sie gepflegt werden muß. Wir setzen uns hier. Wenn man einen jungen Samen pflanzt, wird man ihn nicht bald verlassen. Wenn man einen jungen Gedanken pflegt, wird man ihn nicht bald hinfallen lassen. Der Weizen auf meiner Mühle ist nicht schlecht, wollt ihn mir herzhaft kosten.“ „Graf Slawata, Ihr meint es gut mit mir. Ihr seid uns Bayern hold, der Kurfürst sprach gut von Euch, Leuker lobt Euch, sooft ich ihn sehe. Darauf können wir aber nicht beißen. Der Herzog ist uns jetzt wenigstens der Form nach Freund. So bekommen wir ihn zum Feind und sind dann wirklich verloren. Ihr, Ihr und Ihr seid unsere Hilfe. Er ist Euer General. Wir sind Eure Verbündeten.“ „So kostet doch erst meinen Weizen. Ihr sollt den Spanier verlangen. Ihr sollt es tun, wenn es sein muß, über unseren Kopf weg. Was denkt Ihr denn, junger Kavalier, was wir tun? Ihr meintet schweigen. Das ist schon möglich. Der Herzog zu Friedland hielt das immer für besser, den Menschen auf die Faust statt auf das Maul zu sehen.“ „Ihr würdet also —“ „Den Mund halten. Zum wenigsten. Gewiß.“
Sie blickten sich lange still an; ihre Blicke wiegten sich. „Denkt an meine Zypresse“, fing der Graf an. „Wenn man einen Gedanken pflanzt, läßt man ihn nicht bald vergehen. Ihr seid in Not. Wie Ihr in Not seid, wißt Ihr selbst. Ihr könnt tun, was Euch einfällt. Ich weiß, Eggenberg und Trautmannsdorf denken nicht anders. Keiner darf das Euch jetzt verwehren. Der Spanier wartet auf eine deutsche Einladung.“ „Wißt Ihr das sicher?“ Slawata lächelte fein: „Ich habe mich orientiert. Ihr könnt jeden Gebrauch von Eurer Entschlußfreiheit machen. Wir werden Euch jedenfalls nicht hindern.“
Ein breitkrämpiger brauner Samthut saß auf Kuttners langsträhnigem Blondhaar weit in der Stirn. Vom linken Krämpenrand hing ein goldener Stern mit einer Kugel, gegen die die angehobene linke Hand rhythmisch mit den Fingerkuppen schlug. Er träumte wieder; mit schmerzlicher Weite des seitwärts gedrehten Blicks traf er den dunklen Böhmen: „Die Spanier sind fromme Katholiken; sie werden meinen gnädigen Herrn verstehen, wenn er sie um Hilfe bittet.“ „Denkt in welcher Lage Ihr seid. Wißt,“ er näherte sich flüsternd dem Kopf des andern, „wir warten auf Euch.“ „Wieder? Wieder auf Bayern?“ Das Gesicht des jungen leuchtete auf. „Seht Ihr“, flüsterte Slawata.
In seinem roten Wams mit den losen Purpurhosen, die weiße Spitzen trugen, beugte der schlanke Bayer vor ihm ein Knie: „Wenn Ihr meinem gnädigen Herrn beistehen wollt.“ „Wir werden Euch nicht verlassen.“
Der Bericht des Herzogs Feria, Mailänder Gouverneurs der Spanier, gelangte gleichzeitig an den Hofkriegsratpräsidenten, den Grafen Schlick, den Fürsten Eggenberg und den Botschafter Ognate. Der Mailänder meldete: ihm seien durch besondere Bevollmächtigte des Bundesobersten der Liga Nachrichten zugekommen, die erkennen ließen, daß dieser um die gemeinsame Sache so hochverdiente Fürst in die äußerste Kriegsnot geraten ist. Angewiesen auf eine Truppe von nur wenig Regimentern, unterstützt von nicht kampfbereiten kaiserlichen Regimentern unter der Führung seiner Liebden, des Generalwachtmeisters Aldringen sehe sich die Liga der gesamten Heeresmacht der Schweden gegenüber. Und dies zu einer Zeit, wo es im bayrischen Lande gäre, wo die rheinischen Hilfsquellen der Liga durch feindliche Besetzung verstopft seien und der kaiserliche Generalfeldhauptmann Friedland sich mit seiner gesamten Armee in Böhmen eingeschlossen habe. Bei Erwägung dieser Sachlage und seiner eigenen zugekommenen Nachrichten, die ihm vom deutschen Kriegsschauplatz geworden seien, käme er zu dem Schluß, daß es in naher Zeit sowohl um die kaiserliche wie die gemeinsame Sache bänglich bestellt sei. Weswegen mit der Herrüstung des geeigneten Widerstandes nicht gar so lange gefackelt werden dürfe. Er, der Herzog Feria, sei nun, wie dort bewußt, gemäß erteiltem Befehl der Spanischen Majestät längst im Begriff und im Zuge, in das Römische Reich aufzubrechen, um Truppenkörper nach den Niederlanden zu überführen, wo die Infantin Isabella Hoheit auf den Tod daniederliege und tägliches Ableben zu gewärtigen sei. Begehre er selbst und schlage vor, der dortigen Not Abhilfe zu tun mit seinen spanischen und italienischen Regimentern. Er beschrieb dann noch den Weg, den er nunmehr sogleich einzuschlagen gedachte, endete nicht, ohne vorher auf die eingetretenen und voraussichtlichen Schwierigkeiten der Befehlsgewalt hinzuweisen, die seiner Tätigkeit Eintrag tun könnten und die behoben werden müßten.
„Ich habe es meinem gnädigen Herrn geraten,“ jubelte Kuttner, die beiden Hände Slawatas pressend, „Doktor Leuker war nur zaghaft dabei. Ihr laßt mich nicht im Stich.“ „Ihr werdet alles von mir erfahren, was Ihr braucht, meine junge Zypresse.“
In den dunklen Korridoren der Burg drängte sich der Graf Slawata mit den Vätern der Jesugesellschaft, die den Grafen Schlick täglich heimsuchten, ihren Affilierten: er solle entschlossen den Friedländer anfassen. Den Grafen Slawata widerten die Jesuiten an; es war ihm zuwider, daß sie sich an Wallenstein, seinem Wallenstein vergriffen; er ließ sich mit ihnen in keine Gespräche ein. Sie sahen ihn süß vertraut an; er ekelte sich, dachte oft die Angelegenheit fallen zu lassen, aber immer wieder wurde er von einer schwebenden Bewegung in sich veranlaßt nachzugeben. Er hatte das Gefühl, diese Sache zu Ende bringen zu müssen, dazu vorbestimmt zu sein; er suchte sich ihr zu entziehen, sie fiel ihn wieder an, es war ein Spiel zwischen ihm und der Sache, er war daran verloren. Lächelnd ging er zum Grafen Schlick, dachte, wie sonderbar einfach es sei, ein Werkzeug der Fügung zu sein und daß er eigentlich nichts mit Wallenstein zu tun habe. Schlick, der Papist, schwer und träge in seinem Stuhl, erklärte, er könne das Vorgehen Spaniens nicht verhindern. Der graue Mann schien es dann für einen wertvollen eigenen Einfall zu halten, daß man die Situation gegen den Herzog ausnützen könne.
Die einsetzende geheime Ratsdebatte legte die Schwierigkeit der Situation und die Zerrissenheit der Auffassung bloß. Questenberg wollte empört über Bayern fallen. „Da Bayern offenbar hinterrücks den Spanier gerufen hat, soll man gegen Bayern verfahren. Es ist ein unerhörtes Vorgehen, beleidigend gegen das Kaiserhaus im Äußersten. Es grenzt an Verrat. Freilich ist man es von Bayern gewohnt.“ Was er also gegen Bayern tun wolle. „Wir haben einen Generalfeldhauptmann; der Spanier hat sich ihm sogleich zu unterstellen und seine Befehle entgegenzunehmen. Dies müssen wir anordnen.“ „Ja, wir können es anordnen“, lächelte Trautmannsdorf. Schlick: „Möglicherweise müssen wir es sogar anordnen, denn es steht in seinem Vertrag, im Vertrag des Herzogs.“ Eggenberg: „So wäre ja alles in bester Ordnung. Wir sind uns einig, daß angeordnet werden muß, der Mailänder Gouverneur mit seiner Armee unterstellt sich dem Befehl Friedlands.“ Questenberg unterstrich das Verlangen durch Wiederholung.
Schlick nickte gleichmütig. Slawata und Trautmannsdorf, die beiden, die gern miteinander plauderten, tauschten Blicke, lächelten. Plötzlich wie auf Signal, sahen sie voneinander weg. Gähnend meinte Schlick, er werde das Schreiben, welches ihren Standpunkt charakterisiere, gleich verfassen; bliebe nur die Frage, wer sich zur Überbringung des Briefes und mündlichen Diskussion mit Friedland bereit erkläre. Alle fixierten Questenberg.
Plötzlich war der durch die Einhelligkeit unsicher geworden; er blickte zur Erde, suchte nach Worten; er wolle natürlich gern den Auftrag übernehmen; wozu aber übrigens — das schloß er nach überlegender Pause an — wozu eine mündliche Diskussion da noch benötigt werde, der Brief werde doch wohl rund und nett den hier vorgetragenen Standpunkt wiedergeben; ein Kurier könne dasselbe tun. Trautmannsdorf vorsichtig sanft vor Questenberg; nicht doch, ein Kurier, das sei nicht besser als ein Bote, ein Mensch, der nichts weiß, nichts hört, nichts spricht; und der Herzog wird fragen; er zweifle nicht, daß Friedland wird fragen wollen. — Was denn. — Etwa, wie sich der Hof dazu stelle. — Nun, das sei doch einfach; der Brief ist darin doch von genügender Deutlichkeit; der Hof verlangt völlige Unterstellung des Mailänders unter Friedland. — Eifrig bestätigte das Trautmannsdorf; plötzlich fing er wieder einen Blick Slawatas auf, er fragte: „Warum lächelt Ihr mich an, Slawata?“ „Weil Ihr so eifrig seid. Ich sehe, Ihr seid selbst noch immer so bequem wie früher.“ Eggenberg und Schlick hörten schweigend die Debatte an.
Da fühlte sich der etwas verwirrte, sogar bestürzte Questenberg genötigt, sich an jeden einzelnen zu wenden und ihn zu fragen, ob es denn nun so wäre wie man besprochen habe und wo denn da eine Schwierigkeit zu erwarten sei.
Wie dieses Wort fiel, „Schwierigkeit“, und wie Questenberg so fragte, wurde es ernst und streng in der Kammer. Fest erklärte Schlick: „In dieser Hinsicht habt Ihr den Friedländer darüber aufzuklären, daß er unsere einzige Stütze sei und daß wir keine Machtmittel besitzen den Mailänder zu zwingen, falls der etwa, wie es scheint, seiner Wege gehen will.“ „Es versteht sich auch von selbst,“ fuhr Eggenberg feindselig fort, „daß wir ohnmächtig den Bestrebungen Bayerns gegenüberstehen, sich ausländische Hilfe zu verschaffen. Es liegt bei Bayern ebenso wie bei den rheinischen Städten: wir können ihnen nicht helfen, wir dürfen ihnen darum auch nicht einmal böse sein, wenn sie sich selbst nach Hilfe umsehen. Immerhin könnt Ihr in diesem Zusammenhang dem Friedland bemerken, daß die Schuld an dem Auftreten Bayerns auf ihn selbst falle. Denn er war auch gedacht als Schutz für Bayern; er ist der Befehlshaber eines Reichsheeres.“ Fade lächelte Questenberg: „Ich glaube, ich werde das nicht so sagen.“ „So sagt es anders. Aber irgendwann wird einmal unser Standpunkt hervortreten müssen, Ihr werdet da nicht herumkommen. Was tut denn jetzt Friedland, was hat er im Sommer getan, wofür sind unsere eigenen Steuerquellen in Anspruch genommen worden? Die Herren wissen alle, daß ich kein Fürsprecher bayrischer Politik bin. Nicht von mir hat Maximilian den Kurhut erhalten; aber jetzt haben wir mehr als zurückgezahlt an ihn. Wir fangen alle an, uns des Kurfürsten Maximilian zu erbarmen.“ „Ihr werdet mir noch einen mitgeben müssen; es wird sich leichter verhandeln lassen.“ Eggenberg, herumspazierend, überhörte ihn; er redete laut und scharf: „Wir reden gewiß davon, was uns eigentlich selbst mit all dem von Friedland geschehen ist. Wie uns dies ins Herz schneiden muß, daß ungefragt, ungebeten eine spanische Truppenmacht sich in Bewegung setzt und ins Reich eindringt. So gräßlich liegt das Reich und Habsburg danieder. Wir sind machtlos gegen Friedland, wir wissen es selbst. Er soll es aber nicht bis zum Äußersten treiben. So machtlos sind wir hier nicht, daß wir uns widerstandslos ergeben.“ Dröhnend fiel Schlick ein: „Ich billige ganz, was Ihr sagt, Fürst Eggenberg. Ich werde den Herrn von Questenberg in das Lager Friedlands begleiten. Wir sind nicht so machtlos, daß wir schweigen müssen.“
Trautmannsdorf bat, die Augen leuchtend, um die Erlaubnis reden zu dürfen: was man mit alledem denn vorhabe, worauf es hinausginge. Schlick übernahm die Antwort: „Wir haben es über zu schweigen. Wir haben es nicht nötig zu schweigen.“ „Ihr habt es nicht nötig?“ „Nein, Euer Liebden. Wenn es sein muß, haben wir Bayern und Spanien mit uns. Wir werden uns auch des Friedlands erwehren können, nachdem wir mit Böhmen und anderen fertig geworden sind.“
Zurückweichend pfiff der verwachsene Graf: „Also Kampf.“ „Nein, Entscheidung. Kampf haben wir seit zwei Jahren.“ Betroffen Trautmannsdorf, sich einen Sitzplatz suchend: „Verzeiht, wenn ich Euch in Anspruch nehme. Ihr redet von einem Mann, den ich verehren gelernt habe. So rasch lerne ich nicht um. So rasch hab’ ich mir das alles nicht gedacht. Ihr zeigt mir gütigst die Notwendigkeit, diese sogenannte Entscheidung zu suchen.“ Schwer über sich hängend Schlick, aus großen schlaffen Augensäcken um sich blickend, den Stuhl erdrückend: „Ich sag’ Euch gern meine Meinung. Ich halte Friedland für einen Verräter. Er ist nicht besser als Bernhard von Weimar, aber schlauer.“ Trautmannsdorf lachte, er saß, ihm war schwindlig: „Das sagen die Jesuväter auch. Sie predigen es schon lange. Was ist damit gesagt.“ Eggenberg leise, unterbrechend: „Ich halte ihn nicht für einen Verräter. Er ist uns aber gefährlich. Er muß sich entscheiden.“ „Tut das nicht“, bat Trautmannsdorf. „Was?“ fragte fast zärtlich Eggenberg neben ihm. „Schickt jedenfalls nur Questenberg allein. Graf Schlick bleibt besser hier. Was soll bei alledem herauskommen.“ Schlick: „Wir werden Klarheit finden.“ „Und,“ bettelte Trautmannsdorf, „Ihr werdet durch Euer Auftreten Klarheit in ganz falscher Richtung schaffen. Klarheit, die ohne Euch gar nicht so geworden wäre.“
Sie kamen dann, da Schlick nicht nachgab, überein, Schlick dem Questenberg beizugeben und sie beide zu verpflichten, nicht über eine Aufklärung hinauszugehen. Zuletzt entschied man sich noch, an den Herzog schriftlich mitzugeben, was etwa erforderlich sei, und mit der Reise in das Pilsener Lager noch etwas, jedoch nicht gar so lange zu zögern. Man wollte erst warten, ob es Ernst war mit dem Anmarsch der Spanier.
Schwebend ging Slawata hinaus, an Trautmannsdorf hängend. „Was meint Ihr,“ fragte der Böhme, „Ihr weint ja fast. Der Herzog lebt noch. Er ist noch nicht tot.“ „Sie werden ihn umbringen. Sie wollen ihn beseitigen. Graf Schlick ist kein Mensch. Er ist ein Untier. Es wäre besser, Friedland regiere hier, ganz, schrankenlos, und nichts bewegte sich gegen ihn.“ „Meint Ihr,“ seufzte Slawata und hing dem Gedanken träumerisch nach, „warum wollen wir so Unmögliches bedenken. Es schickt sich in der Tat alles gegen Friedland. Es hat etwas Elementares an sich.“ „Slawata, Ihr seid mein Freund,“ Trautmannsdorf wandte sich plötzlich an den anderen, „wollen wir uns zusammentun. Wir wollen dem Herzog helfen. Ich kann es nicht mit ansehen. Seit Monaten geht es so gegen ihn, Schlick hat alles in der Hand, Eggenberg sagt nicht nein, der Weg ist fast schon vorgezeichnet.“ Ein glückliches Gefühl ging durch Slawata; es war so schön, was der andere vorschlug; kurios war es, daß grade ihm dieser Antrag wurde, aber warum sollte er nicht einmal dem Herzog helfen, helfen, ihn retten. In ihm winselte, zwitscherte es: ich will mit dem Grafen dem Herzog helfen, wir spielen zusammen mit ihm, ich muß ihn doch beseitigen.
Und erst in diesem Augenblick war ihm flammend klar und durchrieselte ihn mit Wonne und Seligkeit, daß er wahrhaft vorhatte, den Herzog zu töten. Riesenhoch lohte es durch ihn: ich will ihn töten, er labte sich an dem Feuer, wuchs stolz daran hoch.
Voll Dank drückte er dem kleinen Grafen den Arm; ihm sei nichts Lieberes begegnet den Tag als dieses Wort des Grafen Trautmannsdorf, man solle den Herzog nicht dem Grafen Schlick überlassen; nein sie wollten sich selbst an ihn heranmachen. Trautmannsdorf starrte ihn an; Slawata in seiner halben Berauschtheit merkte es erst spät: „Was stiert Ihr so.“ „Wir wollen uns selbst an ihn heranmachen.“ Slawata sah ihn an; das hatte sein Mund gesagt, er erinnerte sich nicht; was tat sein Mund. Launisch, gefaßt lachte er: „So will ich meinen Mund schlagen, der sich auf eigene Füße stellen will. Was sagte er. Er ist ein Kalb. Ich möchte mich an den Herzog heranmachen, ihm die Gefahren schildern, ihn führen.“ „Das will ich doch so gern. Wollen wir ihm helfen.“
Und Slawata sog den aufrichtigen Schmerz und die Sorge des andern wie einen starken leidenschaftlichen Geruch ein.
Wie er vor seinem Schreibkabinett saß, schrieb er. Er teilte dem Friedland die Machenschaften am Hofe mit, daß Schlick mit den Jesuiten den Ton angebe, Eggenberg aus Angst mitmache; daß viele gegen ihn seien; bald werde Schlick und Questenberg ihn zur Rede stellen; wichtige Personen am Hofe hätten ihn im Verdacht des Verrats, wichtige entscheidende Personen. Er überlegte sich nicht einmal, als er dies schrieb, wie er seine Teilnahme für den Herzog begründen sollte und was der Herzog dazu sagen würde.
Der Kaiser hielt sich in der Burg auf. Er beobachtete mit argwöhnischen Mienen, was um ihn vorging. Ein sonderbares Vibrieren hatte noch in Wolkersdorf in ihm begonnen. Es trieb ihn seine Umgebung zu beschnüffeln. Man hatte ihm von den Befürchtungen um Friedland berichtet: das waren dieselben Worte, die sie zu ihm gesprochen hatten, ehe man ihm das Generalat übertrug. Der Schwede war hin, jetzt mußte man auf der Hut vor dem General sein. Sie sagten es. Er gab die Jagden auf. Eine Beängstigung Befremdung wuchs in ihm. Er verschwieg sich, daß er vor den Heiligenbildern und Kruzifixen nicht stillstehen konnte, daß er gepeinigt davon fortgetrieben wurde. Er wollte fort aus Wolkersdorf. Er war eines Morgens fast nach Wien geflohen. Er verlangte bald den, bald den Herrn zu sich zum Vortrag. Sein Geheimsekretär wurde von ihm herumgeschickt, dann befragte er ihn ruhelos. Etwas Ängstliches hielt ihn neuerlich in der Burg fest. Mit Widerwillen Widerstreben verharrte er. Die Kaiserin, die fast ein Witwendasein in tiefer Religiosität abgeschlossen in ihrem Flügel führte, kam näher an ihn. Sie tauschten Worte über einige Ordensdinge. Sie war beglückt, daß er nun selbst Schmerz über diesen Wallenstein empfand und damit rang; auch zu ihr waren diese Dinge gekommen durch ihren Beichtvater; auf den Kaiser zu wirken hatte sie aber abgelehnt. In ihr zuckte es wieder, sich ganz neben ihn zu stellen; die Trauer um Mantua lichtete sich etwas; der Mann neben ihr sah gequält aus.
Plötzlich bemerkte sie, daß je mehr sie sich änderte, er von ihr abwich. Er erstaunte über sie; er fühlte: sie bemerkte, daß er den Halt verlor; sie wollte ihm helfen, er wollte es nicht, fand es schamlos, fand sich bloßgestellt, seine Unruhe vertieft; wich, hörte sie trübe an. Sie warb weiter um ihn, es geschah ab und zu, daß er sie wieder ansah.
Eleonore von Mantua, die in Regensburg vor ihm geflohen war. Sie hatten einmal nebeneinander gestanden vor der golden blinkenden Monstranz, die den Baum des Lebens darstellte. Ihr hochrotes Kostüm, die Perlenkrone auf ihrem spröden braunen Haar, dunkle dicke Augenbrauen, die Schleife an ihrer Hüfte mit seinem Namen. Dann hatte er sich hineingestürzt in sie; sie waren, wie sonderbar, auseinandergekrochen wie zwei grüne Kröten, plätscherten nebeneinander. Verwirrt hielt er sich jetzt in manchen Augenblicken an sie fest, sie umschlangen sich, er war glücklich und besinnungslos, in ihr blieb die Freude und die Sehnsucht. Sie hatte nicht mehr in Erinnerung das verquollene leidende Wesen, das ihr in der Innsbrucker Kirche begegnet war, mißtrauisch aus seiner Schale blickend, das stumme machtgeschwollene Ungeheuer von Regensburg. Er verwandelte sich wieder; er blickte sie an. Sie wußte jetzt nur, aus ihrem Witwenzimmer schleifend, daß er ihr Vaterland war. Mantua war verloren: da ging, da schlich — Mantua! Wie sie aus ihrem Witwenzimmer zu ihm gefunden hatte, hatte sie nur dies Gefühl; es lebte zwangsartig in ihr; sog sich in ihr fest.
Nachdem der Kaiser sich bei vielen über die schwebenden Dinge orientiert hatte, lockte es ihn einmal in Gegenwart der Kaiserin den großen Luxemburger, den hinkenden Jesuiten zu sprechen. Ein undeutliches Gefühl hatte ihn bewogen in Gegenwart der Kaiserin und Lamormains die Dinge auf sich wirken zu lassen, mit ihnen gemeinsam die Dinge zu übernehmen. Hilflos fühlte er sich, von Woche zu Woche mehr. Man sah am Hofe: seine große Hoheit war einer Müdigkeit gewichen; er wußte sich keinen Platz, fühlte sich beirrt, gehindert, gereizt, in einer unnatürlichen Lage. Das wehte launenhaft über ihn und breitete sich mehr aus, zerriß seine Einheit. Triebartig hatte er in manchen Stunden das Verlangen, die ganze Last und den Wust von sich abzuschütteln, um wieder zu seiner Macht zu finden. Seine alte Neigung, Schwierigkeiten durch die Flucht zu entgehen, erwachte gelegentlich.
Es drängte ihn jetzt leise zu Menschen, zu Eleonore. Sie sollte alles mit ihm dulden. Was würde sie sagen. O er wollte sich fesseln lassen. Er fürchtete sich, fürchtete sich vor dem, was ihm bevorstand.
Wie Lamormain anschlich, erinnerte ihn Ferdinand, sich in seinen Abtstuhl senkend, an die Ruhe der Tage in Regensburg und wie die Ereignisse gräßlich geworden wären, gräßlich durch das Wanken aller menschlichen Beziehungen; was hätten sie aus seinem Wallenstein gemacht, dies sei kein Verräter, oft hätte er Lust den Herzog zu rufen und mit ihm alles zu klären; Mißtrauen, Übelwollen, daraus sei das jetzige Ungemach geboren, es mußte auf ihrer Seite viel verschuldet sein. Lamormain, mit seinem Stock den Boden zeichnend — sie saßen in einer glasgeschlossenen geräumigen Galerie, die den Blick auf einen Hof gestattete, Gemälde Skulpturen an der seidenbespannten Längswand, bunte Ampeln hingen herunter, der Hof versammelte sich hier oft — auch Lamormain dachte an Regensburg; Maria Himmelfahrt, die gelbroten Flammenräder fuhren über die Wände des Musikzimmers im stillen Bischofspalast; wie ein Begnadeter legte dieser Kaiser alle Macht von sich, legte ihre Schwäche und Kleinheit bloß. Jetzt saßen die Hunde, die er losgelassen hatte, an ihm, fielen den Jäger an. Matt der Pater: Eggenberg hätte sich viel bemüht Schwierigkeiten und Konflikte zu vermeiden, die Dinge nähmen aber einen Verlauf, der fast vorauszusehen war. Gereizt Ferdinand, an seinem grauen Kinnbart rupfend: der Priester möchte das nicht sagen, man möchte nicht Wallenstein schlimme Neigungen zuschreiben, er glaube das nicht, der Verlauf werde ihm vorgezeichnet. — Sein Beichtkind, das flattrig leidend im Stuhl sich bewegte, umfaßte Lamormain mit einem langen herzlichen Blick; er sah auch auf die Kaiserin, die das Kinn auf der Hand, den Arm auf die Sessellehne aufgestützt hatte, leicht vorgebeugt, beide beobachtend: so hätte die römische Majestät es vielleicht richtig genannt; wenigstens zu einem Teil werde dem Herzog ein gefährlicher Weg von außen vorgezeichnet; seit Regensburg könne man das mit Recht sagen. Und als die Kaiserin den aufmerksamen Kopf hob, ihn fragend anblitzte, den Arm sinken ließ: ja, seit Regensburg, seit seiner Entlassung; seit da sei dem Friedland nicht mehr zu trauen; er verirre sich immer mehr. „Seit seiner Entlassung“, hauchte die Mantuanerin errötend, legte sich im Sessel zurück; „man durfte ihn doch wohl entlassen.“ Ernst Lamormain: gewiß, er sei vom Kaiser angestellt und nicht auf Lebenszeit, aber die Menschen seien nun einmal im Grunde ihres Herzens eigentümlich, ein Gefühl für die Rechtsverhältnisse sei nicht da; da kümmere sich einer nicht darum, ob jener Kaiser sei und er Kämmerer; er will seine Begehrlichkeit befriedigen, er läßt sich nicht fortschicken.
„Was ist das?“ Ferdinand fest angelehnt, die linke Hand vor dem Mund: „fortgeschickt. In Regensburg. Der Herzog zu Friedland ist mein Freund gewesen. Sein Grimm, wenn er da ist, hat mit Regensburg nichts zu tun.“ — Lamormain: man erzähle sich, er datiere seit Regensburg. — Ferdinand: in Regensburg sei das Reich geordnet worden; der Streit der Kurfürsten sei beendet worden; das Reich habe sich gefestigt wie niemals. Friedland hat auf Festigung und Sicherung des Reichs gedrungen; was komme man mit Regensburg; wie solle Regensburg ihn, gerade ihn schlimm beeinflußt haben. Mit demselben tiefen herzlichen Blick nahm Lamormain, gebückt über sich sitzend, seine Worte an, traurig die Stirn runzelnd; leise vorsichtig: „Er ist in Regensburg entlassen worden.“ „Von wem redet Ihr, Ehrwürden.“ „Vom Herzog zu Friedland.“ „Eben. Es ist doch kein Lakai oder Barbier entlassen worden. Es ist der Herzog zu Friedland.“ „Was macht es.“ „Nun sprecht doch, Ehrwürden, um Jesu willen.“ „Er ist von der Römischen Majestät mit Glimpf entlassen worden. Er war Generalfeldhauptmann der kaiserlichen Armada, hatte den dänischen König geschlagen, den niedersächsischen Kreis beruhigt.“ „Ich habe ihn mit mehr als Glimpf entlassen. Ich habe ihm Geschenke geschickt, es ist keine Woche vergangen, daß ich ihm nicht ein freundliches Wort gab, er war mir immer mein oberster Feldhauptmann, ich war ihm stündlich gnädig und huldvoll.“ „Ihr wohl, Kaiserliche Majestät. Ihr wart ihm huldvoll und gnädig. Aber er nicht der Kaiserlichen Majestät. Denn er war der Friedländer, der Herzog zu Friedland, Wallenstein; oh, wer das ist, Wallenstein. Und er ist beleidigt worden, er hat gehen müssen, hat der kurfürstlichen Durchlaucht in Bayern weichen müssen.“ „Wir reden im Kreis. Das Reich hat es erfordert. Der Herzog weiß es. Ich habe ihm nicht übel gewollt.“ Immer still der Priester; er hätte, sagt man, dem Kurfürsten in Bayern weichen müssen.
Flammend blickte, beide Arme schräg über die Lehne legend, Eleonore den Kaiser an, dessen Gesicht klein in seiner Gequältheit erschien; etwas Drohendes in ihrer Stimme: man erzähle sich überall; es sei nicht der Kaiser, sondern der Bayer gewesen, der den Herzog abgesetzt habe. Durchbohrend Ferdinand vorgebeugt: „Denkst du das auch?“ Sie legte sich angstvoll zurück: „Ich fragte doch.“ Heiser Ferdinand: „Frage nicht, Eleonore. Du denkst zuviel an Mantua.“ Sein Ausdruck wechselte, wie er sie fixierte; dann sanfter: „Du weißt nicht, wie es zugegangen ist. Ich habe Italien nie übel gewollt. Friedland auch nicht. Ich hätte dir gern Freude gemacht, Eleonore.“ Sie hauchte, fast zärtlich, sich über ihren Schoß errötend breitend: „Ich weiß, Ferdinand. Verzeih mir.“
Sie schwiegen. Die Schloßwache marschierte mit langsamem Gesang über den Hof, das helle Winterlicht erfüllte bis in die Winkel den warmen weiten Raum. Eleonore anscheinend zuhörend: „Welche schönen weltlichen Lieder es gibt.“ Der Kaiser, der gebrütet hatte, auffahrend, als wenn er etwas abwürfe: „Also es sieht aus, als wenn ich schuld an der Lage bin. An den Verwicklungen. Vielleicht, nein, ich bin schuld an dem sogenannten Verrat Wallensteins. Das alles leuchtet mir nicht ein. Ich sage es zehnmal. Und wenn man mir zehnmal und zwanzigmal widerspricht.“ Nach einer Pause hitzig mit Gesten gegen Lamormain, der sich hochgesetzt hatte: „Und wenn ich Schuld habe. Wir reden jetzt nicht davon. Wie lange ist Regensburg her. Ich kann es schon gar nicht mehr denken. Regensburg ist schon fast nur eine Einbildung. Was kommt man mit Regensburg. Wenn ich den Herzog entlassen habe, dann ist alles wieder gutgemacht. Wenn er beleidigt war: er ist Feldhauptmann geworden; er hat, was er will. Was will er?“ Die Mantuanerin drückte ihren langen Fächer auf seinen fuchtelnden Arm; er solle sich nicht erregen, die Dinge würden bald wieder ausgeglichen sein. — „Ausgeglichen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Was dahinter steckt.“ Eleonore behutsam: „Wohinter.“ „Nun versteh doch, Eleonore. Ihr versteht mich gewiß, Ehrwürden. Höre doch einmal. Es ist ja gar kein Grund für den Herzog vorhanden gegen mich zu sein. Ich habe ihm keinen Anlaß geboten. Er ist Haupt des Heeres mit der ungeheuersten Vollmacht. Wir bestreiten sie ihm nicht.“ Seufzend Eleonore: „Er will nicht.“ Bittend Ferdinand mit gespanntem Gesicht: „Was ist, Pater. Was wißt Ihr.“ Nichts, als daß dem Herzog nicht genug sei an den Vollmachten und an dem Heer; daß er nicht zufriedenzustellen sei. — Was er denn wolle. — Er vergißt nicht, daß man ihn bei Regensburg weggeschickt hat. Er läßt das nicht liegen, es ist ihm wichtig für sein Handeln wie irgend etwas. Und nun gibt es keine Ruhe. — „Wir haben ihn nicht besänftigt mit dem neuen Kommando?“ — „Den Herzog?“ „Nun?“ Lamormain lachte freundlich, tauschte Blicke mit der Kaiserin, die lächelte: „Kaiserliche Majestät. Ich will kein Beispiel geben. Es sollte mir auch schwer sein für den Herzog ein Beispiel zu finden. Im Grunde braucht man nur zu sehen, — wenn ein Stein auf einen Marmorboden geworfen wird — eine Kante von dem Stein bricht ab: diese Kante ist nun in alle Ewigkeit ab, sie kann nur durch einen Entschluß Gottes wieder am Stein befestigt werden.“ — „Nun?“ „Der Herzog weiß, wer er ist. Er hat es in Regensburg gemerkt. Es paßt ihm nicht. Er verzeiht es nicht, daß er so ist, unser, der Kaiserlichen Majestät Feldhauptmann, und weiter nichts.“ Ferdinand biß mit gerunzelter Stirn an seinem Handknöchel, er arbeitete mit dem Zeigefinger an seiner Unterlippe, brachte hervor: „Seht einmal, Lamormain. Ist es Euer Eindruck — hat man dem Herzog irgend etwas in den Weg gelegt.“ „Nicht doch“, lachte behaglich Lamormain. „O warum lacht Ihr denn,“ Ferdinand seufzend, flehend, „sagt mir doch, was ist.“ Mit großer Weiche der Jesuit: „Majestät wollen wissen, was man dem Herzog in den Weg gelegt hat. Nichts. Es hätte keiner wagen können. Er hat ja die ganze Macht allein.“ Erleichtert Ferdinand: „Nun also.“ Lamormain mußte ein anspielendes Lächeln unterdrücken: „Es genügt ihm nicht.“ Unsicher Ferdinand, an seinem Gesicht, an seinen Händen hängend, die ganze schwarze starke Gestalt des Jesuiten mit den Augen verschlingend: „Es ist ihm nicht genug.“
Und im Hintergrund fühlte er sich etwas regen, ganz unerwartet sich aus dem Grauen Tiefen schieben, etwas mit tausend Füßen, das lief, lief, das ihm entgegenlief, dem er entgegendrängte, gegen das er sich stemmte. „Puh, puh“, spie er. Das wieder. Dahin, dahin wieder.
Er stand aus dem Sessel auf; das Kleid Eleonores rauschte neben ihm, es duftete stark neben ihm; sie war, wie der Ekel sein Gesicht entstellte, zu ihm gedrängt. Sie gingen nebeneinander Arm in Arm über die Teppiche der Galerie. Lamormain stellte sich an die Brüstung der Galerie. „Es ist ihm nicht genug“, flüsterte Ferdinand, als sie an Lamormain vorbeizogen, hielt etwas an. Sein ausgerenktes Gesicht. Er hielt Eleonore an beiden Armen vor sich fest. Die Mantuanerin halb weinend: „Er ist ein Teufel.“ Von der Seite Lamormain schwer traurig: „Kein Teufel. Ein armer Mensch.“
Er hielt noch die Mantuanerin umfaßt, stierte ihre Augen an wie Fremdkörper, ihre verkräuselten Haare, ihren auseinandergezogenen Mund, ihre abwärts gesenkten Mundwinkel, einen Finger hob er: „Dies ist es. So sind die Menschen. Der Pater hat es gesagt.“
Und wieder wimmelten über ihn die tausend kleinen krebsartigen Füßchen, der schuppentragende langgestreckte Leib; der Leib war so dicht über ihm, er hatte Neigung sich zu bücken.
„Was sagst du dazu?“ Sie mit tränenerfüllten Augen, gebrochener Stimme, ihn im Gehen fortziehend; sie suchte ihrer Stimme einen leichten Ton zu geben: „Es wird nicht schwer sein etwas gegen ihn zu tun. Wir brauchen darum nicht zu sorgen. Wir werden morgen den Fürsten Eggenberg und unseren lieben Schlick bitten. Sie werden uns erzählen, was zu tun ist.“
Der Kaiser ließ sich, ihren Arm ablösend, in seinen breiten Armstuhl nieder; die geschnitzten Menschen empfingen ihn, über die Lehne fließend, Männer Kinder Frauen, abgleitend, sich hebend, er fragte Lamormain: „Ehrwürden?“ Der trat seitlich, mit dem Stock stampfend, plump hervor, pflanzte sich hinter seinem Stuhl auf, die Lehne angeklammert: „Dies alles ist uns nichts Neues. Die Kirche kennt seit lange die Menschen. Wir rechnen mit diesen Menschen. Wir müssen sie brechen auf irgendeine Weise.“ Ein Zittern hatte den Kaiser befallen: „So sind die Menschen. Ihr habt recht. So bin ich wohl auch. Wir können es nur ändern, wenn wir uns der heiligen Kirche unterwerfen.“ Der Priester redete leise: „Die Menschen sind böse. Sie haben teil an der Erbsünde.“ An Eleonore wandte sich, zu ihr aus der Tiefe des Sessels die Arme ausstreckend, der Kaiser hauchend: „Siehst du. Wir sind davon befallen.“ „Ich weiß es, Ferdinand.“
Das schuppentragende lange Reptil schurrte, rauschte klapperte über ihn; Entsetzen lag auf Ferdinands Gesicht.
„Der Friedländer zahlt mir’s heim. Was bin ich anders. — Wir werden morgen den Fürsten Eggenberg zu uns bitten.“ Lamormain lächelnd, die schwere Faust hebend: „Wir brauchen keine Sorge haben. Er wird bewältigt werden, der verräterische Mann.“ „Seht Ihr, seht Ihr, wie gut“, hauchte zitternd, zaghaft zu ihm aufstehend der Kaiser, der ihn und Eleonore mit weißlichen Blicken übergoß. Dabei kaute er an seinem Schnurrbart. Durch ihn fuhr, er erlitt es, es machte seine Schultern schwach, füllte seinen Mund mit lauem Speichel: daß er die Worte eines andern sprach, daß ihn dies alles gar nichts anging. Er war durchkreuzt; der Friedländer war ein starker Feldherr; was tun solche Feldherrn: er konnte seine Gedanken nicht daran annageln. Halbe Minuten dachte er: die Kurfürsten werden sich zufrieden geben, ich werde den Friedland entlassen. Er war ja in Wien, in Wien. Er kaute wieder an seinem Schnurrbart.
Vor seinem Bett stand er nachts in seinem Schlafmantel, hob die Arme vor die Stirn, stieß mit den Ellbogen beiseite, schnob, daß der Leibkammerdiener aufhorchte: „Gebt Raum, gebt Raum.“ Er durchmaß den fast finsteren Raum, rieb das Gesicht am metallenen Leib Christi, keuchte, drohte. Er schlug mit beiden Fäusten gegen die nackte Brust, als wenn er seine Besinnung herrufen wollte.
Wie er am nächsten Tage in Wolkersdorf war, zog er seine schmutzige Handwerkertracht an, gab seinem Kämmerer Bescheid; sie spazierten ziellos durch den Wald. Aber es war ersichtlich, daß der Kaiser einen Weg suchte. Sie kamen zu einer Kohlenbrennerei, und als sie ein Stück weiter gegangen waren, begegneten ihnen drei Männer, zwei dicke Bauern, die Ferkel im Sack auf dem Buckel trugen, und ein lustiger Dominikaner. Die beiden Männer schlossen sich ihnen an. Der Mönch erzählte lange muntere Geschichten, bis bei einer Gelegenheit herauskam, daß seine beiden bäurischen Begleiter Neugläubige waren. Da wand er sich, bekreuzigte sich, schlug die Hände zusammen. Sie gaben trotzig lustige Antwort, setzten ihm auf jede Schulter ein weißes quiekendes Ferkelchen, daß die Tierchen sein Lamento überschrien. Der Kämmerer redete ihnen gütlich zu; der Dominikaner, ihm dankend, wandte sich eifrig, hochrot an die Bauern, ob sie denn nicht geneigt wären in dieser schönen freien Gottesnatur wenigstens ihn anzuhören, ihn sprechen zu lassen. Es gab eine Debatte über das Recht der Ferkelchen, sich auch vernehmen zu lassen. Sie versenkten dann die Tierchen wieder in den Sack. Der Dominikaner sprach auf sie ein. Er sprudelte.
Was sie denn nur wollten. Warum passe ihnen der alte Glaube nicht. Hätten sie sich ihn ausgewachsen, den alten Wams. Ei, und er paßte doch so gut. Warum denn nur die albernen neuen Moden. Wüßten denn auch die Bauern, wie die frommen Bürger und Edlen in der Stadt französisch aufgeputzt daher marschierten. Welche Äfferei. Sie, wackere Bauern, Ferkelchen im Sack, und Neugläubige! Wenn sie es nicht sagten, würde man nicht glauben. Sie möchten doch einmal die Ferkelchen fragen, ob sie einen anderen Glauben hätten als ihre Eltern und Ureltern und weitere Voreltern und Ahnen bis in die Arche Noahs hin. Bei Jesus, solch Tierchen ist den weisen, weisen Menschen über. Man wirft nicht Dinge holterdiepolter in die Asche. Immer sachte, immer vorsichtig, taugt noch alles was. Wer wird so lumpen, einen neuen Glauben, wenn der alte noch ganz gut ist. Hä, und ist er nicht gut?
Da gaben die beiden nur zum Bescheid, er rede so flink und glatt daher. Solle er nur weiter reden, sie hörten gern zu. Der Kammerdiener nickte.
Ja, es gäbe nichts, was nachsichtiger wäre als der wohltemperierte, allen angemessene alte katholische Glauben. Sie könnten schon immerhin, wenn sie sonst etwas glaubten, es glauben. Störe sie niemand darin; wer wird gleich schimpfen, wer wird einem Menschen nicht erlauben ein bißchen zu glauben, was ihm beliebe. Der katholische Glaube sei wie ein Lämmlein oder wie ein Geblendeter, den man am Bändchen führt; er folge völlig den Menschen. Seht hin, ich zeig’ euch, wie das Lämmlein lagert und fromm spielt. Das katholische Christentum wollte nichts vom Menschen, keinen Zwang, kein bißchen Gewalt. Aber die lutherischen Prädikanten schwatzen großwichtig daher von „Überzeugung“ und dem „inneren Glauben“ und was noch, das das Christentum verlange. Verlangen könne man schon, aber wer soll das leisten. Wer hätte denn Zeit für all das Zeug? Wieviel Menschen hätten denn Lust, sich soweit mit diesen hohen und gar schweren Sachen abzugeben; müßten sich ja fürchten, sich daran zu vergreifen in ihrer Einfalt. Da wollte das gute fromme katholische Christentum von seinen Gläubigen nichts als ein bißchen Händefalten, einen sonntäglichen Spaziergang, Geflüster, einen Kniefall.
„Und ist das schwer. Es ist fürwahr nicht so schwer wie diese Säcke zu tragen und daheim sich mit seinem Hauskreuz herumzuplacken. Ein kleiner Spaziergang, o jeh, wieviel mehr verlangen die Herren Richter, die Lehrer in der Schule von einem Kind; solch Kind wird gequält. Ja freilich, man muß manchmal fasten. Das laß ich gelten, es ist nicht jedermanns Sache; aber zehn Heller, zwanzig Heller: ein anderer fastet für dich, oder der Priester erläßt es dir. Das katholische Christentum erlaubt jedem, der ihm anhängt, sich in der erhabensten Gesellschaft der Märtyrer und Heiligen einheimisch zu fühlen. Kein Betrüger kann ein einfacheres und wirksameres Mittel erfinden, um hoch und höher zu kommen; und keiner kann sich ein Ziel stecken, das höher ist. Welche großmächtige Gewalt besitzt die katholische Heilige Kirche. Und gibt es eine Gewalt, die ihre Macht sanfter gebraucht; sie kann im Diesseits und Jenseits die meisten Menschen spießen, sieden, brennen, schmoren lassen. Statt dessen stellt sie ihnen schöne Bilder hin in hohen Gotteshäusern und man braucht sie nur anzugucken. Sie tut Orgeln und die geübtesten feinsten Sänger auf die Chöre, und man braucht sich nur hinsetzen und zuhören; währenddessen hat man nichts nötig als sich das Fluchen und Gotteslästern zu verkneifen, das auch sonst nicht schön klingt. Alles liefert die Kirche den Menschen, sie setzt ihnen reiche, ja königliche Häuser hin. Wenn man es recht betrachtet, was ist denn die Kirche anders als ein Fürstenhof, an dem alle, Bauern Bettler Edle Ritter und Grafen Barone bis zum römischen Kaiser hinauf gleichmäßig geladen sind, um sich zu ergötzen. Jeder kann an ihren Vergnügen teilnehmen, jeder kann sich als Fürst vorkommen, er ist in seinem Haus. Ihr Törichten, was wollt ihr. Ihr braucht nicht beten, braucht euch nicht bemühen. Alles wird euch abgenommen. Wir sind die Schlosser, und die Haustür: Ihr braucht uns nur bitten, wir machen auf. Das Himmelreich kann euch nicht entgehen. Wir haben soviel Gnade geerbt, die Märtyrer haben uns davon hinterlassen, daß wir und unsere Gläubigen bequem Jahrtausende davon in dulci jubilo leben können. Und haben dabei gar nicht nötig, arg Haus zu halten. Wohin sollen wir nur hin mit den ganzen Scheuern der Gnade. Wir werden ja manchmal Lust bekommen, so einem armseligen Protestantlein, das unter dem Tisch hockt, ein Knöchelchen hinzuwerfen. Und Ihr — Ihr könnt nur immer tun, was Ihr wollt. Wer katholisch ist, kann ruhig inzwischen auf Erden seines Weges ziehen. Für ihn ist gesorgt. Es ist alles vorbereitet; er braucht sich nicht drum zu bemühen. Geht hin, wohin Ihr wollt, es nimmt Euch keiner was weg. Ihr habt zu pflügen, zu düngen, das Vieh zu füttern, die Pferde zu striegeln, von den Kindern ist eins bockig, Euer Nachbar zankt mit Euch. Es gibt für Euch soviel schöne und wichtige Sachen, Wein Musik Tanz kleine gelustige Fräuleins Kartenspiele Hahnenschlagen Kirmes. Und die Raufereien und dem Nachbarn die Zähne zeigen. Wir werden Euch nicht stören dabei. Wir hüten schon Euren himmlischen Besitz.“
Der Dominikaner wackelte vergnügt mit dem Finger: „Gell, eine feine Religion? Was sagt ihr zu meiner Religion?“ „Läßt sich hören“, sagten die beiden Bauern. Sie setzten sich zu fünf in eine Mulde des Waldbodens; die Bauern zogen Schinken und Brot hervor. Während die Bauern schmatzend den Dominikaner hießen, noch mehr Späße oder Frommes zu erzählen, schlichen die beiden Männer davon.
Sie kamen in eine öde Gegend.
Einen singenden Bettler fragte der Kaiser, während der andere zurückblieb nach allerhand. Der Bettler führte den Kaiser, nahm, als sie einen kleinen Bergpfad erreicht hatten, Abschied, trabte singend weiter. Den Kopf gesenkt zog Ferdinand des Wegs. Bäume traten auf, ratlos sah der Kaiser zwischen die Stämme. Er erwartete den anderen; wo die Höhle des Einsiedlers, des frommen Jeremias sei, wußte er nicht. Sie setzten sich auf den Boden. Ein kleines Mädchen mit einem Körbchen kam an. Sie gingen ihr nach, eine Waldschneise hinauf. Sie lief über einen Steinhaufen. Als sie zurückkam, gab ihr der Kaiser eine Handvoll Heller; sie möchte dem frommen Jeremias sagen, ein armer Mann begehre zu ihm. Sie lief, und als sie wiederkam meinte sie, der fromme Einsiedler hätte gesagt, er sei selbst ein armer Mann und brauche kein Geld. Ihren kleinen Kopf streichelte Ferdinand; sie möchte die Heller behalten; möchte sie doch noch einmal zu dem Einsiedler gehen; er begehre nach seinem Wort.
Darauf erschien drüben hinter dem Steinhaufen barhäuptig ein schlanker jüngerer braunbärtiger Mann, der lange schweigend ihnen gegenüberstand. Er blinzelte eine geraume Zeit gegen das Licht, hatte eine schrecklich tiefe Blässe des mageren Gesichts. Die Steine rollten; leise fragte er, als sie herangekommen waren, unsicher zwischen beiden hin und her blickend, was sie wollten. Ferdinand stammelte etwas. Der Kammerdiener ging zurück.
Und wie Ferdinand seinen versunkenen Blick zu dem Mann hob, war dessen rechtes Ohr und halbe Wange abgefressen; Stumpfen und Löcher, Geschwüre und Hautfetzen, tiefdunkelrot mit schmierigen Belägen; die Nase des Mannes fein, an einer Nüster angefressen. „Laßt nur,“ winkte Ferdinand, als ihn der Einsiedler vor die stallartige Höhle geführt hatte, „ich will hier sitzen und Euch zusehen.“ Der Einsiedler, nach einigen unschlüssigen Bewegungen, gab ihm einen Rosenkranz in die schlaffe Hand; Ferdinand setzte sich auf die bloße Erde, während ihm die Perlen entrollten. Mit trüben Augen, müdem Ausdruck stand der junge Einsiedler vor ihm, verschwand wortlos in dem Dunkel, aus dem bald ein leises, heftiger werdendes, wieder abschwellendes Gemurmel und Ächzen kam.
Nach zwei Stunden trat der Diener an Ferdinand heran. Der Mönch schoß aus der Höhle hervor. Sie verabschiedeten sich. Voll Wehs suchte der Mönch die Augen des anderen, dessen Mienen sich nicht entspannt hatten. Er gab ihm den Rosenkranz mit, bekreuzigte sich hinter ihm, kniete betend an die Stelle hin, wo jener gesessen hatte.
Der Kaiser kehrte langsam durch die Schneise zurück in den Wald.
Plötzlich war mitten auf breitem Waldpfad ein starkes Flügelschlagen hinter ihm. Er schloß die Augen, blieb stehen, hielt den Kopf steif nach vorn.
Flügelschläge, mächtige Flügel, Flügelpaare, die den Sand peitschten, wehenden Wind vor sich warfen. Er wurde fast nach vorn gehoben.
Er erduldete es einige Sekunden. Zögernd schritt er weiter. Noch einmal gab es ein Wehen, Flügelschlagen von riesigen niedersausenden, sich steil aufstellenden Adlern hinter ihm. Ihm stand das Herz still.
Wie er zehn Schritt weiter gegangen war, sah sich sein völlig versteintes Gesicht nach dem Diener um. Der pendelte ruhig einige Meter über den Weg. Arm in Arm ging er mit dem bestürzten Mann. „Das ist mehr als ein Mensch ertragen kann.“
Die schwedischen Heere über das Reich verstreut. Oxenstirn hielt sie im Zaum. In Thüringen Wilhelm von Weimar, in Bremen Verden Lesley, in Magdeburg Lohausen, in Schlesien Oberst Düwall. Oberrheinischer kurrheinischer Kreis Georg von Lüneburg, Feldmarschall Horn Elsaß und schwäbischer Kreis. Geschleudert war in die Flanke Wallensteins, als er sich regte, der junge Fürst, der einmal Oberst von Gustafs Leibregiment zu Pferde war, Bernhard von Weimar, als Friedland ihnen den Rücken kehrte und glaubte, sie seien in Vergessenheit versunken. Wie die Kaiserlichen hinter den böhmischen Gebirgsmauern verschwanden, fingen die schwedischen Obersten, Offiziere und Gemeine an deutsches Land zu schlucken. Von Bayern, der herrenlosen Kur, Würzburg, Bamberg wurden Stücke abgetrennt, ihnen als Rekompens zugeteilt; Schweden behielt sich die Oberherrlichkeit vor. Dem hochfahrenden Bernhard fiel aus Bamberg und Würzburg ein Herzogtum Franken zu als rechtes Mannlehen der Krone Schweden; er schwur eine ewige und unwiderrufliche Konföderation mit Schweden.
Friedland lag stumm in Böhmen. Da zwang sich, ungewandelt, Oxenstirn die vier oberländischen Kreise unter. Der Sachse, bitter der fremden Herrschaft im protestantischen Direktorium widerstrebend, suchte die oberdeutschen Reichskreise zu sich herüberzureißen, aber Oxenstirn behielt die Oberhand. Zu Heilbronn mußten die Deutschen geloben, die notwendigen Armeen für den Schweden zu unterhalten; Oxenstirn, ein Schwede, setzte sich hin als Direktor des Bundes und oberste Entscheidung in allen Kriegssachen.
Geführt von dem französischen Gesandten, von englischen Herren begleitet, erschien auf diesem winterlichen Kongreß zu Heilbronn eine schwarz verschleierte Frau, glühende Augen, lässige Fülle; sie setzte sich mit Feuquieres auf eine besondere Bank, hörte den Beratungen zu. Dann sprach in langer entschlossener Rede ein kleiner Mensch für sie, Rusdorf. Er schilderte das Schicksal des Pfälzer Kurfürsten, erwählten Böhmenkönigs Friedrich, der wie das Gewissen dieses Krieges gelebt habe. Sein Unglück habe mit dem Prager Treffen begonnen, sei geendet bald nach dem Tod des gottseligen Schwedenkönigs. Er habe gelebt und sei gestorben als guter Deutscher und protestantischer Kurfürst. Seine Sache dürfe und werde nicht mit ihm welken. Dieser Konvent werde nicht umhin können, eine Entscheidung über seine Sache herbeizuführen. Es dürfe nicht scheinen, als hätte man sich des Kurfürsten Friedrich bedient zu eigenen Zwecken, wie die Widersacher verleumderisch in die Welt setzen. In allen, die protestantisch im Römischen Reiche seien, lebe auch fort die hoheitsvolle Gestalt seines Herrn, der am ersten die Schlange beim Kopf gepackt hätte und von ihrem Biß nicht gesundet wäre.
Er blickte, als er sich setzte, die Dame neben sich an. Sie stand kopfsenkend auf, schob den Schleier beiseite. Die evangelische Elisabeth lächelte freundlich und schelmisch verlegen; sie hatte rote runde Wangen wie immer. Sie sagte, ein Kichern kaum unterdrückend, der gelehrte Herr Rusdorf habe wohl und genugsam gesprochen; sie freue sich, die Herren wiederzusehen, die ihrem seligen Gemahl nahegestanden hätten und oft ihre Gäste gewesen wären. Darauf, schweigend und von unten blickend stärker in den Saal lächelnd, weil sie einzelne Edle erkannte, drückte sie plötzlich seitlich gewandt, die Rechte ausstreckend, dem Feuquieres die Hand, der verständnisinnig nickte, nach ihr sich erhob und eine feine prahlende sentimentale Rede losließ, die den tapferen Friedrich feierte und als ein Hauptziel des Krieges bezeichnete sein Haus wieder einzusetzen und sein Schicksal zu rächen.
Trotz schwedischen Widerstrebens kam nach tagelangem Diskutieren ein Beschluß zustande, besonders auf Drängen des Franzosen, der den Schweden nicht das Zuviel an Macht gönnte. Die deutschen Stände verlangten, von Rusdorf gejagt, diesen Beschluß; sie wollten auch irgend etwas erreichen. Dem Gefolge Oxenstirns war bekannt, daß hinter diesem ganzen Überfall mit dem Erscheinen der Kurfürstin und dem Eingreifen des Franzosen nur Rusdorf steckte; Rusdorf wußte, daß sein Leben bedroht war, aber tapfer agitierte das ergraute Männchen hinter den Deutschen, trug den vornehmen Franzosen jeden neuen Winkelzug zu. Es wurde den Schweden abgerungen die eroberte Rheinpfalz; sie war sofort dem Hause Friedrichs zu übergeben. Nicht entringen ließen sich die Schweden die Kontrolle über die Festungen und über das Kirchenwesen. Laut sagte Rusdorf bei der Verkündung des Beschlusses, daß er ihn als Vertreter des pfälzischen Hauses annehme. Für den Augenblick gebe man sich damit zufrieden. Er werde aber nicht ruhen, bis auch die letzten Einschränkungen gefallen seien. Als er im Begriff war zu erklären, daß der Beschluß bei dem Widersacher ein hämisches Lachen über die Uneigennützigkeit der Fremden auslösen werde, drückte ihn begütigend Feuquieres auf die Bank; die Schweden hatten ihn schon verstanden.
Trauerreich und glückvoll war die Einreise der Kurfürstin und des Bruders Friedrichs, eines phlegmatischen Philipp Ludwig von Simmern, in die schöne sanfte Pfalz. Und als sie zum erstenmal den Neckar mit seinem blanken flachen Spiegel wiedersah, an die prunkvolle Fahrt mit Friedrich in dem Brautschiff dachte, und an das jäh sich erhebende niederknatternde Unglück, Prag, Dänen, Schweden, Krieg, endloser Krieg, sie alle gepreßt, jahrelang gewalzt, verblichen der feine von ihr fast übersehene Friedrich, da weinte sie hysterisch, wollte stundenlang nicht weiter fahren, verlangte nach England, zu ihrem Bruder, dem König Karl. Sie wollte nichts wissen von diesem Deutschland. Auch Rusdorfs Herz war erbebt beim Anblick der dunklen Platte des sich hinschlängelnden stillen Neckars. Er besänftigte sie; erzählte sich bezwingend von den schönen Gemächern, die sie erwarteten. Mit Mühe konnte er sie später abbringen vom Jammern um die zerschossenen eingeäscherten Flügel des Schlosses. Er selbst in Freude erweichend, lief über die Dörfer, setzte die Amtsleute ein, knüpfte alle Fäden. Schrieb an seinen alten leidenden Freund Pavel, der in den Niederlanden saß, lud ihn zu kommen, des Grams ein Ende zu machen; bald werde die Kurpfalz von allen Fremden befreit sein. Er lobte neckisch seine eigene Zähigkeit, die er mit der Art einer Bremse verglich.
Genau einen Monat nach seiner Rückkehr auf Heidelberg wurde er an der Tür seines Quartiers angenagelt gefunden. Er lebte noch, als man ihm unter furchtbaren Schmerzen die Nägel aus den Handtellern gezogen hatte; die aus den Füßen konnte man nicht herausreißen, sie waren durch die Knochen getrieben. Es war schwedische Arbeit, wie er sterbend angab; er bat, die Sache nicht zu verfolgen, sie sei aussichtslos. Pavel fand ihn nicht mehr lebend vor. Die Beisetzung seines Freundes übernahm er. Viele hohe Herren der rheinischen Kreise, auch fremde, waren zugegen; sie lobten den kleinen entschlossenen Mann, beklagten seinen überraschenden Tod. Die Gerüchte über die Todesart wurden unterdrückt.
Pavel bat sich die Tür aus, an der sein Freund gehangen hatte. Er überlegte lange, ob er der Kurfürstin und dem Administrator nachgeben sollte und Nachfolger Rusdorfs werden. In den Papieren Rusdorfs fand er dann Aufzeichnungen, aus denen hervorging, daß Rusdorf selbst es war, der ihn damals in Wien fast ermordet hatte, aus Scham und in Sorge um ihre Aufgabe. Aus Briefen mit einem Prädikanten, den der Tote eingeweiht hatte, ging hervor, daß er lange verfolgt war von dem wahnhaften Gedanken, Pavel wirklich ermordet zu haben, und dagegen Hilfe suchte.
Den Kopf senkend erklärte sich Pavel bereit, an die Stelle des Toten zu treten.
Die Gerüchte, daß der Herzog zu Friedland an der Spitze einer großen Armada plane vom Kaiser abzufallen, überall verbreitet, erregten die böhmischen landflüchtigen Exulanten und die Unruhigen in Prag und auf dem Lande. Niemand verstand diesen Mann, der offenbar die Sachsen ins Land gelockt hatte, sie dann heraustrieb, mit Graf Thurn konspirierte, ihn gefangennahm, freiließ. Von dem Dresdener Komitee wurde Sesyma Raschin, der schwarzhaarige Fanatiker, zum Herzog beordert. Er traf in Prag die wohlbekannte Situation an: das Heer ringsherum in Winterquartieren, im Hauptquartier scharfe Tätigkeit für neue Werbungen, Finanzpläne. Eine Anzahl neuer Gesichter in der Umgebung Friedlands; Schweden Franzosen Sachsen im Palast aus- und einkehrend.
Raschin wurde vorgelassen; mißtrauisch horchte ihn der Herzog aus. Er hatte geglaubt, der Kundschafter käme vom sächsischen Hofe; als er von Böhmen hörte, schimpfte er; ob wohl der alte Narr Thurn, das Großmaul, dahinter stecke. Wieder und wieder versicherte Sesyma, daß im Lande alles vorbereitet sei, gespannt auf ihn warte, daß die Schweden ihm behilflich sein würden; man hätte gute Kunde von Bernhard von Weimar, daß er dem Herzog zu Friedland wohl vergönne, sich in den Besitz Böhmens zu setzen. „Ihr Schelme allesamt,“ keifte Wallenstein, der nur aus einem Auge blickte; das andere, gichtisch entzündet, war mit schwarzem Tuch dick verbunden, „ihr haltet mich für eine Leiche, daß ich euch für alle Gaunereien gut genug dünke. Macht eure üblen gefährlichen Geschäfte allein; seid wohl schon tief im Morast, daß ich euch herausziehen soll.“
Sesymas Audienz war kurz; als er sogleich, schwer gekränkt und enttäuscht abziehen wollte, wurde er vom Grafen Trzka und einem Grafen Kinsky am Arm gefaßt und im Schloß festgehalten. Sie erwiesen sich als orientiert über das Vorhaben Raschins, schienen auch genaue Kenntnis über die friedländischen Pläne zu haben, baten ihn, zu verweilen, sei alles im Fluß, es dränge dem Frieden zu, er möchte nicht Mißstimmung unter die Böhmen und nach Sachsen tragen. Graf Kinsky erzählte heimlich dem jungen aufhorchenden Böhmen, er möchte nicht darüber sprechen. Auch von französischer Seite habe man dem Herzog das Königreich Böhmen angetragen, Sesyma möchte sich im Hintergrund halten, der Herzog schwanke, man wisse nicht genau, womit er umgehe. Daß er dem Kaiser böse wolle wegen seiner Absetzung sei sicher; es drehe sich nur darum, ihn, den Herzog in die Zange zu bekommen, daß er sich nicht rühren könne, ihn aus seinen Zweifeln zu lösen. Die Stunde der Schilderhebung rücke näher. Sesyma war über diese Neuigkeiten sehr beglückt, fragte, wie man denn den Herzog in die Zange kriegen werde. Das sei nicht einfach, meinte Kinsky, der ein schlauer eitler älterer Kavalier mit blassem bartlosen faltigen Gesicht war, es gehe darum — nun, dem Herzog zu helfen; Friedland schwanke, das müsse man ausnutzen, man muß es dahin bringen, daß die kaiserliche Sache für ihn ganz unannehmbar werde, dann gäbe es kein Besinnen mehr. Raschin merkte auf; staunend äußerte er, das sei aber ein hohes Spiel. Selbstgefällig Kinsky kichernd: was hohes Spiel; er sei in Paris zu Hause, in Fontainebleau ginge er aus und ein; beim Pater Joseph und dem großen Kardinal würde ganz anders gespielt, schlau, mutig und — gottlos. Darüber freute er sich sehr: gottlos, ja so seien die französischen Diplomaten, aber das sei die wahre, rechte, die einzige Schule. Und er gab dem Böhmen den Rat, sich nicht zu oft vor Wallenstein blicken zu lassen, am Hof zu bleiben, in Böhmen und Sachsen ruhig alles weiter betreiben, als werde der Herzog ihnen zufallen. Beim Abschied flüsterte Kinsky, die Augen aufreißend und drehend, er könne ihm noch nicht alles verraten, aber der Herzog sei ihnen sicher; „sucht Euch schon jetzt ein Stück aus Niederösterreich oder Steiermark aus; was haltet Ihr von Graz? Appetitlich, appetitlich, gelt?“
Kinsky, der ein Schloß in Teplitz besaß, verbannt war, zwischen Pirna und Paris vagierte, die französischen Verhandlungen Wallensteins führte, machte es sich zum Ehrgeiz vor den Herren in Fontainebleau seine Sache zu einem glänzenden Abschluß zu bringen. Reich wie er war, steckte er sich die französischen Dukaten ohne Dank in die Tasche; seine Arbeit war mit nichts zu hoch bezahlt. Den Herzog vom Kaiser abbringen: eine famose Aufgabe, und dabei gar nicht schwer; er war nur ein Glückspilz, daß ihm das zugefallen war. In den Konventikeln der konspirierenden Edlen ließ er sich feiern; hin und her geschleudert war man von den Ereignissen; man rüstete, opferte für Waffen und heimliche Anwerbung große Summen; der Augenblick des großen Schlages rückte näher, der Bezwinger der Dänen und Schweden, Friedland, hatte ihre Sache zu seiner gemacht.
Als der Herzog Kinsky den sonderbaren Brief Slawatas gab, wonach dem Herzog von Wien Gefahr drohte — Wallenstein nickte finster: „vielleicht hat mein Vetter selbst etwas gegen mich vor“ — erwog Kinsky für sich: es wird schon etwas dran sein an dem, was ihr alter Freund Slawata schrieb. Er kam, liebäugelnd mit seinen Gedanken, auf den genialen Einfall, mit dem Grafen Slawata, kaiserlichen Geheimen Rat, eine private Korrespondenz zu beginnen, ihre alte Bekanntschaft zu erneuern. „Ich treibe meine eigene Politik“, sagte er entzückt zu sich, als er den ersten schwadronierenden Brief nach Wien losließ, erklärte sich für einen besonderen Intimus des Generalissimus. Er gedachte Tropfen um Tropfen Gift in Slawatas Ohr zu träufeln, bis er den Herzog unmerklich soweit hatte wie er wollte und der Herzog gebunden wäre. „Wir werden sie kriegen,“ seufzte er glückstrahlend sich in seinem Klingenbeschlag spiegelnd, „wir werden sie kriegen. Die Herren an der Seine werfen sich zu sehr in die Brust. Es ist nicht nötig. Es ist überflüssig, meine Herren; habt nur etwas Geduld.“ Lautsprechend erhob er sich von seinem Schreibkabinett, schneidender Ton in der Stimme: „Der Kardinal von Richelieu, Armand de Plessis, der Pater Joseph! Sieh da, wohlan, sieh da.“
In dem Augenblick, wo der Herzog seine Neigung offenbart hatte, mit den Widersachern in eine nicht genauer bestimmte Verbindung zu kommen, hatte es in seiner Umgebung zu wallen begonnen. Aus bloßen Dienern und Schleppenträgern wurden Akteure, die sich mit Röllchen und Röllchen nicht begnügten, Lust bekamen, sich zu emanzipieren und um sich Zirkel zu bilden. Man trat von außen an sie heran, lockte sie, das Geld lockte, die Eitelkeit lockte, der Wunsch einander den Rang abzulaufen. Immer stieß der Friedländer mit gewaltiger Faust dazwischen; rasch wie nach einem Platzregen ebnete sich wieder die Erde, der Schwarm schloß sich, wogte um ihn. Er brauchte sie, keine geschriebene Zeile gab er von sich, die Menschen schwatzten.
Der blonde naive Graf Trzka hatte sich erhoben; er riß in diesem schweren schwingenden Winter an Arnim, dem sächsischen Feldmarschall. Erst saß er in Arnims Quartier, suchte ihn zu verlocken, zum Herzog überzugehen, ohne den Kursachsen zu befragen, da Wallenstein vorhatte vom Kaiser abzuziehen. Davon wollte Arnim gar nichts wissen; er ruhe im Vertrauen seines kurfürstlichen Herrn und werde es nicht täuschen; und dann fand er, daß Friedlands Verhalten im vergangenen Sommer und Herbst nah an Betrug gegrenzt habe; es sei alles schon leidlich im Wege gewesen, als Friedland Zwang üben wollte. Sachsen habe er verwüstet; die kursächsische Durchlaucht habe einen Eid von einigen tausend Sakramenten geschworen nach den geschehenen Untaten, sie wolle nichts mehr von solchen betrügerischen Traktaten wissen. Als Trzka überlegen lächelte, den Kopf schüttelte, geschickt die letzten Daten zusammenstellte, wonach Wallenstein fast nichts übrig bliebe als vom Kaiser abzufallen, nichts übrig, ja, daß Wallenstein entschlossen, vielleicht gezwungen sei in Kürze mit offenen Karten zu spielen, erklärte sich Arnim, immer dem Herzog im Innern anhängend und ihn verehrend, bereit, Trzka weiter zuzuhören und faßte ihn fast ängstlich bei der Hand.
Er möchte, bat der Böhme, doch dem Herzog als erster nachgeben. Man stehe sich zweifelnd gegenüber, könne nicht von der Stelle; peinvoll sei die Situation des Herzogs, wenn er den ersten Schritt tun solle, der doch für ihn der einzige wäre: zum Sachsen gehen, die Heere zusammenwerfen. Hinter Wallenstein stünde nichts, kein ererbtes anhängendes Land; er sei im Moment vogelfrei; man müsse sich in ihn versetzen, und wer kenne nicht seine Wut auf Wien.
Leidenden Herzens folgte Arnim dem geschickten Unterhändler, suchte seinen Kurfürsten auf. Vor dem jovialen dicken Herrn und seinem spitznäsigen Kammerdiener keine Andeutung von den friedländischen Machenschaften. Arnim hätte alles riskiert; ein Untergebener, der mit seinem Gehorsam spielt, war Johann Georg ein abscheuliches verächtliches aberwitziges Vieh. Unaufrichtig brachte Arnim vor, was er wollte: er fühlte sich gezwungen und verstrickt in das friedländische Netz. Nach Ringen und Würgen gewährte mißlaunig Johann Georg ein neues Verhandlungsrecht; aber daß Arnim das Heer nicht in mißliche Position brächte. Ihn hatte das brutale Vorgehen der Schweden in Heilbronn, die Übervorteilung der wehrlosen Pfälzerfamilie heftig gekränkt; er wollte ab von Schweden. Wieder hoffte er, mit seinem gnädigen Herrn, der erwählten Römischen Majestät, in fürstlich treue Verbindung zu kommen.
„Her, her!“ schrie Wallenstein, der völlig blind auf einer Bank inmitten der Ritterstube saß, die verdunkelt war; beide Augen lagen unter heißen Tüchern, die der stille Doktor Ströpenius sehr oft am Ofen wechselte; „seid Ihr allein, Arnim, wer ist mit Euch?“ Da war noch der rotbäckige muntere Oberst Burgsdorff, ein Brandenburger. Das erfreute den Herzog; er nannte sich ein geblendetes Huhn, das auf einmal zwei Körner gefunden habe. „Aber will Eure fürstliche Gnaden uns picken?“ — Nein, er vermöchte zur Zeit nicht gut den Schnabel zu führen, die Schelmereien säßen ihm in den Augen und Füßen; ob sie nicht wüßten, daß der Kaiser vorhabe, ihm einen Strick um das Bein zu legen, damit er nicht zu ihnen schwenke. — Sie kamen auf die Friedensbedingungen, die Wallenstein entworfen hatte. Rittmeister Neumann las vor: die böhmischen Aufständischen sollten amnestiert und entschädigt werden, die Jesuiten heraus aus dem Reich, Religionsfreiheit, Rekompens an die schwedische Krone.
Burgsdorff, Arnim anstoßend: das sei recht schmackhaft, aber man sei nicht sicher, daß so aufgetafelt werde. — Warum nicht. — Wegen des katholischen Satzes: dem Ketzer sei keine Treue zu halten. „Gottes Schand’. Wie bin ich den Hundsfotten, den Jesuiten gram, die das Wort aufgebracht haben. Ich wollte, der Teufel hätte sie geholt, wollte sie ihm nicht aus dem Rachen ziehen. Gott soll kein Teil an meiner Seele haben, Ihr Herren, wenn ich anders meine. Und will der Kaiser nicht Frieden, so will ich ihn dazu zwingen. Und der Bayerfürst hat das Spiel angefangen. Ihm soll das Land ruiniert werden, daß weder Hahn noch Henne noch Mensch drin zu finden ist. Denn ich will einen ehrlichen beständigen aufrichtigen Frieden im Reich stiften.“
Das befriedigte sie beide sehr. Sie fixierten gemeinsam mit Neumann, rittlings auf ihren Schemeln sitzend, die Punkte auf ihren Schreibtafeln.
Friedland bot indessen, den Ströpenius am Hals umschlingend, mit ihm durch den Saal tappend, ein sonderbares Bild. Er schien, den grauen unordentlichen Kopf vorgebeugt, durch die Tücher gierig sehen zu wollen. Es machte auf die beiden fremden Herren einen schrecklichen angsterregenden Eindruck, wie er an den Wänden entlanggeführt, den Unterkiefer herabgefallen, sich nach dem Schall orientierte, den vorgestreckten Kopf hindrehte. Man sah ihm in den roten Mund, fast in den Rachen; die geschwollene Zunge lag und wälzte sich im nassen Speichel. Er sprach mit schwerer schnarchender Stimme; sein Gesicht lang, Mulden an den Schläfen Wangen. An den Tisch geführt, stehend an der Kante sich haltend, fragte er stolz und hämisch knurrend, was die Herren von seinen Vorschlägen hielten. Sie gaben schreibend zurück, es sei gutes Fahrwasser. — Das solle es wohl sein. „Machen wir uns keine Sorge, was die andern denken. Wer viel fragt, kriegt viel Antwort.“ So blieb er stehen, horchte wie sie schrieben. „Was haltet ihr von den Türken,“ fing er plötzlich an; „man soll sie nicht aus den Augen lassen. Wir zanken uns hier alle auf dem Ätna. Dem Schweden ist der Türke nicht grün gewesen, wie er einen Gesandten hingeschickt hat. Die Römische Majestät fand ihren Gesandten auch nicht besser empfangen. Der Großherr ist uns allesamt nicht grün. Der hat seine Lust an unseren Kriegen.“ Und dann marschierte er wieder herum mit Ströpenius, schwadronierte von der gemeinsamen Christenfront gegen den Sultan; das würde ein Spaß werden; die Kreuzzüge seien der europäischen Christenheit noch immer im Leibe; er warf mit Angriffsplänen um sich. Wie sie sich verabschiedeten, forderte er Trzka vor sich.
„Bist du da, Trzka?“ tastete er sein Gesicht. „Die Bürschchen, die Bürschchen. Dem Ketzer ist keine Treue zu halten. Dazu ist es Not Ketzer zu sein. Es geht sogar gänzlich ohne Taufe, hoho. Das sind Helden. Wir führen Krieg, ich stell’ ihm ein Bein, und das ehrbare Fräulein seufzt: ‚das schickt sich nicht; ich hab’s nicht so gelernt; bei der Muhme Ulricke ging’s anders zu‘.“ Trzka wollte Neumann entfernen; Wallenstein, der es merkte, donnerte: „Das ist mein Blut, laß ihn, befiehl ihm nichts. Setz’ mich, Ströpenius. Was willst du sagen, Trzka.“ Er donnerte in falscher Richtung.
Das Lager bei Pilsen. Um die Mauern Holzhütten Zelte Höhlen Gehöfte, in die Nachbardörfer übergehend, meilenweit ausgedehnt, Stoppelfelder Gehölze zwischen sich fassend. Nahe der Stadt von Sümpfen umgeben, durch Gräben Wolfsfallen abgegrenzt, nur auf Brücken zugänglich die Artillerie, lärmende qualmende Schmieden, wandernde Posten, Kanonenrohre auf Wagen, auf Heu, von Segeln überspannt, einsam schwarze Kugelhaufen. Vor den Hütten kriechende schleppende reitende Söldner, über die Ziehbrunnen schwärmend, schimpfend, Ochsen und Schweine treibend. Übende Fähnlein von Musketieren; Weiber vor Hütten und Erdlöchern an Feuern, kochend, lachend, im Geschrei mit Kindern. Hohe breite Reisewagen, leinenüberzogen, von Reitern eskortiert, über die Äcker in der Anfahrt auf Pilsen, mit Offizieren.
In der kalten Morgensonne trugen schläfrige Stückknechte auf den Schultern Bandhacken, langstielige Ladeschaufeln, Hebebäume nach dem Artilleriepark herüber. In kleinen Verschlägen klöppelten Tischler an Spannbänken für die Sehnen der Armbrüste. Von Zeit zu Zeit wütendes Gekläff, gelle Menschenrufe.
Musik; Kompagniefeldspiel im langsamen Schritt von der Stadtmauer herüber; baßtiefe Soldatenstimmen: „Wir zogen in das Feld, wir zogen in das Feld, da hatten wir weder Säckel noch Geld. Wir kamen vor Siebentor, wir kamen vor Siebentor, da hatten wir weder Wein noch Brot. Wir kamen vor Friaul, wir kamen vor Friaul, da hatten wir allesamt leeres Maul. Strampe de mi, strampe de mi, alla mi presente, al vostro signori.“ Der Fähnrich spazierte neben dem federwallenden Hauptmann, die Rennfahnen am Gürtel vor dem Bauch aufgestemmt, lange Stange mit steifem Blatt, darauf das bunte Wappen des Hauptmanns, junge Vögelchen aus einem Neste die Hälse reckend. Der Hauptmann ging in ein kleines Haus am Weg, die Kompagnie löste sich.
Drei Musikanten spielten vor dem Häuschen weiter, Schellenspieler Trommler Pfeifer, zierlich die Beine lüpfend, bekleidet mit bauschigen Hosen bis zu dem Knie, mit langen seitlich fallenden Schleifen bebändert; an den Füßen spitze Schuhe mit Band und Schnalle. Sie trugen auf den Köpfen große breitrandige Hüte mit Puscheln. Kinder und Hunde liefen um sie.
Dem Trommler hing über der rechten Schulter der knopfbeschlagene Ledergurt, daran die Trommel vor dem linken Bein. Während die eine Hand lässig auf dem blitzenden Trommelrand lag und fein, wie unwillkürlich, Wirbel rollte, lauter leiser wie eine gurrende Nachtigall, hob sich die andere rechte elastisch mit wippenden Bewegungen, warf knappe Schläge hin. Unentwegt die linke; die rechte schloß ihren langziehenden Wirbel manchmal an, wie mitgerissen, dann prasselte rasselte sie über das Fell, daß der Trommelsarg über dem angehobenen folgsamen Knie schütterte und ihm bis in die Zehen der Wirbel drang. Er lächelte, seine Augen zuckten. Der Schellenspieler war ein blitzjunger Mensch. Er hielt die linke Hand sanft in die Hüfte gestemmt. Die fliegende Seidenschärpe wehte nach rückwärts um ihn. In der rechten Hand trug er den meterhohen Stock, an der Spitze ein blinkender Stern mit Glöckchenbehang. Er sah, als wenn er vor niemandem spielte, schweifend über die Kinder, schien von nichts gefesselt zu werden. In einer Pose, in die er sofort mit Anmut versank, stand er fest, nichts bewegte sich an ihm, nicht Kopf, Fuß, Rumpf, nur zwei Augen, ihre Lider und der rechte Arm. Und auch der war meist an den Rumpf gedrückt, der Unterarm angehoben; spielendes Handgelenk. Mit den kleinsten Rucken Drehungen wußte er den Schellenbehang zum Zwitschern Klingen Klappern, stolzen lockenden Schmettern wie aus tausenden Vogelschnäbeln zu bringen; und wenn er seinen Stock wie eine Fahnenstange hochschwang, die Beine wechselte, senkte er den Kopf, blickte trotzig auf seine Schuhspitzen. Der Pfeifer führte sie. Am Bandelier zur Rechten hing ihm die Gabel herab. Er ruhte nicht, folgte selbst seiner Melodie. Sein Mund, seine laufenden Finger ergingen sich, spreizten sich, drückten sich an das runde Rohr. Sie erregten, besänftigten es liebevoll wie ein Tier. Schmachtend blickte er aus schwarzen Augen.
Unter trübem Regen- und Schneewetter kamen nach Pilsen gefahren Graf Schlick und Questenberg. Sie hatten am ersten Tage einen Besuch des liebenswürdigen Grafen Trzka und Rittmeisters Neumann zu überstehen, die sich im Auftrage des Generalhauptmanns nach Quartier und Befinden, ersichtlich auch nach ihrem Vorhaben erkundigen sollten. Vor den Generalhauptmann von Trzka geführt hatten Schlick und Questenberg die gleiche schreckliche Empfindung wie einmal Kaiser Ferdinand: daß dieser Mann gegen den Tod rang, der ihm schwere Gewalt antat. Jede Bewegung stieß eine Hemmung nieder; wund die Gelenke, trocken der Körper; Wein und Wasser schüttete der Herzog in sich hinein; es verdampfte wie auf einer heißen Pfanne. Aber keine Spur von Hilflosigkeit, Verbitterung; nur häufiger als sonst Wut und knirschende Ausfälle. Questenberg sah erschüttert, wie er seinem alten Gönner die knochige schwache Hand drückte und streichelte, daß Wallenstein blind war für das, was ihm geschah.
Der trübe bigotte Schlick gesackt in lauernder Stumpfheit auf dem eigentümlich hohen Schemel, den man ihm zugeschoben hatte. Ein holländisch gebautes Gemach in dem Pilsener Wohnhaus; mattes Tageslicht aus vielen niedrigen Fenstern, weißrote Steinfliesen am Boden, Schiffsbilder über der dunkelbraunen Wandtäfelung, auf dem viereckigen grünverdeckten Tisch Äpfel und Weintrauben in Glasschalen. Im Hintergrund in die Wand verschoben niedrig riesig ein Bett, darüber ein grünseidener flacher Himmel. Vor dem Bett der Herzog, verwittert, zittrig, Wein im Becher neben sich, allein auf der Bank. Er vor dem Bett erkundigte sich, seine Lippen auffallend schlaff und lang, die Augen rot und vorgetrieben, mit alter geräuschvoller Heftigkeit nach dem Befinden der Herren, ihrer Reise, der Römischen Majestät, der er bald wieder eine Aufwartung zu machen gedächte. Und ob es wahr sei, daß die Majestät sich von den politischen Geschäften zurückzuziehen gedächte. Schlick sprach von einfältigen Geschichtenträgern. — Der Herzog sich anlehnend: so, der Kaiser betriebe also die Geschäfte wie zuvor, bekümmere sich, nähme an den Beratungen teil. — Schlick sehr ruhig: wie sonst. — Das sei herrlich. Denn er hätte sich Gedanken gemacht, wie sie einem kommen könnten, der weit vom Schuß sei. Es sei auch Art der Römischen Majestät gewesen, an ihn persönlich ein Brieflein mitzugeben, wenigstens sonst — oder trügen sie es vielleicht noch bei sich und hätten es vergessen. — Nein, sie hätten vom Kaiser keinen Brief; es sei alles mündlich beredet. — Darauf langes Schweigen, Graf Trzka trat neben die Bank des Herzogs. Der blitzte den Grafen Schlick an. Nach Austausch eines Blickes mit Schlick erörterte Questenberg die schwierige finanzielle Lage des Erzhauses; fast demütig schließlich die Frage: ob sich das Heer nicht besser etwa in Thüringen finden würde, damit die Erblande sich etwas erholen könnten. — Ob dies vom Kaiser stamme. — Es sei in mehreren Beratungen des Hofkriegsrats und des Geheimen Rates besprochen worden. — Der Herzog ohne die Augen zu erheben: also welche Quartiere sie für ihn vorhätten. — Wie gemeldet, Thüringen. — Sie wüßten, es stünde ihm frei nach seinem Vertrage sich die Erblande zum Rückzug zu nehmen. — Es sei ein Wunsch, sie wüßten es. — Man habe nicht vor an dem Vertrag zu rütteln? Er fixierte beide scharf. — Keineswegs; ein Wunsch. — „Man wird mich nicht mit einem Vertrag aufs Glatteis locken und im entscheidenden Augenblick mir ein Bein stellen.“ Darum: er werde es sich überlegen. — Schlick immer gleichtönig: es käme nicht auf vierundzwanzig Stunden an; sie könnten einige Tage in dem artigen Städtchen verweilen. — Wallenstein: er werde ihnen im Lager Unterhaltungen verschaffen, italienische Sänger, Schlittenfahrten, wenn das Wetter es gäbe. — Schlick kalt: er sei ein alter Mann; führe nur Befehle aus. Und es sei ihnen schließlich nicht unangenehm, einige Tage im Lager zu verweilen. Sie hätten Lust die neuen Offiziere kennen zu lernen, welcher Geist in den jüngeren Generationen stecke; man belebe sich gern an ihnen. — Questenberg spie plötzlich, aufstehend; er hasse den Schreibbetrieb aufs Blut; wolle nicht gar so tief in das Lager blicken; bekäme vielleicht Lust, wieder die Pike auf die Schulter zu nehmen. — Der Herzog knurrte ihn freundlich, leicht höhnisch an: wem ginge es nicht so; aber schließlich seien schon bald dreizehn Jahre um, daß man sich herumbalge. Werde er nun sehen und sich angelegen sein lassen, den Krieg zu beenden. — Questenberg freudig: dazu möchte Gott seinen Segen geben.
Runzelte Schlick seine niedrige Stirn, schob den Kopf in die Höhe, den Hals reckend, wie ein Laternenträger, der das Licht an der Stange anhebt: so reiche sein Verstand nicht soweit, er sähe noch kein Ende des Krieges; würden alle Schlachten geschlagen sein, damit am Schluß die Feinde triumphierten und sich freuten, so gut davongekommen zu sein. — O, o, lächelte der Herzog, der Herr Graf sei schon lange nicht an der Spitze einer Armee gestanden. — Er denke schon, saß Schlick da, daß seine Erfahrungen ausreichten. Der Krieg gestern sei nicht anders als der vorgestern. — Nein — der Herzog — nur die Bleiplatten an den Sohlen, mit denen man zur Schlacht gehe, seien schwerer geworden. — Mit Bleiplatten, Schlick stärker grollend, könne man auch am Fleck stehen bleiben. Mit Bleiplatten könne man ein Heer zu Hause behalten. Mit Bleiplatten brauche man kein Heer. — Immer abgekühlter freundlich der Herzog: Es sei auch unter Umständen das Beste. — Dann brauche man eben kein Heer. — Eben. — Dann, dann — Schlick mit sich ringend, zum Wutausfalle bereit — sei ja alles überflüssig, alles. — Ihr meint, ich auch. — Wartend der andere, dumpf erregt, ihn anglotzend. — Wallenstein stieß ein Lachen heraus: „Wovon wir da reden. Was meint ihr, Questenberg, Trzka. Wir sind Schuhmacher; wir reden von Bleiplatten an den Sohlen.“
Der mit Silber und Samt ausstaffierte sporenrasselnde Trzka warf an den kleinen Fenstern wandernd erregt seine Locken; lachte mit unnatürlich starrem Gesicht und feuchten Augen, den Herzog willkürlos nachahmend: die Bleiplatten; er kenne ein Märchen, ob er es erzählen dürfe.
Mit fast gehässigem Blick auf ihn sank Schlick in sich. Wallenstein schluckte Wein, krächzte: nur reden sollte er; die Herren würden es gern verstatten. Müßte aber spaßig sein.
„Es gibt einen Schwarzspecht, man findet schwer den Baum, wo er nistet. Hat man den Ort gefunden, so muß man ihn sich merken und warten, bis das Vöglein brütet. Und wenn die Brutzeit vorbei ist, soll man hinauf, wenn der Vogel aus ist, die Öffnung verspunden. Der Specht kommt wieder, und sobald er merkt, die Öffnung ist verspundet, fliegt er fort, halbe Tage lang und sucht und findet einen Ort, da wächst ein Kraut, das heißt Springwurzel, und bringt es. Rasch soll man auf eine Leiter vor das Nest, ein rotes Tuch vors Gesicht gebunden, einen kleinen grünen Wedel in die Faust, und immer nicken, nicken damit und mit dem Fuß klappen, als täte er’s selbst am Baum. Dann erschrickt der Specht, weil er glaubt, es seien seine Jungen ein so närrisches entartetes Volk, und es gehe ein Zauber um, schreit, läßt die Springwurzel fallen, schreit nochmal, flattert davon. Das Kraut aber soll man mit dem roten Tüchel vom Boden aufheben und sorgsam bewahren und einwickeln, man kann damit verschlossene Türen öffnen, Geleimtes Gelötetes lösen, Ketten sprengen.“
Trzka lachte heiser, erregt nach vorn gebeugt zum Grafen Schlick herüber: „Ich bin schon fertig.“ Wallenstein: „Habt Ihr solch Kraut, Trzka?“ „Nein, Eure Durchlaucht. Ich nicht. Vermute aber, des Grafen Schlick Liebden sei in solchem Besitz und Vermögen. Hat er doch etwas mit den Bleiplatten vor, die Eure Durchlaucht an den Füßen tragen.“ Schallender Lachausbruch Trzkas, zusammentönend mit Friedland und Questenberg. Trzka stammelnd: „Und da ich soviel von solchem Wunderkraut gehört habe, hätte ich gern gesehen, wie es sich besieht und befühlt. Muß gar artig und klein sein, da es schon solch winzig Tier im Schnabel führen kann. Möcht’ gar sehr darum bitten, es mir zu zeigen, wenn Ihr’s im Sack tragt.“ Stöhnend hielt Wallenstein im Lachen sich die Rippen; dann mit den Armen abwinkend: „So laßt den Herrn Bruder zu Wort, so redet nicht. Ich bin gar begierig.“
Das phlegmatisch schwere Wesen schien von der Unterhaltung wenig berührt. Er wüßte nicht, worauf des Herzogs Durchlaucht so begierig wären; hätte er und Questenberg schon alles berührt, was sich sagen ließe; vermißten sie doch nur das Wort Wallensteins. Trzka fast triumphierend: „Ihr habt es berührt, daß die Armee sich nicht genug schlage.“ „Berührt, gesagt, als Auftrag und als eigene Meinung.“ „Das ist es ja. Und so müßt Ihr doch die Wurzel bei Euch haben, mit der Ihr den Herzog, meinen Schwager, springen machen wollt.“ Schlick stand drohend auf: „So muß ich Herzogliche Durchlaucht fragen, mit wem ich verhandle, ob mit dem Generalfeldhauptmann oder mit dem Herrn Grafen, des Herrn Schwager.“ Da hatte Wallenstein einen langen scharfen Blick auf Trzka und den Grafen Schlick gerichtet. Leise bat er seinen Schwager die Possen zu lassen. „Die Auffassung in Wien ist,“ Schlick, „daß die Kaiserliche Majestät ein großes Unrecht tat, als sie den bayrischen Kurfürsten hilflos im Stiche ließ gegen den Schweden. Es hat sich das Gewissen bei uns geregt, stärker und stärker, in Anbetracht der großen uns von Wittelsbach zuteil gewordenen Wohltaten, die im ganzen Reich bekannt sind, daß wir nicht zusehen können, wie er die Beute des Feindes wird. Er hat dem Erzhause in Böhmen und bei tausendfältiger Gelegenheit anderer Art geholfen aus dringender Lebensgefahr. Das soll von einem edlen Kaiser unvergessen bleiben. Auch der Geheime Rat hat sich diesen Bedenken nicht entziehen können. Und so ist nach vieler Überlegung beschlossen worden, unverzüglich Eurer Herzoglichen Durchlaucht Entscheid auf Beschleunigung der Kriegshandlungen herbeizuführen.“ Leise Wallenstein: „Genug, Herr Bruder. Was wollt Ihr.“ „Die Winterquartiere müssen abgebrochen werden; Euer Heer ist kaum geschwächt; der Abbruch des Angriffs auf Regensburg hat die ganze Welt verblüfft, man lacht über die Maßnahmen der Armee unserer Kaiserlichen Majestät.“ — „Wer wird das wohl sein, der lacht; wer war verblüfft.“ — „Die Italiener spotten, die Spanier. Herr Bruder, lassen wir das, was hat er vor, sprech er sich aus, sollen wir den Bayern vergehen und verderben lassen.“ „Die Italiener und Spanier. Was haben die Väter der Jesugesellschaft gesagt. Sie haben doch nicht geschwiegen.“ — „Lassen wir das, Herr Bruder. Sprech er sich aus.“ — „Die Herren von der Jesukompanie haben sich dahinter gesteckt und nachdem sie die Heilige Kirche regieren, glauben sie auch ein Heer und die Politik regieren zu können. Wir werden aber selbst wissen, wie wir zu marschieren haben.“ —
Questenberg wollte sprechen; Friedland wischte an seinen roten Augen, aus denen es troff, senkte seine Stimme, schob ihnen Wort für Wort hin: „Es ist genug gekriegt im Reich. Verludert und vernichtet ist genug. Es kann sich jeder damit zufrieden geben, Soldat und Geistlicher. Sei den Herren gewiß: mir liegt nicht an der ewig fortwährenden Verwüstung. Wär ja ein Instrument des Satans, wenn ich’s täte. Es bleibt dabei: wir steuern auf den Frieden zu. Wenn man auch und wer auch zetert.“
Questenberg: „Soll uns doch nichts willkommener sein.“
„Herr Questenberg. Sind andere kriegerischer als wir Soldaten. Ich werde einen Krieg um den Frieden zu führen haben.“
Questenberg milde: „Graf Schlick hat gezeigt, woran uns liegt und was uns herführt. Wir wollen erfahren, was Euer Durchlaucht im Sinn haben, verkennen gewiß nicht die Schwierigkeit der Lage.“ „Das weiß ich. Fragt aber einmal den Herrn Bruder hier, was die Väter der Jesugesellschaft begehren.“ Schlick hochgestemmt, brüllend: „Ich bin im Auftrag der Kaiserlichen Majestät da. Wir haben kaiserliche Aufträge abzulegen.“
„Und ich sitze hier, Herr Bruder, im Auftrag derselben Kaiserlichen Majestät. Habe schon lange ein kaiserliches Heer geführt und Siege errungen. Zeige mir der Herr Bruder seine Vollmacht.“ „Was soll das heißen.“ „Daß ich weiß, daß nicht Ferdinand der Andere sie unterzeichnet hat, sondern — vielleicht der Herr Bruder selber, oder mein alter Freund Eggenberg oder Trautmannsdorf.“ — „Meine Vollmacht wird der Herr Bruder sehen. Die Kaiserliche Majestät hat sie gezeichnet.“ „Werde mir mein Urteil über Euren Auftrag zu bilden wissen. Setze sich der Herr Bruder. Es tut mir leid ihn zu kränken.“ Als sie eine geraume Zeit geschwiegen hatten, brachte wieder stumpf und ruhig der graue Schlick, der die Augen nicht von den Steinfliesen hob, hervor, daß sie sich bereithalten würden die nächsten Tage, die Antwort des Herzogs auf das noch schriftlich anzubringende Ersuchen entgegenzunehmen. Die Herren verabschiedeten sich feierlich.
Wo Friedland gesessen hatte, fanden Trzka und Neumann, die die beiden Herren auf die Diele begleitet hatten, als sie zögernd zur Türe hereintraten, einen bekleideten Körper auf der Bank vor dem Bett, rückwärts gelehnt, den Kopf, das ausgehöhlte Gesicht zurückgebogen. Er brüllte vor Gelächter. In grenzenlosem Schwall. Der Raum tönte, der Herzog erfüllte ihn wie ein Tier mit seinem Geräusch und saß mitten in dem Lärm, den er erzeugte. Fremdartig, monologisch war das Gelächter, daß sie erschreckt und in peinlicher Beschämtheit zur Türe zurückgriffen. Der Kammerdiener brachte den Herzog zu Bett.
Sie setzten sich, wieder eingelassen, um den grünverdeckten Tisch. Aus dem Bett rollte es: „Habt Ihr verstanden, was vorgeht. Sie greifen an die Wiederkehr von Regensburg. Und weil es nicht so leicht geht mit dem Absetzen, ein anderes Plänchen: die Armee ruinieren. Was ist er, der Friedland, wenn er keine Armee hat.“ Trzka, sich quer auf die Bank vor dem Bett setzend: „Der Plan soll ihnen vergehen. Es ist der Bayer, der dahinter steckt.“ „Recht, Trzka, die Jesuiten und der Bayer, der Hundsfott. Er will wieder hochkommen. Beißen will er mich, weil ich ihm nicht pariert habe. In Zirndorf. Soll ihm der Schwede das Land verwüsten. Nicht Hahn noch Henne soll er drin lassen.“ Neumann flehentlich: „Wird Euer Durchlaucht wieder nachgeben?“ Er hatte Tränen in den Augen; der Anblick seines Herrn griff ihn an. „Was wieder?“ „Vermeine wie zu Regensburg.“ Der Herzog böse lachend: „War nicht nachgegeben zu Regensburg. War aufgeschoben bis zum nächsten Male. Bis ich sie haben würde. Der Bayer hatte den Kaiser untergekriegt. Und jetzt ist er eben dabei. Ich — — gebe nicht nach, und wenn mich darüber der Satan mit Zangen in die Hölle holt.“ Neumann leise: „Die Armee bleibt, wo sie ist“; sein Gesicht leuchtete. „Ja, eher schmeiße ich sie mit dem Schweden zusammen und wir überziehen gemeinsam den Uranfänger des Krieges, den schlimmen Bayern; es wäre meine Lust.“
Da hatte Trzka einen gesiegelten Bogen an der Tür aufgehoben, der ihm vorher in der Eile aus dem Arm gerutscht war, brachte ihn pfeifend an: „Ah sieh da. Lest vor, Neumann. Questenberg gab es mir vorhin, er hätte es versäumt bei der Unterhaltung.“ Es war die schriftliche Fixierung des kaiserlichen Ansuchens an den Herzog. Klagen über den schlimmen Verlauf des Sommerfeldzuges, über das traurige Schicksal Bayerns, dann Hoffnungen auf baldige Befreiung Regensburgs, die Verlegung der Winterquartiere. Schließlich ein Nachtrag betreffend den Mailänder Gouverneur Feria und die spanischen Truppen: der Herzog zu Feria rücke nach den Niederlanden, wo die Infantin Isabella Hoheit auf den Tod daniederliege und tägliches Ableben zu erwarten sei. Des Herzogs zu Friedland Durchlaucht wurde ersucht, dem heraufziehenden Mailänder und seinen spanischen Truppen nichts in den Weg zu legen und ihn in jeder Weise zu befördern, wenn er auf dem Kriegsschauplatze erscheine. Der Spanier würde einem Wunsch des Königs Philipp zufolge sich dem bedrohten Kurfürst von Bayern attachieren; man wünsche, Aldringen mit den kaiserlichen Truppen möge nunmehr völlig dem Bayern unterstellt werden.
Wallenstein aufgesetzt, den Kopf eingezogen, der Ausdruck wechselnd zwischen Hohn und Freude. „Wir haben sie bei den Ohren, die tapferen Kriegshelden. Sie haben nicht gewagt, es abzugeben. Es hätte mich zu arg gebissen meinen sie. Bei den Ohren. Mein alter Questenberg, sieh da.“
Trzka: „Ein trauriges außerordentliches Schelmenstück.“
„Ich will mit den Bestien einmal reden. Witzig genug will ich sein; sie wissen bald nicht, wohin sie den Kopf stecken sollen.“
Der blonde Trzka schmetterte seinen Degen über den Tisch: „Der Spanier den verruchten Bayern beigesellt. Aldringen dazu.“
„Die Jesuiten wissen, was sie vornehmen. Wenn’s übel ausgeht, finden sie ein anderes Kollegium, der Kaiser aber kein anderes Land. Trzka, du wirst dein kleines Weibchen eine Weile nach Kaunitz schicken müssen. Wir werden einige heiße Wochen bekommen. Sieh an, sie zwingen mich. Sie setzen uns den krummen Feria auf die Nase. Es ist mir keine Freude, ich hatte es anders vor. Ein Wunsch des Königs Philipp, den giftigen Bayern zu unterstützen: haha, das setzen sie mir vor. Der Feria soll sich nicht mißbrauchen lassen, er ist mir unterstellt, er mag es mit mir aufnehmen.“ Der Herzog diktierte im Bett den Befehl an den Mailänder, sich seiner Wege zu scheren und nicht unaufgefordert sich in deutsche Kriegshändel zu mischen. Es werde ein deutsches Fähnlein ihm entgegengesandt werden, um ihn den richtigen Weg durch Deutschland und aus Deutschland heraus zu führen. Friedland legte sich zurück: „Die Jesuitenkanaille riecht den Braten.“ Neumann, die Schreibtafel ablegend: „Ilow trifft heute ein aus den Quartieren; wir werden ihn orientieren müssen.“ „Heiße Wochen, Neumann. Ilow soll das Lager kommandieren.“ „Ilow wird sich freuen.“
Der Herzog stellte den beiden Fremden Schlitten zu Fahrten zur Verfügung. Sie machten davon keinen Gebrauch; sie fürchteten, daß sie von den Fahrten nicht lebend heimkommen würden. Theaterspiele lehnten sie ab, suchten, unmerklich von Spionen des Herzogs umgeben, Berührung mit den hohen Offizieren des Lagers. Es erregte die Freude Trzkas und auch des Herzogs, als es schien, die Herren näherten sich besonders dem Grafen Gallas, dem strengen würdigen Mann, der von dem Herzog hochgeehrt war; an ihn ließen sie ihn gern heran. Gallas konnte dem spionierenden Trzka dann aber nichts Rechtes von den Unterhaltungen berichten; die beiden Fremden hätten ihn nur über Lagerzucht und wie fest die Kriegsoffiziere und Obersten zu ihrem Feldhauptmann stünden ausgeholt.
Graf Gallas vermeldete nicht, was die beiden kaiserlichen Gesandten ihm auf Zetteln, da sie nicht zu reden wagten vor Lauschern, zugetragen hatten: daß man den zu Friedland einer zweifelhaften Gesinnung zeihe angesichts gewisser zugekommener Nachrichten. Daß man befürchte, er werde sich des Heeres in kaiserfeindlichem Sinne bedienen. Ob man vertrauen könne, daß sich Graf Gallas seines Eides besänne. Diese Zettel waren ein Werk Schlicks, das er zum knirschenden Widerstand Questenbergs unternommen hatte. Wie ein Kind wurde von dem harten engstirnigen Schlick der dicke Questenberg durch das Lager gezerrt; jeder Besuch enthüllte Questenberg mit Schrecken, daß ein feindlicher Geist im Lager und in Pilsen wehte; die sonderbar fremde beobachtende Haltung Trzkas Neumanns Kinskys, besonders dieses Kinskys, der herausfordernd offen in Pilsen sich bewegte, obwohl er verbannt war und der Herzog ihn in Eisen schlagen mußte. „Wir haben einen Unsinn angerichtet, der Herzog wird kopfscheu vor uns gemacht“, stöhnte Questenberg, als der Boden ihm unter den Füßen versank; er sann jemanden zu Hilfe zu rufen, Trautmannsdorf oder Eggenberg. Aber Schlick ging rasch und gnadenlos vor. Dem war alles klar, der kannte nicht Wallenstein, trieb wie ein losgerissenes Floß im Strom, riß Brückenpfeiler ab, schrammte das Ufer, kippte Boote.
In seiner Not um Friedland brachte es Questenberg über sich, den harmlosen freundlichen Grafen Trzka zur Rede zu stellen und insgeheim vieles mit ihm zu durchsprechen. Er gab seiner innigen Liebe zu Friedland Ausdruck; es läge ihm daran alles ins gleiche zu bringen, man möchte ihm helfen dabei; Trzka sähe doch selbst, daß sich ein Abgrund zwischen dem Herzog und dem Kaiserhause auftun müsse, wenn jedes auf seinem Schein bestehen bliebe. Der andere war auch wirklich gerührt von dem herzlichen Ton des Gesandten, bat nichts zu unternehmen, was den Konflikt verschärfen könnte, er werde sich an den General wenden. Dann aber, wie Trzka schleppend auf dem Weg zu Friedland war, schämte er sich; die Aufgabe war sehr peinlich, er fühlte sich schwach. Dem Questenberg gegenüber schämte er sich seiner Untätigkeit, faselte von Friedlands Geneigtheit nachzugeben; der Kaiserliche freute sich, dankte überströmend; Trzka log sich die Aufgabe vom Leibe.
Und so ließ Questenberg, im Vertrauen auf die vorgehende Versöhnungsaktion, dem bösen wilden Schlick freie Hand, auch gegen Gallas. Er bekam es fertig, hoheitsvoll über diese Aktionen zu lächeln und sich in Vertrauen auf seine Gegenaktion zu wiegen. So von ihm befreit wütete der stiernackige Schlick im Lager des Friedländers.
Die kühne nacktgesichtige lange Panthergestalt des Feldmarschalls von Ilow ritt aus den böhmischen Landquartieren in Pilsen ein. Die beiden Fremden wichen dem unerhört groben Gesellen aus. Er hatte am gleichen Tag heraus, was im Lager vorging; wollte die beiden beim Kragen nehmen. Das Reiterrecht, protzte er gegen Trzka ab, solle über sie entscheiden.
Der Generalissimus befahl nach seiner Ankunft, die Obersten und anwesenden Generalspersonen zusammenzurufen, unter dem Vorsitz von Ilows über das kaiserliche Ersuchen betreffend Verlegung der Winterquartiere und sofortigen Angriffskrieg zu beraten. Der Befehl machte sogar den frechen von Ilow blaß. Sein verschnürter Oberleib hing über dem Bett Friedlands; Ilow stammelte, die Obersten werden sich nicht trauen. Friedland: „Die Herren wissen, daß niemand ihnen an den Leib kann als ich und mein Reiterrecht.“ „Der Beschluß wird dem Grafen Schlick gemeldet?“ „Mir, Herr Bruder. Ihr sollt aber dabei sein, wenn ich den Präsidenten damit abfinde.“
Lange Sprünge Ilows zu Trzka. Zweistimmiger herrischer Jubel, Händedrücken, tanzende Umarmung.
Gallas war mehr Zuschauer bei der abendlichen Beratung und der erfolgenden Ablehnung des kaiserlichen Plans.
In der Abschiedsaudienz ließ Schlick kein Wort von der unerhörten Beleidigung des Kaisers über die Lippen. Einsilbig höflich, scheinheilig freundlich, verabschiedeten sich die Gesandten von Wallenstein, der lag, und seinen steifen herausfordernden Herren. Über den Spanier werde Friedland den Hofkriegsrat schriftlich bescheiden.
Sie hörten nicht, aber sie fühlten, Schlick mit Freude, Questenberg gebrochen, daß der Herzog hinter ihnen den Kopf vom Kissen hob: „Die Herren von der Federprofession werden nicht noch einmal von Wien herüberkommen.“ Und wie die Herren meckerten und die Degen bewegten.
Der spanische Botschafter Ognate ließ nicht die Hand vom Würfelbecher. Er spielte mit den edelsten Herren des Hofes, dem Grafen Wratislaw von Fürstenberg, dem Kammerherrn und Verwalter der kaiserlichen Finanzen Baron Brauer, der niemals Rechnung legen brauchte. Der Hofkanzler Werda von Werdenberg, Graf Johann Baptist, der italienische Emporkömmling fanden sich gelegentlich im spanischen Quartier ein. Der geschmeidige Ognate verlor große Summen. Er hatte auf das ihm zugekommene Schreiben des Gouverneurs von Mailand keinerlei Schritte getan, legte, zu stark von seiner Leidenschaft okkupiert, der ganzen Sache kein Gewicht bei. Feria hatte seinen Befehl aus Madrid, das übrige war militärischer Kleinkram.
Doktor Jesaias Leuker auf die Kunde, daß sich spanisch-italienische Regimenter von Mailand in Bewegung gesetzt hatten, bedrängte den Marquis, daß er dem noch unsicheren Mailänder Mut mache und beschleunigten Anmarsch befehle. Leukers plumpe Methode, dem scharfen hochmütigen Spanier Abneigung gegen den Friedländer durch Zuträgereien einzuflößen, verfing nicht; der große Herr ließ sich von ihm Vortrag im Bad und beim Messeweg halten, durchschaute ihn, hielt ihn schweigend hin. Nur einmal wurde er wild, als Leuker zutraulich von einem spanisch-bayrischen Bündnis anfing; da konnte sich der sehr zeremonielle Mann nicht beherrschen: ob der Rat Leuker ihn für gedächtnisschwach hielte, möchte er doch unter seine Pasteten nicht solche Mucken wirken, er litte genug Strafe, daß er ihn anhören müßte. Der Feria sei ein Narr, daß er sich hier einmische; er werde es ihm bedeuten. Die Durchlaucht in München bedürfe wohl gerade des Mitleidens und Erbarmens, und dazu sei die Krone Spaniens gut genug, ihn aus lächerlichem Flennen zu ziehen. Hinge doch sonst so herzlich am König Ludwig, liebte doch früher in Brüssel solch Bündnis nicht. Pfui des Prahlens und der Aufschneiderei. Ein Dutzend Kinder könnten sich an solcher Säugamme vergiften.
Worauf der Bayer klein abzog. Nach Leuker wollte sich der junge Kuttner an die Sache begeben. Er war ganz in der Hand Wilhelms von Slawata, der ihn nur für Tage und halbe Wochen aus Wien fortließ zur Berichterstattung bei Maximilian. Der elegante junge Mensch wollte es von sich aus übernehmen, diese kühne Aufgabe zu lösen: Ognate zu beherrschen und den Schlag gegen Wallenstein zu forcieren. Slawata schwankte lange, ob er ihn an den Spanier heranlassen sollte; es war möglich, daß die eigentümliche Süßigkeit Kuttners Ognate verführte ihn anzuhören; aber der Spanier war vom Spiel in diesen verhängnisschweren Tagen ganz hingerissen. Es waren keine Versuche mehr zu machen; der schöne vornehme Slawata setzte sich selbst am Würfeltisch dem Spanier gegenüber.
Sie spielten ohne die Mienen zu verändern um steigend hohe Summen. Sofort setzte Slawata mit großen Beträgen ein, er sah, daß sein Partner lethargisch in das Spiel versunken war, daß er spielte, spielte, und nur durch Ungeheuerliches aufzureißen war. Die eigentümliche Genußstimmung, in der er diese Wintermonate über war — Kuttner war ihm begegnet, den Hof wollte er nicht verlassen, sein Herz war gefesselt — verstärkte sich jäh vor diesem hageren Gesicht mit den winklig hoch aufgestellten schwarzen Augenbrauen; „erwecken, erwecken!“ flutete drängte es in ihm, „wir spielen.“
Als die Würfel immer schlecht für den Böhmen fielen, rang sich der Spanier das Wort ab: „Warum strengt sich Euer Liebden so an? Ihr seid im Nachteil.“ „Ich kann in Vorteil kommen.“ Ernst der Marquis: „Wie der Herr will.“ Wie die Einsätze Slawatas in die Tausende gingen, begann der Spanier zu zögern; er war in Brand, unsicher fragte er den andern: „Was ist mit Euch? Spielen wir oder nicht?“ Slawata hörte kaum, was er für Zahlen sagte; er beobachtete nur die Wirkung auf das Gesicht seines Gegners; entzückt lächelte er: „Ich hab’ noch mehr.“ Die Lippen sich leckend, zum Sprung gerüstet der Spanier: „Eure Sache, Herr Slawata. Ich bin nicht Euer Vormund.“ „Was denkt Ihr von Spanien?“ fing Slawata an. „Was ist mit Spanien?“ „Es muß schön bei Euch sein. Ich möchte spanischer Botschafter sein.“ „Slawata, Herr, was tätet Ihr da anderes als ich?“ „Was?“ „Spielen.“ „Das weiß ich nicht so genau. Also dreitausend.“ „Also dreitausend, Herr Slawata. Ihr verspielt Euren Kopf. Da, fünfzehn, Ihr habt verloren.“ „Was macht das. Ich verrate meinen Heiland darum nicht. Aber ich wüßte, was ich täte, wenn ich spanischer Botschafter wäre.“ „Wieviel?“ „Setzt Ihr.“ „Dreitausend.“ „Dreitausend. Marquis seid überzeugt, ich säße nicht hier. Keine Minute litte es mich hier.“ „Die Böhmen sind allesamt sonderbare Käuze.“ „Ich achtete hier auf den Hof.“ „Ich achte auf Euch schon gut.“ „Was ist auf mich zu achten. Ich verliere so tapfer an Euch. Nein seht, diesmal Ihr.“ „So hab’ ich doch recht.“ „Eine Ausnahme, Marquis. Also fünftausend.“ „Das nehm’ ich nicht an.“ „Spielt, Herr Ognate. Gerüttelt, geschüttelt.“ „Fünftausend!“ „Keinen Heller mehr. Ihr müßt auf den Hof achten, da werdet Ihr noch öfter staunen. Ihr werdet hier nicht mehr lange sitzen.“ „Graf Slawata wird nicht dafür sorgen, wo der spanische Botschafter sitzt, an den er selbst sein Geld verliert.“ „Fünftausend.“ „Ich spiele nicht fünftausend.“ „Also sechstausend, Marquis.“ „Ich spiele, Herr Graf, ich versichere, ich spiele.“ „Was seid Ihr erregt um meine Habe. Ich bin doch ein Bettler.“ „Was ist das?“ „Was, Herr Ognate?“ „Daß Ihr Bettler seid?“ Slawata lachte freundlich: „Ach Ihr meint, ich hätte schlechtes Gold, oder langes. Nein. Es kommt nur nicht drauf an, ob ich etwas noch habe.“ „Es bleibt bei sechstausend? Sechstausend Gulden?“ „Taler, Marquis.“ Ognate ließ den Würfelbecher aus der schlaffen linken Hand unter den Tisch fallen: „Nein.“ Ernst, melancholisch der Böhme: „Ich hab’ Euch zu verraten, daß ich spiele. Ich liebe meine Habe nicht wie ein Jüngling, der eine verschleierte Geiß für eine Jungfrau anspricht. Ich bin schon ein Bock zu meiner Geiß.“ Mit tiefer Stimme, sich vorbeugend der Spanier: „Ich bitte um Verzeihung, daß ich Euch so weit verlockt habe.“
Und wie Slawata ruhig ablehnte und weiterzuspielen begehrte, saß der Spanier sehr nachdenklich da, nahm zögernd den Becher wieder auf und fragte ganz heimlich, wieviel also der Herr setzen würde und worauf. Und würfelte dann, ohne den andern sehen zu lassen, auf einer Tischkante, rasch die Hohlhand über die Würfel deckend; stand momentan auf, mit einer traurigen Miene: „Wir wollen abbrechen.“
Ein sonderbares Geschick fügte es, daß am nächsten Tag Slawata am selben Ebenholztisch im selben Maße Zug für Zug verlor, derart, daß er erschrak, wild und tief erschrak und zur Beschaffung von Geld aufbrach und am Hofe Urlaub nehmen mußte; er konnte nicht am Hofe erraten lassen, was er trieb. Auf der Fahrt erst kam dem Böhmen die Ungeheuerlichkeit seines Verlustes zu Bewußtsein und betäubte ihn; er mußte in Kürze seinen Stand verlieren. In trüben Gedanken ging er nach Prag und verschaffte sich Gelder; ziellos hing er einige Tage hier, grollte matt sich, dem Friedländer. Er lahmte einmal zu einem Konvent des Adels; wie er die Türklinke berührte, empfand er aber in sich einen Schlag, dunkel stand er vor der Schwelle, sein Kopf hing vor der Brust; er fühlte sich fortgetrieben, gestoßen von der Klinke. Hier war nicht seine Sache, er trieb sein eignes Spiel. Er ging, mußte seinen Wagen nehmen, reiste schon ab; es kam ihm vor, als ob er wieder zu sich käme; mußte seinen Körper nach Wien fahren. Und unterwegs erwachte er. Es erhob sich in ihm wieder, er fühlte sich gefüllt, ein Leben flutete über seine Brust und Arme. Es gab Kuttner, Ognate, den riesigen Herzog Friedland. Er langte in Wien beim Spieltisch des Marquis an. Er war glücklich dazusitzen und sich ganz zu finden. Als gleich die ersten Züge das Unglück des Grafen anzeigten, suchte der Marquis, zum erstenmal während eines Spiels aufstehend, den ruhigen anderen zu einem Spaziergang oder einer Fechtübung einzuladen.
Ognate setzte sich dann nicht wieder mit Slawata an den Ebenholztisch. Sie wechselten die Tische, die Plätze, er suchte ihn ganz vom Spiel abzubringen. Slawata duldete alles in einer eigentümlichen bittersüßen Beklommenheit. Er fühlte: er fuhr.
Er hatte es bald sehr leicht bei dem Spanier. Slawata sah sich wie ein Kranker behandelt und beschenkt. Er hatte sein halbes Vermögen an den Spanier verspielt, ein dunkles Geschick hatte das vollzogen. Lockenschüttelnd entzückt sah der Böhme den Spanier mit dem olivenfarbenen Gesicht vor sich stehen und über den Tisch aus seinem grünen Beutel klingelndes Gold schütteln, das er ihm aufdrängen wollte. Er konnte es sanft vom Tisch wischen mit dem Unterarm, hatte es nicht darauf abgesehen, der Spanier war schon im Begriff zurückzuzahlen.
Sie sprachen vom Friedländer; er entblößte sich, es war rasch geschehen. „Ihr haßt den Friedländer auch“, fragte mit aufleuchtenden Augen zähnefletschend der Spanier; und Ognate begann von dem schamlosen Bestechungsversuch vor Jahren zu reden, ihn auszuforschen. Er gestand lächelnd an einer Auffassung der Situation durch die Beteiligung Bayerns gehindert zu sein. Aber man müsse sich wohl auf die Sprünge machen, wenn es so stehe, und dabei pfiff er schon durch die Zähne. Er hatte mit dem ihm wohlgefallenden vornehmen Böhmen noch öfter Unterredungen; es freute ihn mit dem Böhmen übereinzustimmen, daß Friedland ein böses gefährliches Tier sei, dessen man sich vielleicht von Zeit zu Zeit mit Umsicht bedienen dürfe. Er war sehr begierig Slawata zu Diensten zu sein.
Nun wurde er mit Leichtigkeit von den Jesuiten belauert, vom Grafen Schlick angegriffen. Der Mailänder Gouverneur erhielt mit einmal, wie er schon zögernd durch die Lombardei marschierte, die leidenschaftlich erregte Anweisung vom spanischen Geschäftsträger in Wien, seinen Weg so zu nehmen, wie ihm vom Grafen Schlick, als dem kaiserlichen Kriegsratpräsidenten, vorgeschrieben werde, insbesondere gute Verbindung mit dem stark gefährdeten bayrischen Kurfürsten zu suchen, auch jeglichen anderen Befehl abzuweisen. Große Beschleunigung der Reise wurde ihm ans Herz gelegt.
Die spanische Armee erklomm in wenigen Tagen das Vorgelände der Alpen, sie durchzog die Pässe bei strengem Frost; die angeworbenen Neapolitaner litten sehr. Nach drei Wochen hatten sie die Paßhöhen überwunden, stiegen nach Deutschland herunter.
Die schwarzrockigen Herren, die in den Kammern der Kaiserlichen Burg herumgingen und in deren Mündern die Namen Azorius Vitelleschi Bellarmin die entscheidenden waren, berieten viel über die äußerlichen Zeichen der Ketzerei. Ein Theologe namens Eymerckus hatte angegeben, bleiche Gesichtsfarbe kennzeichne den Ketzer, wilde Blicke den Zauberer. Man erwog die vorbildliche General- und Spezialinstruktion des bayrischen Kurfürsten für den Hexenprozeß: es dürfe keiner, der einmal bekannt hatte unter der Folter, zum Widerruf zugelassen werden; man fand nicht genug Worte für diese weise Verfügung. Denn wie sinnlos sei es, nachdem mit der Gewalt der Folter der Widerstand des Fleisches endlich überwunden sei, das besessene Fleisch mit dem Nachlaß des Drucks noch einmal reden und natürlich widerreden zu lassen. Wie würde der Teufel über solche Albernheit wiehern: das seien Kämpen, die ihm gegenüberstünden!
In ihrer Gesellschaft fanden sich jetzt mehr hohe Herren des Hofes; auch Eggenberg tastete um sie. Der alte Mann kam zu keinem Entschluß. Was der Graf Schlick berichtete aus Pilsen und Questenberg gezwungen bestätigte, stellte Habsburg vor eine gräßliche Aufgabe. Man hatte den Herzog zu Friedland großgezüchtet, hatte sich fast an ihm vergangen, als man ihm die übermenschlichen Vollmachten und Gewalten gab. Nun war die Krise da: die Ehrfurcht vor der Majestät hatte der Friedländer abgestreift, der Chronos sollte von seinen eigenen Kindern verschluckt werden. Müde war Eggenberg, viel grübelte er, dachte hoffnungslos an die Schreckenstage in Regensburg bei Wallensteins Absetzung. Damals war man mit Bangen und Zagen, er selbst fast verschlungen von Entsetzen, um das Schlimmste herumgekommen; Friedland hatte sich nicht gesträubt. Jetzt mußte man auch an dies heran. Müde war er; das bodenlos schwere Schicksal des Reiches, das immer erneute Heranrollen an den Abgrund ermattete ihn. Wie lange würde man sich hinschleppen. Hinter den Jesuvätern schlich er. Hier war Optimismus und Tatkraft; er wollte sich ein wenig von ihnen tragen lassen. Trautmannsdorf suchte er in seiner Unsicherheit mit sich zu ziehen. Sie verhandelten lange zusammen. Der verwachsene Graf erklärte; seitdem der Friedländer den neuen fürchterlichen Vertrag aufgestellt habe, wüßte man woran man mit ihm sei; jetzt käme unerbittlich die Krise. Eggenberg gestand: er hätte manchmal seit der Musterung des Heeres bei Rakonitz mit Wallenstein daran gedacht, aber er hätte auch gedacht, es käme vielleicht alles ganz anders; vielleicht stürbe Wallenstein, vielleicht stürbe er, Eggenberg, selber, und nun gibt das Geschick erbarmenlos nicht nach.
Wie sie auf den Grafen Schlick zu sprechen kamen, wurde Trautmannsdorf heftiger, man ließe dem Herrn zuviel freie Hand, er beneide den Herzog. Alles Reden brachte sie nicht darüber weg, daß man in einer Sackgasse war: der Herzog führte keinen Krieg, er kämpfte nicht, hatte Dinge vor, die man nicht übersah; unerträglich zog er den Krieg hin, statt den Feind zu schlagen, man konnte ihn nicht halten. Fast weinend gestand Trautmannsdorf, daß man ja selbst keine freie Hand mehr habe, seitdem der Bayer so gnadenlos im Stich gelassen worden sei, seitdem auch Spanien sich gegen Wallenstein ausgelassen habe. Und so suchten sie beide die Fußstapfen der Jesuiten und Schlicks, Eggenberg widerstrebend, der Bucklige mit heftigem Abscheu. Ihnen schauerte und sie konnten nicht los.
Sie bildeten mit dem kleinen Abt Anton eine Kommission, die in höchster Verschwiegenheit die Sache des Friedländers behandeln sollte. Sie fühlten sich so zerrissen, daß sie auch den Spanier Ognate hinzuzogen, gelegentlich auch Lamormain. Schlick schlossen sie aus. Es sollte und durfte nichts geschehen, setzten sie von vornherein dringend und mit aller Entschiedenheit und Angst fest, was sie nicht bestimmt und gebilligt hatten. Sie erklärten auch, daß Graf Schlick nicht autorisiert war bei seiner Reise nach Pilsen, Generalspersonen und Kriegsoffiziere wegen ihrer Anhänglichkeit an Friedland zu sondieren; der peinliche Beschluß Friedlands, die Obersten über kaiserliche Weisungen beraten zu lassen, könne dadurch provoziert sein. So schwankend sei die Lage, daß nichts Unvorsichtiges und Heftiges geschehen dürfe. Sie veranlaßten die Kriegskanzlei freundliche ehrerbietige Briefe nach Pilsen zu schicken; sogar der Kaiser, dem man damit noch eine Freude zu machen gedachte, wurde bewogen, als läge nichts vor, an seinen großen General zu schreiben. Ognate drang mit seiner Wildheit nicht durch; man horchte ihn nur aus, band ihn entsetzt fest an die Konferenzen.
Mit dem Baron Breuner pflog der kleine Abt Anton stille und leidenschaftliche Unterhaltungen, von denen er nichts in die Kommission zu tragen wagte. Die Schuldenlast des Erzhauses war unerhört gestiegen; mit gräßlicher Beredtheit wies Breuner, der nicht zur Schlickpartei gehörte, ein ruhiger edler Kavalier, darauf hin, daß ja die Einnahmequellen des Hauses von Wallenstein planmäßig verstopft würden; er brächte nichts mehr an Kontributionen wie früher ins Land hinein, aber lagere sich in Böhmen Mähren; man müsse Österreich schröpfen — für ihn, für ihn; und dafür müsse man ihn angehen um der notwendigsten kaiserlichen Bedürfnisse willen. „Er hat uns beim Schopf,“ winkte Breuner, „er ist kein Esel. Zu guter Letzt kann er uns wegwerfen wie nichts, so faul leer und leicht sind wir.“ Anton, der keine Blumen bei sich hatte und dessen Finger die weichen Blüten vermißten, ging jammernd herum, zupfte an den Vorhängen des kleinen Zimmers. Was bliebe, höhnte Breuner, dann übrig, als daß man die Kronjuwelen eines Tages verpfände an ihn, die Erblande sind schon seine Sicherheit. „Ich wette, eines Tages zieht er an mit zehn zwölf Regimentern, verlangt Bezahlung, wenn wir ihm zu stark zusetzen.“ „Ja, das ist es, man darf ihm nicht stark zusetzen. Wir wissen nicht, wohin wir ihn treiben können.“ „Mehr als auf den Thron setzen kann er sich ja nicht.“ „Mein Gott“, stöhnte Anton. „Mein Gott, Herr Abt; unser Herrgott verlangt Zugreifen. Wir müssen wissen, was unseres Amtes ist. Schrecklich, schrecklich sind wir im Sumpf, kaum ahnt es einer. Fürst Eggenberg will es nicht glauben. Ihr wißt es ja selbst. Bassewi war einmal unser Gehilfe. Jetzt hat ihn der Friedländer im Sack. Die Judenschaft läßt uns im Stich. Sie wollen dem Kaiser nichts geben. Wir können nicht weiter.“ Anton stöhnte: „Wir haben nichts.“
„Was,“ brüllte Breuner, „wir haben nichts? Der Herzog hat uns ausgeraubt. Wir sind betrogen und geplündert worden.“ Anton rieb unglücklich die Handteller aneinander. „Jetzt — in diesem Augenblick ist Habsburg wirklich besiegt.“
„Er hat uns im Sack. Er läuft uns nicht so davon;“ Breuner knirschte und tippte den Abt auf die Brust, „er ist der ruchloseste schamloseste Mensch.“ „Was wollt Ihr. Er ist in allem ein Unhold.“
Was sie tun sollten. — Was sie tun sollten? Mit ihm? Niederschlagen. — Geduldig, bettelte Abt Anton, der Herr Baron solle sich doch zusammennehmen, was käme bei solchem Schmähen heraus. — „Ihr kennt mich als ruhigen Menschen. Ich hab’ es mir lang überlegt. Wir sind in der Notwehr. Wir können uns nicht behaupten. Wir sind die Herren, er der Diener; das Wasser steht uns schon am Kinn. Sind wir darum das Haus Habsburg, daß wir uns von ihm wie von einem Strolch hinwerfen lassen und zum Schluß noch den Hals hinhalten.“ „Habsburg hat Jahrhunderte durch geblüht. Es hat das Christentum verbreitet. Es ist undenkbar, daß es untergeht.“ „Es wird nicht untergehen, Ehrwürden. Uns ist nicht mehr viel geblieben; wir sind aber nicht ganz waffenlos. Wir werden uns mit den Zähnen verteidigen.“
Anton: ob der so erregte Baron es nicht für möglich halte, daß der Herzog auf erstickende Machtmittel verzichtet; daß er vielleicht herausgebe, was ihm nicht zukomme. — Dieser Dialekt ist dem Friedländer unbekannt. — Aber er müsse es herausgeben; er müsse sehen, daß Habsburg und das Haus Friedland sich nicht darum zanken könnten, wie die Dinge einmal liegen; es sei ja Wahnsinn. — Möge der Herr Abt hoffen; er, der Breuner, sage voraus: dieser böhmische Adlige pfiffe auf den Rang und die Jahrhunderte des Hauses Habsburg; und er hätte, im Vertrauen gesagt, Recht damit: denn man könne auf einen pfeifen, der einen leeren Säckel habe und den man über den Haufen schießen könne. „Euch fehlt der Mut im Hohen Rat, Herren; Ihr könnt auch schlecht sehen. Pappelt weiter, beratet, der Friedländer wird Euch gut bedienen. Verwehrt es andern nicht, daß sie das Haus Habsburg und die Heilige Kirche für mehr als eine Diskussionsangelegenheit halten. Es mag gegen ihn vorgegangen werden, wie er mit uns vorhat.“
Seufzend wankte der Abt ab. Tappelte später wieder zu Breuner, zaghaft und ängstlich-begierig wie Fürst Eggenberg zu den Jesuiten. Und immer kam Breuner darauf zurück, es bliebe nichts übrig; sie seien rettungslos verloren, und selbst wenn Wallenstein nichts verbräche, sie müßten seiner Herr werden und ihn hernehmen. „Wir können seiner nicht schonen; Ihr mögt ihn lieben wie Euer eigenes Kind; er muß ob heute oder morgen mit Hab und Gut daran glauben. Ihr müßt Euch entscheiden, Ihr seht doch alles klarer als der Fürst Eggenberg oder Trautmannsdorf oder der Pater Lamormain. Er tut uns den Gefallen, daß er selber die Frage aufwirft: Habsburg oder Friedland. Er wirft die Frage auf; doch. Aber, Ehrwürden, täte er es nicht, es hülfe uns nichts: wir müssen ihn fangen auf irgendeine Weise. Wir müssen ihm eine Falle stellen.“ Entsetzt Anton: „Aber wenn der verdienstvolle Mann nichts verbricht?“ „Wir müssen ihn reizen dazu; er muß ins Garn.“
Ein Jesuit orientierte den Baron Breuner: es sei unsinnig, Gleichheit vor dem Gesetz. Wenigstens vor dem moralischen Gesetz seien die Menschen keineswegs gleich. Es käme auf den Stand, die Person an. Unter Umständen könne ein Edelmann töten, vielleicht hätte ein Bürger dazu kein Recht. Eine edle Gesellschaft, die in Gefahr schwebe, kompromittiert zu werden, könne der Bloßstellung oder Beschimpfung durch Ermordung des Bösen zuvorkommen. Wer werde Hinterlist tadeln. Von einem sehr Starken von vorn angefallen zu werden, ist Tapferkeit; wenn aber ein Nichtstarker töten müsse, solle er darauf verzichten, weil er nicht von vorn angreifen kann? Etwa weil er dem Volke später nicht als tapfer, als Held erscheine? Welches Hängen und Kleben an Silben. Wer werde so billigen Urteilen nacheilen.
Schlick und die Jesuväter wurden durch Spione auf dem laufenden erhalten über das eigentümliche Konspirieren im Pilsener Lager, zuletzt über verstärkten Botenverkehr mit Sachsen. Der dicke breitnasige Italiener Pikkolomini, Wallensteins ehemaliger Leibgardenkapitän, zuletzt General der Kavallerie, ein schweißduftendes hitziges Tier, hielt sich in diesen Wintertagen in Wien auf, um mit Schlick über seine Beförderung Fühlung zu nehmen. Er bot sich bei einem Spazierritt um die Basteien, als Schlick auf die gespannten eigenartigen Verhältnisse hinwies, selbst zu Diensten an; dem Wallenstein trug er nach, daß er ihn dem dänischen Günstling, dem Holk, unterstellt hatte; Stimmen sprachen davon, daß Holk in Sachsen nicht ohne Mitwirkung dieses haarumwallten Herzogs von Amalfi umgekommen sei, und zwar durch ein bequemes Gift. Das trübäugige Untier, der schwere bigotte Schlick gab ihm im Morast des Unteren Wöhrd den Auftrag, die sächsische Korrespondenz des Friedländers zu überwachen und zu stören; es mußte auf alle erdenkliche Weise verhindert werden, daß Wallenstein Machtzuwachs erhielt; isoliert sollte er niedergedrückt werden. Schlick verbot dem General, bevor sie sich der Stadt näherten, mit irgend jemand am Hofe in Verbindung zu treten; es herrsche hier ein lauer unentschiedener Geist; durch die Lauheit sei das Übel erst gewachsen.
Der Italiener erhielt, bevor er abreiste, von dem einsilbigen Präsidenten des Hofkriegsrats das Dekret mit seiner Ernennung zum kaiserlichen Marschall in die fleischigen Hände gedrückt, dazu den Geheimbefehl bis zum verabredeten Augenblick Verschwiegenheit über die Ernennung zu bewahren. Schon nach fünf Tagen konnte der Italiener nach Wien melden, daß er durch eine kleine zuverlässige Schar seiner Landsleute zwei der sächsischen Kuriere habe meucheln lassen; es hätten sich bei ihnen Chiffrebriefe für den Grafen Trzka gefunden, die er mitschickte.
Mit Gewalt mußte Graf Schlick den Ansturm des spanischen Ognate und einiger jesuitischer Herren abweisen, die ihn zu sofortiger Niederwerfung Wallensteins drängten; er deutete ihnen die Schwierigkeit der Situation an. Man könnte nur Schritt für Schritt vorgehen, man riskiere, den Herzog vor der Welt als Märtyrer hinzustellen. Man müsse ihn bequem ganz herauskommen lassen, im Augenblick die Zeit zur Unterminierung seines Bodens ausnutzen.
Um diese Zeit verließ Graf Slawata, der noch immer schöne blühende Mann, Wien, den Hof und Kuttner, um nach Prag zurückzukehren. Kuttner begleitete ihn einen halben Tag Wegs. „Vergesse der Herr nicht unsere Geschäfte“, lächelte Slawata, als der Jüngling ruhig weiter neben seinem Wagen reiten wollte; „in Prag gibt es keine Lorbeeren zu gewinnen, aber Wien hat ein üppiges Klima dafür.“ „Ich will beten, daß, wenn der Herzog zu Friedland fällt, Ihr die Krone von Böhmen bekommt. Ihr seid der beste Mann des Landes.“ „Nach Hause! Kuttner! Rasch! Sorgt, daß man mich nicht am Kragen kriegt. Es wird heftig zugehen. Weg, lieber Kuttner, der bayrischen Durchlaucht bester elegantester schönster Diener. Es ist keine Zeit für verträumte Kinder auf der Straße.“ Kuttner ließ noch lange seine Hutbänder auf der geschwenkten Degenspitze wehen.
Slawatas Wagen aber machte plötzlich eine Wendung. Rasselnd schlug er die Richtung auf Pilsen ein.
In der grünen heißen Kammer der Kaiserin hob sich rauschend die blutrotgekleidete Vortänzerin und tanzte langsam vor der Mantuanerin im Zimmer herum. Sie forderte mit den winkenden Händen, den lockenden ringreichen Fingern die zweite zitronengelbe auf, die neben der Mantuanerin hockte. Sie faßten sich an den Händen, um die Hüften, sich schlingend, schleiften sich über den Teppich. Am Ofen sang eine feine helle Stimme: die dralle Gräfin Kollonits, den sinnenden schwarzen Kopf an der Tapete, beide Hände vor den Augen.
Und als sie zu Ende getanzt hatten, sang sie einsam am Ofen weiter: „Vionetus von Engelland, ein König mächtig sehr, seine Tochter Ursula genannt, der Jungfrauschaft ein’ Ehr. Weil sie mit Christi Blut erkauft und durch des Höchsten Will’ getauft, hat sie Christus erwählt allein, in Keuschheit stets zu dienen sein.“
Vom Boden, wo die Mantuanerin lag, stieg wie dünner Rauch immer das Seufzen auf: „Wie schön! Singt es noch einmal.“ „Wie schön, noch einmal.“ „Ich will nicht soviel singen,“ bat die Gräfin, „des Kaisers Majestät sitzt in der Kammer und wartet.“ „Was du drängst.“ „Kommt mit“, lockte die Mantuanerin, die den Arm ihrer Dame nahm, die beiden Damen.
Ferdinand lächelte ihnen staunend entgegen: „Ich habe gehört, wie gesungen wurde. Aber ich habe teil an der höllischen Passauer Kunst.“ Die zitternde Frau ließ sich in einen Sessel führen. „Ich bin ganz und gar gefroren. Es kommt nichts an mich heran. Hab’ ich es nicht schon einmal gesagt, Eleonore. Danke, meine Damen, rot wie die brennende Liebe, gelb wie Neid. Wo ist Grün vor Minne?“ Und wie die Damen hinaus waren, faßte er sie bei der Hand an: „Ich habe Trautmannsdorf zu mir gebeten; er wollte mich unterhalten.“ „Kommt herein,“ er zog den verwachsenen Grafen aus der Vorkammer zu sich, „ja lacht. Ich predige Euer Lob. Ihr seid mein Gesellschafter.“
Die Kaiserin suchte Trautmannsdorfs Blick zu erhaschen, um ihn in ihre Gewalt zu bekommen; sie lächelte in halber Verzweiflung: „Wie kann denn die Welt so schlecht sein. Wir sind ja alle Christen. Die Welt ist ja zweierlei jetzt, die alte sündige Welt und Jesus, und der Heiland. Man mag nicht so viel von dem Bösen reden.“ Ferdinand näherte sich ihr, strich ihr freudig die Schulter: „Wie gut du das sagst, Eleonore.“
Sie brach fast zusammen unter ihrem Schmuck. Die Augen angezündete Kerzen, schaukelnde Windlichter, in hypnotisierender Weiße.
Da fing Trautmannsdorf an; man solle nicht von dem Bösen reden und man könne nicht von ihm schweigen, wenn man ihn überwältigen wolle. Das Böse selbst redet nicht, es ist da, handelt, verändert, verwirrt. Der Heiland ist an dem Bösen nicht vorübergegangen; das Böse hat ihn an die Welt gelockt. Ferdinand: „Es ist so. Sprecht, Trautmannsdorf. Setzt Euch.“ „Warum muß ich hier zuhören, Ferdinand?“ „Willst du nicht, Eleonore?“ Nach langer Pause sagte sie: „Ich will“ und suchte wieder ihren flehenden Blick an Trautmannsdorfs kühle Augen zu drängen.
Der kleine Graf sprach von den politischen Dingen. Ferdinand hinhorchend, hineindrängend wurde von dem Wagen der Ereignisse fortgeschleift, hing nach rückwärts, Hände und Kopf aufschlagend.
Der Graf Ognate, endete Trautmannsdorf, sei von den Vorgängen — der Kaiser hob abwehrend die Hände — orientiert, die katholische Majestät wünsche im habsburgischen Interesse das rascheste und entschlossenste Ende der gefährlichen Wirren. Das rascheste und sicherste Ende, wiederholte mit den Fingern am Gurt spielend der kühle Graf; der Kaiser und die Mantuanerin hielten die Gesichter einander zugewandt, suchten, klopften, rissen aneinander.
Die Mantuanerin fragte rauh den Grafen, warum er ihr die Antwort schuldig bleibe: die Welt sei zweierlei, Jesus Christus sei für die Welt geboren, zur Unterwerfung des Bösen; ohne den Heiland seien sie ja nicht Christen. „So sprecht“, winkte Ferdinand. Da seufzte Trautmannsdorf, sie seien schon genötigt sich auch dann für Christen zu halten, wenn sie Verrat oder drohenden Verrat abwehrten, mit Gewalt, da es so erfordert werde. Ich muß hören, dachte es in Ferdinand, was hier alles auf der Welt vorgeht. „Ihr müßt denken,“ Eleonore streng aufgestellte Augenbrauen, „keinen Verrat aufkommen zu lassen, der Euch zu entsetzlichen Dingen nötigt. Jesus braucht nicht gelebt zu haben, wenn Ihr nichts weiter könnt, als auf eine Untat so zu antworten.“ „Ich weiß, ich weiß. O wie gut empfinden Majestät das. Ist doch die Aufgabe des Staatsmannes und Politikers nicht besser als eines Scharfrichters oder Schindknechtes. Ich habe nur den Trost, daß das Evangelium nicht ganz den Stab über uns bricht; es hat auch den Satz: ‚Gebet Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist.‘“ „Ihr seid schlau, Graf Trautmannsdorf. Ein schlimmes Gewerbe habt Ihr.“ „Wir haben nicht den Wunsch, gegen den Herzog zu Friedland schlimm zu verfahren. Er wird sich biegen lassen. Wie schlimm stand es auf dem Kollegialtag zu Regensburg. Wir beten, daß Gott uns nicht verläßt.“ „Ich aber“, hob Ferdinand langsam beide Hände gegen ihn, „will Euch fragen, Trautmannsdorf, warum wir denn schlimme Gewalt anwenden müssen, wenn uns der Herzog verrät.“ Da schwieg der Graf. „Könnt Ihr es beantworten, Trautmannsdorf.“ Der stammelte, versuchte zu lächeln, blickte auf die fahle Mantuanerin: „Ja, nein, ich kann schlecht verstehen.“ „Besinnt Euch, Trautmannsdorf.“ „Ich weiß schwer, was ich antworten soll.“ „Wenn uns der Herzog verrät, müssen wir ihm gehorchen?“ Eleonore saß aufrecht; Ferdinand sah sie und den Grafen triumphierend an. Stammelnd errötend Trautmannsdorf: „Ich bedaure, daß unser alter Fürst Eggenberg nicht zugegen ist; er weiß vielleicht rascher als ich Antwort.“ „Ich weiß; ich habe Euch gebeten, ohne ihn; ich will Euch hören.“ „Eure Majestät wird den Thron verlieren, wenn sie nicht dem Herzog gehorcht.“ „Trautmannsdorf, achtet auf, du auch, Eleonore, achte auf. Diese Antwort hat eben Fürst Eggenberg, mein lieber Freund gegeben. Jetzt wird Trautmannsdorf sich äußern: wem ist der Kaiser untertan?“ „Nur Gott.“ „Dem Herzog zu Friedland nicht?“ Der Graf schwieg. „Und ferner: bin ich dem Throne untertan? Denn ich soll den Thron verlieren.“ Auch Eleonore hing gespannt an ihm. „Wenn ich aber Kaiser bin, bin und nicht Lust habe zu gehorchen?“
Mitleidig senkte der kleine Graf den grauen Kopf; leise und langsam: „Versuche Eure Majestät es einmal, so — ungehorsam zu sein. Ich sagte schon, der Erfolg wird uns nicht behagen. Der Herzog wird über Wien fallen, wir werden in Wien sitzen, vielleicht im Kerker; vielleicht liegen wir unter der Erde.“ Ferdinand hob die Hände: „Ich werde nicht unter der Erde liegen.“ Eleonore bitter: „Wie spricht der Herr Graf. Es soll nicht erlaubt sein, solche Gespenster an die Wand zu malen.“ Fast höhnisch Trautmannsdorf: „Gespenster werden wir sein.“
Hauchend Ferdinand: „Sieh an — das hat schon Lamormain gesagt. Und so hat es ein Witz gefügt, daß ich jetzt Krieg gegen den Mann führe, dem ich mein Leben, die Krone und noch manches verdanke. Denn ich wäre doch schon längst Gespenst nach Eurer Theorie, wenn er uns nicht geschützt hätte.“ „Wir wollen“, der Graf mit leichter Verbeugung, „nur dem Kaiser geben, was des Kaisers ist.“ „Mir?“ zuckte Ferdinand; seine Stimme schwoll an; er schrie, „soll das meinetwegen geschehen? Meinetwegen? Eleonore, meinetwegen! Der Herzog hat uns befreit von — ich sage nicht welchen Ketten, er hat uns getragen und hochgehoben. Ich werde nicht unter der Erde liegen. Dahin ist es gekommen! Wodurch, wodurch!“
Der Graf war zurückgetreten, Ferdinand leichenfarben, zitternde Knie, brüllte vor ihm: „Ich — will — nicht.“ Trautmannsdorf sehr leise: „Majestät befehlen.“ Die Arme hochhebend über seinen Kopf Ferdinand: „Ihr werdet nicht auf mich hören. Ich gehorche nicht. Man wage nicht, mich ins Spiel zu ziehen. Ich werde es nicht zugeben. Ich werde mich auf seine Seite stellen, wenn Ihr etwas wagt. Ich — bin — der Kaiser.“ Die Mantuanerin umschlang ihn weinend: „Geht, Herr Graf!“
Ferdinand ließ die Arme nicht herab: „Nicht — mei—net—wegen!“ Sie stellte sich vor ihn; Ferdinand über sie weg: „Wodurch werde ich zu solchem Wahnsinn getrieben. Nichts soll meinetwegen geschehen. Jetzt vergewaltigen sie mich zu Schande und Erbärmlichkeit.“ Die Kaiserin flehte nach rückwärts: „Geht, Herr Graf.“ Sie führte ihn rasch an die Tür.
„Ernüchtert ist er,“ höhnte der Kaiser mit anklagendem Ausdruck am Fleck stehenbleibend, „hinaus. Hinaus. Was haben sie im Kopf, das ich alles muß. Von mir bleibt nichts übrig. Was habe ich früher mich gewunden, daß ich vor dem bayrischen Maximilian betteln mußte. Aber das!“
Er brüllte: „Dienen! Dienen! Ich — will — nicht!“ Dröhnend.
An den Wagen mit den Füßen gebunden, über Steine und Äste schleifend, Hände und Kopf aufruckend, niederklappend.
— Nach Wolkersdorf. In den Wald. Wie auf Wellen, gleitend, sinkend, gehoben. Die Füße rasselnd gegen Steine. An der Kohlenbrennerei vorbei; zwischen den kahlen Stämmen irrend durch Stunden.
Laues tauiges Wetter. Die Waldschneise. Der braunbärtige Einsiedler, dessen rechte Gesichtshälfte aus tiefen Geschwüren eiterte, fragte vor der Höhle, was er wolle. „Euch zusehen.“ Aber diesmal waren die Augen des fremden Handwerkers so begehrend, daß der Fromme vor der Höhle blieb und unter dem Vordach murmelnd betete.
Nach langer Zeit fragte er: „Was ist Euch geschehen?“ „Sprecht, sprecht, guter Mann. Erleichtert Euch.“ „Es ist nicht nötig, daß ich spreche. Ich komme zu Euch. Will Euch hören. Euer Gesicht ist zerfressen; seid Ihr deswegen aus der Welt gegangen?“ „Nein.“ Der Einsiedler hockte vor ihm, faßte ihn am Kinn, vertiefte sich in sein Gesicht, das er mit den Augen fast aufwühlte und umpflügte. Ferdinand griff inbrünstig nach seinen Händen. Der Einsiedler zog ihn in die Höhle.
Drin ließ ihn Ferdinand kaum auf das hohe Strohlager sich setzen, so stammelte, ächzte er: „Was, was, ist es, sagt mir, was ist es mit dem Satan?“ „Du hältst mich für einen Teufelsbanner?“ „Nein, nein.“ „Du glaubst, daß ich mich ihm verschworen habe, weil ich gezeichnet bin.“ „Nein.“ „Warum fragst du. Ich gehöre zu seiner Synagoge, glaubst du, ich habe mich vor euch versteckt, habe eine Salbe, laufe als Wolf herum. Darum kommst du hierher. Du bist Soldat, ich soll dir helfen.“ „Nein.“ „Wo ist der Schatz, den ich für dich heben soll.“ Sein Knie berührte Ferdinand. Während sich die Augen anfunkelten, verzerrte sich das Gesicht Jeremias, ein hoher Ton wie das Piepsen eines kleinen Vogels kam aus seiner Kehle: „Du bist ihm begegnet. Ich sehe es ja; du bist besessen. Du kennst ihn.“ „Ich weiß nicht.“ Flüsternd Ferdinand: „Bruder. Was ist mit ihm.“ Der lachte verzerrt, redete hastig: „Kein Gott kann so grausam sein wie das ist, was die Welt gemacht hat. Weißt du das?“ „Ja.“ „Siehst du, siehst du, du sagst ja, du wagst nicht nein zu sagen.“ „Ich werde dich nicht verraten.“ „Bruder, du wirst mich nicht verraten. Es ist alles Teufelswerk. Du brauchst keine Angst vor dir zu haben. Es gibt nur einen Teufel. Gott gibt es nicht. Den Teufel gibt es. Er ist so sichtbar, für alle Augen erkenntlich wie etwas. Alle Zeichen, die für den Bösen gelten, sind erfüllt. Die Verblendung ist unermeßlich.“ Ferdinand warf sich auf den nackten Boden, zitterte: „Das weißt du. Und die heilige Kirche.“ „Sei stark, wenn du suchst, Bruder. Wir müssen es ertragen. Ermatte nicht zu rasch.“ „Ich höre.“ „Jesus Christus hat es gewußt, Bruder. Ihn hat nicht Maria zur Welt gelockt und die Liebe Gottes: er hat das Böse vorausgefühlt und den Menschen dazu und wollte uns die Last tragen helfen. Sieh, Jesus ist dagewesen; er hat sich erbarmt, niemand kann die Fülle seines Erbarmens fassen. Er hat die Menschen gesehen, die Sünde gesehen, der Satan selbst ist an ihn herangetreten; man muß darüber mit Raschheit hinweggehen, was Jesus mit dem Satan besprochen hat. Niemand weiß es, es hat uns niemand gesagt. Sein Leben unter den Aposteln blieb in Dunkel gehüllt. Er ist schnurstracks seines Wegs gegangen und keiner hat sein wahres Gesicht sehen können. Niemand weiß es. Ich — Bruder —“ „Was ist dir?“
„Komm neben mich. Ich kann zu dir sprechen. Ja, du bist auch besessen. Du wirst mich nicht verraten. Willst du mir etwas glauben, willst du mich nicht für einen Schelm oder Trottel halten.“ „Ich bin zu dir gekommen.“ „Ich will dir erzählen. Wie meine Wange hier einsank, war es eine Angst, die ich hatte, plötzlich eine Stunde, einen halben Tag, einen gräßlichen höllensiedenden langen Tag. Ich — habe — sein — Gesicht gesehen, Jesus, des Gesalbten Gesicht —.“ Er zeigte flüsternd, die Augen aufreißend an der halbfinsteren Hinterwand der braunen Höhle einen lose herausragenden Wurzelstock: „Hier ist eine Wurzel; faß sie an, hier. Du kannst sie sehen, wenn deine Augen sich gewöhnt haben. Es ist dunkel hier. Ich bin Einsiedler und brauche die bunten Farben nicht. Hier ist es gewesen, eines hellen Tages, als die Sonne auf den Getreidefeldern lag, als ich ahnungslos hier eintrat. Das heitere Zirpen der Meisen. Da war er da.“ Er faßte wild ächzend die Wurzel an, um sie hingen Stricke und Kettchen und ohne sich um den Gast zu kümmern, wie gezwungen, entblößte er Brust und Arm; kraterförmig tiefe Geschwürsflächen unter dem Hals, über der halben Brust; er fing an sich zu schlagen, die Arme vor der Brust verschränkend, rechts herüber, links herüber peitschend, saß bald in der völligen Finsternis der Höhle, schob sich stürmisch gegen sich arbeitend immer weiter zurück.
Nach einer Weile hörten die Schläge auf, er rutschte mit geschlossenen Augen neben Ferdinand. Blut quoll an den Schultern aus dem groben Hemd, er saß still und keuchend neben ihm. Dann: „Hörst du mich?“ „Ja.“ „Ich will dir erzählen, Bruder. In einem Sonnenfleck da über der Wurzel. Bleib hier, du brauchst dich nicht fürchten.“ „Ich fürchte mich doch“, flüsterte Ferdinand. „Nein, du brauchst dich nicht fürchten. Ich erzähle dir ja nur. Gib mir deine Hand. Er ist ja jetzt nicht da. Er war hier in der Höhle. Es war so hell; meine Augen waren noch geblendet von dem Sonnenschein draußen, wie ich mich bückte, um hereinzukommen. Da bemerkte ich ein Loch in dem kleinen Lichtfleck, eine Höhlung, eine Vertiefung, als wäre Erde aus der Wand herausgefallen oder hätte ein Tier von innen gewühlt. Ich sehe drauf hin, das Licht geht nicht weg, warum rollt der Sand von der Wand, um das Loch herum, da bewegt sich etwas. Ich halte es für ein Tier, ein langfüßiges schwarzes, vielleicht eine Riesenspinne; es läuft so über das Licht. Das Rieseln und Zittern ließ nicht nach, der ganze Kreis, es kommt mir vor, weißt du Bruder, als ob er sich hebt, als ob es eine Metallscheibe ist, die sich beult. Ich traute mich nicht den Kopf zu bewegen. Mit einmal, als wenn mir die Augen herausgerissen würden, erkannte ich — sein Gesicht.“ „Wessen.“ „Seins, Bruder. Nicht doch. Du verstehst nicht. Es war so dunkel mit Haaren, Ohren, Augen, Kinn in der Helligkeit; die dünnen schwarzen Wangen zitterten ihm, als wenn er fröre oder verhindert würde den Mund zu öffnen oder die Lider hochzuziehen.“ „Bruder, wessen Gesicht hast du gesehen.“ „Und dann lief etwas Schreckliches um seinen Mund. Ich kann es nicht mehr sehen; ich kann seitdem diese Stelle nicht verlassen. Es ist kein Schwur, den ich getan habe, es ist — daß ich an diesen Ort genagelt bin. Ich möchte mich hängen an die Wurzel nur um zu leiden, zu leiden.“
Seine Haare hatten sich gesträubt, ihm strömten die Tränen aus Augen und Nase: „Bruder, du bist mir nicht gram, du wirst mich nicht verachten, weil ich gottlos bin. Ich leide, ich stranguliere mich, ich lege mich zum Rösten in die Sonne, um zu vergessen. Um ihn zu vergessen. Den da.“ Entgeistert wackelte der Braunbärtige auf seinem Platz, er bibberte, stotterte: „Oder mich vor ihn werfen; wenn mich nur einer zerreißen wollte.“
Ferdinand zitterte wie er: „Es war Christus.“ „Er hat Satan gesehen, ich ahne ihn nur; ich sehe die Welt, rieche ihre Verwesung — aber er kannte auch die Menschen, die Seelen. Der hat sich für uns geopfert. Er wußte, daß uns nichts überzeugen könnte als sein schmerzensreicher gräßlicher Tod. Christus Jesus hat sich verstellt für uns. Für dich und mich. Die größte Seele, er hat sich in die Wagschale werfen müssen.“ „Gegen den Satan.“ „Es hat ihn an den Satan herangetrieben, alle Freiheit, alle Selbständigkeit, die Lust des Lebens hat er von sich hingeworfen. Ihn wollte er von uns verscheuchen, von Mensch und Getier. Und —.“ „Was ist.“ „Du weißt ja allein weiter, Bruder, was ist.“ Er durchbohrte mit den Blicken den Kaiser, schrie: „Es hat nichts genutzt. Der Satan wiegt schwerer. Nicht einmal sein Andenken ist aufbewahrt, man weiß nichts mehr von ihm. Man weiß nichts mehr von ihm. Die Kirche hat ihn verschlungen.“ Ferdinand hielt sich die Hände vor die Augen: „O Bruder, was du sprichst.“ „Ihr braucht nicht ratlos sein. Ihr seid gut dran. Ich weiß. Man mißbraucht seinen Namen. Aber du weißt es ja auch anders. Du wirst mich nicht verraten.“ „Was tust du hier?“ Der Einsiedler warf sich dicht an ihn heran: „Du brauchst nicht glauben, was ich sage. Ich hab’ dir doch nichts Neues gesagt. Bleibe draußen. Sei fromm. Bist du mein Bruder?“ Ferdinand zog die Hände vom Gesicht.
Wie Ferdinand im Wald an einer niedergebrochenen Buche stand und von dem schweren Gefühl heimgesucht wurde: zwei Adler standen auf hohen Füßen hinter ihm, schlugen ungeheuer mit den Flügeln, Wind vor sich treibend, krachte sehr nahe ein Schuß. Die Stimme des Dieners: „Schützt Euch, Herr, schützt Euch.“
Es raschelte um sie im Wald, von den Stämmen lösten sich Menschen; in Sprüngen kam ein älterer säbelschwingender Geselle näher, stolperte über seine eigene Säbelscheide, griff Ferdinand an die Brust, riß ihn herum, sah ihm ins Gesicht. Einer mit einem Feuerrohr lief dicht hinter ihm; von allen Seiten sprangen sonderbare Kerle mit Pistolen und Knütteln an. Der Ältere, der Anführer, ein Mann mit einem kühnen Gesicht, fragte den Kaiser, wo die anderen wären. Ferdinand war sehr ruhig. Die Bande suchte in der Umgebung alles ab. Die Debatte zeigte, daß man sich vergriffen hatte; wer ergriffen werden sollte, erfuhr der Kaiser und sein mit Stricken gebundener Diener nicht. Man durchsuchte sie, wollte sie wieder laufen lassen.
Da fühlte Ferdinand plötzlich die tiefe Ruhe, die sich seiner während des Überfalls bemächtigt hatte.
Die Höhle des Einsiedlers.
Die Spinne. Was war das. Es kam ihm meilenweit vor, jahrelang fern.
Er konnte sich nicht trennen. Dem Anführer, der sich in einem Hinterhalt zu einigen gesattelten Pferden begab, folgte er trotz der Anrufe der anderen. Er fühlte, daß ihm befohlen war, mit dem gewalttätigen Kerl zu sprechen, der seine Wut an einigen Bauern ausließ, die bei den Pferden standen und offenbar mitgeschleppt wurden. Bei Wolkersdorf wüßte er einen Grafen, der morgen oder übermorgen zu einer großen Reise die Ausfahrt mache, er nannte einen beliebigen Namen, war glücklich, als der andere anbiß. Der Diener wurde von der Bande nicht losgelassen, Ferdinand nahm tuschelnd von ihm Abschied, der an ein Pferd gebunden war.
Als Ferdinand allein in der Höhle der Kohlenbrennerei war — wußte er nicht, was er vorhatte. Dachte kaum. Fühlte nur, daß ihm ein Glück zuteil geworden war. Ein sonderbares Glück.
Als wenn er eine glatte eingeseifte Bahn herunterrutschte. „Ich gebe nicht nach“, seufzte er noch im Scherz, und rutschte schon weiter den bekannten Weg, den er oft irgendwo gefallen war. Es war eine Freiheit, die ihn mit wachsender Stärke entzückte. Als wenn er das Ende einer Stange ergriffen hätte, an der er sich ruhig, mit geschlossenen Augen, entlang bewegen konnte.
Die Armeen, die der zu Friedland angesammelt hatte, standen massiert in Böhmen, starke Detachements hielten unter dem von Aldringen bei den Bayern; gegen Schlesien und die Mark waren Regimenter vorgetrieben unter Schaffgottsch, nach Süden gegen Budweis und Tabor beobachteten Abteilungen unter Marradas. Eine tiefe Lethargie hatte sich der Truppen bemächtigt. Ein eigentümliches Mißtrauen ging unter den Offizieren um. Man hatte seit dem heißen Leipziger Treffen, bei dem die Königliche Würde von Schweden ihr Leben lassen mußte, nichts getan, was Ruhm und Freude brachte. Märchenhaft weit lagen die Tage von Nürnberg zurück; die Söldner kamen und sangen von dem Burgstall bei Zirndorf, den der Bernhard von Weimar gestürmt hatte, wieder abgeben mußte und Hunderte seiner Knechte verlor. Von Wallenstein, der den König von Dänemark über Jütland weg in die Ostsee gejagt hatte, und den Mansfeld, den Bastard, den Durlacher und den Halberstädter ergriff, daß sie zerbrachen und sich nicht retten konnten. Italienische Fähnlein zogen herauf, einstmal von dem weinseligen toten Kollalto vor Mantua angeworben zur friedländischen Fahne: sie hatten Mantua geplündert, der Herzog von Nevers hatte nicht standhalten können. Nun lungerten sie seit Monaten herum auf schlesischem Boden, vor den sächsischen und schwedischen Heeren, verlagen.
Die Meister der Artillerie häuften die Kugeln an zu Bergen, verkauften sie heimlich an fremde Unterhändler. Die Stückknechte und Büchsenmeister wüteten widerwillig gegen Rost und Staub. Der Arkebusier trug ein Schußgewehr und zwei Pistolen, die Offiziere schrien, wenn sie den Degen umlegten; warum sollte man sich mit dem schweren Gewehr und Pistolen schleppen. Konstabler Schneller Schanzbauern Granatiere Minatoren Bergknappen Pontoniere Petardierer schleiften ihre Füße durch den Lehm des Artillerielagers, ließen untätig die Mäuler hängen, verfluchten Granaten Petarden Lunte Ladungskapseln. Schlichen davon zum Schweden, Sachsen. Fragten wo Krieg sei. Immer noch liefen Neugeworbene an; wurden zu besonderen Fähnlein zusammengeschlossen, nach einundzwanzig Kommandos wurde die Pike exerziert, neunundneunzig Tempi brauchte das Feuern und Wiederladen, hundertdreiundvierzig Kommandos die Musketen; die Alten standen dabei, grinsten und zogen mürrisch weiter. Auch in die Jungen wurde Mißtrauen gelegt, die Strafen stiegen, Wippgalgen, hölzerne Esel wurden überall vermehrt. Die alten Söldner freuten sich mit Grimm: es war das einzige, das sie an die früheren Jahre erinnerte. Heiß wurde draußen geworben, die Agenten ließen trommeln: hundert Gulden Werbegeld, für den Tag zwölf Kreuzer. Während die Rotten zuströmten, schmolzen innen die Heere aus, zogen die neuen in den Schwund hinein; das leckende Rinnsal war nicht zu stopfen.
Heftigkeiten kamen vor. Gegen Artilleristen, die an sächsische und schwedische Händler Munition und Stückkugeln verkauften, verbanden sich Freifähnlein von Kürissern, legten sich in Hinterhalt, nahmen den Betrügern das fremde Geld ab; stießen einige nieder; sie selbst erzwangen sich Aufsicht über größere Waffenlager; ihre heimliche Verpfändung und Verschleuderung betrieb man dann im Verein. Offiziere wurden in solche Affären mit hineingerissen, gegen die Generalspersonen wurden die Vorfälle geheimgehalten, Mannschaften und Offiziere riskierten Posten und Leben. An der bayrischen Front und nach Schlesien hin brachen Fähnlein und Rotten aus, führten auf eigene Faust Krieg. Durch die schärfsten Mandate war Aldringen wie Graf Schaffgottsch bedeutet, jeden Kampf zu verhindern, Plänkeleien und Provokationen zu bestrafen. Die Truppen waren nicht zu halten, die Obersten mußten froh sein, wenn die Abteilungen von ihren wilden Exkursionen zurückkamen und sich den vorsichtig sanften Strafen beugten und nicht einfach beim Feind blieben. Die Offiziere gewöhnten sich, Spione und Vertrauensleute bei den einzelnen Regimentern zu halten, um jedem Ausbruch von vornherein zuvorzukommen; es war ein gefährliches Mittel, das sich oft gegen die Offiziere selbst richtete. Denn bisweilen verrieten sich die Spitzel, wurden erkannt, gegen die Offiziere wurden Anfälle unternommen, die Truppe wankte, die Führer mußten gewechselt werden.
In Böhmen gärte es am wildesten; hier waren keine Feinde, gegen die man sich wenden konnte; das Gros der Offiziere lagerte in Städten und Dörfern unter den Truppen, die Aufsicht war schärfer als an den Außenfronten. Um seine Soldaten fest in der Hand zu halten, hatte der Herzog zu Friedland den eisernen erbarmungslosen Christian von Ilow zum obersten Inspekteur ernannt. Ilow war aufgeklärt worden vom Kanzler Elz, dem Rittmeister Neumann, zuletzt aufs intensivste vom Grafen Trzka: mit aller Macht müsse das Heer bei der Disziplin erhalten werden; der Herzog brauche es parat und schlagfertig, dürfe keine eigene Regung in den Truppen aufkommen, sei jeder widerspenstige Offizier zu entfernen, revoltierende Regimenter aufzulösen und unter zuverlässige zu stoßen. In Ilows Händen lag das Amt des Inspekteurs gut, er hatte keine Ohren für die Klagen vieler Obersten: Truppen seien kein toter Körper, kein Stock oder keine Muskete, die man nach Belieben an die Wand stellt oder vorzieht; die Truppen brauchten Bewegung, Aufgaben. Man durfte nicht ohne Gefahr so zu dem langen Feldmarschall sprechen, er war rasch mit Roheiten da, drohte mit Profoß und Reiterrecht. Lethargisch bissen die Offiziere in den Eisenzaum, den man ihnen hinhielt; inzwischen zuckten die Tumulte weiter durch die Truppen. Böhmen wurde das Opfer hunderter kleiner Banden, die sich aus dem Heeresverbande loslösten, bisweilen eingefangen und zusammengeschossen wurden. Einzelner wurde man nicht habhaft; sie tauchten immer wieder bei den Regimentern unter, wie es hieß, gedeckt von den Offizieren selbst.
Um die furchtbare Neujahrszeit schien das ganze Land wie auf Signal von einem tobenden revoltierenden Truppenschwarm bedeckt zu sein. Zu Plünderung und Vergewaltigung ganzer Ortschaften kam es. Eine Reise Ilows mit Wallensteins Leibgarde mußte das Heer noch einmal in ein brütendes schreckvolles Schweigen zurückdrücken. Kurz darauf stießen aber Rotten aus Marradas Regimentern bei Budweis gegen abgeirrte spanische Truppenkörper vor, sie kämpften mit ihnen aus keinem anderen Grunde, als damit, wie sie sagten, keiner mehr zu ihnen käme; sie seien schon genug; die Spanier wurden empfindlich geschwächt. Die Entwaffnung der Meuternden bereitete wegen der Mißlaune der Truppen große Schwierigkeiten; es kam hinzu, daß Marradas nur bestimmten Kontingenten Waffen anvertraute, daß er aber, heimlich vor dem Pilsener Hauptquartier, nach Wien sich begab und flehentlich um Remedur der Verhältnisse bat. Es müsse eine Änderung in der Kriegführung eintreten, das Heer brauche kriegerische Ablenkung.
Er war nicht der einzige, der in diesen Wochen verschwiegen die Truppe verließ und nach Wien fuhr. Generalspersonen Obersten Kriegsoffiziere fühlten, daß der Boden unter ihnen schwankte. Ihrer selbst hatte sich zu einem großen Teil eine schlecht verhehlte Verdrossenheit bemächtigt. Um den Herzog scharte sich eine Elite von hohen Personen, seine Vertrauten, ein Geheimzirkel.
Ein Kern alter Offiziere war da, die unter dem Herzog alle deutschen Schlachtfelder abgegangen waren. Es kamen zahlreiche besonders italienische Herren, auch spanische dänische schottische, die der europäische Ruf Wallensteins angelockt hatte, die den Krieg kennenlernen, den entscheidenden Schlag Habsburgs gegen die schwedische Koalition miterleben wollten, für sich auf Abenteuer und Karriere ausgingen.
Sie wurden vom Herzog mit Geld gefüttert und dabei blieb es. Von Wallenstein selbst sahen sie nichts. Es hieß nur, er sei krank. Gerüchte liefen, daß er seine Widersacher diplomatisch am Kragen halte und im Begriff sei sie abzumurksen. Man erlebte keine ruhmreichen Schlachten, nicht die ergiebigen Kontributionszüge, von denen sich ganz Europa erzählte, aber ein verworrenes Herumlungern in Schlesien, einen erschöpfenden Lauf nach Fürth herunter gegen den Weimarer Herzog, dann Verstecken und Versinken in Böhmen, Winterquartiere Winterquartiere, wie vorher Sommerquartiere Sommerquartiere.
Da verfluchten viele Offiziere wie die Knechte den kaiserlichen Krieg und schlugen sich zu Bernhard. Die meisten aber blieben an der Futterkrippe hängen, und wie sie blieben, bildeten sie ruinöse Herde der Mißstimmung, der heftigen und ruhelosen Skepsis.
Hier schweiften herum und randalierten die Obersten Montard von Noyal, Sebastian Kossatzky, Petrus von Lossy, Männer, die der Herzog mit Vorschüssen für ein Regiment, andere, die er sogar mit Lehen versehen hatte, kritisierten Politik Taktik Strategie des Generalissimus. Er galt für überlebt, von seiner Krankheit gelähmt, für halb verrückt und verbohrt. Wallenstein war nur eine Ruine; Narren waren sie, daß sie ihm zuliefen, der nur den Namen des „Wallenstein“ trug. Es gab bei den böhmischen Truppen eine Anzahl Offiziere, die einen tiefen Haß auf den Herzog warfen, weil sie ihm angehangen hatten und er sie jetzt, in Politik und Diplomatie versunken, wilden aufgeblasenen Gesellen wie dem von Ilow aussetzte, die irgendwie seine Gunst ergattert hatten.
Trzka und Ilow erfuhren die steigenden Widerstände im Heer. Den Herzog suchten sie nach Möglichkeit darüber hinwegzutäuschen, und wo er etwas merkte, trieb er sie zu blutiger Entschlossenheit an; er haßte nichts so als Disziplinlosigkeit, sie war ihm zum Ekel. Aber unter dem Druck wuchs der Gegendruck, die Offiziere wechselten ihre Standorte, anderswo flackerte das Feuer auf, oder sie verschwanden und hetzten heimlich tückisch und rachsüchtig.
Schon früher waren der Friedländer und die hohen Generalspersonen Attentaten von heißblütigen Mannschaften oder Offizieren ausgesetzt. Jetzt seit dem Einmarsch in die böhmischen Winterquartiere flogen Pfeile in ihre Fenster und Zelte. Warnende Briefe fanden Ilows und Wallensteins Trabanten häufig in den Vorzimmern oder Gaststuben, wo sie nur von Offizieren hingelegt sein konnten. An klaren kalten Tagen ließ sich Friedland durch das Pilsener Lager in seiner Sänfte tragen, besichtigte Fähnlein, hielt bei exerzierenden Rotten, rief Knechte an, befragte unbekannte Offiziere. Es herrschte kein Mangel im Lager, Friedland trieb die Intendanten an, noch mehr von allem herbeizuschaffen: der Soldat, der ruht, müsse gemästet werden, sonst rebelliere er. Und dutzendmal fragte er Ilow und Trzka, als ob er mehr wüßte als sie, ob nicht die Offiziere, die jungen, älteren, über ihn herzögen. Er sah seinen Herren unter die Augen; nun, sie könnten über ihn herziehen, neben Profoß und Reiterrecht gäbe es noch eine wirksame Macht: das Geld, das Spiel, der Wein, die Weiber; daß man die Herren nicht verkommen lasse, das Heer verdiene sich das Prassen reichlich. Er erhöhte Sold und Gehälter, seine Sätze waren fast doppelt so hoch als bei einem anderen Heere. Ohne daß die Gärung nachließ und die Neigung, von ihm abzufallen.
Man wußte, er betreibe leidenschaftlich den Friedensschluß, er brauche das Heer so wie es hier war; und seine Umgebung erfuhr auch, wie das Heer, besonders die ausländischen Truppen, darüber dachten: eines Morgens wehte vor Friedlands Quartier in der Sachsengasse in Pilsen eine Fahne mit den Kirchenfarben, darauf war gemalt: „Wallenstein, der Friedenspapst.“ Einmal hing quer über dem Tor seines Hauses an einem Tau eine abgehäutete blutige Katze; darunter ein Fetzen Zeltleinwand mit der Schrift: „Wir haben kein Fell mehr, wir können nicht kratzen, wir hängen hier gut.“
Nur Neumann, Friedlands Sekretär, erfuhr von dem gräßlichen Getümmel, das in Wolfegg bei Pilsen entstand, als eine von Ilow herbeigerufene Kompagnie hier eingerückt war. Die unruhigen Truppen lockten eine Anzahl der herkommandierten Neulinge in eine mächtige Scheune, angeblich zu einem solennen Begrüßungstrunk. Dann war aber in dem Saal nirgends gedeckt und aufgetafelt, dicht stand Mann bei Mann; die neuen verschwanden völlig unter den andern. Sie erhoben, indem sich an mehreren Stellen zwei drei übereinanderkletterten, auf den Schultern ritten, von diesem Podium in der Scheune ihre Stimme, schmähten, verlangten Aufklärung. Ihnen gegenüber schwangen sich die Meuterischen hoch. Die sonderbaren Menschengestelle rückten und wanderten in dem durch Strömungen zerrissenen Gedränge gegeneinander, kamen voneinander ab, schwangen die Arme, Degen gegeneinander. Man hatte sich jäh aneinander entzündet. Das Gebrüll auf die herkommandierten „Verräter!“ wurde allgemein. Wie sie oben fochten, schrie man, sie sollten entwaffnet werden. Man stürzte die wandernden fechtenden schlagenden Menschensäulen, im Gedränge stieß man sie nieder. Schweden seien die Leute Ilows, wurde gerufen, sie seien Lumpen und Hundsfotte, wollten auf Kosten der andern sich fett machen, man brauche keine Mörder und Profosse mehr. In der sinnlosen Erregung brachen die Meuterer den größten Teil der Scheune ab, zündeten die Balken an und warfen die Waffen, Musketen, Piken, Partisanen der überwältigten fremden Kompagnie hinein, machten sich daran, geradewegs in die Stadt zu stürmen, um zum Herzog zu dringen.
Neumann, von der Lagerwache alarmiert, ließ die Stadttore stark besetzen, Feldgeschütz dahinter auffahren. Er selbst mit kleiner Begleitung fing die tumultuösen Truppen mitten im Lager auf; er war ins Lager hineingeritten, um der drohenden Gefahr einer Ausbreitung des Lärms bis zum Herzog zu begegnen. Ein dunkles Gefühl sagte ihm, daß im Lager jede signalgebende Erregung momentan niedergehalten werden müßte. Er tat, während ihn die Meuterer mit Fackeln auf freiem Stoppelfeld umstellten, als überhöre er ihren Ton und sähe nicht die durchstochenen Hüte und herausfordernd auf Stangen getragenen Wehrgehänge entwaffneter Ilowscher; er wandte sich scheltend an die fünf gefangen mitgeführten Leutnants und Fahnenjunker jener Kompagnie: was sie sich ankommen ließen in Wolfegg zu erscheinen. Ihre Antwort, es sei ihnen befohlen, überdonnerte er. Sie sollten fortmachen, ihre Eigenmächtigkeit würde sie teuer zu stehen kommen. Seine eigene Begleitung nahm die gefangenen Offiziere in die Mitte und führte sie in die Stadt ab. Eine Handvoll Mannschaften der Torbesatzung hatte den sofortigen Abmarsch der neuangerückten Kompagnie zu überwachen. Unter triumphierendem Geschrei zogen die Rebellen zurück. Neumann ritt finster in die Stadt, weihte nur Ilow ein.
Der Vorfall hatte sich kurz nach Schlicks und Questenbergs Besuch in Pilsen abgespielt. Die Vertrauten des Herzogs wußten, daß von kaiserlicher Seite das schwelende Feuer geschürt wurde, ohne daß sie Bestimmtes feststellen konnten. Unter ihnen war man einer Meinung, daß lange der Zustand nicht in der Schwebe bleiben könne; es könnte dahin kommen, daß Meutereien auf das ganze Heer übergriffen. Ilow verlangte einen großen Aderlaß für die Armee, und auch Trzka war dieser Meinung, nur müsse es auf dem Wege eines Feldzuges geschehen. Als Ilow achselzuckend und ärgerlich sagte, der Herzog wolle doch nun einmal keinen Krieg, lächelte Trzka bedeutsam; auch Neumann lächelte: es käme eben nur darauf an, gegen wen. Nämlich, um es kurz zu sagen, gegen den Sachsen zu kämpfen, vielleicht auch gegen den Schweden hätte der Friedländer wenigstens zur Zeit gar keine Lust. Aber da bliebe noch allerhand Feindliches, ein Feind, von dem man nicht viel rede, dem es der Herzog aber so gern antun möchte wie einem Schlangenwesen, daß er gegen ihn sogar selbst auf das Pferd steigen werde. „Und dieser geheimnisvolle Feind?“ Das sei nicht schwer zu erraten. Und als Ilow noch nicht ihr Lächeln durchschaute, wies Trzka ihn auf den Grafen Schlick hin, auf Questenberg, und was sie im Lager vorgebracht hätten, und wie sie dem Herzog die Waffen stumpf machen wollten.
Da blieb auch dem langen von Ilow erst der Mund offen. Er pfiff dann, ging sehr langsam herum; also gegen Wien, das sei aber ein verteufeltes Manöver. Oha! Und er konnte sich lange nicht beruhigen. Er kreischte dann leise lachend, dicht vor Trzka, den anstoßend: „Sie sind ja wehrlos! Wir können sie ja überrennen!“ „Nun ja.“ „Wir brauchen ja gar nicht kämpfen! Trzka, wir brauchen ja nur marschieren, Marradas kippt auf die Nase!“ „Um so besser!“ „Ein Witz, eine Komödie. Wer hat sich das ausgeheckt? Oha, ist das ein Spaß.“
Neumann aber, nachdenklich seinen aufgehobenen Degen betrachtend, erklärte drohend, es sei kein Spaß, man müsse von Tag zu Tag mehr auf dem Sprung sein, man scheine im Augenblick noch der Angreifer zu sein, bald werde einem nichts weiter übrigbleiben als sich verteidigen.
Im Lager und in der Umgebung Friedlands rief es keine Bestürzung hervor, als immer bestimmter die Gerüchte verlauteten, ein größeres Heer, hauptsächlich aus Italienern, von Spanien geworben, hätte die Alpen von Mailand kommend überschritten und ziehe in starken Märschen in das Reich. Auch an dem Herzog sah man keine Erschütterung; mit größter Anspannung beobachtete er die Vorgänge.
Der Mailänder Gouverneur mit einer nicht kleinen Armee hatte sich den ligistischen und aldringischen Regimentern angeschlossen. Es war das eingetreten, was man erwartet hatte; fast lautlos, während er in Böhmen saß, hatte sich die neue Phalanx gebildet. Gegen ihn. Die Phalanx, die er erwartete.
Und bald meldeten Spione aus Wien, eine hohe Deputation sei abermals im Begriff, den Hof in der Richtung auf Pilsen zu verlassen, um nunmehr bestimmte unausweichbare Befehle zu überbringen. Gleichzeitig wurde offenbar, daß es eine unsichtbare hohe, sehr hohe Stelle war, welche die Wühlerei unter den Lagertruppen unterhielt. So nahe an den höchsten Plätzen mußte diese Stelle sein, daß Trzka selbst Warnungsbriefe von anscheinend treuer Seite zugetragen wurden; er war ganz ängstlich und verwirrt, als er die Papiere aufknüllte und las, die höhnisch ihn selbst als Kaiserspion bezeichneten. Affären, wie die der Vertreibung einer sicheren Kompagnie, wurden aufgebauscht. Es wurde erzählt, eine Anzahl hoher Offiziere mit bestimmten Truppen unterschlügen Sold und Kontributionen und verteilten sie unter sich. Daß der Herzog vorhabe Frieden mit Schweden und Sachsen zu machen, um sich von ihnen mit Böhmen beschenken zu lassen und sich rasch seiner Verpflichtungen gegen das Heer zu entledigen, das er an den armen Kaiser verweisen wollte. Das eigentümliche gefährliche Element von Unsicherheit wuchs und wogte im Heere.
Da traf Trautmannsdorf und Questenberg in Pilsen ein. Niemand als Trautmannsdorf hatte sich zu dieser Mission bereit erklärt, er hatte nach dieser Aufgabe mit der Ruhe seiner besten Stunden gegriffen; Questenberg wollte er bei sich haben, um ein vertrautes Gespräch mit einem sicheren Mann führen zu können. Als Trautmannsdorf in Pilsen einfuhr, ließ von Ilow den Zutritt zum Lager auf allen Seiten sperren, jeglicher fremden Person war der Eintritt verboten; hinter Trautmannsdorf und seinen Begleiter hängte er eine Ehrenwache von zehn jungen ungarischen Kornetts. Neben die Wiener Herren stellte er sich selbst und zum Wechsel Trzka und Neumann. Den beiden Gästen sollte kein unbelauschtes Wort gelingen. Der verwachsene Graf war gegen die kriegerischen Herren von einer beleidigenden souveränen Kühle, man drängte ihn rasch vor den Herzog, als er keinen Blick für das imposante vor ihm aufgerollte Bild großer Kavalleriemanöver hatte.
Friedland ging in diesen strengen Wintertagen im Obstgarten seines Quartiers viel spazieren, erfreute sich seiner wiedergewonnenen Beweglichkeit. Der kleine Graf gedachte ihm fremd zu begegnen als Beauftragter des Kaisers, vermochte sich aber nicht zu behaupten, als der Herzog, im langen roten Mantel, auf das spanische Rohr gestützt, ihn herzlich begrüßte, nach dem Kaiser, Eggenberg fragte, bedauerte, daß man durch die Kriegsnöte persönlich auseinandergekommen sei. Und ehe Trautmannsdorf seinen Auftrag beginnen konnte, verwickelte ihn der Herzog in ein langes, von Späßen und Traueräußerungen unterbrochenes Gespräch über den alten Harrach, über die Hofärzte und anderes. Dann erst, immer dieselbe breite kahle Obstallee entlangspazierend, warf Friedland einen Blick auf den stummen dicken Questenberg und bemerkte kurz, er hoffe, der Herr habe den neulichen Besuch gut überstanden.
Das darauf eingetretene Schweigen war das Signal für Trautmannsdorf. Er knüpfte an diesen neulichen Besuch an, schilderte mit übertriebener Zaghaftigkeit die eigentümliche Situation des Kaiserhauses gegenüber Spanien und der Herzog möchte das angekündigte und nun erfolgte Heraufziehen des Spaniers auf den Kriegsschauplatz recht verstehen als eine Maßnahme, die ohne Zutun des Kaiserhauses erfolgt sei und die man auch nicht ohne schwere Komplikationen hätte verhindern können. Er fuhr dann fort: die Armee des Mailänders sei zwar leidlich stark und wohl bewaffnet, jedoch nicht stark genug, um jeder zu erwartenden Truppenmacht Trotz bieten zu können. Man möchte deshalb von vornherein jeden feindlichen Anschlag unmöglich machen, indem man die recht kleine Aldringische Schar auf eine entsprechende Größe brächte und ihr die vom Augenblick gebotene Beweglichkeit gäbe. Es möchte also des Herzogs Durchlaucht sich bequemen und bereit finden, solange er nicht die Winterquartiere verlassen könne, eine ausreichende Zahl von Regimentern dem von Aldringen zur Verstärkung und Verwendung zu gestatten.
„Es ist mir unmöglich“, erklärte freundlich der Herzog. Er wandte sich an den nachfolgenden Neumann, erbat sich ein Verzeichnis der Truppenstärke, wies, als es in Kürze kam, die Zahlen dem kleinen sehr ernsten, kaum hinblickenden Grafen: „Der Herr Graf wird sich selbst überzeugen. Zudem ist der Mailänder von mir angewiesen, rasch den Kriegsschauplatz zu verlassen oder nach Pilsen zu stoßen. Der Kurbayer muß Geduld haben; er wird nicht verlorengehen.“
Der Graf war nicht zu beruhigen; man müsse zunächst andere Dinge hintanstellen, die Notwendigkeiten des Kaiserhauses und so weiter. Trautmannsdorf, immer den Kopf vor der Brust, knaute und kam nicht heraus. Ruhig und sicher lachte der Herzog, der auf ein Trompetensignal gehorcht hatte; darum möge sich der Graf keine Sorgen machen; er erkenne sie wieder, den alten freundlichen Eggenberg und ihn, wie sie sich quälten, vielleicht wäre auch ein Finanzmann im Bunde, um sie zu vexieren; bei ihm läge der Kaiser und das Erzhaus wie in Abrahams Schoß. Er werde sich nicht verläppern. Der Friede sei näher als sie glaubten. Auch als Trautmannsdorf, der schwer beklommen war, ganz schwieg, blieb Wallensteins Ton freundlich; er stellte sich vor die beiden Herren, zog sie an den Gurten zusammen: „Nun wollen wir zusammen beraten, mein Herr Questenberg und Euer Liebden. Ich will mich wie ein rechtschaffener Angeklagter vor Euch, kaiserliche Vertreter, aufstellen und Ihr sollt schelten, was versehen ist.“ Questenberg nahm sich mit Gewalt zusammen: „Wir möchten Durchlaucht bitten, uns dies zu ersparen. Wir sind ja auch ganz und gar nicht als Ankläger hier.“ „Nun seht Ihr,“ unterbrach Wallenstein, der ihre Gürtel nicht losließ, „ernsthaft könnt Ihr nichts anklagen. Es soll euch auch bei Jesu schwer fallen. So gebt doch den Bayern frei. Was setzt man euch in die Ohren. Den Herren scheint es unbekannt zu sein, wie es der Bruder des bayrischen Kurfürsten, der Kölner, mit den Franzosen hält; Maximilian ist da nicht weit vom Schuß.“ Finster gab der Graf, der peinlich Wallensteins Hand am Gürtel fühlte, zu, daß man davon gehört hätte. „Nun,“ tönte der Herzog, seinen Stab schwingend, zurück, „das bedeutet nichts?“ Gezwungen lächelte der Graf, der ein paar Schritte machte, um den Herzog vom Fleck zu bewegen; schwerfällig folgte er auch; es schiene ja bald so, rang sich der Graf ab, daß nicht Wallenstein, sondern sie hier als Angeklagte ständen. „So nehmt doch Vernunft an, Herr Graf. Ihr seht meine Daten. Ihr antwortet nichts zur Sache. Greift mich an. Ihr gebt mir fast zu, was ich sage. Oder — seid Ihr nicht allein hier?“ „Was?“ warf Trautmannsdorf den Kopf herum. „Ich meine, Herr Graf, Ihr steht hier, ich kann Euch wohl sehen und sprechen hören. Aber hier sind noch einige mit Euch, die ich nicht sehen kann. Die sich vielleicht nicht — hergewagt haben.“ „Eure Durchlaucht kennen mich.“ „Ich weiß, es gibt schon Geister in Wien, die mich lieber am Morgen als am Mittag verspeisen möchten. Einige von ihnen tragen viereckige Hüte und schwarze Röcke. Es könnte auch sein, daß sie einen Mann wie den Trautmannsdorf zu Fall bringen.“
Der Graf kühl: „Ich habe mir die Regeln meines Denkens in der guten Schule des Aristoteles geben lassen.“ „Ich weiß, ich weiß, aber so antwortet doch. Ihr seid weder bestechlich noch dumm.“ „Ich will Eure Durchlaucht nur bitten zu bedenken, für wen wir in diesem Augenblick sprechen. Questenberg und ich. Wir haben die Majestät zu vertreten oder Weisungen von ihr abzugeben. So wollten wir Eure Durchlaucht bitten, und ich besonders — denn Euer Durchlaucht weiß, wie ich Euch anhänge, wie ich Euch nach Vermögen am Hof alle Wege geebnet habe, und daß mich keiner zu Bosheiten gegen Euer Durchlaucht anzustoßen vermöchte — ich wollte Euch bitten, gebt uns einen Augenblick nach. Wenn wir auch keine Krone tragen, so sind doch unsere Weisungen da — und was sind wir alle? Vor der kaiserlichen Majestät?“ Hart der Herzog: „Braucht nicht einen darüber aufzuklären, der sein Leben lang für den Kaiser gefochten hat.“ „Der Kaiser weiß, was er Euch zu verdanken hat.“ „Es scheint aber, andere wissen es nicht.“ „O wir —“ „Macht mir nichts, ob Ihr es wißt. Macht nichts.“ „Wir sind allesamt —“ „Kommt nicht darauf an. Meinem Herrn diene ich billig und begehr’ es allezeit zu tun nach seinem Willen. Die anderen lassen die Finger von mir. Jeder Verständige kann begreifen, daß ich nicht geneigt bin von meinem Vertrag abzugehen. Soll keiner mit mir Schindluder treiben. Mein gnädiges Erbieten an Euch zu verhandeln wird verachtet und für nichts angesehen.“
Die Herren schwiegen.
„Ihr sollt mir antworten, Herr, was Ihr gegen meine Gründe zu sagen habt über das spanische und bayrische Ersuchen. Ich kann die kaiserliche Armee nicht schwächen lassen.“ Sie standen immer an einem Fleck; der Herzog wandte sich jetzt, winkte ihnen, ging in das Haus voran.
Und auf dem Weg tauschte der kleine Graf keinen Blick mit Questenberg, dessen Augen er trostlos an sich fühlte. Er hatte die schwere entscheidende Sache mit sich allein abzumachen; die Kiefer biß er zusammen, seine Stiefelspitzen stießen vor, blieben stehen, stießen vor, blieben stehen. Sand, eine Matte, die Schwelle kam. Es galt nicht nachzugeben, nichts hören — sprechen, ein Horn vorstrecken; er sagte sich: „Mach dich steif, du kleiner Trautmannsdorf, denk’ an nichts, dies muß geschehen, du neigst zu Späßen, dies muß geschehen, höre nichts, dies muß geschehen.“
Die niedrige stark geheizte Ritterstube, Wallenstein ohne Hut und Mantel, mit hoher Stirn, weißbärtig, Platz anweisend, selbst auf der Bank an dem kleinen bunten Fenster. Dem Trabanten, der den Mantel hinaustrug, schrie er nach: „Türen schließen.“ Trautmannsdorf, dem andern ein Schweigezeichen gebend, beruhigte sich und hielt sich mit den Blicken fest an einer nach rückabwärts ragenden Hirschgeweihspitze der Krone an der Decke. Sanft und ohne sich von den funkelnden starren Augen des Herzogs beirren zu lassen, setzte Trautmannsdorf auseinander, daß vor der Kaiserlichen Majestät, wenn man sich ihr nicht widersetzen wolle, wenigstens in einem Punkt alle Unterschiede verschwinden müßten: man sei vor ihr Untertan oder Privatperson. Er führte das bezwingend aus. Der Herzog ließ ihn reden. Er sei Reichsfürst, und dies sei das eine. Und dann sei sein geschriebener und gesiegelter Vertrag da. Man habe schon in einem Punkte seinen Vertrag ohne ausreichenden Einspruch durchlöchert: indem Feria in Deutschland erschien, ohne von ihm dahin beordert zu sein, dann indem sich derselbe Feria seiner vom Kaiser verliehenen Befehlsgewalt entzogen und einen ganz unnützen Posten bei der bayrischen Durchlaucht einnahm. Er werde nicht nachgeben und tun, was unsachverständige Leute, ohne ihn zu fragen, beschlössen. Heimtückische Hiebe gegen seine Friedensbemühungen werde er zu parieren verstehen.
Da löste Trautmannsdorf seine Augen von der Geweihspitze. Ihm gegenüber auf der Fensterbank saß ein kalter Mensch, stützte sich auf ein spanisches Rohr, redete entschieden und unwidersprechlich. Er konnte da ohne Schwierigkeit aus seiner Gürteltasche ein geschlossenes gefaltetes Schriftstück ziehen und daraus vorlesen, daß dem Herzog zu Friedland, Seiner Majestät getreuen Feldhauptmann, ernstlich vorzuhalten sei, daß er durch seine Maßnahmen im letzten Feldzug die Sicherheit des Kaiserhauses, der Erblande und des Reiches sehr gefährdet habe, und daß die Majestät sich nunmehr auf Rücksprache mit ihren erfahrenen Ratgebern veranlaßt gesehen habe, zwei ihrer vertrauten Räte, den von Trautmannsdorf und von Questenberg, dazu dem Feldhauptmann bekannt und zugetan, zu ihm zu schicken und sie zu ermahnen, mündlich mit ihm die bayrische und spanische Affäre zur Zufriedenheit des Kaisers beizulegen. Sollte aber der Humor der herzoglichen Durchlaucht einer friedlichen Beilegung auch weiter nicht geneigt sein, so müsse ihr bedeutet werden, daß die Kaiserliche Majestät ihrem Feldhauptmann diesen Befehl gebe und in Ansehung des Ernstes der Umstände über den Kopf des Generalissimus den Obersten Anweisungen geben werde.
Diese kaiserliche Instruktion gab Trautmannsdorf dem Herzog, der sie, ohne sie zu lesen, eine Weile schweigend in der Hand wog. Dann las er sie aufstehend; legte sie, zu ihnen tretend, auf den Tisch. Als die beiden aufstanden, drückte Wallenstein dem kleinen ihn scharf fixierenden Grafen die Hand: „Ihr seid besser als der da.“
Wie sie sich, da sie den Eindruck hatten, er wolle die Sache bedenken, zu weiterer Gunst, Lieb’ und Gnad’ verabschieden wollten, meldete seine leise bestimmte Stimme, daß er sogleich ihnen seinen Willen vorhalten wolle. Er werde dem kaiserlichen Begehren nicht stattun, aber er werde es auch nicht verhindern. Er werde resignieren. Sie möchten einige Tage in seinem Hauptquartier verbleiben, um seine schriftliche Resignation mit auf die Reise zu nehmen.
Dem erschütterten Grafen drückte er noch einmal stark die Hand; er werde ihm den erwiesenen Dienst zu Gutem nicht vergessen.
Weder Trzka noch Kinsky wurde darauf von ihm, als sie nach einigen Stunden ihn aufsuchten, eingeweiht. Er ging in aller Ruhe mit ihnen und dem herbeigerufenen Neumann die Liste der Generalspersonen und Offiziere durch, um sich genaue Angaben über alle machen zu lassen. Er traf ein Grundgefühl bei ihnen, als er erklärte, es sei jetzt das Wichtigste die Schafe von den Böcken zu trennen und alles Unzuverlässige rasch abzustoßen. Über Aldringen lautete das Urteil schlecht, es war recht, daß er hinten in Passau oder sonstwo stand. Für Gallas sagte der Herzog gut; Fürst Pikkolomini, der treue ehemalige Kapitän seiner Leibwache stand außerhalb jeden Verdachts; man ging schrittweise die Listen durch. Über einige Männer, erklärte der sehr nachdenkliche aufmerksame und zugängliche Herzog, werde er sich noch informieren müssen. Er werde auch Zenno befragen, seinen Astrologen, über den und jenen. Das sagte er zum Schluß leise. Es machte auf die anwesenden Herren einen starken Eindruck: der sonderbar suchende Ton und mitten in den geschäftsmäßigen Beratungen der Astrologe Zenno. Sie fühlten: er trug sich mit etwas Außerordentlichem; er war bewegt, er sagte nichts, vielleicht mißtraute er ihnen auch.
Gegen Abend dieses Tages erklärte er nach der Tafel gegen Trzka, er resigniere. Man sei am Hof, anscheinend mit Einschluß des Kaisers, der Meinung, daß er Habsburg und das Reich verrate, es gäbe wohl Narren Schelme und Verleumder auch in seiner Umgebung, die geflissentlich so gefärbte Nachrichten nach Wien kolportierten. Man dränge ihm nun unmögliche Befehle auf, um eine Entscheidung herbeizuführen; er danke ab. Die weitere Durchführung der Listen erübrige sich also.
So bestürzt war Trzka, daß er dem Lagerkommandanten von Ilow nach einer Viertelstunde ohne Besinnung in die Arme fiel, in Ilows Wohnung, die er gedankenlos aufgesucht hatte. Das Faktum der Mitteilung hatte ihn widerstandslos getroffen, obwohl der Ton der vorangegangenen Unterhaltung Friedlands Entschluß schon angedeutet hatte.
Der mächtige von Ilow war keinen Augenblick bewegt. Nachdem er seinen Gast mit einem starken Wein beruhigt hatte, kam ohne weiteres aus ihm heraus, während seine gefleckten Augen auseinanderirrten, wie immer, wenn er sich entschloß: der Herzog brauche sie, er sei hilflos ohne sie, die Reihe sei an ihnen, einzugreifen. Später: daß Friedland von Abdankung rede, geschehe, um sie herauszufordern; er wolle wissen, woran er mit ihnen sei.
Das half Trzka auf die Beine; er fluchte, es sei schmählich, so vor Schlick zurückzuweichen. Dann hielt Ilow fest, die Kriegsoffiziere, einschließlich Generalspersonen und Obersten müßten alarmiert werden; Wallenstein sei der Entschluß, zu gehen, bei ihrer Listendurchsicht gekommen, sein Glaube in die Zuverlässigkeit der Truppen schwanke.
Die rücksichtslos in der Dunkelheit hereingerufenen und im Moment befragten Obersten, fünf, sechs, waren bis zur Verwirrtheit erschrocken und gaben eine Äußerung mehr oder weniger kläglich von sich: wie es mit ihren Gehältern werde und mit ihren Ausständen beim Kaiser, für die Wallenstein gebürgt habe und mit den Vorschüssen, die sie von ihm erhalten hatten.
Von Ilow, Trzka, Neumann und Kinsky besorgten durch Briefe und Besuche am grauenden Tag die Herbeirufung und Orientierung der Generalspersonen und Obersten der in der Nähe liegenden Regimenter. Bei der dann am Abend stattfindenden Besprechung im Pilsener Stadthaus berichtete Neumann, in feinen Franzosenschuhen auf einen wackligen Tisch steigend: der Entschluß sei offensichtlich dem Herzog nach einem beleidigenden Ansinnen der kaiserlichen Delegierten gekommen; es handle sich um dieselben Punkte, über die die Herren Obristen schon einmal auf Geheiß ihrer Durchlaucht beraten hätten: Abmarsch aus den Winterquartieren, die Spanier und wie und unter welcher Eskorte der Nachfolger der niederländischen Infantin aus Mailand nach Brüssel reisen sollte. Schon da schrien einige Offiziere: „Das kennen wir schon!“ „Er soll in Mailand bleiben.“ Es handle sich eben um Abgabe von Truppen, setzte nach beruhigenden zustimmenden Handbewegungen der kluge Neumann fort, sich auf seinem Tisch ausbalancierend. Diese Frage könne nicht am grünen Tisch in Wien entschieden werden. Ob etwa der Pater Lamormain neuerdings auch für Strategie kompetent sei. Unter dem Gelächter kam es einige Zeit nicht zum Fortgang der Erörterung, sämtliche dem Herzog Ilow und Trzka verbundenen Obersten waren zugegen. Ihr Urteil war bald fertig, es handle sich um eine der üblen Hofschikanen gegen den Herzog. Die nicht kleine Zahl derjenigen, die eine Änderung der Heeresverhältnisse wünschten, war ohne Zusammenhang; ihr Widerstreben — sie wagten sich nicht hervor — war auch rasch gemildert, als von Ilow tobend ausstieß, daß die Truppenabgabe im selben Augenblick vor sich gehen solle, wo der Herzog einen großen, noch nicht anzudeutenden Schlag vorhabe. Allgemein ausbrechender Lärm, Fragen, Jubel, Durcheinander. Freches Lächeln Ilows.
Der Lärm verhinderte fast, daß eine Deputation unter von Ilow, bestehend aus dem Obersten Bredow, Henderson, Losy und Mohr vom Wald gewählt wurde, die sich stracks zum Herzog in die Sachsengasse begaben. Sie wurden von ihm in der Schlafkammer, wo er mit Zenno konferierte, angenommen und unter Dank abgewiesen, da sein Entschluß gefaßt sei.
Am frühen Morgen aber, als sich noch Trzka selbst der erregten Deputation angeschlossen hatte und mit tränenden Augen unter den andern vor Friedlands Bett stand, gab Friedland still einen nach dem andern prüfend und lauernd anblickend, jedem langsam die Hand — sie durften sie nur an der Spitze der Finger berühren, er konnte sie schwer anheben — er vernähme ihr Verlangen, ihn bei sich zu behalten, gern, er denke an ihr Geld und ihre Zukunft; so werde er die Last weiter tragen und sie noch diese schlimme Zeit durch führen.
Von der Deputation wurde auf dem klirrenden Heimgang durch das schlafende Pilsen ein feierliches Freudenbankett beschlossen. Es geschah, daß auf ihm nachmittags von mehreren gar nicht sonst vertrauten Obersten im Überschwang der Erregung die Anregung kam, gemeinsam wie man hier sei, der durch Krankheit verhinderten Durchlaucht, ihrem weltberühmten Obersten Feldhauptmann, den sie sich wiedergewonnen hätten und der sie weiter zu Sieg und Ehre führen werde, ihren Dank für seine Sinnesänderung und Gnade aussprechen und durch einen gewandten Schreiber aufzeichnen zu lassen, daß sie zu ihm stünden. Das Schriftstück wurde von dem glücklichen Neumann, dem vor Freude weinenden Trzka während des tosenden Banketts verfaßt. Sie gebrauchten die stärksten Worte: gelobten statt eines körperlichen Eids alles zu befördern, was zu des Herzogs und der Armada Erhaltung gereichte und sich für ihn bis auf den letzten aufgesparten Blutstropfen einzusetzen, sie wollten jeden unter sich, der treulos und ehrvergessen wäre, verfolgen und sich an seinem Hab und Gut, Leib und Leben rächen, als wären sie selbst verraten. Mit einem einzigen riesigen Freudengebrüll, Säbelschlagen, Zerschmettern von Trinkgeschirr wurde das Elaborat in dem Bankettsaal aufgenommen.
In seinem Erker wurden zwei Tische übereinandergestellt, auf dem untern stand mit geschwungenem Degen der mächtige von Ilow; wer schreiben wollte, mußte zu ihm herauf. Bei der zunehmenden Wildheit mußten bald vier Trabanten mit gefällten Partisanen den Eingang zum Erker verwahren. Draußen watete und wankte mähneschüttelnd der schmerbäuchige Pikkolomini zwischen den Tischreihen, schrie italienisch, taumelte Arm in Arm mit Diodati zum Erker, brüllte: „O traditore!“, ohne daß man wußte, wen er meinte; Isolani hatte sich drei fremde Pelzmäntel über den Kopf gezogen, stürmte auf den Obersten Losy, der ihn höhnisch einen savoyardischen Affenführer genannt hatte, bedrohte ihn mit einer Tischplatte. Auch Trzka hatte das Bankett zu einer vollen Mette werden lassen, er ging mit gezücktem Degen einher, wollte jeden niederstechen. Der Erker war gedeckt, es unterschrieben Julius Heinrich von Sachsen, Morzin, Suys, Gonzaga, Lambry, Florent de la Fosse, von Wiltberg, Montard von Noyal, Pychowicy, Rauchhaupt, Kossatzky — dieser, nachdem er zweimal vom Tisch gefallen war und nachdem ihm die Saalwachen mit Hellebarden den Rücken gestützt hatten —, Gordon, Markus Korpaß, Silvio Pikkolomini, Johann Ulrich Bissinger, von Teufel, Tobias von Gissenberg, Juan de Salazar — er ritt mit seinem elefantisch massiven Landsmann Filippi Korrasko —, Lukas Notario, genannt nach seinem Gebaren das Wiesel, der finstere Schotte Walter Buttler, als letzter. Der schmächtige sanfte Christoph Peukher, der nackt, von allen Seiten mit Wein begossen, umherlief, um zu beweisen, daß er ein Mann sei; man vertrieb ihn mehrfach vom Erker, schließlich ließ man ihn zu; von Ilow warf ihn selbst aus dem Fenster in einen Schneehaufen, wie er sagte, um einen Schlußpunkt dem Elaborat zu geben. Die Offiziere drängten an die Fenster, bombardierten ihn mit Bechern und Schemeln im Schneehaufen.
Dem Grafen Trautmannsdorf und Questenberg wurde nach höflichem Empfang und freundschaftlichem Gespräch vom Herzog unter Achselzucken bedeutet, es hätten unvorhergesehene Zwischenfälle seinen bekannten Entschluß, zu resignieren, durchkreuzt. Er sehe sich tatsächlich seinem ganzen Lager, seiner ganzen Armee gegenüber und wüßte nicht wie aus dieser Schlinge heraus. Was die Detachierung eines Truppenkommandos für die Spanier anlange, so hätten sich die Offiziere gesträubt etwas anderes vorzunehmen, als was sich strategisch im Augenblick rechtfertigen ließe. Dabei müsse es denn sein Bewenden haben. Man werde es in Wien einsehen. Es sei auch nicht einfach für ihn, sich von der Armee zurückzuziehen; er bürge den Obersten und Offizieren für ihre Ausstände; wie die Finanzlage der Kaiserlichen Majestät sei, wüßten die Herren.
Trautmannsdorf fragte: „Danach vertrauen die Herren Obersten mehr Eurer Durchlaucht als der Kaiserlichen Majestät.“ Der Herzog unwillig: es sei nur der Unterschied einer räumlichen Entfernung, „ich bin ihnen näher.“ „Und die Befehle betreffend die spanische Verstärkung?“ „Der Graf Trautmannsdorf spielt mir Theater vor. Das ist ein großes Wort „Befehl“, und Euer Liebden gebraucht es gern, es kleidet Euch auch gut. Vergeßt darunter nicht die Tatsache, die ich Euch genannt habe. Mein Sekretär soll Euch einige schriftliche Aufstellungen mitgeben; Graf Schlick mag noch einmal darüber nachdenken.“
Hartnäckig Trautmannsdorf, in dem zum erstenmal Zorn gegen Wallenstein aufwallte: „Aber die schriftlichen unausweichbaren Befehle der Kaiserlichen Majestät?“ Das überhörte der Herzog, der langsam vom Tisch, an dem sie gesessen hatten, aufgestanden war und aus der offenen Truhe von der Wand einen gerollten gesiegelten Papierbogen hervorholte. Sich wieder unter Seufzen niederlassend, besah ihn Wallenstein mit undurchdringlicher Ruhe: „Dies ist das Siegel, das größere Siegel meines Feldmarschalls Christian von Ilow. Die Herren sollten Realitäten sehen und sehen wie es mit Worten steht. Haben die Herren schon hiervon gehört?“ Trautmannsdorf, mit Questenberg Blicke wechselnd, sagte bissig „nein“. Dann aber, als der Herzog ruhig vorlas, die Namen las, waren sie entsetzt und ihnen ging der Atem aus. Es war klar, daß sich der Herzog durch dieses Schriftstück der Offiziere versicherte für den Fall der Enthebung vom Generalat. Trautmannsdorf stöhnte unwillkürlich vor Erregung, so daß sich der Herzog unterbrach, ob er nicht weiter lesen sollte. Sie baten sich eine Abschrift des Reverses aus, die Friedland bereitwillig zusagte. Sollte ihnen gewiß kein Name unterschlagen werden. In eisigem Triumph geleitete sie der Herzog auf die Diele. Außer sich vor Wut, von Scham gelähmt reisten sie tags darauf ab.
An den nächsten Tagen nahm der Herzog selbst an Banketten teil, die man Ilow, ihm und Gallas zu Ehren veranstaltete. Ein trotziges prahlerisches Gerede ging bei dem Getafel um, Friedland beteiligte sich an jedem Umtrieb. Das Frühjahr sei vor der Tür, man wisse wozu man lebe. Junge Offiziere, dem Herzog zu schmeicheln, schrien, man werde den Wiener Intrigen Schach bieten; die Spanier würde man nach Spanien jagen, den Wiener Hof hinterdrein. Wallenstein aber fing von seinen Kreuzzugsideen an, als hörte er nichts; er wolle alle Truppen der ganzen Christenheit einmal zusammenfassen und sie gegen die Türken werfen; da sei ihm gleich recht katholisch oder lutherisch, die Welt wolle erobert sein, ein Hundsfott, wer jetzt die Fahne verlasse und die Wiedervereinigung der Christenheit störe.
In dem Erregungssturm, der das Pilsener Lager erfaßt hatte, arbeitete die Umgebung des Herzogs mit größter Entschlossenheit. Graf Kinsky, der Böhme und Franzosenfreund, in Pilsen herumgehend, brachte de la Boderie vor Friedland, einen Attaché Feuquieres, der den Augenblick für einen tödlichen Stoß gegen Habsburg gekommen hielt. Festlich wie immer schleppte der eitle Kinsky sein Opfer an, einen flinken Mann, die Nase lang gezogen, die Spitze gesenkt über den Mund. Beide erlebten, daß Friedland sie ganz anders empfing, als sie erwartet hatten. Beleidigend kurze schneidende Fragen wie an Bediente stellte er, Ablehnung jeder huldigenden und höflichen Phrase. Das Gespräch wurde italienisch geführt, ging von de la Boderies Erbieten aus, dem Herzog das Königreich Böhmen zuzusprechen, worüber Friedland mit eisigen Wendungen hinwegging, um selber sechs Fragen an den Unterhändler Feuquieres zu richten, vor allem: welche Sicherheit ihm Frankreich bei einem Krieg gegen Habsburg gäbe, wie man sich zu Bayern, Frankreichs Liiertem, stellen solle, worauf die Operationen gegen Habsburg hinausgehen sollten.
Der chokierte, gut informierte unsichere Unterhändler übermittelte erst nach Rücksprache mit Feuquieres, der in Dresden arbeitete, Antworten, daß man Wallensteins Groll Bayern und den Kurfürsten Maximilian opfern wolle, eine Million Livres jährliche Unterstützung ihm verspreche, fünfhunderttausend im Augenblick, den Waffenschutz Frankreichs; es müsse auf Wien losgestoßen werden. Einen persönlichen überfließenden längst vorbereiteten Brief des Allerchristlichsten Königs Ludwig brachte de la Boderie aus Dresden für den Herzog mit. Ein zufriedenes Knurren war die Antwort Friedlands; er warnte den Franzosen, sich einzubilden, daß er vom Kaiser abfalle. „Die Armee steht hinter mir,“ sagte er, „ich bin nicht gegen den Kaiser, ich will zum Frieden kommen, die Kriegspartei am Hofe wird sich fügen. Aber es sieht aus, als ob nun die bayrische und Jesuitenpartei herrscht am Hof, Spanien führt das Szepter. Bayern will seinen Spott an mir üben. Ich bezahle ihnen für jetzt und für das letztemal.“ De la Boderie verabschiedete sich, verständnisvoll sich verneigend, er wolle einen Vertragsentwurf aus Fontainebleau herbeischaffen.
Kinsky wurde von dem grausam ihn anfunkelnden Herzog im Saal festgehalten: ob er das dem Franzosen ins Ohr gesetzt habe, das mit Böhmen — die Franzosen wollten ihn mit dem Königreich Böhmen beschenken. Er zog den verwirrten, sich krümmenden Grafen durch den Saal am Ohr: „Ich werde Euch beseitigen lassen, wenn Ihr mich kompromittiert. Was hab’ ich Euch von Böhmen gesagt? Sagt mal! Ho, ja hi. Was habe ich Euch gesagt? Hat der Herr Verlangen nach seinen Gütern? Hi, ja hi, hihi. Erobere er sie selbst.“ Als Kinsky sprechen wollte, wies ihn der Herzog kreischend hinaus und schlug ihn in den Rücken.
Trzka fing den glühenden Kinsky schon an der Tür ab. Sie flüsterten zusammen; ein besonderer Bote war vom Herzog an den sächsischen Kurfürsten abgefertigt, Sesyma Raschin war aufgetaucht und hatte Aufträge für den Schweden Oxenstirn mitgenommen.
Während es im Lager brodelte, klirrte es metallisch angespannt aus dem herzoglichen Quartier.
Irrtümlich wurden von den Spähern Pikkolominis der Graf Trautmannsdorf und Questenberg gefangengenommen und einige Tage als vermeintliche Geheimboten Friedlands festgehalten. In Wien war mit dem Erscheinen Trautmannsdorfs und Questenbergs die gemeinsame Front hergestellt. Die geheime Kommission, die den Fall Friedland behandelte, gab in panischem Schrecken nach. Sie ging mit fliegenden Fahnen ins Jesuitenlager über. Geängstigt, mit Widerstreben zogen sie zu ihren Beratungen den brutalen Grafen Schlick hinzu; man hielt es auch für gut, den jungen schmächtigen König von Ungarn zu informieren, dessen hochmütige Abneigung gegen Friedland, den „anmaßenden Emporkömmling“, sonst alle abstieß. Nach der Gehorsamsverweigerung, dem offenen Rebellionsakt des Pilsener Schriftstückes war aber die Enthebung vom Generalat unvermeidlich geworden. Das Generalat sollte auf Gallas fallen, der in Pilsen saß und an den man nicht herankonnte; darum sollten zunächst Aldringen in Bayern und Pikkolomini die erforderlichen Absetzungsmaßnahmen in aller Heimlichkeit, Schnelle und Entschlossenheit betreiben. Man schickte zum Kaiser Ferdinand, um die Unterschrift zu dem Beschluß zu erlangen.
Inzwischen wurde auf die Kunde eines drohenden Angriffs in aller Eile die Wiener Stadtgarde alarmiert. Den hohen Würdenträgern in der Kommission krampfte sich die Brust zusammen, als sie die wenigen hundert Mann anrücken sahen, ärmliche Leute, die bei Tag ihrem Beruf oblagen, rasch ausstaffiert mit alten Waffen Musketen und Partisanen, die sie kaum zu handhaben wußten. Unter ungeheurem Hallo und Zulauf fuhren sie noch fünf leichte Feldgeschütze an, die Friedland im dänischen Feldzug erbeutet hatte und die man zum Schmuck auf Brücken aufgestellt hatte. Das Volk lärmte und ritt nebenher, Kinder schwangen sich auf die Lafetten, die Stadtsoldaten ließen sich von Küfern und Lastträgern helfen. Unter großer Lust der angestauten Masse wurden die Geschütze vor den Eingängen zur Burg in Stellung gebracht, die Fähnlein zogen in die Burghöfe ein, wo sie Zelte aufschlugen, Feuer machten und sangen. Es hieß unter ihnen, Zigeuner und die herumstrolchenden Unzufriedenen aus Ungarn hätten einen Raubanschlag auf die Burg vor. Unter den Herren oben wurde es wiedererzählt. Abt Anton flüsterte: „Wie wollen diese Leute einer friedländischen Armee standhalten.“ Eggenberg brach in ein widerstandsloses verzweifeltes Weinen aus, greisenhaft plärrte er; Trautmannsdorf schüttelte den Kopf, als er den hilflosen Mann in einer Kammerecke sah. Trautmannsdorf wußte nicht, daß der alte Fürst auch weinte, weil ihr Herr, der Kaiser, den er jahrzehntelang beraten hatte und dem er anhing, sich so hoffnungslos von ihnen getrennt hatte.
In Wolkersdorf Todesstille. Der Kaiser auf tagelangen Ausflügen. Von Rom, gewählt vom General der Jesukompagnie, war ein gebückter uralter Priester angekommen, wartete auf Ferdinand. Lamormain, der sich nicht mehr fähig fühlte, den Kaiser zu führen, hatte um Hilfe gebeten. Der schwarzröckige Fremde tappte unermüdlich durch die Gänge, stieg die Treppen auf und ab, nur vormittags schlief er einige Stunden. Lamormain schickte dem Greis zur Gesellschaft einen vornehmen Novizen. Der Alte freute sich, redete viel. Sie schlichen durch die Korridore, über die Treppen bis zum Dach, durch die Dachräume, die Treppen herunter.
„Weißt du, Kind, was Jesus gesagt hat. Du mußt es dir merken. ‚Weide die Schafe‘; er hat es zu Petrus gesagt. Ist ein Schaf ein vernünftiges Tier? Das mußt du dich fragen. Ein großer Mann, der unsrer gesegneten Gesellschaft angehörte, hat viel darüber nachgedacht. Jesus hat nichts von sich gegeben, was belanglos wäre. Die Schafe sind unvernünftige Tiere, sie sind vielleicht die unvernünftigsten. Sie haben Triebe und Begierden und weiter nichts. Du siehst, wie Jesus von den Menschen gedacht hat und welche Aufgabe er der Heiligen Kirche zuerteilte. Wir sollen sie führen und weiden, wir wollen wissen, wen wir vor uns haben; wir sollen also keine Leithammel sein. Petrus nahm den Hirtenstab und übte das Hirtenamt. Weißt du, mein Kind, wer wohl als Leithammel zu betrachten ist?“ „Nein, Ehrwürden.“ „Nun,“ er flüsterte, „wir sind ja nicht weit vom Schuß. Es sind die Fürsten Könige und Kaiser. Sie sind der Kirche danach untertan, ja eigentlich ihr Eigentum; denn was kann der Herde besser geschehen, als daß der sachkundige Hirt sie besitzt. Aber es ist eine Verwirrung eingetreten, die Gewalt triumphiert; kaum daß sich unser Heiliger Vater in seinem Land gegen die wildgewordenen Lämmer behaupten kann. Ach, wir haben noch viel Arbeit vor uns, mein Kind. Freu dich deiner jungen Knochen.“
Als der Alte seufzte, meinte der andre leise: „Lange bleibt der Kaiser aus.“ „Wir werden warten“, seufzte der Alte. Nach einer Weile: „Ein sonderbarer Schlag Mensch, ein Fürst. Sie sind etwas für sich. Das Volk spürt es. Als Priester wirst du deine besondere Meinung über sie haben, Kind. Sie sind fast die Schlimmsten der Unvernünftigen. Es ist gewiß, daß die Menschen von Natur frei sind. Ist ja doch jedes Lamm und Schaf, jeder Hund frei; er kann laufen wohin er will. Und der Hirsch, die Wanze, der Floh. Warum nicht der Mensch? Frei bleibt der Hirsch aber nur, solange es keinen — Jäger gibt. Eine Muskete überredet den Hirsch seine Freiheit aufzugeben, eine Muskete hat große Überzeugungskraft. Was die Könige Herzöge und Grafen in ihren Ländern tun, ist von dieser Art. Du wirst das einsehen. Wenn ich einen Hirsch einsperre, so übe ich damit kein Recht, sondern eine große Geschicklichkeit.“ „Warum läßt Gott dies zu?“ „Du bist nicht töricht, mein Kind. Gott ist noch nicht an der Reihe. Weil die Fürsten die Gewalt haben, glauben sie die Vernunft, den göttlichen Gedanken entbehren zu können. Niemand ist so Verwirrungen ausgesetzt wie ein Fürst. Sie verlieren den Boden unter ihren Füßen und rennen ins Leere. Ihre Völker können sie mit sich ziehen. Wir müssen uns der Fürsten bemächtigen, und wenn uns das nicht gelingt, der Völker. Wir dürfen nicht nachgeben und vor nichts zurückschrecken. Nur die Heilige Kirche wird die Menschheit von dem Abgrund zurückhalten.“
Vor einem hohen Wandbild blieben sie verschnaufend stehen; auf dem Schoß der blaumanteligen Jungfrau spielte das heilige Kind mit einem goldenen Buch. Sie stocherten weiter. Der Alte wies rückwärts mit dem Daumen auf das Bild: „Das Buch. Das Buch. Damit glauben nun unsre Schäflein zu haben, was sie brauchen. Jetzt sind sie die Herren. Wer lesen kann, hat Zugang zu Gott.“ „Das ist ja Ketzerei.“ „Nun, hast du einmal nachgedacht darüber, wer schuld ist an der Ketzerei? Luther? Huß? Ei was. Sie sind Betrogene. Es sind alberne flache Köpfe; es reicht bei ihnen nicht zu einem Betrug. Das Buch. Es war Sünde, uns ist es längst klar, die Schrift Laien preiszugeben, sie überhaupt schreiben zu lehren. Die heiligen Worte heilig zu halten, wäre wichtiger als alles andre gewesen. Die heiligen Worte hätten von Papst zu Papst mündlich überliefert werden müssen, und niemand hätte von ihnen hören dürfen, als die der Papst heranzog. Von diesem Baum der Erkenntnis können einfache Menschen nicht essen. Nun ist das Unheil geschehen, und was ist die Folge? Die Massenketzerei. Sie fußen auf der Bibel. Hast du das einmal gehört von den Prädikanten: auf der Bibel? Diesen Tonfall? Das klingt so stolz, als wenn einer sagt: das hat Lamez gelehrt, das hat Vitelleschi gefordert. Sie können, mein Sohn, ebenso sagen, sie fußen auf der Natur, der Tierwelt, den Sternen, auf den Kristallen, den Meerfischen, dem Schindanger. Denn was ist gesagt mit: Bibel? Ein Manuskript voll von Sätzen, von Silben, Buchstaben, Schriftzeichen, hebräisch griechisch lateinisch. Meine Augen gleiten darüber hinweg, ich finde dieses Wort, jenes, zähle zusammen l-o-g-o-s, es gehört schon ein Entschluß dazu, logos zu sagen. Ich steige, kaum ich meine Augen bewege, ins Geistige und — die geschriebene Bibel verschwindet. Mein Geist herrscht.“ „Ehrwürden hält nichts von der Heiligen Schrift?“ „Die Heilige Schrift nichts? Freilich. Wenn du stark bist und nicht erschrickst, Kind; sie ist in gewisser Hinsicht nichts.“ „In gewisser Hinsicht?“
„Eine Papiersammlung, ha, du brauchst nur einen Indianer fragen, ob ich nicht recht habe. Jeder Vogel wird es dir bestätigen. Male die Buchstaben der Bibel auf eine Sammlung Lebkuchen, gieße sie mit weißem Zucker genau nach dem Urtext; du wirst eine Kuh als natürliche Autorität hinzuziehen — sie soll dir sagen, ob das die Bibel oder Lebkuchen ist. Sie frißt das ganze Paket auf und du darfst dann kein Wunder von dem Tierdarm erwarten; was die Kuh später von sich gibt, ist ein Kuhfladen wie jeder andre. Verzeih — ja du lachst, Kind — ich will nur sagen, diese lutherische Kuh hat brav gehandelt, aber sie ist auch trotz des lutherischen Bekenntnisses unsre gute Kuh geblieben.“ „Ich verstehe.“ „Und machen wir erst diesen Schritt, so machen wir alle. Dieser Buchstabenglaube, sag’ ich dir, ist ein Rückfall ins Judentum. Weh dem, der glaubt, weil er zwei Füße hat, er könne auch allein aufstehen. Unser Glaube hat Freiheit, der Heilige Geist hat die Evangelien diktiert, er ist mit dem Papst. Nur mit dem Heiligen Geist ist die Freiheit. Wir werden ernstlich einmal daran gehen müssen, der Kirche und dem Papst die Bibel wieder zu erobern; wir müssen die Schafe vor dem Wahnsinn und dem Tod schützen.“
Gänge, Türen, Treppen. Sie stiegen ernst über die Holzdiele. Hinter den Fenstern des Erdgeschosses saßen sie, blickten in den Wald hinaus. Sie warteten. Ein Diener brachte ein niedriges Tischchen mit Äpfeln und Zuckerwasser. Der Novize öffnete vor dem Priester ein Fenster. Erfrischende Luftströme.
Ferdinand ließ sich vom Pferde helfen. Ein schnauzbärtiger älterer Mann bei ihm, fingertiefe Narben in dem entschlossenen kleinen Gesicht, das unten ein starker vorspringender Unterkiefer abgrenzte. Mit raschen Schritten an dem Geistlichen vorbei. Der Leibdiener holte bald den grauen Pater; der Kaiser dankte ihm, plauderte mit ihm; er wollte ihn abends empfangen.
In dem breiten, von Streben durchschossenen, wie von verschlungenen Armen gestemmten Gewölbe stand Ferdinand, heftig und leise diskutierend mit dem Schnauzbärtigen. Der trug zwei Pistolen im Gürtel, der Kaiser hatte ihn nach dem Überfall bewogen, bei ihm zu bleiben. Jetzt verlangte Ferdinand, weißgrau wie der andre gekleidet, in losen Kniehosen leicht schlotternd, tiefrotes Gesicht, Böckel solle mit ihm weg. Der widerstrebte. Dann wollte Ferdinand ohne ihn weg; man hätte etwas gegen ihn vor, einen Anschlag, flüsterte er ängstlich, es sei nicht ausgeschlossen, daß man ihn einsperren werde, um seiner sicher zu sein; gegen Kaiser Matthias und Rudolf sei auch dergleichen geplant gewesen. Der wollte es nicht glauben. „Es ist so weit,“ verharrte Ferdinand, „sie wollten den Herzog zu Friedland beseitigen, Friedland ist mein Freund, er hat mich hochgebracht; sie werden mich fassen wollen; sie wissen, wie ich denke.“ Der starke Böckel, der einen feisten runden Rücken hatte, listig um sich schauend: also Ferdinand sollte sich nichts vergeben, sie wollten mitnehmen, was sie tragen könnten. Gegen Abend sollte es sein; er wolle hinaus zur Vorbereitung; er tuschelte noch: der Kaiser solle sich keine Blöße geben bis da.
In ein Zimmer ging Ferdinand, den ein Schrecken beim Anblick des fremden Geistlichen befallen hatte, dann nicht mehr, lungerte in der Nähe der Tür herum, ritt angstvoll um das Schloß. Er mußte am späten Nachmittag noch mit dem Fürsten Eggenberg durch die Gänge promenieren; das Absetzungsmandat Wallensteins sollte unterschrieben werden. Zum erstenmal empfand Ferdinand fiebernd einen Haß auf den Mann, der ihn jetzt bedrängte und quälte. Er sah nicht die hündisch treuen Blicke des alten Menschen, er wartete, daß er ging. Was Wallenstein, pfui, pfui, sie sollten ihn zu nichts kriegen.
Als man zur Abendmesse gehen sollte, hing Ferdinand schon auf dem Pferde. Eine halbe Stunde lag Wolkersdorf hinter ihm.
Er dachte daran, wie ihn vor langer Zeit Graf Paar mit Gewalt entführen wollte. In einem Talkessel lagerten Böckels Gefährten; Ferdinand umarmte den eisenstarken Gesellen. Dann schrie er wie ausgelassen sinnlose Silben aus voller Kehle in die Luft, die anderen lachten. Er warf sich auf den bloßen Boden, zuckte mit den Armen und Beinen, knirschte, weinte, schäumte, schrie. Er ließ aufgestemmt bestäubt den Kopf zu Boden hängen. Ferdinand war schwindlig. Er glaubte ein Schlag träfe ihn. Man wollte ihn hindern, aber er fing an sein Pferd abzuhalftern, zu füttern; schüttete dem Tier Stroh und Heu auf, küßte es tränend zwischen die Nüstern, das ihn fortgetragen hatte.
In dieser ersten Nacht, wo er in einer leeren Scheune neben seinem Pferd zwischen den wilden Gesellen schlief, träumte er, er stünde wieder an seinem Fenster in Wolkersdorf; es klatschte etwas gegen die Scheiben, er stieg hinaus, sie nahmen ihn bei der Hand, liefen mit ihm durch den Wald. Aber er lief rascher als sie, er lachte, ließ sie los, berührte kaum den Boden mit den Füßen, nachschleppenden, flog und sank, und wieder lief er mit ihnen, lachte, rollte, flog, balsamische Luft wehte über ihn. Er sah auf, kein Tausendfuß, kein ekler Bauch war über ihm.
Er kicherte im Stroh, daß die andern aufhorchten und im Dunkeln sich seinen Namen zuflüsterten.
Jubel in Dresden über Wallensteins Abfall. An den Börsen in Hamburg Bremen Augsburg furchtbare Unruhe und Verhaltenheit; beklommenes Fragen nach dem Verhalten der Prager Judenschaft, die stark engagiert war; man hörte nur, daß weder der Primas Bassewi noch Graf Michna geflohen waren, daß sie also Friedlands Sache nicht verloren gaben. Beschreibungen des Pilsener Banketts liefen an den Höfen um; der Emissär Friedlands nannte prahlerisch in Dresden die Namen der Obersten und Generalspersonen.
Die neuen Friedensbedingungen des Herzogs langten am sächsischen Hofe an: Die spanische Herrschaft und Einmischung in Deutschland ist abzulehnen. Frankreich ist über den Rhein zu werfen, die Pfalz wird wieder hergestellt; der Herzog Bernhard von Weimar wird mit dem Elsaß oder einem Stück Bayern entschädigt. Der Weg zum Frieden wurde vorgezeichnet: Vereinigung des Herzogs mit Sachsen und Brandenburg; im Augenblick der Vereinigung kann dem Kaiser und den Schweden der Friede diktiert werden. Der dicke Johann Georg war störrisch zu nichts zu bewegen; er zwar wollte Frieden und ihm bangte um sein schrecklich verwüstetes Land, aber den abtrünnigen Herzog nahm er nicht an; das sei ein Bösewicht, ein Mann, der nichts bedeute, er wolle immer und immer nur den Frieden mit dem Erwählten Römischen Kaiser. Sein Feldmarschall Arnim rang entschlossen und hingegeben mit ihm und Kaspar von Schönberg Tag um Tag. Der geschehene Abfall des Herzogs machte seine Position schwieriger; nun war der Kaiser zwar machtlos, von Friedlands eignem Heer ohne kaiserlichen Rückhalt aber dachte der schmerbäuchige Herr niedrig; ja, in Johann Georg regte sich ein Gefühl, der schmählich verratenen Kaiserlichen Majestät gegen solche Hundsfötterei beizustehen. An die Zuverlässigkeit der friedländischen Armee glaubte er trotz des Reverses nicht; wenn die rechte und natürliche Autorität fehle, der Kaiser, werde die Ordnung im Heere verschwinden; auf Schlechtigkeit baue man keine Armee auf. Der Kurfürst und auch sein Kaspar von Schönberg hatten vor, die Situation in ihrem Sinn auszunützen; man werde dem Fuchs, der Sachsen unsicher gemacht habe, seinen Raub heimzahlen. Die Lage wäre wie vor Breitenfeld: Schweden und Sachsen sollten zusammengehen und diesmal dem Friedland einen Schlag auf das Haupt versetzen.
Neben Arnim arbeitete für den Herzog der junge Herzog von Lauenburg, ein schwärmerischer Verehrer Friedlands, in kursächsischen Diensten. Der fuhr, um jeden sächsischen Anschlag auf den Generalissimus zu verhindern, zu Bernhard; er weihte von seinem Vorhaben Arnim ein; Arnim knirschte und fluchte mit ihm in verschlossener Kammer; sie würden die schlimmen kursächsischen Pläne hintertreiben; sie dachten in Dresden schon den Friedländer in der Falle zu haben. Aber bei Bernhard von Weimar, dem lippenaufwerfenden überstolzen jungen General, begegnete er einer brutalen Kälte; er glaubte nicht an einen vollzogenen Abfall, das Ganze sei eine friedländische Finte, um sie ins Garn zu locken, prasselte ein Spottlachen über den Lauenburger: „Es müßte mit merkwürdigen Stücken zugehen, wenn der liebe Gott vorhätte, gerade mit diesem Friedland das Deutsche Reich zu erretten.“ Überdies fragte er, die Augen kneifend, was es auf sich habe, daß er und Arnim hinter dem Rücken ihres Herrn solche Pläne betrieben.
Der schweißduftende Fürst Pikkolomini bemerkte mit Wut, daß die Unterhaltung zwischen Pilsen und den beiden Feinden weiterging. Er schlug dem Federfuchser Aldringen in Passau rasche Schritte vor. Der war einverstanden. An Gallas, der im Pilsener Lager saß und vom Herzog nicht losgelassen wurde, kam man noch immer nicht heran. Aldringen ersuchte den Kurbayern, ihn mit einigen Truppen zur Exekutierung der friedländischen Absetzung zu beurlauben.
Man konnte Maximilian lange nicht zum Entschluß bringen. Er war in Passau anwesend, aber statt an den Beratungen der Herren teilzunehmen, betete er stundenlang. Der entscheidende Schlag stand bevor. Er war unsicher und zögerte die Handlung hin. Wenn man ihn bedrängte, brach Zorn und Feindseligkeit aus ihm. Sein außerordentlicher Stolz war von Friedland tief gedemütigt worden: jetzt sollte die Entscheidung kommen, die das Haus Wittelsbach vernichten konnte. Der Gedanke, das Haus Wittelsbach könnte vernichtet werden, dieser ungeheuerliche — und Schweden, Bernhard von Weimar oder Friedland könnten in Zukunft in Bayern schalten, lähmte sein Gehirn. Kuttner war bei ihm im Passauer Rathaus. Mit der Härte von Slawatas Gedanken setzte er dem schwankenden hilfesuchenden Kurbayern zu; es gelang ihm auf Stunden in Maximilian die Furcht um Wittelsbach zu verdrängen. Er lockte den Kurfürsten auf den alten Kampfgang gegen den Herzog. Da war keine Unsicherheit, Wallenstein mußte herunter.
Und als Aldringen mit seinen Regimentern abgezogen war, saß Maximilian noch im Passauer Rathaus starr auf dem Lehnstuhl am Fenster, hörte das Klappern der Pferdehufe. Wittelsbach war in Gefahr, auf wen verließ er sich? Friedland besaß ein großes Heer. Und diese hier! Kuttner hörte ihn plötzlich ächzen; die Scham glühte über Maximilian; steif und wild blickte der Kurfürst den andern hinter sich an, der sich umdrehte. Wie Kuttner gemartert das Zimmer verlassen hatte, knickte Maximilian auf den Knien vor dem Fenster zusammen; leidenschaftlich trieb er seine Gedanken hinter den Regimentern her, bettelte bei den Schutzheiligen, sich der Truppen anzunehmen, gelobte Geschenke Stiftungen, was es auch sein sollte. Er blieb auf den Knien, als ob er eine Antwort erwarte. Öffnete das Fenster. Die Straße war leer, Aldringen war weg.
Die Regimenter die Gebirgspässe überschreitend; über die Quellen der Moldau. In Neterlitz bei grausigem Schneegestöber holte sie Pikkolomini ein. Es konnte nicht gezaudert werden, die Obersten wurden eingeweiht; Pikkolomini wies ein mit kaiserlichem Siegel versehenes Befehlsschreiben vor, das alle Offiziere und Soldaten ihrer Pflicht gegen den bisherigen obersten Feldhauptmann, den Herzog zu Friedland, enthob und sie an den Grafen Gallas verwies, in Gallas Behinderung an ihn selbst, Pikkolomini und Aldringen. Unterschrieben war das Schriftstück vom König von Ungarn und dem Fürsten Eggenberg angesichts der Erkrankung des Römischen Kaisers. Ursache der Veränderung sei eine ganz gefährliche und weitausschauende Konspiration und Verbündnis des Friedländers, seine meineidige Treulosigkeit und barbarische Tyrannei, die das kaiserliche Haus um Land und Leute, Krone und Szepter zu bringen Vorhabens sei. Gewalt war die Losung, die der hitzige Italiener ausgab; er wollte, schwur er, den Skorpion auf der Wunde erdrücken; der schlaue ängstliche Federfuchser Aldringen ließ ihm seine Regimenter, er selbst zog träge mit seinem Stab hinterdrein. Ohne Zögern stießen die Regimenter unter Pikkolominis Führung auf Prag los. „Ich kann nicht warten,“ hatte der Italiener gespieen, „bis der Herzog in Prag ist.“ Die Stadt war gänzlich ahnungslos. Die Obersten der friedländischen Truppen verstanden nicht, was der Generalwachtmeister im Sinn hatte, als er sie, während seine Truppen in kriegsmäßigen Formationen mit Artillerie die Brücken der Stadt und den Hradschin besetzten, zu sich in das Altstädter Rathaus berief, das Enthebungsmandat vorlesen ließ, das gleichzeitig unter Trommelschlag auf Gassen und Plätzen verkündet wurde, und an sie die Aufforderung richtete, sich ihm zu unterstellen als dem Vertreter des Generalissimus Gallas. Erst während seiner Rede erkannten die Herren in dem dunklen Raum, daß Gefangene schwer gefesselt an der Wand hinter dem Italiener lagen, stöhnten, Offiziere, die dem Herzog zu Friedland eng verbündet waren, seine Lehnsträger. Den Wunsch zweier Obersten, sich über die Sachlage zu besprechen, beantwortete Pikkolomini zustimmend, aber diese Besprechung müsse bei der Gefährlichkeit der Lage in einigen Minuten zu einem für den Kaiser nützlichen Ende geführt sein. Die übrigen erklärten dem kaiserlichen Patent ohne weiteres Folge zu leisten. Sie kletterten verstört hinaus. Ihre Regimenter waren draußen mit Fähnlein der Aldringenschen Truppen untermischt; es wurde den Herren bedeutet, daß keine Unbill gegen sie beabsichtigt würde, aber man wollte sie vor Konflikten bewahren, sie möchten sich einige Tage von den Truppen fernhalten.
Im Anmarsch von Süden Marradas Truppen; überall lautete die Parole: „Wir wollen den Kaiser nicht verlassen, wir wollen die Schweden und Welschen aus dem Reich schlagen.“ Und dann: „Der meineidige Wallenstein; er will dem Kaiser Böhmen nehmen, mit Schweden und Franzosen will er sich verbinden; wir wollen ihm den Paß verbauen.“
Im Moment schlug die Stimmung des friedländischen Heeres in den Prager Quartieren um. Nach der ersten Verblüffung wirkte die Ankunft der fremden Regimenter wie eine Befreiung. Man hatte sie mißbrauchen wollen. Die Truppenkörper mischten sich; die neuen brachten unerhörte Nachrichten von dem Betrug, den man an den böhmischen verüben wollte. Wallenstein, der Gottseibeiuns und seine teuflische hochfahrende Sippe, der Nichtsnutz, der sich mästen wollte, Böhmen stehlen wollte, während sie in mageren Quartieren verkamen. Sie waren des Römischen Kaisers treue Soldaten; sie wollten ins Reich hinaus, sich ihre Beute holen; Gallas würde sie an den reichen Rhein führen; die Franzosen, ei, die Franzosen, in das schöne Elsaß.
In das prunkvolle Friedländerhaus auf dem Hradschin zog Pikkolomini ein. Da erst befiel ein Grauen die Stadt. Die Straßen leerten sich. Jeder versteckte, verschleppte, vergrub seine Kostbarkeiten. In jedem Viertel wurden die Gewölbe geschlossen, verbarrikadiert, ein großer Teil der wertvollsten Sachen nahe der Moldau nachts in Kästen vergraben. Die Juden bewaffneten sich. Keiner von den eingedrungenen Offizieren bemerkte, was in der Stadt vorging. Der Adel beriet hinter verschlossenen Türen an allen Teilen der Stadt und auf den nahegelegenen Gütern. Alle waren sicher: man hatte hinter Wallenstein zu stehen. Heimlich wurden die jungen Bauernburschen und Bürgersöhne, die sich bereit erklärt hatten, einem Zeichen zu folgen, alarmiert; man verteilte Geld und Waffen, gab Losungsworte aus. Eine Riesensumme wurde genannt als Preis für den Kopf des Grafen Wilhelm Slawatas; eine instinktive Wut bezeichnete allgemein den schönen Grafen als Hauptschuldigen an der erschreckenden Wendung; er war seit Wochen abwesend, jetzt hatte er sein Ziel erreicht. Von der uralten Gräfin Trzka erzählte man sich, sie sei auf die Kunde von dem Handstreich des Italieners nach Prag gekommen und hätte Dutzende von goldenen Ketten mitgebracht für den, der den Italiener ermorde. Überall lagen plötzlich Waffen, die auf dem Land herangeschmuggelt wurden.
Während dieser stummen Tage fuhr auch eine unscheinbare Judengesellschaft auf einigen Wagen aus Prag ab. Adlige der Landschaft machten ihnen selbst durch Pässe und Salvegarden den Weg frei. Sie mußten ihnen schwören, der friedländischen und böhmischen Sache hold zu bleiben. Da standen die trauernden Gesellen mit den gelben Zeichen am Mantel in der Kammer der Herren; ihr Herz war, seit Wallenstein lebte, mit ihm. Sie schworen, das kleine schwarze Mützlein aufgesetzt, die rechte Hand bis an den Knorren auf der Bibel beim dritten Gebot, verflucht auf ewig zu sein vor ihrem Gott Adonai, vom Feuer verzehrt zu werden, das auf Sodom und Gomorra fiel, wenn sie Untreue und Falsche brauchten. Der wahre Gott, der Laub und Gras und alle Dinge schuf, solle ihnen nimmer zu Hilfe kommen. Sie fuhren erst nach Norden, als ob sie auf den Markt von Brandeis fahren wollten, dann wandten sie nach Südwesten. Einige jüngere aus den Juden nahmen dann bei Brandeis Pferde, hetzten auf Pilsen zu.
Die Kuriere aus Prag mit ihrer freudevollen Meldung der Einnahme der Stadt fanden einen totenstillen Hof. Der Kaiser verschwunden. Seine Leibdiener in Eisen geworfen. Kein Anhalt über seinen Verbleib. Von der Kaiserin erfuhr man nichts. Sie, die in einer schweren dunklen Erregtheit nach ihm forschte, wurde nicht aufgeklärt; man versuchte sie zu beruhigen mit der Erklärung, der Kaiser fürchte in diesen Tagen in Wien zu bleiben; man hätte ihm empfohlen, sich ohne Aufsehen bei den Truppen des Marradas zu bewegen. Die leidenschaftlich ausfahrende, brüsk sogar mit den Priestern umspringende Erscheinung der Mantuanerin war in diesen schreckensreichen Tagen dem Hohen Rat der furchtbarste Anblick. Lamormain konnte sich nicht von ihrer Seite bewegen. Sie malträtierte ihn, forschte aus, was er von Ferdinand wußte. Der Pater suchte vergeblich sie zum Beten Beichten und zur Ruhe zu bringen. Das Flüstern Schreien Weinen Seufzen auf ihren Zimmern nahm kein Ende.
Eggenberg kam nicht mehr hervor aus seiner Wohnung; er fürchtete die Begegnung mit der Kaiserin; in einer dumpfen Geschlagenheit hockte er zu Hause. Kein Besuch durfte zu ihm. Über seinen Kopf stürzte alles zusammen.
Allein von den herumwandernden Vätern der Jesukompagnie wurde die freudevolle Prager Nachricht herumgetragen, und um sie herum merkte der Hofstaat auf. Die Riesenbeute würde an den Kaiser fallen, und was an den, und was an den. Die Kenner der herzoglichen Güter, des Prager Hauses, Gitschins wurden ausgeforscht: und plötzlich ging man hitzig suchend herum, belauerte sich, verteilte. Wer wollte urteilen, an wen sollte es fallen? Der Kaiser war nicht da, der König von Ungarn unerfahren, Eggenberg hatte sich von den Geschäften zurückgezogen. Nur Graf Schlick hatte noch eine feste Hand. Es würden ungeheure Besitzmassen zur Verteilung kommen, man würde nicht mit sich spielen lassen. Ansprüche wurden geltend gemacht. Verdienste behauptet, bestritten. Die Väter schürten; jedes Wasser auf ihrer Mühle war recht. Es gingen am Hofe verkappte und ehemalige sehr laute Anhänger des Friedländers, Offiziere, die er hochgebracht hatte. In Schmähungen erging man sich schon auf Pikkolomini und Aldringen; man gedachte sie bald zu kirren.
Der Marsch auf Prag wurde in Pilsen beschlossen. Schaffgottsch sollte aus Schlesien zur Unterstützung in jedem Fall herangezogen werden. Nach allen Richtungen lief augenblicklich der Befehl Wallensteins an Obersten und Generalspersonen zum Generalrendezvous der Truppen bei Prag. Er selbst werde sogleich dahin aufbrechen.
Wie aber der Herzog am Morgen nach der Konferenz sich in einer Sänfte ins Lager tragen lassen wollte, war die Stadt auffallend still, Straßen friedlich ohne Posten und Patrouillen, die Tore unbesetzt.
Der lange Ilow am Stadtausgang auf nassem Pferd anklappernd, herunterklirrend zur herzoglichen Sänfte, konnte nur melden, daß der Oberst Diodati nachts in aller Heimlichkeit die Einquartierung Pilsens gesammelt habe und in Richtung Prags abgezogen sei. Mit Diodati sei der schmerbäuchige spanische Agent Navarro verschwunden, der seit einigen Wochen in Pilsen herumpokulierte.
Am Abend dieses Tages, der den Befehl zum ungesäumten Abbruch des ganzen Lagers brachte, wurden in der Sachsengasse beim Friedländer, der über Diodatis Abzug die Achsel gezuckt hatte — der Schwächling gefiel ihm nie —, eine Gesellschaft Juden gemeldet, die sich schon seit Tagen in der Stadt herumtrieb und nicht abzuweisen war. Da die Juden gebeten hatten, allein mit Wallenstein zu sprechen, blieb nur Neumann in dem kerzenerhellten Zimmer. Sie warfen sich, beschmutzt vom Straßenkot, adlig gestiefelt und gespornt, sechs kräftige Männer auf die Knie, zwei ältere weinten. Ihren Primas, den Bassewi, hätten sie nicht mitbringen können; Bassewi sei gefahren, für den Herzog in Augsburg Geschäfte zu betreiben, er wollte gerade jetzt keine Stunde versäumen. Und dann holte ein älterer aus seiner grauen Kappe, die vor ihm auf der Matte lag, einen wunderlich bekritzelten langen Papierstreifen hervor und las, auf das düstere Nicken des Friedländers, das Absetzungspatent vor, während ihre langen Schatten sich auf dem Boden bewegten, das in den Straßen Prags ausgetrommelt wurde, als sie davonritten. Sie schlugen sich die Brust: der böse Pikkolomini sei in das herrliche Friedländerhaus eingezogen, mit List und Gewalt sei er über alle hergefallen; sie wollten dem Herzog Auskunft geben über alles und jedes, was sie gesehen hätten, er solle wiederkommen, rasch, rasch. Mit langem Schweigen hörte sie Wallenstein an. Er zitterte, getroffen auf seinem Schemel, zischte: „Die Canaille, die Canaille.“
Neumann mußte die Daten aufnehmen, die die Juden zu melden hatten. Was die Juden noch wollten, drohte der Herzog. Sie lagen wieder auf den Knien: er hätte sich ihrer soviel angenommen; die böhmischen Völker warteten seiner; sie hingen ihm an, er möchte sich ihrer erbarmen. Friedland schien ihnen nicht zugehört zu haben, sein Gesicht hatte die Blässe und Verzerrung zunehmender Wut, seine Augen wurden steif und abwesend; auf Neumanns Wink flüchteten die Juden auf den Zehenspitzen aus der Stube. Sie durften ihn auch am nächsten Tage nicht sprechen; Neumann riet ihnen, sich aus der Sehweite Friedlands zu begeben. Die Nachricht von der Besetzung seines Prager Hauses durch den schelmischen Italiener war tödlich heiß in Wallenstein gefahren. Wie vor Brennesseln wich er vor den Juden zurück, als er sie nahe dem Lagertor traf, wo sie in einem bittenden Haufen standen. Er wußte nicht, was sie ihm sonst vorgetragen hatten; sein leidenschaftlicher Schmerz.
Trzka küßte am Abend dem Herzog die Hände, schwur die Niedertracht an Pikkolomini rächen zu wollen und wenn es sein Leben koste. Der Herzog röchelte; er habe nie einen Menschen mit größerer Courtoisie traktiert als ihn; er fragte nach seiner Frau und der Schwägerin; sie saßen beide in Gitschin. Ilow sollte schleunigst ein paar Kroatenkompagnien auf Gitschin werfen; im Falle der Gefahr sollten die Frauen ihm nach. Nachdem sie lange stumm nebeneinandergesessen hatten — draußen knarrten schon die Wagen des aufbrechenden Heeres, der Lafetten; Pferde wieherten und stießen mit den Köpfen gegen die Fensterläden — gab Wallenstein dem kopfsenkenden Trzka leise Auskunft über seinen Brief an Ferdinand. Oberst Mohr am Wald und Brenner überbrächten ihn; er habe vor, sich außerhalb der Erblande an die Peripherie des Reiches nach Hamburg oder Danzig zurückzuziehen; ihm bliebe ja nichts mehr als zu sterben; seine Herzogtümer wollte er behalten. „Ist es Euer Ernst?“ flüsterte Trzka, ohne den Kopf zu heben. „Ich bin alt, Trzka, das ist wahr, und ich lebe nicht mehr lange. Meinen Brief werde ich überall veröffentlichen, sobald ich wieder Luft schöpfe. Er reißt ihnen die Maske ab. Du wirst sehen: es liegt ihnen nichts daran, ich bin ihnen auch in Hamburg im Wege. Die Jesuiten haben ein böses Gewissen, weil sie den Frieden in Deutschland nicht aufkommen lassen wollen. Darum wollen sie mich beseitigen. Der Kaiser will mein Geld, ich bin sein Gläubiger.“ „Die Herrlichkeit Pikkolominis in Prag wird nicht lange dauern.“ „Ich kenne sie in Wien. Sie scheuen die gröbste Ungerechtigkeit nicht, wenn sie ihnen in ihren Kram paßt. Mit dem Pfälzer wurden sie rasch fertig. Solange ich auf den Beinen stehe, werden sie ihre Not mit mir haben. Von Ungarn bis jetzt habe ich, Trzka, unter ihnen mich ducken müssen. Jetzt reden wir ein offenes Wort.“ Trzka schüttelte die Fäuste, unwillkürlich knirschte er mit den Zähnen: „Die ganze Armee steht hinter euch.“ „Und wenn es nur die halbe oder ein Viertel ist — wenn ich selbst meine zwei Beine behalte. Sie sollen keine frohe Stunde von mir haben. Trzka, alle Waffen sind im Kampf erlaubt. Ich schwöre auf die Armee nicht. Diodati ist nicht allein. Nicht geredet, lehr’ mich Menschen kennen. Es wird nicht leicht halten. Du suchst einige Kroaten aus, sie schleichen sich nach Prag, tausend Gulden für jeden, der mitläuft, zehntausend Gulden, wer Pikkolomini vergiftet oder erdolcht. Ich verlaß mich, daß Ilow sofort nach Gitschin reiten läßt und die Frauen in Sicherheit bringt.“
Es war dann nicht nötig, daß die bestürzten Herren Maßnahmen zur Heranziehung fremder Hilfe von sich aus trafen. Jetzt leitete Wallenstein alles selbst, mit Umsicht und größter Schärfe. In Pilsen wurden alle Pferde angespannt. Die Kriegskasse mitgenommen: Zehntausend Taler, sechstausend Dukaten, siebzehn Goldketten. Den Kreishauptleuten nahm man zehntausend Taler. Der Stadt Pilsen wurde vor dem Abmarsch noch eine Kontribution von dreißigtausend Talern auferlegt. Schweden, Sachsen, Franzosen wurden noch einmal mobilisiert, nach keiner Seite legte sich Wallenstein bloß; so unerschüttert war er. Graf Trzka schrieb verzweifelt an den jungen Herzog von Sachsen-Lauenburg, der sich noch um den Weimaraner bemühte: „Eile, Eile, Eile!“ Arnim wurde vom Herzog selbst aufgefordert, die entscheidenden Entschlüsse ungesäumt zu fassen; es sei, drohte er, die Krisis für Kursachsen; er selbst rücke zu einem Schlage auf Prag los. Der Kaiser werde aus Österreich geschlagen werden.
Das ganze Heer, aufgebrochen, rückte nördlich. Eine Unruhe und Unsicherheit war unter den Knechten aller Waffenarten und den unteren Chargen: Generalrendezvous der Heere war bei Prag befohlen, aber Kroaten mit leichter Artillerie flogen der Armee voraus, der Troß wurde kriegsmäßig gesichert. Man rollte auf gefrorenen Chausseen ohne Hindernis vorwärts. Plötzlich kamen Befehle von rückwärts aus dem Hauptquartier, das sich eben in Bewegung setzte: es seien Gerüchte verbreitet von Meutereien in Prag; allen wurde die strengste Zucht, widerspruchsloser Gehorsam befohlen, der Generalprofoß bereise das marschierende Heer, an das Reiterrecht wurde erinnert. Und kurz darauf: der Vormarsch sei zu beschleunigen, Prag werde bei Widerstand zur Plünderung auf sechs Stunden preisgegeben.
Man rollte durch stille Dörfer; Pfarrer, die man befragte, erklärten kleinlaut, von Prag seien sie angewiesen, auf allen Kanzeln Friedlands, des gewesenen Generalfeldhauptmanns, Absetzung auszuschreien; es laufe ein kaiserliches Mandat im Land um, er sei ein Verräter, darum sei ihm das Kommando abgenommen. Man fing schon vereinzelte vorspürende Aldringensche Reiter im Gelände, die wußten, daß sie den meineidigen Wallenstein hatten aus Prag jagen sollen; die Friedländischen hätten ihn schon verlassen. Trzkas Reiterei mit leichter Artillerie zehn Meilen südwestlich von Prag wurde von einem starken Aldringenschen Dragonerregiment gestellt. Die Dragoner fingen den Stoß auf, Trzkas Reiter wurden zurückgeworfen, sie fluteten zurück. Trugen Bestürzung in die langsam marschierenden Massen. Das ganze Heer, als wenn es gegen einen Wald von Piken liefe, wogte und rollte. Kleine schwerbewaffnete Kürassierpatrouillen mit Profossen und Henkern tauchten da bei allen Regimentern auf. Befehle kamen, den Marsch einzustellen, zur Formierung einer Kampffront.
Helles frühlingmäßiges Wetter. Wasserlachen, schmelzender Schnee auf den Chausseen. Anplantschend von allen Seiten lauschende Weiber, bekümmerte Bauern: von Prag sei in wenigen Stunden der Anmarsch der Kaiserlichen zu erwarten. Berichte von den Verlusten bei Trzkas Reiterei. Erschütterung, Erbitterung lawinenartig flutend über die gestauten Regimenter. Geflüster unter den Augen der Polizeipatrouillen: „Wir sind in den Winterquartieren. Kaiserliche! Wir sind Kaiserliche! Was will man von uns! Wer betrügt uns.“ Die Truppen auf den Feldern, zwischen den Dörfern, die nichts hergaben: „Vorwärts, vorwärts! Auf Prag. Wir warten nicht.“ Es tobte hin und her zwischen den Regimentern; vorwärts wollten sie alle, auf Prag, kein Kampf, man führte keinen Krieg mit Kaiserlichen.
Beim Regiment de la Moully fing es an; die Fuhrknechte zweier Hagelgeschütze hatten laut geschworen, sie würden noch morgen zum Heiligen Sigismund in Prag am Schloßgrab beten; sie wären aufgeknüpft worden; Korporale, Fouriere und einige Schlangenschützen waren über den Profoß und seine Leute hergefallen, hatten sie niedergeschlagen; die nahende Kürassierpatrouille schoß in den Haufen mit Pistolen. Darauf fiel die geschlossene Kompagnie über sie, zerriß sie. Geschrei und Getümmel dehnte sich über die nahen Regimenter aus, überall wurden die Patrouillen angefallen, entwaffnet oder niedergemacht, Gerichtswebel, Schultheiß, Stabhalter. „Nach Prag!“ tobte es, beim Regiment Altmannshausen, Rodell, Balbiano, Hamerl, Notario. Der geschlagene Vortrab ritt schon an mit weißbewimpelten Lanzen. Obersten und Offiziere folgten willenlos; das Heer schob sich vorwärts. Tumultartig überrannten sich Abteilungen, brachen seitlich aus. Schwere Artillerie blieb auf den Feldern stecken.
Da scholl Lärm, Freudengeschrei vorn, Marradassche Aldringensche Reiter, fast waffenlos, galoppierten unter den aufgelösten Verbänden! Sie hatten Befehle an die kommenden Obersten bei sich, eine Ordonnanz des neuen Generalissimus Gallas. Er drohte kraft des ihm erteilten kaiserlichen Patents, bei Vermeidung kaiserlicher Ungnade: keiner der Herren wolle mehr Ordonnanzen vom Friedländer Ilow und Trzka annehmen, sondern allein dem nachkommen, was er befehlen werde oder Aldringen und Pikkolomini.
Auf den Feldern zwischen Pappelständen und den zahlreichen geschwollenen Bächen gab es ein kurzes unordentliches Gefecht: fünf Kompagnien Trzkascher Kürassiere, erlesene deutsche Truppen, schlugen sich nach Süden durch, Wasser und Erde werfend.
Aus den südlich gelegenen böhmischen Sümpfen, aus ungarischen Salzfeldern waren sieben Teufel losgebrochen; häuserhoch, baumlang die Arme an den Schultern schleppend. Sie liefen geduckt im Frühlingswetter zwischen den Wäldern. Von Wolfsart war ihr Fell; knietief schlugen sie ihre Hufe nachts in die weichen nassen Äcker. Bei ihrem Trappeln, beim Trompeten ihrer Nasen stürzten viele Menschen tot um. Manche wurden bei ihrem ungeheuren horizontverdeckenden Anblick von der Lust ergriffen und davon bewältigt, mitzulaufen, nachzurennen. Sprangen an, hingen sich an die dicken Zotteln, krochen in dem Gedünst an ihnen hoch, grunzend und blasend wie sie, oft im Lauf zerquetscht an Felsen oder bei Flußübergängen ertränkt.
In Böhmen und Mähren bemächtigte sich eine rätselhafte Panik der Regimenter. Niemand wußte, woher der Schrecken kam. Immer lief ein Teufel hinter dem andern; oft rannten sie ziellos im Kreis. Es hieß, sie wollten durch das Reich an die russische See. Bei den Sachsen fingen die Fahnen an den stillstehenden Stangen zu wehen an. Das Regimentsspiel klirrte bei schwedischen Regimentern.
In den Wäldern hinter den schwedischen Linien, in der Oberpfalz, im versengten Sachsen schwemmten die Massen; aus Erdlöchern Ställen Ruinen Gräbern, wo sie sich verbargen, kamen sie. Halsfletschend: „Es gibt nur Katholische und Lutherische, Kaiserliche, Schweden, Bayern; es gibt sonst nichts auf der Welt. Schlagt uns tot.“ „Es kommt nicht darauf an, ob wir leben. Ein Bübchen, eine Weide, ein Wasser. Wir haben kein Recht zu leben. Müssen zu Mist und Erde werden.“ Sie schwemmten plündernd in Dörfer. „Ein Hundsfott, der von Kaiser und Christus redet. Sie haben es verscherzt.“ Gebrüll. „Ich schwöre den Kaiser ab.“ „Ich schwör’ auf Totschlag und goldene Münzen.“ Sie rissen, wo sie es sahen, Wappenschilder, kaiserliche Farben, Skapuliere, Rosenkränze, geweihte Ketten und Kreuze herunter. „Schlagwasser ist besser, besprochenes Papier.“ „Es ist ein Zähnchen von meinem Kind.“ „Es ist kein Zähnchen, Jungfer, Ihr habt es weihen lassen.“ Sie weinte: „Ich kann es nicht geben. Nehmt es mir nicht.“ „Du willst uns verraten.“ „Nein, Jesus kann nichts dafür. Laßt nur meinen lieben Herrn.“ Sie schlugen auf sie ein. „Ich bin kein Verräter. Ich bete für Euch, Gott wird Euch helfen. Glaubt mir, liebe Freunde. O wär’ ich schon tot.“
Bleich gebückt, niedergebrochen ritt vor einem heubeladenen Troßwagen neben dem starken Fuhrknecht ein Pilsener Bürger, ein etwas fetter Mann unter einem schwarzen breiten Lederhut; den hatte der Fuhrknecht auf seine Bitten mit auf den Weg nach Prag genommen. Wie die Verbände sich stauten auflösten, die Aldringenschen Reiter durch die Reihen galoppierten, steckte der Pilsener dem Knecht einen vollen Beutel in die Hand, löste das Begleitpferd vom Wagen, sprengte rückwärts. Slawata, schwindlig aufgewirbelt, hatte nur den Gedanken: wo ist der Herzog, wir verlieren ihn, er entwischt. Er hatte ihn in Pilsen belauert, jetzt: wo war er.
Einen halben Tag durch Getümmel und Schlägerei. Ihn fangen, ihn nicht entwischen lassen. Und dann der Jubel: Trzkas Kürassiere, Kompagnien, die westwärts zogen, nördlich an Pilsen vor den Wäldern vorbei, in der Richtung auf Mies.
Entlang dem Zug ritt Slawata: eine Doppelreihe langsam auf der Allee schreitender Musketiere, in der Mitte Dragoner zu Pferde, dahinter eine geschlossene Sänfte von zwei Pferden getragen. Berauscht ritt der ärmlich gekleidete Mann auf den Feldern in großer Entfernung hintennach, löste sich nicht von der geschlossenen Sänfte, deren Anblick ihm wohltat, die der Wind umblies. „Ich habe dir ein gutes Grab bereitet,“ flüsterte er vor sich, streichelnde Blicke herüber, „es wäre schade um dich, du wärst irgendwo gestorben in einem Bett und es wäre niemandem ein Glück damit geschehen. Ich freu mich für dich.“ Das Pferd stieß: „Es ist lustig, es spürt mich. Komm nicht so wild. Du sollst ihn ziehen, wenn er unser geworden ist. Wenn er so schön lang und still liegt.“ Das Pferd wieherte lustig, ging ruhiger.
Ihn überfiel, wie er einsam durch den Lehm nachschleppte, die Freude, die von rückwärts über das dunkelnde Feld über seinen Rücken herzuwuchs. Wie sich alles so jäh gewandt hatte, als wenn die Vorsehung ihm in die Hand spielte: das Heer zerrissen, keine Brücke zu Pikkolomini, die saßen drüben in Prag, konnten nicht an ihn heran, schrieben Erlasse, Proskriptionsmandate, Ächtungen, Vogelfreierklärungen: sie kamen nicht heran an den Friedland! Er, er, er hatte ihn, hier ritt er, allein, im Namen der ewigen Bestimmung. Drüben, wie schön, wie schön, trug man ihn in einer Sänfte. Die guten beiden Pferde; daß sie ihn treu behüteten; die Kürisser, daß sie ihn gut bewahrten. Er gehörte ihm. Er war ein Böhme, er war sein Vetter. Es hatte keiner Anspruch auf ihn.
Er labte sich an den Gedanken in der rasch fallenden Dunkelheit. Von magischer Sicherheit war er geführt.
Der Herzog bog in Mies ein. Und wie Slawata verzückt auf leerem Felde und willkürlos den Lederhut abnahm, ihm nachsah, marschierten von Süden Kompagnien an, klirrende, schwer gepanzerte Dragoner. Slawata mischte sich erschreckt unter sie, da schwenkten sie in das Städtchen ein, geführt von einer Trzkaschen Patrouille. Bis in die Nacht wartete der Böhme hinter dem Hause, in dem der fremde Oberst einquartiert war. Als er vom Herzog zurückkam, drang Slawata zu dem finsteren Mann fast unter Gewalt ein.
Er rang mit ihm zwei schwere Stunden. Dieser Oberst, der auf dem befohlenen Marsch nach Prag zum Generalrendezvous gewesen war, war eben vom Herzog unsicher gemacht worden durch das Angebot von zweihunderttausend Talern, wenn er bei ihm verbliebe bis zur Ankunft von Verstärkung; nur eine kleine Anzahl Truppen hätten angeblich gemeutert. Der Oberst, der das Pilsener Papier unterschrieben hatte, hing nicht am Herzog; er wollte das Proskriptionsmandat sehen, von dem ihm in der finsteren Kammer der Geheime Rat Graf Slawata sprach. Es gelang dem Grafen den verschlossenen Mann zu erregen und zum Fäusteballen zu bringen mit dem Hinweis auf das böse Gemüt des Friedländers, der nun offen von der frommen katholischen Sache abschwenkte zu den Sachsen und Schweden. Einen Bescheid, ob er sich des Herzogs bemächtigen wolle, erhielt er von dem schwer beweglichen Iren nicht. Der äußerte nur grimmig und einsilbig, er werde beim Herzog bleiben, da die Vorsehung es einmal so gefügt habe, und böse Pläne werde er zu verhindern suchen. Slawata flüsterte weggehend, dem Obersten bittend, beinah inbrünstig die Hände küssend: sie seien allein: die Sache der Heiligen Kirche und des Hauses Habsburg hinge von ihnen beiden ab.
Marsch von Mies in kühler, nebliger Luft auf Eger. Der Oberst hielt eisern seine Dragoner zusammen; fünf altsächsische Reiterkompagnien, die sich ihnen angeschlossen hatten, entwischten; zweihundert zu Fuß blieben. Wippende Moorwiesen, Wassertümpel, dürftige Krüppelbäume. Da hob sich der Grünberg, oben die Spitze der Sankt Annakapelle. Die Zitadelle von Eger. Obertor, Untertor von Eger schlossen sich nachmittags hinter ihnen.
Der einsame schöne Böhme wanderte abends zur Kapelle hinauf, sah auf die ruhige Stadt, lachte sich schauernd aus, wie er zurückschlenderte in der Nacht: er war ein Opfer seiner Leidenschaft, gurgelte er, konnte nicht von ihr lassen, wollte sich von ihr die Hände und Füße fesseln lassen. Nun kam bald die geheimnisvolle Stunde, auf die er so lange gewartet hatte.
Die Dragoner lagerten auf freiem Feld, der Oberst mit den Fahnen in der Stadt. Sie hinderten die herzoglichen Kuriere nicht aus- und einzulaufen. Im Stadthaus des Bürgermeisters am Markt saß der Herzog zu Friedland. Im Hof, eine Holzgalerie umlaufend; hinten quartierten sich ein Trzka Kinsky Ilow.
Zerbrochen, unbrauchbar der blasse eitle Graf Kinsky; er zitterte, wußte nicht, wie fliehen; schlich durch die Stadt, um das Haus, freundete sich hier an, dort an. Störrisch und böse der lange Panther, der von Ilow; er schlug sich mit dem Grafen Trzka herum, in den Stuben, beim Ritt: Trzka hätte die Aldringenschen zurückwerfen sollen, hätte ausharren müssen; wie, konnte er nicht sagen; Trzka gab nach, sie waren beide in einer verbissenen Unruhe. Die Meuterei hatte sie wie mit einer Flut von jäher Betäubung weggeschwemmt, sie waren verwirrt und verzagt aus Geheul und donnerndem Lärm davongestürmt, hatten nicht einmal gedacht, sich mit dem zurückbleibenden Herzog in Verbindung zu setzen.
Den erreichte Getümmel und allgemeine Panik erst, als blutende Polizeitruppen an ihm vorbeiflüchteten. Er verließ die Sänfte, die Steigbügel seines Leibpferdes wurden mit Seide umwickelt, führte im roten allen bekannten Mantel selbst die Kompagnien um ihn zurück. Über den Weg ließ er hinter sich in aller Raschheit einen niedrigen Wall aufwerfen, den eine Handvoll Schützen deckten; aber es war nicht nötig, daß sie sich in der klumpigen triefenden Erde eingruben; es dachte niemand von den Truppen an Verfolgung, alles war nach Prag. Spät erst, nach vier Stunden Ritt, legte er sich in seine Sänfte, eine Totenlarve hing ihm vor dem Gesicht. In Eger im Pachhelbelschen Hause gingen sie mit Scheu um ihn; Scham und Pein bei seinen Vertrauten. Er brach nicht in Wut aus. Aber sie sahen, daß er grausam an sich hielt, keinen Vorwurf machte, daß er in furchtbarster Gerichtsstimmung war, von seiner Rachsucht gegen die, die ihm das angetan hatten, ganz verschlungen war.
Untereinander maßen sie sich; sie wollten es noch abwarten, konnten sich vom Herzog nicht losreißen. Der junge Albrecht von Sachsen-Lauenburg, sächsischer Marschall unter Arnim, ritt in Eger ein, er schmähte schon am Tore auf Ilow und Trzka, deren Fahrlässigkeit das gräßliche Unglück verschuldet habe, das alle Chancen verschlechtert habe; vor dem Herzog zu Friedland lag er fast auf den Knien. Wallenstein, in schwarzem Pelzmantel gebückt mit untergeschlagenen Armen sitzend, die kleinen Augen graublau umrandet, spitze Backenknochen, trockener nackter Hals, die schlaffen Lippen zuckend, gab ihm heiser auf, dem Bernhard von Weimar zu Regensburg zu sagen, er verteidige sich hier in Eger mit den Truppen, die ihm geblieben seien; er werde die von der Panik mitgerissenen Regimenter wieder an sich ziehen. Bernhard möge gegen die böhmische Grenze vorrücken mit Berittenen, so viel er frei machen könne, auch solle er Fußvolk hinterdrein werfen, um die Artillerie zu schützen. „Sagt dem Herzog Bernhard,“ fausthebend Wallenstein, sein Blick hart und listig, „daß er sich ins eigene Fleisch schneidet, wenn er sich nicht beeilt. Ich werde mich hier verteidigen; man wird mich nicht zur Übergabe bringen, er wird mir glauben, daß ich gegen Gallas und Pikkolomini mich werde schlagen können. In zwei drei Wochen sieht die Armee des Kaisers anders aus und meine anders.“
Fiebernd nur von einem Pagen begleitet raste der Lauenburger fort, auf Regensburg, noch einmal im Streit Trzka anfallend, ihm den Mantel zerreißend.
Aus Eger erging ein Erlaß des Friedländers an alle seine Regimenter, von einer Zahl fanatischer Böhmen getragen: darin forderte der Herzog kraft seines Generalates und gemäß dem ganzen Respekt, durch den die Obersten an ihn von Kaiserlicher Majestät gewiesen seien, die Obersten auf, sich sogleich in Eger einzufinden, die Truppen in Laine. Er bediente sich zur Begründung in dem Mandat der Wendung, es geschehe im Dienst der Kaiserlichen Majestät und damit man dem Feind, wie er’s verdiene und wie sich’s gebühre, begegnen und sein Attentat verhindern könne. Denn wie der Herzog in Pilsen Juden vorgefunden hatte, so erwarteten ihn auf dem Wege von Mies nach Eger Haufen über Haufen adeliger bewaffneter Böhmen, die sich aus Prag und dem Egerland aufgemacht hatten, um sich mit dem Herzog zu vereinen. Er hätte keinen Reiterschutz für die Reise nötig gehabt, die Böhmen beobachteten alle Wege Wälder vor, hinter, neben ihm; sie traten nicht in die Stadt ein, die die Truppen hinter sich verschlossen. Auf das Bitten Sesyma Raschins ließ Wallenstein ein Dutzend von ihnen ein. Sie boten sich an ihn persönlich zu schützen; er war befremdet, böse, fand, daß die Herren in Prag sich nützlicher gemacht hätten, wenn sie Rebellion erregten. Er wurde dann stiller, schien gar nicht geneigt sie anzuhören; sie hörten, wie er im seitlichen Gespräch mit Trzka, der ihn beruhigen wollte, gehässig zischte, die Herren wollten ihn für ihre Zwecke mißbrauchen, suchten sich wohl einen König von Böhmen, er hätte mit dem kindischen Pack nichts zu schaffen. Nach einer ganzen Weile erst trat er wieder an sie heran mit gefährlicher Miene; sie sollten nicht meinen, daß er ihnen Zugeständnisse in irgendwelchem Belang mache, er wolle sie für allerhand Geschäfte annehmen. Smil von Hodojewsky, jetzt ein bärtiger leiser Mann, der unzähmbare kleine Berka, der gramvergorene Daniel Lockhaus stürzten vor ihm hin, küßten nacheinander dem Herzog die widerwillig hingehaltene Hand. Auch als die drei hinausgegangen waren, sprachen sie kein Wort. In einen Schuppen seitlich vom Hause zog Smil die anderen. Sie sahen sich an, umarmten und drückten sich. Auf den Anblick der leidend hochgezogenen Augenbrauen Daniels unterdrückte Smil das Schluchzen, das aus der erfüllten Brust in ihm hochwogte; sie ließen Daniel allein weinen und trösteten ihn. Sie würden Wallenstein erobern, noch jetzt, erst jetzt. Er hatte sie angenommen. Auch er hatte erfahren, was Habsburg ist. Sie würden ihn nicht verlassen. Eine gewählte Anzahl der Böhmen durfte in die Stadt zum Verteidigungsdienst, die übrigen sollten im Land schleunigst Rebellion vorbereiten und den Anmarsch eines gegen Eger ziehenden Heeres erkunden und belästigen. Ilow und Trzka bekamen den Befehl, die Verteidigung Egers in die Hand zu nehmen. Der Kanzler Elz wurde zu den nahewohnenden protestantischen Herren und Grafen geschickt, sie aufzubieten, auch zu dem Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach.
Der kam, ein vertrocknetes altes Herrchen selbst mit kleiner Begleitung angefahren, um sich nach den Umständen zu erkundigen. Wallenstein drang in den listigen zähen Gesellen ein, zu ihm sofort mit seinen hundert Territorialtruppen zu stoßen und zu alarmieren, wer ihm zuverlässig erschien. „Ich bin“, sagte der Herzog an diesem bleichen Morgen, „hierher gekommen nach Eger, um nunmehr den Kampf mit dem Kaiser in aller Offenheit aufzunehmen. Euer Liebden weiß, wie die Dinge im Reich stehen. Euer Liebden sind Reichsfürst und Protestant. Wir unterwerfen uns alle der Kaiserlichen Oberhoheit, aber nicht dieser. Ich habe sie gezwungen, in den letzten Wochen, die Maske abzulegen. Es handelt sich um die Niederringung der Religionsfreiheit und sie sind maßlos. Der Kaiser ist ihr Instrument; ich habe Nachricht, daß man nicht weiß, wo der Kaiser steckt; ich weiß, man hat den gütigen edlen Herrn beiseite gedrängt, als man gedachte vorzugehen.“ Dann: „Euer Liebden: die Reichsfürsten müssen sich besinnen; es ist hohe Zeit. Ich weiß, Ihr werdet mir vorhalten, ich habe wenig Grund, das Euch vorzuhalten, ich hätte selbst genug an den Reichsfürsten gesündigt als Kapo einer kaiserlichen Armada. Da habe ich geglaubt, einem Kaiser zu dienen. Ich bin gewaltsam vorgegangen wie ein Soldat, aber ich habe geglaubt dem Frieden dienen zu müssen. Ich bin auch widerstandslos gegangen, als man mich meines Generalates enthob. Jetzt hab’ ich nicht mehr den Wahn, dem Kaiser zu dienen. Ich habe die Zähne zu zeigen der eigensüchtigen Kamarilla, den verbohrten Scheinkatholiken, denn das sind die Jesuiten, die euch Protestanten die Treue absprechen und nicht als Menschen, geschweige als Fürsten und Herren anerkennen.“ Darauf knurrte der Kleine, er kenne diese unflätigen Lehrer, die die Grausamkeit und Unversöhnlichkeit predigen und die man totschlagen möge. „Ja totschlagen, Herr Markgraf. Da seht, wer totschlagen kann. Mich haben sie hierher getrieben wie einen Räuber und gedenken mich auch zu fangen wie einen Räuber. Wären mir die Regimenter nur gefolgt, wären sie überführt ihrer Falschheit und Bosheit und das Reich ginge der guten Beruhigung entgegen.“ „Ihr seid machtlos,“ krächzte später erregt der Herzog, als der dürre Markgraf von einem neuen großen protestantischen Bund redete, „laßt Eure Neuigkeiten, Ihr kommt nicht weiter vor Hader, wir haben es gesehen an dem Bund von Bärwalde, in Heilbronn. Schickt Soldaten zu mir, daß ich den Stoß der Kaiserlichen auffangen kann. Ich verlasse mich auf den Feldmarschall Arnim, Bernhard wird die Situation erfassen. Jetzt keine Eigenbrödeleien, Euer Liebden. In acht Tagen entscheidet sich das Geschick des Reiches.“ Der Kleine kaute: „Mich wird man nicht ausrotten können.“ Wild der Herzog: „Euer Liebden können mir vertrauen, ich habe lange genug die Fäden in meiner Hand gehabt; Ihr wißt, daß mein Name nicht ohne Klang ist. So will ich nicht Friedland und von Wallenstein heißen, wenn nach diesem Krieg von Euch Reichsfürsten mehr als ein Haufen von Edlen übrigbleibt, die jeder ausplündern kann. Das Heilige Reich verblast Ihr —“ „Was soll das?“ „Gebt mir Truppen. Jetzt, im Augenblick. Die Judasse, die das Reich verderben, kennt Ihr.“
Der alte Markgraf trabte ab; verärgert schimpfte er seinen Begleiter aus: „Ich mach’ seine Rebellion nicht mit. Das Mandat des Gallas paßt ihm nicht, und er denkt mich zu beschwatzen. Er wird den Reichsfürsten noch aus der Hand fressen, der Gernegroß, der böse Gewaltmensch. Sein großer Name: ha.“
In zwei Tagen hatte der Herzog, selbst ausreitend, die Kompagnien so in der Hand, daß bei stürmischem Schneewetter das Aufwerfen von Schanzen in der Stadt, die Aufstellung einer leidlich starken Knechtstruppe aus der Stadt und den Dörfern in flottem Gang war. Gegen die Offiziere erging er sich in groben Worten über die abgefallenen Regimenter, besonders über den treulosen Grafen Gallas und das usurpierte Generalat; er würde, wenn es sein müßte, gegen Wien marschieren und sie Mores lehren. Der lange Ilow und Trzka arbeiteten wieder in leidenschaftlicher Anspannung. Jetzt erst erschreckte Wallenstein, sein gräßliches marterndes Leiden mißachtend, seine Umgebung durch die alten tobsüchtigen Ausbrüche. Er bäumte sich gegen das Gefängnis dieser Stadt: der Kaiser müsse geworfen werden, das Reich in Fetzen zerrissen. Er werde einmal seine Rache für alles nehmen, von Ungarn angefangen bis Regensburg und Pilsen.
Er trug keine Schuh, in dicke weiße Verbände waren seine Füße eingeschlagen, sein Pferd mußte geführt werden. Im Lederkoller, den weiten roten Mantel unter seinem Federhut, der ihm zu weit geworden war, auf dem schaukelnden Pferderücken. Er war mit Riemen angebunden; vor Schwäche sank er oft nach vorn auf den Mund über die Mähne des Tiers und mußte hochgehoben werden.
Im Haus drückte er sein dick gedunsenes Gesicht gegen das Fenster, knirschend: „Sie haben es erreicht. Ich wollte Frieden machen. Da ist er. Hin. Da lieg’ ich.“ Leise zu Trzka: „Ich sage dir: das Römische Reich ist nicht zu retten. Ich konnt’ es nicht. Ein anderer wird’s auch nicht können. Ich nehme Gott zum Zeugen, daß ich’s versucht habe.“ Seine Lippen baumelten und zitterten.
Da hielt es Slawata in Gemeinschaft mit dem Oberst des abgefangenen Regiments und angesichts des Zulaufs aus dem Land nicht mehr an der Zeit zu warten. Er war durch die täglich zahlreicher andrängenden böhmischen Freiwilligen — schon waren fünf ganze Kompagnien vor den Mauern — in stündlicher Gefahr erkannt zu werden. Der gedungene Oberst Butler war des Wartens schon lange überdrüssig. Als der Einfluß des Herzogs auf sein eigenes Regiment sichtbar zu werden begann, als Trzka frohlockte, Bernhard von Weimar rücke von Süden an, Arnim von Norden, das ehemalige friedländische Heer sei noch in voller Unordnung, sie würden ein leichtes Schlachten haben, kam Butler mit Slawata überein, augenblicklich in dieser Nacht die Exekution vorzunehmen und den Herzog samt seinen Begleitern vom Leben zum verdienten Tode zu befördern. Der Kommandant Egers mußte eingeweiht werden, weil man vor Beginn der Nacht ein paar Dutzend zuverlässige Dragoner, die draußen im Freien kampierten, einlassen wollte. Man konnte diesen Mann, der entsetzt war, einen Obristleutnant Trzkas, nicht gewinnen; er war nur bereit, diese Nacht das Kommando an Butler selbst abzugeben. Aber sie konnten sich damit nicht abfinden; der Kommandant mußte seine Wohnung in der Zitadelle zu einem Bankett hergeben, mußte dem Bankett vorsitzen.
Es war des feinen Grafen Slawata letzte Bewegung in dieser Sache. Sie ließ ihn, wie sie vor der Vollendung stand, los. Eine Schlaffheit befiel ihn, er ging in Unruhe durch die Gassen; Ratlosigkeit, Mißtrauen höhlte ihn aus. Vor einem verendenden Pferde stand er neben dem Karren des Schinders; übel lief es ihm im Mund zusammen. Er bewegte sich zitternd fort. Aus der Stadt weg verlangte ihn. Vor dem Pachhelbelschen Haus strich er; ob er mit Kinsky sprechen sollte; worüber? An den Vorbereitungen zum Bankett nahm er nicht Teil.
Die friedländischen Vertrauten gaben sich nach den schweren Erregungen der Tage gern zu einem Fest her, in dieser düsteren Stadt, vor der ihnen schauderte. Sie tauten auf, der gewalttätige Ilow, der blonde Graf Trzka, Kinsky mit der unglücklichen Miene, der schmächtige trotzstarke Rittmeister Neumann, unter der munter zusprechenden Gesellschaft. Sie tranken und tranken; das herrliche Bankett im Pilsener Lager erstand vor ihren Augen. Schon angetrunken, in himmlischer Stimmung gingen sie zur Durchsicht eben abgegebener Depeschen in ein Nebenzimmer, ließen sich das Konfekt nachtragen. Da folgten ihnen auf ein Zeichen irländische und italienische Hauptleute und Oberstwachtmeister, voran ein gewisser Deveroux, gegen den ein Haftbefehl wegen Erpressung und gemeiner Notzucht vom Herzog vorlag, mit Piken, gezückten Degen und Pistolen in das abseits gelegene Zimmer, stießen, sich anfeuernd, das Gebrüll: „Es lebe Ferdinand!“ „Wer ist gut kaiserlich?“ „Viva la casa d’austria“ beim Eintritt in das Zimmer aus.
Das Zimmer hatte nur eine Kerze, vor der die vier Herren lasen. Der Kommandant nahm die Kerze vom Tisch; wie Kinsky, der heulend auf die Knie sank, zwischen Hals und Kragen durchbohrt sich lang ausstreckte, stürzte dem zitternden Kommandanten die Kerze aus der Hand. In einer Zimmerecke wurden Ilow und Trzka, die rasend mit bloßen Armen schlugen, da sie im Gedränge nicht an ihre Degen herankamen, durch Schläge der Piken, zahllose Degenstöße im Finstern niedergemacht; sie wurden zerdrückt, daß man sie kaum an Armen und Beinen aufheben konnte, als man sie zum Fenster auf den Hof werfen wollte. Der Rittmeister Neumann entwischte im Dunkeln aus dem Raum, auf dem Gang zum Bankettsaal lief er in die vorgehaltenen Partisanen der Posten.
Deveroux, rasselnd mit dem metallbeschlagenen Mantel, torkelte unter Gebrüll und Gejohl mit einigen Dragonern durch die mondhellen Gassen von der Zitadelle in die Stadt, auf den Markt. Er schlug in seiner Betrunkenheit mit seinem Degen Funken aus den Steinen vor Wallensteins Haus, schmähte laut den Herzog, lachte, bis Butler ihn tief erschrocken hereinzog. Die Wache an der fackelhellen Treppe zu Friedlands Zimmer wollte der lauten Gesellschaft den Weg versperren; sie warfen den Posten die Stufen herunter. Grölten, schoben sich gedankenlos von Stufe zu Stufe.
Da kreischte hinten einer, krachte die Treppe herunter, das Geländer schwankte. Sie sahen sich vorne um. Ein schmächtiger rasender Mann drängte sich, einen Dolch schwingend, durch sie herauf, zischte. Sie wichen verblüfft seitlich. Oben schlug er Deveroux, der die Arme in den Hüften aufgestemmt sich über das Geländer bückte, mit den Fäusten und dem Dolchknauf ins Gesicht. Lief, wie der stöhnend den Kopf beiseite wandte, vor ihm in den Gang zur Kammer des Herzogs.
Ein Kammerdiener stand da mit einer Kerze, der eben dem Herzog auf einer goldenen Platte eine Arzenei in Bier bringen wollte. An der Tür der Kammer schrie der leichenblasse Mensch mit dem Dolch — seine schmutzige Kappe fiel hinter ihn, die langen blonden Locken hingen ihm strähnig wild über die Augen — nach dem Oberst. Verzweifelt kreischte er: „Weg! Weg hier! Wo ist Butler!“ Heulend, mit schnarrenden Zähnen, bibbernd lag Slawata unten im engen Gang auf den Knien, streckte bettelnd den Arm nach ihnen aus. Sie hatten die Wämser zerrissen, die Stiefelschäfte herabgetreten, die Hosen von Wein und stürzenden Speisen und Fisch besudelt; die blutbeschmierten Gesichter streckten sich vor. Sein Mund öffnete sich weit, im Schuß stürzte Erbrochenes heraus. Er stöhnte: „Holt den Oberst. Geht eurer Wege.“ Als sie über die Lache traten, tastete er sich hoch. Er wimmerte, raste in Haß und Entsetzen. Seine Stimme überschlug sich, er schwang schützend vor der antrampelnden Horde rechts und links seinen Dolch. Hinter ihm wurde die Tür geöffnet. Er stürzte nach rückwärts lang vor die Kammer, von einem entsetzlichen Partisanenhieb quer über den Kopf zertrümmert.
Dem Herzog, der im weißen Schlafhemd mit ausgespannten Armen neben Slawatas zuckendem Körper stand, riß die Partisane die halbe Brust auf.
Die Worte: „Schelm, du mußt sterben!“ tönten in der verwüsteten Schlafkammer noch von den tosenden, als er schon längst ausgeblutet war. Butler trat mit Peitsche und Pistole unter sie und jagte sie aus dem Zimmer.
Von der verschneiten Zitadelle wurden Knechte befohlen, die Friedlands Kanzlei besetzten. Sie ergriffen einige höfische Begleiter in den Betten. Der Astrolog Zenno wurde aus seiner Stube geführt; er war im Begriff den Zeitpunkt einer neuen Aktion zu bestimmen; man zog ihm viertausend Kronen aus dem Beutel, die Friedland für Berechnungen vorausgezahlt hatte.
In vorgerückter Nacht sprengte man die Tür zur Stallung eines Privatmanns. Die Kutsche wurde auf die Gasse gerollt. Soldaten spannten sich vor. Der tote Friedland war in den roten bluttriefenden Fußteppich seines Zimmers eingeschlagen. Holterpolter zerrten drei Mann ihn die Treppe herunter, zur Haustür heraus. Ließen ihn beim Mondenlicht rasseln über die Steine, den dünnen Schnee, die Frostschalen der Wassertümpel. Quer lag er im Wagen; der Teppich hing zu beiden Seiten heraus.
Sie konnten an ihm tun, was sie wollten. Das war nicht mehr Wallenstein.
Ein gurgelnder Blutstrom war aus dem klaffenden Loch an seiner Brust hervorgestoßen, wie von Dampf brodelnd. Mit ihm war er davon.
Wieder eingeschlürft von den dunklen Gewalten. War schon aufgerichtet, getrocknet, gereinigt, gewärmt. Sie hielten ihn murmelnd, die starblinden Augen zuckend, an sich.
Gegen Morgen wurde eine Treibjagd auf die Böhmen in der Stadt veranstaltet, mit den Kompagnien vor der Stadt an den Schanzen war ein regelrechter Kampf zu führen; zuletzt flohen sie und zerstreuten sich. Die Sieger fürchteten sich dann in der Stadt und glaubten, die Schweden oder Arnim rücke bald ein. Aber sie hatten die Freude den Herzog von Lauenburg abzufangen, der glücklich von Regensburg kam, um dem Friedländer den baldigen Aufbruch Bernhards zu melden; des Lauenburgers Page entkam nach Regensburg. Sie hätten auch Arnim beinah abgefangen, der über Zwickau langsam und zweifelnd anmarschierte; das Mordgerücht kam zu ihm. Gelähmt von Ekel und Entsetzen blieb er liegen. Die flüchtigen Böhmen trugen die Nachricht ins Land hinein.
Sie lief zugleich mit dem Gerücht herüber: Welsche, Italiener, dazu Irländer hätten den Mord verübt in ihrer alten Abneigung gegen die Deutschen. Es kam in dem noch schäumenden Lager von Prag unter Pikkolominis Regimentern zu Revolten, Deutsche gingen gegen Welsche vor. Zwischen Offizieren begann es mit tödlichen Duellen, die Knechte lauerten sich in Fähnlein gegenseitig auf. Aldringens und bayrische Regimenter marschierten gegen die Empörer heran, warfen alles gnadenlos nieder.
Wallender Siegesrausch in Wien. Bei den Kapuzinern und im Stephansdom Dankgottesdienst für die Errettung des Hauses Habsburg und die Bewahrung der Heiligen Kirche. Glückwünsche von dem tieferschreckten Papst Urban in Rom zu der Erlegung des greulichen Untiers. „Was für Kraft in diesen Deutschen steckt“, fragte er sich mit Abscheu.
Graf Schlick, die trübe kopfsenkende Masse, neben dem König von Ungarn allwaltend am Wiener Hof, nahm mit dem Baron Breuner und dem Abt Anton die Hinterlassenschaft Friedlands auf. Jeder der zwölf Dragoner, die zu Wallenstein eingedrungen waren, erhielt hundert Reichstaler, die Offiziere, die geführt und assistiert hatten, tausend und zweitausend, Deveroux auf das Drängen wegen seiner Verwundung noch vierzigtausend Gulden, dazu mehrere konfiszierte Güter. Im ganzen hatte Wallenstein an fünfzig Millionen Werte aufgespeichert. Friedland Reichenberg wurden gegeben an Gallas, Aldringen erhielt Teplitz, Pikkolomini Nachod. Ihm verlieh man auch den Titel eines Grafen von Arragon. In sein Wappen nahm er eine Schildkröte mit der Umschrift: „Schritt für Schritt.“
Stille Zimmer beim alten Fürsten Eggenberg. Der verwachsene Graf saß viel bei ihm; schlaff beide. Eggenberg aus dem Bett flüsternd: „Was klagt Ihr mich an, Trautmannsdorf?“ Der Graf: „Ich klage Euch nicht an, ich bin nur durch ihn hochgekommen.“ Und dann erschüttert: „Ich bin nicht schuld daran. Er sollte abgesetzt werden, wenn es sein mußte, mit Gewalt. Wir haben niemanden zu der Bestialität autorisiert.“
„Wenn er lebte, Trautmannsdorf, und Euch hörte, würde er den Kopf schütteln; man kann Gewalt nicht begrenzen.“ „Ich bin nicht schuld, ich weigere mich, ich bin nicht schuld. Wenn man ihm mit einer Partisane die Brust aufgerissen hat, so bin ich nicht schuld daran. Solange ich lebe, werde ich das nicht zugeben; Eggenberg Ihr seid alt und gerecht, Ihr werdet das nicht auf mich legen.“ Der eingefallene Mann im Bett matt lächelnd: „Er ist ja tot.“
Das weiße Gesicht des verwachsenen Grafen verzerrte sich, er wetzte die Zähne aneinander: „Was kommt Ihr mir damit. Er lebt von mir noch. Ihr habt es in Regensburg zu dem Unglück kommen lassen, der Kaiser hat Euch gehört. Ich habe es nicht vergessen.“ „Ich weiß, ich weiß, Trautmannsdorf. Ihr habt recht. Laßt es ruhn. Ich beuge mich. Was bin ich noch bei dem allen.“ Sie schwiegen, das Zimmer war lange still, der schwere große Luxemburger hinkte herein. Da schwiegen sie zu dritt.
Man hatte das Geheimnis der Ermordung aufgedeckt: die Leiche des Grafen Slawata, von dem Oberst Butler nicht gesprochen hatte, war erkannt worden. Der sonderbare Familienhaß hatte die Hauptrolle bei dem Unglück gespielt, es erleichterte sie alle. Lamormain erzählte von seinem Freund, dem Abt Anton, der ihm aus dem Weg ginge, um bei aller Betrübnis seine Freude zu verbergen, daß man jetzt aus der Schuldenwirtschaft herauskomme. „Es ist ja ein Glück; der Herzog war ein Werkzeug des Himmels, um das Haus Habsburg aus dem Elend herauszuziehen. Wir wollen das Gute bedenken. Das Haus Habsburg, das die heilige Kirche beschützt, verdient es schon, daß sich selbst ein ruhmreicher Feldherr für sein Gedeihen opfert.“
Trautmannsdorf abwinkend: „Laßt das, Pater. Ihr geht noch, noch zuviel zu Euren Brüdern von der frommen Gesellschaft.“ Und sehr leise weiter: „Was habt Ihr vom Kaiser gehört?“ Eggenberg richtete sich auf dem rechten Arm um, blickte groß zu dem Pater herüber. „Nichts.“ „Und — Ihr habt auch keinen Anhaltspunkt, keinen Wink?“ „Ich glaube, Graf Trautmannsdorf, wir werden lange nichts von unserem guten frommen Herrn hören.“ „Und warum meint Ihr das?“ „Er wird sich in ein Kloster, in irgendeine abgelegene Einsiedelei begeben haben. Er war so weit. Er war längst soweit. Ich dachte es öfter.“
Im Bett wälzte sich Eggenberg; er zog die Decke über das Gesicht, darunter schluchzte er leise. Nach einer kleinen Weile kam er hervor, suchte trübe im Zimmer; abgerissen zu Trautmannsdorf: „Und — warum jammert Ihr jetzt nicht, Trautmannsdorf? Hier nicht?“ „Um den Kaiser?“ „An ihm ist Euch nichts gelegen. Ich tadle ja Euren Friedländer nicht allzu scharf. Es mag sein, daß er uns den Frieden gebracht hätte. Er hat vielleicht das Richtige gewollt. Aber — was war gegen ihn unser Kaiser. Ein gütiger Mensch. Ein frommer Christ. Unser Fürst.“
Graf Trautmannsdorf senkte den Kopf: „Das war er. Ich hoffe, wir finden ihn noch. Eggenberg.“ „Ich hoffe es nicht. Nein, laßt nur. Laßt ihn auch nur. Ihr müßt nicht nach ihm suchen, Pater. Was wollt Ihr denn von ihm. Was muß auf ihn gedrückt haben. Mir ist es noch im Sterben ein tröstlicher Gedanke, meinen gnädigen Herrn im Kloster zu wissen.“
In diesen Tagen warf sich die Kaiserin Eleonore, die Mantuanerin, aus dem Fenster ihrer Schlafkammer in der Burg und zerschmetterte auf den Steinen des Hofes. Man hatte sie, nachdem sie durch einen Zufall von der Flucht Ferdinands erfahren hatte, wegen ihres tobsüchtigen Verhaltens einsperren und bewachen lassen. Ihre liebe Gräfin Kollonits hatte sich eine Stunde von ihr verleiten lassen, auf den Hof mit ihr hinauszuschauen; sie plauderten wie früher; scherzend band die hinterhältige Mantuanerin der freudigen Freundin einen blauen Schleier um den schwarzen Kopf, über die Augen, band ihn, als die Gräfin lachte, fest und gewaltsam im Nacken zu. Mit aller Ruhe rückte sie sich einen Sessel heran, während die Kollonits schreiend an dem Knoten arbeitete, stand händefaltend auf dem Fenster, ließ sich, laut Maria anrufend, vornüber auf das klagende Gesicht fallen.
Während der junge König Ferdinand mit dem Grafen Gallas das Heer reorganisierte und unter den Reichtümern, über die man verfügte, sich alles neu belebte, Truppen und Offiziere sich dem Grafen Gallas unterwarfen, Schweden und Sachsen abwartend zurückwichen, begann eine sehr diskrete Fühlungnahme des bayrischen Hofes mit Wien. Die Macht und der Einfluß Maximilians in Wien waren außerordentlich, die herrschenden Parteien des Hofes priesen ihn als das Rückgrat der katholischen Sache im Reich. Der Bayer hatte keine Kinder, er war Witwer. Er hielt dafür sich noch einmal zu verheiraten; von Ferdinand war eine junge eben herangereifte Tochter da; der sehr gealterte Mann ließ sich nicht davon abbringen, die junge Maria Anna zu fordern.
Im Innwinkel saß er bei seinen Truppen, da traf ihn die Nachricht von Wallensteins Verderben. Der Kaiser Ferdinand war verschwunden, der Schlemmer, der alberne heitere Mensch, wer weiß von wem verführt. Es war zuviel für Maximilian. Er geriet unter die knechtende Raserei seiner Gefühle; er wußte nicht, ob er weinen oder lachen sollte; keinen Schlaf fand er vor der Marter des Glücks, das seine Brust Hände mit Feuer umgab, über sein Gesicht flammte, seine Gedanken verdunkelte. Auf den Rat Kontzens, vor den er sich hilflos völlig verändert und Schutz suchend warf, hungerte er einige Tage, begann eine wilde Geißelung. Seinen zwangartigen Drang, von sich wegzuschenken hinzugeben, durfte er durch Stiftungen an die Heilige Kirche entladen. Gelegentlich stand er in völliger Verfinsterung und war gelähmt.
Nun ging er eisig aus sich heraus, vorsichtig, langsam, Schritt für Schritt sein Inneres zudeckend, zurückdrückend. Er bewegte sich zu Handlungen, beschwichtigte sich. Kuttner, der schöne zarte, verstand nicht, was der Kurfürst wollte, als ihm befohlen wurde, auf Wochen den Hof zu verlassen. Aber er ging. Richel suchte dem trauervollen bitter lachenden Kavalier das Herz zu erleichtern, indem er ihm eine neue Pariser Mission konstruierte. Aber trotz aller Zucht konnte Maximilian, nach München zurückgekehrt, es nicht verhindern, daß er einmal an der Drehbank, zwischen den subtilsten Elfenbeinarbeiten, sich dem lodernden Gedanken gegenüber sah, Maria Anna, die junge schöne fromme Tochter des flüchtigen Kaisers aus seiner ersten Ehe zu seiner Frau zu begehren. Jach wie aus dem Munde stürzte ihm der Gedanke; es war ein nicht zu beseitigendes Erlebnis. Er arbeitete, ging mit den alten Methoden an sich heran. Und dann war es ihm plötzlich zuviel. Keine Ruhe, keine Freude, kein Kuttner; er ließ sich los; es durchsetzte ihn.
Maximilian hatte das Gefühl des Verbrecherischen; er hatte das zitternde Gelüst in ein schwarzes offenes Fenster einzusteigen oben am Dach, die Hand auszustrecken und zu rauben. Er hätte nie geglaubt, daß ein Verlangen so stark sein könnte, — wie dies: die junge Tochter des flüchtigen Ferdinand, Maria Anna, aus Wien zu holen. Es züngelte in ihm; es war unendlich labsam, hin und her werfend und dann wieder einschläfernd, gar keine Folter.
Er entschloß sich, als Kontzen nichts verbot, dem Gefühl nachzugehen; mit einer Wonne, die er nie gefühlt hatte, machte er sich zum Vollstrecker seines Gefühls.
Es war die letzte Tat des verfallenden Eggenberg, den Graf Trautmannsdorf im Auftrag des Königs Ferdinand besuchte, die Antwort auf die Frage zu formulieren, ob man dem Kurbayern Maria Anna zusagen sollte oder nicht. Das stolze Auftreten der bayrischen Delegierten Richel und Wolkenstein hatte am Hof trübe Erinnerungen geweckt. Eggenberg blieb dabei: „Geben, geben. Laßt sie stolz sein. Wir sind beides Opfer. Gebt sie ihm; er betrügt sich mit ihr.“
Die Prinzessin widerstrebte, Maximilian war alt und als hart verrufen, man tröstete sie mit seiner Frömmigkeit.
Sie wurden zu München in der Augustiner Kirche kopuliert. Abends brannten die Teertonnen und Scheiterhaufen auf den Plätzen. Auf dem Marktplatz vor der großen Mariensäule waren geölte Gänse an Stangen gebunden; Burschen jagten auf Pferden vorbei, suchten ihnen die Hälse abzureißen. In der Residenz tanzten die Edlen den heiteren Tanz der Guillarde, die Sarabande, Gavotte. Bankette auf dem großen Saal, Ballett, Ring und Quintanrennen. Beim Aufzug zum Rennen wurde der goldüberladene Kurfürst und seine Braut hinter Trompeten und Heerpauken, geführt von den Maestri de Campo, auf einem Triumphwagen durch die Straßen gezogen, im blendenden Frühlingssonnenschein von blumenstreuenden Nymphen umgeben. Zwei weiße Pferde waren vor den Wagen gespannt, Maximilian lächelte starr. Sie lachte erst, als auf dem schwarzen Blachfeld beim Armbrustschießen die schlechten Schützen gepeitscht wurden und man die Hosen auf einer Stange herumtrug, die die Stadt als Preis aussetzte. Und nach den Schwerttänzen der Waffenschmiede küßte sie vor dem jubelnden Volk den strengen Menschen neben sich auf dem Thronsessel. Er trug eine dreifache Perlenschnur um den Hut; ein goldener Reiherkopf aufgelegt mit Diamanten, hoch wippend und schwankend der weiße Reiherbusch. Sein fettes Gesicht war von einem dichten graubraunen Vollbart eingerahmt. Eine Glutwelle hüllte seinen Kopf ein. Er tauschte, die Augen lauernd vom Boden erhebend, einen verwirrten fast schamvollen Blick mit dem seitwärts stehenden jungen Kuttner.
Auf dem Schrannenplatz, an der Stelle des alten Galgens, errichtete Maximilian eine Mariensäule. Ihren Fuß umgaben mächtige geflügelte Engel mit starken Waffen, sie kämpften gegen Untiere. Kontzen predigte an ihr nach dem Psalmenwort: Du wirst über Nattern und Basilisken wandeln und Löwen und Drachen zertreten.
Die Menschenmassen ließen sich nicht halten. Sie schwappten und rieselten von Böhmen her nach Westen, von Norden gegen Thüringen, vom Rhein herunter. Gurgelten unablässig. Aus Bayern schwollen sie an, gespeist aus allen Teilen des Landes. Die Quellen fanden die tosenden Söldner, das Brunnenrohr schlug die Einquartierung ein, Erpressung und Drangsalierung, Hungersnot und Verzweiflung trieben die Wasser zum Anschwellen. Am Chiemsee floh die Masse der männlichen Bevölkerung in die Wälder und Berge, dann sammelten sie sich unter den Entbehrungen. Zwischen Alz und Inn, Inn und Isar zuckten und zitterten die Kirchenglocken, gepeitscht von den metallenen Schwengeln. „Aufstand!“ bullerte es über die Dörfer, die in die Ebenen geglitten waren, in den Bergen träumten, sich in dem Chiemsee spiegelten. Die Heere, Bayern Maximilians des Hoffärtigen, Spanier und Italiener des Gouverneurs von Mailand, Kaiserliche des speichelleckenden Aldringen, des glatten grausamen Federfuchsers, wollten sie über die Isar werfen.
Sie liefen im Winter frierend über die dunstige Erde; auf den Bergen sah man sie laufen und lief nach. Frauen und Kinder, Greise, Kranke im Zug. Sie drangen plündernd in die Häuser der Grundholde ein, rissen die Tore der Scheunen auf, hingen die Müller an den Mühlen auf, schleuderten die Mehlsäcke, Mehlsäcke über Mehlsäcke auf die hungernde Straße. In Rosenheim taten sie sich zusammen, erließen gegen den Kurfürsten Maximilian ein Famosschreiben, nannten ihn Geizkragen Bestie Paternosterknecht. Die Pfarrer warf man als seine Lakaien aus den Häusern, Jesuiten wurden gepeitscht, hie und da ermordet.
Als sich die Grundherrn nach München wandten, schickte man ihnen Kapuziner, die sollten die Bauern besänftigen; die Mönche wagten sich nicht an den Herd heran. Das Regiment Kronberg stand bei Endorf und Prien am Chiemsee, dann über Riederung und Sochtenau; die Kompagnien wurden einzeln überfallen, zerstreut, die Pferde geraubt, die Waffen gesammelt; allenthalben begann der Einbruch in die Schlösser und Depots, Waffen wurden gesucht. Eine beherzte Mönchskommission machte sich auf zu den Rebellen; sie sah in den Bauernlagern solchen Jammer, daß sie, ehe sie Maximilians Mandat verlesen hatte, abzog; die Mönche verschluckten vor diesen Männern, die sich vor Schwäche kaum auf den Beinen hielten, vor diesen hohlbäckigen, den Gräbern, an die man sie führte, die zornige Warnung, ließen sich gramvoll durch die leeren Dörfer zurückführen.
Generalwachtmeister Lindelo in Wasserburg erhielt den Auftrag, seinen Platz zu halten. Spanisches Fußvolk aus Ferias Heer kommandierte Oberst Billehn, Artillerie kam aus München, Fürstenberg führte seine Reiter heran. Bei Ebersberg machten sie zweihundert Bauern still. Als das Dröhnen der Kirchenglocken nicht aufhörte, schoß Artillerie die Dörfer in Trümmer. Die ortskundigen Söldner machten Zeichnungen der Landschaft, man konnte ohne Lärm große Massen der Bauern umzingeln, mit Feldstücken und einigen Schlangen umlegen. Versprengte von Kronbergs Reiterei suchten Rache; den Rädelsführer Michael Mauerberger faßten sie, er wurde ihnen vom Oberst Billehn entrissen und da er gestand am Rosenheimer Famosschreiben beteiligt zu sein, sogleich enthauptet, gevierteilt. Die zerhackten Stücke stellte man aus, auch gegen die oberösterreichische Grenze, wo das Branden eben begann.
In die wandernden Scharen der Landesflüchtigen, in die Verödung der Landschaften geriet Ferdinand hinein. Er war dem Bandenführer entwichen, der ihn zehn Tage gefesselt hatte, um ihn an den Wiener Hof gegen ein Lösegeld wieder auszuliefern. Er strudelte mit den Bettelnden Hungernden Plündernden. Ferdinand, längst schmierig wie sie, aß Fleisch von gefallenen Pferden wie sie, lief vor hetzenden Hofhunden; Kaspar Weinbuch, der vertriebene Müller von Bamsham, mit ihm. Sie hielten sich keine zwei Tage an einem Ort auf; der Boden war lebendig, er hob sich auf, stieß sie von sich. Ferdinand, dünn geworden, sein Gesicht knochenmager, überzogen von einer schlaffen faltigen schmutzüberkrusteten Haut; er ging krummer, rascher als sonst, sein hellblauer Blick bestimmt und sehr lebhaft. Redete und fuchtelte nach rechts und links: „Kein Erbarmen! Kein Erbarmen! Gebt nicht nach. Es sind Teufel in der Welt; wenn ihr sie nicht bezwingt, kommt die Sintflut und was Lebensodem in der Nase hat, wird ausgerottet. Es kann nicht anders geschehen. Der Herr kann sich nicht anders retten.“ Seine Parole wie Kaspar Weinbuchs, eines noch jungen einarmigen Menschen, der seine Mühle angesteckt hatte, weil er für die Italiener mahlen sollte: „Gebt nicht nach. Braucht Gewalt! Kein Mitleid! Braucht eure Arme, eure Zähne. Sterbt nicht, sterbt nicht hin. Wo ist eine Rettung für die Menschen, wenn ihr vergeht. Die Mühle, die die nächsten Geschlechter, Kinder und Enkel und Enkelkinder zermahlen soll, steht schon da, unser Blut, unsere Knochen hängen am Mühlrad. Sie muß brennen. Gebt nicht nach. Sterbt nicht! Sterbt nicht!“
Sie plünderten viel, um leben zu bleiben, verteidigten sich, trugen Waffen; Pferde konnten sie nicht halten, da der Hafer ausging. Obwohl sie sich oft in leere Häuser einquartierten, litten sie furchtbar unter der Kälte.
Ferdinand legte sich den Namen Grimmer bei. Die hetzenden harten Reden flossen aus seinem Munde; er wollte nicht sehen, wie sich Verzweifelte in die Städte schlichen, sich satt zu essen und zu wärmen, ob man sie auch totschlüge oder sich bei den verfluchten Söldnern anwerben zu lassen. Grimmer, kaum an seinem Stock laufend, tröstete und reizte sie: „Fürchtet Gott! Fürchtet ihn! Wisset, daß eine grausige Macht hinter der Welt ist, der wir Verantwortung schulden. Gebt keine Nachsicht. Mordet, mordet! Vergeßt ihn nicht!“
Was manche dieser Horden vor sich trugen, war das Schrecklichste, das die umlaufende Bevölkerung gesehen hatte: Kreuze aus starken Baumästen, mit Stricken zusammengebunden, daran hing ein wirklicher faulender Leichnam, bald ein Mann, bald ein Weib, manchmal ein Weib und an jedem Querast ein baumelndes Kind; den pestilenzialischen Geruch schienen, die das Kreuz trugen, nicht zu merken.
Sie wurden allenthalben zersprengt. Über Fürth irrte Grimmer mit Kaspar Weinbuch.
Es war Frühling geworden, als sie böhmischen Boden betraten. Fließender Regen ohne Ende. Man ängstigte sich vor den hetzenden Gesellen, trieb sie weiter. Eine alte Fischerin, die sie für Stunden aufnahm und beköstigte, warnte sie, zeigte die Kinder ihrer Tochter, drei junge Geschöpfe, die sie bei sich hatte; Vater und Mutter waren bei einer böhmischen Revolte umgekommen: „O, was haben sie von den lieben Kindern. In der Erde, so jung, so jung.“ Böhmen hätte gelernt, sei still geworden. Während der bärtige Müller finster lachte, streichelte Grimmer die Hände des alten Weibchens: „Was willst du? Es ist ja alles wahr, was du sagst. Ich möchte es so gern glauben. Es hilft aber nichts.“
Sie betrachtete ihn traurig: „Wie lange wirst du alter Mann noch herumlaufen; wirst ruhig sein wie ich.“ „Ach, es hilft nicht, Weibchen, was du sagst. Du willst dich sterben legen. Alle wollen sich sterben legen. Bleibt doch leben, haltet Euch steif.“ „In der Bibel steht: meine Kraft ist an dem Schwachen mächtig.“ „Ihr wollt sterben. Ihr könnt nichts als sterben.“
Der Müller riß ihn, der versunken in der Hütte saß, mit sich fort, brüllte draußen: „Das Volk, Männer und Weiber, ist eins; träge und lahm. Wollt Ihr sie gründlicher studiert haben als wir.“
Vor ihnen scholl das Gerücht: der Friedländer, des Kaisers Feldhauptmann, sei in Eger erschlagen auf kaiserlichen Befehl, seine Freunde, die hohen Offiziere mit ihm. In Mies sollte er begraben sein, auf dem Boden seines ehemaligen Feldmarschalls von Ilow. In dem Ort suchte und suchte Grimmer, er wollte zu ihm auf die bewachte Grabstätte im Franziskanerkloster. Sie hielten sich lange hier auf. Und wie Weinbuch schon unwillig weiter drängte, knarrten eines Mittags Reisewagen in das Dörfchen von Osten; eine edle noch junge Frau stieg herunter in grauer Kleidung des Leides, um die Stirn die Kreppbinde, vom Ärmel fiel der weiße Trauerstreifen; vier Frauen hinter ihr; Isabella, das Weib des toten Friedländers. Da vermochte Weinbuch den andern nicht von der Stelle zu bringen.
Eine kleine Bande Klopffechter, Sankt Markus- und Lukasbrüder trollte am selben Tage in das Dorf ein, die Kunst des Fechtens mit allen Gewehren zu zeigen; ein jovialer wohlgenährter Zahnbrecher und Steinbrecher war dabei, die beiden herumlungernden düsteren Tröpfe wurden von ihm erblickt, angelockt, zu seinen Schauprozeduren herangeholt; er fütterte sie.
Aus dem dumpfigen Boden wurde der Körper, der ehemals sich mit dem Herzog Albrecht von Friedland, dem Böhmen von Wallenstein, bewegt hatte, geschaufelt: zwischen zwei dünnen Kieferbrettern lag er geklemmt. Dorfbevölkerung hatte die Witwe aufgeboten zur Begleitung der Leiche über die Bannmeile; auf zwei Stangen trugen alte Bauern den Sarg, mit einer grauen Decke war er überhängt, damit man nicht sähe, daß dem zu langen Toten die Unterschenkel zerschlagen und umgebrochen waren.
Armselig hinter den vier Mönchen zwischen den Bittfrauen und Groschenweibern die ganz verhängte Fürstin. Schritt, Schritt.
Von weitem folgte Ferdinand, auf zwei Stöcken, die Kappe in der Hand, weinend, das vibrierende graue Gesicht von dem warmen Wasser gefühllos überlaufen.
Weinbuch schimpfte über das Geplärr. Das Maul breitziehend ließ ihn der Müller, schlug sich zu den andern, die auf Kosten der Fürstin den Tod im Wirtshaus versoffen mit Bier und Rosmarinwein. Auf einen Leiterwagen lud man an der Wegkreuzung den Herzog; die Witwe fuhr hinterdrein, auf Gitschin zu, in die Karthause Walditz.
Grimmer, dem ein stoppliger Backen- und Kinnbart gewachsen war, war von dem Tag an von einer sonderbaren Einsilbigkeit; sein Gesicht war unbeweglich. Er stand, als ein kläglicher kleiner Zug Flüchtlinge vor ihnen vorbeizog und der Müller die Arme ausstreckte und zu reden anfing, stumm und wartend abseits. Der Müller jauchzte die alten lockenden wilden Worte: „Nicht nachgeben! Beile genommen! Schlagt aus nach rechts, schlagt aus nach links! Gehämmert in die Mauern!“ Die Flüchtlinge reckten die Arme wie er.
„Was stehst du da?“ fuhr ihn der Müller an, wie sie gingen, gefährlich. Still und ohne Klage sagte der andere: „Ich kann’s nicht. Ich bring’ es nicht heraus.“ „Was bringst du nicht heraus.“ „Ich kann nicht fluchen.“ „Was bist du für einer. Du bist selbst angefressen. Legst dich selbst zum Sterben.“ Es war mit Grimmer nichts anzufangen.
Ferdinand hatte sich, als er unter die flutenden Menschenmassen geriet, überwältigen lassen. War dem Jammer, der ihm begegnete, unterlegen. In Graus und Reue hatte er geschrien: „Beile genommen! Beile! Nicht nachgeben!“ Das schlief schmerzlich vor Wallensteins kläglichem Holzsarg ein.
Und nun kam die Dunkelheit über ihn. Er wußte nicht, was wurde, aber er wartete. Ein großes Bedürfnis nach Schlaf hatte er. Es wäre möglich gewesen, daß er ohne Widerstand hinstarb. Und dann regte sich eine Bewegung in ihm. Er seufzte und die Erinnerung trat in ihm auf: „Gebt Raum, gebt Raum.“ Sanftheit und Stille, worin er Platz nehmen wollte. Der Balken, an dem er sich entlang tastete. Oft blickte etwas in ihm auf Wallensteins Sarg. Er fühlte sich bewogen, viel hinter dem Sarg herzugehen, Hände zu drücken, die gebrochenen Beine auf Watte zu schienen.
Die Fechtbrüder und der Zahnbrecher hatten Gefallen an ihm, nahmen ihn und den Müller auf ihrem Wagen mit; er sollte für sie ausrufen. Sie gerieten in Streit mit dem Müller, als der sich daran machte, in ihrer Weise sie zu erregen. Als Weinbuch in seinem Zorn ihnen einmal zwei gute Degen mit einem Stein zerbrach, prügelten sie ihn. Der Müller entwischte; den andern, der mit ihm wollte, ließen sie nicht fort. In die Zone der Heere reiste die Bande, um besseren Gewinn zu finden. Als die ersten Kompagnien in der Gegend von Joachimstal an ihnen passierten, bettelte Grimmer, sie möchten ihm das schenken, den Anblick der Söldner, er wolle fort von hier. Jubelnd kam einmal der dicke Quacksalber an: er habe den andern mit dem braunen Bart, den Kaspar, den Müller, gesehen. Wo, wolle er nicht sagen: hoch in der Luft, an einem Soldatengalgen hänge er; hätte wohl das Maul sehr voll genommen. Grimmer flammte: „Führt mich hinein. Führt mich hin. Ich will ihnen alles sagen. Er ist einen guten Tod gestorben.“ Und er schrie über Weinbuch und weinte: „Laßt mich fort! Helft mir doch.“ Sie lachten: „Gewalt! Gewalt! Lauf mit deinen Krücken. Wir werden einen Hund gegen dich jagen, daß er dich umrennt.“ Er hob die Hände und zitterte: „Ihr könnt nichts für eure Wildheit.“
In einem Birkenwald, der eben grünte, lag an dem Platze, wo sie ihr Lager aufschlagen wollten, ein brauner Frauenschuh, und nicht weit kam ein ganz feines Winseln zwischen den Stämmen her. Sie gingen dem Winseln nach. Da lag entblößt und zerhackt ein zusammengebogener Frauenkörper und auf der Erde hinter seinem Rücken streckte ein verpacktes kleines Kind die weißen Beinchen in die Luft, schlug mit den blauen Händchen, winselte. Mit einem markerschütternden Geheul, als hätte er die Sinne verloren, warf sich Grimmer an die Erde, kroch auf den Knien vor die Frau, deren eisiges Gesicht er bestrich. Sie rissen ihn von der Zerhackten los; er ließ den Stock liegen, tastete nach dem Kind, hielt es fest. Sie vermochten nicht es ihm aus dem Mantel herauszuziehen; er warf sich, als sie damit begannen, auf das Gesicht und deckte das Kind. Sie bewogen ihn dann aufzustehen; das Wesen schrie in seinem Mantel; er stand wie ein Bock; sie mußten ihm das Geschöpf lassen; grausig brüllte er, er gäbe es nicht ab.
Die Bande stahl Frauen und erpreßte mit ihnen Geld, verkaufte unerlaubte Hartmacherbriefe. Sie ließen den Grimmer mit seinem Kind nicht los, weil er schon zuviel von ihnen wußte. Er besänftigte sich, folgte, war gut zu ihnen. Aber es war etwas Gespanntes in ihm, wovor sie Furcht hatten. Das Kindchen gab er einer Nonne ab. Er bohrte, bohrte, sie sollten ihn laufen lassen. Welches Recht sie hätten, ihn zu halten. Er drohte; sie lachten. Verzweifelt saß er stundenlang in einer Wagenecke, rang die Hände. Sie ließen ihn im Stroh gackern. In ein rasendes Gezänk ließ er sich mit ihnen ein; da er ihnen rachsüchtig schien, nahmen sie ihn nicht mehr auf die Märkte, in die Dörfer hinein mit; sie wollten ihn schon kirre kriegen. Er hatte in dieser Zeit die Aufgabe, mit einigen Roßbuben auf die Wagen zu achten. Als die Buben berichteten, daß der Grimmer, statt sich um die Wagen zu kümmern mit vorbeiziehenden Wallonen lange heimliche Gespräche führte, daß auch einzelne Wallonen sich schon mehrfach in der Nähe des Quartiers hätten sehen lassen, beschlossen sie sich seiner zu entledigen; sie waren der Meinung, daß Grimmer an Flucht oder Verrat dachte.
Sie kamen bei Kaaden vorbei, wo ihnen das Kind eines Ratsherrn in die Hände fiel. Die aus der Stadt aber hatten einige Reiter, die sich hinter ihnen her machten. In ihrer Angst ließen sie das Kind auf der Landstraße zurück. Als sich die Reiter damit noch nicht zufrieden gaben und nach ihnen suchten, spannten sie die Pferde von den Wagen, ritten davon mit allem, was sie schleppen konnten; den Grimmer ließen sie bei den Wagen. Er wurde von den Reitern gefaßt, nach Kaaden gebracht und in der Stadtmauer eingesperrt. Die Büttel, von den Angehörigen des Kindes noch bestochen, ließen ihre Wut an ihm aus.
Ferdinand aber schien, seit er die Quälereien von der Fechterbande erfahren hatte, ein vollkommener Narr geworden zu sein. Er war von einer flutenden, stoßweise ihn durchrollenden Erregung heimgesucht. Wie ihn die Räuber auf die Straße warfen und er gefangengenommen wurde, war er, als wäre er alle Sorgen losgeworden. Er hatte schon die Wallonen im Wald nicht, wie die Buben erzählten, aufgefordert, ihn zu befreien, sondern nur von sich erzählt. Er sei in einem hohen Amt gewesen, hätte es aufgegeben. Denn das Regieren hätte wenig Zweck. Es läuft alles von selbst. Es ist auch alles gut, hätte er erkannt; man müsse nur wissen wie. Man könne mit ihm tun, was man wolle, man täte ihm nicht weh. Er forderte die Wallonen geradezu auf, ihm doch Hiebe zu versetzen, sie täten ihm Gutes damit an. Als ihm einer dann einen Faustschlag gegen die Schulter gab, sank er in das Gras, wand sich vor Schmerz, aber lächelte verzerrt: es machte nichts, es täte ihm wohl; sie ließen ihn blaß, halb ohnmächtig sitzen. Im Stadtkerker wurde er gemißhandelt, daß er meist seine Besinnung verlor. Sobald er aber frei war, erzählte er wieder, er sei der Kaiser Ferdinand, der Römische Kaiser, es ginge ihm jetzt besser. Wie gegen einen Klotz verfuhr man mit ihm; um ihm Geständnisse zu erpressen, brannte man ihn an Stirn und Arm und streute Salz in die Wunden. Er gab zu, was er von der Bande wußte, sich selbst beschuldigte er nicht. In dem Keller stand er bei jeder Vernehmung vor dem Richter und dem Henker, der gebückte graue Mann, bejammerte Richter und Henker, beschwor sie an sich zu denken und nicht an das Gesetz und den Kaiser; er sei Kaiser gewesen, er spräche sie frei von der Verpflichtung; Mehrer des Reiches möchte er sein, und darum möchten sie davon ablassen, ihn zu quälen: es helfe ihnen nichts.
Er rief sie an: „Ihr müßt euch freuen. Es ist Mai oder Juni. Es ist eine schöne Zeit. Macht nicht so finstere Mienen. Euer Handwerk verdirbt euch, es macht euch die Brust eng. Würde doch kein Tier so finster und trübe leben wollen wie ihr. Lacht. Wenn man lacht, begrüßt man die anderen Wesen.“ Sogar nach einer peinlichen Prozedur des Streckens bat er matt: „Ihr müßt nicht so strenge Mienen machen. Es ist ja alles in der Welt so schön. An mir müßt ihr keinen Anstoß nehmen. Ich bin kein Schelm; meinetwegen braucht ihr euch nicht zu erbittern. Und auch mit den anderen könntet ihr fröhlicher fertig werden. Fröhlich, fröhlich. Ich bin es auch und möchte darum leben.“ Er glitt an seiner Stange entlang.
Sie lachten aber nicht. Und ganz finster wurden sie erst, als der Henker eines Morgens Grimmers Zelle leer fand.
Die Klopffechterhorde hatte von seiner Einkerkerung gehört; sie gereute es nicht gerade, ihn überliefert zu haben, aber sie wollten dem Ratsherrn einen Possen spielen, nachdem sie um den Prellohn gekommen waren. Sie überwältigten, da sie starke Menschen waren, eines Nachts die Posten der Stadtwache vor dem Kerker, nachdem sie unbemerkt über die Mauer gestiegen waren. Grimmer vom Fackellicht aufgeschreckt, blinzelte sie aus dem Stroh an; sein Gesicht tieftraurig, er erkannte sie nicht. Dann als sie ihn anhoben und mit einem Mantel bedeckten, begrüßte und streichelte er sie flüsternd. Sie schleppten ihn mühselig über die Mauer, Ferdinand verbiß jeden Schmerz. Während sie selbst vor Übermut kicherten, mußten sie seinen Jubel dämpfen. Der dicke Steinschneider, der sein Pferd führte, fragte ihn, als sie davon durch den sausenden Wald ritten, ob er nicht einen Priester haben wollte. Ferdinand lachte: „Noch nicht. An meinen Heiland glaube ich. Aber wenn ich Sünden bekennen sollte, ich wüßte nicht, welche ich bekennen sollte.“ „Du bist schlecht“, warnte der andere. „Nein, verzeih mir. Es hat sich mir alles verwischt. Weißt du, wo ist Sünde und Tugend?“
Nach vierstündigem Ritt lagerten sie in einer Hütte, wo die anderen Gesellen schon warteten, blieben dort ungestört einige Tage. Ferdinand lobte sie für die Wohltat an ihm. Sie ließen ihn viel allein.
Als man zu dem tief gelbsüchtigen fiebernden Ferdinand, dessen Körper aus vielen Wunden eiterte, einen Barfüßermönch schickte, weinte er heftig, gestand: „Die Sünde, ja, das ist es.“
„Nun siehst du.“
„Ich kenne sie, ich weiß, was Sünde ist.“
„Siehst du.“
„Nur, ich kann sie nicht fühlen. Mir ist alles verwischt. Wer hat mir das angetan?“
„Du bist krank, du frierst, du schüttelst dich im Frost.“
Aber Ferdinand blickte ihn ruhiger aus seinen hellen Augen an: „Ich bin verzaubert. Ich kann nichts als mich freuen.“
Der Barfüßer sprach Gebete, segnete ihn, ging davon.
Ferdinand überwand das Fieber. Sehnsüchtig, wenn die Horde fortgerasselt war, kroch er zur Tür hinaus auf allen Vieren in den grünen Wald. Es war sonnig. Er suchte sich zu heilen.
Der Wald, der Grund eines weiten Meeres, Tag und Nacht durchwogt und aufgewühlt. Die jungen und alten Bäume hielten sich mit Wurzeln an der Erde fest; Geäst und Blattwerk, hungrig hochgeworfen, wurden am Schopf gefaßt, nach unten gebogen, seitlich geschnellt, im Kreis geführt. Vielfarbige Blumen wuchsen im versteckten Gras. Ferdinand zog sich an dünnen Stämmen hoch, fühlte seine Knie; die Luft blies in seinen geöffneten Mund, der Atem ging leise aus seiner matten Brust; er rutschte wie ein weicher Wurm ab auf das Moos. Er pendelte und schwankte getrieben wie ein Ertrunkener in der Luft. Wie dunkle Zauberworte klang manchmal in ihm auf: das Reich, der Krieg, der Thron. Auf Minuten breitete er stöhnend die Arme aus: „Ich bete nicht, Maria muß mir helfen, sie wird mir verzeihen.“ Unversehens, wie er lag, hatte ihn das pelzige Moos.
Kopfbeugend und mit Ungeduld ging und stand er, bis sich die Horde verlaufen hatte, um sich zwischen den stummen Bäumen wieder einzufinden.
Auf einem Baum erwartete ihn ein sonderbares Wesen. Es saß zwischen starken Ästen, steckte den kleinen braunschwarzen Kopf zwischen Blätterhaufen hervor. Ein verwahrloster junger Mensch, stark am ganzen Körper behaart. Er ließ die Äste zusammenschnellen, sah wieder herunter. Über Schulter und Bauch hatte er sich einen fellartigen Lumpen gebunden; er stieß und hangelte mit den affenartigen mageren Beinen. Der Kobold, die schwarze knochige Brust nach einiger Zeit herunterbeugend, krächzte etwas Wortähnliches, lief vorsichtig, wie er Ferdinand kriechen und liegen sah, auf den Ästen um ihn herum, dann am Boden. Ferdinand winkte ihm. Er floh.
Von Tag zu Tag kam er dichter. Einmal schwang er sich zu dem Kranken, griff schnell nach seinem Brot, aß im Fortlaufen. Er beobachtete Ferdinand aus fliegenden grauen Augäpfeln, die rastlos in ihren flachen Höhlen spielten, ohne daß sich die kleinen Lider bewegten. Schließlich betastete und beschnüffelte er den sitzenden Mann, der ihm öfter die Hand hinstreckte. Er wich ihr aber zuckend aus, zuletzt nahm er sie bei den Fingern, besah sie dicht, drehte und hob sie, beschnüffelte sie, ließ sie los. Saß da, um plötzlich auf ein Geräusch einen Baum anzuspringen und zu verschwinden.
Einmal, wie Ferdinand die Tür der Hütte aufließ, schlich das Geschöpf hinein, kam rasch mit einem großen Stück Fleisch heraus, das er auf einem Baum verschlang. Wie er wieder neugierig Ferdinand beobachtete, der sich an seinem Stock hochschob und einige Schritt schleifte, stellte er sich neben ihn, stützte ihn geschickt von hinten, indem er ihm unter den Arm griff; dabei kicherte er mit demselben Krächzen, mit dem er sprach.
Ferdinand verstand rasch seine kindlichen Bezeichnungen. Einmal morgens — Ferdinand hatte ihm wegen seines stechenden Geruchs verwiesen in die Hütte zu gehen — erwartete ihn das Geschöpf listig lauernd schon draußen. Es winkte, lachte, gab zu verstehen, daß es etwas Schönes wüßte. Und dann stürzte es Ferdinand unter einen Arm, zuletzt trug das kleine Geschöpf keuchend den anderen eine Strecke bergigen Bodens auf dem Rücken. Von einer nahen Anhöhe zwischen Gesträuch sahen sie herunter. Da war ein Fluß und an ihm ein weites buntes klingendes Badehaus. Schwimmende Tische; auf den Galerien gingen Damen mit geschlitzten Mänteln. Von oben warfen sie Blumen herunter, die unten spannten ihnen Laken entgegen. Die lustigen Fräulein streckten die Hände nach der Galerie um Geschenke aus, sie tanzten im Bad, das Gewand schwamm obenauf. Flöten und Lauten spielten. Bälle mit Glöckchenbehang flogen über dem Wasser. Der Waldmensch kreischte leise, knirschte mit den Zähnen, hatte funkelnde Augen, leckte sich einen hochspritzenden Tropfen wonnig vom Mund. Er hüpfte mit Ferdinand vorsichtig zurück.
Ferdinand liebte das wilde Geschöpf außerordentlich. Er wunderte sich selbst. Überaus stark griff ihn die Neigung, dieses sonderbare Verlangen zu dem Tierwesen. Er war in vieler schmerzhafter Spannung, gesundete mehr; sein Gesicht und Hände häuteten in der Sommerluft. Die Bande ließ sich oft tagelang nicht sehen, er mußte mit Brot und Fleisch haushalten. Da war der Waldmensch weg. Zwei Tage stellte er sich nicht ein. Es fehlte nicht viel, daß Ferdinand, leicht erschöpflich wie er war, ihm nachging. Bis er eines Mittags allein in der Hütte liegend von dünnen Rufen, dann einem knackenden Geräusch und nahem Scharren überrascht wurde.
Vor einem Gestrüpp das braunschwarze Geschöpf. Es bückte sich über etwas Weißem. Winkte krächzend lachend schnarrend Ferdinand mit Händen und Blicken zu. Das Weiße hob sich. Es war ein junges rothaariges Fräulein, nur leicht gekleidet. Er mußte sie aus dem Bad gestohlen haben. Das nicht schöne pockennarbige Mädchen streckte aus seinem tödlich blassen Schrecken, immer wieder ohnmächtig, Ferdinand die Arme entgegen. Der aber sah sie kaum an. Der Waldmensch fletschte die Zähne, schleppte sie rückwärts, knurrend fauchend und brünstig kreischend ins Gebüsch, nach Ferdinand, der herausgetreten war, sich umschauend, hob ihr die Tücher ab, verging sich glucksend und schlagend an ihr.
Ferdinand hatte mit hellen überweiten verglasten Augen in der Nähe gestanden. Das Waldtier winkte ihn hervortauchend, kochenden Leibes, zu dem Fräulein heran, fiel ihm grunzend und speichelnd um die Brust. Es hauchte ihn hitzig an. Die wand sich im Gras, wollte weglaufen. Ferdinand zitterten unten die Knie. Er konnte sich von diesem betäubenden Atem nicht losmachen. Er drückte halb willkürlos den Waldmenschen an sich. Schaurig, fast unerträglich strömte es über ihn bei der Berührung der zottigen Haut und bei dem starken schweißgemischten Dunst. Er kannte kein Erbarmen mit dem Fräulein unter der Aufpeitschung seines Innern. Er vermochte, wie es durch ihn raste, die Arme fest um den Kobold zu schließen, verzehrt von Angst und Hingenommenheit. Das Mädchen war fort. Das heiße Geschöpf lachte ihn an, schüttelte sich losgelassen, knurrte, schnarrte, wie es das Fräulein nicht sah, schwang sich davon.
Ferdinand saß mit flimmernden Augen in der dunklen Hütte, blinzelte. Sah sich um, wußte nicht, wo er war. „Ich muß fort“, war ihm bewußt. Als er zwei Stunden geschlafen hatte, war er schweißgebadet. Sein Kopf floß. Durch seinen Traum hatte sich das Schaurige Betäubende gewaltig und fessellos geschwungen.
Am nächsten Morgen kam die Bande. Den Abend zuvor hatte er noch mit Ästen nach dem Waldmenschen geworfen, wie der sich ihm grinsend nähern wollte, hatte die Tür vor ihm zugeklemmt.
Aber wie sie über Hügel und Felder fuhren, wurde er wieder eine Beute der Betäubung. Klee Heckenrosen Lupinen zogen vorbei. Und so blieb es tagelang in der Ruine, in deren Kellern sie sich versteckten und Ferdinand, der leidlich gehen konnte, als Wächter beließen für die gestohlenen Pferde Rüstungen Säcke, während sie draußen ihr Handwerk trieben. Hier entschlüpfte Ferdinand, völlig modelliert von dem Erlebnis. Etwas Geheimnisvolles lag über ihm. Im Schnappsack trug er Brot Käse und Rauchfleisch mit sich. Grau und sehnig war er, das Gesicht noch gelb. Er machte einen beunruhigenden Eindruck auf die Leute, die ihn beköstigten und schlafen ließen. Wich ihnen aus.
Ihn trieb es, wie er auch widerstrebte und sich wand, nach dem Wald und der Gegend des Koboldes. Er grollte und lobte sich in einem Gedanken, daß er ihm ausgewichen war. Wie er eine Baumrinde berührte, fühlte er, wohin er gehörte; er bekam die Hand, als friere sie fest, kaum los von dem Stamm.
Er näherte sich nach Tagen erregt dem Ort. Von Schreck durchzuckt fand er die Hütte. Das niedrige Holzgestell, die groben braunen Latten. Es benahm ihm den Atem. Einen Augenblick stand sein Herz still. Er ließ sich nieder. War tief beglückt. Den ganzen Tag wartete er, schlief im Freien ein. Und noch ein Tag. Er ging und bewegte sich wie in einem festen Schlaf. Wie er im Morgengrauen aufwachte unter Gezwitscher, saß der braunzottige Kobold neben ihm, betrachtete ihn von der Seite, lachte ihn an. Ferdinand aufwallend blieb ernst, berührte ihn bittend. Der wies ihm den Buckel, schien ihn schleppen zu wollen. Ferdinand legte die Hände an das Wesen, genoß, im Innersten durchrieselt, die Berührung. Der quietschte, kratzte sich, gab wegkriechend Zeichen auf die Hütte, schnarrte, lallte. Die Hüttentür war offen. Der Mann ging sich duckend hinein. Eine Bande mußte erst jüngst dagewesen sein; es lag Brot und Schinken unter dem Tisch, auf den Bänken; sie waren übereilt abgezogen.
Ferdinand setzte sich hin, sah atmend dem Kobold zu, der alles durcheinander warf, zuletzt mit einem Stück Brot davonrannte.
Sommerliches Rauschen im Wald, die Sonnenlichter spielten.
Der Waldmensch öffnete gegen Abend, wie es glührot geworden war, die Tür. Ferdinand lag gestreckt auf der Bank. Das Geschöpf klopfte mit dem Finger gegen die nackten Fußsohlen des Mannes. Der richtete sich auf.
Ein breites flaches Messer lag unter dem Tisch neben der Bank. Das Geschöpf stieß mit den Zehen daran. Im Moment bückte es sich, faßte mit einem langen behaarten Arm herunter. Seine Augen glitzerten.
Rittlings schwang es sich vor den Mann auf die Bank, drückte sich fest an den erschauernden freudvoll blickenden, und senkte blitzschnell das Messer von hinten in seinen Rücken. Mehrmals. Sie hielten sich Auge in Auge. Ein leichtes Staunen kam in Ferdinands Ausdruck. Er erzitterte bis in die Fußspitzen, legte sich seitlich um.
Das Geschöpf rutschte von der Bank, blickte das Messer an, sauste hinaus, gab Stöße in den Grasboden, schleuderte das Messer von sich gegen die Hütte.
Nach zwei Tagen schlich es herein, aß. Faßte den Körper, der unter dem Tisch lag, an beiden Füßen, spannte sich wie ein Pferd vor, lief mit ihm hinaus, zerrte ihn über das Gras. Der Kobold war so stark, daß er den mageren Körper im Kreis um sich schwingen konnte. Er schnalzte kicherte freute sich daran.
Lief mit ihm über Gebüsch Äste. Es war Regenwetter. Die Tropfen klatschten. Ferdinand lag auf zwei sehr hohen Ästen. Das dünne kühle Wasser floß über die hellen Augen. Der Kobold hatte kleine Zweige zu sich heruntergezogen, er saß vom Laub gedeckt. Schaukelte den Körper auf den großen Ästen, knurrend stirnrunzelnd.
Unter die aufmarschierenden Heere der Kaiserlichen Sachsen Schweden Bayern gerieten von allen Seiten die losgelösten verzweifelten Volksteile. Viele gingen zu den Truppen über, von Lohn und Nahrung verlockt. Was ihnen störend in den Weg kam, zerklatschten die Heere.
Die Söldnermassen selbst brachen gegeneinander los, schlugen sich nieder, verfolgten sich, metzelten sich von neuem, Kaiserliche Sachsen Schweden Bayern. Im Westen hatten sich die Welschen gesammelt. Sie warteten in frischer Kraft auf ihr Signal, um sich hineinzuwerfen.
Ende
Werke von Alfred Döblin
Die drei Sprünge des Wang-lun
Chinesischer Roman
Achte Auflage
Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine
Roman
Vierte Auflage
Der schwarze Vorhang
Roman von den Worten und Zufällen
Dritte Auflage
Wallenstein
Roman
Zwei Bände
Dieser Roman ist ein Zeichen jenes Einfühlungsvermögens, das seit den Schlegeln der deutschen Literatur gegeben ward. Das ist kein papierner Hintergrund, bemalte Kulissen, das sind die wogenden Reisfelder, das ist der breite gelbe Strom, das sind die engen erbärmlichen Händlergassen, das Volk, das stiehlt, betrügt und betet; chinesische Märchen und Lieder beschreiben es uns. Gleicher Ebenen Hauch, tausendjährige Kultur umweht uns in diesem Buch, und manche Seite könnte vielleicht ebensogut in einem chinesischen Werke selbst stehen.
(Rheinisch-Westfälische Zeitung, Essen)
Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine
Kein Zweifel, dieser Roman ist eine Leistung. Mit einem künstlerischen Eifer, den man fast Ingrimm nennen möchte, werden hier Menschen aufeinandergehetzt, wird ein Leben dargestellt, das nur in Arbeit, Kampf, Hetzjagd, fahrig an sich gerafftem Genuß, Mißtrauen, Unrast, Feindseligkeit besteht. Nach außen hin, da doch irgendeine Form gefunden werden muß, gibt sich dies als eine Konkurrenz zwischen zwei Berliner Fabrikanten, einem des älteren Systems und seinem Gegner, der ihn mit der Dampfturbine schlägt, ihn übrigens auch zu Diebstahl, Fälschung von Papieren und ähnlichen Existenznotwendigkeiten treibt. Wie Döblin dieses Buch, mag ein Gelehrter sein Werk schreiben, auch nur mit dem Verstand, wohl mit innerer Teilnahme, aber ohne Liebe, ohne Phantasie. Und trotzdem ermangelt es dieser natürlich nicht, ebensowenig fehlt es an Geist und Erfindung.
(Die Zeit, Wien)
Der schwarze Vorhang
In diesem Frühwerk zeigt sich schon die ganze Kraft und Eigenart Döblins. Er gestaltet auch hier schon ins Großzügige hinein. Zwar handelt es sich in der Hauptsache um Empfindungen und Gefühle. Aber er formt sie schon in mächtigen Zügen. Er hebt sie über das kleine, zerpflückende Alltägliche hinaus und gibt ihnen Gewicht, Bedeutung und fast Ewigkeitsinhalt. Allerdings stellt das Werk auch Anforderungen an den Leser. Es fordert Geduld und Hingabe. Aber am Ende lohnt sich dies alles. Wenn auch wieder der aufmerkende Leser nicht mit allen Schlüssen Döblins einverstanden sein wird.
(Die Post, Berlin)
Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig
Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Druckfehler wurden, zum Teil unter Hinzuziehung späterer Ausgaben, korrigiert wie hier aufgeführt (vorher/nachher):
End of Project Gutenberg's Wallenstein. II. (of 2), by Alfred Döblin
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK WALLENSTEIN. II. (OF 2) ***
***** This file should be named 43932-h.htm or 43932-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/3/9/3/43932/
Produced by Jens Sadowski
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation information page at www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at 809
North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email
contact links and up to date contact information can be found at the
Foundation's web site and official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For forty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.